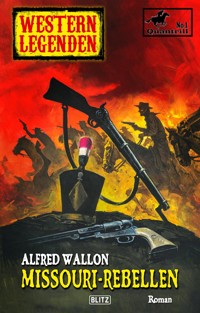
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Western Legenden (Historische Wildwest-Romane)
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
William C. Quantrill, die Geißel des Südens, schrieb vor und während des Sezessionskrieges (1861–1865) blutige Geschichte. Mit seinen legendären Raiders versetzte er ganze Landstriche in Angst und Schrecken. Viele Jahre terrorisierte er das Grenzland von Kansas.Wer war Quantrill? Ein Teufel in Menschengestalt oder nur eine tragische Figur, geprägt von den Ereignissen einer vergangenen Zeit? Welche Motive bestimmten sein grausames Vorgehen in Lawrence/Kansas am frühen Morgen des 21. August 1863, als er eine komplette Stadt niederbrennen ließ? Noch bis heute ranken sich Legenden um Quantrill.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 261
Ähnliche
Western Legenden
In dieser Reihe bisher erschienen
9001 Werner J. Egli Delgado, der Apache
9002 Alfred Wallon Keine Chance für Chato
9003 Mark L. Wood Die Gefangene der Apachen
9004 Werner J. Egli Wie Wölfe aus den Bergen
9005 Dietmar Kuegler Tombstone
9006 Werner J. Egli Der Pfad zum Sonnenaufgang
9007 Werner J. Egli Die Fährte zwischen Leben und Tod
9008 Werner J. Egli La Vengadora, die Rächerin
9009 Dietmar Kuegler Die Vigilanten von Montana
9010 Thomas Ostwald Blutiges Kansas
9011 R. S. Stone Der Marshal von Cow Springs
9012 Dietmar Kuegler Kriegstrommeln am Mohawk
9013 Andreas Zwengel Die spanische Expedition
9014 Andreas Zwengel Pakt der Rivalen
9015 Andreas Zwengel Schlechte Verlierer
9016 R. S. Stone Aufbruch der Verlorenen
9017 Dietmar Kuegler Der letzte Rebell
9018 R. S. Stone Walkers Rückkehr
9019 Leslie West Das Königreich im Michigansee
9020 R. S. Stone Die Hand am Colt
9021 Dietmar Kuegler San Pedro River
9022 Alex Mann Nur der Fluss war zwischen ihnen
9023 Dietmar Kuegler Alamo - Der Kampf um Texas
9024 Alfred Wallon Das Goliad-Massaker
9025 R. S. Stone Blutiger Winter
9026 R. S. Stone Der Damm von Baxter Ridge
9027 Alex Mann Dreitausend Rinder
9028 R. S. Stone Schwarzes Gold
9029 R. S. Stone Schmutziger Job
9030 Peter Dubina Bronco Canyon
9031 Alfred Wallon Butch Cassidy wird gejagt
9032 Alex Mann Die verlorene Patrouille
9033 Anton Serkalow Blaine Williams - Das Gesetz der Rache
9034 Alfred Wallon Kampf am Schienenstrang
9035 Alex Mann Mexico Marshal
9036 Alex Mann Der Rodeochampion
9037 R. S. Stone Vierzig Tage
9038 Alex Mann Die gejagten Zwei
9039 Peter Dubina Teufel der weißen Berge
9040 Peter Dubina Brennende Lager
9041 Peter Dubina Kampf bis zur letzten Patrone
9042 Dietmar Kuegler Der Scout und der General
9043 Alfred Wallon Der El-Paso-Salzkrieg
9044 Dietmar Kuegler Ein freier Mann
9045 Alex Mann Ein aufrechter Mann
9046 Peter Dubina Gefährliche Fracht
9047 Alex Mann Kalte Fährten
9048 Leslie West Ein Eden für Männer
9049 Alfred Wallon Tod in Montana
9050 Alfred Wallon Das Ende der Fährte
9051 Dietmar Kuegler Der sprechende Draht
9052 U. H. Wilken Blutige Rache
9053 Alex Mann Die fünfte Kugel
9054 Peter Dubina Racheschwur
9055 Craig Dawson Dunlay, der Menschenjäger
9056 U. H. Wilken Bete, Amigo!
9057 Alfred Wallon Missouri-Rebellen
9058 Alfred Wallon Terror der Gesetzlosen
9059 Dietmar Kuegler Kiowa Canyon
Alfred Wallon
Missouri-Rebellen
QUANTRILLBand 1
Als Taschenbuch gehört dieser Roman zu unseren exklusiven Sammler-Editionen und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt.Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.© 2023 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Jörg KaegelmannTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerLogo: Mario HeyerSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-678-1
Erstes Buch Die blutigen Jahre
Dunkle Regenwolken zeichneten sich am nächtlichen Himmel von Kansas ab, als sich der kleine Reitertrupp von Osten her der kleinen Farm näherte. Wind kam auf und zerrte an den Mänteln der Reiter, die sie zum Schutz gegen die jetzt einsetzenden Regentropfen trugen.
Auf ein Zeichen des Anführers teilte sich der Reitertrupp. Vier Männer ritten von hinten an die Farm heran, stiegen dort von den Pferden und schlichen unbemerkt an das Haus heran, das noch im Dunkeln lag. Keiner der Bewohner schien bis jetzt etwas bemerkt zu haben. Erst als die restlichen Männer direkt auf das Haus zuritten, zeichnete sich ein schwacher Lichtschein hinter einem der schmalen Fenster ab. Das hinderte jedoch keinen der Reiter daran, ihr ursprüngliches Vorhaben in die Tat umzusetzen. Sie stiegen von den Pferden, zogen ihre Waffen und näherten sich mit schweren Schritten der Tür des kleinen Farmhauses, während der Regen an Heftigkeit zunahm.
Sekunden später schlug eine Faust dumpf gegen die Eichentür.
„Collins“, rief eine heisere Stimme. „Frank Collins, komm heraus!“
Zuerst rührte sich überhaupt nichts auf der anderen Seite der Tür. Endlose Augenblicke verstrichen, bis schließlich ein ängstliches Stottern verhalten zu den Männern herausdrang.
„Was wollt ihr? Lasst mich in Ruhe.“
Einer der Männer vor der Tür spuckte verächtlich aus und grinste seinen Gefährten zu, bevor er ein zweites Mal an die Tür klopfte. Diesmal allerdings bedeutend heftiger.
„Komm endlich heraus, Frank Collins“, erklang nun die drohende Stimme. „Oder wir zünden dir das Dach über dem Kopf an, du verdammter Sklavenhalter!“
Undeutliche Stimmen drangen an die Ohren der Männer, die die Farm umkreist hatten und nur darauf lauerten, dass einer der Bewohner etwas zu unternehmen versuchte. Es waren Stimmen, die sehr zornig klangen.
„Ich komme ja schon!“, rief schließlich Frank Collins. „Aber was geschieht dann mit meiner Frau?“
„Nichts, wenn du vernünftig bist, Collins“, bekam er zur Antwort. „Nun beeile dich gefälligst, sonst brennen wir deine armselige Hütte doch noch ...“
Noch bevor der Anführer des Reitertrupps diese Worte beendet hatte, zerbrach plötzlich eine Fensterscheibe auf der anderen Seite des Farmhauses. Erregte Rufe waren zu hören, gefolgt von einem Schuss, der die Stille der Nacht durchbrach. Ein leises Röcheln, ein dumpfer Fall, dann herrschte wieder grausame Stille. Drinnen im Haus weinte jemand, während sich die Tür unendlich langsam öffnete und ein eingeschüchterter Frank Collins ins Freie trat.
Die Augen des Anführers hefteten sich auf den Farmer, während sich von der anderen Seite des Hauses hastige Schritte näherten. Einer der Männer blickte wütend drein, als er sich an den Anführer wandte.
„Einer wollte fliehen, Saul“, stieß er aufgeregt hervor. „Zum Glück haben wir ihn noch erwischen können. Er ist tot.“
„Eine Kugel ist das einzig Richtige für Sklavenhalter und solche, die mit diesen Bastarden paktieren“, sagte Saul Perkins, der Anführer, und spuckte dem verängstigten Frank Collins vor die Füße. „Les“, wandte er sich dann an seinen Gefährten. „Wer ist dieser andere Bursche? Hast du ihn erkennen können?“
„Ich glaube, es ist einer von dieser verfluchten Quantrill-Sippe“, erwiderte der Angesprochene, während der Regen auf dem aufgeweichten Boden kleine Pfützen bildete. „Luke Quantrill.“
„Wieder einer weniger von diesen Sklavenhaltern“, sagte Perkins und richtete seinen Blick dabei besonders lange auf Frank Collins, der sich nicht zu rühren wagte. Er fürchtete um sein Leben, und auch seine Frau, die jetzt zu ihm geeilt kam und sich neben ihn stellte, ahnte, dass in dieser Regennacht der Tod ein zweites Mal seine knöcherne Hand ausstrecken würde. „Man sollte euch alle standrechtlich erschießen oder aufhängen.“
„Um Gottes willen“, rief jetzt Betty Collins, die angesichts dieser massiven Drohung nicht länger schweigen konnte. „Was in aller Welt hat mein Mann denn nur verbrochen? Er hat kein Verbrechen begangen!“
„Aber er ist ein Freund dieser Sklavenhalter und paktiert mit ihnen“, schnitt Perkins der Farmersfrau das Wort ab. „Wir wissen alle, dass er Freunde unter diesen Herrenmenschen hat, und dafür gibt es nur eine Antwort, nämlich den Strick.“
Frank Collins’ Augen weiteten sich ungläubig, als Perkins einem seiner Männer ein Zeichen gab. Dieser nickte nur, verließ den schützenden Vorbau und ging in den strömenden Regen hinüber zu seinem Pferd. Er holte ein starkes Seil herbei, um daraus eine Henkersschlinge zu formen.
„Das ist ... das ist doch Mord“, keuchte der Farmer. „Ihr könnt doch nicht einfach ...“
„Und ob wir das können“, fiel ihm Perkins ins Wort. „Du glaubst wohl, dass sich seit John Browns Märtyrertod viel geändert hat, wie? Nein, Collins, für uns gilt nach wie vor das ungeschriebene Gesetz, dass Sklavenhalter Verbrecher sind, und um die zu bestrafen, sind wir hier.“ Er sah zwei seiner Männer an. „Packt diesen Verbrecher. Er soll endlich seine verdiente Strafe bekommen.“
Die beiden Männer in den langen Mänteln zögerten keine weitere Sekunde mehr. Sie gingen auf Collins zu, packten ihn an beiden Armen und hielten ihn fest umklammert wie ein Schraubstock.
„Nein!“, schrie Betty Collins und versuchte, die Männer an der Ausübung ihres schrecklichen Vorhabens zu hindern. „Ihr Mörder!“
Auch Collins wehrte sich heftig, kam aber gegen die Bärenkräfte von Perkins’ Männern nicht an. Er wurde hinaus in den Regen gezerrt, während einer der Männer Collins’ Frau festhielt. Regenschleier peitschten in die Gesichter der Nachtreiter, aber das nahm kaum einer von ihnen wahr. Sie wollten Frank Collins seiner, wie sie glaubten, gerechten Strafe zuführen. Da war ihnen jedes Mittel recht.
Einer von Perkins’ Männern, derjenige mit dem Seil, war schon dabei, die notwendigen Schritte in die Wege zu leiten. Ungefähr zwanzig Yards vom Farmhaus entfernt befand sich eine Sykomore-Eiche, die ihre starken Äste in den regenverhangenen Nachthimmel emporstreckte. Über einen dieser Äste warf der Mann nun das Seil, bis es vom Wind getrieben mit der Schlinge hin und her baumelte.
Collins bekam einige Schläge in die Nieren, als er nicht weiter vorangehen wollte. Dann streifte ihm jemand den rauen Hanfstrick über den Hals und zog die Schlinge so weit zu, bis sie auch richtig saß. Drüben beim Farmhaus erklang Betty Collins’ flehende Stimme, die die Männer darum bat, das Leben ihres Mannes zu verschonen. Aber Saul Perkins und die übrigen Abolitionisten kannten keine Gnade, wenn es darum ging, einen ihrer Ansicht nach Schuldigen abzuurteilen und zu hängen.
„Frank Collins, der Staat Kansas hat dich für schuldig befunden, Separatismus zu betreiben und Sklavenhalter bei ihrem wirklich menschenverachtenden Treiben zu unterstützen. Dafür gibt es nur eine Strafe, nämlich den Tod durch Hängen. Willst du noch ein Gebet sprechen, bevor du deinem Schöpfer gegenübertrittst?“
„Zur Hölle mit euch allen!“, schrie Frank Collins angesichts seiner Hilflosigkeit. „Ihr habt überhaupt nicht das Recht, ein Gericht abzuhalten, und erst recht nicht über mich, da ich mir doch nichts zuschulden kommen ließ. Betty, mein Gott, ich ...“
Sein Kopf in der Schlinge fuhr herum, und er versuchte, zu seiner Frau hinüberzusehen, so gut das der straffe Strick eben zuließ. Er erhaschte gerade noch einen letzten Blick, bevor Saul Perkins den Männern neben dem Farmer ein unauffälliges Zeichen gab. Zu zweit zogen sie Collins hoch, während dieser wie wild mit den Füßen um sich trat und verzweifelt nach Luft zu schnappen versuchte. Doch die Schlinge um seinen Hals zog sich unerbittlich und quälend lange enger. Er wurde langsam stranguliert, während seine verzerrten Züge eine dunkle Farbe annahmen.
Einer von Perkins’ Leuten hängte sich schließlich an die zappelnden Beine des Farmers, zog und riss daran, bis das Genick von Collins brach. Wie eine leblose Puppe baumelte der Farmer im Wind, während seine Frau aus Leibeskräften schrie. Sie konnte einfach nicht glauben, was gerade geschehen war.
„Betty Collins“, wandte sich nun Saul Perkins mit funkelnden Augen an die Frau des toten Farmers. „Du hast zwei Tage Zeit, um von hier zu verschwinden. Sonst wirst auch du gerichtet werden, gemäß den Gesetzen eines freien Staates Kansas. Hast du das verstanden?“
Die unglückliche Farmersfrau konnte nur stumm nicken, während ihr die Tränen über die Wangen liefen. Daraufhin wurde sie losgelassen und fiel zu Boden, während ihr der Wind weiter den Regen ins Gesicht peitschte. Perkins und seine Männer kümmerten sich nicht mehr um sie, sondern stiegen wieder in die Sättel ihrer Pferde.
Sie verschwanden so plötzlich im Dunkel der stürmischen Regennacht, wie sie aufgetaucht waren. Wie Racheengel aus einer anderen Welt, die gekommen waren, um sich ihre Opfer zu holen.
Betty Collins hob langsam den Kopf. Ein wilder Schmerz durchfuhr sie, als sie drüben an der Sykomore-Eiche die leblose Gestalt ihres Mannes am Strick hängen sah. Hinter dem Haus lag der junge Luke Quantrill, erschossen von den Männern, die glaubten, das Gesetz auf ihrer Seite zu haben.
Ein trockenes Schluchzen entrang sich ihrer Kehle, als sie sich mühsam erhob und mit schweren Schritten durch den vom Regen aufgeweichten Boden stapfte, hinüber zu der Eiche. Etwas zerbrach in der Farmersfrau, als sie in die verzerrte Grimasse des Gehenkten blickte und sah, wie hart er gestorben war. Sie spürte die feuchte Kälte in ihren Kleidern nicht, die jetzt allgegenwärtig war. Es regnete immer noch, während Betty Collins nun allein mit sich und ihrem Schmerz war.
*
Die ersten Strahlen der wärmenden Morgensonne tauchten aus der dichten Wolkendecke hervor und glitzerten in den feuchten Pfützen, die sich auf der unebenen Straße von Paola gebildet hatten. Es war noch früh am Morgen, und die meisten Bewohner der kleinen Stadt im südöstlichen Kansas begannen erst damit, ihren täglichen Gewohnheiten nachzugehen. Der General Store in der Nähe der Kirche war erst seit zehn Minuten geöffnet, aber Hugh Tatum, der grauhaarige Besitzer, war schon eifrig dabei, den Bürgersteig vor seinem Laden wie ein Besessener zu fegen, als erwarte er jeden Augenblick einen förmlichen Ansturm sämtlicher Stadtbewohner.
Drüben in der Schmiede war das dumpfe Hämmern auf einem Amboss zu vernehmen. Weiter entfernt hinter dem Mietstall erklang das Kläffen eines Hundes und riss Jeffrey Towns, den Eigentümer, unsanft aus seinem Schlaf, während der alte Neil Simpson wie jeden Morgen seine Haustür hinter sich zuschlug und es sich in dem Stuhl auf der Veranda gemütlich machte. Simpson ging schon auf die sechzig zu und genoss es, die erwachende Stadt jeden Morgen zu beobachten und zu sehen, wie sich die Straßen langsam mit Leben füllten. Er blickte hinauf zum Himmel und lächelte gedankenverloren, als er feststellte, dass heute ein schöner Tag werden würde. Nach dem heftigen Regenguss der vergangenen Nacht war die Sonne gerade im Begriff, die letzten Wolken zu vertreiben.
Der alte Simpson entdeckte drüben bei der Kirche den blonden Davy Pearce zusammen mit dem Jungen von Barry Hopkins. Die beiden Lausbuben spielten wahrscheinlich wieder einmal die Belagerung von Alamo und lieferten sich einander ein wildes Gefecht, in einer solch unbekümmerten Art und Weise, wie es nur Kinder tun können, die noch nichts von den Problemen der Erwachsenen wissen.
Sein Blick schweifte ab, als er drüben von der anderen Straßenseite Luther Briggs auf sich zukommen sah. Briggs war ein alter weißhaariger Veteran, der schon im Mexikanischen Krieg gekämpft hatte und sich dort eine Verletzung zugezogen hatte, die ihn seitdem hinken ließ. Es gehörte zum morgendlichen Ritual, dass sich die beiden alten Männer vor Simpsons Veranda trafen und über die vergangenen Zeiten plauderten. Wie auch heute.
„Verflixte Bande!“, schimpfte Luther Briggs, als die beiden Lausbuben dicht an ihm vorbeirannten und beinahe mit ihm zusammengestoßen wären. Er sah ihnen kopfschüttelnd hinterher, bevor er Simpson zunickte. „Kein Respekt vor dem Alter haben diese Jungs.“
„Lass sie doch, Luther“, winkte Neil Simpson ab und nickte Briggs zu, es sich auf dem zweiten Stuhl gemütlich zu machen. „Sollen sie ruhig herumtoben, der Ernst des Lebens kommt schon noch frühzeitig genug auf sie zu.“
„Da magst du recht haben“, erwiderte der Kriegsveteran, „In diesen elenden Zeiten kann man nie wissen, was morgen sein wird. Hast du auch schon gehört, dass in der Nähe der Grenze einige Farmen in Flammen aufgegangen sein sollen?“
„Habe ich“, bestätigte ihm Simpson das. „Luther, ich sage dir, irgendwann explodiert dieser ganze Hexenkessel. Manchmal frage ich mich, ob es nicht doch besser wäre, wenn ich meine Sachen zusammenpacke und von hier verschwinde. Halte mich nicht für verrückt, aber ich mache mir doch ziemliche Sorgen um meine alte Haut.“
„Glaubst du, ich vielleicht nicht?“, entgegnete Briggs und schaute Simpson dabei nachdenklich an. „Diese verdammten Politiker sollten so schnell wie möglich eine endgültige Lösung finden, und zwar eine Lösung, die die Gemüter dieser Hitzköpfe beruhigt. Mit John Browns Tod hat es nicht aufgehört. Es ist nur noch schlimmer geworden, nachdem sie ihn nach dem Überfall in Harpers Ferry geschnappt und aufgehängt haben.“
„Obwohl er eigentlich gar kein schlechter Bursche war“, sinnierte Simpson. „Schließlich hat er sich dafür eingesetzt, dass das Sklavenproblem ...“
„Aber doch nicht mit Gewalt“, unterbrach ihn Briggs, weil Simpson damit eine wunde Stelle des Kriegsveteranen getroffen hatte. „Dieser alte Hitzkopf hat doch nur die Stimmung zum Kochen gebracht. Ein Mörder und Plünderer war er, und dazu stehe ich auch jetzt noch.“
„Vielleicht schafft es dieser Lane, die Gemüter wieder zu beruhigen“, gab Simpson zu bedenken. „Obwohl es da bestimmt einige Burschen gibt, die Brown nacheifern werden.“
„Was die Lage in dieser Gegend ziemlich zuspitzen dürfte“, fügte Briggs hinzu. „So friedlich, wie es heute Morgen ist, wird es bestimmt nicht mehr lange bleiben und ...“
Seine Worte brachen ab, als er am anderen Ende der Mainstreet einen Pritschenwagen erkannte, dessen Pferde wie wahnsinnig angetrieben wurden. Ungläubig blickte Briggs auf die Frau auf dem Bock des Pritschenwagens, die die Peitsche schwang und den Pferden alles abverlangte.
„Das ist doch Betty Collins!“, entfuhr es dem alten Simpson, der Briggs’ Blicken gefolgt war und nun auch diesen Wagen sah. „Verdammt, die hat es aber ganz schön eilig.“
„Da muss was passiert sein, Neil“, folgerte Briggs und hielt es jetzt nicht mehr länger auf seinem Stuhl auf der schattigen Veranda aus. „Schau doch, jetzt reißt sie wie verrückt an den Zügeln.“
„Yeah, sie hat den Wagen endlich zum Stehen gebracht, genau vor Quantrills Haus.“
„Komm schon“, forderte Briggs seinen Freund auf. „Das müssen wir uns ansehen. Wenn du mich fragst, ich habe auf einmal ein verdammt ungutes Gefühl in der Magengegend.“
*
Betty Collins war schweißüberströmt, als sie das Pferdegespann endlich zum Stehen brachte. Sie war sich der zahlreichen Blicke etlicher Stadtbewohner bewusst, die natürlich gemerkt hatten, wie eilig es die Farmersfrau hatte. Aber das war ihr gleichgültig, denn in diesen schrecklichen Stunden war sie über sich selbst hinausgewachsen.
Nach dem Abflauen des Regens hatte sie die schwere Aufgabe übernommen, ihren toten Mann unter die Erde zu bringen, den ermordeten Luke Quantrill in eine Decke zu hüllen und unter Aufbietung all ihrer Kräfte auf den Wagen zu laden. William Clarke Quantrill, Lukes Bruder, musste unbedingt schnellstens erfahren, was geschehen war.
„Mister Quantrill“, rief sie dann so laut, dass man es in dem Haus eigentlich hören musste. „Mister Quantrill, bitte kommen Sie.“
Wenige Sekunden vergingen, bis sich die Tür öffnete und ein Mann ins Freie trat. Er war nicht groß, auch nicht besonders muskulös und besaß eine bleiche Gesichtsfarbe. Seine Augen flackerten unruhig, so, als ob es ihm nicht recht sei, dass jemand nach ihm rief. Lukes älterer Bruder war ein notorischer Einzelgänger, der auch jetzt noch im Grunde genommen ein Fremder in Paola war. Auch wenn die Quantrills hier schon fast ein Jahr lebten und William versucht hatte, die Stelle eines Lehrers auszuüben. Er war daran gescheitert, wie an so vielen anderen Dingen auch.
„Mister Quantrill!“, rief ihm Betty Collins jetzt zu, als sie seine schmale Gestalt in der Tür stehen sah. „Es ist etwas Furchtbares passiert. Luke ist ...“
In diesen Sekunden fehlten ihr die Worte. Ihr wurde wieder schmerzhaft bewusst, wie viel in diesen schrecklichen Stunden zwischen Mitternacht und Morgengrauen geschehen war.
Der schwarzhaarige William Clarke Quantrill schwieg noch immer. Er blickte auf die Ladefläche des Wagens. In seinem Gesicht arbeitete es, als er mit schweren Schritten an Betty Collins vorbeiging, die dunklen Augen auf die alte Decke geheftet, unter der sich etwas verbarg, was er wahrscheinlich schon ahnte.
„Sie kamen spät am Abend“, versuchte Betty Collins jetzt dem stoisch wirkenden Quantrill klarzumachen, was geschehen war. „Zehn Männer. Sie zwangen Frank, herauszukommen; Luke ahnte Unheil und wollte fliehen. Da haben sie ihn einfach erschossen.“
William Quantrill registrierte überhaupt nicht die Tatsache, dass in diesem Moment zahlreiche Menschen um den Wagen herumstanden und nun auch sahen, dass er vorsichtig einen Zipfel der Decke hochhob. Er blickte in das bleiche Gesicht seines Bruders, dessen Hemd dunkelrot vor Blut war.
„Frank haben sie einfach aufgehängt, wie einen Verbrecher!“, rief jetzt Betty Collins und blickte Hilfe suchend in die Runde. „Dabei weiß doch jeder, dass sich Frank überhaupt nichts zuschulden hat kommen lassen. Umgebracht haben sie ihn. Kaltblütig!“
Ihre Worte brachen ab, ein plötzliches Schluchzen erschütterte ihren ganzen Körper. Quantrill dagegen blieb immer noch ruhig und gefasst, introvertiert, wie ihn hier jeder in Paola kannte. Nur seine dunklen Augen wurden jetzt etwas unruhiger. In ihnen leuchtete ein Feuer auf, das mit jeder verstreichenden Sekunde größer wurde.
„Holt den Coroner!“, rief jemand aus der Menge.
„Wo zum Teufel steckt denn der Sheriff?“, beklagte sich ein anderer.
Unruhe erfasste die Umstehenden, als ihnen bewusst wurde, was für schreckliche Dinge draußen auf der Collins-Farm geschehen waren. Quantrills Blicke hefteten sich jetzt auf Betty Collins. Durchdringend klang seine Stimme, als er die folgende Frage an sie richtete.
„Wer war es?“
Diese Frage kam so voller Hass aus seinem Mund, dass die Farmersfrau unwillkürlich zusammenzuckte und einige Sekunden brauchte, bis sie sich die passenden Worte zurechtlegen konnte.
„Abolitionisten, Mister Quantrill“, stieß sie dann hervor. „Jedenfalls gaben sie vor, welche zu sein. Sie beschuldigten Frank, den Süden zu unterstützen, und hängten ihn deswegen auf. Mein Gott, was für ein Wahnsinn ist das alles.“
Was sie sonst noch zu sagen hatte, registrierte William Clarke Quantrill gar nicht mehr. Er hatte erfahren, was er wissen wollte, und sein Entschluss stand fest. Wortlos wandte er sich ab und ging hinein in das Haus. Wenige Sekunden später kam er wieder heraus, um seine schmalen Hüften war ein schwerer Revolvergurt geschnallt. Erregtes Gemurmel war in der Menge zu vernehmen, als Quantrill einem der Umstehenden einige Geldscheine in die Hand drückte.
„Das müsste ausreichen, um ihn anständig unter die Erde zu bringen“, sagte er, ohne den Mann dabei direkt anzusehen. Er achtete auch nicht mehr darauf, dass der alte Luther Briggs ihm etwas hinterherrief. Quantrill war mit seinen Gedanken bereits ganz woanders.
Er ließ die Menge hinter sich, ging hinüber zum Mietstall und holte sich sein Pferd. Wenige Minuten später saß er im Sattel und ritt unter den Augen der staunenden Menge davon, direkt in die aufgehende Sonne hinein, und schon bald waren die Hufschläge des Pferdes nicht mehr zu vernehmen.
„Gütiger Himmel!“, stieß Neil Simpson ganz aufgeregt hervor, als er genau wie auch die anderen dem davonpreschenden Reiter hinterhersah. „Luther, hast du den Ausdruck in Quantrills Augen bemerkt? Ich sage dir, die Kerle, die seinen Bruder umgebracht haben, die können sich jetzt warm anziehen.“
„Da magst du recht haben“, pflichtete ihm der weißhaarige Kriegsveteran bei. „So habe ich Quantrill ja noch nie erlebt. Von dem werden wir ganz bestimmt noch hören.“
Luther Briggs konnte noch nicht ahnen, wie wahr seine Vermutung eines Tages werden würde. Sowohl er selbst, als auch Simpson und die restlichen Bewohner der Stadt würden noch in diesem Jahr erfahren, welchen traurigen Ruhm William Clarke Quantrill erlangte. Aber nach Paola kam er nie wieder zurück.
*
Die Sonne hatte ihren höchsten Stand noch lange nicht erreicht, als Quantrill sein Pferd auf der Anhöhe der Collins-Farm zügelte. Für einen winzigen Moment ließ er seine Blicke über die verlassene Farm schweifen, bevor er dem Tier die Zügel freigab. Erst dann ritt er hinunter und erkannte unmittelbar neben dem Farmhaus das frische Grab, wo Betty Collins ihren Mann beerdigt hatte. Genau dort stieg er ab, schaute sich gründlich um und untersuchte dann den Boden nach Spuren.
Quantrill hatte Glück. Der vom Regen in der Nacht aufgeweichte Boden war mittlerweile getrocknet und ließ die Spuren, die die Reiter in der feuchten Erde hinterlassen hatten, sehr gut erkennen. Der schwarzhaarige schlanke Mann brauchte nicht lange, um herauszufinden, dass die Fährte nach Nordosten führte. Deshalb zögerte er keinen Augenblick mehr, sondern stieg sofort wieder in den Sattel des Pferdes, gab dem Tier die Zügel frei und ritt in diese Richtung davon. Seine Gedanken waren dunkel vor Hass auf die Männer, die hier gewütet hatten wie die Tiere.
Er wusste nicht, wie lange er geritten war, als er bemerkte, dass die Fährte in eine unwegsame Hügelregion führte. Es war heiß, aber Quantrill ignorierte die Hitze, die ihm den Schweiß auf die Stirn trieb. Er überlegte fieberhaft, wie er sich am besten diesen verdammten Abolitionisten nähern konnte, ohne dass sie ihn bemerkten.
Er wusste, im Grunde genommen rechneten diese Hundesöhne nicht mit einer Verfolgung. Das würde ihm helfen, sich hoffentlich ungesehen in den Rücken der Feinde zu schleichen, um mit ihnen abzurechnen. Unbändiger Hass trieb den ehemaligen Lehrer voran, der bisher in Kansas an allem gescheitert war, was er versucht hatte.
Vorsichtig führte er sein Pferd am Zügel mit sich, stets darauf bedacht, sich leise zu verhalten, und irgendwie hatte er Glück. Denn schon nach einer halben Stunde hörte er Stimmen bei einigen Sandsteinfelsen, Stimmen, die ihn alarmierten und zusammenzucken ließen. Sofort band er sein Pferd an einen Strauch und schlich sich dann ganz vorsichtig näher an die Stelle heran, von wo er die Stimmen gehört hatte.
Eine Viertelstunde später gelang es ihm dann, sich so nahe heranzuschleichen, dass er erkennen konnte, wem die Stimmen gehörten. Es waren Männer, die in der Abgeschiedenheit dieser Wildnis ihr Camp aufgeschlagen hatten, Männer in langen Staubmänteln und mit stoppelbärtigen Gesichtern. Quantrill hörte ihr raues Gelächter und ballte die Fäuste vor Zorn, weil er sich förmlich zwingen musste, nicht sofort das Feuer auf diese verdammten Mörder zu eröffnen. Denn er hatte einige Gesprächsfetzen verstanden und wusste demzufolge, dass diese Kerle zu den Mördern seines Bruders gehörten.
Offensichtlich hatte sich der Reitertrupp getrennt, denn es waren nur noch fünf Männer, die sich in diesem verborgenen Camp aufhielten. Umso besser für Quantrill, denn gegen eine Übermacht von zehn Männern wäre sein Vorhaben ziemlich aussichtslos gewesen. Jetzt aber rechnete er sich wirklich eine gute Chance aus. Denn er würde in dem Augenblick zuschlagen, wenn keiner der Männer mit einem Angriff rechnete.
Quantrill wartete jetzt kaltblütig ab, während die Mittagssonne heiß auf seinen Rücken brannte. Geduldig registrierte er, dass zwei der Männer sogar ihre Waffen abgelegt hatten, weil sie sich so sicher fühlten. Aber nicht mehr lange!
Er zog seinen Revolver und zielte dann auf den Rücken des Mannes, der gerade ein Feuer entzünden wollte. Quantrill drückte ab. Der Schuss durchbrach die Stille in der Abgeschiedenheit der Felsenlandschaft, traf den Mann in den Rücken und stieß ihn nach vorn.
Quantrill wartete nicht ab, bis der Mann zu Boden fiel, sondern nutzte den Moment der Überraschung. Er hatte bereits den zweiten Mann im Visier und traf ihn voll, noch ehe dieser eine Chance hatte, nach seiner Waffe zu greifen. Den dritten erwischte Quantrill mit einer Kugel in den Kopf, bevor dieser einen Sprung zur Seite machen konnte.
Entsetzensschreie drangen zu ihm empor, aber das registrierte Quantrill nur am Rande. Sein Augenmerk galt den restlichen zwei Mördern, die dieser plötzliche hinterhältige Überfall so überrascht hatte, dass sie viel zu spät reagierten.
Quantrill spürte das hässliche Pfeifen einer Kugel, die gefährlich nahe an ihm vorbeiflog. Aber einen genaueren Schuss konnte sein Gegner nicht mehr anbringen. Quantrill ließ ihm keine zweite Chance und traf den Mann in den Magen. Der Mann wurde wie von einer unsichtbaren Faust zur Seite geschleudert, während die Waffe seinen kraftlosen Fingern entglitt. Als er zu Boden fiel, war er bereits tot.
Jetzt war nur noch einer übrig: Ein panikerfüllter Gegner, der das Schlimmste befürchtete. Quantrill dagegen blieb jetzt genauso eiskalt wie am Anfang. Er wusste, dass er auch in dieser angespannten Situation der Sieger bleiben würde.
Geduldig wartete er ab, bis nur wenige Sekunden später seine Chance kam. Den Augenblick, den sein Feind zum Laden benötigte, nutzte Quantrill, um seine bisherige Position zu wechseln und zu versuchen, seitlich näher zu kommen, ohne dass der andere etwas davon bemerkte.
Irgendwie hatte Quantrill das Glück auf seiner Seite, er registrierte mit Genugtuung, dass sein Gegner den Stellungswechsel nicht bemerkt hatte, denn er gab weiterhin einen Schuss in die Richtung ab, wo sich Quantrill noch vor wenigen Augenblicken befunden hatte.
Geduldig wartete er ab, bis er den richtigen Moment für gekommen hielt, um sich weiter heranzuschleichen, so nahe, dass er den Mann genau im Visier hatte. Dann hob er die Hand, zielte kurz und drückte ab. Sicherlich hätte Quantrill den Gegner genau zwischen die Schulterblätter getroffen, doch in dieser Sekunde bewegte sich der Kerl, sodass ihn Quantrills Kugel nur in der rechten Schulter erwischte und nach vorn schleuderte.
Der Mann schrie laut auf, während Quantrill aus seiner Deckung emporhechtete, zu dem Getroffenen lief und erbarmungslos die Waffe auf ihn richtete, bevor dieser die Finger nach dem Revolver ein weiteres Mal ausstrecken konnte.
Das Gesicht des jungen Mannes war kreidebleich, als er in Quantrills mitleidlose Augen blickte. Er zitterte vor Angst und Schmerzen, als er in den Lauf der todbringenden Waffe schaute.
„Bitte ...“, stammelte er ganz ängstlich. „Bitte, Mister, ich ...“
In der Gewissheit eines schrecklichen, kurz bevorstehenden Todes verlor er die Kontrolle über seinen Körper. Quantrill rümpfte angewidert die Nase, als er es roch, und spuckte verächtlich aus.
„Verdammter Bastard!“, knurrte er und stieß dem jungen Burschen den Lauf seiner Waffe ins Gesicht. „Ich sollte dich über den Haufen schießen wie einen Hund. Aber ich glaube, eine Kugel ist viel zu schade für einen elenden Feigling wie dich.“
Quälende Sekunden der Furcht vergingen für den Verletzten, bis Quantrill schließlich den Lauf der Waffe sinken ließ und ihn aus kalten Augen ansah.
„Steh auf und verschwinde von hier, bevor ich es mir noch anders überlege“, sagte er zu ihm. „Und erzähle deinen Abolitionistenfreunden, dass William Clarke Quantrill noch mit ihnen allen abrechnen wird. Hast du das kapiert?“
„Ja“, nickte der Verletzte heftig und bemühte sich, aufzustehen. Das gelang ihm aber nicht gleich beim ersten Mal. Unter Schmerzen schaffte er es dann doch noch. Stets die Augen auf den Lauf der Waffe des Mannes mit den kalten Augen gerichtet, wankte er hinüber zu den Pferden und zog sich mühsam in den Sattel. Immer noch darauf gefasst, dass er vielleicht doch noch von hinten erschossen wurde, genauso wie seine Gefährten.
„Vergiss den Namen nicht!“, rief ihm der unheimliche Mann hinterher, der in diesem einsamen Camp so schrecklich gewütet hatte. „Der Name ist Quantrill. William Clarke Quantrill!“
Der Mann wich Quantrills Blicken aus, er drückte dem Pferd die Hacken in die Weichen und verließ so schnell wie möglich den Schauplatz des Schreckens.
Er ritt, als sei er dem Teufel persönlich begegnet. Vielleicht hatte er mit dieser Vermutung noch nicht einmal so unrecht.
Quantrill schaute dem davonpreschenden Reiter hinterher, bis er zu einem winzigen Punkt am fernen Horizont wurde. Erst dann widmete er seine Aufmerksamkeit den erschossenen Abolitionisten. Er beugte sich über die Leichen, durchsuchte sie gründlich und brachte dabei etwas Geld und eine Taschenuhr zutage. Ohne mit der Wimper zu zucken, nahm er diese Sachen an sich und verstaute sie in seiner Jackentasche. Erst dann wandte er sich ab, ging hinüber zu den Pferden der Getöteten, die noch immer ein wenig nervös waren. Es waren gute und ausdauernde Tiere, wie Quantrill nach kurzem Mustern feststellte. Er würde sie sicherlich zu einem guten Preis verkaufen können.
Dann stieg er in den Sattel seines Pferdes, nachdem er die Zügel der übrigen Tiere zusammengebunden hatte. Mit seiner Beute verschwand er in der einsamen Wildnis, während die Sonne sich allmählich gen Westen neigte. Seine Spur verwischte der aufkommende Wind.
*
In den folgenden Monaten verliert sich die Spur des Mannes, der den Abolitionisten Rache geschworen hat. Es liegen auch keinerlei historische Quellen darüber vor, was Quantrill in dieser Zeit unternommen hat und wovon er lebte. Als sicher gilt es jedoch, dass er schon im Spätsommer Kansas endgültig den Rücken kehrte und nach Missouri ging. Wahrscheinlich glaubte er, in Missouri sicher vor eventuellen Verfolgern zu sein, die ihm diese Morde anlasteten. Mit dieser Vermutung lag er richtig.
Quantrill war fest entschlossen, mit den verhassten Abolitionisten auf seine Weise abzurechnen, auch wenn er zu dieser Stunde vielleicht noch nicht so recht wusste, wie er diese Abrechnung am besten verwirklichen konnte. Doch im frühen Winter des Jahres 1860 bot sich dann eine Gelegenheit für Quantrill, eine Chance, die der entwurzelte Mann sofort nutzte.
*
Der Wind kam von Norden und trug Schnee mit sich. Als der einsame Reiter sein Pferd in der Nähe eines Pinienwäldchens zügelte und gedankenverloren hinauf zum wolkenverhangenen Himmel blickte, wusste er, dass es nur noch eine Frage von Tagen war, bis der Winter seinen Einzug in Missouri halten würde.
Die letzten Wochen waren alles andere als leicht für William Clarke Quantrill gewesen. Zwar hatte er sich durch den Verkauf der Pferde recht gut durchschlagen können, aber der Hass in seinem Herzen war nur noch größer geworden. Hass, der ihn während einsamer Nächte in kargen, heruntergekommenen Hotelzimmern manchmal kaum einen klaren Gedanken fassen ließ. Quantrill war ein noch junger Mann, aber sein Herz erkaltete mit jedem Tag mehr, wo er erfuhr, dass sich die Situation an der Grenze von Kansas und Missouri dramatisch zuspitzte.





























