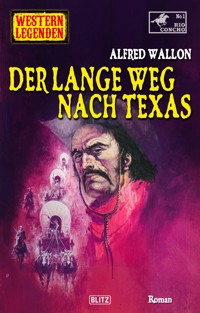
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Western Legenden (Historische Wildwest-Romane)
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Tom Calhoun und seine Familie haben ihre Heimat in den Appalachen verlassen und brechen mit einem Siedlertreck nach Texas auf. Sie hoffen auf eine gute Zukunft. Doch die lange Reise birgt viele Gefahren. Endlich angekommen ergeben sich neue Probleme, denn die Ranch, die Tom Calhoun aufbauen möchte, liegt abseits jeder Zivilisation. Und die Comanchen warten nur auf einen günstigen Zeitpunkt, um die verhassten Weißen anzugreifen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 288
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Western Legenden
In dieser Reihe bisher erschienen
9001 Werner J. Egli Delgado, der Apache
9002 Alfred Wallon Keine Chance für Chato
9003 Mark L. Wood Die Gefangene der Apachen
9004 Werner J. Egli Wie Wölfe aus den Bergen
9005 Dietmar Kuegler Tombstone
9006 Werner J. Egli Der Pfad zum Sonnenaufgang
9007 Werner J. Egli Die Fährte zwischen Leben und Tod
9008 Werner J. Egli La Vengadora, die Rächerin
9009 Dietmar Kuegler Die Vigilanten von Montana
9010 Thomas Ostwald Blutiges Kansas
9011 R. S. Stone Der Marshal von Cow Springs
9012 Dietmar Kuegler Kriegstrommeln am Mohawk
9013 Andreas Zwengel Die spanische Expedition
9014 Andreas Zwengel Pakt der Rivalen
9015 Andreas Zwengel Schlechte Verlierer
9016 R. S. Stone Aufbruch der Verlorenen
9017 Dietmar Kuegler Der letzte Rebell
9018 R. S. Stone Walkers Rückkehr
9019 Leslie West Das Königreich im Michigansee
9020 R. S. Stone Die Hand am Colt
9021 Dietmar Kuegler San Pedro River
9022 Alex Mann Nur der Fluss war zwischen ihnen
9023 Dietmar Kuegler Alamo - Der Kampf um Texas
9024 Alfred Wallon Das Goliad-Massaker
9025 R. S. Stone Blutiger Winter
9026 R. S. Stone Der Damm von Baxter Ridge
9027 Alex Mann Dreitausend Rinder
9028 R. S. Stone Schwarzes Gold
9029 R. S. Stone Schmutziger Job
9030 Peter Dubina Bronco Canyon
9031 Alfred Wallon Butch Cassidy wird gejagt
9032 Alex Mann Die verlorene Patrouille
9033 Anton Serkalow Blaine Williams - Das Gesetz der Rache
9034 Alfred Wallon Kampf am Schienenstrang
9035 Alex Mann Mexico Marshal
9036 Alex Mann Der Rodeochampion
9037 R. S. Stone Vierzig Tage
9038 Alex Mann Die gejagten Zwei
9039 Peter Dubina Teufel der weißen Berge
9040 Peter Dubina Brennende Lager
9041 Peter Dubina Kampf bis zur letzten Patrone
9042 Dietmar Kuegler Der Scout und der General
9043 Alfred Wallon Der El-Paso-Salzkrieg
9044 Dietmar Kuegler Ein freier Mann
9045 Alex Mann Ein aufrechter Mann
9046 Peter Dubina Gefährliche Fracht
9047 Alex Mann Kalte Fährten
9048 Leslie West Ein Eden für Männer
9049 Alfred Wallon Tod in Montana
9050 Alfred Wallon Das Ende der Fährte
9051 Dietmar Kuegler Der sprechende Draht
9052 U. H. Wilken Blutige Rache
9053 Alex Mann Die fünfte Kugel
9054 Peter Dubina Racheschwur
9055 Craig Dawson Dunlay, der Menschenjäger
9056 U. H. Wilken Bete, Amigo!
9057 Alfred Wallon Missouri-Rebellen
9058 Alfred Wallon Terror der Gesetzlosen
9059 Dietmar Kuegler Kiowa Canyon
9060 Alfred Wallon Der lange Weg nach Texas
9061 Alfred Wallon Gesetz der Gewalt
9062 U. H. Wilken Dein Tod ist mein Leben
9063 G. Michael Hopf Der letzte Ritt
Alfred Wallon
Der lange Weg nach Texas
RIO CONCHOBand 1
Als Taschenbuch gehört dieser Roman zu unseren exklusiven Sammler-Editionen und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt.Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.© 2023 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Jörg KaegelmannTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerLogo: Mario HeyerSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-681-1
Kapitel 1
„Du hast leider verloren, Junge!“
Die Stimme des bärtigen Spielers zerriss die atemlose Stille, die rings um den Tisch herrschte. Mehr als eine Stunde dauerte dieses Spiel jetzt schon, und der Mann im tadellos sitzenden Anzug hatte den jungen Mann nach Strich und Faden ausgenommen. Ganze zwanzig Dollar hatte er ihm abgeknöpft, ein Vermögen für den Burschen, der die grobe Kleidung eines Farmers trug.
Eilig raffte der Spieler das Geld an sich. Ein breites Grinsen zeichnete sich auf seinen hageren Zügen ab. Wieder einer von diesen Grünschnäbeln, die ihre Finger nicht von den Karten lassen konnten, obwohl sie keine Ahnung vom Spiel hatten.
Der junge Mann hatte bis zu diesem Moment noch gar nichts gesagt. Man sah ihm deutlich an, dass er nachdachte. Aber das änderte gar nichts daran, dass er das Geld verloren hatte. Geld, mit dem er eigentlich Proviant hatte einkaufen sollen. Und nun war es weg!
„Sie hatten einfach zu viel Glück, Mister!“, entfuhr es dem jungen John Calhoun, weil er seinen Zorn nur mühsam zurückhalten konnte. „Ob das wirklich nur Glück war?“
Der Spieler erstarrte jetzt.
„Was?“, fragte er dann gefährlich leise. „Bist du jetzt verrückt geworden, Farmerseele? Für solche Worte sind hier schon Leute erschossen worden. Weißt du das?“
John Calhoun zeigte keine Spur von Angst, als er das hörte. Stattdessen bemühte er sich, weiterhin ruhig zu bleiben.
„Ich meine das Herz-Ass, Mister“, fuhr er nun fort. „Sie hatten es aus dem Ärmel gezogen. Das habe ich ganz deutlich sehen können.“
Stühle wurden hastig zurückgeschoben. Männer sprangen nun auf und suchten das Weite, weil sie wussten, dass hier in den nächsten Sekunden etwas Schlimmes geschehen würde.
„Du Drecksfarmer!“, keuchte der Spieler wütend. „Dafür werde ich dich ...“
Seine Rechte glitt unter die Jacke. John stieß mit den Beinen den Tisch von sich und traf den Spieler damit genau in den Magen. Der Mann stöhnte auf und taumelte zurück. Mit einem dumpfen Poltern entglitt die Waffe seinen Fingern. Gerade hatte er damit auf John schießen wollen, der war aber zum Glück schneller gewesen.
„Ich bin unbewaffnet, du Schweinehund!“, rief John erzürnt.
Dann ballte er die Fäuste und stürzte sich auf den Spieler. Der war zwar älter und größer als John, aber er besaß nicht die Kraft und die Ausdauer eines jungen Farmers, der Tag für Tag hart arbeiten musste.
John wich zur Seite aus, als ihn der Spieler angriff. Der Schlag des Betrügers ging fehl. Dagegen landete John einen Volltreffer im Genick des Mannes.
John setzte sofort nach und gab dem Spieler keine Chance mehr. Augenblicke später lag der Mann am Boden, fertig von den Schlägen, die er hatte einstecken müssen. So musste er zusehen, wie sich John über ihn beugte und sich an seinem linken Ärmel zu schaffen machte. Sekunden später holte John eine Spielkarte heraus und hielt sie hoch.
Das Herz-Ass. John hatte die Wahrheit gesagt. Der Bursche war also wirklich ein Falschspieler!
„Damit dürfte die Sache wohl klar sein“, sagte John und wandte sich von dem besiegten Gegner ab. „Das war die Quittung dafür. Ich schlage vor, wir teilen uns den Spielgewinn“, richtete er nun das Wort an die beiden anderen Männer, die mit von der Partie gewesen waren.
In diesen Sekunden achtete niemand mehr auf den Mann am Boden, der trotz der Schläge noch nicht aufgegeben hatte. Hasserfüllt griff er nach der Waffe, die nur wenige Inches neben ihm auf dem Fußboden lag. Die Augen des Spielers blitzten vor Zorn, als er jetzt die Pistole an sich riss und damit genau auf Johns Rücken zielte.
„Stirb, du Farmerseele!“, brüllte er und drückte ab.
Kapitel 2
Tom Calhoun musste unwillkürlich Luft holen, als er sich seinen Weg durch die Menge bahnte. In diesen Tagen des Jahres 1859 war die Stadt Independence in Missouri ein Hexenkessel und Schmelztiegel aller möglichen Rassen. Er suchte seinen Sohn John, der versprochen hatte, sich um den Proviant zu kümmern. Bis jetzt war er aber noch nicht ins Siedlercamp draußen vor der Stadt zurückgekehrt. Irgendwo musste der Junge aber stecken, und Tom hatte auch schon eine Vermutung, wo er ihn zu suchen hatte.
Independence war eine Stadt, die einem Durchreisenden jede Menge Verlockungen bieten konnte. Seit Jahren war hier das Tor für die großen Trecks in die unberührte Wildnis des Westens. Die Stadt war ein Sammelplatz für die Handelstransporte, die seit über einem Jahrzehnt den langen Santa-Fe-Trail nach Mexiko gingen. Jedes Jahr starteten hier die schweren Murphy- und Conestoga-Wagen in Richtung Westen, beladen mit allen möglichen Handelsgütern.
Ein Betrunkener lag im Straßenschlamm und schlief seinen Rausch aus. Er bemerkte nicht, wie sich ein struppiger Hund an ihn heranschlich, ihn von allen Seiten beschnupperte und dann wieder das Interesse an ihm verlor.
Schrille Schreie und lautes Grölen klangen aus dem Dutzend von billigen Kneipen und Saloons an seine Ohren. Etliche dieser Häuser hatte er bereits durchkämmt, John jedoch nirgendwo angetroffen. Gerade als er die Schwingtüren des Silver-Spur-Saloons passierte, fiel sein Blick eher zufällig auf einen Mann, der am Boden lag und nach einer Waffe griff. Er riss sie jetzt hoch und zielte damit auf den Rücken eines anderen Mannes, mit dem er wohl eine Rechnung zu begleichen hatte.
Tom wurde kreidebleich, als er jetzt John erkannte. Der ahnte jedoch nichts von dem, was hinter seinem Rücken geschah.
„Vorsicht, John!“, rief Tom Calhoun ihm zu. „Er schießt!“
John hörte den Warnruf, drehte sich um und erkannte seinen Vater. Gleichzeitig fiel hinter ihm ein Schuss, und John spürte, wie etwas dicht an seiner Schulter vorbeipfiff.
Doch bevor der Spieler ein zweites Mal abdrücken konnte, fiel jetzt ein Schuss von der Theke des Saloons her. Die Kugel traf den mordlüsternen Spieler und stieß ihn nach vorn. Der Mann schrie laut auf, wälzte sich am Boden und rührte sich dann nicht mehr.
Fassungslos blickte John jetzt in das markante Gesicht eines Mannes, der ganz in Leder gekleidet war und der jetzt seinen Paterson-Colt wieder ins Holster zurücksteckte. Er bemerkte dabei Johns Blick und grinste deshalb.
„Hätte ich denn zusehen sollen, wie er dich über den Haufen schießt, Junge?“, fragte er und wandte sich dann wieder der Theke zu.
Stimmengemurmel brandete auf, während Tom Calhoun zu seinem ältesten Sohn eilte. Sorge stand in seinem braun gebrannten Gesicht geschrieben, als er John am Arm packte.
„Was hast du angestellt, Junge?“, fragte er. „Wolltest du nicht Proviant einkaufen?“
John blickte schuldbewusst zu Boden. Er wusste, dass er seinen Vater belogen hatte, und das tat doppelt weh. Denn er war den Verlockungen des Saloons gefolgt und hatte alle Warnungen ignoriert.
„Seien Sie nicht zu hart mit dem Jungen, Mister!“, meldete sich jetzt der Mann in Leder zu Wort, der John buchstäblich im letzten Atemzug das Leben gerettet hatte. „Ich denke, er hat etwas daraus gelernt.“
Toms Augen hefteten sich auf den großen Mann an der Theke.
„Mein Junge und ich stehen in Ihrer Schuld, Mister“, sagte er mit rauer Stimme und streckte ihm seine Hand entgegen. „Mein Name ist Tom Calhoun. Das ist mein Sohn John. Normalerweise hört er auf das, was man ihm sagt.“
„Reden wir nicht mehr darüber“, winkte der Mann ab. „Ich heiße übrigens Roy Catlin. Sie sind einer der vielen Siedler, die sich im Südwesten eine neue Existenz aufbauen wollen?“
„Ja“, erwiderte Tom. „Meine Familie und ich wohnen im Camp draußen vor der Stadt. Mister Catlin, Sie haben John das Leben gerettet, deshalb lade ich Sie ein, uns zu besuchen.“
Roy Catlin begriff sofort, dass er Tom Calhoun beleidigen würde, wenn er die Einladung ablehnte.
„Ich werde kommen, Mister Calhoun“, sagte er nach kurzem Überlegen. „Nach Sonnenuntergang. Ist Ihnen das recht?“
„Sicher“, stimmte ihm Tom zu, während in diesem Moment ein Mann den Saloon betrat, der in seiner Armbeuge eine Schrotflinte hielt. Auf dem verwaschenen Baumwollhemd blinkte ein Marshalstern.
„Sieht ganz danach aus, als ob es da noch einige Dinge zu klären gibt“, meinte er dann zu Catlin.
Der sagte gar nichts, sondern wartete ab, bis der Marshal seine Blicke auf ihn richtete und dabei den Lauf der Schrotflinte etwas anhob.
„Waren Sie das?“, wollte er von Catlin wissen und schaute kurz zu dem toten Spieler.
„Wenn ich nicht eingegriffen hätte, dann wäre dieser Junge hier jetzt tot“, erwiderte Catlin mit einem kurzen Seitenblick zu John. „Ich kann eben nicht zusehen, wenn so ein Hundesohn wie dieser Bursche da versucht, einem anderen in den Rücken zu schießen.“
„Stimmt das, was der Mann gerade gesagt hat?“, fragte der Marshal die anderen Gäste im Saloon. „Wer von euch will dazu etwas sagen?“
Einen Augenblick lang herrschte Schweigen. Doch dann meldeten sich mehrere Männer zu Wort, die Catlins Aussage bestätigten. Der Marshal hörte sich das an und fällte dann eine Entscheidung.
„Sieht nach klarer Notwehr aus“, schlussfolgerte er. „Ihr beiden!“, wandte er sich an zwei Männer, die neben ihm standen. „Ihr tragt den Toten hinüber zum Coroner. Ich denke, dass der Fall damit erledigt ist.“
Er bückte sich rasch und fingerte in den Taschen des toten Spielers herum, bis er fündig geworden war.
„Das dürfte reichen, um ihn anständig unter die Erde zu bringen. Schließlich hat die Stadtverwaltung auch Kosten.“
Er steckte das Geld ein, ohne ein weiteres Wort zu verlieren, und gab den beiden Männern ein Zeichen. Diese packten den toten Spieler an Händen und Füßen und schleppten ihn aus dem Saloon. Zurück blieb ein dunkler Fleck auf dem Fußboden.
„Ich möchte keinen weiteren Ärger in der Stadt haben, Mister“, wandte er sich an Catlin. „Sie haben doch nicht vor, hier länger zu bleiben?“
„Eigentlich wollte ich morgen früh weiter, Marshal“, antwortete Catlin. „Ist das zeitig genug?“
Damit war der Gesetzesbeamte sichtlich zufrieden und verließ den Saloon.
Tom Calhoun und sein Sohn hatten alles mit angesehen und dachten sich jeder ihren Teil. Tom hielt es für besser, wenn er sich jetzt mit John wieder auf den Rückweg zum Camp machte, denn Sarah und der kleine Billy würden sich bestimmt schon um beide sorgen, wenn sie noch länger ausblieben. Deshalb verabschiedete sich Tom noch einmal von Roy Catlin und bat ihn erneut, abends ins Camp zu kommen.
John schaute im Hinausgehen noch einmal auf die Stelle, wo der tote Spieler gelegen hatte. Der Keeper streute jetzt neue Sägespäne auf den Boden, um den Blutfleck unkenntlich zu machen.
Kapitel 3
„Ich hoffe, das war dir eine Lehre, Junge“, sagte Tom zu ihm, als sie draußen waren. „Geh nicht in solche Spielhöllen. Das bringt doch nur Unglück.“ Während er das sagte, preschte auf der Straße ein Pferdegespann vorbei. Der Kutscher schlug wie ein Wilder auf die Tiere ein. Die Passanten, die jetzt die Straße überquerten, mussten sich hastig in Sicherheit bringen, wenn sie nicht überfahren werden wollten.
„Ich wollte doch nur eine Möglichkeit finden, um unsere Kasse etwas aufzubessern, Pa“, erwiderte der achtzehnjährige John. Aber sein Vater winkte ab, als er das hörte.
„Sei froh, dass du deinen Spieleinsatz wiederbekommen hast, John“, belehrte ihn der erfahrene Tom. „Es hätte alles auch ganz anders kommen können, Junge. Und was hätte ich dann deiner Mutter sagen sollen?“
John seufzte. Er wusste, wie recht sein Vater hatte. Gemeinsam folgten die beiden nun dem Gehsteig bis zu dem Laden, wo John Proviant hatte kaufen sollen. Es wurde jetzt höchste Zeit dafür.
Nur zwei Kunden hielten sich im Store auf, und die schauten Tom und seinen Sohn misstrauisch von oben bis unten an, weil die Calhouns geflickte Kleidung trugen und man ihnen die Siedler schon von Weitem ansah.
„Was darf’s denn sein, Mister?“, wandte sich der Storebesitzer nun an Tom. „Ich habe alles da, was Sie auf dem langen Weg nach Westen brauchen können. Mehl und Zucker, Patronen und Pulver.“
„Packen Sie ein, was auf diesem Zettel steht“, unterbrach ihn Tom und drückte ihm ein Stück Papier in die Hand. Jetzt war der Mann doch sehr erstaunt, dass es unter den Siedlern auch solche gab, die schreiben und lesen konnten. Sofort begriff er, dass er diesen Mann nicht so herablassend behandeln konnte. Deshalb beeilte er sich, die gewünschten Waren zu holen.
Eine Viertelstunde später hatte er alles zusammengepackt.
„Das macht fünfzehn Dollar, Mister“, sagte er und streckte die Hand aus.
Tom runzelte unwillkürlich die Stirn, als er den Preis hörte. Viel zu viel, das war keine Frage. Aber hier in Independence war das normal. Jeder versuchte, dem anderen möglichst viel aus der Tasche zu ziehen. Deshalb musste er zusehen, dass er seine Familie so schnell wie möglich von hier wegbrachte. Sonst war ihr Geld schneller verbraucht, als ihnen lieb war.
John nahm einen Teil der Waren an sich, sein Vater trug den Rest. Beide verließen den Store und machten sich auf den Weg zum Siedlercamp draußen vor der Stadt. Ein Betrunkener am Straßenrand flehte Tom an, ihm einen Dollar zu geben. Aber Tom ignorierte ihn und ging einfach weiter. Es wurde höchste Zeit, ins Camp zurückzukommen, und je schneller sie diese Stadt verließen, umso besser würde das sein.
Kapitel 4
„Mein Pa sagt, dass es da draußen in den Prärien Indianer gibt, die jeden Treck angreifen“, sagte der dreizehnjährige Ben Wagner. „Sie sollen jeden Weißen töten, der ihnen über den Weg läuft, heißt es.“
„Mal nicht den Teufel an die Wand, Junge“, erwiderte Sarah Calhoun. „Ich denke, du und deine Familie kommt auch aus dem Osten. Woher wollt ihr das alles so genau wissen?“
Ben Wagner grinste. „Pa kennt einen Offizier aus der Stadt“, erwiderte er. „Und der muss es schließlich wissen, oder?“
Sarah Calhoun ersparte sich eine Antwort, denn sie wusste, dass Ben Wagner ein großes Mundwerk besaß. Das hatte er wohl von seinem Vater geerbt, denn der wollte auch immer große Reden schwingen.
„Machen Sie sich keine Sorgen, Mrs. Calhoun“, fuhr der Junge jetzt fort. „Wenn es ernst wird, dann unternimmt mein Pa schon etwas. Er wird bestimmt auch Ihnen und Ihrer Familie helfen.“
Mit diesen Worten wandte er sich ab und ging zurück zu dem schweren Murphy-Wagen, in dem er und sein Vater wohnten. Sarah war erleichtert, dass der aufdringliche Bursche gegangen war. Es passte ihr nämlich gar nicht, dass sie und ihre Familie in unmittelbarer Nachbarschaft der Wagners leben mussten. Zumindest so lange, bis der Wagenzug aufbrach.
Ihre Gedanken brachen ab, als sie drüben vom Zelt her die helle Stimme des kleinen Billy hörte. Der Junge war aus dem Zelt gekrochen und suchte nach seiner Mutter, war sichtlich erleichtert, als er sie nur wenige Schritte entfernt entdeckte.
„Ich habe Hunger, Ma!“, rief der Kleine, der für sein Alter schon recht aufgeweckt war.
„Bald ist es so weit, Billy“, tröstete Sarah ihren Jüngsten und hoffte selbst darauf, dass Tom und John bald wieder zurückkamen. Zum Glück musste sie nicht mehr lange warten, denn schon wenige Augenblicke später entdeckte sie die beiden.
„Das wurde aber auch Zeit“, sagte sie mit einem leisen Vorwurf in der Stimme. „Ihr habt euch ja eine Ewigkeit Zeit gelassen mit dem Einkaufen. War das denn wirklich so schwer?“
„Das Einkaufen eigentlich nicht“, erwiderte Tom, stellte den Packen ab und hob den kleinen Billy hoch, lächelte ihn an. „Aber John will dir etwas erzählen, nicht wahr, mein Junge? Komm schon, erzähl endlich deiner Mutter, was du angestellt hast. Du wirst ja jetzt wohl nicht kneifen!“
Schweren Herzens fügte sich John und erzählte seiner Mutter nun, welchen Ärger er in der Stadt gehabt hatte. Und der kleine Billy schaute den älteren Bruder mit großen Augen an, als er das hörte. John war in Billys Augen wirklich zu beneiden. Der hatte wenigstens schon etwas erlebt, während Billy immer in der Nähe seiner Mutter bleiben musste.
Kapitel 5
Roy Catlin roch den Rauch der vielen Lagerfeuer draußen vor der Stadt. Flammen loderten in den dunklen Himmel empor. Aus einiger Entfernung erklang ein trauriges Lied, das einer der Siedler sang.
Catlin zügelte sein Pferd bei den Wagen und stieg aus dem Sattel. Dann ging er zu einem der Männer.
„Wo finde ich Tom Calhoun und seine Familie?“, erkundigte er sich und registrierte gleichzeitig, wie man ihn misstrauisch musterte. Denn Roy Catlin sah nicht aus wie ein Siedler. Der Revolver im Holster war blank geputzt, ein Zeichen für einen Mann vom schnellen Eisen.
Trotzdem beschrieb ihm der Mann den Weg zu den Calhouns. Catlin bedankte sich und zog das Pferd am Zügel hinter sich her. Im Schein der Lagerfeuer passierte er viele ärmlich gekleidete Menschen. Kinder tollten bei den Wagen herum. Stimmen klangen an sein Ohr, auch in Sprachen, die er nie zuvor gehört hatte. Und doch hatten diese Menschen alle eins gemeinsam: den Traum von einer neuen und besseren Zukunft. Sie klammerten sich an die Hoffnung, dass im Südwesten alles leichter wurde. Roy Catlin war ein erfahrener Mann, der schon so manchen Siedlertreck begleitet hatte, und er wusste, wie viele Hindernisse sich diesen Menschen noch entgegenstellen würden.
Dann sah er den graubärtigen Mann, dessen Sohn er vor der Kugel des Falschspielers gerettet hatte. Und auch Tom Calhoun erblickte den Mann in der Lederkleidung sofort.
„Ich freue mich, dass Sie gekommen sind, Mister Catlin“ begrüßte er ihn und schüttelte ihm erfreut die Hand. „Meine Frau weiß schon Bescheid, dass wir heute Abend einen Gast haben. Aber zunächst möchte ich Sie mit einigen Leuten bekannt machen.“
Catlin band sein Pferd am Wagen an und folgte dann Tom Calhoun hinüber zu einem lodernden Campfeuer, an dem drei Männer saßen und den Neuankömmling neugierig anschauten. Es waren Männer vom Schlage Tom Calhouns. Einfache Menschen, aber in ihren Augen spiegelte sich der Wille wider, mit dem Treck in eine neue Zukunft aufzubrechen.
„Bevor wir essen, will ich Ihnen die Leute zeigen, die genau wie ich nach Texas wollen, Mister Catlin“, begann Tom. „Wir haben uns für den Santa-Fe-Trail entschieden, weil der nicht so beschwerlich ist wie der Weg nach Oregon. Außerdem lebt ein Bruder von mir in Texas.“ Er zeigte jetzt auf einen bulligen Mann auf der anderen Seite des Feuers. „Das hier ist Dick Wagner. Ein echter Germane, wie er im Buche steht. Wenn es nötig ist, kann er für zwei arbeiten.“
Catlin nickte Wagner kurz zu und stellte dabei fest, dass der Deutsche ihm irgendwie unsympathisch war. Später sollte sich herausstellen, wie recht er mit dieser Vermutung gelegen hatte.
Die beiden anderen Männer waren Mark Windham und Stu Edwards. Zwei wackere Pioniere mit dem Herz auf dem rechten Fleck. Beide hatten Familien und glaubten auch an eine Chance in Texas.
„Waren Sie schon mal in Texas?“, wollte Wagner nun von dem Mann in Leder wissen. „Wir haben gehört, dass es ein riesiges Land mit großen Weiden ist. Stimmt das?“
„Ich kenne Texas“, antwortete Catlin. „Und auch den Weg über den Santa-Fe-Trail. Mister Wagner, ich habe schon einmal einen Treck dorthin geführt.“ Er registrierte das erleichterte Aufleuchten in den Augen der Männer am Feuer. „Aber denken Sie nur nicht, dass es ein einfacher Weg ist. Der Trail nach Süden steckt voller Gefahren.“ Er machte eine kleine Pause und blickte in die Runde.
„Wissen Sie eigentlich, was Sie Ihren Familien da zumuten?“, fuhr er dann fort. „Wer weiß, ob alle lebend am Ziel ankommen. Und das nur wegen eines gottverdammten Traums, der vielleicht nur ein Hirngespinst ist! Ich kann das beim besten Willen nicht verstehen. Die Männer, die ich letztes Jahr nach Texas führen sollte, sahen genauso aus. Menschen mit vielen Hoffnungen und Wünschen. Diese Wünsche wurden schon nach wenigen Wochen zerstört, als die Comanchen angriffen. Das ist die Realität, und die sollte keiner von Ihnen vergessen!“
Er brach ab und blickte in die Runde. Aber dann erkannte er, dass seine Worte zwecklos gewesen waren. Die Menschen waren förmlich besessen von der Idee, noch einmal woanders von vorn zu beginnen. Und diesen Glauben konnte auch ein Mann wie Roy Catlin nicht erschüttern.
„Wir sind zu allem entschlossen, Mister Catlin“, ergriff nun Tom Calhoun wieder das Wort und holte sich einen glimmenden Span aus dem Feuer. Er zündete sich eine Pfeife an und rauchte genüsslich, bevor er wieder fortfuhr. „Meine Familie und ich können in den Appalachen nicht mehr leben. Das Land ist zu karg, und mein anderer Bruder Brett Justin, der noch dort ist, muss jetzt schon um seine Existenz kämpfen. Mark Windham hat ein ähnliches Schicksal hinter sich, und Stu Edwards hat sein Land in einem Gerichtsprozess verloren, weil er kein Geld hatte, um die hohen Steuern bezahlen zu können. Und Dick Wagner kam, weil er in Europa so viel von Texas gehört hat. Mister Catlin, wären Sie verärgert, wenn ich Sie frage, ob Sie uns alle nach Texas bringen würden?“
Sein Gesicht nahm einen bitteren Zug an, als er fortfuhr.
„Ich weiß, ich habe Sie ursprünglich nur zum Essen eingeladen, und dabei soll es auch bleiben, egal, wie Sie sich entscheiden werden. Aber die Lage für uns wird immer kritischer. Am späten Nachmittag ließ sich ein Lieutenant blicken, um uns zu sagen, dass im Augenblick kein Scout zur Verfügung steht. Wir sollen noch zwei Wochen warten, Mister Catlin. So lange können wir aber in Independence nicht bleiben. Hier kostet alles ein Heidengeld, und das wenige, was wir zusammengespart haben, brauchen wir in Texas!“
Catlin hörte ihm schweigend zu. Er hätte Tom Calhoun sagen können, dass sich die Armee momentan dagegen sträubte, Siedlertrecks durch die Indianergebiete zu führen. Die Kiowa und Comanchen, denen das Land gehörte, waren erzürnt darüber, dass die Weißen einfach ihr Land durchquerten, als gehöre es ihnen schon. Es hatte schon einige blutige Gefechte gegeben, und deshalb ging die Armee auf Nummer sicher.
„Mister Calhoun, Sie sind der entschlossenste Mann, der mir seit Langem begegnet ist“, sagte Catlin schließlich. „Wer weiß? Sie könnten es vielleicht sogar schaffen.“
Der graubärtige Siedler lächelte jetzt.
„Heißt das, dass Sie einverstanden sind?“, fragte er Catlin und war sehr erleichtert, als dieser jetzt nickte.
„Hören Sie“, fuhr Tom dann fort. „Wir haben schon etwas zusammengelegt. Jeder hat etwas gegeben. Insgesamt sind es 300 Dollar, das ist zwar nicht viel, aber es ist ein fairer Lohn für einen guten Scout.“
Mark Windham schien jetzt sichtlich erleichtert, als Catlin und Tom Calhoun diese Abmachung mit einem Handschlag besiegelten. Auch Edwards war froh darüber, dass das Problem endlich gelöst war. Der Deutsche sagte gar nichts, er schaute Roy Catlin nur an.
„John!“, rief der graubärtige Siedler nun zu den Wagen herüber. „Bring uns den Krug Whiskey, wir haben was zu feiern.“
Toms ältester Sohn hatte sich in der Nähe des Feuers aufgehalten und mitbekommen, was hier besprochen worden war. Sein Herz klopfte jetzt ganz aufgeregt, als er erfuhr, dass der Mann in Leder der neue Scout sein sollte. Als der Whiskeykrug dann wenige Minuten später die Runde machte, durfte sogar John einen Schluck trinken.
Stu Edwards hatte eine Fiedel aus seinem Wagen geholt und spielte zum Tanz auf. Die Frauen hatten gekocht, und es breitete sich eine euphorische Stimmung aus. In Windeseile hatte sich herumgesprochen, dass Tom Calhoun und seine Freunde einen Scout angeheuert hatten. Spontan schlossen sich nun vier weitere Familien an, die nicht mehr in Independence warten wollten, bis ihnen die Armee einen Führer zur Verfügung stellte. Insgesamt waren es jetzt zehn Familien, die einen Treck nach Südwesten bildeten.
„Sie haben sich ein wenig im Camp umgesehen, Mister Catlin“, sagte John zu dem neuen Scout, der außerhalb des Campfeuers stand und zusah, wie die anderen feierten. „Was denken Sie? Schaffen wir es?“
„Du machst dir zu viele Gedanken, Junge“, erwiderte Catlin ausweichend. „Es gibt Leute unter euch, die immer noch denken, dass das alles ein Kinderspiel ist. Einige haben keine Ochsen als Zugtiere. Das sind die Ersten, die auf der Strecke bleiben werden.“
„Weshalb das denn?“, fragte der wissbegierige John. „Wir haben ja auch Ochsen, aber ich denke manchmal, dass die viel zu träge sind, um die lange Strecke durchzuhalten.“
„Da täuschst du dich aber“, erwiderte Catlin. „Der Weg nach Independence war einfach. Aber warte erst einmal ab, bis wir die Stadt verlassen haben und in der Wildnis sind. Da gibt es keine Straßen, denen wir folgen können. Reißende Flüsse und öde Landstriche erwarten uns, und das halten Ochsen viel besser durch als Pferde. Die sind es gewohnt, schwere Lasten zu ziehen. Pferde geben viel schneller auf. Was das da draußen bedeutet, muss ich wohl nicht mehr sagen, oder?“
John hörte dem neuen Scout schweigend zu. Er spürte, dass Roy Catlin ein erfahrener Mann war, der schon vieles miterlebt hatte. Er wusste, dass sein Vater auf diesen Mann zählte. Und wenn Tom Calhoun sich und seine Familie jemandem anvertraute, dann konnte man sicher sein, dass es auch der richtige Mann war.
„Kommen Sie doch mit rüber zum Feuer“, forderte ihn John jetzt auf. „Sie müssen doch nicht abseitsstehen. Tanzen Sie doch wie die anderen auch!“
Catlin schüttelte den Kopf.
„Junge, dein Vater hat mir einen verantwortungsvollen Auftrag erteilt. Ich muss dafür sorgen, dass ihr alle heil und gesund in Texas ankommt. Da muss ich mir noch den Kopf zerbrechen, wie ich das am besten bewerkstellige. Deswegen schaue ich mir jetzt noch einmal genau alle Wagen an. Die Planen müssen wetterfest sein, damit sie auch ein Unwetter aushalten.“
Er bemerkte Johns besorgten Blick und fuhr deshalb rasch fort.
„Diese Wagen werden eure Häuser für viele Wochen sein, Junge. Ein Haus muss einem Unwetter trotzen können, das gilt auch für die Planwagen. Auch das Fahrgestell muss stark und stabil sein. Wenn dich das so sehr interessiert, dann komm doch am besten mit, wenn ich jetzt die Wagen inspiziere. Ich habe ohnehin das Gefühl, als ob du verdammt neugierig bist.“
Er lächelte, und John grinste zurück. Die beiden verstanden sich auf Anhieb. John folgte dem Scout, während drüben am Lagerfeuer die Stimme von Dick Wagners Frau Ruth zu hören war. Sie sang ein altes deutsches Lied. Es war eine seltsam traurige Weise, die fast alle Menschen im Camp ergriff und sie ihre augenblicklichen Sorgen vergessen ließ. Drüben von den Häusern der Stadt her fiel wieder ein Schuss. Auch nachts schien Independence keine Ruhe zu finden. Aber die eigentliche Ruhe und Einsamkeit eines weiten unerschlossenen Landes kannte noch keiner der mutigen Siedler.
Kapitel 6
„Billy, wach auf, es ist Zeit!“
Die Stimme seiner Mutter weckte den Kleinen aus dem Schlaf. Verstört riss er die Augen auf und sah das Morgenrot, das sich am fernen Horizont abzeichnete. Erst dann erkannte er die vertraute Gestalt seiner Mutter, die sich nochmals über ihn beugte und ihn sanft an den Schultern rüttelte.
„Fahren wir jetzt nach Texas, Ma?“, wollte Billy wissen und rieb sich die Augen.
Seine Mutter nickte.
„Die Wagen stehen schon bereit, Junge. Dein Vater und John sind vorn bei den Ochsen. Komm, schau es dir ruhig an.“
Billy nickte eifrig und stand jetzt auf. Über ihm wölbte sich die dichte Plane, die sie zukünftig vor Sturm und Regen schützen sollte. Für die nächsten langen Wochen war dieser Planwagen sein Zuhause.
Der Kleine kletterte hinaus ins Freie und sah sich um. Die Wagen hatten sich schon formiert. Männer, Frauen und Kinder hatten sich versammelt, um auf das Startzeichen zu warten.
Billy sah seinen Vater, und John lief auf die beiden zu. Tom Calhoun strich seinem jüngsten Sohn über die blonden Haare und bemerkte den fragenden Blick in Billys Augen.
„Ja, Billy, heute ist es so weit“, sagte er. „Gleich brechen wir auf nach Texas. Während du noch tief geschlafen hast, haben John und ich schon alles zusammengepackt. Siehst du da vorn Mister Catlin? Hör gut zu, was er uns jetzt allen zu sagen hat.“
Billys neugierige Blicke hefteten sich auf den Mann, der die Männer, Frauen und Kinder ansah, die sich ihm anvertraut hatten. Trotz seiner jungen Jahre war sich Billy der Feierlichkeit bewusst, die sich unter den Menschen ausgebreitet hatte. Sie alle wussten, dass es nun so weit war.
„Ich möchte euch allen noch etwas sagen, bevor es losgeht!“, hörte Billy die Stimme des Scouts. „Wir brechen in ein noch ungewisses Schicksal auf. Es kann sein, dass einige am Ziel nicht ankommen werden, denn die nächsten Wochen werden uns viel Kraft kosten. Auch Frauen und Kinder werden hart arbeiten müssen, denn uns wird nichts geschenkt auf diesem Trail nach Texas. Was ihr bereits von anderen über die Mühen eines Wagentrecks gehört habt: Vergesst es. Denn die Wirklichkeit ist noch viel schlimmer. Wer es sich jetzt noch überlegen und hierbleiben will, der soll es besser gleich sagen, denn unterwegs können wir keine Rücksicht mehr nehmen. Habt ihr das alle verstanden?“
Keiner der Siedler sagte etwas. Niemand machte jetzt einen Rückzieher. Die Männer hoben ihre Frauen und Kinder auf die Wagen, bevor sie selbst auf den Bock kletterten und die Zügel der Gespanne in die Hände nahmen.
„Dann los!“, rief Roy Catlin mit lauter Stimme und hob die rechte Hand. Er drückte seinem Pferd die Hacken in die Weichen, und das Tier trabte an.
Jubelschreie aus Dutzenden von Kehlen durchbrachen die Stille des beginnenden Tages. Die Wagenräder mahlten sich durch den schmutzigen Boden des Camps, das in den letzten Tagen das Zuhause der Pioniere gewesen war. Die Ochsen brüllten, als sie sich in die Geschirre legten und die schweren Wagen anzogen. Die Männer schwangen die Peitschen und ließen sie über den Köpfen der Tiere knallen.
Es war ein faszinierendes Bild, als die zehn Siedlerfamilien Independence verließen und nach Südwesten aufbrachen. Viele der Stadtbewohner blieben vor ihren Häusern stehen und schauten den wagemutigen Menschen nach. Schon oft genug hatten sie gesehen, wie Siedler in ein ungewisses Schicksal aufgebrochen waren und alles hinter sich zurückgelassen hatten, was ihnen bekannt und vertraut gewesen war.
Billys Herz schlug bis zum Hals, als er sich umdrehte und zurückschaute. Die Stadt wurde allmählich immer kleiner, und bereits jetzt erschienen die Gebäude wie winzige Puppenhäuser. Bald danach hatte der Horizont Independence ganz verschluckt. Die große Ebene von Missouri nahm den Treck auf. Die Zivilisation blieb hinter den Siedlern zurück. Das große Abenteuer hatte für die entschlossenen Pioniere begonnen.
Kapitel 7
„Wie sieht es aus?“, rief Stu Edwards Tom Calhoun schon von Weitem zu, als dieser mit Catlin die ersten Wagen des Trecks erreichte. „Haben Sie da draußen Indianer gesehen?“
Vor allem die letzte Frage galt dem Scout. Aber der schüttelte nur den Kopf.
„Bis jetzt ist alles friedlich, Mister Edwards. Wir sollten uns aber trotzdem anstrengen, dass wir heute noch ein gutes Stück zurücklegen. Bis zum Einbruch der Dunkelheit müssen wir diese Ebene hinter uns haben. Dann schlagen wir unser Nachtlager auf.“
Der Siedler nickte stumm und trieb die Ochsen weiter an. Catlin übernahm wieder die Spitze des Wagenzugs, während Tom zu seiner Familie zurückritt. John hatte unterdessen den Planwagen gelenkt. Sarah und Billy saßen hinten.
„Es geht weiter nach Süden, Junge!“, rief Tom seinem Ältesten zu. „Bring deine Mutter und Billy heil über die Prärie!“
Die Augen des schwarzhaarigen John leuchteten auf bei diesen Worten. Sein Vater übertrug ihm eine Menge an Verantwortung, und darauf war er stolz. Tom lächelte Sarah noch einmal kurz zu, bevor er weiter nach hinten zu den anderen Wagen ritt.
Direkt hinter dem Murphy-Wagen der Calhouns fuhren Dick Wagner und seine Familie. Der Deutsche saß auf dem Bock und fluchte wie verrückt, weil ihm die Ochsen nicht gehorchen wollten. Er ließ die Peitsche über den Köpfen der Tiere knallen, aber dadurch ging es auch nicht besser. Tom sah das und rief ihm zu, dass er mehr Geduld haben müsse.
Hinter den Wagners fuhren die Windhams. Mark Windham hatte jung geheiratet. Die kleine Lucy war der ganze Stolz der Familie. Sie war zwar erst zwölf Jahre alt, aber schon so aufgeweckt wie eine junge Lady. Windham winkte Tom kurz zu, als dieser an dem Wagen vorbeiritt. Auch die übrigen Siedler taten das jetzt, denn schließlich war es ja Tom Calhoun zu verdanken, dass ein erfahrener Scout wie Roy Catlin diesen Wagenzug nach Südwesten brachte.
Staub wurde von den Eisenreifen der Wagen aufgewirbelt, und die Letzten in der Kolonne mussten ihn schlucken. Ganz gewiss war das unangenehm, aber die Siedler ertrugen auch diese Strapazen. Weiter bahnte sich der Wagenzug seinen Weg durch das unendliche Grasland der Prärie. Markierungen oder sonst irgendwelche Wegweiser auf die Fahrtrichtung gab es schon lange nicht mehr. Diese mutigen Menschen waren allein in einem fast unbesiedelten Teil des großen Landes, und sie wussten nicht, mit welchen Gefahren sie noch konfrontiert werden würden. Aber keiner von ihnen schaute zurück und dachte an die Vergangenheit. Die Zukunft wartete auf sie. In dem Land, das schon bald eine neue Heimat für sie sein würde. In Texas!





























