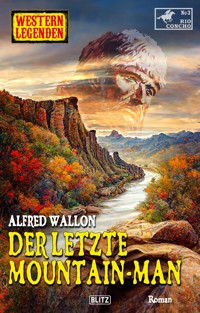
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Western Legenden (Historische Wildwest-Romane)
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Der alte Trapper Ezekiel Calhoun will zurück in die Black Hills, um dort seinen Lebensabend zu verbringen. In den heiligen Bergen der Lakota-Indianer will er jagen und fischen. Doch dort wird eine Eisenbahnlinie geplant. Mit der Eisenbahn kommen auch die Büffeljäger. Schon bald gerät der alte Mann in einen tödlichen Konflikt, hinter dem gewissenlose Politiker im fernen Washington stecken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 324
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
IN DIESER REIHE BISHER ERSCHIENEN
DER LETZTE MOUNTAIN MAN
RIO CONCHO NO. 03
WESTERN LEGENDEN
BUCH 64
ALFRED WALLON
INHALT
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Über den Autor
Dieses Buch gehört zu unseren exklusiven Sammler-Editionen
und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.
In unserem Shop ist dieser Roman auch als E-Book lieferbar.
Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt. Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.
Copyright © 2024 BLITZ-Verlag
Hurster Straße 2a, 51570 Windeck
Titelbild: Mario Heyer
Umschlaggestaltung: Mario Heyer
Logo: Mario Heyer
Satz: Torsten Kohlwey
Alle Rechte vorbehalten
www.Blitz-Verlag.de
ISBN: 978-3-7579-4890-0
9064v1
KAPITEL1
Längst war die Sonne hinter den fernen Bergen untergegangen. Nur das unruhige Flackern eines brennenden Lagerfeuers erhellte die Dunkelheit der Nacht. Buffalo Dancer, der alte Medizinmann der Lakota, blickte mit weisen Augen in die Gesichter der jungen Männer, die ihn fragend und neugierig zugleich anschauten. Weil sie wussten, dass die nächsten Tage für sie von großer Bedeutung waren. Denn es war die Zeit gekommen, wo aus den jungen Männern Krieger werden sollten.
»Wakonda ist allgegenwärtig«, sagte der alte Medizinmann und blickte gedankenverloren in die hellen Flammen. »Er wacht über unsere Welt und beschützt auch die Tiere. Zwischen ihm und der Erde befindet sich das Reich der Adler, des Donners und Blitzes sowie der Sonne und des Mondes. All diese Geister haben die Macht, auf die Erde herunterzukommen und Menschengestalt anzunehmen, wenn sie es wollen.«
Er lächelte wissend, als er die staunenden Augen der Jungen sah. Wie es jedes Mal der Fall war, wenn er den Heranwachsenden von der Welt der Geister und Götter erzählte.
»War es Wakonda, der uns P-te schickte, Buffalo Dancer?«, wollte der junge Hunts-the-Bear wissen, der auf der anderen Seite des Feuers saß und aufmerksam den Worten des alten Medizinmannes gefolgt war.
Buffalo Dancer nickte. Er sah Hunts-the-Bear lange an, bevor er fortfuhr. Weil er spürte, dass der Junge beseelt von dem Gedanken war, morgen bei Sonnenaufgang den Stamm zu verlassen und sich auf die Suche nach seiner Vision zu begeben. Genau wie die anderen Jungen, die der Medizinmann heute Abend zu sich gerufen hatte.
»P-te, der große Büffel, ist das Herz unserer Welt«, sagte Buffalo Dancer. »Er war schon hier, bevor unsere Ahnen in dieses Land kamen, und er wird noch hier sein, wenn wir schon wieder bei unseren Ahnen sind. P-te gibt uns Leben, ohne ihn gäbe es kein Volk. Es sind die Büffelgeister, die in den Körpern P-tes wohnen. Diese Seelen sind es, die den hungrigen Menschen Nahrung geben. Vergesst dies nie, wenn ihr eines Tages mit den anderen Kriegern auf die Jagd geht. Und seid dankbar für das, was euch die Büffelgeister schenken. Und nun geht und reinigt euch. Morgen ist ein wichtiger Tag in eurem zukünftigen Leben – vielleicht der bedeutsamste.«
Buffalo Dancer nickte den Jungen auffordernd zu, sich vom Feuer zu erheben und ihm zu folgen. Hinunter zum kleinen Fluss, wo die Frauen eine feste Hütte aus Weidenzweigen errichtet hatten. Nicht weit davon hatten sie ebenfalls ein kleines Feuer entzündet und erhitzten dort große Steine.
»Geht hinein und betet zu Wakonda!«, befahl Buffalo Dancer, während sich die jungen Männer auszogen und sich dann in die Weidenhütte begaben. Dann wurden die erhitzten Steine in die Hütte gebracht und mit Wasser übergossen. Dampf stieg auf, brachte die Haut der Jungen sofort zum Schwitzen. Wohltuender Geruch von Kräutern und Pflanzen hing im Raum, denn Buffalo Dancer wusste, was notwendig war, um Körper und Geist zu reinigen. Auch wenn es schon fast unerträglich heiß in der kleinen Hütte war, so harrte doch jeder der Jungen dort aus, betete schweigend zu Wakonda und den Büffelgeistern, suchte Rat und Hilfe für den kommenden Tag.
Dann erklang die Stimme des alten Medizinmanns, riss die betenden Jungen aus ihrer stummen Zwiesprache. Daraufhin verließen sie die Schwitzhütte, gingen hinunter zum Fluss und badeten in dem kalten Wasser – eine Wohltat nach der Hitze in der Hütte.
Hunts-the-Bear spürte das kalte Wasser auf seiner Haut und fror im ersten Moment noch. Dann spürte aber auch er, wie gut ihm das tat. Seinen gleichaltrigen Gefährten erging es nicht anders. Schließlich verließen sie das Flussbett wieder, zogen sich an und verließen den Zeremonienort, an dem sie sich für den morgigen Tag gestärkt hatten.
Der junge Lakota war schon ein wenig aufgeregt, denn noch nie zuvor hatte er seinen Stamm verlassen. Niemand wusste, wie lange die Suche nach seiner Vision dauern würde. Manchmal kehrten die jungen Krieger schon nach wenigen Tagen wieder zurück zum Stamm, andere wiederum brauchten viel mehr Zeit. Thunder Killer, ein Krieger aus dem Geheimbund der Dog Soldiers, war so lange vom Stamm ferngeblieben, dass kaum noch jemand vermutet hätte, dass er noch lebte. Und doch war er zurückgekommen und zählte nun zu den tapfersten Kriegern des ganzen Stammes.
Schweren Herzens begab sich Hunts-the-Bear zurück zu dem großen Tipi, in dem er und seine Gefährten die vorerst letzte Nacht verbrachten. Das Gesetz schrieb vor, dass er sich auf diese Weise von seinen Eltern löse, und wenn er zurückgekommen war, dann hatte Doe Calf, seine Mutter, ein Kind verloren, aber einen Krieger als Sohn gewonnen. Ein entscheidender Abschnitt im Leben des jungen Hunts-the-Bear.
Er hörte die Stimmen seiner Gefährten, lauschte aber nicht auf den Sinn ihrer Worte. Stattdessen fühlte er jetzt die große Müdigkeit, die von seinem Körper Besitz ergriff. Deshalb war er dankbar, als er das Tipi betrat und sich bald darauf mit einem dicken Büffelfell zudecken konnte. Sofort spürte er die wohlige Wärme, die ihn einhüllte, und schloss die Augen. Sekunden später war er bereits eingeschlafen.
* * *
Er spürte die wärmenden Strahlen von Angpetu Wi, der hellen Morgensonne, die durch das halb offene Tipi schien. Zuerst musste Hunts-the-Bear unwillkürlich blinzeln und hatte Mühe, sich in der Wirklichkeit zurechtzufinden. Denn er hatte tief und fest geschlafen.
»Ich hatte einen Traum«, erklang jetzt die Stimme von Panther, der nicht weit von Hunts-the-Bear gelegen hatte. »Ich habe Hokewingla, den Schildkrötenmann im Mond, gesehen.«
Ungläubig sah Hunts-the-Bear seinen Gefährten an, denn er selbst hatte überhaupt nicht geträumt und war natürlich jetzt ein wenig enttäuscht und von Neid erfüllt, als ihm Panther berichtete, dass Hokewingla ihm im Traum versprochen hatte, seine schützende Hand über ihn zu halten.
»Du musst Buffalo Dancer davon erzählen«, sagte Hunts-the-Bear zu ihm. »Er wird eine Antwort darauf wissen und dir sagen, was das zu bedeuten hat.«
»Es bedeutet, dass ich als großer Krieger zurückkommen werde – was sonst?«, antwortete der um einen Kopf größere Lakota und genoss nun die staunenden Blicke der anderen Jungen im Tipi. »Ihr werdet euch an meine Worte erinnern.«
Hunts-the-Bear erwiderte gar nichts, sondern verließ nun das Tipi. Draußen wartete Buffalo Dancer schon auf ihn und die anderen. Der alte Medizinmann hatte sich in seine beste Büffelrobe gehüllt. Nicht nur er, sondern auch viele andere Krieger, Frauen und Kinder waren an diesem Morgen schon früh erwacht. Denn jeder wollte den Augenblick erleben, wo die Jungen den Stamm verließen.
Hunts-the-Bear blickte hinüber zum Tipi seiner Eltern und sah dort Doe Calf, seine Mutter. Sie stand an der Seite ihres Mannes Otter Skin und lächelte ihm zu. Mehr war ihr nicht erlaubt, und Hunts-the-Bear spürte einen Stich in seinem Herzen. Aber da war auch die Freude und Hoffnung auf das, was noch vor ihm lag, und dieser Herausforderung wollte sich der junge Lakota nun stellen.
Buffalo Dancer stimmte nun einen alten Gesang an, betete anschließend zu den Heyoka, einer Gruppe von Schutzgottheiten, flehte sie an, die jungen Lakota nicht vom rechten Pfad abkommen zu lassen, und beschwor auch Anungite, das zweigesichtige Wesen, den zukünftigen Kriegern fernzubleiben. Als er seine Gesänge und Gebete schließlich beendet hatte, richtete er seine prüfenden Blicke auf Hunts-the-Bear und dessen Gefährten.
»Geht nun hinaus und sucht eure Vision!«, rief er mit lauter Stimme. »Wasicong, der Schutzgeist der Lakota, wird euer ständiger Begleiter sein. Hört auf ihn und behaltet euer Ziel vor Augen. Ihr geht als Kinder und werdet zurückkommen als Männer!«
Dann hob er beide Hände empor zum hellen Morgenhimmel und gab damit den jungen Lakota das Zeichen, das Lager zu verlassen. Ohne Waffen und ohne Nahrung, wie es das Gesetz vorschrieb, und jeder von ihnen musste seinen Weg nun allein fortsetzen.
Auch Hunts-the-Bear schaute nun noch ein letztes Mal zurück, bevor er sich auf den Weg machte. Stolz und erhobenen Hauptes ging er in Richtung Norden, wo sich in der Ferne die schneebedeckten Gipfel der Paha Sapa, der heiligen Berge der Lakota, erhoben. Er wusste noch nicht, ob er dorthin gehen sollte. Er hoffte, dass die Schutzgeister und Wakonda ihm den Weg wiesen.
Einige Krieger der Dog Soldiers begleiteten die jungen Lakota weiter hinaus in die Ebene, achteten darauf, dass sich die Jungen wirklich auch trennten und jeder von ihnen seinen Weg allein fortsetzte. Denn wer gegen dieses Gesetz verstieß und sich womöglich aus Furcht oder Zweifel einem anderen anschloss, der hatte einen Anspruch auf eine spätere Mitgliedschaft im Geheimbund der Dog Soldiers verwirkt.
Hunts-the-Bear spürte die wärmenden Strahlen der Morgensonne auf seinem bloßen Oberkörper, während der Wind durch sein langes blauschwarzes Haar fuhr. Es war ein guter Tag, denn am Morgenhimmel zeichnete sich keine einzige Wolke ab. Wakinyan, der Donner, zeigte sich heute nicht, und vielleicht auch nicht in den nächsten Tagen, ein Zeichen, das viel Gutes versprach.
Der junge Lakota beschleunigte seine Schritte, verfiel nun in einen Wolfstrott, den er schon von Kind auf gelernt hatte. Jeder heranwachsende Junge im Stamm lernte so früh wie möglich das schnelle Laufen, auch auf lange Distanz über. Hunts-the-Bear war schon immer ein guter und ausdauernder Läufer gewesen. Das würde ihm sicherlich jetzt zugutekommen.
Das grüne Gras der weiten Plains reichte ihm bis zu den Knien. Irgendwo weit jenseits des Horizontes erstreckte sich das Reich P-tes, des zottigen Büffels. Hunts-the-Bear wusste, dass die großen Herden bald auch in dieses Gebiet kommen würden. Und dann würde die große Jagd beginnen, vielleicht auch mit ihm als Krieger.
* * *
Der einsame Reiter zügelte sein Pferd auf einer Anhöhe und blickte hinaus auf die weite Ebene, die sich vor seinen Augen erstreckte. Fast endlos erschien ihm das Grasmeer, das vom Wind bewegt wurde. Es kam ihm vor, als sei er wirklich der letzte Mensch auf Gottes Erdboden, denn die weiße Zivilisation lag irgendwo weit jenseits des Horizontes im Süden hinter ihm zurück.
Ezekiel Calhoun vermisste die Zivilisation nicht. Die letzten Jahre über hatte er unten in New Mexico, in Taos gelebt und war dort mehr schlecht als recht über die Runden gekommen. Deshalb hatte er seine wenigen Habseligkeiten einfach zusammengepackt und war dann sang- und klanglos von Taos nach Norden aufgebrochen. Sein Ziel waren die Great Plains, die weiten Ebenen, die Heimat der großen Büffelherden und des Volkes der Lakota.
Ezekiel Calhoun stieg mühsam aus dem Sattel, denn er hatte schon lange das sechzigste Lebensjahr überschritten. Ein Alter, wo man sich eigentlich zurückziehen und den Lebensabend in Ruhe genießen sollte. Aber Ezekiel zählte sich selbst weiß Gott nicht zum alten Eisen. In seiner Zeit als Trapper und Pelzjäger war er schon einmal in den Black Hills gewesen, hatte dort Biberfallen aufgestellt, war auch bei so mancher Expedition weißer Entdecker als Scout mit dabei gewesen. Er kannte das Land, das er jetzt erreicht hatte, und wusste, dass sein Ziel nicht mehr weit entfernt war.
Irgendwo jenseits des weiten Grasmeeres würde er schon sehr bald die ersten Ausläufer der majestätischen Black Hills sehen; die Lakota nannten sie Paha Sapa, die heiligen Berge. Ein Flecken Erde, wo noch kein Weißer Fuß gefasst hatte. Eine Landschaft, die noch so war, wie sie Gott einst vor Ewigkeiten geschaffen hatte.
Ezekiel fühlte die Hitze der Sonne, die den Zenit bereits erreicht hatte. Seine Kehle war staubig und trocken nach diesem langen Ritt. Deshalb nahm er die Wasserflasche vom Sattelhorn, schraubte sie auf und nahm einen Schluck. Er schüttete auch etwas in seinen alten zerbeulten Hut und gab dann dem Pferd zu trinken, das ihn bis hierhergebracht hatte.
Während das Pferd gierig soff, brachen die Gedanken des alten Fallenstellers plötzlich ab. Denn auf einmal hörte er ein leises Donnern, das aus Richtung Norden kam. Unwillkürlich blickte er hinauf zum blauen Himmel. Aber der war wolkenlos, und kein Anzeichen eines Wetterumschwungs war in Sicht.
Dann wurde der Donner lauter und auch heftiger. Das Pferd schien auf einmal auch zu spüren, dass da etwas nicht stimmte, und fing an zu schnauben.
Von einer dumpfen Ahnung beseelt, zog Ezekiel ein altes Armeefernrohr aus der Satteltasche, das ihm schon oft gute Dienste geleistet hatte. Er spähte hindurch, blickte nach Norden in Richtung des weiten Horizontes und sah auf einmal eine kleine Staubwolke. Sofort wurde ihm klar, was das bedeutete. Hastig verstaute er das Fernrohr wieder in der Satteltasche, stieg wieder auf den Rücken des Pferdes und griff dann hastig nach den Zügeln.
»Los, Alter!«, rief er dem Pferd zu und gab dem Tier die Zügel frei. »Jetzt musst du rennen, was das Zeug hält!«
Das Pferd streckte sich, fiel aus dem Trab wenige Sekunden später in einen raschen Galopp. Ezekiel wusste jetzt, was die Staubwolke bedeutete. Eine Büffelherde war es, die mit ihren Hufen den Boden der Prärie zum Erzittern brachte. Eine riesige Herde kam von Norden und würde alles niederwalzen, was ihr im Wege stand!
Ezekiel wusste, was das bedeutete. Wenn er es nicht schaffte, mit seinem Pferd rasch Land zu gewinnen, dann würde ihn die Herde einholen und ihn in Grund und Boden stampfen, bis nichts mehr von ihm übrig war.
Das Tier schien zu ahnen, in welch großer Gefahr sie steckten. Es galoppierte, als sei der Leibhaftige hinter ihm her, während die Staubwolke am fernen Horizont schon beängstigend groß geworden war. Mittlerweile schälten sich auch schon die ersten zottigen Büffel aus dem Staub, preschten weiter auf dem Weg durch die Grasebene. Ezekiel lenkte sein Pferd, so gut er konnte. Sein Herz raste, als er sich vorstellte, unter die Hufe der Büffel zu geraten. Nein, so wollte er nicht sterben.
Er dirigierte sein Pferd weiter nordwestlich, versuchte, höheres Gelände zu erreichen. Wieder einmal erwiesen sich seine Vermutungen als richtig. Weiter drüben, vielleicht noch gut drei Meilen entfernt, zeichneten sich die Umrisse einer Hügelgruppe ab, die von einigen Felsen umrahmt wurde. Das Gelände dort lag etwas höher und war auch nicht mehr so flach wie die Ebene, die er jetzt durchquerte. Instinktiv spürte er, dass dies die Rettung sein konnte. Das Pferd musste nur noch bis dorthin durchhalten.
Schweißflocken zeichneten sich auf dem Fell des erschöpften Tieres ab, aber es streckte sich noch einmal, gab alles, was es konnte. Der alte Fallensteller war sehr erleichtert, als das Pferd schließlich das höher gelegene Gelände und wenige Minuten später auch die schützenden Felsen erreichte. Sofort stieg Ezekiel aus dem Sattel, zog das Tier weiter in die schützende Deckung und wagte es dann erst, sich umzudrehen.
Unter normalen Umständen wäre es ein Bild gewesen, das von so einmaliger und unbeschreiblicher Schönheit kündete, dass man Mühe hatte, diese Eindrücke in Worte zu fassen. Denn unten in der Ebene donnerte jetzt die riesige Büffelherde vorbei, wirbelte Unmengen von Staub auf, die sogar das Licht der Sonne verdunkelten. Der Boden erzitterte, und das Dröhnen ließ den alten Fallensteller zusammenzucken. Er war buchstäblich im letzten Moment den Büffeln entkommen, hatte sich in Sicherheit bringen können. Trotzdem hielt er seine alte Hawken Rifle griffbereit, denn er wollte lieber sichergehen, falls sich von der großen Herde einige Tiere absonderten und ihren Weg in der Nähe der Felsen fortsetzten. Wäre das der Fall gewesen, dann hätte sich der alte Fallensteller in einer schlimmen Falle befunden. Denn vereinzelte Tiere konnten es fertigbringen, einen großen Teil der Herde mit sich zu reißen – und dann hätten auch die wenigen Felsen, die Ezekiel jetzt noch Deckung boten, ihn nicht mehr vor einem qualvollen Tod bewahrt.
Aber der Sensenmann wollte ihn wohl noch nicht. Es ging alles gut, und die Büffelherde blieb zusammen, donnerte weiter durch die Grasebene. Ezekiel Calhoun verlor jegliches Zeitgefühl, während er Unmengen von Staub entgegengeschleudert bekam. Die Welt tauchte ein in einen braunen Nebel, und die Luft zum Atmen wurde knapp. Die Sonne wurde verdeckt von dem allgegenwärtigen Staub, und für jemanden, der so ein Naturereignis einer vorbei stürmenden Büffelherde noch nie gesehen hatte, konnte es so vorkommen, als ob die Welt unterging. Tausende von zottigen Tieren bahnten sich ihren unaufhaltsamen Weg durch die Prärie!
Stunden vergingen, wurden zu quälenden Ewigkeiten. Dann ebbte der stetige Donner schließlich ab, und der Staub ließ nach. Ezekiel blinzelte, erhob sich langsam aus seiner Deckung und spähte hinunter in die Ebene, wo jetzt die letzten Tiere der großen Herde vorbeipreschten. Erst dann lichtete sich der Staub wieder, und die Sonne kam durch.
Eine breite erdbraune Schneise hatte sich im Grasmeer der Prärie gebildet, markierte den Weg, den die große Herde genommen hatte. Ezekiel hustete, weil der Staub in seiner Kehle saß und dort unangenehm juckte. Aber er war noch am Leben, und nur das zählte. Schließlich verließ er seine Deckung und stieg wieder in den Sattel des Pferdes. Sein Weg führte ihn in die Richtung, aus der die große Büffelherde gekommen war, weiter hinein ins Herz des Landes, das er schon als junger Fallensteller kennengelernt hatte.
KAPITEL2
»Unglaublich«, murmelte der untersetzte aschblonde Mann, als er seine Blicke hinunter ins Tal richtete und dort die große Büffelherde entdeckte. »Das müssen ja Tausende sein.« Er hatte Mühe, Herr über seine momentane Aufregung zu werden. »Sind Sie auch sicher, dass die Tiere weder uns noch die Pferde wittern, Sturgess?«
»Ganz sicher, Mister Winslow«, erwiderte der Angesprochene, der neben dem Engländer im hohen Gras der Prärie kauerte und die Büffel in der Ebene beobachtete. »Die Tiere sind ziemlich dumm und werden auch gar nicht begreifen, was jetzt gleich geschehen wird. Sie werden ein wahres Schützenfest veranstalten können, Sir.«
»Umso besser«, erwiderte Stuart Winslow mit einem breiten Grinsen. Der Engländer fühlte das Jagdfieber in sich und konnte seinen Tatendrang kaum noch bremsen. Nun konnte er endlich das in die Tat umsetzen, was er sich vorgenommen hatte, nämlich auf Büffeljagd zu gehen.
Stuart Winslow war ein sehr vermögender Mann, der sein Geld mit Tee aus Indien gemacht hatte. Die weite Reise über den Atlantischen Ozean hatte er angetreten, weil in den britischen Zeitungen so viel Faszinierendes über den unermesslichen Kontinent Amerika gestanden hatte. Winslow hatte weder Kosten noch Mühe gescheut und sich deshalb zu einer Expedition in den Westen Amerikas entschlossen. Gab es denn etwas Schöneres, als in diesem weiten Land auf Jagd zu gehen und die Herausforderung zu suchen?
Der hagere Jake Sturgess ahnte etwas von den Gedanken des Engländers. Ihm war es im Grunde genommen völlig egal, weshalb Winslow diese Reise angetreten hatte. Was für ihn am wichtigsten war, das war der gute Lohn, den Winslow ihm und seinen Freunden zahlte. Mochte dieser reiche Spinner doch so viel Büffel abschießen, wie er wollte. Wenn er darin seine Erfüllung fand, dann wäre Sturgess der Letzte gewesen, der etwas dagegen gehabt hätte.
»Ich hole jetzt die anderen«, sagte Jake Sturgess zu Winslow. »Warten Sie hier und unternehmen Sie erst etwas, wenn ich wieder zurück bin.«
»In Ordnung«, versicherte ihm der Engländer und blickte sehnsüchtig nach der großen Sharpsflinte, die griffbereit neben ihm auf dem Erdboden lag. Auch wenn es ihm schwerfiel, noch zu warten, so sah er ein, dass Sturgess recht hatte. Umso größer würde der Spaß sein, wenn er bald das Feuer auf die Büffelherde eröffnete.
Seine Gedanken brachen ab, als er leise Schritte hinter sich hörte. Dann erkannte er Jake Sturgess und dessen Gefährten. Es waren vier Männer, die allesamt recht heruntergekommen wirkten. Das Einzige an ihnen, was wirklich tadellos gepflegt war, das waren die Waffen der Männer.
Der Engländer wusste nicht mehr über sie als ihre Namen: Tom Bailey, Jeff Sullivan, Hadley Brackett und Duff Warner. Er hatte sie zusammen mit Sturgess in Fort Sedgewick angeheuert, und seitdem bildeten sie eine Gemeinschaft. Es waren schweigsame, meist recht zurückhaltende Kerle. Sie befolgten aber Winslows Befehle, auch wenn der Engländer aufgrund seiner noblen Kleidung hier draußen in der Prärie wie ein Fremdkörper wirkte. Denn obwohl es recht heiß war, hatte Winslow den Kragen seines weißen Hemdes noch zugeknöpft, so, wie es ein britischer Gentleman in den Londoner Salons tat, wenn er mit der Oberen Gesellschaft verkehrte.
Der dicke Duff Warner blieb bei den Pferden und dem Wagen, in dem der Engländer all das mittransportierte, das ihm auch hier draußen einen gewissen Luxus verschaffte. Tafelgeschirr und silbernes Besteck, um nur ein Beispiel zu nennen. All das befand sich gut 200 Yards entfernt. Schließlich sollten die ahnungslosen Büffel keine Fremdwitterung zu spüren bekommen.
Winslow sah, wie Sturgess den anderen einige kurze Zeichen gab, und sie gingen daraufhin in Stellung, hielten ebenfalls ihre Gewehre bereit. Natürlich würden sie auch diese Chance nutzen und sich bei diesem Schützenfest beteiligen. Es waren genügend Büffel zum Abschießen da – und zwar weitaus mehr, als sie an Munition besaßen.
Dann nahm der Engländer die Sharps an sich. Es war eine schwere Waffe, deren Gewicht man spüren konnte. Deshalb benötigte Winslow eine Gabel, die er in die braune Erde steckte, um mit deren Hilfe seine Ziele besser anvisieren zu können.
»Ich feuere den ersten Schuss ab«, sagte Winslow mit einer Gier in der Stimme, die er nicht mehr verbergen konnte. »Zuerst ich, dann kommt ihr, hat das auch jeder verstanden?«
Er war viel zu erregt in diesem Moment, als dass ihm aufgefallen wäre, dass einige von Sturgess’ Männern ihm einen wütenden Blick zuwarfen. Stattdessen konzentrierte er sich ganz auf die Büffel, die ihm am nächsten waren. Er visierte ein besonders starkes und prächtiges Tier an, eine Büffelkuh, die friedlich graste und nicht ahnte, dass der Tod in der Nähe war.
Winslow zielte lange, bevor er abdrückte. Dann bellte der Schuss in der Mittagshitze auf, und die Kugel traf die Büffelkuh direkt über dem Höcker, wo sich die verwundbarste Stelle des Tieres befand.
Wenige Sekunden vergingen, dann brach das Tier plötzlich mit den Hinterläufen ein und fiel. Das Büffelkalb, das dicht neben seiner Mutter gegrast hatte, schien überhaupt nicht zu begreifen, was gerade geschehen war. Es tappte auf die tote Büffelkuh zu und stieß sie an.
Das war der Moment, wo Winslows zweite Kugel ihr Ziel traf und das Kalb ebenfalls tötete. Daraufhin begannen auch Jake Sturgess und die anderen mit dem Feuer auf die Büffelherde. Das Donnern von Sharpsflinten erfüllte das abgeschiedene Tal. Büffel brachen zusammen, stießen Blutfontänen aus, bevor sie starben. Es war ein gnadenloses Abschlachten, in dessen Verlauf die Läufe der Flinten heiß wurden. Das hinderte die Männer aber nur für einen kurzen Moment, ihr blutiges Handwerk fortzusetzen. Sie gossen Wasser über die Flintenläufe und visierten Sekunden später schon das nächste Ziel an.
Noch nicht einmal eine Viertelstunde war vergangen, seit Stuart Winslow den ersten Schuss abgegeben hatte. Aber mittlerweile säumten die Kadaver von mehr als fünfzig Büffeln die Prärie, und in die große Herde geriet auf einmal Unruhe. Der Geruch des Blutes brachte die zottigen Riesen dazu, unruhig mit den Hufen zu scharren. Diese Nervosität griff auf immer mehr Tiere über, und schließlich donnerte die Herde los, voller Panik über das plötzliche Sterben der Tiere. Sie konnten einfach nicht erkennen, dass die Weißen in dieses Land gekommen waren, und dass das Schlachten der Büffelherden zu einem der größten Geschäfte werden würde. Aber all das lag noch in der Ferne.
»Verdammt!«, entfuhr es dem Engländer, als er sah, wie die Büffelherde die Flucht ergriff. Sofort lud er die Sharpsflinte noch einmal auf und schaffte es, noch zwei weitere Tiere zu erlegen, bis eine große braune Staubwolke ein genaueres Zielen unmöglich machte.
Auch die Gewehre der anderen Männer verstummten jetzt. Ihre Gesichter waren geschwärzt vom Pulverrauch, als sie sich erhoben und hinunter in die Ebene blickten, wo die toten Büffel lagen. Eben noch war es ein Bild von majestätischer Schönheit gewesen, jetzt bot sich ihren Augen nur noch der Tod dar. Aber weder Stuart Winslow noch seine Begleiter sahen das so. Sie waren vom Jagdfieber gepackt und wollten nun ihren Triumph genießen.
Der Engländer rannte jetzt hinüber zu der Büffelkuh, die er zuerst erlegt hatte. und betrachtete stolz seine Beute von allen Seiten. Aus nächster Nähe sah das Tier noch größer und stärker aus, und doch war es von einer einzigen Kugel gefällt worden! Genau wie die anderen Tiere in der Grasebene.
Winslow verspürte ein wildes Gefühl des vollkommenen Triumphes, als er die toten Büffel betrachtete.
»Das ist es, was ich wollte«, murmelte er und trat dicht zu der erlegten Büffelkuh, stellte sich stolz in Positur und präsentierte dabei das Gewehr wie ein Oberbefehlshaber einer glorreichen Armee.
»Der Mensch hat über das Tier gesiegt!«
Jake Sturgess sagte überhaupt nichts dazu, sondern ließ lieber seine Blicke in die Runde schweifen. Schließlich waren die Great Plains die Heimat zahlreicher Indianerstämme. Und es war gut möglich, dass man die donnernden Schüsse gehört hatte.
Der Revolvermann spähte hinüber zu den gegenüberliegenden Hügeln und den wenigen Büschen, die dort wuchsen. Irgendwie glaubte er sich von einem unsichtbaren Augenpaar beobachtet und konnte sich noch nicht einmal erklären, warum das so war. Aber dieses Gefühl blieb und wollte nicht mehr weichen.
»Tom«, wandte er sich dann an seinen Kumpan Bailey. »Geh rüber zur anderen Seite und sieh zu, dass du ungesehen zu den Hügeln da vorn kommst. Ich glaube, wir haben Besuch bekommen.«
Dem schwarzhaarigen Bailey brauchte er das nicht zweimal zu sagen. Der hatte sofort begriffen, was auf dem Spiel stand. Auch die anderen hielten ihre Gewehre griffbereit und waren nun auf alles gefasst. Nur Stuart Winslow wusste im ersten Moment nicht, was Sturgess beabsichtigte.
»Ganz ruhig, Sir«, sagte Sturgess nun rasch zu ihm. »Benehmen Sie sich ganz normal und freuen Sie sich über Ihren Jagderfolg. Alles andere überlassen Sie am besten uns.«
Winslow nickte, fühlte sich aber dennoch ein wenig mulmig. Weil er von den Roten schon viel gehört, aber noch nichts gesehen hatte.
Schließlich hielten sie sich alle in einem Land auf, wo man damit rechnen musste, auf Indianer zu stoßen, auch auf solche, die den Weißen alles andere als freundlich gesinnt waren. Aber Stuart Winslow fürchtete sich nicht. Mit den Waffen, die sie alle besaßen, glaubte er, notfalls einen ganzen Stamm in die Flucht jagen zu können. Er konnte aber jetzt noch nicht wissen, dass sein Schicksal bereits schon vorgezeichnet war, seit er diese Expedition gestartet hatte.
* * *
Er hörte das rollende Echo von donnernden Schüssen und hielt sofort inne. Sofort blickte er über das weite Grasmeer in Richtung Norden. Irgendwo dort am weiten Horizont geschah etwas, was den jungen Hunts-the-Bear stark beunruhigte. Der junge Lakota, der vor zwei Tagen seinen Stamm verlassen hatte, um seine Vision zu finden, fiel wieder in den Wolfstrott und hielt auf die Stelle zu, von wo er die Schüsse vernommen hatte. Wenige Augenblicke später sah er den großen Wagen und einen weißen Mann in einiger Entfernung. Es waren fünf Pferde außer den beiden Tieren, die den Wagen zogen. Also mussten sich noch weitere Weiße hier aufhalten.
Hunts-the-Bear duckte sich jetzt tief ins Gras. Er hatte erst einmal in seinem jungen Leben Weiße gesehen. Das waren Trapper und Fallensteller gewesen, die in dieser Gegend gejagt hatten. Aber das lag schon einige Jahre zurück, und der Mann da drüben beim Wagen sah nicht wie ein Fallensteller aus. Er wirkte stattdessen gefährlich und irgendwie bedrohlich, ohne dass Hunts-the-Bear dies hätte erklären können.
Es war sein Instinkt, der ihn davor warnte, sich den Weißen zu zeigen und stattdessen lieber in Deckung zu bleiben. Stattdessen schlich er sich seitlich an dem Wagen und den Pferden vorbei, um die Ursache der Schüsse zu ergründen, die unvermittelt anhielten und die friedliche Stille des Tages zerstörten.
Augenblicke später erstarrte Hunts-the-Bear fast das Blut in den Adern, als er von einigen Büschen verborgen das schreckliche Bild unten in der Ebene sah. Die Weißen veranstalteten ein grauenhaftes Abschlachten unter der Herde, die friedlich graste. Der junge Lakota sah, wie die Tiere unter den Schüssen zusammenbrachen und die Herde so unruhig wurde, dass sie schließlich mit donnernden Hufen die Flucht ergriff.
Fassungslos blickte Hunts-the-Bear auf die getöteten Büffel und konnte einfach nicht verstehen, warum das die Weißen getan hatten. Hungerten sie denn so sehr, dass sie gleich so viele Tiere erlegen mussten? Waren noch mehr Weiße irgendwo da draußen, für die diese Tiere bestimmt waren? Fragen, auf die der junge Lakota in diesem Moment keine Antwort bekam.
Er sah nun, wie die Weißen hinunter zu den getöteten Büffeln gingen. Einer von ihnen postierte sich stolz vor der Jagdbeute und lachte so laut, dass es auch Hunts-the-Bear von hier oben klar und deutlich hören konnte. Aber er verstand nicht, weshalb die Weißen jetzt nicht damit begannen, die erlegten Tiere abzuhäuten und das Fleisch sicherzustellen. Keiner von ihnen schien dies tun zu wollen. Aber warum hatten sie dann diese vielen Büffel getötet? P-te, der zottige Riese, gab doch Nahrung für ein ganzes Volk. Wenn diese Weißen das nicht brauchten, weshalb hatten sie dann dieses sinnlose Morden veranstaltet?
Hunts-the-Bear musste seinem Stamm davon berichten. Buffalo Dancer und sein Vater Otter Skin mussten unbedingt erfahren, was hier geschehen war. Denn wenn die Weißen noch mehr Büffel töteten, dann zerstörten sie das Gleichgewicht der Natur, das für die Lakota lebenswichtig war.
Auf einmal hörte er ein leises Geräusch hinter sich. Sofort drehte er sich um und sah zu seinem großen Schrecken auf einmal einen Weißen, der mit dem Gewehr in Anschlag nur wenige Schritte von ihm entfernt stand. In den Augen des Büffeltöters leuchtete der Hass, als er auf Hunts-the-Bear zielte und dabei glucksend lachte.
Der junge Lakota sprang in Panik auf und wollte fliehen. Aber in diesem Moment fiel der Schuss. Gleichzeitig versetzte eine unsichtbare Faust Hunts-the-Bear einen harten Schlag am Kopf. Eine gewaltige Schmerzwelle erfasste ihn und löschte sein Bewusstsein von einem Atemzug zum anderen aus. Er spürte gar nicht mehr, wie er taumelte und dann zu Boden fiel.
* * *
»Habe ich dich erwischt, du Bastard!«, sagte der schwarzhaarige Tom Bailey grinsend und setzte das Gewehr ab, mit dem er den Roten niedergeschossen hatte. Er ging einige Schritte auf die leblose Gestalt im Gras zu und vergewisserte sich noch einmal, dass von dem Indianer keine Gefahr mehr drohte. Die Anspannung in ihm legte sich Sekunden später, als er erkannte, dass er den Burschen wirklich erwischt hatte. Sein Kopf war eine einzige Wunde, und er rührte sich auch nicht mehr.
»Tom, was ist?«, erklang jetzt die Stimme von Jake Sturgess unten aus der Senke.
»Ich habe ihn erwischt, Jake!«, rief der Revolvermann nun lachend zurück, damit seine Gefährten Bescheid wussten. »Es war nur ein junger Bursche. Jetzt hat er eine Kugel im Kopf!«
Bei diesen Worten warf er noch einen letzten Blick auf den toten Indianer. Er spuckte verächtlich aus, wandte sich dann ab und ging wieder zurück zu den anderen.
»Sag mal, hast du denn gar nichts davon bemerkt, dass sich ein Roter angeschlichen hat?«, wollte Sturgess nun von Duff Warner wissen, der zuerst bei den Pferden geblieben war, jetzt aber auch bei den anderen stand. »Mann, das hätte gefährlich werden können, ist dir das eigentlich klar?«
Warner biss die Zähne zusammen und sah betreten zu Boden. Es war ihm sichtlich unangenehm, dass Sturgess ihm solche Vorwürfe machte.
»Ich habe ihn wirklich nicht gesehen, Jake«, antwortete Warner dann. »Verdammt, diese Roten sind wie Katzen. Man merkt es erst, wenn sie schon da sind.«
»Schon gut«, sagte Sturgess, für den die Sache damit erledigt war. »Aber wir sollten zusehen, dass wir jetzt aufbrechen. Wir wissen nicht, ob noch mehr Indianer in der Nähe sind.«
»Eine gute Idee, Sturgess«, ergriff nun auch der Engländer das Wort, den der Tod des jungen Lakota überhaupt nicht berührte. Vielleicht auch deswegen, weil er in der roten Rasse ohnehin nichts Menschliches sah.
»Gut, dann sind wir uns ja einig«, meinte der hagere Revolvermann abschließend und nickte seinen Gefährten zu. Wenig später hatten die Männer die Stätte des Grauens wieder verlassen und setzten ihren Weg in nördlicher Richtung fort. Zurück blieben die Kadaver der Büffel und ein junger Lakota, den man für tot hielt.
* * *
Er sah Anungite, das zweigesichtige Wesen aus dem Reich der Dunkelheit, das sich ihm näherte. Ein dumpfer hämmernder Schmerz erfasste seinen Kopf und ließ ihn laut stöhnen. Hunts-the-Bear sah alles wie durch einen milchigen Schleier und erkannte den roten Rock des Geistwesens, das nun immer näherkam und jetzt nur noch wenige Schritte von ihm entfernt war.
»Geh«, murmelte der schwer verletzte Lakota mit schwacher Stimme. »Noch bin ich am Leben, und ich werde es bleiben.«
Aber Anungite schien sich von dieser Drohung nicht abschrecken zu lassen. Das Wesen ging noch näher auf Hunts-the-Bear zu und beugte sich nun über ihn. Erst dann erkannte der junge Lakota, dass es nicht Anungite war, sondern ein weißer Mann mit eisgrauen Haaren und einem sonnenverbrannten, von vielen Falten und Furchen gekennzeichneten Gesicht.
»Ich bin nicht Anungite, mein Junge«, sagte der Weiße nun zum Erstaunen des anderen im Stammesdialekt der Lakota. »Ich bin aus Fleisch und Blut und werde dir jetzt helfen. Bewege dich nicht, es ist eine böse Wunde. Ich muss sie erst versorgen.«
Nun wichen auch die letzten Schleier vor den Augen des Verletzten, und er sah die Gestalt des in einen roten Jagdrock gekleideten Weißen ganz deutlich. Er sah auch, wie ihm der Weiße zulächelte, und das half ihm, sich etwas zu entspannen. Denn wenn ihn dieser Mann hätte töten wollen, dann wäre das sicherlich schon längst geschehen.
Ezekiel Calhoun ging zurück zu seinem Pferd, das er nur wenige Schritte von dem verletzten Lakota an einem Strauch angeleint hatte, und holte dann die Wasserflasche. Er goss etwas davon auf ein Tuch, das er aus der Satteltasche geholt hatte, und reinigte dann notdürftig die Kopfwunde des jungen Lakota, der sich bemühte, seinen Schmerz nicht zu deutlich zu zeigen. Trotzdem entrang sich ihm doch hin und wieder ein leises Stöhnen, ein deutliches Zeichen, wie schlecht es ihm ging.
Der alte Fallensteller hatte den Verletzten vor einer guten halben Stunde entdeckt, als er dem Büffelpfad weiter nach Norden gefolgt war. Schon von Weitem hatte er die kreisenden Bussarde am Himmel gesehen und sofort geahnt, dass er hier entweder ein verendetes Wild oder einen Toten vorfinden würde. Er war dann wenig später auf beides gestoßen, auf die Kadaver von Büffeln und auf den verletzten Indianer.
Im ersten Moment hatte er den jungen Lakota auch für tot gehalten, denn die Kopfwunde hatte ziemlich schlimm ausgesehen. Umso erleichterter war er aber, als er feststellen musste, dass der Junge noch lebte. Jedoch benötigte er so rasch wie möglich Hilfe und eine gute Pflege, und die konnte er nur bei seinem Stamm bekommen.
»Wer bist du?«, fragte ihn Hunts-the-Bear mit schwacher Stimme, als er sah, wie der alte Mann das Tuch in zwei Streifen riss und ihm dann einen Kopfverband anlegte. »Warum tust du das?«
»Warum wohl?«, brummte der alte Fallensteller kopfschüttelnd. »Weil ich dir helfen will. Oder willst du jetzt schon die Reise in die ewigen Jagdgründe antreten? Dafür bist du entschieden zu jung, wie ich meine. Deshalb bringe ich dich jetzt zurück zu deinem Stamm. Und um auf deine Frage zu antworten, ich heiße Ezekiel Calhoun. Sag mir deinen Namen, Junge.«
Hunts-the-Bear antwortete nun und erzählte dem alten Fallensteller, dass er seinen Stamm vor Kurzem verlassen hatte, um sich auf die Suche nach seiner Vision zu begeben. Er berichtete Ezekiel, wie er auf die Büffeljäger gestoßen war und was diese für ein Blutbad angerichtet hatten.
»Du bist auch ein Weißer«, fuhr der junge Lakota nun fort. »Aber du gehörst nicht zu diesen Mördern, die P-te töten. Ich kann in deine Augen sehen und glaube dir, was du gesagt hast. Der Stamm muss erfahren, was hier geschehen ist und ...«
»Das wird er, mein Junge«, unterbrach ihn der alte Fallensteller. »Bleib hier liegen und beweg dich nicht. Ich baue unterdessen einen Travois für dich, und dann bringe ich dich zu deinem Stamm. Lebt der alte Buffalo Dancer noch?«
Hunts-the-Bear blickte Ezekiel Calhoun erstaunt an. Nie im Leben hätte er damit gerechnet, dass der alte Mann jemanden vom Stamm der Lakota kannte. Ezekiel bemerkte den Blick des Verletzten und grinste.





























