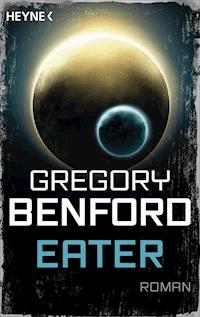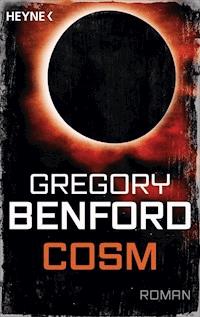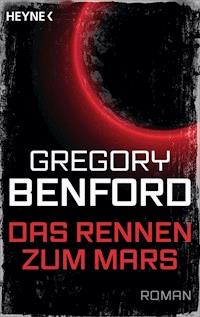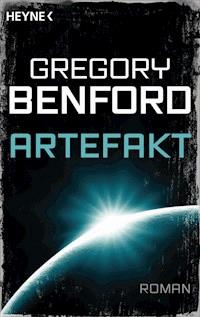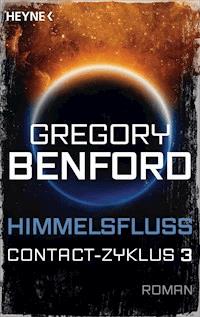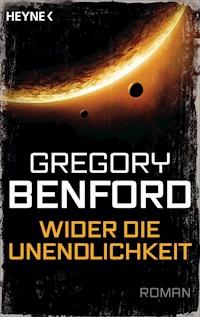5,99 €
5,99 €
oder
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Wohin führt uns die Technik?
Die nahe Zukunft: Die Welt steht vor dem ökologischen Kollaps. Eine Gruppe von Wissenschaftlern versucht, eine Botschaft in die Vergangenheit zu senden, damit dort die Ursachen der Katastrophe beseitigt werden können. Doch das gewagte Unterfangen hat verheerende Folgen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 700
Veröffentlichungsjahr: 2009
3,8 (18 Bewertungen)
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Der Autor
Vorwort
ZEITSCHAFT
Kapitel 1
Kapitel 2
Copyright
Das Buch
Die Zukunft: Die Welt steht vor dem ökologischen Kollaps. Eine Gruppe von Wissenschaftlern versucht, mit Hilfe von Tachyonen eine Botschaft in die Vergangenheit zu senden, damit dort die Ursache der Katastrophe beseitigt werden kann. Zwar wird die Botschaft tatsächlich im Jahr 1962 in Kalifornien empfangen, aber zunächst erkennt keiner der beteiligten Wissenschaftler, dass es sich bei den aufgefangenen Signalen um eine Nachricht aus der Zukunft handelt - mit fatalen Folgen …
Gregory Benfords mehrfach preisgekröntes »Zeitschaft« gilt als einer der besten Science-Fiction-Romane der letzten Jahrzehnte: Kaum ein anderes Buch stellt ähnlich überzeugend die Welt der Naturwissenschaftler dar, ihre Triumphe und Niederlagen - und ihre Visionen, die unser Verständnis vom Universum völlig verändern.
Der Autor
Der Amerikaner Gregory Benford, geboren 1941 in Alabama, studierte Theoretische Physik in Deutschland und Kalifornien, bevor er 1965 mit seiner ersten SF-Story Furore machte. Meisterhaft verbindet er in seinen Romanen komplexe wissenschaftliche Zusammenhänge mit dramatischen Handlungen. Benford lehrt und forscht an der University of California, Irvine.
Vorwort
von Jack McDevitt
Im Laufe des letzten Jahrhunderts oder so hatten die Physiker mit uns Übrigen eine Menge Spaß. Sie haben uns erzählt, dass wir im Keller mehr wiegen als auf dem Dach, dass die Zeit schneller abläuft, wenn wir dem Bus hinterher rennen, als wenn wir auf ihn warten. Sie behaupten, der Raum könne wie Gummi gekrümmt und gedehnt werden. Ohne eine Miene zu verziehen, behaupten sie, egal, wie genau wir hinschauen, wir könnten über den exakten Ort eines Elektrons niemals Gewissheit haben. Und dann ist da noch diese Katze, weder tot noch lebendig, die darauf wartet, dass wir den Kasten öffnen …
Die meisten von uns nehmen derlei Dinge kaum zur Kenntnis, hauptsächlich, weil Physiker sie füreinander beschreiben, und zwar in einer Sprache, die dem Rest der Welt kaum verständlich ist. Zudem widersprechen viele von diesen Konzepten schlechthin dem gesunden Menschenverstand. Schließen Sie die Kühlschranktür, und das Licht geht nicht aus, sondern in eine Art neutralen Zustand über. Schlimmer noch, wir sind außerstande, uns manche von diesen Effekten bildlich vorzustellen. Wenn die Leute anfangen, von fünf oder sechs zusätzlichen Raumdimensionen zu reden, verkriechen sich die meisten von uns unterm Bett.
Und das ist der Punkt, wo Versuche, Wissenschaftler bei der Arbeit darzustellen, meistens mit der Realität kollidieren. Wenn Schriftsteller Forscher bei der Arbeit darstellen wollen, wie sie mitten im Prozess einer Entdeckung stecken, müssen die meisten auf die Bemerkung zurückgreifen, der Professor trage einen weißen Laborkittel und neige zur Vergesslichkeit. Oder er sei geistig verwirrt und komme nicht darüber hinweg, dass man ihm vor ein paar Jahren für diese Schwerkraftsache keinen Nobelpreis verliehen hat. Uns fehlt einfach die Erfahrung, die man für eine genaue Darstellung von Forschern benötigt; unsere Wahrnehmung ist von dem vernebelt, was wir im Kino sehen, und unser Verständnis für wissenschaftliche Abläufe ist so gut wie nicht vorhanden. Wenn Wissenschaftler in der Literatur nicht gerade Magnetrepulsatoren entwickeln, die später hoffnungslos aus dem Ruder laufen, dann waten sie selbstlos in tiefes Wasser und kommen mit Lösungen für Probleme wieder heraus, die für gewöhnliche Sterbliche unüberwindlich scheinen. Die halbe Menschheit liegt mit einem Virus von einem völlig neuen Typ darnieder? Wartet, in einer Stunde haben wir ein Impfserum für euch.
Daher sind, wenn Wissenschaft und Literatur zusammenkommen, die Ergebnisse oft oberflächlich: Die feindliche Flotte, obwohl nach Anzahl und Feuerkraft weit überlegen, wird mit einer schlauen Taktik hinweggefegt; das außerirdische Ding lässt man durch eine magnetische Falltür fallen; nach der Bruchlandung wird die Mannschaft in letzter Minute von einer Welt gerettet, die im Begriff ist, in einen Gasriesen zu stürzen (passiert nicht alles in letzter Minute?).
Jeder ehrgeizige Schriftsteller würde gern eine exakt umgesetzte Suche nach einer neuen Erkenntnis über die Funktionsweise des Weltalls liefern. Nichts kommt dem Triumphgefühl gleich, das diese Art Erfolg begleitet; und sei es ein Teilerfolg. Warum also sehen wir so etwas nicht öfter? Weil zu wenige von uns das Zeug haben, so etwas zu bieten.
Es ist einfacher, den Prozess zu übergehen, der im Idealfall genau das ist, wovon Science Fiction handelt. Ich verlange nicht, dass die Geschichte den Leser mit Messwerten der Magnetresonanz und Strahlungsfluktuation überfällt. Aber wenn wir wirklich über das Wesen von Entdeckungen schreiben wollen, wenn es im Kern der Science Fiction genau darum geht, dann kompromittieren wir uns, wenn wir auf die Dramatik verzichten, die der Suche nach Verständnis innewohnt. Das Weltall hat sich schließlich als ein außergewöhnlich raffinierter Ort erwiesen, viel komplizierter, als man glaubte.
Nur eine Handvoll Schriftsteller verfügen über den notwendigen Hintergrund und das Talent, um alles so einzurichten, dass der Leser den Forscher begleiten kann, dass er spürt, was es heißt, Beweise zu sammeln, sich durch Berge von Daten zu wühlen und sogar gelegentlichen Spott von anderen hinzunehmen, die auf demselben Gebiet arbeiten. Und letztlich die ungetrübte Hochstimmung zu erleben, wenn es möglich wird, eine Hypothese aufzustellen.
In dieser kleinen Gruppe ragt Gregory Benford hervor, selbst ein begabter und international anerkannter Physiker. Er pflegt übrigens zu betonen, dass der Forscher letzten Endes nicht auf mehr als eine Hypothese hoffen kann. Wir erhaschen nur einen kurzen Blick auf etwas, was niemand zuvor erblickt hat. Wir werden kein neues Gesetz aufstellen, kein in Stein gemeißeltes Prinzip. Wir werden nichts bekommen, was die Aura einer absoluten Wahrheit hat. Aber es wird ein Durchbruch sein. Und das wird genügen.
Wissenschaftler, legt Benford dar, erzielen keine unumstößlichen Ergebnisse, trotz der in der Öffentlichkeit weit verbreiteten Illusion, Wissen, wenn es »wissenschaftlich« ist, stehe außer Frage. »Das ist wissenschaftlich bewiesen«, erzählen uns irgendwelche Marktschreier gern und meinen damit eine Qualität, die über jeden Zweifel erhaben ist. In Wahrheit beginnt die Suche nach Wissen mit dem Grundsatz, dass nichts heilig ist. Nicht einmal dieses Konzept selbst. Alles ist für neue Untersuchungen offen. Die »endgültige Wahrheit« bleibt der Religion und der Politik überlassen.
Es gibt einige wenige ganz und gar unvergessliche Momente in der SF-Literatur. Da fällt einem etwa Ray Bradburys »Mars Is Heaven«1 ein, wo die Besatzung eines Schiffs, das gerade auf dem Roten Planeten gelandet ist, eine Kleinstadt wie in Ohio sichtet, mit Palisadenzäunen und einer Kirche, und sie öffnen die Luke und hören ein Klavier »Schöner Träumer« spielen. Oder der jesuitische Astronaut in Arthur C. Clarkes »Der Stern«, der die unglückseligen Folgen jener Supernova entdeckt. Auch in »Zeitschaft« gibt es solch einen Moment. Eine einzige Passage, einen Augenblick der Bestätigung, der dem Leser für immer bleiben wird. Ich will ihn nicht verderben, indem ich ihn hier verrate - Sie werden ihn erkennen, wenn Sie ihn sehen.
Bei Benford ergänzten sich seine Fähigkeit, uns zu zeigen, wie Wissenschaftler wirklich arbeiten, und eine seltene Begabung, das Wesen der Forschung in verständlichen Begriffen zu erklären. Denn in »Zeitschaft« steht die Forschung selbst im Mittelpunkt des Dramas, wir brauchen also die Erklärung. Tachyonen, deren Haupteigenschaft es ist, dass sie sich schneller als Licht bewegen, werden im Laufe des Romans verständlich. (Nun ja, fast verständlich. Während ich las, brachte mich Benford zu der Überzeugung, ich verstünde es, und das genügt. Ich konnte sogar sehen, warum sie unweigerlich durch die Zeit zurückprallen würden.)
»Zeitschaft« bietet uns viel mehr als die übliche Dosis an Folgen einer herausragenden Entdeckung - wir bekommen auch die Bausteine geboten. Wir erfahren die persönlichen und beruflichen Belastungen, Enttäuschungen und Rivalitäten der Forscher und derjenigen, mit denen sich ihr Leben überschneidet. Wir sehen ihre Schwächen, ihren Ehrgeiz, als Erste mit einer Entdeckung auf den Markt zu kommen, ihren gelegentlichen Kleinmut, ihre Frauengeschichten. Einige von den interessanteren Passagen bestehen aus nichts als dem Besuch von Cocktailpartys und diversen Empfängen, wo die Helden herumstehen und über ihre Arbeit, ihre Ambitionen, ihre Politik reden. Wir sehen zu, wie sie debattieren - manchmal mit anderen, oft mit sich selbst -, ob sie eine Forschungsrichtung weiterverfolgen sollen, die bei der Obrigkeit auf Widerstand stößt, ob die benötigten Mittel zur Verfügung stehen werden, ob die Beweise ausreichen, um eine Schlussfolgerung zu rechtfertigen, von der Karrieren und letzten Endes Lebensläufe abhängen.
Der wachsame Leser wird auch feststellen, dass er fasziniert Berühmtheiten beobachtet. Ein großer Teil der Handlung spielt in den frühen sechziger Jahren an der University of California in La Jolla. Benford bringt eine Anzahl wohlbekannter Wissenschaftler jener Zeit auf die Bühne. Zu denen, die einen solchen Auftritt haben, gehören Murray Gell-Mann und Freeman Dyson, wie übrigens auch der Autor selbst (um ihn zu identifizieren, braucht der Leser nur zu wissen, dass Gregory Benford und sein Zwillingsbruder James zu jener Zeit Doktoranden an der U. C. waren).
Und es ist auch eine landesweit bekannte Persönlichkeit zugegen, deren Name verändert wurde, da er als eine der Hauptfiguren agiert.
Seinen Ursprung nahm »Zeitschaft« als »The Tachyonic Antitelephone« in der Physical Review (1970, D2, S. 263). Der Beitrag erörterte Kausalitätsverletzungen, die sich ergäben, wenn Tachyonen tatsächlich existieren würden. Die Herausgeber zögerten anfangs, den Text anzunehmen. Ob sich Benford im Klaren sei, dass er die Tachyonen zusammen mit dem ptolemäischen Weltbild und dem Piltdown-Menschen 2 auf den Müll warf? Am Ende musste sich Edward Teller einschalten, um die Veröffentlichung durchzusetzen.
Die Faszination des Autors für Tachyonen zeigte sich abermals in einer Kurzgeschichte, »3:02 P.M., Oxford«, die im September 1970 in If erschien, und dann wieder 1975 in »Cambridge, 1:58 A.M.« (in der Anthologie »Epoch«, herausgegeben von Robert Silverberg und Roger Elwood). Die Erzählung zitierte einen wesentlichen Abschnitt aus dem Artikel in der Physical Review, und etliche von den Figuren, die schließlich den Roman bevölkerten, tauchten hier zum ersten Mal auf.
Doch der Autor war damit nicht zufrieden. Es blieb zu viel Terrain zu erkunden. Die dramatischen Möglichkeiten, die der theoretischen Existenz von Tachyonen innewohnen, trafen sich mit seinem Interesse, Wissenschaftler bei der Arbeit auf die Bühne zu bringen. Und dieser Beharrlichkeit verdanken wir einen der großen Science-Fiction-Romane.
Er zog alle Register. Er schuf eine Handlung, die Wissenschaftler bei der Arbeit an einem ausgefallenen Konzept zeigt, und er vermittelte dem Leser ihre Sicht. Er schilderte ihr Leben, wie sie denken, wie die Arbeit alles beeinflusst, was sie tun, und schließlich zeigte er uns, was ihnen wirklich wichtig ist. Und vielleicht am schwersten: Wie es sich anfühlt, Erfolg zu haben. Etwas völlig Neues zu entdecken.
Es dauerte vier Jahre, bis »Zeitschaft« vollendet war. Benford erhielt Unterstützung von seiner Schwägerin Hilary, die Wesentliches zu den Cambridge-Abschnitten des Buches beitrug.
Das Tachyonen-Konzept, muss angemerkt werden, ist allerdings nicht nur eine Laune. Ein australisches Experiment mit kosmischer Strahlung im Jahre 1972 meldete die Beobachtung von Teilchen, die sich mit etwa doppelter Lichtgeschwindigkeit bewegten. Die Beobachtung ist niemals bestätigt worden. Doch sie lieferte dem Autor eine spekulative Grundlage: Was, wenn sie zuträfe? Was würden Physiker daraus machen? Meine erste Reaktion wäre gewesen, die Physik zu verwirren - was in meinem Fall nicht schwer wäre - und zu behaupten, es sei möglich geworden, eine Zeitmaschine zu bauen. Aber Benford verfügte schon damals über genug Kenntnisse, um zu wissen, dass das Unsinn war.
Er wählte einen spannenderen Weg. Ein aktiver Physiker, wusste er, würde zunächst einmal die Ideen erproben. Und er würde Paradoxe betrachten. Eins nach dem anderen.
1979 war der Roman fertig und konnte einem Verlag angeboten werden. Doch Benford hatte Bedenken. Die Handlung enthielt wenig von der atemberaubenden Action und gar nichts von den Spannungseffekten, an die sich die Leser gewöhnt hatten. Es gab kein geheimnisvolles Schiff, das durch die Weiten des Sonnensystems kreuzt, keine marsianischen Artefakte, keine untergegangene Zivilisation, keine entsetzlichen Außerirdischen kurz vor der Invasion. Stattdessen versuchen zwei Teams von Wissenschaftlern, eins 1998 in Cambridge, das andere 1962/63 an der University of California in La Jolla, einige quälende Problemen zu lösen, von denen der Leser weiß, dass sie zusammenhängen.
Benford hielt den Roman für zu komplex, angefüllt mit Diskussionen und philosophischen Doppeldeutigkeiten. Außerdem - wer würde sich wirklich dafür interessieren, Physikern bei der Arbeit zuzuschauen?
Wie sich zeigte, fast jeder. »Zeitschaft« wurde von den Kritikern enthusiastisch begrüßt und gewann sowohl den Nebula als auch den John W. Campbell Memorial Award. Die Hardcover-Ausgabe verkaufte sich praktisch über Nacht, und der Roman hat eine Reihe von Taschenbuchausgaben erlebt. In dem Vierteljahrhundert seit seinem ersten Erscheinen ist er regelmäßig wiederaufgelegt worden.
Benford hat eine beständige Leidenschaft für »harte« Science Fiction, jenen Zweig des Genres, der davon handelt, was möglich ist. Wenn Sie auf Elfen und Drachen aus sind, auf sexuelle Begegnungen zwischen Menschen und Außerirdischen oder auf allmächtige Zauberer, sollten Sie sich wohl lieber etwas anderem zuwenden. Wohin führt uns die Technik? Welche Lebensformen - wenn überhaupt - könnten wir im Weltraum finden? Könnten sich Computer zu etwas entwickeln, das letzten Endes unser Überleben bedroht? Das sind die Fragen, denen er nachgeht.
Was dazu führt, dass seine Romane keine hübsch eingewickelten Päckchen darstellen. Wenn wir die Auflösung erreichen, dann haben wir nicht das Gefühl, alles sei wohlgeordnet. Es bleibt immer etwas offen, weil es zu viel gibt, was wir nicht wissen. Es ist diese Jagd nach dem Unbekannten, die Benfords Geschichte vorantreibt, und sie verlässt uns nicht, lange nachdem wir den Roman ausgelesen haben.
Gregory Benford erhielt seinen Doktorgrad 1967 von der University of California, San Diego. Gegenwärtig ist er Professor für Physik an der University of California, Irvine, wo sich seine Forschungen um Plasmaturbulenz und Astrophysik drehen. Er ist Woodrow Wilson Fellow und war Fellow an der Universität Cambridge. Er hat den Lord-Preis für wissenschaftliche Leistungen und die Medaille der Vereinten Nationen für Literatur erhalten. Zudem ist er Berater der NASA und des Energieministeriums und war Mitglied des Rates für Weltraumpolitik des Weißen Hauses.
Er hat zweihundertfünfzig wissenschaftliche Artikel geschrieben, dazu vier Sachbücher, zuletzt »Beyond Human: The New World of Cyborgs and Androids« (2003).
In seiner freien Zeit hat er - zum Teil mit Koautoren - siebenundzwanzig Romane geschrieben, darunter »Wider die Unendlichkeit« (1983), »Artefakt« (1985), »Cosm« (1998) und »Das Rennen zum Mars« (1999). 1976 begann er mit »Im Meer der Nacht« den sogenannten Galaktischen Zyklus.
Des Weiteren gibt es von ihm bisher vier Erzählungsbände, zuletzt »Immersion and Other Short Novels« (2002). Er hat zahlreiche Anthologien herausgegeben und ist auf allen wichtigen Gebieten der Science Fiction in Erscheinung getreten. Wenn Sie nach alledem nicht überrascht sind zu hören, dass er auch als Simultanschachspieler auftritt und dreißig, vierzig Blindpartien gleichzeitig spielt, kann ich das nur zu gut verstehen.
Jack McDevitt ist einer der bekanntesten Hard-SF-Autoren der USA. Zuletzt ist von ihm auf Deutsch der Roman »Polaris« erschienen.
ZEITSCHAFT
Für Richard Curtis, mit Dank
Absolute, wahre und mathematische Zeit fließt, aus der ihr eigenen Natur, gleichförmig, ohne Beziehung zu äußeren Gegebenheiten.
ISAAC NEWTON
P.C.W. DAVIES
The Physics of Time Asymmetry, 1974
1
Frühjahr 1998
Denk daran, viel zu lächeln, dachte John Renfrew melancholisch. Die Leute schienen das zu mögen. Sie fragten sich nie, warum man nicht zu lächeln aufhörte, ganz gleich, was gesagt wurde. Es war wohl ein generelles Anzeichen guten Willens, vermutete er, einer der Tricks, die er nie beherrschen würde.
»Daddy, sieh mal …«
»Verflixt, pass doch auf!«, schrie Renfrew. »Nimm das Papier aus meinem Porridge, ja! Marjorie, warum sind die verdammten Köter in der Küche, während wir frühstücken?«
Drei Gestalten, mitten in der Bewegung erstarrt, blickten ihn an. Marjorie, die sich mit dem Bratenwender gerade vom Herd abwandte. Nicky, die den Löffel zum Mund hob, der sich zu einem erstaunten »Oh« geformt hatte. Johnny neben ihm, der seine Schulaufgaben in der ausgestreckten Hand hielt und dessen Gesicht Enttäuschung verriet. Renfrew wusste, was seiner Frau jetzt durch den Kopf ging. John muss wirklich nervös sein. Er wird niemals wütend.
Das stimmte. Ein weiterer Luxus, den sie sich nicht leisten konnten.
Die Momentaufnahme löste sich in Bewegung auf. Marjorie scheuchte mit einer hektischen Bewegung die kläffenden Hunde zur Hintertür hinaus. Nicky beugte den Kopf über den Teller und schaute prüfend auf ihren Haferbrei. Dann führte Marjorie Johnny zu seinem Platz am Tisch zurück. Renfrew holte tief Luft und biss in seinen Toast.
»Fall Daddy heute nicht zur Last, Johnny. Er hat heute Morgen eine wichtige Besprechung.«
Ein ergebenes Nicken. »Tut mir Leid, Daddy.«
Daddy. Alle nannten ihn Daddy. Nicht Pop, wie Renfrews Vater stets genannt werden wollte. Das war ein Name für Väter mit schwieligen Händen.
Melancholisch nahm Renfrew seine Umgebung in sich auf. Manchmal fühlte er sich hier, in seiner eigenen Küche, fehl am Platz. Dort saß sein Sohn in dem graublauen Blazer der Schuluniform und sprach mit der klaren Stimme der Oberschicht. Renfrew erinnerte sich an die verwirrende Mischung aus Verachtung und Neid, die er in Johnnys Alter für solche Jungen empfunden hatte. Gelegentlich, wenn er Johnny beiläufig anblickte, kam die Erinnerung an jene Zeit zurück. Dann bereitete er sich innerlich auf die vertraute herablassende Gleichgültigkeit im Gesicht seines Sohnes vor - und war gerührt, wenn er dort stattdessen Bewunderung fand.
»Ich bin derjenige, der sich entschuldigen sollte, Junge. Ich wollte dich nicht so anschreien. Wie deine Mutter schon gesagt hat, ich bin heute ein wenig nervös. So, und was wolltest du mir gerade zeigen, he?«
»Weißt du, da ist der Aufsatzwettbewerb zu dem Thema«, begann Johnny scheu, »wie Schulkinder helfen können, die Umwelt zu säubern und Energie zu sparen und so. Ich wollte dir meinen Aufsatz zeigen, bevor ich ihn abgebe.«
Renfrew biss sich auf die Lippe. »Heute habe ich keine Zeit, Johnny. Wann musst du ihn spätestens abgegeben haben? Ich werde versuchen, ihn heute Abend zu lesen, okay?«
»Okay. Danke, Daddy. Ich lasse ihn hier. Ich weiß, dass deine Arbeit schrecklich wichtig ist. Der Englischlehrer hat das gesagt.«
»So, hat er das? Was hat er denn gesagt?«
»Nun, eigentlich …« Der Junge zögerte. »Er hat gesagt, die Wissenschaftler haben uns in den Schlamassel reingebracht, und sie sind die Einzigen, die uns jetzt da wieder rausholen können - wenn es überhaupt jemand kann.«
»Das haben andere auch schon gesagt, Johnny. Eine Binsenweisheit.«
»Binsenweisheit? Was ist eine Binsenweisheit, Daddy?«
»Meine frühere Lehrerin hat genau das Gegenteil gesagt«, warf Nicky plötzlich ein. »Sie sagt, die Wissenschaftler haben schon genug angerichtet. Sie sagt, Gott sei der Einzige, der uns wieder rausholen kann, und wahrscheinlich wird er das nicht.«
»Ach, du liebe Güte, noch so ein Untergangsprophet! Na ja, schätzungsweise immer noch besser als die Primmies und ihr Zurück-in-die-Steinzeit-Gewäsch. Außer, dass die Untergangspropheten uns ständig in den Ohren liegen und uns deprimieren.«
»Miss Crenshaw sagt, die Primmies werden Gottes Urteil ebenso wenig entgehen, wie weit sie auch davonrennen mögen«, sagte Nicky bestimmt.
»Marjorie, was ist in dieser Schule nur los? Ich will nicht, dass sie Nickys Kopf mit solchen Ideen voll stopft. Die Frau hört sich unausgeglichen an, unausgewogen. Sprich mal mit ihrer Direktorin über sie!«
»Ich bezweifle, dass das etwas nutzen würde«, entgegnete Marjorie gleichmütig. »Heutzutage gibt es mehr ›Untergangspropheten‹, wie du sie nennst, als sonst wen.«
»Miss Crenshaw meint, wir sollten alle nur beten«, fuhr Nicky störrisch fort. »Miss Crenshaw sagt, es ist ein Strafgericht. Und wahrscheinlich das Ende der Welt.«
»Aber das ist doch Unsinn, Liebes«, sagte Marjorie. »Wo kämen wir denn hin, wenn wir alle nur rumsäßen und beteten? Man muss doch vorankommen. Was mich daran erinnert, dass ihr euch jetzt besser vorwärts bewegt, sonst kommt ihr zu spät zur Schule.«
»Miss Crenshaw sagt: ›Seht die Lilien auf dem Felde‹«, murmelte Nicky im Hinausgehen vor sich hin.
»Und ich bin keine verdammte Lilie«, sagte Renfrew. Er schob seinen Stuhl zurück und stand auf. »Da mache ich mich wohl besser an mein mühsames Tagwerk.«
»Und ich bleibe zu Hause und spinne?« Marjorie lächelte. »Anders geht es wohl nicht. Hier ist dein Mittagessen. Diese Woche gibt es wieder kein Fleisch, aber ich habe auf der Farm ein bisschen Käse ergattert und ein paar frühe Karotten ausgezogen. Ich glaube, dieses Jahr könnten wir auch ein paar Kartoffeln haben. Das würde dir gefallen, oder?« Sie stand auf und gab ihm einen Kuss. »Ich hoffe, deine Besprechung verläuft erfolgreich.«
»Danke, Schatz.« Wieder spürte er das beklemmende Gefühl. Er musste diese Geldmittel bekommen. Er hatte unermesslich viel Zeit und Denken in das Projekt gesteckt. Er musste die Geräte haben. Es musste versucht werden.
Renfrew verließ das Haus und stieg auf sein Fahrrad. Er war bereits dabei, den Familienvater abzustreifen; seine Gedanken wanderten ihm voraus ins Laboratorium, zu den Anweisungen an die Techniker, zu dem bevorstehenden Gespräch mit Peterson.
Radelnd ließ er Grantchester hinter sich und umfuhr Cambridge. Während der Nacht hatte es geregnet. Dicht über den gepflügten Feldern hing ein dünner Nebel, der das Licht weicher werden ließ. An den frisch ergrünten Blättern der Bäume klebten kleine Tropfen. Auf dem Teppich aus Glockenblumen, der die Lichtungen bedeckte, glitzerte es feucht. Die Straße verlief hier parallel zu einem Bach, der von Erlensträuchern und Nesselbüschen gesäumt wurde. Auf der Wasseroberfläche sah er winzige Wellen, die entstanden, wenn die Ruderwanzen auf ihren weit ausladenden Beinen sich mit ruckartigen Stößen vorwärts bewegten. An den Ufern blühte ein goldenes Tuch aus Butterblumen, die ersten Kätzchen sprossen aus den Weiden. Es war ein frischer Aprilmorgen, wie er ihn als Junge in Yorkshire immer so geliebt hatte; er hatte in der bleichen Morgensonne den aus den Mooren aufsteigenden Nebel beobachtet und den Hasen nachgeschaut, die er mit seinen Schritten aufscheuchte. Der Weg, dem er jetzt folgte, war mit den Jahren abgesunken, und sein Kopf war fast auf einer Höhe mit den Baumwurzeln auf beiden Seiten. Ihn erreichte ein Geruch feuchter Erde und regengetränkten Grases, vermischt mit dem beißenden Geruch von Kohlenrauch.
Ausdruckslos blickten ein Mann und eine Frau ihn an, als er vorbeiradelte. Sie lehnten untätig gegen einen altersschwachen Holzzaun. Renfrew verzog das Gesicht. Monat für Monat trieb es mehr Squatter in die Gegend, weil sie Cambridge für eine reiche Stadt hielten. Weiter rechts standen die Überreste eines alten Bauernhauses. In der letzten Woche waren die gähnend leeren Fenster mit Zeitungspapier, Brettern und Lumpen gestopft worden. Es war nur erstaunlich, dass die Behausung nicht schon früher von Squattern aufgespürt worden war.
Das letzte Stück durch die Vororte von Cambridge war das Schlimmste. Überall waren kreuz und quer verlassene Autos abgestellt, die die Straße zum Hindernisparcours machten. Es hatte einmal ein staatliches Programm gegeben, die Wracks dem Produktionskreislauf wieder zuzuführen, aber mehr als viel Gerede im Fernsehen hatte Renfrew nie davon gesehen. Er schlängelte sich zwischen den Autos hindurch, die dort wie augen- und gliederlose Käfer hockten, aller beweglichen Teile beraubt. In einigen Wagen wohnten Studenten. Schläfrige Gesichter wandten sich ihm zu.
Vor dem Cavendish kettete er sein Fahrrad an dem Gestell fest. Ein Auto stand auf dem Platz, bemerkte er. Dieser Kerl Peterson würde doch wohl kaum so früh da sein? Es war noch nicht einmal halb neun. Er ging die Stufen hinauf und durchquerte die Eingangshalle.
Der jetzige Komplex aus drei Gebäuden war für Renfrew eine anonyme Angelegenheit. Das ursprüngliche Cav, wo Rutherford den Atomkern entdeckt hatte, war ein altes Backsteingebäude im Zentrum von Cambridge, ein Museum. Nur zweihundert Meter von der Madingley Road entfernt, konnte man diesen Gebäudekomplex leicht für den Sitz einer Versicherung, eine Fabrik oder ein Bürohaus halten. Als es Anfang der Siebziger eröffnet worden war, war das »neue Cav« makellos gewesen: aufeinander abgestimmte Farbstrukturen, Teppiche in der Bibliothek und wohlbestückte Regale. Jetzt waren die Flure nur spärlich beleuchtet, und viele Laboratorien, bar jeder Ausstattung, gähnten vor Leere. Renfrew begab sich zu seinem Labor im Mott-Gebäude.
»Guten Morgen, Dr. Renfrew.«
»Oh, Morgen, Jason. Ist jemand da gewesen?«
»Ja, George war da, um die Vorpumpen anzuwerfen, aber …«
»Nein, nein, ein Besucher, meine ich. Ich erwarte jemanden aus London, Peterson heißt er.«
»Oh, nein. So einer war nicht da. Möchten Sie denn, dass ich jetzt anfange?«
»Ja, bitte. Was machen die Apparate?«
»Läuft ganz gut. Das Vakuum baut sich auf. Wir sind jetzt bei zehn Minuten. Wir haben eine frische Füllung Flüssigstickstoff, die Elektronik ist überprüft. Sieht so aus, als gäbe einer der Verstärker bald den Geist auf. Wir nehmen noch ein paar Eichungen vor, und in etwa einer Stunde müsste die gesamte Anlage klar sein.«
»Okay. Sehen Sie, Jason, dieser Peterson kommt vom Weltrat. Er erwägt höhere Zuschüsse. Wir werden ihm einen Durchgang vorführen und zeigen, was in den Geräten steckt. Versuchen Sie, einen tatkräftigen Eindruck zu machen, und putzen Sie alles ein bisschen heraus, bitte.«
»In Ordnung. Ich setz alles in Gang.«
Renfrew ging über den Steg in das eigentliche Labor hinunter und trat geschickt über die Drähte und Kabel. Der Raum bestand aus nacktem Beton und war mit altmodischen elektrischen Leitungen und deutlich neueren Kabeln ausgestattet, welche sich durch die Gänge zwischen den Geräten wanden. Renfrew begrüßte jeden Techniker einzeln, stellte Fragen über den Betrieb des Ionenbündlers und gab seine Anweisungen. Inzwischen kannte er seine Ausrüstung aus dem Effeff, mühselig hatte er die Teile beschafft und eigenhändig zusammengestellt. Der Flüssigstickstoff brodelte in seinem Dewargefäß. Einheiten unter Strom summten an Stellen, wo geringfügige Spannungs-Fehlanpassungen auftraten. Auf den grünen Schirmen der Oszilloskope tanzten und wogten gelbe Linien. Er fühlte sich in seinem Element.
Selten bemerkte Renfrew die schlichten Wände und die klobige Anordnung der Geräte; für ihn handelte es sich um eine gemütliche Zusammenstellung vertrauter, zusammenwirkender Elemente. Den zurzeit grassierenden Abscheu vor technischem Gerät konnte er nicht begreifen; er argwöhnte, es handelte sich um die eine Seite der Medaille, deren andere Ehrfurcht war. Aber beides war Unsinn. Genauso gut konnte man beispielsweise diese Gefühle einem Wolkenkratzer gegenüber hegen, doch das Gebäude war nicht größer als ein Mensch - der Mensch hat es erschaffen, nicht umgekehrt. Das Universum der Artefakte war ein menschliches Universum. Wenn Renfrew sich durch die Gassen zwischen den wuchtigen Geräten bewegte, kam er sich manchmal wie ein Fisch vor, der durch die warmen Gewässer seines ureigenen Ozeans schwamm. Die komplizierte Anordnung des Experiments steckte wie ein mehrschichtiges Diagramm in seinem Kopf, und er verglich es ständig mit der niemals vollkommenen Realität vor sich. Er liebte diese Art des Nachdenkens und Korrigierens, er liebte die Suche nach dem unsichtbaren Mangel, der die gesamte gewünschte Wirkung zerstören konnte.
Die meisten seiner Geräte hatte er beschafft, indem er die übrigen Forschungsgruppen im Cav plünderte. Forschung war stets ein offensichtlicher Luxus gewesen, der leicht beschnitten werden konnte. Die letzten fünf Jahre waren eine Katastrophe gewesen. Wenn eine Gruppe aufgelöst wurde, hatte Renfrew versucht, zu retten, was zu retten war. Als Spezialist für die Erzeugung von Strahlen aus Hochenergie-Ionen hatte er in der Kernresonanzgruppe angefangen. Ihre Bedeutung gewann sie durch die Entdeckung einer völlig neuen Art subatomarer Teilchen, der Tachyonen, über die seit Jahrzehnten theoretisiert worden war. Renfrew war in diesen Bereich übergewechselt. Er hatte sein kleines Team durch geschickte Subventionspolitik über Wasser gehalten und sich zudem die Tatsache zunutze gemacht, dass Tachyonen, das Neueste vom Neuen, einen eindeutigen intellektuellen Anspruch auf die Geldmittel hatten, die dem Nationalen Forschungsrat noch geblieben waren. Der NFR hatte sich allerdings im letzten Jahr aufgelöst.
In diesem Jahr war die Forschung eine Marionette, deren Fäden direkt zum Weltrat führten. Die Nationen des Westens hatten ihre Forschungsanstrengungen in dem Versuch, ökonomisch zu handeln, zu einem Pool zusammengeschlossen. Renfrew hatte den Eindruck, die Politik des Rats beschränkte sich darauf, vor allem spektakuläre Projekte zu unterstützen. Das Fusionsreaktorprogramm erhielt immer noch einen Löwenanteil, obwohl es keinen erkennbaren Fortschritt zeigte. Die besten Gruppen des Cavs - wie die Radioastronomie - waren letztes Jahr aufgelöst worden, als der Rat beschlossen hatte, Astronomie insgesamt sei unbrauchbar und solche Arbeiten sollten »für längere Zeit« ausgesetzt werden. Wie lang dieser Zeitraum genau sein könnte, war eine Frage, welcher der Rat geflissentlich auswich. Er ging von der Grundannahme aus, dass die westlichen Nationen während der sich verschärfenden Krise ihren Forschungsluxus aufgeben müssten. Stattdessen sollten sie sich intensiv auf die Ökoprobleme und die entsprechenden Schreckensnachrichten konzentrieren, die die Schlagzeilen beherrschten. Aber man musste seinen Mantel nach dem Wind hängen. Renfrew wusste das. Ihm war es gelungen, einen Weg zu finden, Tachyonen einen »praktischen« Zweck zuzuweisen, und dieser Kunstgriff hatte seine Gruppe bislang über Wasser gehalten.
Renfrew eichte noch einige Geräte - dieser Tage war stets etwas in Unordnung - und legte eine kurze Pause ein, in der er dem geschäftigen Summen des Laboratoriums lauschte.
»Jason«, rief er, »ich gehe mal eben Kaffee holen. Halten Sie bitte alles in Betrieb.«
Er nahm seine alte Cordjacke vom Haken und reckte sich ausgiebig, wobei die Schweißflecken im Stoff unter seinen Achselhöhlen sichtbar wurden. Plötzlich bemerkte er zwei Männer oben auf der Plattform. Einer der Techniker zeigte zu Renfrew hinunter und sagte etwas. Als Renfrew seine Arme senkte, betrat der andere Mann den Steg zum Labor hinab.
Spontan erinnerte Renfrew sich an seine Collegetage in Oxford. Er war einen Gang entlanggeschritten, der ein hohles, widerhallendes Echo zurückwarf, wie nur Mauerwerk es kann. Es war ein schöner Oktobermorgen, und er schäumte vor Begierde, sein neues Leben zu beginnen, auf das er sich so lange gefreut hatte, das Ziel langer Studentenjahre. Er hatte gewusst, er war brillant; hier, unter intellektuell Gleichwertigen, würde er endlich seinen rechten Platz finden. Er war am Vorabend mit dem Zug aus York gekommen, und jetzt wollte er in die Morgensonne hinaustreten und alles in sich aufnehmen.
Zwei von ihnen kamen ihm auf dem Gang entgegengeschlendert. Sie trugen ihre kurzen akademischen Gewänder wie Höflingsroben, und sie gingen, als gehörte ihnen das Gebäude. Während sie sich ihm näherten, unterhielten sie sich laut, und sie musterten ihn, als sei er ein Ire. Als sie an ihm vorbeigingen, sagte der eine gedehnt: »Mein Gott, schon wieder so ein Bauernlümmel mit Stipendium!« Das hatte die Atmosphäre seiner Jahre in Oxford bestimmt. Natürlich hatte er summa cum laude abgeschlossen, und inzwischen hatte er sich in der Physik einen Namen gemacht. Aber er hatte immer das Gefühl gehabt, dass sie selbst dann, wenn sie ihre Zeit vergeudeten, ihr Leben mehr genossen, als er je können würde.
Die Erinnerung daran schmerzte ihn, als er Peterson auf sich zukommen sah. Nach so langer Zeit konnte er sich nicht mehr an die Gesichter der beiden studentischen Snobs erinnern, und wahrscheinlich bestand keinerlei physische Ähnlichkeit, aber dieser Mann demonstrierte die gleiche geschmeidige, arrogante Selbstsicherheit. Er bemerkte auch, wie Peterson gekleidet war, und er verabscheute es, die Art der Kleidung eines anderen Mannes zu bemerken. Peterson war hochgewachsen, schlank und dunkelhaarig. Aus einiger Entfernung vermittelte er den Eindruck eines jungen, athletischen Stutzers. Er ging leichtfüßig. Nicht wie ein Rugbyspieler, der Renfrew in jungen Jahren gewesen war, sondern wie ein Tennisoder Polospieler oder vielleicht sogar ein Speerwerfer. Aus der Nähe besehen, sah er aus wie Anfang vierzig und war zweifellos ein Mann, der es gewohnt war, Macht auszuüben. Er war auf eine sehr strenge Art gut aussehend. Sein Gesichtsausdruck zeigte keine Verachtung, aber Renfrew dachte bitter, dass er es als Erwachsener wahrscheinlich gelernt hatte, sie zu verbergen. Reiß dich zusammen, John, ermahnte er sich stumm. Du bist der Experte, nicht er. Und lächle!
»Guten Morgen, Dr. Renfrew.« Die samtglatte Stimme entsprach genau seiner Erwartung.
»Guten Morgen, Mr. Peterson«, murmelte er und streckte eine große, klobige Hand aus. »Freut mich, Sie kennen zu lernen.« Verdammt, wieso hatte er das gesagt? Es hätte fast die Stimme seines Vaters sein können. »Ich freue mich wirklich, Sie kennen zu lernen.« Er wurde paranoid. In Petersons Gesicht war nichts, das etwas anderes als ernsthaftes Interesse an seiner Arbeit offenbarte.
»Ist das das Experiment?« Peterson blickte sich mit sachlichem Ausdruck um.
»Ja. Wollen Sie es als Erstes sehen?«
»Bitte.«
Sie gingen an einigen alten grauen Schränken englischer Herstellung vorbei und dann an einigen neueren Geräten, die in hellen Fächern von Tektronics, Physics International und anderen amerikanischen Firmen untergebracht waren. Diese grellroten und gelben Einheiten stammten aus dem kargen Zuschuss des Weltrats. Renfrew führte Peterson zu einer komplizierten Apparatur zwischen den Polen eines großen Magnets.
»Eine superleitende Anordnung, natürlich. Wir brauchen die hohe Feldstärke, um während der Übertragung eine gestochen scharfe Kurve zu bekommen.«
Peterson betrachtete das Labyrinth aus Drähten und Messgeräten. Über ihnen türmten sich in Regalschränken elektronische Geräte. Er zeigte auf ein bestimmtes und fragte nach dessen Funktion.
»Oh, ich hätte nicht gedacht, dass Sie so viel über die technische Seite wissen wollen«, sagte Renfrew.
»Versuchen Sie’s!«
»Nun, hier haben wir eine große Indiumantimonid-Probe, sehen Sie …« Renfrew zeigte auf das verkleidete Gehäuse zwischen den Magnetpolen. »Wir beschießen sie mit hochenergetischen Ionen. Wenn die Ionen auf das Indium auftreffen, geben sie Tachyonen ab. Es ist eine komplexe, sehr empfindliche Ionenkernreaktion.« Er blickte Peterson an. »Tachyonen sind Teilchen, die schneller als Licht sind, wissen Sie. Auf der anderen Seite« - er zeigte hinter die Magneten und führte Peterson zu einem langen blauen zylindrischen Tank, der zehn Meter von den Magneten entfernt aufragte - »ziehen wir die Tachyonen heraus und bündeln sie zu einem Strahl. Energie und Spin sind bei ihnen so speziell, dass sie nur mit Indiumkernen in einem starken Magnetfeld in Resonanz geraten.«
»Und wenn sie unterwegs auf etwas auftreffen?«
»Genau das ist es«, sagte Renfrew scharf. »Tachyonen müssen einen Atomkern genau im richtigen Energie- und Spinzustand treffen, bevor sie in dem Prozess Energie verlieren. Durch gewöhnliche Materie gehen sie glatt hindurch. Deshalb können wir sie über Lichtjahre schießen, ohne dass sie unterwegs gestreut werden.«
Schweigend musterte Peterson die Geräte.
»Aber wenn eines unserer Tachyonen auf einen Indiumkern in genau dem richtigen Zustand trifft - eine Situation, die von Natur aus nicht sehr häufig auftritt -, dann wird es absorbiert. Der Spin des Indiumkerns wird dadurch in eine andere Richtung gelenkt. Stellen Sie sich den Indiumkern als einen kleinen Pfeil vor, der zur Seite geschlagen wird. Würden all die kleinen Pfeile vor dem Auftreffen der Tachyonen in dieselbe Richtung weisen, dann würden sie durcheinander geraten. Das wäre festzustellen und …«
»Verstehe, verstehe«, unterbrach Peterson geringschätzig. Renfrew fragte sich, ob er mit den kleinen Pfeilen den Bogen vielleicht überspannt hatte. Es wäre verhängnisvoll, würde Peterson glauben, er redete von oben herab zu ihm - obwohl es natürlich zutraf.
»Ich nehme an, das Indium gehört jemand anderem.«
Renfrew hielt den Atem an. Das war die heikle Stelle. »Ja. Ein Experiment, das im Jahre 1963 durchgeführt wird«, sagte er langsam.
»Ich habe den einleitenden Bericht gelesen«, meinte Peterson trocken. »Diese Vorberichte sind häufig irreführend, aber den habe ich verstanden. Die technische Abteilung sagt mir, er sei schlüssig, aber ich kann einige der Dinge, die Sie geschrieben haben, nicht glauben. Diese Geschichte mit der Veränderung der Vergangenheit …«
»Wir erwarten diesen Markham noch - er wird das schon klar machen.«
»Wenn er kann.«
»Richtig. Sehen Sie, wenn man einmal darüber nachdenkt, ist eigentlich eindeutig, warum noch keiner versucht hat, Botschaften in die Vergangenheit zu schicken: Wir können einen Sender bauen, aber es gibt keinen Empfänger. Niemand in der Vergangenheit hat je einen gebaut.«
Peterson runzelte die Stirn. »Nun, natürlich …«
Enthusiastisch fuhr Renfrew fort. »Wir haben natürlich einen gebaut, um die einleitenden Experimente durchzuführen. Aber die Menschen wussten 1963 noch nichts über Tachyonen. Der Trick besteht also darin, sich in etwas einzuschalten, das sie bereits betreiben. So Klapptisch.«
»Hmm.«
»Wir versuchen, Tachyonenausbrüche zu konzentrieren und sie so zu zielen …«
»Moment!«, unterbrach Peterson und hob eine Hand. »Worauf zielen? Wo befindet sich 1963?«
»Ziemlich weit weg, wie sich herausstellt. Seit 1963 hat sich die Erde um die Sonne gedreht, während die Sonne sich um das Zentrum der Galaxis gedreht hat, und so weiter. Zählen Sie alles zusammen, und dann werden Sie sehen, dass 1963 ganz schön in der Ferne liegt.«
»Relativ wozu?«
»Nun, relativ zum Massenzentrum unserer Galaxiengruppe. Man darf aber nicht vergessen, dass auch diese Gruppe sich bewegt, und zwar relativ zu dem Bezugsrahmen, den die Hintergrundstrahlung im Mikrowellenbereich schafft, und …«
»Bitte, lassen Sie das Fachchinesisch. Sie wollen also sagen, 1963 ist irgendwo am Himmel?«
»So ist es. Wir senden einen Tachyonenstrahl aus, um diesen Ort zu treffen. Wir decken das Raumvolumen ab, das zu jener bestimmten Zeit von der Erde eingenommen wurde.«
»Hört sich unmöglich an.«
Renfrew wog seine Worte. »Ich meine nicht. Der Trick besteht darin, Tachyonen mit praktisch unendlicher Geschwindigkeit zu erzeugen …«
Peterson lächelte gelangweilt. »Aha - ›praktisch unendlich‹? Lustig dieses technische Gerede.«
»Ich meine mit unmessbar hoher Geschwindigkeit«, präzisierte Renfrew. »Entschuldigen Sie bitte die Ausdrucksweise, wenn sie Sie stört.«
»Sehen Sie, ich versuche doch nur zu verstehen.«
»Ja, ja, tut mir Leid, ich war wohl zu voreilig.« Renfrew sammelte sich sichtlich für eine neue Attacke. »Also, im Wesentlichen geht es darum, diese Hochgeschwindigkeitstachyonen zu bekommen. Dann können wir, wenn wir die richtige Stelle im Weltraum treffen, eine Botschaft ein ganzes Stück zurücksenden.«
»Diese Tachyonenstrahlen gehen geradewegs durch einen Stern hindurch?«
Renfrew runzelte die Stirn. »Genau wissen wir es nicht. Es besteht die Möglichkeit, dass andere Reaktionen - zwischen diesen Tachyonen und anderen Atomkernen außer dem des Indiums - ziemlich stark sein werden. Falls das so ist, würde ein Planet oder ein Stern, der uns in den Weg kommt, einige Probleme schaffen.«
»Aber Sie haben doch einfachere Tests durchgeführt, oder? Ich habe in dem Bericht gelesen …«
»Ja, sicher, sie waren sehr erfolgreich.«
»Nun ja, trotzdem …« Peterson wies auf das Labyrinth im Labor. »Mir kommt das hier wie ein großartiges Experiment vor. Fördernswert. Aber« - er schüttelte den Kopf - »ich bin verblüfft, dass Sie das Geld dafür bekommen haben.«
Renfrews Miene erstarrte. »So viel ist es nun wirklich nicht.«
Peterson seufzte. »Also, Dr. Renfrew, ich will ganz offen sein. Ich bin hier, um die ganze Sache für den Weltrat zu bewerten, weil einige Großkopfete gesagt haben, es sei eine recht vernünftige Geschichte. Nach meinem Gefühl habe ich nicht die wissenschaftliche Qualifikation, zu einer angemessenen Bewertung zu kommen. Keiner im Rat hat sie. Wir sind hauptsächlich Ökologen, Biologen und Org-Leute.«
»Die Basis müsste breiter sein.«
»Gewiss, zugegeben. Wir sind früher davon ausgegangen, die Spezialisten nach Bedarf hinzuzuziehen.«
Barsch: »Dann wenden Sie sich doch an Davies am King’s College in London. Er ist gewitzt bei solchen …«
»Dafür haben wir keine Zeit. Wir suchen nach Notstandsmaßnahmen.«
»Steht es so schlimm?«, fragte Renfrew gedehnt.
Peterson machte eine Pause, als hätte er zu viel verraten. »Ja. Sieht so aus.«
»Ich kann schnell vorankommen, wenn Sie das meinen«, sagte Renfrew knapp.
»Vielleicht müssen Sie das.«
»Es wäre besser, wir hätten hier eine komplette neue Gerätegeneration.« Renfrew umfasste mit einer Handbewegung das ganze Laboratorium. »Die Amerikaner haben elektronische Teile entwickelt, die uns weiterhelfen würden. Um wirklich sicher zu sein, dass wir durchgekommen sind, müssen wir die Amerikaner mit einschalten. Die meisten Schaltelemente, die ich brauche, werden in ihren staatlichen Labors entwickelt, Brookhaven und so.«
Peterson nickte. »So steht es in Ihrem Bericht. Deshalb will ich diesen Markham heute dabeihaben.«
»Besitzt er den nötigen Einfluss, um das zu schaukeln?«
»Ich denke schon. Er genießt einen guten Ruf, heißt es, und er ist ein Amerikaner, der hier verfügbar ist. Deshalb muss sich die Nationalstiftung für Wissenschaften zurückhalten, für den Fall …«
»Ach ja, verstehe. Markham muss nun jeden Moment eintreffen. Trinken wir einen Kaffee in meinem Büro.«
Peterson folgte ihm in das voll gestopfte Zimmer. Renfrew räumte Bücher und Papiere von einem Stuhl. Seine geschäftigen Bewegungen waren die eines Menschen, dem beim Eintreten eines Gastes plötzlich bewusst wird, wie unordentlich sein Büro ist. Peterson setzte sich, zog die Hosenbeine an den Knien etwas hoch und legte dann ein Bein über das andere. Renfrew machte eine umständliche Prozedur daraus, den scharf riechenden Kaffee zu holen, weil er Zeit zum Nachdenken haben wollte. Es fing schlecht an; Renfrew stellte sich die Frage, ob die Erinnerungen an Oxford ihn automatisch gegen Peterson eingenommen hatten. Nein, jedenfalls war das nicht erkennbar; heutzutage war ohnehin jedermann ziemlich gereizt. Vielleicht konnte Markham die Dinge ins Lot bringen.
2
Marjorie schloss die Küchentür hinter sich und ging, einen Eimer mit Hühnerfutter in der Hand, ums Haus herum. Der Rasen hinter dem Haus wurde durch Pflasterwege geviertelt, in der Mitte, wo sie sich trafen, stand eine Sonnenuhr. Aus Gewohnheit folgte sie dem Weg und trat nicht auf das feuchte Gras. Hinter dem Rasen lag ein von ihr entworfener Rosengarten. Als sie hindurchging, zerriss sie mit ihrem Körper feucht glitzernde Spinnweben. Hier und da blieb sie stehen, um eine tote Blüte abzuschneiden oder an einer Knospe zu riechen. Es war noch früh im Jahr, aber einige wenige Rosen blühten bereits. Im Vorbeigehen redete sie mit jedem Busch.
»Prächtig machst du dich, Charlotte Armstrong. All diese Knospen! In diesem Sommer wirst du eine vollkommene Schönheit sein. Wie geht es dir, Tiffany? Da sehe ich doch ein paar Blattläuse. Ich werde dich spritzen müssen. Guten Morgen, Queen Elizabeth, du siehst sehr gesund aus, aber du ragst zu weit in den Pfad hinein. Ich hätte dich an dieser Seite mehr beschneiden müssen.«
Irgendwo in der Ferne hörte sie ein klopfendes Geräusch. Dazwischen erklang das Trillern einer Blaumeise, die auf der Hecke saß. Plötzlich wurde ihr bewusst, dass das Klopfen von ihrem Haus kam. Heather oder Linda konnten es nicht sein, sie wären ums Haus herumgekommen. Sie drehte sich um. Regentropfen spritzten von den Blättern, als sie die Rosenbüsche streifte. Sie eilte über den Rasen und um die Haustür herum. An der Küchentür setzte sie den Eimer ab.
Eine schäbig gekleidete Frau mit einem Krug in der Hand wandte sich gerade von der Haustür weg. Sie sah aus, als hätte sie die ganze Nacht im Freien verbracht; ihr Haar war verfilzt, auf ihrem Gesicht waren Schmutzflecken zu sehen. Sie war etwa so groß wie Marjorie, aber dünner, und sie hatte hängende Schultern.
Marjorie zögerte, die Frau ebenso. Sie musterten einander über den U-förmig geschwungenen Kiesweg hinweg. Dann trat Marjorie einen Schritt vor.
»Guten Morgen.« Sie wollte noch sagen: »Kann ich etwas für Sie tun?«, unterließ es aber; sie war sich unschlüssig, ob sie für die Frau etwas tun wollte oder nicht.
»Morgen, Frollein. Können Sie mir vielleicht was Milch leihen? Ich hab nix mehr, und die Kleinen haben noch kein Frühstück gehabt.« Ihr Auftreten war selbstsicher, aber irgendwie nicht herzlich.
Marjories Augen verengten sich. »Wo kommen Sie her?«, fragte sie.
»Wir sind grade in die alte Farm unten an der Straße eingezogen. Nur’n bisschen Milch, Gnädigste.« Den Krug ausgestreckt, kam die Frau näher.
Die alte Farm - aber die ist doch verlassen, dachte Marjorie. Es müssen Squatter sein. Ihr Unbehagen wuchs.
»Wieso kommen Sie hierhin? Die Läden haben um diese Zeit schon geöffnet. Und an der Straße liegt eine Farm, wo Sie Milch kaufen können.«
»Aber, Gnädigste, Sie woll’n doch wohl nicht, dass ich meilenweit renne und die Kleinen warten lasse, oder? Sie kriegen’s zurück. Glauben Sie mir nicht?«
Nein, dachte Marjorie. Warum war die Frau nicht zu ihresgleichen gegangen? Nur ein paar Meter hinter ihrer Behausung standen ein paar kleine Siedlungshäuser.
»Tut mir Leid«, sagte sie entschlossen, »aber ich habe nichts übrig.«
Einen Moment lang standen sie Auge in Auge. Dann wandte die Frau sich auf das Gebüsch zu.
»Hierher, Rog«, rief sie. Ein großer, hagerer Mann tauchte zwischen den Rhododendronsträuchern auf. An der Hand zog er einen kleinen Jungen mit sich. Marjorie musste sich zusammenreißen, um ihre Angst zu verbergen. Sie stand starr, den Kopf ein wenig zurückgelegt, und versuchte den Eindruck zu erzeugen, die Situation unter Kontrolle zu haben. Der Mann trat neben die Frau. Marjories Nasenlöcher weiteten sich unmerklich, als sie den herben Geruch von Schweiß und Rauch aufnahm. Er trug eine Mischung von Kleidungsstücken, die aus vielen verschiedenen Quellen stammen mussten; eine Stoffmütze, einen langen gestreiften Collegeschal, Wollhandschuhe mit aufgetrennten Fingern, ein Paar blaugemusterte Espadrillen, bei denen eine Sohle sich schon löste, Hosen, die einige Zentimeter zu kurz und zu weit waren, und obendrein eine üppig bestickte Weste unter einer verschmutzten alten Vinyljacke. Er war wahrscheinlich in Marjories Alter, sah aber zehn Jahre älter aus. Sein Gesicht war ledrig, seine Augen waren tief eingesunken, und mehrere Tage alte Bartstoppeln bedeckten sein Kinn. Sie war sich des Kontrasts bewusst, den sie zu den beiden bildete: rosig und wohlgenährt, das kurze Haar vom Waschen weich, ihre Haut von Cremes und Lotions gepflegt, bekleidet mit, wie sie es nannte, »alten« Gartensachen: einem flauschigen blauen Wollrock, einem selbstgestrickten Sweater und einer Lammfelljacke.
»Denken Sie etwa, wir nehmen Ihnen ab, dass Sie keine Milch im Haus haben?«, knurrte der Mann.
»Das habe ich nicht gesagt.« Marjorie sprach gepresst. »Ich habe genug für mich und meine Familie, aber nicht mehr. Da unten sind genug andere Häuser, in denen Sie es versuchen können, aber ich würde vorschlagen, Sie gehen ins Dorf und kaufen Milch. Es ist nur eine halbe Meile. Tut mir Leid, dass ich Ihnen nicht helfen kann.«
»Nichts tut Ihnen Leid! Sie woll’n einfach nich helfen. Hochnäsig wie alle reichen Typen. Sie woll’n alles für sich behalten. Sehn Sie nur, was Sie da haben -’n großes, schönes Haus nur für sich allein, schätze ich. Sie wissen nich, wie hart das Leben für unsereins ist. Vier Jahre hab ich keinen Job gehabt und keine Wohnung, aber Sie haben’s bequem …«
»Rog!«, sagte die Frau warnend. Sie legte ihm die Hand auf den Arm. Er schüttelte sie ab und machte einen Schritt auf Marjorie zu. Sie blieb stehen, Wut stieg in ihr auf. Welches Recht, zum Teufel, hatten sie, hierher zu kommen und sie in ihrem eigenen Garten anzuschreien?
»Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass ich nur genug für meine Familie habe. Für jeden ist es eine schwere Zeit«, sagte sie kühl. Aber ich würde nie betteln gehen, dachte sie. Kein moralisches Rückgrat, diese Leute.
Der Mann kam näher. Instinktiv ging sie zurück und wahrte den Abstand zwischen sich und ihm.
»Für jeden eine schwere Zeit«, äffte er sie nach. »Schlimm, nich wahr? Schlimm für jeden, solange man’n hübsches Haus hat und genug zu essen und vielleicht’n Auto und’nen Fernseher.« Seine Augen wanderten über das Haus, nahmen die Garage, die Fernsehantenne auf dem Dach und die Fenster auf. Gott sei Dank waren die Fenster verschlossen, dachte sie, und die Haustür auch.
»Ich kann Ihnen nicht helfen. Würden Sie jetzt bitte gehen.« Sie drehte sich um und wollte wieder ums Haus herumgehen. Der Mann hielt Schritt mit ihr, stumm folgten ihm die Frau und das Kind.
»O ja, so ist es richtig. Drehn Sie uns nur den Rücken zu und gehn in Ihr großes Haus. So leicht werden Sie uns nich los. Der Tag wird kommen, an dem ihr alle von euerm verdammten hohen …«
»Ich wäre Ihnen dankbar, wenn …«
»Es reicht, Rog!«
»Eure Zeit ist abgelaufen. Es wird’ne Revolution geben, und dann bettelt ihr um Hilfe. Und denken Sie etwa, Sie kriegen welche? Nich’n bisschen!«
Marjorie beschleunigte ihren Schritt und versuchte, ihn abzuschütteln, bevor sie die Küchentür erreichte. Sie
1
»Mars ist der Himmel«. Wesentlich bekannter ist diese Erzählung unter dem Titel »Die dritte Expedition« in Bradburys »Mars-Chroniken«. - Anm. d. Übers.
2
Der Piltdown-Mensch war ein Schädel, der 1908 bei Piltdown in Sussex gefunden und für eine Zwischenform von Affe und Mensch gehalten, 1953 aber als Fälschung entlarvt wurde. - Anm. d. Übers.
Titel der amerikanischen Originalausgabe TIMESCAPE Deutsche Übersetzung von Bernd Holzrichter Vorwort, Anhang sowie aus den bisherigen deutschen Ausgaben gestrichenen Romantext übersetzte Erik Simon
Umwelthinweis:Dieses Buch wurde auf chlor- und säurefreiem Papier gedruckt.
Redaktion: Erik Simon
Copyright © 1980 by Gregory Benford und Hilary Benford Copyright © 2006 des Vorworts by Jack McDevitt Copyright © 1992 des Anhangs by Susan Stone-Blackburn Copyright © 2006 dieser Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München in der Verlagsgruppe Random House GmbH www.heyne.deUmschlagillustration: Clark Dunbar/Getty Images
eISBN : 978-3-641-02424-6
Leseprobe
www.randomhouse.de