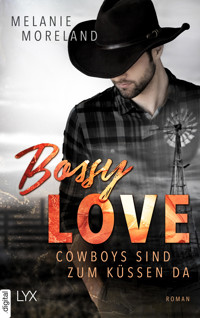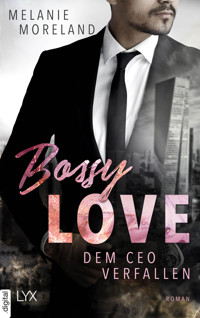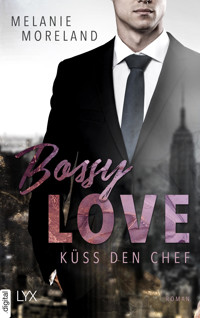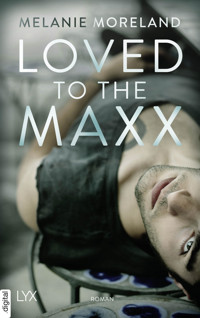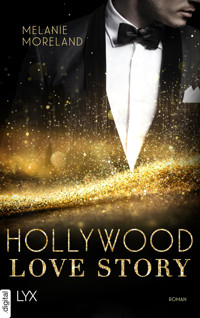6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Berührend, herzzerreißend, einfach magisch!
Alles, was Zachary Adams will, ist allein gelassen zu werden. Menschen meidet er, da sie sich von seinen Narben abgestoßen fühlen. Seine Bilder, der Ozean und die Einsamkeit - das ist seine Welt. Doch dann lässt er Megan Greene in sein Leben. Auf der Flucht vor ihrer Vergangenheit, hat die junge Schriftstellerin nur ein Ziel: zur Ruhe kommen. Das Sommerhaus in Maine, das ihr eine Freundin zur Verfügung stellt, ist perfekt. Das Meer, der Strand und das kleine Städtchen sind alles, was sie braucht. Bis sie über ein Gemälde stolpert, das sie auf den ersten Blick fasziniert. Bis sie auf den verschlossenen Künstler trifft, der ihr mit diesem Bild aus der Seele spricht. Bis sie Zachs Geheimnisse aufdeckt und damit zerstört, was sie sich aufgebaut haben ...
"Ein unglaublich gefühlvolle Liebesgeschichte!" Book Bitches
Der neue Roman von Bestseller-Autorin Melanie Moreland
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 462
Ähnliche
Inhalt
TitelZu diesem Buch12345678910111213141516171819202122232425262728EpilogDanksagungDie AutorinMelanie Moreland bei LYX.digitalImpressumMELANIE MORELAND
Beneath the Scars
Nie wieder ohne dich
Roman
Ins Deutsche übertragen von Andreas Heckmann
Zu diesem Buch
Alles, was Zachary Adams will, ist allein gelassen zu werden. Menschen meidet er, da sie sich von seinen Narben abgestoßen fühlen. Seine Bilder, der Ozean und die Einsamkeit – das ist seine Welt. Doch dann lässt er Megan Greene in sein Leben. Auf der Flucht vor ihrer Vergangenheit, hat die junge Schriftstellerin nur ein Ziel: zur Ruhe zu kommen. Das Sommerhaus in Maine, das ihr eine Freundin zur Verfügung stellt, ist perfekt. Das Meer, der Strand und das kleine Städtchen sind alles, was sie braucht. Bis sie über ein Gemälde stolpert, das sie auf den ersten Blick fasziniert. Bis sie auf den verschlossenen Künstler trifft, der ihr mit diesem Bild aus der Seele spricht. Bis sie Zachs Geheimnisse aufdeckt und damit zerstört, was sie sich aufgebaut haben …
Für Matthew,der zu sehen vermag, was unter meinen Narben liegt, und mich mit einer Unbedingtheit liebt, die mir den Atem verschlägt. Du bist meine Welt.
Dem Andenken meiner geliebten Mutter, die jeden Moment dieser Reise genossen hätte. Ich vermisse dich Tag für Tag.
1
Megan
Je weiter ich mich entfernte, desto entspannter wurde ich; meine Schultern lockerten sich, als die Stadt zurückblieb und sich freier Raum vor mir erstreckte. Ich fuhr nicht schnell, sondern ließ mir Zeit und genoss die Landschaft. Aus den Lautsprechern kam klassische Musik, und das sanfte Crescendo der Streicher tat meinen Nerven gut. Normalerweise hörte ich zeitgenössische Musik, doch in diesem Moment brauchte ich die beruhigenden Klänge von Bach. Ich ließ das Fenster runter und streifte endlich mein Haarband ab. Zusammengebunden trug ich die Haare nur bei der Arbeit oder im Hochsommer, und nun genoss ich es, wie der Wind hineinfuhr und mir Kopf und Hals kühlte.
Immer öfter blitzten Wasserflächen auf; das Panorama wandelte sich, und statt zähflüssigem Verkehr gab es leere Straßen. Vereinzelte Bäume standen in der hügeligen Landschaft, die nach dem überstandenen Winter noch kahl dalag und die Rückkehr von Frühling und Wärme erwartete.
Mir war ganz ähnlich zumute.
Am späten Nachmittag hielt ich vor dem kleinen Laden in Cliff’s Edge. Das Küstenstädtchen war ruhig. Zu dieser Tageszeit hatten die meisten Geschäfte geschlossen; von den Einheimischen abgesehen, war die verschlafene Ansiedlung fast ausgestorben. Genau an einem solchen Ort wollte ich sein.
Der Drang, Boston zu verlassen, hatte mich plötzlich übermannt. Meine Freundin Karen hatte mir ihr Haus am Strand angeboten, und ich hatte nicht mal der Schlüssel wegen bei ihr vorbeigesehen, sondern war direkt zu Coopers Gemischtwarenladen gefahren, um die Zweitschlüssel abzuholen.
Karen war nicht glücklich darüber gewesen, dass ich so spät noch aufbrechen wollte, sie meinte, ich sollte doch bis zum nächsten Tag warten, aber ich wollte los, musste fliehen. Die Mail, die ich am frühen Nachmittag bekommen hatte, war der Tropfen gewesen, der das Fass hatte überlaufen lassen.
Doch daran wollte ich nicht denken und konzentrierte mich darauf, wohin ich unterwegs war: zum Strandhaus. Karens Worte »privat« und »abgelegen« gingen mir im Kopf herum – beides klang großartig.
Ich holte tief Luft, stieg aus dem Wagen, streckte mich und betrat den hell erleuchteten Laden, um die Schlüssel zu holen und mir die letzte Wegstrecke beschreiben zu lassen.
Das Haus war unerwartet weit von der Kleinstadt entfernt, die Wegbeschreibung kompliziert. So hatte Mrs Cooper mir angeboten vorauszufahren. Ich folgte ihrem Wagen über steile Straßen und seufzte erleichtert, als wir schließlich hielten. Die Rücklichter ihres Fords erloschen, und auch ich schaltete den Motor aus, ließ den Kopf auf die Brust sinken und genoss die neuen Geräusche ringsum. Es fühlte sich gut an, hier zu sein – an einem anderen Ort und allein.
Kaum war ich ausgestiegen und hatte meine Jacke angezogen, wollte ich Dixie aus ihrer Transportbox befreien und mit ins Haus nehmen. Sie musste müde sein, nachdem sie so lange in dem kleinen Kasten eingesperrt gewesen war, wo es auf Autofahrten sicherer für sie war. Als ich aber die Heckklappe des Wagens öffnete, schoss mein kleiner Hund aus seiner Box; irgendwie musste er den Riegel aufbekommen haben und stürmte nun bellend und schwanzwedelnd auf den dichten Wald hinterm Haus zu. Ich hetzte ihr nach, und wir spielten einige Minuten lang Fangen, ehe ich Dixie mit Mrs Coopers Hilfe in die Enge treiben und an die Leine nehmen konnte. Keuchend lehnte ich an meinem Wagen, während die Händlerin über unser Tollen lachte. »Das Tier hält Sie gut auf Trab.«
Ich nickte. »Ihre Umgebung erkundet sie liebend gern.« Erneut holte ich tief Luft. »Danke, dass Sie mich hierher gelotst haben. Sie hatten recht – allein hätte ich das Haus nie gefunden.«
Mrs Cooper bückte sich zu Dixie und kraulte ihr die Ohren. »Kaum zu fassen, dass Sie so spät gekommen sind, Megan. Gut, dass ich Sie herbringen durfte. Ich habe gestaunt, als Karen mir am Telefon sagte, Sie kämen schon heute. Sie war etwas besorgt wegen Ihrer Ankunftszeit.«
Achselzuckend zupfte ich mir am Ohrläppchen. »Ich wollte einfach weg.« Das Meer rauschte, und ich roch die herrliche Seeluft. »Ich wollte morgen hier aufwachen, wenn Sie verstehen.«
Sie schnalzte bestätigend und gab mir die Schlüssel in die Hand. »Haben Sie, was Sie brauchen?«
»Ich hab einiges mitgebracht und kaufe morgen noch mal ein.« Bei meinem Besuch des kleinen, aber erstaunlich gut sortierten Gemischtwarenladens hatte ich vor allem zweierlei besorgt: Ich wollte eine Menge fettiges Popcorn essen und dann eine Großpackung Eis vertilgen. Zwar hatte ich nicht an die Fruchtsoße gedacht, aber die würde ich nachkaufen.
»Gut. Es ist alles für Sie vorbereitet – mein Mann ist gleich nach Karens Anruf hergefahren und hat nachgesehen, ob alles in Ordnung ist. Ich hab ihm noch einiges mitgegeben. Sie dürften heute Abend also versorgt sein.« Sie hielt inne. »Soll ich mit Ihnen hineingehen?«
Ihre Umsicht ließ mich lächeln. »Danke, ich komme zurecht. Ich bringe schnell meine Sachen ins Haus, und dann gehe ich mit Dixie ein wenig spazieren; später machen wir uns einen ruhigen Abend.«
»Aber gehen Sie nicht zu weit. Sie sehen ja: Der Wald ist dicht – da verläuft man sich leicht.«
»Wir schlendern nur kurz am Strand entlang.« Ich trat einen Schritt von ihrem Auto weg. »Gute Nacht, Mrs Cooper.«
»Nehmen Sie beim Spazierengehen die Taschenlampe aus der Küche mit. Mein Mann hat neue Batterien eingesetzt. Unsere Telefonnummer haben Sie – rufen Sie an, wenn Sie etwas brauchen.«
Sie winkte mir und fuhr davon, und im nächsten Moment war ich allein.
Ein kurzes Bellen ließ mich schmunzeln. Ich hob Dixie hoch, lachte, als sie mit ihrer rauen Zunge über meine Wange leckte, strich ihr über den Kopf, trug sie zur Veranda und war froh, dass alle Schlüssel Etiketten besaßen. Ich schloss die Hintertür auf und brachte Dixie ins Haus, um ihr ein Schlafplätzchen zu bereiten und mich dann ans Entladen des Autos zu machen. Im vorderen Teil des Hauses musterte ich das gemütlich wirkende Zimmer. Der Ausblick war atemberaubend.
Rasch setzte ich Dixie ab und trat näher an das Panoramafenster heran, ohne den Blick von der Aussicht zu wenden. Die Sonne war fast versunken; nur letzte Strahlen schimmerten auf dem Wasser. Die herrliche Szenerie vor meinen Augen schlug mich in Bann. Das Haus lag ein Stück vom Ufer entfernt und deutlich über dem Strand, aber doch so nah am Meer, dass ich sah, wie sich die Wellen am felsigen Ufer brachen. Das Rauschen der Brandung war sogar durch die geschlossenen Fenster zu hören. Neben mir hatte Dixie sich auf die Hinterbeine gestellt und sah schwanzwedelnd durch die Scheibe. Ich lächelte zu ihr hinunter und kraulte sie an den Ohren. »Das Auto kann warten. Lass uns spazieren gehen!«
Ich vergewisserte mich, dass Dixie angeleint war, nahm die Taschenlampe und ging mit meinem Hund zum Strand hinab. Die Luft war frisch und rau, und ihr salziger Geruch füllte meine Lunge. Der Wind schlug mir kalt ins Gesicht, und als wir ans Wasser kamen, spürte ich die eisige Gischt der gegen die Felsen donnernden Brecher. Die gewaltigen Räume von Meer und Himmel schnürten mir beinahe die Kehle zu. Die schlichte Schönheit, dazu der brausende Wind und die rauschenden Wellen als einzige Geräusche, all das trieb mir unversehens Tränen in die Augen. Ich schlang die Arme um den Leib und stieß – froh, schon heute gekommen zu sein – einen erleichterten Seufzer aus. Dixie rannte, so weit die Leine reichte, beschnüffelte alles und bellte fröhlich. Nach einem weiteren tiefen Atemzug wischte ich mir die Nässe von den Wangen, und wir gingen am Wasser entlang und genossen das Offene ringsum. Ich zog die Jacke fester zusammen, stellte mich mit dem Rücken zum Ozean und betrachtete das Haus, in dem ich wohnen würde.
Seine ganze Seeseite war ein einziges Panoramafenster, das bequemen Ausblick aufs Meer bot – jenen Ausblick, der mich an den Strand getrieben hatte. Wände aus rustikalen Steinquadern umrahmten das Fenster, und davor lag eine große Terrasse, aber das Gebäude war weniger groß, als ich es bei Karens Geschmack erwartet hatte. Ich musste lächeln: Hier waltete offenbar der Einfluss ihres Mannes Chris. Die Formen waren einfach und klar, fast streng. Er kam oft für längere Zeit nach Cliff’s Edge, während Karen immer nur kurz blieb. Ihr war das Städtchen zu klein; es gab keine Bars und Klubs, keine großen Läden und zu wenig Wellness- und Beauty-Angebote, um sie beschäftigt zu halten. Chris dagegen genügten wie mir ein Buch, eine Tasse Kaffee und der herrliche Ausblick; Karen wurde es schnell langweilig bei diesem Angebot.
Mein Blick glitt zu den beiden anderen Gebäuden dieses abgeschiedenen Küstenstreifens. Das eine stand nah am Strand und war um einiges größer als das von Karen und Chris; das Haus, von dem Karen mir gesagt hatte, es sei das ganze Jahr bewohnt, lag am anderen Ende oben auf der Klippe. Licht drang durch die Vorhänge, und es tröstete mich etwas, dass es an diesem verlassenen Strand noch jemanden gab – auch wenn er laut Karen zurückgezogen lebte und recht unnahbar war. Alle drei Häuser hatten hinter sich den dichten Wald und vor sich den Ozean. Die Straße hierher war schwer zu finden, jedenfalls stieß man nicht so einfach auf sie. Das bot denen, die hier lebten, viel Privatsphäre. Inzwischen verstand ich, warum Karen mir geraten hatte, bei Tag anzureisen.
Mir fiel ein Licht ins Auge. Wieder sah ich zum Haus auf der Klippe und überlegte, wie überwältigend die Aussicht von dort oben sein musste, wenn schon der Blick vom Strand so großartig war. Das Haus war das größte der drei und hatte drei Etagen. Nur in der obersten brannte Licht. Es lag am abgelegensten, hoch über dem Wasser und fast völlig umgeben von dichtem Wald.
Dixie zerrte an der Leine und riss mich aus meinen Gedanken. »Lass uns auspacken und Popcorn und Kakao machen. Das Sofa im Wohnzimmer ruft, und ich will unbedingt das neue Buch anfangen zu lesen.« Ich seufzte zufrieden – meine Vorstellung von einem vollkommenen Abend würde erweitert werden um das gedämpfte Rauschen des Meeres, das gegen die Felsen und auf den Strand brandete. Auf dem Rückweg hörte ich ein unheimliches Heulen tief aus dem Wald. Ein Frösteln, eisiger als das Meer, durchfuhr mich. Ich nahm Dixie hoch und erinnerte mich an Karens Warnung vor den Tieren im Wald.
»Du bleibst schön an der Leine, solange wir hier sind.« Ich tätschelte Dixie, die mir den Kopf zuwandte und mir durchs Gesicht leckte. »Du wärst ein Leckerbissen für die Kojoten und Wölfe da draußen – oder was für Tiere auch immer das sind.« Wieder ertönte ein trauriges Heulen und ließ mich schaudernd ins Haus eilen. Ich setzte Dixie ins Gästezimmer und schloss die Tür, damit sie in Sicherheit war. Obwohl das Geheul aus weiter Ferne kam, schaltete ich alle Außenlichter ein, ehe ich den Wagen entlud. Und war froh, als ich damit fertig war und die Hintertür von innen fest schließen konnte.
2
Megan
Am nächsten Morgen ging ich viel weniger angespannt als am Vortag mit weit schwingenden Armen am Strand spazieren und bewunderte die Schönheit vor meinen Augen. Es war noch immer sehr kalt. Vor mir rannte Dixie und blieb oft stehen, um zu schnuppern und alles anzubellen, was ihr missfiel. Das bescheidene Vergnügen, sie dabei zu beobachten, genügte, um mich zum Lachen zu bringen. Es war noch früh; die Sonne war erst vor Kurzem aufgegangen, warf ihre vielfarbigen Strahlen über das Wasser und beleuchtete den Strand. Die Erleichterung vom Vorabend hatte Wurzeln geschlagen und mir ein Hochgefühl beschert. Mit über den Kopf gestreckten Armen drehte ich mich um mich selbst, bis mir schwindlig wurde und ich mich – amüsiert über meine Anwandlungen – auf den Sand werfen musste. Dixie sprang heran und leckte mir durchs Gesicht. Ich setzte mich auf und umarmte sie innig. Der Wind blies mir das Haar aus dem Gesicht, ich warf den Kopf in den Nacken und genoss ihn.
Ich schloss die Augen, atmete die frische Luft tief ein, lauschte der an die Küste schlagenden Brandung und den Möwenschreien über mir und spürte, wie mir Gischt ins Gesicht geweht wurde.
Hier würde ich hoffentlich innere Ruhe finden, meine Schreibfähigkeit zurückerlangen, die letzten Wochen voll furchtbarer Verletzungen und Peinigungen wegschieben, wieder Tritt fassen und vorwärtsgehen. Ich öffnete die Augen und sah aufs Wasser hinaus. Hier gab es keinerlei Ablenkung. Keine Kameras, keine störenden Anrufe drangen in mein einst so abgeschirmtes Leben, keine Drohungen meines Exfreundes, und niemand sagte mir, wie enttäuscht er über meinen Verrat sei. Ich stand auf, klopfte mir den Sand von der Hose und betrachtete das Haus, dessen klare Linien im Tageslicht noch augenfälliger waren. Hier würde ich arbeiten können. Wieder zu Kräften kommen. Mein Gleichgewicht zurückerlangen.
Ein Bellen ließ mich den Kopf wenden. Vom anderen Ende des Strands kam ein Hund angerannt. Ich nahm Dixie hoch, da ich das große Geschöpf nicht kannte, das da heranstürmte, sah aber bald, dass es ein Golden Retriever war; sein Gesicht war freundlich, und er wedelte mit dem Schwanz. Ich streckte die Hand aus, und er beschnüffelte und leckte sie mehrfach, um sich stets wieder umzudrehen, zu bellen und aus tiefster Kehle zu wimmern. Ich kniete nieder und ließ Dixie und den großen Hund sich vorsichtig beschnuppern. Als ich mir sicher war, dass er ihr nichts Böses wollte, setzte ich Dixie wieder auf den Sand, wo die beiden sich inspizierten. Ich lächelte unwillkürlich: Der eine Hund war groß und entzückt, der andere klein und misstrauisch. Der Retriever war sehr sanft zu meiner Dixie, stupste sie spielerisch mit seiner großen Nase und leckte ihren Kopf. Sie sah mich an, als wollte sie fragen: »Was denn?«, legte sich dann zwischen seine großen Pfoten und genoss die Aufmerksamkeit, die er ihr entgegenbrachte. Schmunzelnd betrachtete ich die beiden – zwei, die sofort Freundschaft geschlossen hatten.
Von Weitem hörte ich eine Pfeife schrillen. Ein Mann stand auf der Treppe von der Klippe zum Strand, und sein dunkler Mantel flatterte in der steifen Brise. Sofort erhob sich der Retriever und rannte zu seinem Herrn, der keinen Schritt in unsere Richtung tat. Ich hob die Hand und winkte, denn ich fand, das sei eine gute Gelegenheit, mich ihm vorzustellen. Er aber erwiderte meinen Gruß nicht, sondern blieb reglos auf der Treppe stehen. Ich machte ein paar Schritte auf ihn zu, überlegte, ob er mich vielleicht nicht gesehen hatte, und winkte erneut.
Schließlich hob er die Hand zu einem kurzen Gruß. Das nahm ich als Einladung und sah lächelnd zu Dixie runter. »Komm, lernen wir unseren Nachbarn kennen.« Doch als ich wieder aufschaute, hatte er sich bereits umgedreht und war oben an der Treppe; sein großer Hund folgte ihm dichtauf. Es war offenkundig: Er hatte kein Interesse, meine Bekanntschaft zu machen.
»Unfreundlich« hatte Karen ihn genannt. Und »aggressiv verschlossen«.
Chris dagegen hatte eingewandt, er lege eben Wert auf Privatsphäre und sei »zurückhaltend«.
Ich sah ihn verschwinden, vermutlich ins Haus, das bei Tageslicht noch größer und beeindruckender wirkte als am Vorabend. Aus Stein und Zedernholz errichtet, stand es hoch über dem Meer wie eine Festung zwischen den Bäumen: eine Privatsphäre, die den Eindruck aggressiver Verschlossenheit erweckte. Es wirkte so wie mein Nachbar selbst.
Ich seufzte – das war wirklich unfreundlich gewesen. Fast unverschämt. Ich hatte mich ihm nur vorstellen wollen! Unsere Hunde hatten sich schon getroffen und angefreundet. Kopfschüttelnd beschloss ich, dass es egal war. Ich war schließlich nicht hier, um Menschen kennenzulernen oder Freundschaften zu schließen. Sondern um Frieden und Trost zu finden und mein Leben auf die Reihe zu bekommen.
Mochte mein Nachbar nun unverschämt sein oder nicht!
»Sind Sie mit allem zufrieden?«
Ich lächelte Mrs Cooper an. »Sehr. Vielen Dank für das, was Sie mir hingestellt haben. An Toastbrot hatte ich gar nicht gedacht. Die Butter, die ich gekauft hatte, war für Popcorn bestimmt.«
»Kein Problem. Fahren Sie gleich zum Haus zurück?«
»Ich dachte, ich schau mich hier ein bisschen um.«
»Wunderbar. Die Galerie weiter unten an der Straße ist sehr schön. Ich lasse meinen Mann die Sachen in Ihr Auto laden, während Sie sich in der Stadt umsehen. Zu dieser Jahreszeit ist längst nicht alles geöffnet. Aber falls Sie Hunger haben: Im Café gibt es tolles Mittagessen.«
»Danke, das probiere ich.«
»Wo ist denn Ihr kleiner Hund?« Mrs Cooper hielt nach Dixie Ausschau.
»Der ist zu Hause und schläft. Heute Morgen haben wir einen langen Strandspaziergang gemacht.« Ich zögerte. »Dabei haben wir einen anderen Hund getroffen – einen Golden Retriever, sehr freundliches Tier.«
»Das war sicher Elliott, der Hund von Zachary.«
Der Nachbar besaß also einen Namen. Nun erst fiel mir auf, dass Karen ihn nie genannt und ich nicht danach gefragt hatte. »Den hab ich nicht kennengelernt. Er ist nicht runter zum Strand gekommen.«
Erstmals blickte Mrs Cooper bekümmert. »Zachary legt großen Wert auf … seine Privatsphäre und hält sich von allen Menschen fern.« Ich war mir recht sicher, dass sie noch »der arme Mann« gemurmelt hatte, aber vielleicht hatte ich mir das auch eingebildet.
»Ich habe ihm gewunken.«
Sie lächelte, doch ihre Augen blieben ernst. »Hat er reagiert?«
»Irgendwie. Mit einem kurzen Gruß. Er schien aber kein Interesse daran zu haben, mich kennenzulernen.«
»Nicht persönlich nehmen! Den meisten Einheimischen hat er nie gewunken, obwohl er schon lange hier wohnt. Wie gesagt, er hält sich praktisch von allen Menschen fern.«
Ihr Ton machte deutlich, dass sie über meinen Nachbarn nicht weiter reden wollte. Also dankte ich ihr erneut und versprach, in ein paar Tagen wieder vorbeizukommen.
Draußen sah ich die nahezu entvölkerte Straße auf und ab. Gut möglich, dass die Gehwege im Sommer voller Menschen waren, viele Urlauber das hiesige Warenangebot probierten und in den Restaurants aßen, aber zu dieser Jahreszeit war Cliff’s Edge – von den wenigen Einheimischen abgesehen – eine Geisterstadt. Ein bitteres Lächeln umspielte meinen Mund: Genau das war es, was ich brauchte.
Als ich die Straße überqueren wollte, fuhr ein SUV mit dunkel getönten Scheiben an mir vorbei und bog an der Ecke ab. Er glänzte nagelneu und schien mir nicht zu den älteren Autos zu passen, die sonst in der Stadt geparkt waren. Stirnrunzelnd sah ich den Wagen verschwinden und überlegte, warum er mir aufgefallen war – vermutlich nur wegen seiner Langsamkeit. Ich setzte den Erkundungsgang durch die Läden fort und sah mich in manchen Geschäften etwas länger um. Ich kaufte beim Bäcker Brot und Kekse, dann ein paar Flaschen Wein, und im Café nahm ich ein kleines Mittagessen zu mir. Mrs Cooper hatte recht: Das Essen war sehr gut, und so kaufte ich dort noch eine Suppe, um sie mir am nächsten Tag aufzuwärmen.
Ich verstaute meine Einkäufe und beschloss, die Galerie zu besuchen, die Mrs Cooper erwähnt hatte. Laut Plakat im Fenster stellten dort heimische Künstler aus; erneut war ich mir sicher, dass das Geschäft im Sommer brummte. Eine Türglocke läutete, als ich eintrat. Die Galerie war leer, doch aus einem Hinterzimmer drangen Stimmen. Kurz darauf erschien ein Mann und versicherte mir, er komme gleich. Ich erwiderte sein Lächeln und sagte, er solle sich nicht beeilen, ich wolle mich ohnehin nur umschauen.
Die Vitrinen enthielten beeindruckende Objekte. Von den üblichen Geschmacklosigkeiten für Touristen war nichts zu finden. Dafür gab es herrliche Bleiglasarbeiten, zarte Holzskulpturen, handgemachte Seidenschals und Schmuck, alles ansprechend präsentiert. Ich unterdrückte ein Lächeln: Karen fand diesen Laden bestimmt herrlich.
Im hinteren Bereich der Galerie hing eine großartige Sammlung von Gemälden. Viele ganz unterschiedliche Künstler waren ausgestellt, doch vor allem die Arbeiten eines Malers erregten mein Interesse. Mehrere Werke von ihm hingen in einem Kabinett, und ihre Kunstfertigkeit erschloss sich auch meinem ungeübten Auge unmittelbar. Seestücke, tiefe Wälder, herrliche Strände – alles war so lebensnah und detailgetreu wiedergegeben, dass ich meinte, Fotografien zu betrachten. Licht und Farbe waren verblüffend. Signiert waren die Bilder nicht – nur die Initialen Z D A in fetter Schrift schmückten die Werke. Vor allem ein Gemälde fesselte mich, und seine Schönheit schlug mich in Bann: das Bild eines Sturms, der sich Richtung Küste bewegte und direkt auf mich zuzukommen schien. Wildheit und Kraft waren perfekt eingefangen. Das Stahlgrau und Weiß der zornigen Wolken, die das Wasser zu enormen Wellen peitschten und es an die Felsen krachen ließen, waren so überwältigend, dass ich fast zu spüren meinte, wie mir die kalte Gischt von der Leinwand ins Gesicht schlug. Was der Wind an Farbwirbeln im Wasser in Bewegung setzte, war faszinierend; das Chaos war so lebensecht dargestellt, dass sich fast nicht sagen ließ, wo das Meer begann und die Wolken endeten. Mir war, als hätte der Künstler meine aufgepeitschten Empfindungen genau getroffen und sie so auf die Leinwand gebannt, dass jeder sie sehen konnte. Minutenlang stand ich da und starrte versunken auf das Bild, bis ein Geräusch mich zusammenfahren ließ. Ich spürte jemanden hinter mir vorbeigehen und seufzte leise. Der Geruch des Meeres mit all seinen berauschenden Aromen traf mich mit voller Wucht, und mir war, als würden Sonne, Sand und Wasser selbst hinter mir vorüberziehen.
Beim Umdrehen nahm ich aus dem Augenwinkel kurz einen groß gewachsenen Mann wahr, der sich eilig entfernte. Den Mantelkragen hatte er hochgeschlagen, sodass sein Gesicht fast ganz verdeckt war, und eine gehäkelte Mütze saß tief in seiner Stirn. Mit breiten, gestrafften Schultern öffnete er die Hintertür der Galerie. Bevor er verschwand, sah ich für einen Sekundenbruchteil sein Profil – er hatte eine gerade Nase und einen Stoppelbart. Seine langen Finger ruhten kurz auf dem Türrahmen, und etwas prangte auf dem Handrücken – ein Muttermal vielleicht oder eine Narbe? Er war so rasch auf und davon, dass ich es nicht besser erkennen konnte.
Ich hatte ein äußerst merkwürdiges Gefühl und wollte ihm nachrufen, ihn aufhalten, wollte, dass er zurückkehrte, doch ich unterdrückte den Impuls. Mir fiel auf, dass ich die Hand nach dem Bild vor mir ausgestreckt hielt, und ich senkte den Arm und fragte mich, wodurch diese eigenartige Geste zustande gekommen sein mochte. Aus dem Quietschen von Reifen hinterm Haus schloss ich, dass der Mann, der die Galerie so gehetzt verlassen hatte, es eilig hatte, und stöhnte vor Enttäuschung. In jüngster Zeit schienen alle Männer vor mir zu fliehen.
Der mysteriöse Mann war jedoch sofort vergessen, als mich die Kraft des Gemäldes erneut in den Bann schlug. Seine Schönheit faszinierte mich so, dass ich beschloss, es zu kaufen. Ich musste es besitzen.
»Großartig, nicht wahr?« Ein anderer Mann erschien. Er war ebenfalls groß, trug sein graues Haar zum Pferdeschwanz gebunden und lächelte offen und freundlich. Unwillkürlich erwiderte ich sein Lächeln.
»Ja«, gab ich zurück. »Der Schmerz darin … ist so tief empfunden, dass er sich auf den Betrachter überträgt.«
»Dieses Bild stammt von einem der beliebtesten Künstler unserer Region.« Der Mann streckte mir seine Hand entgegen. »Ich bin Jonathan. Meiner Frau und mir gehört die Galerie.«
Ich schüttelte die Hand. »Eine wunderbare Ausstellung haben Sie hier. Ich bin Megan.«
»Vielen Dank. Meine Frau Ashley fertigt den ganzen Schmuck und die Schals. Sind Sie auf der Durchreise?«
Ich schüttelte den Kopf. »Ich wohne oben bei den Klippen.«
Er hob die Brauen. »Dann sind Sie mit den Harpers befreundet?«
Ich lachte. »Woher wissen Sie das?«
»Da oben stehen nur drei Häuser. Die Smiths haben nie Besuch, und mit Zachary sind Sie nicht befreundet, aber Sie sind genau im richtigen Alter für Karen.« Er lächelte. »Sie kommt oft her, wenn sie in der Gegend ist. Meine Frau versteht sich gut mit ihr.«
Mit Zachary bin ich nicht befreundet.
Mit dem unhöflichen Nachbarn.
Interessant – offenbar war er auch anderen gegenüber unhöflich.
»Sie sind sehr scharfsinnig.«
Er lachte. »Vielleicht hab ich von Mrs Cooper gehört, dass eine Freundin von Karen in die Stadt kommt.«
Ich lachte ebenfalls. »Offenbar bin ich eine echte Neuigkeit.« Wohin ich an diesem Vormittag auch gekommen war: Überall hatte man mich herzlich begrüßt und willkommen geheißen. Ich wandte mich wieder dem Gemälde zu. »Ich verstehe, warum dieser Künstler so beliebt ist. Alle seine Werke sind erstaunlich. Aber dieses möchte ich kaufen.«
Er schüttelte kaum merklich den Kopf und wies auf ein kleines Zeichen in der Ecke. »Es ist unverkäuflich. Aber der Künstler war so freundlich, es uns für kurze Zeit zu leihen.«
»Verstehe. Mir ist aufgefallen, dass die Werke nicht signiert sind.«
»Nein – er legt großen Wert auf seine Privatsphäre.«
Ich runzelte bekümmert die Stirn. »Vielleicht würde er ein Angebot von mir trotzdem erwägen?«
Jonathan zuckte die Achseln. »Ich kann ihn fragen, wenn er nächstes Mal kommt. Er ändert seine Meinung selten, aber wenn es ein gutes Angebot ist, denkt er womöglich darüber nach. Geben Sie mir bitte Ihre Telefonnummer. Wie lange bleiben Sie?«
»Drei Wochen vielleicht.«
»Nächste Woche kommt er wieder vorbei. Übrigens ist er erst vor wenigen Minuten gegangen.«
Ich betrachtete die Initialen auf dem Gemälde. Z D A. Der Hüne, der so eilig hinter mir verschwunden war und nach Meer gerochen hatte – hatte es sich um den geheimnisvollen Zachary gehandelt? Wie viele Menschen, deren Vorname mit Z begann, mochten hier leben?
»Gerade erst?«, fragte ich. »Und er trug einen dunklen Mantel?«
Der Galerist zögerte und bejahte dann.
Mein Nachbar hatte einen Mantel getragen, als ich ihn am Morgen gesehen hatte. Es musste dieselbe Person sein.
Er hatte mich offenbar vom Strand her erkannt und kein Interesse, mich kennenzulernen. Wieder betrachtete ich das Gemälde. Ich wollte es noch immer haben. Was diesem Mann an Gewandtheit abging, machte er mit seinem Pinsel mehr als wett. Das Bild sprach mich unmittelbar und mächtig an.
»Unsere Hunde haben sich heute Morgen am Strand kennengelernt«, sagte ich. »Da hat Zachary auch seinen Mantel getragen.«
Jonathan nickte nur knapp, äußerte sich aber nicht.
Ich schrieb ihm meine Telefonnummer auf und sagte, ich würde bei meinem nächsten Besuch in der Stadt wieder bei ihm vorbeischauen. Zudem wäre ich froh, persönlich mit »dem Künstler« sprechen zu können, sofern ihm das recht sei, denn immerhin seien wir Nachbarn. Jonathan lächelte bekümmert, und die seltsame Miene, die ich bei Mrs Cooper wahrgenommen hatte, trat nun auch in sein Gesicht. »Nein. Wie gesagt: Er legt großen Wert auf seine Privatsphäre. Sollten Verhandlungen zu führen sein, übernehme ich das. Sie lassen ihn besser in Ruhe, denn sonst … machen Sie jede Chance zunichte, das Gemälde doch kaufen zu können. Diese Chance ist, wie ich leider sagen muss, ohnehin minimal: Er ändert seine Meinung sehr selten.«
Ich nickte verwirrt. Offenkundig übertrieb Zachary es mit der Privatsphäre, aber wenn dies die Bedingung war, um an das Bild zu kommen, würde ich mich daran halten.
Wieder glitt mein Blick zu dem beeindruckenden Gemälde mit seiner brillanten Darstellung.
Ich musste es besitzen.
3
Zachary
»Nein.« Ich schüttelte entnervt den Kopf. Nicht zu fassen, dass wir diese Unterhaltung schon wieder führten.
»Denk doch an die vielen Möglichkeiten, die sich dadurch eröffnen«, erwiderte Jonathan geduldig. »Dein Name wird berühmt, Zachary.«
»Meine Initialen meinst du wohl. Mehr bekommen sie nicht. Wir haben das alles schon durchgesprochen, Jonathan. Möglichkeiten brauche ich keine. Ich bin sehr zufrieden mit der jetzigen Lösung und meinem gegenwärtigen Leben, und ich will nicht, dass alle Welt meinen Namen kennt.«
»Zachary …«
»Nein, hab ich gesagt.«
Jonathan lehnte sich in seinem Stuhl zurück und betrachtete mich schweigend. »Die Leute möchten wissen, wer diese Gemälde geschaffen hat«, sagte er schließlich.
»Kommt nicht infrage. Entweder du verkaufst meine Bilder wie vereinbart, oder ich nehme sie aus der Galerie.« Ich würde nicht klein beigeben, auf keinen Fall.
Er hob die Hand. »Sei doch nicht so prinzipiell.« Und dann: »Wir könnten Gespräche mit dir aufzeichnen, nur Ton, keine Kamera. Und bloß deinen Vornamen verwenden.«
»Keine Werbung. Ich habe dir erlaubt, meine Gemälde auf deine Website zu stellen und sie hier in der Galerie zu verkaufen, basta. Keine Interviews, keine Begegnungen mit dem Künstler, kein Vorname, gar nichts.«
»Es könnte eine Zeit kommen, wo du das nicht länger ablehnen kannst.«
Das war mir klar, doch ich zuckte nur die Achseln. »Dann höre ich auf zu malen.«
»Sag das nicht – dein Talent zu vergeuden, wäre ein Verbrechen. Aber gut, lassen wir dieses Thema. Bleib ruhig weiter nur drei Initialen auf der Leinwand.«
»So will ich es.«
Er seufzte. »Ich weiß zwar nicht, warum, aber es ist deine Entscheidung.«
Er wusste nicht, warum?
Meine Augen wurden schmal, während ich ihn musterte und mir Mühe gab, ruhig zu bleiben. Natürlich wusste er nicht, warum. Früher einmal hätte ich es auch nicht verstanden; doch mein Name in der Öffentlichkeit hieße, dass sich womöglich eine Tür in meine Vergangenheit öffnete. Würde Fragen, Bilder, Menschen bedeuten, die mich anschauten und über die Vergangenheit redeten; all die Gerüchte und Erinnerungen würden vielleicht wieder hochkommen. Das konnte ich nicht zulassen. Ich war zufrieden damit, wie die Dinge waren. Den Leuten gefielen meine Bilder, und mir machte es Freude, sie zu schaffen. Ein Vorgang, der mir leichtfiel und an dem ich nichts ändern wollte – egal, wie sehr Jonathan mich dazu zu bewegen suchte. Innerlich schüttelte ich den Kopf und wusste sehr wohl, dass er heute nicht zum letzten Mal damit angefangen hatte.
»Ich habe mich entschieden, Jonathan. Die Sache ist für mich erledigt.«
»Gut, ich bin schon still. Schließlich will ich deine Gemälde nicht verlieren. Das wäre schlecht fürs Geschäft, und außerdem würde meine Frau mich umbringen.«
Ich gestattete mir ein Lächeln. Ashley war eine große Stütze meiner Arbeit. Nur ihrer Freundschaft wegen hatte ich zugestimmt, meine Gemälde zum Verkauf anzubieten. Sie und mich verband etwas, das Jonathan nicht verstand und – sosehr er seine Frau liebte – nicht verstehen konnte. Der Kontakt zu ihr war ein kleines Licht in meiner finsteren Welt, doch auch darauf würde ich verzichten, wenn ich keine andere Wahl zu haben meinte.
Sein Telefon klingelte. »Ich geh besser dran. Und dann schau ich, ob die Kundin noch da ist.«
Froh, endlich fahren zu können, stand ich auf. Der Tag hatte mich aufgewühlt. »Bis demnächst.«
Ich öffnete seine Bürotür und nahm den üblichen Weg zum Hinterausgang. Als ich um die Ecke bog, ließ mich der Anblick erstarren; mein Herz begann zu hämmern, und ein Kribbeln durchrieselte mich von Kopf bis Fuß.
Vor mir stand die Frau, die ich am Vorabend und heute Morgen am Strand gesehen hatte. Elliotts leises Bellen hatte mir angezeigt, dass draußen etwas war, und als ich nachsehen ging, erblickte ich sie am Strand. Sie stand reglos und in sich gekehrt da und schaute aufs Wasser. Ich überlegte, was genau sie betrachten, was ihre Aufmerksamkeit in Beschlag nehmen mochte. Am Morgen dann tollte sie mit ihrem kleinen Hund; ihr langes Haar wehte im Wind, und ihr perlendes Lachen drang zu mir, der schweigend dastand, herauf. Der Klang faszinierte mich so sehr, dass ich von der Veranda auf die Treppe trat, um ihm näher zu kommen. Wie sie auf dem Strand mit offenen Armen herumwirbelte, ließ mich lächeln. Ihr Verhalten war ganz einfach und fröhlich; ich lachte sogar, als sie in den Sand fiel und ihr Hund angesprungen kam und ihr das Gesicht leckte.
Als ich Elliott zurückpfiff, ehe ihr in den Sinn käme, sich mir zu nähern, winkte sie mir. Ich reagierte kaum auf ihr freundliches Grüßen und verschwand über die Treppe ins Haus. Sie sollte nicht auf die Idee kommen, mir zu folgen; schon die pure Vorstellung hätte mich bei meiner Flucht fast panisch werden lassen. Trotzdem stand ich dann am Fenster und sah zu, wie sie in ihr Haus verschwand. Als ich später in die Stadt fuhr, um in der Galerie einiges zum Malen zu holen, was Ashley für mich bestellt hatte, sah ich sie wieder. Sie stand auf dem Gehsteig, wollte über die Straße und tat nicht das Geringste, um aufzufallen, und doch fand ich sie fesselnd. Ich fuhr sogar extra langsam an ihr vorbei, um sie erneut zu betrachten, und wusste nicht recht, wie ich auf diese Fremde reagieren sollte.
Nun stand sie reglos und mit ausgestreckter Hand vor meinem Bild Der Sturm. Ihre Finger berührten die Leinwand nicht, sondern schwebten voller Verlangen Zentimeter davor. Sie war in Bann geschlagen, und ihre Miene zeugte von Bestürzung. Die Farbwirbel schienen sie gefangen genommen zu haben. Von dort, wo ich stand, spürte ich ihre Empfindungen und betrachtete sie bewundernd. Nie war mir eine derart elementare Reaktion auf dieses Gemälde begegnet. Ihr Leib schien die Gefühle zu verkörpern, die ich beim Malen gehabt hatte. Schmerz, Sehnsucht und unendliches Chaos waren tief in das Bild eingesenkt, und sie empfand jeden Pinselstrich wie selbst erlebt. Sie war so offenkundig aufgewühlt, dass es mir den Atem verschlug, und ich lehnte mich an die Wand, um nichts zu tun, was ich bereuen würde – zu ihr gehen und sie berühren, zum Beispiel. Zugleich begehrte ich heftig, ihre samtene Haut unter den Fingern zu spüren.
Von meinem Standort aus konnte ich sie bestens beobachten; ihr ganzes Wesen war in meine Arbeit versunken. Am Vorabend hatte ich in der Frau am Strand meine Nachbarin Karen vermutet. Doch schon am Morgen war mir klar, dass ich mich getäuscht hatte. Das war nicht Karen, obwohl sie ähnlich klein und zierlich war. Ihre Gesichtszüge aber waren weich, fast edel. Karen war von funkelnder, selbstbewusster Schönheit, wie ich seit unserem ersten, überraschenden Zusammentreffen im Dunkel des Waldes wusste; danach war es noch zu gelegentlichen, stets verlegenen flüchtigen Begegnungen gekommen. Die Körperhaltung dieser Frau indes zeugte von Schüchternheit, und sie biss sich auf die Unterlippe. Warum auch immer: Es drängte mich heftig, neben sie zu treten und ihre Unterlippe zu befreien, um zu schauen, ob sie so weich war, wie sie aussah. Ich wollte diesen Mund schmecken. Wollte mit der Zunge darüber fahren und ihn küssen.
Dieser seltsame Gedanke ließ mich den Kopf schütteln. Ich erinnere mich nicht, wann ich das letzte Mal eine Frau küssen oder einem anderen Menschen so nah sein wollte wie ihr.
Das Tageslicht in der Galerie ließ ihr Haar herrlich leuchten: Dunkel war es und üppig, das Kastanienbraun spielte ins Kupferne und kontrastierte effektvoll mit ihrer hellen Haut. Die Sommersprossen auf ihren Wangen betonten deren Blässe nur. Die Hände waren schmal, und die nach der Leinwand ausgestreckten Finger zierlich. Mir fiel auf, dass sie müde aussah. Ihre dunklen, großen Augen blickten erschöpft, obwohl sie in das Bild versunken war, und ihr Gesicht war voller Emotionen. Eine intensive Sehnsucht durchzuckte mich – ein Gefühl, das mir selten begegnet war, vielleicht nie zuvor: Ich wollte ihr helfen. In dem Bedürfnis, ihr Trost zu spenden und die Qualen zu lindern, die sie so verletzlich wirken ließen, streckte ich den Arm aus, um ihre Linke in meiner größeren Rechten zu bergen und zu beruhigen. Doch kaum sah ich meinen Handrücken, schlug die Wirklichkeit wieder über mir zusammen: Sie würde meinen Trost niemals wollen oder annehmen. So wenig wie jede andere Frau.
Mit gesenktem Kopf hastete ich zum Hinterausgang und sog beim Vorbeigehen ihr Aroma ein. Ihr Duft war so zart und edel wie ihre Gesichtszüge. Ich spürte, wie ihr Blick vom Gemälde zu mir glitt, ging rascher und hoffte, Jonathan käme nicht aus seinem Büro und riefe mich beim Namen. Ich würde nicht stehen bleiben; meine Panik war viel zu groß.
Seufzend riss ich die Tür auf und rannte beinahe zu meinem SUV, um schnellstens zu fliehen. Zitternd kämpfte ich mit dem Sicherheitsgurt, raste mit quietschenden Reifen vom Parkplatz und schlug den Weg zu meinem Haus ein.
Beim Fahren fiel es mir schwer, die Atmung wieder zu kontrollieren; in meinem Kopf herrschte heilloses Durcheinander. Ein Gedanke allerdings war gewichtiger als alle anderen.
Ich begehrte sie. Ich begehrte sie so sehr wie seit Jahren keine Frau mehr.
Sie – eine vollkommen Fremde.
In meiner Vorstellung sah ich uns zusammen, sah unsere Gliedmaßen eng umschlungen, während ich den Kopf in ihrem vollen Haar vergrub und ihre weichen Rundungen unter mir spürte. Ihr diskretes Parfüm hing in der Luft, und ich sehnte mich danach, ihr erneut nah genug zu sein, um es einzuatmen. Meine Finger sehnten sich, ihre helle Haut zu liebkosen; mein Mund wollte über ihre volle Unterlippe streichen und sie schmecken. Ich musste einfach wissen, ob sie so süß war wie ich annahm – oder noch süßer.
Ich wollte sehen, wie sie auf andere Arbeiten von mir reagierte. Wollte das Wunder ihres bildschönen Gesichts beobachten, wenn sie die Leinwände studierte.
Ich stellte mir vor, wie sie in meinem Atelier stünde und die Sonne ihr herrliches Haar beleuchtete. Ich wollte ihr Bild auf der Leinwand einfangen.
Ich wollte noch sehr viel mehr mit ihr tun als das.
Fluchend hämmerte ich mit der Hand aufs Lenkrad. Ich könnte niemals mit ihr zusammen sein.
So wenig wie mit einer anderen Frau.
Sie würde mich nie begehren.
Ich musste ihr aus dem Weg gehen und sie auf Distanz halten.
Denn käme sie in meine Nähe, könnte ich ihr vielleicht nicht widerstehen.
4
Megan
Von: Jared Cameron
An: Megan Greene
Betreff: Fliehst du vor der Wahrheit, Megan?
Glaubst du, dich zu verstecken sei die Lösung? Hör auf, mich zu ignorieren! Tu endlich das Richtige! Jeder macht Fehler. Widerrufe deine Aussage und lass die Angelegenheit auf sich beruhen, dann verfolge ich sie auch nicht weiter. Findest du nicht, ich hatte schon genug zu leiden, als ich feststellen musste, dass meine Assistentin, die zugleich meine Freundin war, mich nicht nur benutzt hat, sondern meine Arbeit auch als ihre eigene ausgeben wollte? Ich bin tief verletzt, Megan, und doch vergebe ich dir, denn nur so komme ich darüber hinweg. Einst habe ich dich geliebt, und dein Verrat hat mich ins Mark getroffen. Beende unser beider Leiden.
Jared
Er war verdammt clever. Wieder eine flehentliche Mail, die den Medien mit Sicherheit irgendwie zur Kenntnis käme. Und sie sollte nicht nur demonstrieren, wie er mich nahezu auf Knien gebeten hatte, ihn endlich nicht mehr zu verletzen, sondern auch sein zu Ausgleich und Vergebung neigendes Wesen. Und das alles, damit es so aussah, als wäre ich die Böse; genau daran lag ihm nämlich. Es gab auch Schriftstücke und eine AB-Nachricht von ihm, die alle die gleichen Lügen verbreiteten und so taten, als wäre er der Verletzte. Ich war des Ganzen herzlich müde und drauf und dran, nachzugeben, obwohl Karen mich beschwor zu kämpfen. Er hatte ganze Arbeit geleistet. Es war ihm gelungen, meine Glaubwürdigkeit zu zerstören, meine Karriere zu ruinieren, meine Hoffnungen zu töten, als Autorin veröffentlicht zu werden, und mir obendrein das Gefühl zu geben, wertlos zu sein. Wie sollte ich all das nur bewältigen?
Seufzend richtete ich mich im Stuhl auf und rieb mir die Stirn, doch das half nicht gegen das aufziehende Kopfweh.
Draußen war es bedeckt, und die Wolken hingen tief; ein Sturm braute sich zusammen. Ich schaute aus dem Fenster, und mein Blick glitt zum Ende des Strands und zu dem Haus auf der Klippe. Seit meinem Besuch in der Galerie vor zwei Tagen hatte ich nichts von Jonathan gehört. Ich hatte dem Drang widerstehen müssen, über den Strand zu gehen, an die Tür von Zachary zu klopfen und ihn zu bitten, mir doch sein Gemälde zu verkaufen. Stattdessen hatte ich lange Spaziergänge am Strand gemacht und stundenlang vor meinem Laptop gesessen. Immer wieder hatte ich versucht, Inspiration zum Schreiben zu gewinnen, war aber jedes Mal gescheitert und stets auf der Website der Galerie gelandet, um mir die Gemälde von Zachary anzusehen.
Ich hatte keine Ahnung, wie sein voller Name lautete – alle seine Arbeiten waren als Werke von Z D A gelistet –, doch schon seine Initialen faszinierten mich. Stundenlang betrachtete ich die Fotografien seiner Bilder. Sogar seine einfachsten und lieblichsten Gemälde von Strand und Meer enthielten ungemein viel Gefühl – das spürte ich selbst am Bildschirm. Er schien in all seinen Arbeiten Empfindungen authentisch einzufangen. Auf manchen Bildern – etwa auf dem Sturm – brachte er sogar Gefühle zum Vorschein, die man in aller Regel für sich behält.
Ich blickte auf den Schirm, dann auf den dicken Block daneben. Es juckte mich, den Kugelschreiber zu nehmen, mich aufs Sofa zu setzen und so zu schreiben, wie es mir gefiel. Aber nach dem, was geschehen war, zweifelte ich, das je wieder tun zu können. Höchstens, wenn ich jede Seite sofort fotokopieren, das gesamte Manuskript in einen Safe packen und nie mit jemandem darüber reden würde. Ein Seufzer kam mir über die Lippen. Ich wusste nicht, ob jemals jemand lesen würde, was ich schrieb – selbst wenn es mir gelänge, trotz des kürzlichen Fiaskos wieder ins Schreiben zu finden.
Das Kopfweh machte sich langsam bemerkbar, und ich rieb mir die Schläfen. Koffein hatte so wenig geholfen wie meine spontane Idee. Ich holte tief Luft und verzog die Miene wegen des noch immer im Zimmer stehenden Geruchs von Nagellack. Angesichts des stahlblauen Fläschchens in der Kommode hatte ich nicht widerstehen können, mir die Zehennägel zu lackieren. Immerhin war ich am Strand, und so fand ich es fast verwerflich, das zu unterlassen. Jetzt aber musste ich einen Spaziergang machen und frische Luft schnappen. Meine Nägel waren noch immer nicht getrocknet, doch Karen hatte Flipflops, die ich mir leihen konnte.
Ich schaute zum zweiten Stuhl und lächelte. Dixie saß auf ihrem Kissen, sah mich an und zitterte fast vor Aufregung. Es gefiel ihr hier sehr, sie genoss all die Freiräume. Der Strand hielt unendliche Erkundungsmöglichkeiten für sie bereit, und ich brauchte sie tagsüber nicht mal an die Leine zu nehmen. Wenn wir spazieren gingen oder über den festen Sand liefen, blieb sie dicht bei mir, und oft spielten wir Fangen. Am späteren Abend nahm ich sie für den Fall, dass etwas sie erschrecken sollte, bei Spaziergängen vorsorglich an die Leine. Der große Retriever war nicht wieder auf Besuch gekommen, und ich vermutete, dass Zachary seinen Hund vom Strand fernhielt, um nicht mit mir in Kontakt kommen zu müssen. Ich stellte ihn mir als den Inbegriff eines Künstlers vor: in sich gekehrt vor sich hin brütend; nur dann essend, wenn der Hunger unüberwindbar war; in seinem Atelier vergraben; mit mahlendem Kiefer vor der Leinwand mit der Farbe ringend und die Welt um sich herum scheuend.
Ich musste schmunzeln, doch dann seufzte ich. Dass man die Welt scheuen konnte, verstand ich sehr gut. Schließlich tat ich dasselbe. Vielleicht konnte er mir, was das anging, ein paar Tipps geben.
Als ich die wenigen Stufen zum Strand hinunterging, war ich überrascht, nicht nur den Golden Retriever, sondern auch den mysteriösen Zachary zu sehen. Ich blieb kurz stehen und musterte ihn unbemerkt. Barfuß verharrte er, wo die Wellen ausliefen, und sah aufs Meer hinaus, während sein Hund in der Nähe tollte. Zachary hob sich als dunkle Silhouette gegen den Sand und den stürmischen Himmel ab, der an diesem Nachmittag in seltsamen Farben leuchtete. Er trug dunkle Jeans und wieder den Mantel, der seine breiten Schultern so gut zur Geltung brachte, und hatte einmal mehr eine Mütze in die Stirn gezogen. Die Hände in den Taschen, stand er reglos da, während das Wasser um seine nackten Füße spülte. Die aufgerollten Hosenbeine waren nass von der Gischt. Ihn nur dort stehen zu sehen, ließ mich schon schaudern. Das Meer musste eisig sein.
Kaum hatte Dixie ihren neuen Freund entdeckt, kläffte sie munter, und der Retriever kam angestürmt und leckte ihr erneut zur Begrüßung den Kopf. Dann preschten die beiden zu Zachary. Er bückte sich, begrüßte Dixie, ließ sich von ihr kurz beschnüffeln, tätschelte ihren Kopf und richtete sich wieder auf, drehte sich aber nicht um und gab in keiner Weise zu erkennen, dass er mich wahrgenommen hatte. Ich verdrehte die Augen und näherte mich ihm so weit, dass er mich hören konnte, ich aber keine Gefahr lief, mit den Füßen in das eisige Wasser zu geraten. Ich wartete, doch er sagte nichts und ignorierte mich vollständig.
Wirklich unfreundlich.
»Das ist Dixie, mein Hund.«
Er senkte nur kurz das Kinn. »Elliott.«
Ich konnte mir ein wenig Spott nicht verkneifen: »Sie oder Ihr Hund?«
Seine Mundwinkel zuckten. »Mein Hund.«
»Ich wohne im Haus der Harpers.«
Er nickte.
»Ich bin nicht Karen, sondern eine Freundin von ihr.«
»Schon klar«, erwiderte er sarkastisch. »Ich bin ihr schließlich begegnet, nicht nur einmal. Sie beide sind sich womöglich etwas ähnlich, aber ich erkenne schon, dass da ein Unterschied besteht. Vor allem bei den Haaren.«
»Ihnen zu begegnen, war sicher aufregend für Karen«, gab ich mit ironischem Unterton zurück und staunte noch immer über seinen britischen Akzent.
Schweigen.
»Ich darf hier eine Zeit lang wohnen.«
»Wie nett.«
Ich schüttelte den Kopf. Ist das sein Ernst?
»Ich bin Megan. Megan Greene.«
Stille.
Ich fischte nach einem Gesprächsthema. »Sieht so aus, als bekämen wir Sturm.«
»Gut beobachtet.«
Ich runzelte die Stirn – er war wirklich ungehobelt. Seine Stimme aber klang trotz des barschen Tons dunkel und nuancenreich, und sein leichter Akzent wand sich wie eine Girlande um die Worte. Ich wollte mehr als nur Einsilbiges von ihm hören, und er sollte meinen Namen sagen.
»Ist Ihnen nicht kalt an den Füßen, Zachary?«
Er senkte den Blick, zuckte die Achseln, blieb dem Meer zugewandt und reagierte nicht darauf, dass ich seinen Namen wusste. »Eigentlich nicht. Ich bin Kälte gewöhnt.«
Ich beschloss, ein neues Thema anzuschneiden, das ihn vielleicht etwas aus sich herauskommen ließe. »Ich habe Ihre Arbeiten in der Stadt gesehen, in der Galerie; Sie sind sehr begabt.«
Wieder nickte er.
»Ihr Sturm ist …« – ich suchte nach dem richtigen Wort – »… außergewöhnlich.«
»Das Bild ist unverkäuflich.«
Enttäuscht musterte ich sein teils verdecktes Profil. Wieder war das Kinn unter Bartstoppeln verborgen, und nur seine Nase und die so vollen wie grimmigen Lippen waren zu sehen. Zwei, drei widerborstige Strähnen, deren Farbe schwer zu erkennen, wahrscheinlich aber dunkel war, sahen unter der Mütze hervor und wehten im Wind. Ich wollte an ihn herantreten und ihn zwingen, mich anzuschauen, doch seine angespannte Körperhaltung schrie: »Bleib mir vom Leib!« Es war ihm offenkundig unangenehm, dass ich ihm so nah war, und so blieb ich an meinem Platz, obwohl ich das absurde Bedürfnis hatte, mich ihm weiter zu nähern. Ich musste mich wirklich beherrschen, nicht neben ihn zu treten, meine Hand in seine zu schieben und ihn zu trösten, um seine verspannten Schultern zu lösen. Mein seltsames Bedürfnis ließ mich den Kopf schütteln.
»Würden Sie sich das noch mal überlegen?«
»Nein. Jonathan hat deshalb schon bei mir angefragt. Ich habe das Gemälde der Galerie aus persönlicher Gefälligkeit allein zu Ausstellungszwecken überlassen. Es ist unverkäuflich – egal, welcher Preis dafür geboten wird.«
Ich lächelte und wollte ihn necken. »Alles hat seinen Preis, Zachary.«
Dass er mit derart gehässiger Stimme antworten würde, darauf war ich nicht gefasst.
»Mir ist klar, dass es in der Welt fast immer so ist. Aber ich führe mein Leben anders.«
Er wandte sich ab und entfernte sich mit großen Schritten; sein offener Mantel flatterte hinter ihm im Wind. Er pfiff nach Elliott, der sofort sein Stöckchen fallen ließ und seinem Herrn nachsetzte.
Dixie und ich blickten reglos den verschwindenden Gestalten nach. Zachary blieb weder ein einziges Mal stehen noch schaute er zurück, und Elliott war ihm bald weit voraus. Ich wartete, bis der Maler seine Treppe erklommen hatte, und ließ ihn dabei keinen Moment aus den Augen.
Dann blinzelte ich und sah aufs Meer hinaus.
Jetzt konnte ich behaupten, dass ich meinen Nachbarn kennengelernt hatte.
War doch gut gelaufen.
Die frische Luft tat mir gut, doch noch immer hatte ich Schmerzen im Hinterkopf und fühlte mich schlapp. Dixie und ich verbrachten den restlichen Nachmittag friedlich dösend auf dem Sofa und sahen uns zwischendurch einen Film an. Um wenigstens ein wenig produktiv zu sein, fabrizierte ich ein Bananenbrot – das Einzige, was ich mit einiger Aussicht auf Erfolg backen konnte. Während es auf der Anrichte abkühlte, sah ich aus dem Fenster; die Sonne sank langsam zum Horizont und brach durch die tief hängenden Wolken. Das Wasser reflektierte ihre Strahlen, und auf den lang gestreckten Wellen funkelte das Licht. Ich ging auf die Terrasse, atmete die kalte Luft tief ein und genoss das Rauschen des Meers. Eine Bewegung fiel mir ins Auge, und zu meinem Erstaunen sah ich Zachary oben auf den Klippen. Er hielt eine Kamera ans Auge. Ein Bein nach hinten abgewinkelt, kauerte er da, und sein Oberkörper drehte und wendete sich auf der Suche nach dem idealen Aufnahmewinkel. Statt des Mantels trug er nun eine lange, graue Kapuzenjacke. Ich genierte mich dafür, ihn Stunden zuvor aus seiner Ruhe geschreckt zu haben, und als mir der Geruch frisch gebrühten Kaffees in die Nase stieg, fiel mir ein, wie ich mich entschuldigen konnte. Ich eilte ins Haus, füllte einen kleinen Korb, holte tief Luft, um mir Mut zu machen, und machte mich auf zu den Klippen.
Zachary
Ich spürte sie, bevor ich sie sah. Die Atmosphäre um mich herum veränderte sich leicht, und meine Konzentration ließ etwas nach – da wusste ich, dass sie kam. Unwillkürlich vergewisserte ich mich, dass meine Kapuze auf dem Kopf saß und ich von ihr abgewandt stand. Die Versuchung, die Klippe eilends zu verlassen, war groß, doch ich beherrschte mich; ich wollte nicht schon wieder davonlaufen.
»Hallo«, sagte sie mit leiser, sanfter Stimme. Sie war nah, viel zu nah für meinen Geschmack, und unwillkürlich wich ich zurück, grüßte sie aber mit einem wortlosen Nicken. Was sie dann sagte, überraschte mich.
»Tut mir leid wegen vorhin. Ich wollte Sie nicht beleidigen.«
Ich senkte den Fotoapparat und sah sie an. Es schnürte mir die Kehle zu. Die Sonne schien auf ihren Kopf und verwandelte die Haarsträhnen in Farbbäche, und das seltsame Licht ringsum brachte ihre herrlichen Locken so vielfach zum Leuchten, dass ich es niemals mit dem Pinsel hätte einfangen können. Doch es juckte mich, genau das zu versuchen. Ihre Miene war traurig, ja, reumütig, und ich schämte mich meiner barschen Worte. Ich war unhöflich gewesen, nicht sie.
Aber ich wollte und konnte sie nicht ermutigen. So zuckte ich bloß die Achseln und setzte die Kamera wieder ans Auge. »Kein Thema.«
Sie stellte mir einen kleinen Korb hin. »Ich hab Ihnen etwas Kaffee mitgebracht. Und selbst gebackenes Bananenbrot.«
Beim Blick auf ihre Gaben stieg ein seltsames Gefühl in mir auf.
»Ich weiß nicht, wie Sie Ihren Kaffee trinken, und hab deshalb nur etwas Sahne dazugegeben. Zucker habe ich aber auch«, fügte sie hinzu. Ich bemerkte die Hoffnung in ihrer Stimme. Sie wollte, dass ich ihr Friedensangebot annahm.
»Ich trinke ihn schwarz.«
»Oh.«
Wie es ihr gelang, so viel Enttäuschung in einem Laut unterzubringen, war mir ein Rätsel. Genauso wenig begriff ich, warum ihre Enttäuschung mir so zusetzte. Ich zog den Korb näher heran und nahm ein Stück Bananenbrot. Während ich von der mächtigen Scheibe abbiss und tapfer kaute, spürte ich die ganze Zeit ihren Blick auf mir.
»Schmeckt gut«, brummte ich.
Auch sie nahm eine Scheibe und knabberte daran. Ich wandte mich ab, setzte den Fotoapparat ans Auge und fing im magischen Licht der letzten Abendsonne die atemberaubenden Farben und Formen der ungewöhnlich dunklen Wolken ein.
»Fotografieren Sie viel?«
»Geht so.«
»Verkaufen Sie die Aufnahmen auch?«
»Nein.«
Sie seufzte enttäuscht. »Wo ist Elliott?«
»Im Haus. Ich bin allein losgezogen, der Konzentration wegen. Ich wollte keine Ablenkung.«
»Lenke ich Sie ab?«
»Ja.«
»Ich wollte mich nur bei Ihnen entschuldigen.«
»Das haben Sie schon getan.«
»Ist das eine Aufforderung, mich zu verziehen?«
Ich schnaubte ungeduldig. »Ich bin hier, um das einzigartige Licht einzufangen. Nicht, um zu plaudern.«
»Sie haben es gern ruhig und friedvoll?«
Meine Stimme wurde scharf. »Ich mag es ruhig – was friedvoll sein soll, entzieht sich meiner Kenntnis.«
Dass sie mir plötzlich ihre Hand auf den Arm legte, ließ mich zusammenfahren. Die Wärme ihrer zarten Berührung bestürzte mich, und ich war wie elektrisiert. »Verstehe.«
Ich erhob mich mit einem Ruck und wandte ihr weiter den Rücken zu. Ihre Nähe bereitete mir Herzrasen – genau wie das merkwürdige Bedürfnis, sie möge mich weiter berühren. »Das bezweifle ich sehr.«
Auch sie erhob sich. »Wie eingebildet von Ihnen! Sie wissen nichts von mir und meinem Leben.«
»Und ich will auch nichts darüber wissen.«
Sie schnappte nach Luft. »Wie ungehobelt Sie sind! Dabei wollte ich nur –«
Ich schnitt ihr das Wort ab. »Mir egal, was Sie wollten. Lassen Sie mich in Ruhe, Megan. Ich brauche keine Freundin und auch niemanden, der meint, mich zu verstehen.« Ich schob den Korb mit dem Fuß weg. »Und an Gesellschaft oder Geschenkkörbchen habe ich kein Interesse. Bleiben Sie einfach auf Distanz.«
Darauf herrschte Schweigen. Mir war klar: Sollte ich mich umdrehen und sie anzuschauen wagen, würde ich Tränen in ihren dunklen Augen bemerken. Einmal mehr würde Verletztheit ihre Wangen röten, doch ich musste sie dazu bringen, mich in Ruhe zu lassen.
Erneut setzte ich den Fotoapparat ans Auge, obwohl das Licht schwand und die Farben an Intensität verloren. Ich spürte, wie sie sich mit zögernden Schritten entfernte, drehte mich um, beobachtete sie und konnte nicht anders, als ihre davongehende Gestalt von hinten aufzunehmen. Ihr Kopf war gesenkt, ihre Schultern hingen bekümmert herab. Selbst ihr Haar, das im stumpfen Licht noch schwach schimmerte, hing ihr nun schlaff über die Schultern und bewegte sich nicht länger im Wind. Nicht nur das Sonnenlicht verblasste – ich hatte auch ihr inneres Leuchten zum Verlöschen gebracht. Und ich hatte sie überaus wirksam und vollständig davon überzeugt, dass ich allein gelassen werden wollte.
Sie drehte sich nicht mehr um und verschwand in ihr Haus.
Mit schweren Beinen stieg ich die Treppe zu meinem hinauf.
Nie hatte sich das Alleinsein so einsam angefühlt wie in diesem Moment.
Megan
Nach meiner Begegnung mit Zachary warf ich mich die ganze Nacht unruhig im Bett herum. Er hatte mir sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass er nichts mit mir und meinen freundlichen Gesten zu tun haben wollte. Seine Zurückweisung bereitete mir Schmerzen in der Brust, die ich nicht zu erklären vermochte, doch alles in mir sagte, dass sein Handeln ihm die gleichen Qualen bereitete. Ich hatte ihm nicht geglaubt, als er gesagt hatte, er wolle allein sein – doch ich war mir sicher, dass er nichts anderes kannte als Einsamkeit.
Am Nachmittag war der Druck hinter meinen Augen fast unerträglich. Die am Vortag aufgezogene Sturmfront hing noch immer niedrig und lastend am Himmel, bewegte sich zunächst aber kaum. Je näher sie dann kam, umso schlimmer wurde mein Kopfschmerz. Ich hatte alle Symptome einer Migräne: Tunnelblick, Lichtempfindlichkeit, pulsierenden Kopfschmerz und zunehmende Übelkeit. Was ich hingegen nicht bei mir hatte, waren Medikamente. Da ich seit einiger Zeit von Migräne verschont gewesen war, hatte ich daran nicht gedacht. Etwas Paracetamol im Badezimmerschrank war das Einzige, was ich finden konnte. Ich wusste, dass ich mich hinlegen und ausruhen musste, also ließ ich die Schiebetür offen, damit frische Luft hereinkam, und rollte mich auf dem Sofa zusammen. Dixie sprang zu mir und kuschelte sich an mich. Ich schloss die Augen und betete, der Sturm möge losbrechen und den Kopfschmerz lindern.