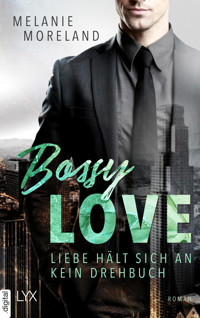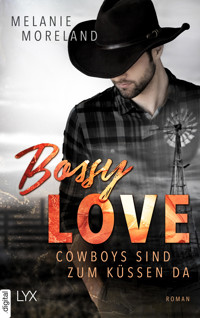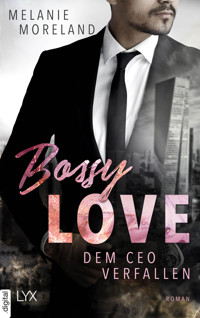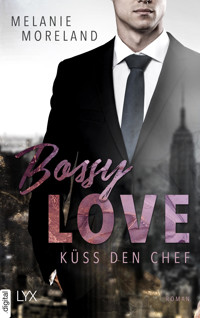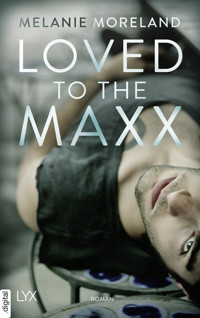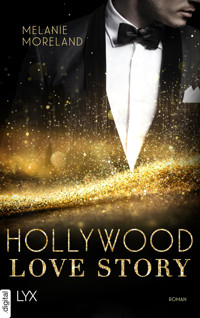6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Seine Stimme berührt ihr Herz ...
Charlotte Prescott arbeitet in der Firma ihres Vaters. Sie schafft es kaum, die langen Stunden in einem Job zu überstehen, den sie hasst, für einen Vater, der niemals zufrieden sein wird. Immer schwerer wiegt die Last auf ihren Schultern, doch eine Sache trägt sie durch ihre Tage bis zu der U-Bahn-Station auf dem Nachhauseweg. Die Stimme des Mannes, der stets mit seiner Gitarre dort steht, lässt sie durchatmen und so etwas wie Glück empfinden. Eines Abends, als Charlotte wieder seinen Songs lauscht und ihren tristen Alltag hinter sich lässt, passiert das Unvorhergesehene: Sie schläft ein und als sie wieder aufwacht, sitzt der Fremde neben ihr. Eine einzigartige Liebesgeschichte nimmt ihren Anfang ...
"Logan und Lotties Story war genau das, was ich brauchte: herzerwärmend, emotional und wohltuend." Carrie Elks, Bestseller-Autorin
Der neue Roman von Bestseller-Autorin Melanie Moreland
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 454
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Liebe Leser:innen
Widmung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Epilog
Danksagung
Die Autorin
Die Romane von Melanie Moreland bei LYX
Leseprobe
Impressum
MELANIE MORELAND
Voice of my Heart
Roman
Ins Deutsche übertragen von Gesa Andres
Zu diesem Buch
Charlotte Prescott arbeitet in der Firma ihres Vaters. Sie schafft es kaum, die langen Stunden in einem Job zu überstehen, den sie hasst, für einen Vater, der niemals zufrieden sein wird. Immer schwerer wiegt die Last auf ihren Schultern, doch eine Sache trägt sie durch ihre Tage bis zu der U-Bahn-Station auf dem Nachhauseweg: Die Stimme des Mannes, der stets mit seiner Gitarre dort steht, lässt sie durchatmen und so etwas wie Glück empfinden. Eines Abends, als Charlotte wieder seinen Songs lauscht und ihren tristen Alltag hinter sich lässt, passiert das Unvorhergesehene: Sie schläft ein, und als sie wieder aufwacht, sitzt der Fremde neben ihr. Eine einzigartige Liebesgeschichte nimmt ihren Anfang …
Liebe Leser:innen,
danke, dass eure Wahl auf Voice of My Heart gefallen ist. Da es eine so große Auswahl an Büchern gibt, fühle ich mich geehrt, dass ihr euch entschieden habt, heute meines zu lesen.
Voice of My Heart ist eine Geschichte, die ursprünglich im Mai 2017 in der What The Heart Wants-Anthologie herausgekommen war. Für die Gutenachtgeschichten in der Facebook Gruppe The Korner wurde extra eine Kurzfassung erschaffen. Die Leser:innen liebten, wie unbeirrt besitzergreifend Logan Lottie begegnete. Hier ist jetzt ihre Geschichte in voller Länge.
Wenn ihr am neuesten Stand über aktuelle Veröffentlichungen, exklusive Informationen und Angebote interessiert seid, meldet euch doch bitte für den Newsletter an über https://bit.ly/MMorelandNewsletter.
Keine Sorge – nur Unterhaltsames aus meiner Bücherwelt – nie Spam!
xoxo,
Melanie
Für Matthew
Weil es dich gibt, gehe ich nicht allein durch die Welt.
Du bist tief in meinem Herzen.
Für immer.
1
Lottie
Stimmen schwirrten durch den Konferenzraum und ratterten Zahlen herunter. Geplante Etats, Schuldenquoten, Zeitschienen. Alles sehr wichtig – alles sehr langweilig. Ich starrte aus dem Fenster in die Dämmerung des späten Nachmittags und verlor mich im Anblick der sich anmutig und geschmeidig im Wind wiegenden Äste der Bäume. Hell und kristallklar wirbelte der Schnee, die Flocken eingefangen vom Licht der Straßenlaternen. Wie eine Art Tanz – eine schöne, elegante Ankündigung des Winters, der immer näher rückte.
So wie die Mauern, die ich immer näher kommen fühlte.
Ich schüttelte meinen Kopf, um die Gedanken loszuwerden, und versuchte mich auf das Meeting zu konzentrieren. Als mein Blick über den Tisch schweifte, sah ich, wie alle auf die anstehenden Termine schauten, also blätterte ich schnell die Seiten um, wohl wissend, dass mir das meiste von dem, was eben besprochen wurde, entgangen war.
»Charlotte, hast du zu dem Bereich noch Bedenken anzumelden?«
Ich sah auf und begegnete dem eindringlichen Blick des CEO, Charles Prescott. Sein Blick war ruhig und unverwandt, und doch fragte ich mich, ob er merkte, dass ich nicht bei der Sache war.
Ich schluckte nervös. »Im Moment nicht.«
»Gut. Ralph, was ist mit Ihrem Bereich?«
Ich entließ einen Stoßseufzer der Erleichterung, denn, dem Himmel sei Dank, war ich vor dem Meeting alle Aufzeichnungen zu dem Projekt noch mal durchgegangen. Ich kannte die Ein- und Ausgaben, und zum jetzigen Zeitpunkt hatte ich keine Bedenken, sofern keine Katastrophen eintraten.
Ich versuchte mich zu konzentrieren, tat so, als würde ich aufpassen, schrieb mir Stichpunkte auf und nickte, wenn die anderen am Tisch Bemerkungen machten. Das hielt ungefähr fünfzehn Minuten. Bis eine Windböe an der Scheibe rüttelte, ich hinsah und feststellte, dass die Schneeflocken größer wurden. Ein vertrauter Nervenkitzel überlief mich.
Ich liebte den Winter. Ich liebte die Kälte, den Schnee und alles, was damit zusammenhing. Die Vorboten der Feiertage. Schlitten und Ski fahren oder einfach durch den frisch gefallenen Schnee spazieren – vor allem nachts, wenn die Flocken vom Himmel fielen und die Straßen menschenleer waren. Ich würde stundenlang spazieren gehen, warm eingepackt und geschützt gegen die eisige Kälte. So lange, bis meine Nase anfing zu kribbeln und sich meine Finger in den Fäustlingen krümmten.
Ich liebte Fausthandschuhe.
Meine Lieblingsbeschäftigung im Winter war, mich mit einem guten Buch, einer Tasse heißer Schokolade und einer kuscheligen Decke auf dem Sofa zusammenzurollen. Allein und friedvoll. Etwas, wozu ich nur sehr selten kam.
»Charlotte?«
Blinzelnd kam ich wieder in die Realität zurück. Meine Brust zog sich zusammen, als mir klar wurde, dass ich erneut abgedriftet war. Meine Hand war schlaff, der Stift lag auf der geöffneten Akte und mein Kopf war vornüber gesunken. Wahrscheinlich erweckte ich den Eindruck, ich wäre eingeschlafen.
Ich hob den Kopf und rang mir ein Lächeln ab. »Entschuldigung, ich war ganz in Gedanken. Mir sind ein paar Zahlen durch den Kopf gegangen.«
Charles zog die Augenbrauen hoch, was nicht den geringsten Zweifel daran ließ, dass er wusste, meine Gedanken waren nicht beim Meeting und hatten auch nichts mit Zahlen zu tun.
»Ich habe gefragt, ob du für den Ausschuss zur Verfügung stehst. Ich hätte dich gern dabei.«
Ich unterdrückte einen Seufzer. Noch ein Ausschuss. Noch mehr Meetings, in denen ich sitzen und langweilige Diskussionen über mich ergehen lassen und dem Schwadronieren anderer Führungskräfte zuhören müsste, wie wichtig sie für das Projekt wären. Ich hasste solche Meetings.
»Selbstverständlich. Ich halte mir die Termine frei.«
»Ausgezeichnet. Okay, alle zusammen, das war alles für heute. Der Schneesturm da draußen wird schlimmer, also passen Sie auf sich auf.«
Ich stand auf, froh, dass das Meeting vorbei war.
Charles hob seine Hand. »Einen Augenblick, Charlotte.«
Ich setzte mich wieder, versuchte ein gleichgültiges Gesicht aufzusetzen, obwohl ich wusste, dass mir eine Standpauke bevorstand. Er wartete, bis alle anderen gegangen waren, stand auf, ging um den Tisch und setzte sich neben mich.
»Alles in Ordnung, Charlotte?«
»Mir geht es gut.«
»Du machst nicht den Eindruck, als wärst du bei der Sache. Du warst eine Zeit lang gar nicht richtig anwesend.«
Ich fuhr mit dem Zeigefinger der Holzmaserung nach, unfähig ihm in die Augen zu blicken. Ich wusste, in ihnen wäre nur Enttäuschung zu erkennen. »Ich bin ein bisschen abgelenkt«, gab ich zu. »Ich habe im Moment viel um die Ohren.«
»Wie wir alle. Das liegt in der Natur des Jobs. Du musst mit dem Kopf ganz dabei sein. Das ist eine große Sache. Ich zähle auf dich.«
»Ich weiß.« Ich räusperte mich. »Es wird nicht wieder vorkommen.«
Er musterte mich einen Moment lang und neigte dann billigend den Kopf. »Ich erwarte, dass du es besser machst.«
Mich überkam Scham. »Das werde ich.«
»Du siehst erschöpft aus.«
Die unerwartet persönliche Bemerkung überraschte mich. »Mir geht es gut. Ehrlich. Mir fehlt nichts.«
»Na gut. Du bist eine erwachsene Frau, ich verlasse mich auf dein Wort. Aber ich empfehle dir, zukünftig nur noch am Wochenende auszugehen. Ich brauche deinen klaren Kopf. Keine Abwesenheit mehr während eines Meetings.«
»Ja, Sir.«
Er erhob sich, strich das Jackett seines Anzugs glatt, eine Korrektur, derer es nicht bedurft hätte – Charles Prescott sah immer untadelig aus. Sein silbriges Haar glänzte im Licht, nicht eine Strähne tanzte aus der Reihe. Mit seinen sechzig Jahren war er immer noch groß und breitschultrig und hatte eine stramme Haltung. Seine blauen Augen wirkten wie Eis. Als ich klein war, hätte ich darauf geschworen, dass ihnen nichts entging, wie sehr ich auch versuchte, meine Fehler zu verbergen. Ich war sicher, so war es immer noch.
Er durchquerte den Raum und blieb an der Tür stehen. »Deine Mutter erwartet dich heute Abend zum Dinner.«
»Ich werde da sein.«
»Willst du mit mir fahren?«
»Nein, ich muss vorher noch ein paar Dinge erledigen. Ich nehme die U-Bahn.«
Er atmete hörbar aus und klang ungehalten. »Du weißt, was ich davon halte, Lottie. Ich wünschte, du würdest mit diesem Unabhängigkeitsgetue aufhören und mir gestatten, dir einen Wagen und Chauffeur zur Verfügung zu stellen.«
Nur selten nahm ich im Büro auch nur ein flüchtiges Anzeichen dafür wahr, dass er mein Vater war. Hier waren wir Charles und Charlotte. Nie wurde ich Lottie genannt. Persönliche Dinge wurden nicht besprochen. Die Trennlinie war klar gezogen. Hier ging es um das Geschäft, schlicht und einfach. Es spielte keine Rolle, dass ich seinen Namen trug oder seine Tochter war. Er bestand auf seine Regeln. Ich war daran gewöhnt, und ich achtete darauf, mich jederzeit daran zu halten. Das war es, was man von einer Prescott erwartete.
»Ich gehe gern zu Fuß.«
Er schnaubte und verdrehte die Augen. »Und nimmst die U-Bahn.«
Ich zuckte mit den Achseln. »Ich mag Menschen. Ich beobachte sie gern.«
»Das kannst du auch bequem von einer Limousine aus tun.«
Nun war es an mir, mit den Augen zu rollen. »Das hat einen ziemlich elitären Beigeschmack.«
Er lächelte mich an – ein kaltes Lächeln, das seine Augen nicht erreichte.
»Gott verhüte, dass ich elitär klinge, wenn es um die Sicherheit meiner Tochter geht.«
»Mir passiert schon nichts. Ich bin vorsichtig.«
»Trotzdem gefällt mir das nicht.«
Bei dem Gedanken, er würde auf den Wagen bestehen, drehte sich mir der Magen um. Denn wenn das geschah, würde mir das Einzige, was mein Leben derzeit erträglich machte, der einzige Lichtblick, genommen werden. Das konnte ich nicht zulassen.
»Bitte, lass es gut sein«, bat ich, und meine Gefühle schnürten mir die Kehle zu. »Lass mir dieses kleine bisschen Freiheit.«
Er öffnete die Bürotür. »Also gut. Fürs Erste. Aber das Thema ist noch nicht abgeschlossen.«
Ich nahm meine Akten und folgte ihm hinaus. »Das hätte ich auch niemals angenommen.«
2
Lottie
Die Zeit zog sich. Ich sah auf die Uhr, deren Zeiger langsam die Sekunden heruntertickte, bis ich endlich würde gehen können. Jeder lachte über die altmodische, batteriebetriebene Uhr auf meinem Schreibtisch. Aber ich mochte den beruhigenden Klang der sich sanft bewegenden Zeiger, die die Minuten vergehen ließen. Und das leise Läuten zu jeder Stunde half mir durch den Tag.
Endlich war es sechs Uhr. Ich klappte meinen Laptop zu und verstaute ihn in meiner Kuriertasche. Ich versicherte mich, dass ich meinen Ausweis dabeihatte, und machte mich auf den Weg zum Aufzug. Kurz bevor sich die Türen schlossen, trat mein Vater herein.
»Hast du deine Meinung geändert? Fährst du mit mir?«
»Ähm, nein. Ich bin auf dem Weg nach Hause.«
Ein Ausdruck von Missfallen überzog sein Gesicht. »Deine Mutter …«
Ich unterbrach den Beginn seiner Gardinenpredigt. »Ich komme zum Abendessen, aber vorher muss ich noch nach Hause.«
Er zog die Augenbrauen zusammen. »Du wohnst im Osten. Wir wohnen im Westen. Was ist so wichtig, dass du dafür quer durch die Stadt willst?«
Mein Herz begann wie wild zu schlagen. Auf meinem Nacken bildete sich Angstschweiß. »Ich will mich umziehen, und, ähm, Brianna ruft mich noch an.«
»Blödsinn.«
»Sie will dringend mit mir sprechen, Dad. Ich habe es versprochen.«
»Na schön. Ich werde den Chauffeur holen, damit er dich fährt.«
»Nein!« Fast schrie ich es ihm entgegen.
Er trat einen Schritt auf mich zu. »Charlotte, was ist mit dir los?«
»Nichts. Es ist nur … ich muss ein paar Kleinigkeiten erledigen. Das Abendessen beginnt nie vor halb neun. Ich habe mehr als genug Zeit.«
Er sah mich scharf an. »Und du bestehst darauf, die U-Bahn zu nehmen?«
»Ich mag die U-Bahn. Ich höre Musik, und ich kann mir eine Auszeit nehmen.«
»Ich begreife dich nicht. Du bist durcheinander. Das gefällt mir nicht.«
»Mir geht es gut.« Die Lifttüren öffneten sich, und ich eilte vor ihm hinaus. »Wir sehen uns später!«
Er kam mir nicht hinterher. Mir war klar, dass er das nicht tun würde. Charles Prescott würde niemals in der Öffentlichkeit eine Szene machen. Dennoch blieb ich erst stehen, nachdem ich um die Ecke war. Ich lehnte mich an die Wand und versuchte, wieder runterzukommen.
Natürlich hatte er recht. Es war bescheuert, durch die ganze Stadt zu meiner Eigentumswohnung zu fahren, um mich danach auf den Weg zu ihnen zu machen.
Aber wenn ich es nicht tat, würde ich ihn verpassen.
Das durfte nicht geschehen.
Er war das Einzige, wofür ich in letzter Zeit lebte.
Auch wenn er nichts davon wusste.
Ich stieg aus der Bahn, meine Augen suchten die Gegend ab. Ich war total aufgewühlt heute Abend. Die Beklemmung in mir wuchs täglich, und ich stand unter Spannung, bis ich ihn sah. Erst dann entspannte sich mein Körper, mein Herz schlug langsamer, und es ging mir besser.
Es passierte jedes Mal.
Zuerst hörte ich ihn. Die Klänge seiner Gitarre drangen an meine Ohren, seine Musik nistete sich in meinem Kopf ein und hüllte mich in Frieden. Ich folgte dem Klang und fand ihn wie gewöhnlich in der Nähe der Bänke. Sein Kopf war gesenkt, strubbeliges braunes Haar fiel ihm ins Gesicht, während er auf seine Hände hinuntersah. Über seiner Stirn mischten sich weißblonde mit dunklen Strähnen, und ich fragte mich oft, ob sie wohl von der Sonne ausgebleicht waren, weil er so viel draußen war. Es verlieh ihm einen künstlerischen Anstrich, der ihm gut zu Gesicht stand. Er lehnte lässig an der Wand, groß und kräftig gebaut, mit einer muskulösen Brust unter seiner abgewetzten Lederjacke und dem engen T-Shirt. Mit seinen langen, kräftigen Fingern entlockte er einer Gitarre Klänge, die so alt schien, dass ich sicher war, es handelte sich um ein antikes Stück. Ein ramponierter Gitarrenkoffer lag vor ihm auf dem Boden, die Münzen, die Pendler hineingeworfen hatten, blinkten im Licht. Es befanden sich nur ein paar Scheine unter dem Münzgeld, und ich fragte mich wie immer, wenn ich ihn sah, ob er genug zusammenhatte, um heute Abend etwas zu essen. Und ob er einen Platz zum Schlafen hatte.
Meine Finger umklammerten die Scheine in meiner Tasche. Irgendwie würde ich ihn heute Abend lang genug ablenken, um das Geld in seinen Gitarrenkoffer fallen zu lassen. Jedes Mal, wenn ich es versuchte, sah er mich missbilligend an. Er ließ mich wortlos, allein durch den Blick seiner goldbraunen Augen wissen, dass er mein Geld nicht wollte. Einmal hatte er es angenommen – danach nie wieder. Als ich mich das letzte Mal näher heranwagte, in der Absicht, etwas Geld in den Gitarrenkoffer werfen, stieß er mit seinem Fuß den Deckel zu und warf mir mit energischem Kopfschütteln einen aufgebrachten Blick zu. Erst nachdem ich zurückgewichen war und mich auf die hinterste Bank gesetzt hatte, klappte er den Kasten wieder auf, damit andere Passanten Geld hineinwerfen konnten.
Warum er mir nicht gestattete, es ihnen gleichzutun – ich hatte keine Ahnung.
Als ich dastand und ihm zuhörte, hob er den Kopf. Quer über den belebten Bahnsteig trafen sich unsere Blicke. Der Anflug eines Lächelns umspielte seine Mundwinkel. Heute Abend war an seinem Kinn der Schimmer von Bartstoppeln zu erkennen, die seinen kantigen Kiefer betonten. Mal war er glatt rasiert, dann wieder ließ er den Bart wachsen. Ich wusste nie, was mich erwartete.
Er grinste, und sein allgegenwärtiges Grübchen wurde tiefer. Der Druck auf meiner Brust ließ nach, als ich näher ging und mich mit einem Seufzer der Erleichterung auf eine der Bänke sinken ließ.
Ich sprach kein einziges Wort mit ihm. Von seiner Seite kamen keinerlei Annäherungsversuche. Aber jeden Abend war ich da und hoffte, dass er irgendwo auf dem Bahnhof spielen würde. Und er war da, jeden Abend. Seine Musik tröstete und beruhigte mich. Schon seine Anwesenheit genügte mir.
Auch an diesem Abend war das nicht anders. Ich war bereit, den Tag vergehen zu lassen.
Zum ersten Mal hörte ich ihn, als ich gestresst und aufgebracht über den Bahnsteig eilte. Das Projekt, an dem ich arbeitete, lief nicht besonders gut. Es lag hinter dem Zeitplan, die Investoren wurden ungehalten und drohten damit, ihre Unterstützung zu entziehen. Mein Vater war in Rage geraten, und es spielte keine Rolle, dass ich seine Tochter war. Seine Schimpftirade, die lang und heftig ausfiel, galt auch mir. Nachdem er uns endlich entlassen hatte, machte ich mich auf den Heimweg, fühlte mich erschöpft und war völlig verzweifelt.
Ich hasste meinen Job mit Leidenschaft. Hasste jeden Aspekt davon. Und ich machte ihn nur aus Pflicht und Schuldigkeit. Ich war zwar gut genug, fand aber keinerlei Befriedigung im Arbeitsalltag. Andere um mich herum lebten dafür, und ich wünschte mir, ich hätte etwas von ihrem Ansporn.
Meine Beine waren zu zittrig, um mich länger aufrecht zu halten, und ich stolperte zu einer Bank, um mich zu setzen und Kraft für den kurzen Heimweg zu sammeln. Ich schloss die Augen und ließ den Kopf nach vorn sinken. Ein paar Minuten später hörte ich es. Die Akkorde einer Gitarre und den Gesang einer leisen Tenorstimme. Während ich lauschte, fühlte ich, wie eine Woge der Ruhe über mich kam und meine Kraft zurückkehrte. Ich hob meinen Kopf und begegnete einem Blick, der mich bis ins Innerste erschütterte.
Augen von der Farbe dunkelsten, stärksten Whiskys sahen mich an. Sein Haar war lang und zerzaust, was ihm jedoch gut stand. Bekleidet mit zerrissenen Jeans und einer abgetragenen Lederjacke, stand er da, groß und selbstbewusst, und sah mir in die Augen. Ohne sein Spiel und den Gesang zu unterbrechen, beobachtete er mich stirnrunzelnd. Er neigte den Kopf, als wollte er wortlos fragen, ob mit mir alles in Ordnung wäre. Ich ertappte mich dabei, in seine Richtung zu nicken. Und da passierte es.
Er lächelte.
Sein Grübchen kam deutlich zum Vorschein, seine Lippen kräuselten sich, und es fühlte sich für mich an, als würde in der U-Bahn plötzlich die Sonne aufgehen. Ich spürte die Warmherzigkeit seiner Seele in seinem Lächeln. Dann, genauso schnell, wie es erschienen war, verschwand es wieder und ließ mich frierend zurück. Doch blieben seine Augen, während er einen Song nach dem anderen spielte, weiter auf mich gerichtet.
Ich harrte aus, solange es irgend ging, und hörte zu. Als mir klar wurde, dass ich es nicht länger aufschieben konnte, stand ich auf. Ich fand es grässlich, gehen zu müssen. Ihn zu verlassen. Ich wühlte in meiner Tasche, denn ich wusste, dass ich ein paar Zwanziger darin hatte. Er beobachtete mich, wie ich auf ihn zuging und vor ihm stehen blieb. Zum ersten Mal, seit ich die Augen geöffnet hatte, stockte er, hielt inne und unterbrach sein Spiel. Unser Blickkontakt allerdings blieb ungebrochen.
Ich warf das Geld in seinen Koffer. »Danke«, flüsterte ich.
Er nahm sein Spiel wieder auf, und erneut erschien ein Schmunzeln auf seinem Gesicht.
Seine Musik verfolgte mich die Treppenstufen hinauf und hallte den ganzen Abend in meinem Kopf nach.
Seitdem war er jeden Abend auf dem Bahnhof. Seine Ausstrahlung wirkte noch lange, nachdem ich gegangen war, in mir nach.
Die Zeit raste viel zu schnell vorbei. Mir war klar, dass ich noch zu meinen Eltern musste. Dabei wollte ich nur eines – sitzenbleiben und ihm noch ein wenig länger zuhören. Nur ging das leider nicht. Ich stand auf, strich über meinen Rock und ließ meine Hand in die Tasche gleiten. Ich schaute mich um und überlegte, wie ich das Geld am besten in seinen Koffer bugsieren konnte. Er ging bestimmt davon aus, dass ich links an ihm vorbei zur Treppe gehen würde. Stattdessen würde ich zurück Richtung Gleise gehen, was bedeutete, dass ich rechts an ihm vorbeikäme, wo auch sein Koffer auf dem Boden lag. Ich würde nicht anhalten; ich würde ihn nicht ansehen. Ich würde lediglich an ihm vorbeihuschen und das Geld hineinwerfen. Das Ziel war groß genug. Ich konnte es kaum verfehlen. Um absolut sicherzugehen, knüllte ich die Scheine in meiner Faust zusammen.
Ich holte tief Luft, warf mir die Kuriertasche über die Schulter und ging auf ihn zu. Das Glück war mit mir, ein paar Leute standen vor ihm und hörten ihm zu. Es versammelte sich öfter eine kleine Menschenmenge um ihn, was mich immer freute, vor allem, wenn die Leute auch Geld in seinen Gitarrenkoffer warfen. Ich fühlte seinen Blick auf mir, als ich näher kam. In der letzten Sekunde bog ich nach rechts ab und ging mit eiligen Schritten an ihm vorbei. Ich ließ die zusammengeknüllten Scheine in den Koffer fallen und sah, wie sie neben ein paar Münzen liegen blieben. Sein Gitarrenspiel stockte, aber ich ging weiter und war zufrieden mit mir. Er akzeptierte es von jedem anderen. Ich war seine dankbarste Zuhörerin, und es war mir wichtig, ihm zuzuhören.
Ich wartete auf dem Bahnsteig, um in den Stadtteil meiner Eltern zu fahren. Ich stieg in den Zug und setzte mich. Kaum schaute ich auf, traf mich durch die Scheibe der intensive Blick seiner Augen. Die Gitarre im Koffer verstaut, den er über seine Schulter geworfen hatte, stand er nun mit in die Hüfte gestemmten Händen da und sah mich aus kurzer Entfernung missbilligend an. Ich konnte nicht anders, als ihm meinen zuversichtlich gereckten Daumen zu zeigen.
Sein Lächeln erschien – das eine Lächeln, das meine Welt erstrahlen ließ, und mit ihm das tiefe, markante Grübchen in seiner Wange. Als der Zug losfuhr, trat er einen Schritt zurück, um sich dann in einer altmodischen Geste, mit der ich nicht gerechnet hatte, die Hand aufs Herz zu legen.
Der Anblick dieser Geste ließ mein eigenes Herz schneller schlagen.
»Ich dachte, du bist heimgefahren, um dich umzuziehen.«
Ich hob, um Zeit zu schinden, das Weinglas an die Lippen. »Das Gespräch mit Brianna hat länger gedauert als erwartet.«
»Du hättest sie von hier aus anrufen können.«
»Sie wollte skypen.«
»Du …«
»Genug der Befragung, Charles«, unterbrach ihn meine Mutter. »Ist bei Brianna alles in Ordnung?«
»Ja, es geht ihr gut. Männerprobleme«, brachte ich lahm heraus.
Meine Mutter schnaubte durch die Nase, zweifellos ein Zeichen ihrer Ungeduld. Sie billigte Brianna nur aufgrund ihrer Herkunft, nicht etwa, weil sie sie als Mensch mochte. Ich war mir nicht sicher, ob meine Mutter irgendjemanden wirklich mochte. »Nichts Ungewöhnliches bei Brianna.«
Mein Vater gab ein merkwürdiges Geräusch von sich. »Wenigstens gibt es einen Mann in ihrem Leben.«
Ich warf meinen Kopf mit einem Seufzer in den Nacken. »Echt jetzt, Dad? Du kannst nicht lockerlassen?«
Er reichte mir die Kartoffeln und runzelte die Stirn, als ich sie an meine Mutter weitergab. »Eine Frau deines Alters sollte verheiratet sein.«
»Ich bin gerade mal sechsundzwanzig – weit entfernt von Altersschwäche. Wenn mir der Richtige begegnet, werde ich schon noch heiraten.«
Mein Vater gab einen kehligen Laut von sich, wechselte aber das Thema.
»Ist das alles, was du zu essen vorhast? Ich habe während des Meetings bemerkt, dass du dein Sandwich kaum angerührt hast. Du bist viel zu dünn.«
»Gut jetzt. Können wir für heute aufhören, auf Charlotte herumzuhacken?«
Mom legte ihre Gabel nieder. »Genug. Alle beide. Ihr ruiniert mir den Appetit mit eurer Zankerei. Charles, lass das Mädchen ihr eigenes Leben leben.« Sie wandte sich mir zu. »Zeig deinem Vater etwas Respekt. Er verdient es.« Sie räusperte sich. »Wir sind deine Eltern, und in Anbetracht unserer Erfahrung haben wir jedes Recht, uns um deine Gesundheit Sorgen zu machen. Fühlst du dich krank?«
»Nein«, versicherte ich ihr. »Ich bin absolut gesund. Ich war letzten Monat beim Arzt. Alles im grünen Bereich«, betonte ich.
»Dann hat dein Vater recht. Du bist zu schmal. Iss dein Abendbrot.«
»Mir geht es gut. Ich hatte heute Mittag einfach keinen Appetit.«
Mein Vater reichte die Schüsseln mit den Kartoffeln wieder in meine Richtung. »Aber jetzt?«
Mit einem Seufzer häufte ich Kartoffeln auf meinen Teller. Ich war nicht übermäßig hungrig, aber wenn er mich dann vom Haken ließ, würde ich die verdammten Kartoffeln eben essen.
Nach dem Essen half ich beim Abräumen. June hatte heute ihren freien Tag. Ich vermisste das sonnige Gemüt unserer Haushälterin, aber nächstes Mal würde ich sie wiedersehen. Ich räumte die Spülmaschine ein, während meine Mutter redete.
»Du musst verstehen, dass dein Vater besorgt ist, Lottie. Er hat mir erzählt, wie zerstreut du im Büro warst.«
»Mit mir ist alles in Ordnung.«
Sie zog die Stirn kraus. »Du bist nicht du selbst.«
Ich wollte sie fragen, ob sie überhaupt noch wusste, wer ich war, verkniff es mir aber.
Ich schloss die Spülmaschine, richtete mich auf und begegnete ihren ernst blickenden dunkelbraunen Augen. Ich hatte, wie mein Vater, blaue Augen, kam aber ansonsten nach meiner Mutter und hatte ihre haselnussbraunen Haare. Auch wenn ihre inzwischen ein wenig Unterstützung von ihrem bevorzugten Salon bekamen. Ich war klein und feingliedrig, genau wie sie, aber innerlich waren wir beide Kämpferinnen. Wir kämpften nur auf unterschiedliche Weise.
Aber in letzter Zeit war mir die Kampfkraft verloren gegangen.
»Es ist … die Arbeit.«
»Was ist damit?«
Ich zuckte die Achseln, unsicher, wie ich es formulieren sollte.
»Bist du nicht glücklich mit dem Projekt? Vielleicht könnte dir dein Vater ein anderes zuweisen?«
Ich musste tief Luft holen. »Ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt noch irgendein Projekt möchte, Mom.«
Ihre Augen wurden groß, als sie begriff. »Lottie. Hast du mit deinem Vater darüber gesprochen?«
»Kann ich nicht. Ich weiß nicht, wie. Du kennst seine Erwartungshaltung.«
»Du musst mit ihm sprechen. Er würde dir zuhören. In erster Linie ist er dein Vater.«
Ich wollte sie fragen, ob sie ernsthaft daran glaubte. Für mich fühlte es sich an, als wäre er erst einmal Charles und an zweiter Stelle mein Vater. Das war seit Jahren so.
Seit dem Tag, als wir Josh verloren.
Sie reichte über den Küchentresen, ergriff meine Hand, und ihre Stimme klang leise und traurig. »Du kannst ihn nicht zum Leben erwecken, indem du deines aufgibst, weißt du. Es würde ihm nicht gefallen, wenn er wüsste, dass du es überhaupt versuchst.«
»Ich weiß«, murmelte ich, geschockt von ihren Worten. Sie sprach sonst nie von Josh. Genau genommen sprach sie kaum über etwas Persönliches mit mir. Sie führte ein Leben, über das sie früher gelacht hätte. Lunch, Wellnesstage und Nachmittage mit den »Damen«. Meine Eltern lebten in einem teuren Hochhaus, hatten eine Haushälterin, die putzte, kochte und den Einkauf erledigte. Die Frau, die vor mir stand, war wohlfrisiert und formvollendet und völlig anders als die Mom meiner Erinnerung, die, mit mir im Schlepptau, einen Einkaufswagen vor sich herschob, während wir Cracker aus der offenen Tüte knabberten und Josh uns erklärte, welche Müslisorte er haben durfte. Aber diese Tage waren seit Jahren Vergangenheit. Meine Mom oder Jo-Jo, wie Dad sie nannte, verschwand an dem Tag, als Josh starb, und Josephine trat an ihre Stelle.
Unsere Augen trafen sich, und für einen Augenblick konnte ich darin ihren Schmerz erkennen. Kurz dachte ich, sie würde noch etwas anderes sagen wollen, aber sie straffte ihre Schultern und setzte wieder die unnahbare Maske auf, die ich gewohnt war.
»Wenn du meinst, das machen zu müssen, bringe es deinem Vater schonend bei. Er hat schon genug verloren.«
Ich hörte die unterschwellige Warnung hinter ihren Worten und schüttelte energisch den Kopf. Ich dachte an den Gesichtsausdruck, den er machen würde, wenn ich es ihm mitteilte. Die niederschmetternde Enttäuschung. Ich könnte es nicht ertragen. Ich konnte nicht diejenige sein, die ihm das antat. Ich verdankte ihm schon so viel.
»Es wird vorbeigehen, Mom. Das letzte Projekt war sehr stressig. Sobald das nächste Projekt beendet sein wird, nehme ich eine kleine Auszeit. Vielleicht fahren Brianna und ich in Urlaub. Ich schaffe das schon.«
Sie seufzte, faltete ein Geschirrhandtuch und legte es auf den Küchentresen. »Ich werde dich im Auge behalten, Lottie.«
Ich stand auf und griff nach meinem Mantel. »Ich gehe jetzt besser.«
Mom verstand sofort und sah mich an. »Machst du dich aus dem Staub, solange dein Vater telefoniert, damit er nicht auf einen Wagen für dich besteht?«
Ich beugte mich vor und gab ihr einen Kuss auf die Wange. »Du weißt genauso gut wie ich, dass Rodney mich auf dem Weg zur U-Bahn im Auge behalten wird. Ich bin absolut sicher. Und wenn ich angekommen bin, habe ich nur noch fünf Minuten Fußweg.«
Sie schüttelte den Kopf. »So unabhängig.«
»Das ist alles, was ich habe.«
Sie betrachtete mich stirnrunzelnd. »Du hast einen großartigen Job. Bedenke, wie wichtig deinem Vater die Firma ist, Lottie. Eine Menge Menschen hätten liebend gern deine Möglichkeiten.«
Ich unterdrückte eine Widerrede und lächelte meine Mutter an. Niemandem war klarer als mir, wie wichtig ihm die Firma war. Sie hatte alles andere in seinem Leben ersetzt, nachdem Josh gestorben war.
Und ich wusste, dass der flüchtige Moment, den meine Mutter und ich eben geteilt hatten, vorbei war. Jegliche Hoffnung, dass sie zu meinen Gunsten mit meinem Vater sprechen würde, war erloschen. Sie stellte sich immer an seine Seite. »Natürlich.«
Sie tätschelte meine Wange. »Wie du selbst gesagt hast, du kannst eine Pause machen, sobald das nächste Projekt abgeschlossen ist.«
»Stimmt. Ich werde später darüber nachdenken.«
»Gut.«
»Gute Nacht, Mom.«
Ich eilte davon, weil ich befürchtete, mein Vater würde aus dem Arbeitszimmer auftauchen und mich aufhalten.
Mit schleppenden Schritten stieg ich aus der U-Bahn; so erschöpft, wie ich war, fühlte sich mein Körper älter als sechsundzwanzig Jahre an. Ich ging die Stufen hoch, begrüßte die frische Luft, als ich aus dem Bahnhof trat, und wickelte meinen Schal enger um den Hals. Ich hatte keine Eile und ging im Schneckentempo. Ich bezweifelte ohnehin, dass ich bei all dem, was mir im Kopf herumging, würde schlafen können.
Ich fühlte mich wie in einer Falle. Ich verachtete meinen Job wirklich, hatte aber bisher keine Idee, wie ich da rauskommen sollte. Meinem Vater gehörte die Firma, und ich war die rechtmäßige Erbin. Es wurde von mir erwartet, das Erbe anzutreten. Mir tat das Herz weh, wenn ich daran dachte, warum. Es wäre Joshs Rolle gewesen. Wie mein Vater hatte er alle Bereiche des Geschäfts geliebt. Er saugte alles auf wie ein Schwamm. Er war das Goldkind, das von klein auf darauf vorbereitet worden war, die Firma zu übernehmen und den Namen Prescott weiterzutragen. Schon in jungen Jahren verstand er das Wesen von Vaters Geschäft und begeisterte sich dafür. Ich war nur das kleine Mädchen, geliebt, weil ich das Nesthäkchen war, von dem nichts erwartet wurde – bis zu dem Zeitpunkt, als Josh krank wurde.
Es ging alles sehr schnell. Kam er mir an einem Tag noch gesund vor, schien er am nächsten Tag, zumindest für das Kind, das ich damals war, lebensgefährlich erkrankt. Das ganze Leben drehte sich nur noch um das Krankenhaus und Josh. Alles was ich hörte, waren Diskussionen und Pläne für die Behandlungsmöglichkeiten. Nichts anderes mehr zählte. Mit jeder Behandlung, die versucht wurde und fehlschlug, verschlossen sich meine Eltern mehr. Als die Ärzte eine Therapie mit Stammzellen ins Gespräch brachten, wurden meine Eltern getestet, mit dem Ergebnis, dass sie nicht infrage kamen. Er wurde auf die Liste für eine Knochenmarktransplantation gesetzt, aber die Zeit lief uns davon. Das Einzige, was ich wusste, war, dass ich meinen großen Bruder vermisste und ihn wieder zu Hause haben wollte. Ich wollte, dass unser Leben wieder so wurde, wie es mal gewesen war. Als die Ärzte vorschlugen, mich trotz meiner Jugend zu testen, da eine große Chance bestand, dass ich als Spenderin infrage kam, sah ich die Hoffnung in den Augen meiner Eltern. Mir war bewusst, wie wichtig ein Erfolg war. Ich war die letzte Hoffnung, um Josh zu retten.
Und obwohl meine Merkmale perfekt passten und alle Hebel in Bewegung gesetzt wurden, blieb es am Ende vergeblich.
Die Enttäuschung im Gesicht meines Vaters, als er sich von mir abwandte, weil ihm klar wurde, dass nichts mehr helfen würde, werde ich niemals vergessen. Ich hatte versagt.
An dem Tag, als Josh starb, starb meine gesamte Familie mit ihm. Es war, als hätten sie mich vergessen. Ich bemühte mich so sehr um ihre Aufmerksamkeit, versuchte die Menschen zurückzuholen, die ich als meine Eltern gekannt hatte. Ich brillierte in der Schule. Ich verdrängte den albernen Traum, Konditorin zu werden, und konzentrierte mich auf das Geschäft. Ich fing an, für meinen Vater zu arbeiten, nachdem ich sicher war, dass es das war, was er wollte.
Ich versuchte, in Joshs Fußstapfen zu treten. Und den Verlust meiner Eltern wettzumachen, indem ich mein Leben für sie opferte.
Aber auch damit scheiterte ich.
3
Lottie
Es war spät, als ich endlich meine Schreibtischlampe ausmachte. Meine Uhr schlug achtmal, als ich in meinen Mantel schlüpfte und meine verspannten Muskeln dehnte. Ich machte mir heute Abend nicht die Mühe, meinen Laptop einzupacken. Bis ich zu Hause war und etwas gegessen hatte, war es Zeit ins Bett zu gehen, und morgen würde ich schon früh wieder zur Arbeit fahren.
Ich saß mit leerem Blick in der U-Bahn, und mein Kopf war noch damit beschäftigt, den Tag zu verarbeiten. Ein Meeting war in das nächste übergegangen, die E-Mails und To-do-Listen wurden nicht weniger. Ich kam kaum hinterher. Ich schlief miserabel, und der Appetit war mir fast völlig vergangen. Keine Ahnung, wie lange ich noch so weitermachen könnte.
Die nächste Haltestelle war meine, ich stand auf und war traurig, weil ich mir sicher war, dass ich ihn heute Abend nicht mehr sehen würde. Letzte Woche hatte ich ihn auch an einem Abend verpasst. Am nächsten Tag, als sich unsere Blicke über den Bahnsteig hinweg begegneten, hätte ich schwören können, dass ein Ausdruck der Erleichterung über sein Gesicht gehuscht war. Aber wahrscheinlich war das nur ein Wunschgedanke. Ich hatte mich für einige Minuten hingesetzt, ihm gelauscht und seine Musik in meine Seele dringen lassen, um dann nach Hause zu eilen und einen weiteren Abend mit Arbeit zu verbringen.
Heute Abend würde ich nicht mal diese paar Minuten haben.
Kaum war ich jedoch um die Ecke gebogen, blieb ich vor Schreck wie angewurzelt stehen, als ich ihn entdeckte, gegen die Mauer gelehnt und bedächtig auf seiner Gitarre eine Melodie zupfend, die ich nicht kannte. Er hob seinen Kopf, unsere Blicke verbanden sich, und ein Glücksgefühl durchströmte meine Brust. Ich wusste nicht, warum er so spät noch hier war, aber das war mir egal. Er war da. Das war das Einzige, was zählte.
Der Bahnhof war nicht mehr sehr bevölkert, und ich setzte mich in seine Nähe, um zuzuhören. Er begann einen anderen Song – einen meiner liebsten –, und ich lehnte mich entspannt zurück, ließ zu, dass sich meine Augen schlossen, während die Töne leise und süß zu mir herüberdrangen. Als er zu singen begann, lief mir eine Träne über die Wange, so warm und volltönend war seine Stimme. Mir war, als würde er allein für mich singen. Wieder nur eine Wunschvorstellung, aber so fühlte es sich für mich an.
Seine Stimme umfing mich wie die Umarmung eines Geliebten. Ich fühlte mich gewärmt, getröstet, und in seiner Gegenwart entspannte sich mein Körper zum ersten Mal wieder, seit ich ihn letzte Nacht verlassen hatte.
Als der Song verklang und der nächste begann, blieb ich einfach, wo ich war. Ich brauchte das heute Abend, brauchte ihn, so sehr. Mit einem Seufzen ließ ich meinen Kopf nach vorn sinken und gab mich der Musik hin. Seine Finger entlockten der Gitarre die Töne; seine Stimme umgab ihn und mich mit einem Zauber.
Und meine elende Welt verging.
Etwas war anders. Die Musik hörte nicht auf, klang aber plötzlich sehr nah. Ich öffnete blinzelnd die Augen und bemerkte mit Entsetzen, dass ich mitten in der U-Bahn-Station eingeschlafen war. Panisch fuhr ich hoch.
»Es ist okay. Du bist in Sicherheit«, beruhigte mich eine Stimme.
Ich kannte die Stimme, hatte sie aber noch nie sprechen, sondern bisher nur singen gehört. Ich drehte meinen Kopf und sah erschrocken, dass er direkt neben mir saß. Er hatte die Gitarre auf dem Schoß, strich über die Saiten und verfehlte keinen einzigen Ton.
»Ich habe auf dich aufgepasst.«
»Was?«
»Du bist eingeschlafen. Ich habe darauf geachtet, dass dir nichts passiert.«
Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. »Danke.«
Er neigte den Kopf und betrachtete mich. »Du arbeitest zu viel. Du bist erschöpft.«
Ich rückte von ihm weg. Seine zutreffende Beobachtung war mir unangenehm. »Du kennst mich doch gar nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob dir so eine Aussage zusteht.«
Seine Finger hörten auf zu spielen, und er legte seine Hände auf die Gitarre. »Ich bin zu weit gegangen. Tut mir leid.«
»Mmh, okay.«
Er streckte mir seine Hand entgegen. »Und da ich dich nicht kennen, schlage ich vor, dass wir das ändern. Ich bin Montgomery Logan.«
Ich starrte auf seine Hand. Seine Finger waren lang und die Nägel feinsäuberlich manikürt. Er wartete geduldig, bis ich meine Hand in seine legte, umschloss sie mit den Fingern und drückte sie leicht. Wieder wartete er und hob eine Augenbraue.
»Charlotte Prescott.«
Er drückte meine Hand. »Schön, dich kennenzulernen, Charlotte.«
»Lottie. Meine Freunde nennen mich Lottie.«
Er lächelte, und sein Grübchen kam zum Vorschein. »Meine Freunde nennen mich Logan. Montgomery ist ein ziemlicher Zungenbrecher.«
»Logan«, wiederholte ich.
Er nickte. »Da wir uns jetzt beim Vornamen nennen, gehe ich davon aus, dass wir Freunde sind?«
»Okay?«
Er beugte sich zu mir und zwinkerte. »Du siehst müde aus, Lottie. Du musst besser auf dich achten.«
Darüber musste ich nun doch kichern. »Okay.«
Er nahm seine Gitarre vom Schoß, verstaute sie im Koffer und klappte den Deckel zu. Er lehnte sich vor, stützte die Arme auf die Oberschenkel und sah mich prüfend an. »Du bist spät dran heute Abend.«
»Ich hatte auf der Arbeit viel zu tun.« Ich stockte kurz und sah mich um. »Bist du immer um diese Zeit hier?«
Er grinste, der Schalk stand ihm ins Gesicht geschrieben.
»Nee. Ich habe auf dich gewartet.«
»Auf mich?«, quiekte ich.
»Ich habe auch letzte Woche gewartet. Du weißt doch, die Nacht, in der du deinen kleinen Stunt abgezogen hast.«
»Ich habe dich nicht gesehen, als ich zurückgekommen bin.«
Er zuckte mit den Schultern. »Ich war hungrig, also bin ich über die Straße gegangen und habe mir etwas zu essen besorgt. Ich habe dich aus dem Bahnhof kommen sehen und aufgepasst, dass du heil nach Hause kommst.«
»Du hast was?«
»Ich bin dir gefolgt.«
Ich blickte ihn verblüfft an. Er sagte das so, als hätte es nichts zu bedeuten. Als wäre es völlig normal, jemandem hinterherzugehen. Ich schluckte. Ein Schauer der Angst lief mir über den Rücken.
Er gluckste mit tiefer, leiser Stimme. »Du müsstest dein Gesicht sehen. Ich wette, du versuchst zu entscheiden, ob du auf der Stelle wegrennen oder die Polizei rufen sollst, stimmt’s?«
Ich leckte über meine trockenen Lippen. »Ähm …«
Er hob seine Hand. »Das kam falsch rüber. Ich sah dich aus dem Bahnhof kommen, bin aus dem Coffeeshop rausgelaufen und habe dir nachgeschaut, bis du zu Hause warst.«
»Woher weißt du, dass ich zu Hause war?«
»Ich habe dich herauskommen sehen, als ich daran vorbeigegangen bin«, erklärte er. »Ich bin dir nicht im Sinne von hinter dir her nachgegangen.« Er hielt nun beide Hände hoch. »Ehrlich, Lottie. Ich habe nur geschaut, dass du sicher ankommst. Dann bin ich wieder reingegangen und habe meinen Burger zu Ende gegessen.«
Ich dachte über seine Worte nach.
»Du solltest um diese nachtschlafende Zeit nicht allein unterwegs sein.«
Ich schnaubte. »Du klingst wie mein Vater. Der Weg ist kurz.«
Er zog eine Schulter hoch. »Ich sag ja nur.«
»Das hier ist eine sichere Nachbarschaft.«
Er rutschte ein wenig näher. »Trotzdem, bei dem Gedanken, dass dir etwas passieren könnte …« Er schloss die Augen und erschauerte sichtlich. »Das gefällt mir nicht.«
»Ich werde vorsichtig sein«, versprach ich und wunderte mich, warum seine Worte eine Wärme in mir hervorriefen, die sich in meiner ganzen Brust ausbreitete. Er klang, als ob er sich Sorgen machen würde. Aus unerfindlichem Grund mochte ich den Gedanken.
»Warum hast du auf mich gewartet?«
Er saugte sorgenvoll an seiner Unterlippe, hob dann die Hand und schob eine Haarlocke hinter mein Ohr. Seine unerwartete Berührung schickte einen Schauer über meinen Rücken.
»Du sahst die letzten Abende erschöpft aus. Mehr als gewöhnlich. Ich wollte fragen …« Er geriet ins Stocken und räusperte sich.
»Was fragen?«, ermunterte ich ihn.
»Ob du dich von mir zu einem Kaffee einladen lassen würdest? Und mit mir essen gehst?«
»Oh«, stieß ich hervor.
Und ob ich wollte. Ich wollte nur zu gern überall dort hingehen, wo er hinwollte, ihm zuhören und mit ihm reden. Zeit mit ihm verbringen. Ihn kennenlernen. Dennoch zögerte ich.
»Das ist ein öffentlicher Ort. Du wirst vollkommen sicher sein.«
»Darüber mache ich mir keine Sorgen, Logan.«
Er fuhr sich mit der Hand durchs Haar und schob sich ungeduldig die Strähnen aus der Stirn. Eine überflüssige Geste, denn sie fielen direkt wieder zurück. Er sah erst weg und dann in meine Augen. Sein Blick war traurig, seine Stimme gequält. »Du willst nicht mit mir gesehen werden. Ist es das? Mit einem Straßenmusiker?«
»Nein!«, stellte ich klar. »Das ist es ganz und gar nicht!«
Er stand auf und reichte mir die Hand. »Dann komm mit mir.«
Ich wollte ihn nicht fragen, ob er es sich überhaupt leisten konnte und heute genug Geld verdient hatte, um wieder essen zu gehen. Ich beschloss, mir nach dem Essen einfach die Rechnung zu schnappen. Ich ließ ihn meine Hand nehmen und mich auf die Füße ziehen. Ich musste mich zurückbeugen, um sein Gesicht zu sehen.
»Du bist wirklich groß.«
»Und du nicht.«
»Ich bin Durchschnitt.«
Er beugte sich herunter, und der Anflug eines Lächelns umspielte seine Lippen, als er gluckste und mit tiefer Stimme in mein Ohr brummte: »Ich würde dich nie als Durchschnitt bezeichnen.«
»Ich meine nur größenmäßig.«
»Nun. Ich bin’s nicht. Was das anbetrifft, gehörte ich schon immer in die Oberliga.«
»Ich glaube, du gehörst bei vielem in die Oberliga.«
Er grinste und zog mich nah an seine Seite. Seine hochgewachsene Statur gab mir das Gefühl von Sicherheit.
»Ich nehme an, das wirst du jetzt herausfinden, nicht wahr, Lottie?«
Ich konnte nur noch nicken.
4
Lottie
Er führte mich über die Straße zu dem Coffeeshop, von dem ich annahm, dass er mich am letzten Abend von dort aus beobachtet hatte. Offensichtlich war er ein Stammgast, denn er lächelte die Kellnerin vertraut an.
»Hallo, Macy.«
»Hi, Logan. Kaffee?«
Er sah mich Bestätigung suchend an und nickte ihr dann zu. »Zwei, bitte.«
»Kommt sofort.«
Wir setzten uns, und Logan stellte seinen Gitarrenkoffer auf einen leeren Stuhl. Ich sah mich neugierig um. Ich war schon öfter an dem Laden vorbeigekommen, aber nie hineingegangen. Es war wie ein Blick zurück in eine andere Zeit, in der Leute noch zusammenkamen, um den Tag miteinander zu verbringen. Der Raum war mit Theken und Tischen aus Resopal, abgewetzten Stühle aus Vinyl und einem alten Linoleumboden ausgestattet. Unabhängig vom altersbedingten Zustand war alles penibel gepflegt – die Theken poliert, der Boden makellos sauber. Am Tresen saßen ein paar ältere Männer, tranken Kaffee und aßen Kuchen, der in Schaukästen Stück für Stück appetitlich angerichtet war. Der Geruch von Kaffee und Fett vom heißen Grill im Hintergrund hing in der Luft und ließ meinen Magen knurren.
»Hier gibt es die besten Cheeseburger der Stadt«, verkündete Logan und sah dabei nicht einmal auf die Speisekarte. »Falls du Fleisch isst.« Er verzog den Mund. »Gehörst du zu den Mädels, die nur Salat essen? Bist du darum so dünn?«
»Ich esse Fleisch. Und dünn bin ich auch nicht«, fügte ich abwehrend hinzu.
»Doch, bist du. In letzter Zeit bist du schmaler geworden.«
Ich verschränkte die Arme. »Sag, wie eingehend hast du mich eigentlich beobachtet?«
Macy kam und stellte uns den Kaffee hin. »Wollt ihr auch essen oder nur Kaffee trinken?«
»Zweimal Spezial, Macy. Extra Käse auf beide.«
Sie verschwand, bevor ich etwas sagen konnte.
»Vielleicht bin ich ja laktoseintolerant.«
»Und? Bist du?«
»Nein.«
»Dann wäre das abgehakt. Abgesehen davon habe ich dich ein paarmal Kaffee trinken sehen. Und du hast immer Milch reingetan.«
»Logan …«
»Lottie«, zog er mich auf.
»Du hast meine Frage nicht beantwortet.«
Er nahm einen großen Schluck Kaffee, ließ mich dabei aber nicht aus den Augen. Der Dampf aus der großen Tasse, die seine langen Finger locker umschlossen, waberte um seinen Kopf.
Er setzte sie ab und stützte seine Arme auf. »Wie eingehend ich dich beobachtet habe?«
Mir war fast ein wenig mulmig vor der Antwort. »Ja.«
Er strich mehrmals über den Henkel seiner Tasse. »Sehr eingehend.«
»Warum?«
Seine Antwort kam zögernd. »Weil ich glaube, dass du jemanden brauchst, der auf dich aufpasst.« Er sah mich mit gefühlvollen Augen an, das Licht schimmerte in seinen Iriden, die die Farbe von Whisky hatten. »Außerdem bist du zuerst zu mir gekommen.«
»Bin ich?«
»An dem Tag in der U-Bahn. Ich habe dich gehen sehen – deine Schultern waren hochgezogen, und du sahst so traurig aus. Als du dich hingesetzt hast, hatte ich das Bedürfnis, etwas zu unternehmen, damit du dich besser fühlst. Also habe ich angefangen, für dich zu spielen.«
»Für mich? Ich dachte, das war, äh …« Ich stotterte, unsicher, wie ich mich ausdrücken sollte.
»Für Geld?«
»Ja.«
»Das war eine Dreingabe, aber nicht der eigentliche Grund. Ich wollte etwas für dich tun. Du sahst so verloren aus, fast gebrochen.« Er ließ seine Hand über den Tisch gleiten, verschränkte meinen kleinen Finger mit seinem und drückte ihn. »Ich wollte – ich musste – dir helfen.«
Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich blickte hinunter auf unsere Hände. Meine wirkten so zierlich im Vergleich zu seiner. Wie seine Hand auf meiner lag und meine fast unter ihr zu verschwinden schien. Sein Griff war kräftig, die Fingerkuppen hatten Hornhaut vom Gitarrespielen und, wie ich annahm, von vielen Jahren harter Arbeit. Seine raue Haut störte mich aber überhaupt nicht. Im Gegenteil, seine Berührung tat mir gut. Ich hob die Augen, traf seinen Blick und brachte endlich den Mut auf, ihm zu sagen, was ich schon so lange dachte.
»Deine Musik bringt mir Frieden, Logan. Sie ist das Einzige, worauf ich mich jeden Tag freue. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, zu beschreiben, wieviel es mir bedeutet.«
»Ich spiele nur für dich.«
Ich hatte keine Gelegenheit zu antworten.
Macy kam und brachte uns Teller, voll beladen mit riesigen Burgern und einem Berg von Pommes Frites, die fast über den Rand fielen. Wir ließen einander los, und mir wurde zum ersten Mal bewusst, wie nah wir uns gekommen waren. Logan schien das nicht peinlich zu sein. Er zwinkerte, griff nach der Ketchup-Flasche, schüttete sich eine großzügige Portion auf den Teller und reichte sie dann mir. Ich nahm sie und spritzte einen Kleks an den Rand meines Tellers.
Ich betrachtete den Burger von allen Seiten und hatte keine Ahnung, wie ich ihn essen sollte, ohne mich vollständig zu bekleckern. Ich warf einen kurzen Blick auf Logan, der seinen Burger mit großem Appetit in Angriff nahm. Käse und Ketchup tropften ihm aus dem Mundwinkel. Mit einem Grinsen nahm er eine Serviette und wischte sich den Mund. Dann schubste er mir meinen Teller näher hin.
»Lang zu, Lottie. Ich will sehen, dass du isst.« Er nahm einen weiteren großen Bissen und kaute genüsslich. Wenn er schluckte, hüpfte sein Adamsapfel. Ich sah fasziniert zu, wie eine Handvoll Fritten durch Ketchup gezogen, in den Mund geschoben, gekaut und hinuntergeschluckt wurden.
Er schüttelte den Kopf und beugte sich über den Tisch. »Muss ich dich füttern?«
Ich riss mich aus der Trance. »Nein.« Ich nahm den Burger und biss hinein. Heißer Käse, fettiges Fleisch und frittierte Zwiebeln trafen auf meine Geschmacksknospen. Ich kaute und schluckte, und meine Augen schlossen sich vor Genuss von ganz allein. Er hatte recht. Das war der beste Burger, den ich je gegessen hatte.
Sein leises Lachen ließ mich die Augen wieder öffnen. Er zwinkerte mir zu, hielt mir eine Serviette hin, und ich wischte mir Ketchup vom Kinn.
»Das schmeckt lecker.«
»Habe ich dir doch gesagt.«
»Du bist ganz schön von dir überzeugt.«
Er zuckte mit der Schulter, während er zubiss und kaute. »Wahrscheinlich bin ich das. Das muss man, um durchs Leben zu kommen.«
»Durchs Leben kommen? Meinst du das generell oder in Bezug auf, äh, dein Metier?«
»Du meinst, als junger Singlemann in einer Großstadt? Oder als Straßenmusiker?«
»Ähm …«
»Das ist es, was du in mir siehst, ja? Arm, ums Überleben kämpfend, abhängig von Almosen, wie gestern Abend?«
Er ließ mich keinen Moment aus den Augen, und ich fühlte, wie mir Hitze den Nacken hochkroch und meine Wangen rot wurden. »Das waren keine Almosen.«
»Wie würdest du es bezeichnen?«
»Als Dankeschön.«
»Wirfst du immer hundert Mäuse in einen offenen Gitarrenkoffer?«
»Nein, aber …«
»Aber was?«
Ich hatte das Gefühl, die Unterhaltung driftete gerade in dunkles Gewässer ab. Ich legte meinen Burger vorsichtig zurück auf den Teller und wischte mir die Hände ab.
»Deine Musik bedeutet mir etwas. Mehr als ich dir sagen kann. Sie bringt mich zur Ruhe. Darauf freue ich mich den ganzen Tag. Nur darauf.« Ich erhob die Stimme. »Außerdem lässt du jeden Geld hineinwerfen. Nur mich nicht!«
»Das ist was anderes.«
»Ich verstehe nicht.«
Er aß seinen Burger auf und schob barsch den Teller beiseite. Dann trank er seinen Becher aus, gab Macy das Zeichen nachzuschenken und wartete, bis sie mit dem Kaffee kam und mit dem leeren Teller wieder verschwand.
»Du hast dein Essen kaum angerührt.«
Ich sah auf meinen halb gegessenen Burger und den Riesenhaufen Fritten hinunter, der immer noch auf meinem Teller lag. »Ich bin nicht so hungrig. Möchtest du?«
»Nein. Ich möchte, dass du es isst.«
»Erkläre mir, was du mit deiner Bemerkung meintest.«
Er rieb sich unwirsch über das Gesicht. »Ich spiele für dich. Wenn andere Leute zuhören und ein wenig Spaß haben, ist das schön. Wenn sie Geld dalassen wollen, auch gut. Aber meine Musik ist ein Geschenk an dich. Du sollst nicht bezahlen, um sie zu hören. Niemals.«
Seine Worte verblüfften mich.
»Was macht mich so anders?«
»Du machst den Unterschied.« Er beugte sich vor, streckte die Hand über den Tisch und strich mit seinen Fingern über mein Handgelenk. »Seit dem Abend, als ich dich das erste Mal sah, fühlte ich diesen Drang … das Bedürfnis, auf dich aufzupassen. Ich war auf dem Weg nach Hause, als du mir aufgefallen bist. Du sahst aus, als läge das ganze Gewicht der Welt auf deinen Schultern. Es erinnerte mich …« Er runzelte die Stirn und verstummte.
»Es erinnerte dich …«, wiederholte ich ermunternd.
»Es erinnerte mich daran, wie mein Vater gewöhnlich aussah. Zermürbt und abgespannt. Längst an seinen Grenzen angekommen.« Seine Augen loderten, als er über den Tisch sah. »Die Geschäftswelt hat ihn umgebracht. Mit zweiundvierzig Jahren war er tot. Er bekam einen Herzinfarkt an seinem Schreibtisch. Einfach tot zusammengesackt.«
Ich schlug die Hand vor den Mund. »Logan«, stieß ich hervor.
»Ich war vierzehn. Ich habe ihn immer beobachtet und sah, wie hart er gearbeitet hat. Es war nie genug. Wenn er zehn Stunden geschuftet hatte, verlangten sie zwölf. Arbeitete er sechs Tage die Woche, erwarteten sie sieben. Er hat jeden verdammten Tag darum gekämpft, gut genug zu sein, aber es hat nie gereicht. Er hat alles gegeben, was in seinen Möglichkeiten stand, um den Forderungen der Firma gerecht zu werden, und als Dank dafür wurde er vorzeitig ins Grab befördert.« Er schleuderte seine Serviette auf den Tisch. »Und alles, was mir blieb, war, von einem Kinderheim in das nächste gesteckt zu werden, bis ich davonrannte.«
»Was ist mit deiner Mutter?«
»Sie hat uns verlassen, als ich noch ein Kind war. Sie hasste das mittelmäßige Leben, das sie führen musste. Sie hörte nicht auf, meinem Vater damit in den Ohren zu liegen, dass sie mehr erwartete. Eines Tages packte sie ihre Sachen und ging, ohne auch nur einem von uns etwas zu sagen.« Logan schloss für einen Moment die Augen. »Damit saß mein Vater in der Klemme – mit mir und einer Arbeit, die er hasste.« Er stieß laut den Atem aus. »Das nenn ich ein Leben.«
Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, und Schweigen senkte sich über uns. Logans Finger trommelten einen ruhelosen Takt auf den Tisch, sein Bein wippte in kleinen, raschen Bewegungen auf und ab. Er langte an mir vorbei nach meinem Teller und begann die Pommes Frites zu essen. Er wirkte nervös und angespannt, und er sah mir nicht in die Augen.
Endlich sprach er. »Entschuldige, ich hätte das nicht alles bei dir abladen dürfen. Ich spreche selten über die Vergangenheit, aber in deiner Gegenwart ist es einfach irgendwie herausgeplatzt.
»Nein, ich bin froh, dass du es mir erzählt hast. Wie hieß dein Vater?«
»William. William Logan.«
»Ich bin sicher, er wäre sehr stolz auf dich.«
Logan fuhr mir ins Wort. »Erzähl mir von dir.«
»Da gibt’s, ehrlich gesagt, nicht viel zu erzählen. Ich arbeite bei Prescott Inc.«
»Der Investmentfirma?«
»Ja.«
»Prescott, wie dein Familienname?«
»Ja, die Firma gehört meinem Vater, und er ist der Geschäftsführer.«
»Verstehe. Keine Vetternwirtschaft weit und breit.«
Ein Schwall Wut kam in mir hoch. »Keineswegs. Ich war auf der Hochschule und habe mir meinen Abschluss verdient. Ich musste mich hocharbeiten, so wie jeder andere auch. Ich bin nur die Abteilungsleiterin einer kleinen Gruppe von Leuten. Wenn überhaupt, dann muss ich härter arbeiten und mich mehr beweisen als jeder andere dort, weil ich die bin, die ich bin.« Ich hob mein Kinn und gab seinen festen Blick zurück. »Mein Vater ist überzeugt, dass man sich seine Stellung verdienen muss. Familie hin oder her.«
Er hob flehend die Hände. »Entschuldige, das sollte ein Scherz sein. Ich bin überzeugt davon, dass du großartig bist in dem, was du tust.«
Ich zuckte mit den Schultern und griff nach meiner Tasse. »Ich versuche es zumindest.«
»Magst du deinen Job?«
Mein Blick wanderte durch das Lokal und landete dann wieder auf Logans Gesicht. Er hob eine Augenbraue und betrachtete mich eingehend. »Wenn du so lange darüber nachdenken musst, gehe ich davon aus, die Antwort ist ein deutliches Nein.«
»Ich bin mir unsicher, ob überhaupt irgendjemand seinen Job mag.«
Er schürzte die Lippen und zuckte kurz mit den Achseln. »Doch, ich.«
»Nicht jeder von uns kann durch die Straßen ziehen und zum Vergnügen Musik machen.«
Er deutete auf meinen Teller. »Isst du das wirklich nicht mehr?«
»Nein.«
Er zog den Teller zu sich heran, nahm den Burger und vernichtete ihn in Sekundenschnelle.
Ich machte mir Gedanken, ob er genug zu essen bekam. Er war schlank, sah aber nicht unterernährt aus. Er war ziemlich muskulös und gut in Form.
Er ertappte mich dabei, wie ich ihn anstarrte, kicherte und winkte Macy herbei. »Noch zwei Kaffee, bitte. Und ein Stück von dem Gewürzkuchen. Mit zwei Gabeln.«
Sie füllte beide Tassen nach und räumte meinen nun ebenfalls geleerten Teller ab.
Er wischte seine Finger und seinen Mund ab und zerknüllte die Serviette. »Mir ist schon klar, was du denkst. Aber ich versichere dir, dass ich durchaus in der Lage bin, selbst auf mich aufzupassen.«
»Oh, ähm …«
Macy brachte ein großes Stück Kuchen und zwei Gabeln.
»Lasst es euch schmecken.«
Logan spießte ein Stück auf, beugte sich über den Tisch und hielt mir die Gabel entgegen. »Du musst diesen Kuchen probieren – er schmeckt einfach fantastisch.«
Ich ließ zu, dass er mir die Gabel in den Mund schob, lehnte mich zurück und genoss den reichhaltigen Geschmack des Kuchens. Er war üppig, saftig, und auf meiner Zunge explodierte der Geschmack von Zimt und Muskat.
»Köstlich.«
»Mein Favorit.« Er brummte genüsslich und nahm einen großen Bissen. »Ich bestelle ihn jedes Mal.«
»Kommst du oft hierher?«
»Ziemlich oft. Ich bin kein sehr guter Koch – von Brunch mal abgesehen. Mein Rührei ist der Hit.«
»Du hast also einen Platz zum Kochen?«