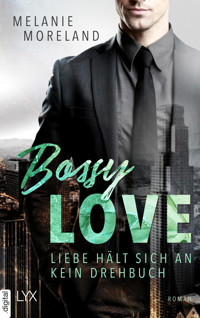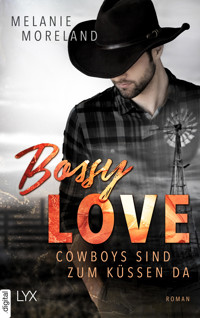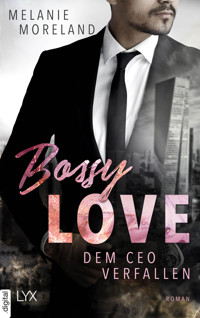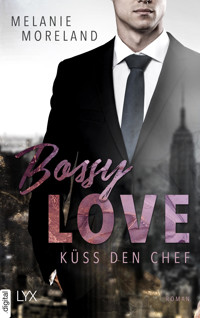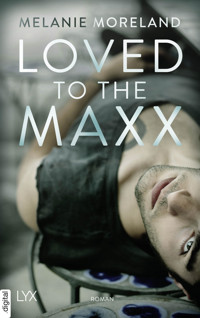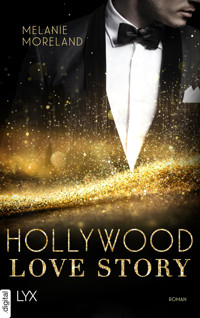6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Vested Interest
- Sprache: Deutsch
Was passiert, wenn ein Mann, der nicht an die Liebe glaubt, sein Herz verliert?
Halton Andrew Smithers ist Anwalt. Er vertritt die Schwachen und verhilft ihnen zu Gerechtigkeit. Weil er so viel Schlimmes gesehen hat, glaubt er nicht an die Liebe und vermeidet zu enge Bindungen - nach seiner Erfahrung verletzen sich die Menschen im Laufe der Zeit immer. Doch als die Frau seines ärgsten Konkurrenten sein Büro betritt und um Hilfe bittet, ändert sich alles für ihn. Fiona rührt eine unbekannte Seite in ihm, und das erste Mal in seinem Leben sehnt Hal sich nach einer Liebe, die ein Leben lang hält ...
"Wunderbar geschrieben und soo emotional. Ich konnte nicht aufhören zu lesen, fünf Sterne reichen nicht aus!" THE OVERFLOWING BOOKCASE
Band 6 der CORPORATE-LOVE-Serie von Bestseller-Autorin Melanie Moreland
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 431
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Widmung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Epilog
Danke!
Die Autorin
Die Romane von Melanie Moreland bei LYX
Leseprobe
Impressum
MELANIE MORELAND
Corporate Love
HAL
Roman
Ins Deutsche übertragen von Hans Link
Zu diesem Buch
Halton Andrew Smithers ist Anwalt. Er vertritt die Schwachen und verhilft ihnen zu Gerechtigkeit. Weil er so viel Schlimmes gesehen hat, glaubt er nicht an die Liebe und vermeidet zu enge Bindungen – nach seiner Erfahrung verletzen sich die Menschen im Laufe der Zeit immer. Doch als die Frau seines ärgsten Konkurrenten sein Büro betritt und um Hilfe bittet, ändert sich alles für ihn. Fiona rührt eine unbekannte Seite in ihm, und das erste Mal in seinem Leben sehnt Hal sich nach einer Liebe, die ein Leben lang hält …
Für meine Leser, die dieses Buch haben wollten
Und für Melissa
Dieses Buch ist für dich
Danke
1
Halton
»Sagen Sie Ihrem Mandanten, dass er zwölf Stunden Zeit hat, sich zu entscheiden.«
Am anderen Ende entstand eine Pause.
»Haben Sie mich gehört?«, blaffte ich.
»Es ist neun Uhr abends, Hal. Erwarten Sie von ihm, dass er sich heute noch entscheidet?«
»Es ist sein Kind, verdammt noch mal. Wenn er wirklich der Vater ist, der er so unbedingt sein will, wird ihn die Entscheidung fünf Minuten kosten.«
Ich knallte das Telefon auf den Schreibtisch und drehte meinen Stuhl so, dass ich aus dem Fenster schauen konnte. Ich atmete etwas dringend benötigten Sauerstoff ein. Lange, ruhige Atemzüge, die mich beruhigen und erden sollten.
Es half nicht.
Ich nahm eine Flasche vom Sideboard und goss mir etwas Scotch in ein Kristallglas. Für einen Moment hielt ich das Glas ins Licht, bewunderte die goldene Färbung und kippte dann den Alkohol runter. Das Brennen in meiner Kehle fühlte sich gut an, die samtige Weichheit des Scotchs schmeichelte meinen Geschmacksknospen und wärmte mir die Brust. Ich schenkte mir noch ein Glas ein, lehnte mich zurück und schaute in die Nacht hinaus.
Der frühherbstliche Abend war klar, und die Lichter der Stadt leuchteten hell. Hier oben, in meinem Eckbüro im vierzigsten Stock, hatte ich eine herrliche Sicht auf den Hafen von Toronto und die Innenstadt. Ich schaute oft aus dem Fenster, wenn ich den Tag Revue passieren ließ oder über die beste Lösung für ein Problem nachdachte.
Oder über Versager von Eltern fluchte, die das Gefühl hatten, sie verdienten es, aus einer Laune heraus eine Rolle im Leben ihres Kindes zu spielen.
Seufzend lehnte ich den Kopf an das dicke Leder meines Bürostuhls, nippte an dem Scotch und lockerte meine Krawatte.
Dieser Fall ärgerte mich maßlos. Ein geschiedenes Paar – die Mutter hatte das alleinige Sorgerecht erhalten, während der Vater nach der üblichen Regelung jedes zweite Wochenende und gelegentlich abends sein Kind sehen konnte.
Wenn es ihm in den Kram passte – und das war nicht oft der Fall.
Wie meine Mandantin, seine Exfrau, belegen konnte, tauchte er in den meisten Fällen überhaupt nicht auf. Bis sie jemanden kennengelernt hatte, der eine Vaterfigur für ihre Tochter und ein Partner für sie geworden war.
Jetzt wollte dieser Blödmann plötzlich am Leben seiner Tochter teilhaben und verlangte ein großzügigeres Besuchsrecht. Er behauptete, seine Exfrau würde seine Tochter von ihm fernhalten und sie, was seine Person anging, negativ beeinflussen.
Glücklicherweise hatte meine Mandantin über alle versäumten Besuche penibel Buch geführt, alle Textnachrichten und E-Mails, die sie geschickt hatte, um ihn an bevorstehende Geburtstage, wichtige Termine und Besuchszeiten zu erinnern, sorgsam aufbewahrt. Die er sämtlich ignoriert hatte, bis er herausfand, dass er ersetzt worden war.
Das Problem lag in der Großzügigkeit meiner Mandantin. Statt ihre Tochter in einen Sorgerechtsstreit zu verwickeln, der hässlich werden konnte, versuchte sie, eine Lösung zu finden. Ihr Angebot eines regelmäßigen Umgangs war mehr als fair, vor allem angesichts der Tatsache, dass er das nur tat, weil er beleidigt war. Bei seinem Ego ertrug er es nicht, ersetzt zu werden. Und obwohl Janet das wusste, entschied sie trotzdem im Zweifelsfall zu seinen Gunsten.
»Ich will nicht, dass Kimberly ihren Vater nicht kennt«, erklärte sie mir. »Er war ein guter Dad, als wir noch zusammen waren, und sie hat ihn angebetet.«
»Das war damals«, wandte ich ein. Ich hätte ihm am liebsten ohne jede Zurückhaltung das Leben schwergemacht und ihn völlig aus dem Leben der beiden getilgt. »Sein Verhalten spricht für sich selbst.«
Sie sah traurig aus. »Ich weiß, aber ich habe die Hoffnung, dass er sich Mühe gibt, wenn ich es ihm anbiete. Wirklich Mühe gibt. Damit ich Kimmy, sollte sie jemals fragen, aufrichtig sagen kann, was ich alles versucht habe, damit er in ihrem Leben präsent ist.« Sie seufzte und schaute an mir vorbei aus dem Fenster. »George liebt sie auch, aber Hank ist ihr Vater.« Resigniert zuckte sie die Achseln. »Wie George immer sagt, kein Kind kann zu viel Liebe bekommen. Wenn sie beide haben kann, dann ist das eine gute Sache.«
Ich hatte ihre Worte noch immer im Ohr. Kein Kind kann zu viel Liebe bekommen.
Einige Kinder bekamen gar keine Liebe. Manchmal waren sie nur Schachfiguren – gefangen in einem Spiel, das sie sich nicht selbst ausgesucht hatten.
Einem Spiel, in dem sie die Verlierer waren – jedes Mal.
Ich schüttelte den Kopf, um ihn freizubekommen, schob die Erinnerungen und mit ihnen die Gefühle da hin, wo sie hingehörten.
In die Vergangenheit.
Das Öffnen der Tür hinter mir ließ mich aufschrecken, und ich sprach, ohne mich umzudrehen. »Warum bist du denn immer noch hier?«
Ein langer Seufzer drang an meine Ohren. »Weil mein tyrannischer Chef auch noch hier ist. Daher bin ich als guter Soldat ebenfalls geblieben.«
Ich drehte mich um und begegnete dem ruhigen Blick meines Mitarbeiters. »Jetzt bist du also Soldat?«
Fältchen erschienen um Renes Augen, als er kicherte. Er war zwanzig Jahre älter als ich, verfügte aber dennoch an den meisten Tagen über größere Energiereserven. Er hatte jung geheiratet, und sein Sohn war in meinem Alter, verheiratet und hatte zwei Kinder, in die Rene völlig vernarrt war. Seine Frau war vor zehn Jahren gestorben, und seither bezeichnete er sich selbst als Herzensbrecher. Groß, dünn, mit milchkaffeefarbenem Teint und einem glänzenden, kahlen Kopf, steckte er in seiner gewohnt extravaganten Kleidung. Ich hatte eine Weile gebraucht, um mich an seine Garderobe zu gewöhnen. Wenn ich eine große Anwaltskanzlei gehabt hätte, wäre er herausgestochen wie ein bunter Hund, aber da ich allein arbeitete, hatte ich nichts dagegen.
Dunkle Anzughosen, ein leuchtend blaues Hemd, eine Weste mit wildem Muster und eine freche Krawatte waren seine Vorstellung von angemessener Kleidung fürs Büro. An anderen Tagen trug er gemusterte Jacketts und Einstecktücher in grellen Farben. Seine Füße steckten immer in den verrücktesten Schuhen, und an seinem Ohr glänzte ein goldener Ring. Seine Garderobe schrie geradezu: reich und verwöhnt, aber bei der Arbeit war er definitiv zupackend, und ohne ihn wäre ich verloren gewesen. Er leitete mein Büro mit großer Präzision und fand sich, ohne sich je zu beklagen, mit meinem mörderischen Terminkalender ab.
»Ich bin mir sicher, dass ich das Outfit habe, um es zu beweisen.«
Ich grinste. »Daran habe ich nicht den geringsten Zweifel.«
Er legte einen Stapel Ordner auf meinen Schreibtisch. »Ich habe deinen Kalender auf den neuesten Stand gebracht, alle Akten zusammengesucht, die du morgen brauchst, und außerdem all deine Textnachrichten und E-Mails beantwortet, die ich beantworten konnte. Darüber hinaus musste ich dir das Dinner mit deiner aktuellen Flamme auf Donnerstag verlegen. Am Mittwochabend hast du ein Treffen mit einer neuen Mandantin, und ich weiß, wie sauer Ms Molly wird, wenn du sie warten lässt.«
Meine Lippen zuckten. »Gut mitgedacht.«
»Sie geht mir auf den Wecker.«
Ich versuchte, nicht zu lachen. »Tatsächlich? In welcher Hinsicht?«
»Ihre ganze Art. Sie ist ziemlich schwierig. Von ihrer Stimme ganz zu schweigen. Wie Fingernägel, die über eine Schiefertafel kratzen.«
»Danke für das Update.«
»Ich sage dir, wenn du die Sache mit ihr beendest – und wir wissen beide, dass du das tun wirst –, wird sie es ziemlich schlecht aufnehmen. Sie ist der Typ, der klammert.«
»Ist pflichtschuldig vermerkt.«
»Du musst dir endlich ein nettes Mädchen suchen. Ruhiger werden. Mit diesem oberflächlichen Scheiß aufhören.«
»Kein Interesse, vielen Dank.«
Er musterte mich und verschränkte die Arme vor der Brust. »Für irgendjemanden hast du eine Menge zu bieten, Halton.«
Ich schnaubte. »Im Bett vielleicht. An etwas anderem habe ich kein Interesse.«
»Nur dafür gestattest du dir, Interesse zu haben.«
Ich wedelte mit der Hand und tat seine Worte ab. »Das geht dich nichts an, Rene. Verschon mich also damit.«
»Mein Leben wäre leichter, wenn ich mir nicht immer merken müsste, wer wer ist und mit wem du diese Woche schläfst.«
»Ich bezahle dich gut genug, damit du den Überblick über solche Details behältst. Mach einfach deinen Job.«
»Und ich mache ihn gut, vielen herzlichen Dank.«
Ich zog eine Schulter hoch. »Na ja, schon möglich.«
»Oh, überschlag dich nur nicht mit Komplimenten«, gab Rene schnippisch zurück. »Ich würde gern sehen, wenn sich ein anderer mit dir altem Grübler herumschlagen müsste.«
Er hatte recht, und wir wussten es beide, aber ich piesackte ihn gern. Er zahlte es mir ja auch bei jeder sich bietenden Gelegenheit heim.
Ich lehnte mich zurück und schürzte die Lippen. »Warum arbeitest du für mich, wenn ich so ein elender Bastard bin?«
»Weil du einen Anzug trägst, als kümmere dich nicht, was andere denken, und meine unteren Regionen singen, wenn ich dir beim Herumstolzieren zusehe«, gab er zurück, ohne die Miene zu verziehen.
Ich blinzelte. »Ich habe keine Ahnung, was ich darauf sagen soll.«
Rene verdrehte die Augen und wurde wieder ernst. »Ich arbeite für dich wegen der Dinge, die du tust, Halton.«
Ich unterbrach ihn mit einer ungeduldigen Geste. »Hör auf, mich so zu nennen. Du weißt genau, dass ich Hal vorziehe.«
Er schüttelte den Kopf. »Hal ist nur eine Rolle. Er ist das Arschloch, mit dem andere Anwälte und Richter sich Tag für Tag herumschlagen müssen. Der Mann, der keiner Auseinandersetzung aus dem Weg geht. Die Person, die der Welt ein gleichgültiges Gesicht präsentiert. Ich kenne den wahren Halton. Den Mann, der sich für Kinder einsetzt. Für eine Frau, die versucht, den Ehemann, der sie misshandelt, zu verlassen. Für den Dad, der das bessere Elternteil für sein Kind sein will. Du setzt dich für die Benachteiligten ein.«
»Behalt doch die Herzschmerzgeschichten für dich. Ich sehe es gern, wenn der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Ganz einfach. Und ich gewinne gern.«
Rene drehte sich auf dem Absatz um und ging zur Tür. »Sag, was du willst, hinter all dem Gepolter und der Bissigkeit verbirgt sich ein guter Mann.«
»Raus aus meinem Büro.«
Rene blieb grinsend noch einmal stehen. »Keine Sorge, Boss. Ich mag meinen Job zu sehr. Letzteres behalte ich für mich.«
»Tu das.«
Er schloss die Tür, und mein Telefon klingelte.
Als ich die Nummer sah, grinste ich. »Hal Smithers«, blaffte ich ins Telefon.
»Wir nehmen das Angebot an.«
»Ich werde es meine Mandantin wissen lassen.«
Ich legte auf und griff nach meinem Scotch.
Gewonnen.
2
Halton
»Du hörst nicht zu«, keifte Molly.
Ich schaute stirnrunzelnd von meinem Telefon auf. »Ich habe dir doch gesagt, dass ich mitten in einem wichtigen Fall stecke. Meine Arbeit hat Priorität. Das habe ich unmissverständlich klargemacht von Beginn dieser … wie immer du die Sache zwischen uns nennen willst.«
Sie schniefte. »Ich dachte, es sei eine Beziehung.«
Mit einem Seufzen legte ich das Telefon beiseite, griff nach meinem Scotch und nippte anerkennend an der goldenen Flüssigkeit. Im gedämpften Licht des Restaurants betrachtete ich Molly. Sie war entzückend – wenn man auf große, gertenschlanke Brünette mit tollen Brüsten stand.
Und das tat ich.
Aber sie sah unzufrieden aus. Sie kniff die dunklen Augen zusammen, tippte mit ihren langen Nägeln gegen ihr Weinglas und musterte mich mit finsterer Miene und heruntergezogenen Mundwinkeln. Ich fühlte mich versucht, sie daran zu erinnern, dass Grimassen Falten verursachten, aber ich hielt mich zurück.
»Beziehungen sind nichts für mich, Molly. Daraus habe ich nie einen Hehl gemacht. Ich lade dich mit Freuden zum Abendessen ein oder nehme dich hin und wieder zu gesellschaftlichen Anlässen mit, verreise manchmal sogar übers Wochenende mit dir, aber das ist alles, was ich dir bieten kann.«
»Und Sex«, ergänzte sie. »Du magst Sex.«
»Jepp. Auch in dieser Hinsicht war ich immer offen zu dir. Du hast dich noch nie darüber beklagt.« Ich hielt inne und wählte meine nächsten Worte mit Bedacht. »Ich bin nicht dein ›Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage‹, Molly. Ich mache diesen Scheiß nicht. Das weißt du.«
»Du bist der emotional unnahbarste Mann, der mir je begegnet ist.«
Ich hätte am liebsten die Augen verdreht. Das war kaum eine Neuigkeit. Ich hielt nichts von Gefühlen – es sei denn, es handelte sich um Zorn, den ich in die richtigen Bahnen lenken konnte, um einen Fall zu gewinnen. Zorn, Hass – diese Gefühle waren nützlich für mich. Auf sie hatte ich meine Arbeit gegründet. Und sie waren ehrlicher als das eine Gefühl, von dem ich mich fernhielt. Liebe. Das war das gefährlichste aller Gefühle. Fünf kleine Buchstaben, die die Macht hatten, alles, was ihr in die Quere kam, zu zerstören.
Ich schüttelte den Kopf, um den Gedanken zu verscheuchen. Molly runzelte erneut die Stirn, offensichtlich sauer, dass ich nicht auf das reagierte, was sie gesagt hatte. Ich griff wieder nach meinem Drink.
Ich hatte das Gefühl, ich könnte heute Abend Alkohol gebrauchen.
»Ich denke, wenn du nur gut genug hinschaust, wirst du feststellen, dass keiner von uns Männern besonders engagiert ist, Molly. Zumindest nicht die Art Mann, die du zu mögen scheinst.«
»Was soll das denn heißen?« Sie verschränkte die Arme, sodass ihre sowieso schon großen Brüste noch mehr hervortraten.
»Du magst reiche Männer. Männer wie mich, die dir Geschenke machen. Die dich zum Abendessen ausführen.«
Sie warf das Haar zurück. »Ja, und?«
Ich zuckte die Achseln. »Der Typ Mann, der sich dich leisten kann, ist für gewöhnlich nicht auf der Suche nach einer ernsten Beziehung.«
»Du bist echt unhöflich.«
»Ich nenne halt die Dinge beim Namen. Außerdem hast du das alles von Anfang an gewusst. Ich lade dich zum Abendessen ein, wir haben Sex, ich mache dir gelegentlich Geschenke. Bisher hat es funktioniert, also, wo ist das Problem?«
Sie lehnte sich zurück, schlug die Beine übereinander und lenkte meinen Blick auf ihren kurzen Rock. Ihr oberes Bein schwang schnell hin und her und verriet ihre innere Erregung. »Ich habe dich zwei Wochen lang kaum gesehen. Und warum siehst du so müde aus? Die Ringe unter deinen Augen sind noch dunkler als sonst. Das ist nicht attraktiv, Hal.«
Ich verkniff es mir, ihr zu erklären, wie viel ich arbeitete – so etwas war ihr zu fremd, als dass sie es verstanden hätte. Genau wie meine ständige Schlaflosigkeit. Sie konnte nichts davon wissen, da ich nie die Nacht mit ihr verbrachte – oder mit irgendjemandem sonst. Solche Dinge behielt ich für mich. Stattdessen hob ich mein Telefon. »Arbeit. Ich jongliere im Moment mit fünf Fällen gleichzeitig, allesamt ziemlich unerfreulich. Ich habe alles beiseitegeschoben, um heute Abend mit dir essen zu gehen.«
»Und du hast die ganze Zeit an deinem Telefon gehangen«, nörgelte sie. Ihre Stimme sägte an meinen Nerven, und ich dachte an Renes Bemerkung. Er hatte recht – Mollys Stimme war nasal und hoch, doch irgendwie war mir das bisher gar nicht aufgefallen. Ich musterte sie ein wenig genauer. Mir war auch nicht aufgefallen, wie viel Make-up sie benutzte, und die Wahl ihrer Garderobe war ziemlich fragwürdig. Wenn sie sich über den Tisch beugte, war ich mir sicher, würde sie den Gästen im Restaurant eine beachtliche Show bieten. Ihr hingen die Titten praktisch aus dem tiefen Ausschnitt. Mit diesem Dekolleté und der unpassenden Rocklänge schrie sie geradezu: »Seht mich an!«
Was hatte ich mir bloß bei der ganzen Sache gedacht?
Innerlich schüttelte ich den Kopf. Wie gewöhnlich, wenn es um Frauen ging, hatte ich mich nicht von meinem Hirn leiten lassen. Diese großartigen Brüste hatten mein Urteilsvermögen getrübt, was nicht zum ersten Mal geschah.
»Ich brauche mehr Aufmerksamkeit«, fügte sie hinzu. »Ich will dieses Wochenende wegfahren.« Sie hob das Kinn. »Und ein Geschenk, das die Zeit wettmacht, in der du mir keine Beachtung geschenkt hast.«
Ich hatte genug. Mit einem Seufzen stellte ich das Glas ab – es war eine Schande, dass wir noch nicht gegessen hatten. Ich hatte mich auf mein Filet gefreut. Ich senkte die Stimme und schlug den Ton an, den ich über die Jahre, in denen ich mich mit Richtern, Geschworenen und Mandanten auseinandergesetzt hatte, perfektioniert hatte. Die Stimme, die schmeichelte und besänftigte und die Leute in die Richtung lenkte, in die ich sie haben wollte.
»Ich denke, wir müssen dieses Dinner als das bezeichnen, was es wirklich ist, Süße. Unsere letzte gemeinsame Mahlzeit. Ein Lebewohl.«
Ich nannte alle Frauen, mit denen ich ausging, Süße. Das rettete mir den Arsch, damit ich beim Sex nicht womöglich den falschen Namen ausrief.
Ihre Augenbrauen zuckten in die Höhe. »Was?«
»Wir wollen unterschiedliche Dinge«, erklärte ich und stürzte mich dann in meine gewohnte Abgangszusammenfassung. »Du bist großartig, Molly, und du verdienst einen Mann, der all das, was du zu bieten hast, zu schätzen weiß. Der dir seine Zeit und Aufmerksamkeit schenken kann. Das bin nicht ich. Ich denke, wir sollten uns nicht mehr treffen.«
»Du machst mit mir Schluss?«
»Ja.«
Ihre Finger krampften sich um ihr Weinglas, und ich konnte ihre Gedanken lesen.
»Das würde ich nicht tun.« Ich deutete auf das Glas, das sie langsam hob. »Mein Scotch brennt wesentlich stärker, wenn er in deine Richtung fliegt.«
»Das würdest du nicht tun«, stieß sie leise hervor. Sie musterte mich argwöhnisch, unsicher, ob sie ihre eigenen Worte glauben sollte.
Sie hatte recht. Ich würde einer Frau niemals Alkohol ins Gesicht schütten, ganz gleich, was sie getan hätte. Ich besaß Klasse und Manieren.
Und ich würde den Scotch nicht vergeuden wollen.
»Stell mich auf die Probe«, gab ich höhnisch zurück.
»Du bist ein Arschloch.«
»Schuldig im Sinne der Anklage.
Ihre Finger bewegten sich erneut, und ich wartete ab und verfluchte den Umstand, dass ich heute Abend meinen grauen Lieblingsanzug trug. Der Rotwein würde mit Sicherheit Spuren hinterlassen.
Verdammt.
Dann griff sie mit einer Bewegung, die ich nicht erwartet hatte, nach ihrem Wasserglas und schleuderte den Inhalt in meine Richtung. Ich neigte den Kopf zur Seite, und glücklicherweise war sie schrecklich schlecht im Zielen, sodass der überwiegende Teil der kühlen Flüssigkeit an meiner Schulter vorbeiflog und an die Wand hinter mir klatschte, das Geräusch laut in dem stillen Restaurant. Das Eis knallte dagegen, und das Wasser rann in kleinen Bächen in den Teppich.
Sie stand auf und kreischte mich an: »Niemand macht mit mir Schluss!«
Ich griff nach meiner Serviette und wischte mir die Wange ab.
»Ich glaube, Süße, da irrst du dich. Ich habe es gerade getan.«
Sie stampfte mit dem Fuß auf wie ein Kleinkind, stürmte aus dem Restaurant und verfluchte dabei meinen Namen auf sehr undamenhafte Weise.
Ich musste zugeben, dass das eine Premiere für mich war. Für gewöhnlich machte ich unter vier Augen Schluss und schickte am nächsten Tag Blumen mit den besten Wünschen. Molly war von dem Moment an, in dem ich sie kennengelernt hatte, eine Ausnahme gewesen. Ein Irrtum – ein furchtbarer Fehler meinerseits.
Ein Kellner erschien und entfernte ihr Gedeck. Ein weiterer Kellner widmete sich der Sauerei, die sie an der Wand hinter mir hinterlassen hatte.
»Möchten Sie noch einen Scotch, Sir?«
Ich hatte eigentlich vor abzulehnen und um die Rechnung zu bitten, aber zu meiner Überraschung wandten sich nach anfänglichem Gaffen alle um mich herum kein bisschen verstört wieder ihrem Essen zu.
Wahrscheinlich hätte mir das Ganze peinlicher sein sollen, als es der Fall war, doch ich verspürte nur Erleichterung. Eine Szene war ein kleiner Preis dafür, sie los zu sein. Kaum dass die Worte aus meinem Mund gekommen waren, war mir bewusst geworden, dass ich sie loswerden wollte. Sie war ermüdend und anstrengend. Ständig hatte sie mir mit jeder Einzelheit ihres Lebens die Ohren vollgequatscht – Dinge, von denen mich die meisten nicht interessierten. Sie hatte Geschenke verlangt – welche von der Sorte, die in einem Kästchen überreicht wurden, und solche, die meine Zeit beanspruchten. Die Geschenke, die ich kaufen konnte, bereiteten mir weniger Mühe, aber meine Zeit war nun mal begrenzt, und das lag jetzt hinter mir. Das ganze Thema. Ich brauchte eine komplette Pause von Frauen und musste mich auf meine Arbeit konzentrieren.
»Ja, bitte. Ich hätte mein Essen gern sobald wie möglich. Ich bin halb verhungert. Bringen Sie mir außerdem den Salat, der für die Dame bestimmt war. Ich werde alles aufessen.«
Er nickte. »Sehr wohl, Sir.«
Ich griff nach meinem Telefon und war dankbar dafür, dass das Wasser es nicht erwischt hatte. Ohne Handy wäre ich verloren gewesen. Es war heutzutage genauso notwendig für mich wie das Atmen. Ich verzog den Mund zu einem schmalen Lächeln – ich hatte Glück gehabt, dass sie das Wasser gewählt hatte.
Ich widmete mich wieder meinen E-Mails, dankbar für die Ablenkung.
Zumindest musste ich ihr keine Blumen schicken. Aber ich würde ihre Nummer auf meinem Handy blockieren und Rene anweisen, dass ich keine Anrufe mehr von ihr entgegennehmen und sie auch nicht mehr in meinem Büro sehen wollte.
Er würde triumphierend lachen, wenn ich es ihm erzählte.
Der Mistkerl.
3
Halton
Mit langen Schritten kam ich durch die Tür und ging an Rene vorbei in mein Büro, wo ich die Tür hinter mir zuschlug. Nachdem ich meine Aktentasche aufs Sofa geworfen hatte, ließ ich mich danebenfallen und lehnte den Kopf gegen das kühle Leder. Es fühlte sich gut auf der vor Zorn erhitzten Haut meines Nackens an. Ich dachte an die Verhandlung, die an diesem Morgen stattgefunden hatte.
»Aber Euer Ehren, es liegt nicht im Wohl des Kindes!«, argumentierte ich, obwohl ich wusste, dass meine Worte auf taube Ohren stoßen würden. Dennoch war ich entschlossen, es zu versuchen.
Richterin Sparks sah mich mit einer hochgezogenen Augenbraue an, ihre Stimme voller Hohn. »Ich entscheide, was im Wohl des Kindes liegt, Herr Anwalt.«
»Auf jeden Fall ist es nicht die Mutter«, zischte ich. Ich deutete auf meinen Mandanten, der mit herabgesunkenen Schultern neben mir saß. »Ihr Vater hat große Sorge wegen des Einflusses ihrer Mutter auf sie. Er möchte ihr nicht das Besuchsrecht verweigern, aber er hat das Gefühl, es wäre das Beste, wenn er die Hauptbezugsperson der Kleinen wäre.«
Die Richterin schüttelte den Kopf. »Ich sehe das anders. Ich bin der Meinung, ein Kind gehört zu seiner Mutter. Ihr Mandant bekommt ein Besuchsrecht. Ich schlage vor, er macht das Beste daraus.«
Laut ertönte der Hammer im Gerichtssaal und verkündete das Ende der Verhandlung und ihren Abgang. Ich fing Erics enttäuschten Blick auf.
»Wir können in Berufung gehen. Versuchen, einen anderen Richter zu bekommen.« Ich hasste es, wenn Richterin Sparks den Vorsitz hatte. Sie schlug sich immer auf die Seite der Mütter. Wenn man sich dann noch den Mistkerl von Anwalt ansah, den Erics Exfrau angeheuert hatte, war die Entscheidung zwar nicht überraschend gewesen, aber ich hatte dennoch gehofft, die Sache würde anders ausgehen.
Er schüttelte den Kopf. »Ich kann Maddy nicht noch mehr zumuten, Hal.« Er seufzte. »Wir haben alles versucht.«
Er schaute zu seiner Exfrau hinüber, die mit ihrem Anwalt sprach, das siegreiche Strahlen auf ihrem Gesicht unübersehbar. »Ich kann nur hoffen, dass sie der Verantwortung bald müde wird. Dass sie mir, sobald sie das Gefühl hat, mich genug bestraft zu haben, Maddy überlassen wird«, fügte er hinzu. »Darauf setze ich meine Hoffnungen. In der Zwischenzeit kann ich nur versuchen, für Maddy da zu sein, wenn sie mich braucht, und den negativen Einfluss, den Audrey auf sie hat, zu entschärfen.«
Ich folgte seinem besorgten Blick. Seine Exfrau war eine Irre. Viel zu sehr darauf konzentriert, dafür zu sorgen, dass ihre Tochter mager blieb und mit den »richtigen Kids« rumhing, statt ihr zu erlauben, ein kleines Mädchen zu bleiben. Sie behandelte Maddy wie eine Freundin und nicht wie ein Kind, und sie missbrauchte ihre Achtjährige, um ihre eigenen Probleme zu bewältigen. Audrey konnte man nie etwas recht machen, und sie beklagte sich unaufhörlich.
Ihre ständige Kritik hatte Eric vertrieben, und er hatte darum gekämpft, Maddy behalten zu können, weil er es hasste, wie seine Tochter sich wegen seiner Exfrau fühlte und benahm. Ich hatte persönlich gesehen, welche Wirkung ihre Mutter auf sie hatte. In ihrer Gegenwart war sie in sich gekehrt und nervös, immer still und wohlerzogen, das Strahlen in ihren Augen erloschen. Sie übernahm die Verantwortung für Audreys Traurigkeit und verhielt sich, als sei sie deren Mutter. Aber bei Eric war sie glücklich und wurde geliebt. Sie lachte und spielte – machte sich schmutzig und wollte in den Arm genommen werden. Er hatte keine Erwartungen an sie, abgesehen davon, dass sie ein kleines Mädchen war. Das war es, was sie brauchte. Bedingungslos geliebt zu werden. Nicht wie eine Mini-Erwachsene behandelt zu werden, die die Last der Welt auf ihren Schultern trug.
Aber der Anwalt ihrer Mutter hatte alles verdreht. Hatte Maddys Schuldgefühle dazu benutzt, sicherzustellen, dass sie darum bat, bei ihrer Mutter bleiben zu dürfen. Irgendwie war es dem Anwalt gelungen, die Richterin zu bekommen, die er haben wollte. Hatte eidesstattliche Erklärungen von Freunden und Kollegen gesammelt, die aussagten, wie nah Maddy und Audrey sich standen. Ich hatte keine Ahnung, wie Scott Hutchings, ihr Anwalt, so viele Leute dazu gebracht hatte, für sie zu lügen, aber es war ihm gelungen. So etwas tat er ständig. Er war mein Erzfeind, und ich hasste alles, wofür er stand.
Denn bei ihm ging es im Grunde immer nur darum, dass gewinnen alles war – ganz gleich, was man tun musste, um einen Sieg zu erringen.
Ganz gleich, wessen Leben man dafür versaute.
Das Knarren der sich öffnenden Bürotür riss mich aus meinen Grübeleien. Rene kam mit einem Tablett in Händen herein. Er stellte es auf den niedrigen Tisch vor mir.
»Ich habe dir Kaffee und ein Sandwich gebracht. Iss, grüble noch eine Weile und dann schüttel es ab. Du hast alles getan, was du konntest, Halton. Ich weiß es. Du weißt es. Dein Mandant weiß es. Zumindest hast du mehr Besuchszeit herausgeschlagen, als die Gegenseite angeboten hat, und strengere Regeln vereinbart, was die gemeinsame Erziehung betrifft.«
Ich seufzte und nahm den dampfenden Becher in Empfang, den er mir hinhielt. »Ich weiß. Eric glaubt, dass sie in alte Gewohnheiten zurückfallen und feststellen wird, dass Maddy mehr Mühe macht, als sie wert ist. Ich habe ihm geraten, Unterlagen zu sammeln, E-Mails, Textnachrichten, und er soll alle ihre Telefongespräche aufnehmen.«
»Dann wird sie sich ihre eigene Grube graben. Eric wird ein Auge auf sein Kind haben. Er liebt die Kleine zu sehr, um das nicht zu tun.« Er hielt inne. »Und du hast andere Mandanten, die dich brauchen.«
»Ich weiß. Bei einem dieser Prozesse trete ich wieder gegen Hutchings an. Ich hasse diesen Penner. Er ist der Typ, der uns Anwälte in Verruf bringt.«
Rene legte einen Ordner auf den Tisch. »Ich habe Informationen gefunden, die bei diesem Prozess hier hilfreich sein könnten. Der Vater hat seiner Liebe zum Glücksspiel nachgegeben. Sich an den Ersparnissen bedient, die sie für das College ihres Sohnes zurückgelegt hatten.«
Ich stieß einen Pfiff aus. »Er befand sich ohnehin schon auf dünnem Eis – selbst mit Hutchings an seiner Seite.«
Rene kicherte. »Ich weiß. Amy hatte sich dieses Konto nicht einmal angesehen. Mir fiel die Diskrepanz auf, und ich habe sie gebeten, mir die Unterlagen zu besorgen. Ich habe den Kontakt, den Reid Matthews uns vermittelt hat, damit beauftragt, ebenfalls ein wenig nachzubohren.« Er tippte auf den Ordner. »Wyatt hat ein paar interessante Dinge aufgetan.«
»Großartig. Da hat uns Reid einen guten Mann besorgt. Wenn ich schon den Meister selbst nicht haben kann, ist einer seiner Schüler ein wirklich guter Ersatz.«
Rene lachte. Ich hatte Reid einige Male auf spezielle Fälle angesetzt. Das brillante IT-Genie der Firma BAM meines Freundes Bentley war von unverzichtbarem Wert gewesen.
Und Bentley gegenüber absolut loyal, ganz gleich, wie viel ich ihm bot, damit er zu meiner Kanzlei wechselte. Schließlich hatte Reid einen Freund empfohlen, der fast so gut war wie er selbst. Wenn es darum ging, Informationen auszugraben, die ich für meine Fälle nutzen konnte, war er super. Und das Material, das ich nicht nutzen konnte, half zumindest, mich in legaleres Fahrwasser zu lenken. Seine einzige Bedingung war, dass er von zu Hause aus arbeiten konnte – er hasste alles, was nach weißem Establishment und der Geschäftswelt roch.
Wenn man von der großen Honorarpauschale absah, die ich ihm zahlte. Die nahm er mit Freuden entgegen, und seine Ehrlichkeit rang mir Respekt ab. Er hatte mich noch nie im Stich gelassen, und ich war froh, dass mir seine Dienste zur Verfügung standen.
Vor allem wenn ich gegen einen so schmutzigen Gegner wie Scott Hutchings antrat.
Ich seufzte wieder und rieb mir die Augen.
»Schläfst du denn überhaupt nicht?«, fragte Rene.
Ich wedelte mit der Hand, weil ich mit ihm nicht darüber reden wollte. »Keine Sorge, es geht mir gut.«
Er wartete und bedachte mich mit einem strengen Blick.
»Na schön«, räumte ich ein, »die Schlafstörungen sind in letzter Zeit schlimmer geworden.«
»Du musst damit wirklich mal zu irgendeinem Arzt gehen, Halton.«
Ich schüttelte den Kopf. »Nichts hat funktioniert. Noch nie. Zwei Stunden unruhigen Schlafs scheinen alles zu sein, was ich in den meisten Nächten bekommen kann. Wenn überhaupt.«
»Es sieht nicht so aus, als würdest du auch nur diese zwei Stunden schlafen.«
Er hatte recht, aber das würde ich ihm nicht auf die Nase binden. Nickerchen von fünfzehn oder zwanzig Minuten ab und an waren alles, was mir in diesen Tagen vergönnt war. Ich war vollkommen erschöpft.
Er öffnete den Mund, um noch etwas zu sagen, aber ich hob die Hand. »Ich werde es wieder mit den Tabletten versuchen, wenn ich diesen Teufelskreis nicht bald durchbrechen kann.«
Er presste die Lippen aufeinander, sagte aber nichts. Rene wusste, wie sehr ich es hasste, Medikamente zu nehmen, und schlimmer noch, wie ich mich bei den Nebenwirkungen fühlte. Aber ich war allmählich verzweifelt genug, um mit der Trägheit zu leben, die mit der Einnahme einherging. Vielleicht besser als die Erschöpfung, aber noch konnte ich mich nicht dazu durchringen.
Er schob das Tablett näher zu mir heran, hielt auf dem Weg zur Tür aber noch einmal inne. »Du musst besser auf dich achtgeben.«
Auf die Schnelle fiel mir keine Erwiderung ein, die ich ihm nachrufen konnte. Er hatte wahrscheinlich recht, aber mir war schleierhaft, wie ich das anstellen sollte.
Ich griff nach dem Sandwich, biss hinein und dachte über das nach, was er über den Prozess gesagt hatte. Er hatte recht. Ich hatte alles für Eric getan, was in meiner Macht stand. Ich konnte nur hoffen, dass er wirklich wusste, wie seine Frau tickte, und dass seine Prophezeiungen in kurzer Zeit eintreten würden, Maddy wieder zu ihm zurückkehren würde, und zwar auf einer dauerhafteren Grundlage. Ich würde wieder vor Gericht ziehen und um die Rechtsdokumente kämpfen, die daraus etwas für immer machen würden.
Ich klappte den Aktenordner auf, den Rene mir gereicht hatte, entschlossen, dass mein Mandant diesmal gewinnen würde. Niederlagen trafen mich immer hart, denn ich nahm sie persönlich.
Und das galt für jeden Prozess.
Ich rieb mir die müden Augen und schaute auf die Uhr. Es überraschte mich nicht, dass es schon nach neun war. Draußen hatte sich die Dunkelheit herabgesenkt, und das einzige Licht in meinem Büro kam von der Leselampe hinter mir. Mein linierter Notizblock war gefüllt mit meinem »Gekrakel«, wie Rene meine Handschrift nannte. Wyatt hatte bei dem zukünftigen Exmann meiner Mandantin eine Menge übler Dinge ausgegraben. Einiges davon würde helfen, seine Version der Geschichte zu widerlegen. Jedem Richter müssten Zweifel kommen, bevor er ihm mehr als ein Umgangsrecht unter Aufsicht zusprach.
Ich erhob mich, holte eine Wasserflasche aus dem Kühlschrank und trank daraus, während ich nachdenklich aus dem Fenster schaute.
Ich nahm nur Fälle an, an die ich glaubte. Ich setzte mich für Ehegatten in Bedrängnis ein, für Kinder, die zu klein waren, um sich selbst Gehör zu verschaffen, Teenager, denen vom staatlichen System übel mitgespielt wurde. Ich bohrte nach und suchte, bis ich mir sicher war, dass meine Mandanten mir gegenüber ehrlich waren. Und ich weigerte mich, jemanden zu vertreten, bei dem ich das Gefühl hatte, dass er nicht die Wahrheit sagte. Wenn mich jemand belog, war die Sache gelaufen. Ich trennte mich von dem Fall. Mit der Wahrheit konnte ich umgehen und arbeiten, konnte herausfinden, wie ich es anstellen musste, dass sie möglichst wenig Schaden anrichtete, falls es schlimm kam. Eine Lüge beendete alles. Ich hatte früh im Leben gelernt, wie Lügen einen Menschen zerstören konnten.
Eine zweite Chance gab es bei mir nicht – niemals.
Als mein Magen knurrte, deutete ich das als Zeichen, endlich zu gehen. Ich griff mir meinen Mantel und ließ mein Büro so, wie es war. Niemand würde es ohne meine Erlaubnis betreten. Nicht einmal die Putzkraft. Sie kam nur, wenn Rene da war, der ein Auge auf sie haben konnte. Was das anging, war ich eigen, ich hatte nicht gern Leute im Büro, wenn sonst niemand da war. Das war eine meiner Marotten.
Eine von vielen, wie Rene sagen würde.
Ich eilte über die Straße, spürte den kalten Wind schmerzhaft auf der Haut. Die Temperatur war gefallen, und es hatte zu regnen begonnen. Herbstregen – von der Art, die die Kleider durchnässte und einem an die Substanz ging, ganz gleich, was man anhatte. Schaudernd trat ich in die Bar gleich um die Ecke. Ich zog den Mantel aus und schüttelte ihn, dann ging ich hinüber zu meiner Lieblingsnische. Die Bar war erstaunlich leer für einen Freitagabend, und dafür war ich dankbar. Ich bestellte ein kleines Guinness vom Fass und einen ihrer selbst gemachten Hamburger. Ich brauchte das Fleisch und die Kohlehydrate. Außer dem Sandwich hatte ich noch nichts gegessen, und das war auch schon Stunden her.
Ich ließ mich auf der abgenutzten Bank nieder, deren Polsterung bereits ganz dünn war und in deren verschrammtem Holz Initialen, Daten und Herzen von längst verflossenen Liebschaften hineingeschnitten worden waren. Dann scrollte ich durch mein Telefon und wechselte das Profil zu meinem privaten. Es waren einige Werbe-E-Mails dabei, die ich gleich löschte. Zwei persönliche Nachrichten von Freunden, die wegen eines Abendessens beziehungsweise eines Konzerts anfragten, die ich rasch auf ein andermal vertröstete, und zu guter Letzt eine Mail von meiner Mutter.
Ich hielt inne, und mein Daumen schwebte über der Betreffzeile, weil ich mir unsicher war, ob ich die Nachricht jetzt oder später öffnen oder sofort löschen sollte, ohne sie gelesen zu haben. Ich war in die Bar gekommen, um runterzukommen und mich zu entspannen. Eine E-Mail von meiner Mutter würde wahrscheinlich das Gegenteil bewirken.
Ich legte das Telefon weg, griff nach dem Guinness und trank einen tiefen Schluck. Mein Blick schweifte umher und fing den einer Frau auf, die an der Theke saß. Sie musterte mich und sah mir geradewegs in die Augen.
Helles silbergraues Haar, das ihr in Wellen über die Schulter fiel, umrahmte ihr hübsches Gesicht. Auf ihrer Nasenspitze saß eine Brille, die ihr etwas Schelmisches verlieh. Da sie die Theke nur wenig überragte, schien sie eher klein zu sein. Sie trug einen blauen Mantel, den sie sich um die Schulter gelegt hatte, als versuche sie, die Kälte abzuwehren. Vor ihr stand ein Guinness – genau wie vor mir. Sie hob es zu einem stummen Prost, und mit einem Grinsen hob auch ich mein Glas und griff dann wieder nach meinem Telefon. Ich hatte kein Interesse an einer älteren Frau – nicht einmal an einer höchst attraktiven. Schnell schaute ich wieder auf – sie kam mir bekannt vor, aber ich konnte sie nicht einordnen. Mein Hamburger wurde gebracht, und ich löschte die Nachricht meiner Mutter, ohne sie gelesen zu haben, dann verbannte ich die Gedanken an die hübsche Frau an der Theke aus meinem Kopf. Ich hatte Hunger.
Ich wechselte das Profil und checkte das geschäftliche, in dem Wissen, dass alles Wichtige bereits von Rene erledigt worden war. Also tat ich es eher, um nachzuschauen, was über den Tag so passiert war, und um festzustellen, ob etwas Neues gekommen war, das ich mir ansehen musste.
Ich scrollte, während ich aß. Der mächtige Hamburger strotzte nur so vor Käse und Speck, und er stillte meinen Hunger. Ich verputzte auch den Salat und die Pommes frites, dann schob ich den Teller weg und bestellte mir noch ein kleines Bier. Während ich wartete, ging ich die letzten meiner Nachrichten durch.
Ein Guinness erschien vor mir, und ich schaute auf, um Danke zu sagen. Meine Augen weiteten sich beim Anblick der Frau, die mir an der Theke aufgefallen war und die jetzt an meinem Tisch stand. Sie ließ das Glas nicht los, das sie vor mich hingestellt hatte.
»Ist Alkohol die beste Methode, um Ihre Aufmerksamkeit zu erregen?«, fragte sie.
Ihre Stimme war leise und melodiös. Sehr angenehm.
Ich schüttelte den Kopf. »Meine Aufmerksamkeit ist im Moment auf die Arbeit gerichtet, tut mir leid.«
Sie ließ sich auf der Bank mir gegenüber nieder. »Wunderbar. Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen würden.«
Ich lehnte mich zurück, musterte sie und stellte leicht schockiert fest, dass es sich bei ihr gar nicht um eine ältere Frau handelte. Trotz des silbergrauen Haares war ihr Gesicht jugendlich. Sie war jünger als ich mit meinen sechsunddreißig Jahren – eher um die dreißig, schätzte ich. Sie hatte einen elfenbeinfarbenen Teint, und ihre Wangen waren leicht gerötet – ob vom Alkohol oder aus Verlegenheit, konnte ich nicht sagen. Ohne ihre Brille waren ihre Augen von einem satten Grün – strahlend und klar. Sie war nicht groß – kleiner als der Durchschnitt, schätzte ich, da ich nicht gesehen hatte, wie hoch ihre Absätze waren. Sie sah zerbrechlich aus – beinahe zu dünn, meiner Meinung nach. Doch irgendetwas an ihrem Blick und dem Schwung ihres Mundes deutete auf Intelligenz hin, auf Witz und Stärke unter der Oberfläche.
Ich seufzte. »Hören Sie, Süße, ich fühle mich geschmeichelt, aber ich bin im Moment nicht auf dem Markt.« Ich rieb mir den Nacken. »Es war eine lange Woche, und ich bin nur hergekommen, um in Ruhe ein Bier zu trinken und einen Happen zu essen.«
Ihre Wangen wurden röter, aber sie weigerte sich, klein beizugeben. »Meine Güte, was für ein Ego Sie haben. Werden Sie von allen Frauen, die Sie sehen, angemacht?«
Ich zuckte die Achseln. »Von den meisten.«
Sie lachte leise und zog sich den Mantel fester um die Schultern. »Ich bin nicht hier, um Sie anzumachen, Mr Smithers.«
Ich zog herausfordernd eine Augenbraue hoch. »Sie sind mir gegenüber im Vorteil. Sie wissen, wer ich bin, aber ich kenne Sie nicht.«
Sie streckte die Hand aus. Sie war klein und ließ sich von meiner viel größeren leicht umfassen. »Fiona.«
»Freut mich, Sie kennenzulernen, Fiona. Darf ich ehrlich sein?«
Ihre Miene wurde ernst. »Ich bevorzuge Ehrlichkeit, Mr Smithers.«
»Da Sie mir versichern, dass Sie nicht hier sind, um mich anzumachen, weiß ich zwar nicht, was Sie wollen oder brauchen, aber heute Abend ist nicht der Abend, um mich danach zu fragen.« Ich schob ihr meine Karte über den Tisch. »Wenn Sie auf eine Spende für irgendeine Wohltätigkeitsorganisation aus sind, finden Sie einen Link auf meiner Website, von wo aus Sie weitergeleitet werden. Wenn Sie Reporterin sind, ich rede nicht über meine Fälle. Wenn Sie ein juristisches Problem haben, schlage ich vor, Sie rufen in meiner Kanzlei unter der Nummer auf der Karte an, und ich werde mich so bald wie möglich bei Ihnen melden. Offen gesagt wird es eine Weile dauern, weil ich zurzeit mehr als genug Fälle habe. Sagen Sie meinem Mitarbeiter, worum es geht, und er wird es weitergeben, dann kann ich Ihnen jemanden empfehlen.«
»Ich bin nicht auf Geld oder ein Interview aus. Ich brauche einen Anwalt. Ich will niemanden sonst. Ich will – ich brauche – Ihre Hilfe.«
Ärger flammte in mir auf. Ich war müde. Die Woche war hart gewesen, und ich hatte ein langes Wochenende mit noch mehr Arbeit vor mir. Ich wurde zugeschüttet mit Fällen. Und hatte deshalb vor ein paar Wochen beschlossen, keine neuen anzunehmen, es sei denn, es handelte sich um einen echten Notfall. Rene und ich hatten über alle potenziellen Mandanten gesprochen, und dann hatten wir sie, so es möglich war, zu guten, anständigen Anwälten weitergeschickt, denen ich vertraute. Ich erinnerte mich nicht daran, dass er eine Frau namens Fiona erwähnt hatte, daher bezweifelte ich, dass sie überhaupt versucht hatte, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Sie hatte sich einfach für die Abkürzung entschieden, und das machte mich ziemlich sauer.
Ich stand auf, warf ein paar Scheine auf den Tisch und ließ das unberührte Bier stehen. »Wie ich schon sagte, setzen Sie sich mit meinem Mitarbeiter in Verbindung.«
Mit langen Schritten verließ ich die Bar, ohne mir die Mühe zu machen, noch einmal zurückzuschauen. Ich überquerte die Straße, nachdem ich beschlossen hatte, es für heute Abend gut sein zu lassen und nach Hause zu gehen. Über die Rampe zum Parkplatz hinunter ging ich zu meinem Wagen und murmelte leise etwas über aufdringliche Frauen vor mich hin, als ich ein Geräusch hörte.
Jemand rannte hinter mir her.
Ich drehte mich um. Fiona lief quer über den Parkplatz auf mich zu. Heftig atmend blieb sie vor mir stehen. Sie war klein – mindestens dreißig Zentimeter kleiner als ich mit meinen eins sechsundachtzig. Das regennasse Haar klebte ihr am Kopf, und sie hielt sich den Mantel zu.
»Bitte«, keuchte sie. »Ich wollte Sie nicht verstimmen, Mr Smithers. Ich wusste nur einfach nicht, was ich sonst tun sollte. Ich habe den ganzen Abend vor Ihrer Kanzlei darauf gewartet, dass Sie herauskommen.«
Ich fuhr mir mit einer Hand durchs Haar, und ihre echte Bekümmerung ließ meinen Ärger verfliegen. Aus der Nähe betrachtet konnte ich die Erschöpfung auf ihrem Gesicht sehen. Spuren von schlaflosen Nächten und Sorgen, mir selbst nur zu vertraut, hatten sich ihr in die Haut gegraben.
»Rufen Sie am Montag in meiner Kanzlei an, Fiona«, sagte ich mit ruhiger Stimme. »Teilen Sie Rene mit, ich hätte gesagt, dass er Sie irgendwie dazwischenschieben soll.« Ich konnte ihr ja wenigstens zuhören.
Sie schüttelte den Kopf. »Das habe ich schon versucht. An diesem Pitbull komme ich einfach nicht vorbei.«
Ihre Beschreibung Renes war zutreffend, aber ich runzelte die Stirn. Nicht Rene traf bei uns die Entscheidungen. Das lag in meiner Verantwortung.
»Tut mir leid, das verstehe ich nicht. Sie haben angerufen?«
»Ja. Ich bin auch in der Kanzlei gewesen. Er hat mir erklärt, Ihr Terminplan sei voll und Sie hätten keine Zeit, mit mir zu sprechen.«
Etwas in ihrer Stimme ließ mich aufmerken. Wieder verspürte ich dieses Gefühl von Vertrautheit.
»Sind wir uns schon mal irgendwo begegnet?«, fragte ich.
»Ein einziges Mal«, antwortete sie. »Es war nicht gerade, äh, angenehm.«
»Ach?«
»Es war mit meinem Mann. Dem Mann, der sich jetzt von mir scheiden lässt. Gegen den ich kämpfen will, und dafür brauche ich Ihre Hilfe.«
Eine Erinnerung tauchte aus den Tiefen meines Gehirns auf. Ein Dinner vor einigen Jahren. Ein Raum voller Anwälte.
Insbesondere einer war mir im Gedächtnis geblieben.
Ich kniff die Augen zusammen. »Wie heißt denn Ihr Mann?«
Ein leichtes Schaudern durchfuhr sie. »Scott Hutchings.«
4
Halton
Nachdem sie diese Bombe hatte platzen lassen, standen wir da auf dem Parkplatz und schauten uns an.
Jetzt wusste ich, warum sie mir so bekannt vorkam.
»Netter Versuch, Mrs Hutchings. Was immer Sie und Ihr Mann für ein Spiel spielen – ich bin nicht interessiert.«
Ich wandte mich zum Gehen, aber sie hielt mich am Arm fest. »Bitte, Mr Smithers! Ich spiele kein Spiel.«
Ich wirbelte herum und schüttelte ihre Hand ab. Sie hielt meinem zornigen Blick stand, und ich glaubte Aufrichtigkeit in ihren Augen erkennen zu können.
»Scott verlangt die Scheidung. Er hat unsere Ehe beendet, Mr Smithers. Bitte, helfen Sie mir.«
»Warum ich? Es gibt so viele andere Anwälte in der Stadt. Nehmen Sie sich doch einen von denen.«
»Nein, ich will Sie.«
»Warum?«
»Weil Sie Scott fast so sehr hassen wie ich, und ich weiß, dass Sie es gut machen würden.«
Ihre Feststellung verblüffte mich. »Hass ist ein starkes Gefühl.«
»Es ist das Gefühl, das ich empfinde … endlich.«
Ich musterte sie. »Ich werde Ihre Geschichte prüfen.«
Sie hob das Kinn. »Im Gegensatz zu Scott habe ich nichts zu verbergen.« Ein langer Schauder durchlief sie, und ich erinnerte mich an ihre Worte von vorhin.
Ich habe den ganzen Abend vor Ihrer Kanzlei darauf gewartet, dass Sie herauskommen.
Es war den ganzen Abend über stetig kälter geworden, und schon vor Stunden hatte es angefangen zu regnen. Das Gebäude wurde um sechs abgeschlossen.
»Wo haben Sie eigentlich auf mich gewartet?«, erkundigte ich mich neugierig.
»In dem Hauseingang auf der anderen Straßenseite, damit ich sehen konnte, ob Sie herauskommen. Oder ob Ihr Wagen herausfährt.«
»Hatten Sie vor, sich vor meinen Wagen zu werfen?«
»Wenn nötig, ja.« Ein weiterer Schauder schüttelte sie.
Ich schaute mich auf dem fast leeren Parkplatz um. »Wo haben Sie geparkt?«
Sie schüttelte den Kopf. »Ich habe kein Auto. Ich habe den Bus genommen.«
Ich traf eine Entscheidung und legte eine Hand unter ihren Ellbogen. »Kommen Sie mit.«
»Wohin gehen wir?«
»Ich werde Sie nach Hause fahren.«
»Aber mein Fall …«
Ich unterbrach sie mit einem Kopfschütteln. »Mrs Hutchings, ich gehe meiner Arbeit nicht am späten Freitagabend auf einem Parkplatz nach, während eine potenzielle Mandantin sich zu Tode friert. Ich werde Sie nach Hause fahren, und Sie können am Montag in mein Büro kommen, und dort reden wir.«
Die automatische Wagenentriegelung der Fernbedienung in meiner Tasche klickte, und ich öffnete die Beifahrertür und bedeutete ihr einzusteigen. Sobald sie drinnen war, schloss ich die Tür und ging auf die Fahrerseite. Mir schwirrte der Kopf.
Ich hatte nichts davon gehört, dass es in der Ehe der Hutchings kriselte. Nicht eine Silbe. Bis ich die Bestätigung hatte, würde ich der Sache mit Vorsicht begegnen. Aber ich ließ keine Frau gestrandet und frierend einfach stehen, selbst wenn sie die Gattin eines Mannes war, den ich nicht leiden konnte.
Ich erinnerte mich an das Dinner, bei dem ich Fiona Hutchings begegnet war. Scott war auch dort gewesen und hatte zu viel getrunken und zu laut geredet, so wie er es auch im Gerichtssaal tat. Er liebte es, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Er war ein Angeber und Lügner, und es hatte mich Mühe gekostet, ihm nicht zu sagen, dass er den Mund halten solle.
Wir hatten Plätze am selben Tisch bekommen, und am Ende saß ich ihm gegenüber, kaum in der Lage, die Tatsache zu ertragen, dass ich seiner Gesellschaft ausgesetzt war. Irgendwie landete Fiona neben mir, und zuerst hatte ich nicht gewusst, dass sie seine Frau war. Sie hatte sich nur mit dem Vornamen vorgestellt, und wir unterhielten uns kurz. Sie war elegant und hatte Klasse, und ihr Haar – damals noch blond – war im Nacken zu einem Knoten frisiert, ihr Kleid schlicht. Ich erinnerte mich daran, sie während unserer kurzen Unterhaltung charmant und geistreich gefunden zu haben. Obwohl sie nicht mein Typ war, fand ich sie zudem sehr attraktiv. Dann hatte ich den schmalen Ehering an ihrem Finger gesehen und mich gezügelt – ich ließ mich nicht mit verheirateten Frauen ein. Das war noch eine meiner Regeln. Egal, ob ich sie in einer Bar, bei einem dieser Dinners oder ganz besonders als Mandantin kennenlernte – wenn die Frau verheiratet war, hieß das für mich: Hände weg.
Im nächsten Moment dröhnte Scotts Stimme über den Tisch, so tief, dass es fast wie ein Knurren klang. »Fiona! Brichst du jetzt schon das Brot mit dem Feind?«
Sie war errötet, und ich hatte begriffen, mit wem sie verheiratet war, und versucht, nicht zu schaudern. So viel zum Thema erster Eindruck.
Ein anderer Anwalt am Tisch hatte leise gelacht. »Na, na, Scott, das hier ist ein geselliger Anlass. Außerhalb des Gerichtssaals können wir uns doch alle verstehen, oder?«
Scotts Gesichtsausdruck hatte alles gesagt, obwohl er mit den anderen mitlachte, aber er hatte darauf bestanden, dass sie mit jemandem den Platz tauschte. Er hatte ein großes Gewese daraus gemacht, ihr den Arm um die Schulter zu legen und sie zu küssen. Ich war mir damals sicher gewesen, dass sie den Kopf leicht abwandte, damit der Kuss auf ihre Wange traf und nicht auf ihren Mund. Den Rest des Abends hatte ich Scott geflissentlich ignoriert, obwohl ich mich dabei ertappte, dass mein Blick gelegentlich auf Fiona ruhte.
Sie war kaum mit irgendjemand anderem ins Gespräch gekommen und hatte unsicher und ängstlich gewirkt, als fühle sie sich fehl am Platz. Gelegentlich war ein gequälter Ausdruck über ihre Züge gehuscht, und ich hatte mich gefragt, ob Scotts Benehmen ihr peinlich war. Ich erinnerte mich, gedacht zu haben, dass sie an seiner Seite deplatziert wirkte – beinahe zu sanft, um mit ihm in Verbindung gebracht zu werden. Damals hatte ich mich gefragt, wie sie es ertragen konnte, mit jemandem zusammenzuleben, der so skrupellos war – es sei denn, sie war aus demselben Holz geschnitzt. Ich wusste nur allzu gut, dass der Schein trügen konnte. Sie mochte süß rüberkommen, aber soweit ich wusste, konnte sie genauso gut ein kaltherziges Miststück sein und die Fassade der Sanftheit zu ihrem Vorteil nutzen. Witz und Charme verdeckten viele Sünden.
Doch die Frau, die mich kurz zuvor angefleht hatte – die Frau, die stundenlang in der Kälte gestanden hatte, weil sie unbedingt mit mir reden wollte, machte nicht den Eindruck eines kaltherzigen Miststücks. Etwas in den Tiefen ihrer gepeinigten grünen Augen und dem flehenden Ton ihrer Stimme sagte mir, dass sie aufrichtig war.
Ich stieg in den Wagen und ließ den Motor an, dann stellte ich auf ihrer Seite die Heizung höher.
»Gleich wird es warm«, versicherte ich ihr.
»Vielen Dank.«
»Wo wohnen Sie?«
»Wenn Sie mich an der U-Bahn absetzen würden, reicht das völlig.«
Ich seufzte und schnallte mich an. »Es regnet jetzt noch heftiger. Ich werde Sie nach Hause fahren. Nennen Sie mir die Adresse.«
»Mississauga, Mr Smithers. Das ist eine lange Fahrt für Sie. Wenn Sie mich an der U-Bahn absetzen würden, wäre das wunderbar. Mein, äh, Zimmer befindet sich nur einige Häuserblocks von der Endhaltestelle entfernt.«
»Zimmer?«, fragte ich verwirrt. Warum wohnte sie in einem Zimmer? Und warum draußen in Mississauga?
Hutchings lebte, wenn ich mich recht erinnerte, in einem noblen Viertel von Toronto.
»Ich bin dorthin gezogen, nachdem Scott …«, sie schluckte, »nachdem es mit uns auseinandergegangen ist.« Sie sah mich nicht an, sondern blickte aus dem Fenster. »Ich wohne bei einer Freundin.«
»Hatten Sie Kontakt zu ihm?«
Sie drehte den Kopf, der Schmerz in ihren Augen unverkennbar. »Nein. Er reagiert nicht auf meine Anrufe, außer um mir zu sagen, dass er meinen Handyvertrag kündigen und nicht länger dafür bezahlen werde. Er hat mich rausgeworfen, Mr Smithers. Hat unsere Ehe beendet, mir etwas Geld gegeben und mich in ein Hotel gefahren. Er hat mir kaum Zeit gelassen, eine Tasche zu packen – es war, als könne er es nicht länger ertragen, in meiner Nähe zu sein. Dann hat er mir noch die Hausschlüssel abgenommen. Ich stand unter Schock, und ich konnte sonst nirgendwohin, daher bin ich Joanne dankbar, dass ich bei ihr unterkommen kann.«
Für einen Moment waren im Wagen nur das Brummen des Motors und das leise Summen der Lüftung zu hören, während ich ihre Worte verdaute. Was immer geschehen war, was immer sich zugetragen hatte, wenn sie die Wahrheit sagte, hatte sich Scott Hutchings seiner Frau gegenüber wie ein absoluter Mistkerl verhalten. Es wunderte mich nicht im Mindesten, das zu erfahren, aber ich wollte die ganze Geschichte hören.
Meine Finger umfassten das Lenkrad fester. »Hal«, sagte ich zu ihr.
»Wie bitte?«
»Ich ziehe es vor, wenn meine Mandanten mich Hal nennen. Nicht Mr Smithers.«
»Bin ich jetzt Ihre Mandantin?«
»Kommen Sie am Montag zu mir, und dann entscheiden wir darüber.«
Am Montagmorgen war ich bereits im Büro, als Rene eintraf. Heute war er ganz in Schwarz gekleidet, aber seine Weste war ein Feuerwerk von Farben, wie explodierende Sterne in der Nacht. Eine Fliege machte das Outfit komplett. Sein kahler Schädel glänzte.