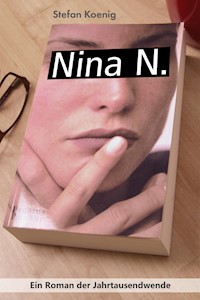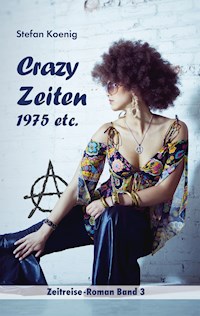Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Zeitreise-Roman
- Sprache: Deutsch
"Bunte Zeiten – 1980 etc." ist der vierte Band der spannenden musikalischen und gesellschaftlichen Zeitreise-Serie. Die Romane erzählen in spannender Weise vom Anfang der Friedens- und Hippiebewegung, erreichen nach Indien und Nepal (im 3. Band) jetzt im 4. Band San Francisco, die Hippies auf Hawaii, die mexikanische Mafia und Jamaica, die Reggae-Insel. Die durchgängige Geschichte und ihr Spannungsbogen erzählt vom Auf und Ab der Jugendhoffnungen, von Konzerten und Utopien, von Krisen, von gesellschaftlichen Ereignissen, die den Alltag prägten. Und dies in unterhaltsamem Stil. Eine Abenteuer-Reise durch die reifende Bundesrepublik, durch den fernen Osten und durch den bunten Wilden Westen. Für alle, die diese Zeit nicht aus eigenem Erleben kennen. Und für die, die die Zeit erlebten und sie "wiederauferstehen" lassen wollen: die Musik, die Hippie-, Punk- und politischen Festivals, die gesellschaftliche Atmosphäre, das Liebes- und Zusammenleben der Alten und Jungen – romantisch, revolutionär, visionär. Es waren Aufbruchzeiten. Zeiten mit Utopien. Aber die Zeiten änderten sich. Auch davon erzählen die bisher erschienen vier Zeitreise-Romane. Sie finden ihre Fortsetzung bis in die heutigen Tage – und immer steht im Mittelpunkt die jeweilige Jugendbewegung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 512
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stefan Koenig
Bunte Zeiten - 1980 etc.
Zeitreise-Roman
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Impressum
Vorbemerkung
1979 – San Francisco – People in motion
Sauna-Kuschelkurs
Nina & Helle & der Bahnhof Zoo
Frisco-Freaks & das Hippie-Berkeley
Traurige Mütter, frische Lehrer & Lutz, der Seefahrer
Jugendtreffs & Dope & falsche Liebe
Grand Canyon Walk, der Helikopter Absturz & Death Valley
Der schwitzende Weihnachtsmann von Haweii & die Hippie-Kommune
1980 – Post aus der Heimat & Neues von Nina
Auf nach Mexiko & Uschis Interview
Schussgeil in Berlin & Schüsse in Mexiko
Mayas, Freibeuter & die Muschi von Uschi
Saumagen, Schlampsäcke, Räuber & geheime Aktionen
Fußball-EM, Verschwörung in Dallas, Old Shatterhand & Jamaica
Ein Apfel wird Computer & ein Koffer verschwindet
1981- Neue Deutsche Welle & Frequenz ist Trumpf
Italienischer Sumpf & Reggae-Love & Mord in Seckbach
Synthesizer & The Rocky Horror Picture Show
Auf nach Bonn & No Pershing II & best Bull‘ Ralle
Parteisäuberungen, die tödliche Doris & Geier Sturzflug
1982 – Sylt, Flick, der Amazonas Dschungel & Fitzcarraldo
Romy Schneider & Judiths Tod & Kinskys Bierglaswurf
Gangster, Schlümpfe & ein Unfall
Coalitus interruptus & die Schere im Kopf
Das weiche Wasser bricht den Stein & Uschi & Bockhorn
1983 – Neue Männer braucht das Land
Neue Freunde & neue Musik & Ninas letzte Chance
99 Luftballons & Computerstaat? Nein danke!
Neuer Job, alte Götter, Sesamstraße & der Denver-Clan
Kackbraune Tagebücher & der Tod junger Freunde
Lieber Gott, lass die Sonne wieder scheinen
Silvester mit Rudi Carrell & Bockhorn nähert sich dem Ende
1984 Tod in Baja, George Orwell & die Scheinwelten des Erfolgs
Saure Ausreden & Saurer Regen
Mehrscheiner, Grüne & das Damenkränzchen
Hundescheiße, Scheißaufrüstung, Freiheitsrechte & Taxifahrer
Geburt, Glück, Ottifanten & der selige Staatsschutz
Dank & Nachbetrachtung
Impressum neobooks
Impressum
Stefan Koenig
Bunte Zeiten
1980 etc.
Zeitreise-Roman
Band 4
Aus dem Deutschen
ins Deutsche übersetzt
von Jürgen Bodelle
If you're going to San FranciscoBe sure to wear some flowers in your hairIf you're going to San FranciscoYou're gonna meet some gentle people there
For those who come to San FranciscoSummertime will be a love-in thereIn the streets of San FranciscoGentle people with flowers in their hair
All across the nationSuch a strange vibrationPeople in motionThere's a whole generationWith a new explanationPeople in motion
© 2019 by Stefan Koenig
Für den Inhalt verantwortlich: Stefan Koenig
Verlag Pegasus Bücher
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Mail-Kontakt
zu Verlag und Autor:
Postadresse:
Pegasus Bücher
Postfach 1111
D-35321 Laubach
Vorbemerkung
Bunte Zeiten – ja, bunt waren die Zeiten durchweg, aber die Achtziger schienen mir bunter zu sein, als die Zeiten davor und danach. Aber, liebe Leser, das ist und bleibt Ansichtssache. Vieles, worüber in meiner Zeitreise-Serie berichtet wird, entspringt meiner ganz individuellen Betrachtung. Es wäre vermessen, meine Reiseberichte durch die verschiedenartigen Zeitabschnitte als „objektive Berichterstattung“ auszugeben. Nein, das wäre unredlich, denn jeder von uns empfindet anders, ordnet seine Erlebnisse ganz individuell ein. Dennoch gibt es über das individuelle Empfinden weit hinausgehende Gefühle und herausragende Ereignisse, die von großen Mehrheiten gemeinsam als die „wahre Erinnerung“ empfunden werden. Auch das ist normal. Denn sonst wäre der Begriff vom „Zeitgeist“ völlig überflüssig. Es gibt ihn freilich, den Zeitgeist – und ich versuche, ihn jeweils so treffend wie möglich in unser aller Erinnerung zu rufen.
Eine Frage, die gelegentlich aufkam, möchte ich noch einmal wie bereits im ersten Band der Zeitreise-Serie »Sexy Zeiten – 1968 etc.« beantworten: Personen der Zeitgeschichte habe ich mit ihrem Klarnamen benannt. In anderen Fällen wurden die Namen verfremdet. Und in diesem Zusammenhang noch eine Bitte: Lassen Sie sich nicht von den vielen Namen, über das Ihr Gehirn im Laufe des Romans stolpert, verwirren. Ihr Gehirn ist klüger als Sie denken. Anders als Sie, ist es in der Lage, sich auch noch im nächsten und übernächsten Zeitreise-Band an eine Episode zu erinnern, der Sie beim ersten Lesen keinerlei Bedeutung beigemessen haben.
Nehmen wir einmal an, ich würde hier in diesem Band ganz kurz von einem Günni, der zum Felix wird und der ein Faible für Gedichte und für das Romanschreiben hat, berichten. Werden Sie dann bitte nicht nervös und denken Sie nicht, Sie hätten etwas versäumt. Lehnen Sie sich entspannt zurück und vertrauen Sie Ihrem Gehirn, es wird sich zur gegebenen Zeit an ihn und seine Vorliebe erinnern. Und dann – in der Story, Jahre später – werden Sie verstehen, warum diese Person in diesem oder jenem Abschnitt meiner über fünfzig jährigen Geschichte, die ich erzähle, vorkommt.
Jeden einzelnen Band meiner Zeitreise-Serie habe ich versucht so zu konstruieren, dass man ihn für sich genommen lesen kann. Warum? Weil ich bei den vorherigen Bänden auf die Meinung nicht weniger Zeitreise-Interessenten gestoßen bin, die sagten: „Ach, die Sechziger! Ach, die Siebziger – sehr schön, aber das war nicht meine Zeit. Ich bin ein Kind der Achtziger Jahre.“
„Ach“, antworte ich dann, „Sie lesen also auch nur Krimis, wo Sie beim Mord und der Aufklärung persönlich dabei waren?“ Viele verstehen diese Anspielung, lachen und geben mir Recht: „Ja, die Zeit davor könnte mich schon interessieren.“
Einige aber verstehen meine Anspielung nicht, selbst wenn ich sie bis zum Grund des San Andreas Graben vertiefte. Immerhin ist der 30 bis 45 Kilometer tief. Sie wollen auf Teufel komm‘ raus nur über „ihre“ Zeit lesen. Am liebsten wäre es ihnen, sie kämen persönlich darin vor. Aber das kann ich dann doch nicht bieten.
In diesem Sommer, im Juni 2019, besuchte ich zwei Hippie-Festivals. Das erste war das World Music Festival der Klangfreunde in Loshausen. Dort verteilte ich am ersten Tag meine Werbeflyer für die Bücher. Am zweiten Tag schlug ich meinen Stand auf und eine junge Frau, Mitte Zwanzig, kam zu mir.
„Hast du auch ein Buch, das meiner Altersgruppe am nächsten kommt?“, fragte sie mich.
„Das Buch, das du dir wünschst, erscheint erst im Juli 2021. Es heißt »Zeitlose Zeiten – 2000 etc.«. Kannst du denn so lange warten?“
Sie lachte. „Natürlich nicht. Aber selbst »Crazy Zeiten«, dieser Mittsiebziger-Band, ist ja noch so schrecklich weit von mir entfernt.“
Jetzt war ich am Lachen. „Das Erstaunliche ist: Je älter du wirst, desto mehr schmelzen die Zeitspannen zusammen – und in spätestens zwei Jahrzehnten wirst du merken, dass die Siebziger Jahre nicht himmelweit weg sind.“ Sie schaute mich sehr kritisch an, und da wurde mir bewusst, dass für sie natürlich auch die vor ihr liegenden, von mir gerade erwähnten zwanzig Jahre eine Ewigkeit bedeuteten.
Jedenfalls kaufte sie die »Crazy Zeiten«.
Drei Tage später, am letzten Festivaltag, kam sie an den Stand gerannt. „Hast du noch den zweiten Band, »Wilde Zeiten«? Jetzt interessiert mich doch, was davor geschah und wie alles war.“
Sie nahm ihn mit. Vier Tage später begann das Burg Herzberg-Festival, wo ich wieder meinen Stand hatte. Diese vielen lieben Hippie-Leutchen, Althippies, Neohippies, Möchtegernhippies und Liebhaber der alten wie neuen Hippie-Songs und viele andere zogen an mir vorüber. 12.000 Besucher zählte das Festival. Viele blieben stehen und nahmen die Flyer mit, ohne dass ich diese – wie auf der letzten Buchmesse in Frankfurt – wie Sauerbier anbieten und nur in mürrische Gesichter schauen musste.
Da erblickte mich die Mittzwanzigerin aus Loshausen und kam strahlend an den Stand.
„Und jetzt hätte ich gerne den ersten Band »Sexy Zeiten«. Es ist ja so spannend. Und das Lesen auf der Zeitschiene klappt auch in umgekehrter Rückwärtsfolge.“
Na, das war ja beruhigend. „Kannst du auch etwas an Geschichtswissen aus meinen Büchern mitnehmen?“, fragte ich.
„Und ob! Ganz viel Interessantes, was ich noch gar nicht oder nur ganz anders wusste.“
Ja, so ist es. Die Jugend muss die Geschichte kennen.
Und wir müssen die Geschichte erzählen.
Wer, wenn nicht wir?
I.
Denk‘ nicht nur an dich allein
Denk‘ nicht nur an deine Familie
Denk‘ an alle
Denk‘ an die ganze große Menschheitsfamilie
Du gehörst zu ihr
II.
Glück ist,
wenn der Verstand tanzt,
das Herz atmet
und die Augen lieben
Für Aurelia, Viviane und Desiree
1979 – San Francisco – People in motion
Das grauenhafte Grollen draußen vor meinem Zimmerfenster ließ mich ans Fenster stürzen. Normalerweise hatte ich von hier aus einen herrlichen Ausblick auf San Franciscos Polk Street. Ich schaute bei untergehender Sonne gerne nach draußen. Ich liebte das dumpfe Hupen der Schiffe, bevor sie im Hafen anlegten oder nachdem sie abgelegt hatten und sich auf den Weg durch den Pazifik machten. Ich stellte mir dann diese modernen Frachtschiffe als alte Dampfer vor, wie sie zu Zeiten der europäischen Okkupation dieses herrlichen Kontinents über die Ozeane kreuzten. Ob auch die Ureinwohner diese Signale liebten? Eher nicht, für sie kündigten sich damit unabwägbare Gefahren an.
Mir war bewusst, dass es damals keineswegs mit friedlichen Mitteln zugegangen war. Es war keine Idylle sondern knallharte Eroberungs- und Besatzungsrealität gewesen. Dennoch schlummerte in mir jene gewisse Wildwest-Romantik, die mir so anschaulich Karl May mit seinen Indianergeschichten mit Winnetou, Sam Hawkens und Old Shatterhand ins emotionale Gedächtnis eingebrannt hatte.
Auch Mark Twain hatte mit Tom Sawyers Abenteuern und Streichen seinen Anteil an jener Romantik – diese gemütlichen, hupenden Schaufelrad-Dampfer, dieser unbändige Mississippi, diese überwältigende Natur, dieses ewige Fernweh und jene großen Fahrten zwischen Europa, Afrika und der Neuen Welt. Import von Menschen und Gütern; Sklavenhandel, Ranches, Cowboys, Forts und der Kampf zwischen den „Weißen“ und den „Rothäuten“, zwischen den Süd- und den Nordstaaten – wahrlich keine Idylle, eigentlich kein Platz für Romantik, eigentlich … aber dieses dumpf hupende Ankunfts- und Abschiedsritual der Überseeschiffe faszinierte mich dennoch jedes Mal aufs Neue.
Einen kurzen Augenblick lang verfing sich mein Gefühl in diesem aus der Kurzzeiterinnerung hervorgekramten Schiffsgedröhne; wahrscheinlich sortierte mein Hirn die Signale, doch da war kein aufwendiger Sortieraufwand nötig. Dieses Dröhnen da draußen hatte nichts mit den Schiffsignalen gemein. Mein emotionaler Gedankenbrei wurde abrupt unterbrochen, als sich das unheimliche Geräusch jäh zu einem schrecklichen Donnergrollen steigerte.
Ich zögerte einen Moment, ob ich bei diesem Orkan das Fenster öffnen sollte. Dann riss ich es auf – und spürte keinen einzigen Windhauch. Ein Orkan? Weit gefehlt. Ein unheimlicher Stillstand schien trotz des wütenden Geräusches zu herrschen. Unbegreiflich! Ich bekam eine Gänsehaut. Weit und breit bewegte sich nichts – außer mir.
Alles drehte sich plötzlich um mich herum. Mir wurde schlecht. Ich erlebte etwas völlig Neues, Unbekanntes: einen Schwindelanfall. Ich schloss schnell das Fenster, torkelte ein paar Schritte zurück ins Zimmer, lehnte mich erschrocken mit dem Rücken an die Wand, um nicht hinzufallen. Und dann sah ich es: Das von mir gestern an einem Stück Kordel aufgehängte Bild der Berliner Malerin Monika Sieveking „Kohlekumpels im Streikrevier“ pendelte an der gegenüberliegenden Wand hin und her. Selbst die Wanduhr hinter dem Fernseher schien sich zu bewegen. Erst dachte ich, es läge an meiner Schwindelattacke, aber dann schaute ich noch einmal zum Kohlekumpel-Bild. Kein Zweifel, es pendelte tatsächlich von links nach rechts. Jetzt plötzlich hörte ich von überall her Schreie. All das passierte in Sekunden, aber mir kam es vor, als seien es lange, bange Minuten.
„Open the door!”, hörte ich im Treppenhaus meinen Nachbarn brüllen. Meinte er mich? Ich war wie benommen.
„Open it and get down under the doorway!“, schrie
Sam. “It’s an earthquake!”
Ein Erdbeben! Hätte ich es nicht ahnen können? Hatte ich doch erst kürzlich in Vorbereitung meines achtzehnmonatigen Frisco-Aufenthaltes einiges über den San-Andreas-Graben und über die im wahrsten Sinne des Wortes „bewegte Geschichte“ San Franciscos gelesen. Es war eigentlich klar, dass es wieder geschehen würde. Dennoch hatte ich die Gefahr völlig verdrängt. So wie ganz Frisco mit einer fast unbegreiflichen Sorglosigkeit und einem erstaunlichen Mangel an Wirklichkeitssinn das Urteil, das die Natur über die Stadt verhängt hatte, ignorierte.
Was blieb mir auch anderes übrig, als mich dieser gängigen Ignoranz zu ergeben, wenn ich nicht als Angsthase mein gesamtes, mühsam erarbeitetes Forschungs-, Doktoranden-, Erlebnis- und Karriereprojekt an die Wand klatschen wollte! Natürlich hatte ich lange vor meiner Abreise in dahindämmernden Minuten vor dem Einschlafen gelegentlich an diese Gefahr gedacht. Doch ich hatte sie mit wunderbaren neuartigen Zukunftsphantasien aus dem Bett geworfen.
Dann träumte ich lieber von meiner zügigen Arbeit an meinem Forschungsprojekt, das letztlich der Steuerzahler trug, weshalb ich mich zu guten Ergebnissen verpflichtet fühlte. Ich stritt innerlich mir selbst gegenüber entschieden ab, dass dies alles eine Stufe auf der Karriereleiter sei, denn als Karrierist wollte ich vor mir selbst keinesfalls gelten. Nein, ich war nur ein kleiner Doktorand, der versuchte, im Land seines Erzfeindes ein realistisches Bild von dessen Innerem zu gewinnen.
Meine „Gefahren-Verdrängungs-Träume“ entführten mich durch das gesamte Umfeld von Frisco, führten an den mammutgroßen Red Woods vorbei nach Sausalito in die Golden Gate National Recreation Area, entlang der kalifornischen Weinanbaugebiete, entführten mich an die berühmte Hippie-Uni von Berkeley, anschließend in den Süden ins Silicon Valley und zur Stanford University, weiter nach Santa Cruz bis Monterey, um schließlich in Los Angeles anzukommen. Dort würde ich Anne treffen, meine liebenswerte Bekannte aus alten Gammler- und Provo-Zeiten vom Frankfurter Marshallbrunnen. Sie musste jetzt auch schon Mitte Zwanzig sein. Wenn ich mich recht erinnerte, war sie 1968 vier Jahre jünger als ich, also vierzehn Jahre alt, gewesen. Sie konnte wunderschön zur Gitarre singen. Noch vor Weihnachten dieses Jahres würde ich sie in L.A. besuchen. Davon und von Amy träumte ich.
Denn Amy, meine frühere Intimfreundin, die ich erst vor kurzem zufällig vor der Haustür meiner Wohnung in der Washington Street getroffen hatte, war ebenfalls mit Anne eng befreundet gewesen. Anne und ich hatten uns damals ewig lange gefragt, wohin Amy wohl verschwunden sei, und was die Umstände ihres abschiedslosen Verschwindens gewesen sein mochten. Jetzt aber befanden wir Drei uns in California – yippie yeah!
Diesen Traum träumte ich mehrere Male. Dann wachte ich auf und freute mich über die Neuerkundungsmöglichkeiten und das Wiedersehen.
Als ich mir eines Tages dieser Träumerei noch beim Aufwachen bewusst wurde, dachte ich wieder einmal an unsere frührevolutionäre Devise: »Trau keinem über Dreißig«. Und noch eines dieser früheren Vorhaben trotzte mir ein müdes Morgenlächeln ab: Keiner von uns pubertierenden Jungrevolutionären, die wir damals nur der „schonungslosen Wahrheit“ verpflichtet waren, wollte jemals dieses Alter erreichen. Dreißig – pfui Deibel! Eher würden wir im Guerillakampf neben Che Guevara sterben wollen. So alt werden! Nein. Ausgeschlossen!
Nun stand ich also ein Jahr vor diesem teuflischen Alter und empfand nichts Ungewöhnliches dabei, diese Altersgrenze bald zu erreichen. Erwachsenwerden ging also automatisch. Das hatten wir uns damals, 1968 am Marshallbrunnen, ganz anders vorgestellt, als uns all die Spießer wegen unserer Beatles-Haare anpöbelten. Als uns die LKW-Fahrer einen Groschen aus dem Autofenster zuwarfen und meinten, wir sollten mal auf einen Frisör sparen. Wollten wir auf diese erbärmliche Art erwachsen werden, in Frisiersalons sozialisiert werden? Nein, niemals! Erwachsene schienen uns größtenteils aus völlig abgehalfterten, abgestumpften, unzufriedenen, ewig grollenden Untertanen zu bestehen.
Jetzt, rund um mein neues Zuhause in Friscos Washington Street, grollte es auf andere, viel bedrohlichere Art und Weise. Plötzlich fing alles zu zittern und zu holpern an.
Ich kam zu mir.
Neben dem Donnergrollen hörte ich hektisches Klopfen an meiner Wohnungstür. Ich öffnete und stand meinen Nachbarn Sam, Vicky und Mary-Kay gegenüber. Mary packte mich am Arm.
„Stay here!“, brüllte sie gegen das Grollen an. Sie blieb mit mir unter dem Türrahmen stehen, während Sam und Vicky unter dem gegenüberliegenden Türrahmen ihrer Wohnung Schutz suchten. Meine Güte, wie konnte ich das vergessen haben: Bei einem Erdbeben musst du unter baulichen Verstrebungen Schutz suchen, wenn du nicht rechtzeitig hinaus ins weite Freie gelangen kannst.
Im nächsten Moment rumpelte es noch einmal gewaltig, und dann trat eine unheimliche Stille ein. Mary sah mich erleichtert an, dann küsste sie mich unversehens auf den Mund und griff mir zwischen die Beine, um mal kurz zuzudrücken. Puh!Eine verrückte Nudel, dachte ich. Das Erdbeben war hoffentlich vorüber, doch welches persönliche Beben stand mir nun bevor?
Wir warteten zehn urig lange Minuten. Danach liefen wir auf die Straße, wo schon andere Anwohner ängstlich und aufgeregt durcheinanderquasselten. Einige hatten Kofferradios dabei. Zwei Stunden später kam die Entwarnung. Wir inspizierten unsere Wohnungen, in denen sich zum Glück keinerlei Risse zeigten. Der einundzwanzigjährige Sam, seine ein Jahr ältere platonische Geliebte Vicky und die zweiundzwanzig Jahre alte Mary betätigten nun alle Wohnungs- und Schranktüren. Ich schloss mich ihnen an, um festzustellen, ob sich etwas verzogen hatte. Aber alles war noch voll funktionsfähig. Unser Haus war großenteils aus Holz gebaut, was zwar dem Brandschutz nicht zur Ehre gereichte, dafür jedoch einem Erdbeben besser als jeder Betonbau standhielt.
Wir waren zunächst noch unsicher, ob die Lage stabil blieb. Sie blieb es; es gab kein Nachbeben.
Wie wir am folgenden Tag erfuhren, gab es einige Risse in den Nachbarhäusern. Später erfuhren wir außerdem aus den News, dass eine Seite der Autobahnzubringerbrücke zum wichtigen Highway 80 eingestürzt war. Der Highway führte zur San Francisco-Oakland Bay Bridge, was für mich von Bedeutung war, da mich mein erster Arbeitsbesuch zu Professor Elliot Cahn an der dortigen Berkeley University führen sollte. Den Termin verschob ich am nächsten Tag telefonisch um einen Monat.
Das Bild der dramatisch halb herabhängenden Brücke wurde noch zwei Wochen lang in wiederkehrenden News gezeigt. Eingeblendet wurde immer wieder die jeweils aktuelle Aufbauarbeit an der beschädigten Brücke. Das Beben hatte eine Stärke von 6,8 auf der Richterskala gehabt, wie der Nachrichtensprecher in so lockerer Weise erläuterte, als sei alles eine Lappalie gewesen. Er erklärte dann, was es mit der Richterskala auf sich habe. Dass sie dazu diene, Aussagen über die Stärke von Erdbeben zu treffen und vom US-amerikanischen Seismologen Charles Francis Richter entwickelt und in den 1930er Jahren eingeführt worden war. Ein Beben von der Stärke 6,0 bis 7,0 sei als „stark“ einzustufen, denn es könne zu Zerstörungen in besiedelten Gebieten führen.
Dann zeigte man in dem Sendebeitrag eine Tabelle mit höheren Werten. Bei Stärken zwischen 7,0 und 8,0 bezeichne man demnach ein Beben als „groß“, denn es könne schwere Schäden über weite Gebiete verursachen. Eine Stärke von 8,0 bis 9,0 sei dagegen „sehr groß“, weil es starke Zerstörungen in Bereichen von einigen hundert Kilometern verursachen könne. Als „sehr groß“ zähle auch ein Beben in den Stärken zwischen 9,0 und 10,0 – denn hier wirkten Zerstörungen in Bereichen von tausend Kilometern verheerend. Ein Beben mit einer größeren Stärke als 10,0 sei noch nie gemessen worden. Man würde diese Stärke als „massiv“ bezeichnen.
Das mussten wir nicht erleben. Wie durch ein Wunder war bei „unserem“ Beben niemand getötet oder lebensgefährlich verletzt worden. Das Epizentrum befand sich glücklicherweise 74 Meilen südlich-östlich von San Francisco mitten auf dünn besiedeltem Land in der Nähe der Mercey Hot Springs. Hätte es nur 60 bis 120 Kilometer weiter nordwestlich gelegen, wäre es zu Friscos Super-Gau und zu meiner ganz persönlichen Katastrophe gekommen.
Die Forschung ging von einem großen Beben aus, das für Frisco unausweichlich sei. In den folgenden Tagen drehten sich die Fragen daher auf allen regionalen Fernseh- und Radiosendern darum, ob und wie man das erwartete, das unausweichliche »Große Beben« voraussagen könne. Mutmaßungen machten die Runde: Wächst die Spannung im Gestein unter San Francisco im Stillen? Oder wird sich das nächste Jahrhundertbeben durch anschwellendes Rumpeln ankündigen?
Meine Nachbarn erzählten mir, dass schon im April 1979 Forscher zum 73. Jahrestag des Bebens von 1906 versucht hatten, die Kalifornier aufzurütteln. Denn, so meinte Mary, es stehe fest, dass der nächste »Big One« kommen werde. Die Geschäftigkeit und betonte Lässigkeit der Kalifornier deutete meine nachbarliche »Sack-Grapscherin« als Anzeichen einer kollektiven Psychose.
„Verdrängung einer bevorstehenden Katastrophe“, lautete die Diagnose auch von Sam und Vicky.
Sam wusste mehr zu berichten. „San Francisco begeht den Jahrestag jenes Erdbebens, das am 18. April 1906 die Stadt zerstörte, jedes Mal in geheuchelter Demut“, fand er. Zwar würden bei unzähligen Veranstaltungen Bilder der Katastrophe präsentiert. Man führe den Einwohnern vor Augen, was ihr Schicksal wäre, wenn die Katastrophe sich wiederhole. „Vorsorge muss dringend getroffen werden, heißt es dann – aber geschehen tut nichts“, sagte er.
Ich hatte von dem historischen Beben gelesen und erinnerte mich. In der Morgendämmerung des 18. April 1906 um kurz nach 5 Uhr riss Kalifornien auf halber Länge auf. Die Erdkruste brach entlang einer von Norden nach Süden verlaufenden Nahtzone auf einer Länge von 1.280 Kilometern. Der Bruch war örtlich 500 Meter breit. Konservativen Schätzungen zufolge starben 3.000 bis 4.000 Menschen, Hunderttausende wurden obdachlos. San Francisco wurde fast völlig zerstört. Niemand hatte mit dieser Katastrophe gerechnet.
„Jetzt wissen wir wieder einmal, auf welchem Pulverfass wir sitzen!“, rief Mary aus und holte mich in die Gegenwart zurück. „Und deshalb müssen wir unser Leben genießen! Let’s get together for sauna this evening. Du kommst doch hoffentlich mit?“
Ich war überrumpelt, und bevor ich näher darüber nachdenken konnte, ob ich das unter den gegebenen Umständen wollte oder nicht, nickte ich.
Mary strahlte. „Sure?“
„Sure!“, entfuhr es mir. Hätte ich nur geahnt, worauf ich mich einlasse!
Es war bereits Ende August. Einen Monat zuvor, am 29. Juli, am Tag, als der große Philosoph – der Lieblingsphilosoph der frühen APO-Studenten – Herbert Marcuse, starb, waren meine Freundin Siu und ich in unsere „neue Heimat auf Zeit“ aufgebrochen. „Heimat auf Zeit“ hatte mein Vater Otto bei unserem Abflug Frisco genannt.
Siu und ich waren nun schon ein halbes Jahr zusammen, und wir verstanden uns prächtig. Nach unserer Ankunft in Californias schönster Stadt hatten wir gemeinsam Anschaffungen und nötige Erledigungen gemacht und in meiner neuen Wohnung einiges eingerichtet. Dann hieß es für Siu, ihre Uni aufzusuchen und ihr eigenes Studentenzimmer an der Stanford-University zu beziehen.
Wir hatten uns erst vor zwei Wochen in ihrem supermodern eingerichteten Zimmer auf dem Stanford-Campus innig geliebt und uns mit sehnsüchtigen Küsschen voneinander verabschiedet. Stanford war nicht weit von meinem Wohnsitz in San Francisco entfernt. Wir würden uns an den Wochenenden immer besuchen; manchmal vielleicht sogar unter der Woche. In den Semesterferien würden wir gemeinsame Fahrten machen. Ins Death Valley, nach Las Vegas, in den Yosemite-Nationalpark. Wir hatten viel vor – neben unserer Studien- und Forschungsarbeit.
Wir beide waren gemeinsam mit großen Hoffnungen nach Frisco aufgebrochen. Ich hatte für Siu alle Hebel bei der Naumann-Stiftung in Bewegung gesetzt, damit wir zeitgleich hier aufschlagen konnten. Was die Sponsoren von der FDP-nahen Stiftung nicht wussten, war, dass wir inzwischen ein Pärchen waren und natürlich hier in Übersee neben unseren Arbeits- und Studienaufträgen eine schöne gemeinsame Zeit verbringen wollten.
Nun hatte ich tagelang nichts mehr von Siu gehört, obwohl wir uns versprochen hatten, jeden übernächsten Tag anzurufen. Sie war nicht ans Telefon gegangen, egal zu welcher Uhrzeit ich anrief. Gerade heute, nach dem Beben, wurde ich unruhig. In dem Moment, als ich jetzt bei ihr anrufen wollte, klingelte das Telefon. Es war Siu.
„Hi Stefan“, sagte sie. „habt ihr das Beben gut überstanden?“
„Ich bin so beruhigt, deine Stimme zu hören“, antwortete ich. „Dir geht es also auch gut? Wir alle hier sind ohne Kratzer davon gekommen.“
„Ja. Schön.“ Pause.
„Geht es dir gut? Ich habe dich so oft angerufen, dich aber nicht erreicht. Ist etwas mit deinem Anschluss nicht in Ordnung?“
Stille am anderen Ende.
„Hallo, Siu?“
„Doch, alles in Ordnung. Ich habe viel zu tun. Das ist hier ziemlich hart. Bin voll im Studium und noch im Eingewöhnungsmodus.“
„Kommst du mit den Kommilitonen klar?“
Pause.
„Siu?“
„Ja, ja, alle sehr nett hier.“ Ich hörte sie kichern.
„Das freut mich. Ich liebe dich.“
„Oh ja. Ich habe wirklich viel zu tun. Kann ich dich demnächst wieder anrufen? Heute haben wir eine Campus-Party für alle Neulinge. Da möchte ich nicht fehlen. Verstehst du?“
„Na klar. Dann viel Spaß. Wann höre ich wieder von dir?“
„Hier ist volles Programm. Ich weiß noch nicht.“
„Heute Abend gehe ich mit unseren Nachbarn in die Sauna. Soll ein tolles Örtchen sein, oben auf der Dachterrasse eines Hochhauses. Wenn es schön ist, gehen wir demnächst zusammen hin, okay?“
„Weiß nicht. Aber lass es dir gut gehen. Tschüss!“
„Tschüss und Kussi!“
Wortlose Stille.
„Ja. Bis dann.“
Sauna-Kuschelkurs
Auf dem fünfminütigen Weg zum Hochhaus drückte sich Mary eng an mich und steckte mir ihre Hand in die Po-Tasche meiner Jeans. „We are friends, aren’t we?“
„Yes, we are very best neighbours“, antwortete ich. Ich war mir unsicher, was für eine Meinung meine drei best neighbours von American friendship hatten. Was bedeutete ihnen Freundschaft, was Liebe? Ich war und blieb in Siu verliebt – und diese Liebe war nicht teilbar. Aber mit Marys Nachbarschaftsfreundschaft – und damit natürlich auch mit der daran hängenden Freundschaft von Sam und Vicky – wollte ich es mir nicht verderben.
Am Hochhaus angekommen, war das Gebäude nicht ganz so groß, wie ich erwartet hatte; unten waren Stores angesiedelt. Ab dem ersten bis zum achten Stockwerk bestand es aus Wohneinheiten. Im letzten, dem neunten Stock, befand sich das individuelle Partyobjekt meiner punkigen Nachbarn, wie mir Mary vorab verraten hatte – ein großes Schwimmbecken mit 25-Meter-Bahnen, einem Whirlpool und zwei Saunen mit einmal 170 Grad Fahrenheit, was etwa 80 Grad Celsius entsprach, und einmal mit 60 Grad Celsius. Vor dem Haupteingang warteten auf uns bereits drei Punk-Pärchen und Sams dreiundzwanzigjähriger Freund James.
„Has anyone noticed you?“, fragte Sam seinen Liebhaber.
„Nobody saw us!“
„It has to stay that way now. Be quiet in the hall and in the elevator.”
Wir sollten im Flur und im Aufzug ruhig sein, meinte Sam. Mir war klar, dass die Jungs sich hier nicht ganz offiziell für ihre Privatparty kostenfrei „eingemietet“ hatten. Sam holte einen Schlüssel aus seinem Portemonnaie hervor und schloss auf.
„Woher habt ihr den Schlüssel?“, fragte ich.
„Wir haben einen Studienfreund am Kunstinstitut. Er ist hier nebenberuflich als Caretaker tätig, um sein Studium zu finanzieren.“
Es gab sehr viele Worte, Begriffe und Idioms, die ich noch nicht kannte. Sam erklärte mir im Aufzug flüsternd, dass »Caretaker« das Wort für Hausmeister sei.
„Ist es einer der Jungs, die hier mit ihrem girlfriend dabei sind?“
„My goodness, was denkst du! Wenn er erwischt würde, würde er gefeuert und sein Studium wäre unbezahlbar!”
„Und wenn ihr erwischt werdet?“
„Dann nennen wir den Namen eines Verwaltungsmanagers, den uns unser Freund genannt hat, und behaupten, dass er es erlaubt und uns den Schlüssel geliehen hätte.“
„Und wenn ihr genau an diesen Mann geratet, wenn ihr erwischt werdet?“
„Dann haben wir noch einen zweiten Namen. Aber wenn das so kommt, dann wäre es hier mit den geilen Partys leider vorbei.“
„Und die Bewohner? Gehen die nicht schwimmen und in die Sauna?“
„Das kommt ganz selten vor, meistens nur samstags oder sonntags. Wir feiern am liebsten unter der Woche. Bisher, also in den letzten acht Monaten, haben wir nur zwei Mal jemanden getroffen, und die haben sich dann gleich verzogen, weil wir ihnen zu viel waren. Die denken dann, dass wir Gäste eines Mieters seien und fragen auch nicht nach, sondern ziehen sich dezent zurück. Alles völlig easy. Du kannst dich entspannen. Timid German!“
Okay, dann schätzte er mich also als schüchtern ein. War mir völlig egal, insbesondere, weil ich an diesem Abend das Wort „timid“ noch nicht auf meinem Vokabular-Radar hatte. Aber schüchtern war ich tatsächlich, als wir endlich im Pool planschten, allesamt splitternackt. Die drei Pärchen knutschten im Wasser und schäkerten überlaut. Sam und James vergnügten sich offensichtlich mit Unterwasser-Sex. Nur Vicky und Mary-Kay liebkosten sich verhalten im plätschernden Nass und sahen hin und wieder zu mir, der ich lonely meine Runden schwamm und an Siu dachte.
Ich sah, wie Vicky zu den beiden gays auf die andere Poolseite hinüberschwamm und sich an ihren Vergnügungen beteiligte. „Diese Jugend! Diese amerikanische Großstadtjugend!“, dachte ich und fühlte mich mit einem Mal so schrecklich erwachsen. Dann dämmerte es mir – denn hieß »erwachsen« nicht »Mangel an Offenheit für die Unbefangenheit der jungen Jahre«? Plötzlich spürte ich eine zarte Flosse auf meinem Schenkel. Es war Mary. „Join me in the sauna.“
Wir stiegen aus dem Wasser und ich folgte ihr brav und bedenkenlos in die 60-Grad-Sauna. Kaum waren wir alleine, fiel sie mir um den Hals und knutschte mich von oben bis unten ab. Sie war fast unten, hatte mit ihrer Zunge meinen Bauchnabel gerade hinter sich gelassen, als ich wieder an Siu denken musste. In meinem verwirrten Zustand haute ich in Erinnerung eines Beatle-Songs einen verrückten Satz raus: „Let it be!“ – was in meinem spontanen Lübke-Englisch eigentlich „Lass es sein!“ heißen sollte. Tatsächlich aber bedeutete es eher »Toleriere es« oder »Nimm es hin« oder wie im besagten Song: »Nimm es dir nicht so zu Herzen«.
Sie sah kurz zu mir auf, erster Augenaufschlag, verführerisches Lächeln, zweiter Augenaufschlag, dann kniete sie sich neben mir hin, reckte mir ihren Po entgegen, spreizte ihre Beine, feuchtete ihre Hand mit der Zunge an, steckte sie zwischen ihre Beine und forderte mich auf: „Come on, German. It’s your turn. Do it. I would like it. It’s time for love.“
„I’m very sorry. It’s too hot. You are very hot. The sauna is very hot, but I‘m not able to be hot. My heart belongs to Siu. I hope you are not … you are not … äh …”
“You mean disappointed?”
“Yes, disappointed.” Genau, das war das Wort für »enttäuscht«.
“I’m so disappointed. But I hope you’ll change your mind in the foreseeable future.”
Ich war für’s Erste gerettet. Ihre Enttäuschung hielt sich offenbar in Grenzen. Sie hoffte auf eine »absehbare Zeit«. Aber was meinte Mary mit ihrer Hoffnung auf eine Meinungsänderung? Das war doch eine Sache des Gefühls, eine Sache des Herzens und nicht Sache irgendeiner Meinung. Dachte sie, man könne mehreren Göttinnen dienen? Das erinnerte mich an unsere frühe Jugendphase mit der einhergehenden sexuellen Revolution – damals, in den Jahren zwischen 1967 und 1970, jener angestrebten Freizügigkeit ohne Eifersucht. Es erinnerte an unsere Ideen von freier Liebe, von abwechslungsreichen und doch intensiven Partnerschaften. Was war uns Treue damals wert? Und was war sie mir heute wert? Siu war so präsent. Ich würde sie noch heute Abend anrufen.
Als nächstes, während mir der Saunaschweiß in kleinen einzelnen Bächen durch die Brustbehaarung rann, um sich im Nabel zu vereinigen, dachte ich an Tommis Witzelei, als er uns in der Clausewitz-WG über seine Jura-Prüfung berichtet hatte:
„Beim Examen wird der angehende Jurist gefragt: »Was ist die Höchststrafe für Bigamie?«
Erwidert der Prüfling: »Zwei Schwiegermütter!«
Ja, deshalb also hatte wohl Karl Marx sich nur auf seine einzigartige Jenny konzentriert!“
Wir hatten gelacht, natürlich auf Kosten aller Schwiegermütter, weltweit. Und Tommis Freundin Rosi hatte gemeint: „Schwiegermütter aller Länder, vereinigt euch!“
Tommi, unser guter Ex-Postler und jetzt nur noch Gelegenheits-Postmensch, der mit seinen fortschrittlichen Attitüden die Postgewerkschaft in Westberlin auf Vordermann gebracht hatte, war auf dem Weg zu einem sehr brauchbaren Advokaten.
Er hatte mir versprochen, mich per Briefpost über die politische Entwicklung in good old Germany auf dem Laufenden zu halten. So erreichte mich Ende August die Nachricht, dass sich erstmals die beiden evangelischen Kirchen der BRD und der DDR mit einem »Wort zum Frieden« in einer gemeinsamen Erklärung an die Öffentlichkeit gewandt hatten. „Anlass ist der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs vor 40 Jahren am 1. September 1939“, schrieb Tommi.
(Noch einmal 40 Jahre später las ich in der Biografie über die Kanzlerin »Das erste Leben der Angela M.«, ihr Vater, Horst Kasner, habe am »Wort zum Frieden« an führender Stelle als Vertreter der Christlichen Friedenskonferenz mitgewirkt. Er verstand sich als Christ, der zwischen den christlichen und den sozialistischen Wertvorstellungen keine gravierenden Unterschiede sah.)
An jenem Abend, nachdem ich diesen außergewöhnlich heißen Saunagang hinter mich gebracht hatte, hatte ich das dringende Bedürfnis, mit Siu zu sprechen. Ich rief sie an. Sie nahm sofort das Gespräch an, was ich erleichtert aufnahm, da ich bereits – wie in der Woche zuvor – mit einem ergebnislosen Klingelmarathon gerechnet hatte. Sie hatte sich so verdächtig rar gemacht.
Jetzt aber fiel sie mit der Tür ins Haus.
„Ich glaube, du kannst nicht treu sein. Du bist ein Filou. Hast du eine andere Freundin?“
Einen kurzen Moment war ich baff. Hatte jemand aus dem Saunakreis meine Siu angerufen und eine Falschmeldung platziert? Das konnte nicht sein. Niemand außer mir hatte Sius Telefonnummer.
„Wie kommst du darauf?“, fragte ich entrüstet.
„Du bist ein Filou.“
„Was meinst du damit?“ Ich ahnte, dass sie – aus welchem Grund auch immer – gerade in Eifersucht gefangen war. Sie konnte sich gut in diese Sucht hineinsteigern. Die nichtigsten Anlässe waren ihr recht, um ihr Suchtpotenzial auszutoben. Aber nun wollte ich schon ganz gerne wissen, was der Anlass war.
„Was ich meine? Dass du immer untreu sein wirst“, sagte sie.
Ich war sprachlos.
„Ja“, fuhr sie fort, „du kannst dazu nichts. Du bist halt wie alle Europäer.“ Ihre Stimme klang plötzlich nicht mehr lieblich und weich, und ich hörte kein Kichern und Lächeln heraus. Es klang kalt und abweisend. „Ihr denkt immer nur an andere Frauen. Ich glaube aus uns beiden wird nichts. Es ist besser, wenn wir Schluss machen. Gehe deinen Weg. Tschüss. Mach‘s gut.“
Siu legte auf. Ein Knacken in der Leitung. Das abrupte Ende einer facettenreichen Beziehung.
Ich war derart aufgekratzt, dass mir nichts anderes einfiel, als bei meinen Nachbarn zu klingeln.
Vicky öffnete.
„Did someone of you call Siu this evening or in the last days?”
“I didn’t”, sagte Vicky und ging mir voran in den Wohnraum, wo Mary, Sam und James saßen. Keiner von ihnen hatte jemals mit Siu telefoniert; niemand kannte ihre Telefonnummer. Wie sie mir versicherten, hätte auch niemand hinter meinem Rücken je so gehandelt. Sie wollten wissen, was vorgefallen sei. Ich erzählte den eben in drei schäbigen Telefon-Minuten erlebten Beziehungsschluss.
Vicky schaute zu Mary. Beide schauten zu Sam und als er nickte, brach es aus Vicky heraus. Sie und Mary hatten Siu mit einem braunhäutigen athletischen Schönling Arm in Arm als verliebtes Pärchen in Sausalito, jenseits der Golden Gate Bridge, gesehen, als sie in einem Café saßen und Siu mit ihrem neuen Lover dort vorbeispazierte.
„Are you sure it was Siu?“, fragte ich mit gewissem Entsetzen in der Stimme.
Sie sahen mich ernst an.
„Ganz, ganz sicher“, antwortete Vicky. „Wir sahen sie sogar ein zweites Mal, als beide vor der Tür standen und überlegten, ob sie das Café betreten sollten.“
„Warum habt ihr mir das nicht erzählt?“ Ich ahnte jetzt, weshalb Mary zuvor so draufgängerisch gewesen war.
„Wir dachten, dass du es von ihr erfahren wirst. Wir sprachen auch über die Möglichkeit, dass du es bereits wusstest, uns jedoch nicht vorzeitig darüber informieren wolltest. Your privacy, you know.“
Was jetzt geschah, blieb für mich wochenlang im Nebel. Mary stand auf, nahm mich an der Hand und führte mich in ihr Zimmer, direkt aufs Bett und begann mich zärtlich zu streicheln. Merkwürdigerweise konnte oder wollte ich mich nicht dagegen wehren. Ich nahm nur wahr, dass ich wie ein Automat mit Mary Liebe machte.
Einige Tage später telefonierte ich nach Westberlin, sprach mit meiner Ex-Freundin Doro, der ich mich noch verbunden fühlte. Ich schilderte ihr die für mich tragische Neuigkeit bis hin zur Bettgeschichte mit Mary. Da sagte Doro lapidar: „Dazu gibt’s was Lustiges zu erzählen: Beklagt sich ein Glühwürmchen bei seinem Freund: »Meine Augen werden schlechter.«
»Wieso?«
»Gestern habe ich eine halbe Stunde mit einer Zigarettenkippe geflirtet.«“ Doro lachte. „Nun sag: Trifft das auch auf das Bums-Erlebnis mit Mary zu – werden deine Augen schlechter?“
„So ein Quatsch. Lass uns nicht unser Telefongeld mit solch kruden Blödeleien verplempern.“
Das war natürlich eine völlig unzutreffende Bemerkung. Schließlich telefonierte ich wieder einmal von einer Telefonzelle auf der Polk Street aus. Und zwar völlig umsonst, besser gesagt: auf Kosten von IBM. Den ziemlich simpel-dreisten Trick hatten mir meine Nachbarn verraten. Das Geheimnis sollte ich für mich behalten. Was mir schwer fiel, denn es gab späterhin noch einige sehr hilfsbedürftige und geldknappe Deutsche, bei denen ich nicht umhin kam, den hilfreichen Trick unter dem Siegel der absoluten Verschwiegenheit weiter zu verraten.
„Die Sache ist mir zu ernst“, sagte ich in die Muschel. „Ich leide. Mein erster ernsthafter Liebeskummer, glaube ich.“ Meine Humorgrenze war unter aller Sau. Ich litt wirklich. Dazu kam plötzlich ein Gefühl, das ich bis dahin noch nie empfunden hatte, von dem ich wusste, dass es wohl existierte, das ich mir bisher aber ganz und gar nicht hatte vorstellen können: Heimweh.
Doro entschuldigte sich für den „dummen Witz, mit dem ich dich doch nur zum Schmunzeln bringen wollte.“ Dann analysierte sie in der mir bekannten Art meine psychosozialen Schwächen: Ohne lebendiges und allgegenwärtiges Umfeld würde ich mich allzu schnell als „nichtsnutzig“ empfinden.
„Knapp daneben ist auch vorbei“, sagte ich. „Eigentlich liegst du sogar voll daneben. Nichtsnutzig habe ich mich noch nie gefühlt. Du müsstest aus unserer siebenjährigen Beziehung wissen, dass für mich »Langeweile« ein völlig unbekannter Begriff ist. Ich habe immer eine Aufgabe und sehe auch an jeder Ecke auf mich lauernde Aufgaben. Insofern trifft es nicht zu, dass ich mich jemals als nichtsnutzig empfunden habe. Außer vielleicht … nun ja …“
„Außer heute, wo dir deine Liebe unerwartet weggebrochen ist. Stimmt’s?“
„Nichtsnutzig ist wirklich Quatsch, ich habe ja meine Aufgaben und Forschungspflichten. Es ist eher das ganz Persönliche. Privat fühle ich mich etwas verloren. Und die Sauna- und Bettgeschichte mit Mary geht mir irgendwie unangenehm nach.“
„Die Sache in der Sauna lässt sich aber gut erklären. Ich habe vor kurzem etwas zu menschlichem Verhalten in Ausnahmesituationen gelesen. Über Extremsituationen, wo es um Leben und Tod geht.“
„Was meinst du damit?“
„Ihr hattet das bedrohliche Erdbeben. Da kam dir unter dem Türrahmen Mary mit ihrem unverblümten Griff in die Eier doch schon sehr nahe. Das war das erste Zeichen. Dann lebte die existentielle Bedrohung noch eine Weile in euch weiter, und als ihr die Überlebens-Pool- und Sauna-Party aus Freude darüber, dass euch nichts passiert war, habt steigen lassen, gab es das spontane urwüchsige Bedürfnis nach Fortpflanzung.“
„Bei mir nicht!“, wandte ich ein.
„Bei dir deshalb nicht, weil du dein Überlebens- und Fortpflanzungspotential für Siu aufheben wolltest. Aber bei Mary griff offenbar dieses evolutionär bedingte Ur-Verlangen.“
„Große Worte“, sagte ich.
„Worte der Psychowissenschaften. Bin ich mit meiner Arbeitsgruppe gerade draufgestoßen.“
Doro erzählte mir noch ausgiebig von ihrem ehrenamtlichen studienbegleitenden Praktikum als Sozialpädagogin in der Bahnhof-Zoo-Szene: Viel Elend, große psychische Belastung, viel zu tun, starke Nerven, großer Erfahrungszugewinn, praktische Hilfe gefragt, Staatsversagen und so weiter.
Zum Schluss unseres fast fünfundvierzigminütigen Gesprächs sagte Doro: „Noch einmal zu Marys Sexual-Aktivitäten – sie wusste ja viel früher als du, dass es mit Siu am Ende war. Für sie warst du frei. Oder wegen mir auch Freiwild, egal.“
Als ich zurück nach Hause ging und in die Washington Street abbog, musste ich an IBM und deren Telefonkosten denken. Wenn die pleitegingen, war es zu einem millionstel Teil gewiss meine Schuld.
Um meine Gefühle in den Griff zu kriegen, haute ich in die Schreibmaschinentasten. Ich bombardierte meine Freunde auf dem guten alten Kontinent mit Briefen, in denen mein mehr oder minder verstecktes Heimweh aus allen Zeilenabständen triefte. Ich wollte kein Mitleid; nein, nein, nein, das wollte ich nicht; eigentlich ging es mir doch super – lebte ich nicht wohlversorgt in einem traumhaften Land? Aber Verständnis würde mir jetzt so gut tun, ein wenig Verständnis für meine Abgeschiedenheit in dieser freundlichen Atmosphäre des gelebten easy-going, der allgegenwärtigen Oberflächlichkeit.
Nina & Helle & der Bahnhof Zoo
Ich saß in meinem gemütlichen Wipp-Sessel, den dumpfen Signalhörnern in der Ferne lauschend. Bald schon würde der »kleine« Lutz, der jetzt immerhin schon zweiundzwanzig war, zu einem mehrwöchigen Besuch zu mir kommen. Die Clausewitzer, meine liebenswürdige Ex Doro, ihre Busenfreundin Elke, die ich sehr mochte, und die mich stets mit aktuellen Nachrichten aus Italien versorgte, und ich – wir alle hatten den Jungen 1973 als sechzehnjährigen „Kleinen“ unter unsere WG-Fittiche genommen. Er war bei seiner alleinerziehenden Mutter ausgebüxt. Sie hatte vor einiger Zeit hier in Frisco angerufen und mich gefragt, ob ich ihrem Sohn wegen seiner verrückten Berufswünsche den „Kopf gründlich waschen“ könne.
„Seefahrer, Leichtmatrose – das ist doch nichts für meinen sensiblen Lutz!“
Auf mich würde er doch hören. Ihre Worte seien bisher wirkungslos verpufft.
Ich hatte unbedachter Weise zugesagt.
Während mich das vage Gefühl von Heimweh ruhelos hin und her wippen ließ und ich damit nicht aufhören, musste ich noch einmal an Doro denken. Sie hatte ein soziales Herz, was uns stets verbunden hatte. Sie trat mit all ihren Fähigkeiten und mit ganzem Herzen für diejenigen ein, deren Not ersichtlich war. Sie hatte mir bereits vor meiner Abreise berichtet, wie sie sich um Nina, die blutjunge Freundin von Lutz, kümmerte.
Hintergrund dazu war ihr Sozialpraktikum. Es gab ihr in der Szene eine gewisse Autorität, zumal man dort die blonde, langhaarige und unkonventionelle Doro in ihren modernen knöchelfreien, leicht ausgestellten Jeans als unbürokratisches, hilfsbereites Gutherzchen zu schätzen wusste. Einigen Fixern war Doro zu bürgerlich und modernistisch, und doch war es wohl gerade das, was sie faszinierte: Eine aus dem fortschrittlichen und doch so verhassten Bürgertum scheute sich nicht, sich zu ihnen, den heruntergekommenen Outlaws, zu gesellen und sich ihrer Probleme anzunehmen. Keiner von ihnen wusste von Doros politischer Weltanschauung. Politik interessierte Junkies nicht.
Nina war vor einem Jahr, als sie am Bahnhof Zoo langsam in den Heroin-Sog geraten war, gerade einmal vierzehn Jahre alt gewesen. Jetzt war sie fünfzehn. Lutz kannte seine junge Nachbarin vom gegenüberliegenden Wohnblock und vom städtischen Jugendtreff, wo er ihr fast täglich begegnete. Sie gingen nicht fest miteinander; er war eher ihr Beschützer. Lutz war Ninas sieben Jahre älterer „Außen-Anker in der realen Welt der Kälte“, wie Nina es einmal so klug umschrieben hatte. Bei ihr konnte unser Kleiner der Große sein. Das Gute an dieser Verbindung war, dass Lutz niemals zu Drogen gegriffen hatte und auch nicht in Versuchung gekommen war.
Eigentlich war er das ideale Vorbild für Nina. Er fand, dass es mit der Liebe nicht gut zugehen konnte, wenn man zugedröhnt war. Er stand bedingungslos auf der Seite der Liebe. „Dope und Liebe vertragen sich nicht“, war sein Statement. Aber Ninas Sucht war bereits viel zu ausgeprägt.
Für Nina hatte er Mitleid empfunden und versucht, sie aus dem Sumpf zu befreien. Es war ihm nicht gelungen. Das lag an Ninas intimem Freund, der schon lange vor ihr zur H-Szene, wie man die Heroin-Szene kurz nannte, gehört hatte. Er hieß Helmut und sein Nickname war Helle. Beide verkehrten im Sound, einer Diskothek in der Genthiner Straße im Westberliner Bezirk Tiergarten. Nina war beeindruckt von »Europas modernster Disco« mit diesen einmaligen Laserprojektionen, der Nebelmaschine und dem professionellen Video-Aufzeichnungsgerät – Dinge, die es in keiner anderen Berliner Disco gab, noch nicht einmal im Big Eden, das dem schwerreichen Playboy Rolf Eden gehörte. Im Sound versorgte sich Nina mit Haschisch. Sie war anfangs nicht mehr als eine kleine Hascherin, wenn auch mit dreizehn, vierzehn Jahren viel zu jung.
Doro hatte in zig vertrauensvollen Gesprächen mit Nina herausgefunden, dass sie keines jener armen Mädchen war, die von einem bösen Fixer oder Dealer bewusst angefixt worden war, wie man es immer in der Zeitung las.
„Die meisten Jugendlichen kommen ganz allein zum Heroin, wenn sie so reif dafür sind, wie ich es war“, sagte Nina. Sie war eine durchaus ehrliche Haut und erkannte ihren Tanz auf dem Vulkan, sagte mir Doro später. Sie hatte eine Art Tagebuch über Ninas und Helles Leben in der Dope-Szene und auf dem Babystrich verfasst. Ich konnte es später lesen und war erschüttert.
An jenem Abend als ich in Frisco meine Arbeiten für das Forschungsvorhaben „Privacy and Freedom of Information Act“ vorbereitete, wollte Nina mit Helles Freund Kalle zu dem bei den Teenies »total angesagten« David-Bowie-Konzert in Westberlin gehen. Das war in ihrer Vorstellung das bedeutendste Ereignis ihres Lebens. Darauf wollte sie sich gut vorbereiten. Helle hatte von seinem Vater ausgerechnet an diesem Abend Ausgehverbot erhalten, aber dafür stand Kalle bereit. Er war Helles bester Freund. Kalle war in Ninas Augen ein taffer souveräner Fixer, den nicht nur sie, sondern viele Mädels aus dem Sound wegen seiner coolen Fixer-Mentalität bewunderten.
Während ich also In Frisco über meiner Arbeit brütete, traf sich Nina mit dem spindeldürren Kalle am Hermannplatz, um auf das Konzert zu gehen. „Du bist verdammt dünn“, sagte sie.
„Ich wiege immerhin noch 63 Kilo. Habe mich gerade beim Blutspenden gewogen.“
Kalle verdiente sich einen Teil des Geldes für sein Dope mit Blutspenden, wofür man alle vier Wochen antreten durfte und wofür es sagenhafte vierzig Mark gab. Obwohl ein vierwöchiger Rhythmus medizinisch unverantwortlich war und obwohl Kalle blass wie ein Todgeweihter und seine Venen total zerstochen waren und Fixer ja nicht unbedingt Gelbsuchtfrei waren, nahmen sie ihn immer wieder zum Blutspenden.
Als die beiden in der U-Bahn saßen, fiel Nina ein, dass sie ihr Valium zu Hause vergessen hatte. „So ein Kack, ich wollte es mitnehmen, falls ich beim Konzert durchdrehe.“
Sie hatte allerdings heimlich, ohne dass ihre Mutter es bemerkt hatte, im Bad schon ein paar Valium eingeschmissen. Das sollte für Coolness beim Bowie-Konzert sorgen. Ohne eine weitere Portion Valium in der Tasche fühlte sie sich unsicher.
Kalle wollte sofort kehrt machen und das Valium holen. Nina sah in genau an und schnallte, was Sache war. Seine Hände zitterten. Er kam auf Turkey. Das Wort stammt aus dem Amerikanischen und bedeutet »Truthahn«. Wenn ein Truthahn erregt ist, beginnt er gewaltig zu flattern. Turkey sind die Entzugserscheinungen bei alten Fixern, wenn die Wirkung des Drucks nachlässt, hatte mir Doro erklärt.
„Du bist auf dem Affen!“, sagte Nina. „Aber wir können nicht zurück, sonst kommen wir zu spät zum Konzert.“
„Ohne Dope und ohne Kohle aufs Konzert zu gehen ist Wahnsinn!“ Kalle wurde zusehends nervöser. Er war plötzlich nicht mehr der souveräne, erfahrene Fixer, den Nina noch vor ein paar Stunden bewundert hatte. „Vielleicht ergibt sich ja dort noch was“, fügte Kalle dann hoffnungsvoll hinzu.
Die Stimmung in der Deutschlandhalle muss spitze gewesen sein, wie Nina später Doro berichtete. Räucherstäbchen- und Marihuana-Düfte durchzogen die Sitzreihen. Neben Nina und Kalle saßen auf der einen Seite »echt coole« Berliner und Westdeutsche, die extra wegen Bowie gekommen waren; auf der anderen Seite saßen amerikanische Soldaten, die eine Pfeife rauchten. Nina und Kalle brauchten nur hinzugucken und man gab die Pfeife an sie weiter. Kalle zog wie verrückt an der Pfeife, aber es half nichts – es ging ihm immer schlechter.
Passender Weise sang Bowie gerade seinen Song »It’s too late«. Nina schleuderten die Worte mit einem Mal aus der Wahnsinnsstimmung heraus. Sie musste daran denken, dass der Song genau ihre Situation beschrieb. „Es ist zu spät“ – es drehte sich in ihrem Kopf wie eine Endlosspirale. „Es ist zu spät. Es ist zu spät.“ Jetzt hätte sie ihr Valium gebraucht.
Als das Konzert dem Ende zuging, wankten die beiden etwas vorzeitig aus dem Saal; Kalle war jetzt volle Pulle auf Turkey und Nina am Boden. Sie trafen auf einen Bekannten aus der Szene. Perry meinte, dass man sofort etwas für Kalle tun müsse. Auch er könne noch einen Druck vertragen. Er hatte noch zwei LSD-Trips, die er für zwanzig Mark versilberte. Was jetzt noch für Heroin an Knete fehlte, sollte Nina »schlauchen«. Sie war Meisterin im Schlauchen. Leute um ein paar Groschen anhauen, fiel ihr leicht. Es mussten mindestens noch einmal fünfzehn Eier zusammenkommen. Darunter gab es nichts zu kaufen in der Szene.
Das Schlauchen vor der Deutschlandhalle ging wie geschmiert. Viele Kids hatten gute Kohle mitgebracht, kamen aus gutsituierten Elternhäusern, in denen mit Moos nicht gespart wurde. Nina brachte ihre Sprüche „Kein Geld für die U-Bahnfahrkarte“; „Man hat mir das Portemonnaie geklaut“, „Ich hab‘ meine Tasche verloren“ und so weiter. Die Markstücke klingelten nur so in ihrer Plastiktüte. Der Bekannte kaufte davon Heroin – mehr als genug für zwei Drucks. »H« war damals gerade recht billig, weil dies den Einstieg erleichtern sollte, wie Nina später von einem Junkie und Oberdealer erfahren hatte.
An diesem Tag, an dem ich im Wipp-Sessel vor meinem Fenster in San Francisco saß, hatte Nina ihren Einstieg. Der Gedanke kam ihr wie angeflogen: Jetzt habe ich das Geld schon dafür geschlaucht, jetzt will ich davon auch wenigstens mal was probieren. Mal sehen, ob das Zeug wirklich so glücklich macht, wie die Fixer nach dem Druck aus der Wäsche gucken!
Weiter dachte Nina nicht; ihr war nicht bewusst, dass sie sich in den vergangenen Monaten systematisch fürs Heroin reif gemacht hatte. Erst die heimliche Bewunderung für diese lässigen Fixer und ihre abgeschottete Szene, dann offene Bewunderung. Danach das Eintauchen ihres Freundes Helle in die Fixerszene und ihre Akzeptanz dieser Szene. Nina war sich auch nicht darüber im Klaren, dass sie der Song »It’s too late« in diesem entscheidenden Moment voll geflasht hatte, weil sie sich in einem wahnsinnigen Tief befand.
Alles, was sie dachte, war, dass man sie jetzt nicht allein mit ihrer Scheiße lassen durfte. Apropos Scheiße – daran musste ich denken, als ich Doros Aufzeichnung zu Nina las – das Wort hat es doch tatsächlich geschafft, innerhalb eines Jahrzehnts die Kulturgrenze zu durchbrechen und sich im allgemeinen jugendlichen Sprachgebrauch in der Bundesrepublik dauerhaft einzunisten. Aus amerikanischer Literatur war bekannt, dass »shit«, »fuck« und »asshole« schon lange nicht mehr auf die sprachliche Goldwaage gelegt wurden. Aber, so hatten mir meine Nachbarn erklärt, das war eben stinknormal für das Land der rauen Cowboys und rauen Sitten. Erst kürzlich hatten die Ku-Klux-Klaner in Texas einen Schwarzen aufgehängt. Einfach so. Weil er schwarz war, halt ein Nigger.
Nina also wollte nicht mit ihrem Scheißgefühl alleine gelassen werden. „Wenn schon kein Valium da ist, um mich zu beruhigen, dann will ich jedenfalls endlich das H probieren!“, sagte sie zu Kalle und dem Bekannten.
Kalle rastete aus. „Du spinnst. Das würde mir Helle nie verzeihen, wenn ich das zulasse! Das kommt nicht in Frage. Du lässt das! Du weißt gar nicht, was du dir antust! Wenn du jetzt Dope nimmst, bist du in kurzer Zeit genau da, wo ich jetzt bin. Dann bist du eine lebendige Leiche!“
Erst dachte sie, dass er den Stoff vielleicht alleine für sich haben wollte, aber dann merkte sie, dass er es ernst mit ihr meinte. Die aufkommenden Zweifel wischte sie weg. Aber einem sich aufspielenden Übervater, der so unerfahren war wie Kalle, dem musste man nicht glauben. Wenn das jetzt Helle wäre, okay, dann würde sie vielleicht nachgeben, aber so?
„Ich lass mir von dir nichts befehlen!“, schrie sie ihn an. „Erstens ist das Meiste mein Dope, weil ich die Knete besorgt habe. Außerdem red’ nicht so’ne gequirlte Scheiße. Ich werd’ doch nicht so abhängig wie du! Ich weiß, was ich will. Ich hab’ mich total unter Kontrolle. Ich probier’ das mal, und jetzt Schluss mit dem Gelaber!“
Nina wusste noch nicht, wie schwach man auf Turkey ist; Kalle war jedenfalls mucksmäuschenstill nach Ninas Attacke, knickte vor ihrer Entschiedenheit ein; er war wie eingeschüchtert und zog es vor zu schweigen. Die Drei gingen in einen Hauseingang, und der Bekannte teilte das Dope gerecht in drei Teile.
„Ich war jetzt ganz geil auf das Zeug“, hatte Nina Doro berichtet. Da war kein Nachdenken, kein schlechtes Gewissen, keine Zukunftsangst, keine Angst vor der alleinerziehenden Mutter. Sie wollte einfach schnell wieder gut drauf sein. Nur vor der Spritze hatte sie Angst.
„Ich schniefe das Zeug“, sagte sie den beiden Jungs und zog das Pulver sofort durch die Nase ein. Sie spürte einen beißend bitteren Geschmack und musste den Brechreiz unterdrücken. Sie spuckte eine gute Portion des Dopes wieder aus. Doch dann kam es verdammt schnell über sie. Ihre Glieder wurden unheimlich schwer und waren zugleich so leicht, als könnten sie fliegen.
„Ich bin irrsinnig müde“, sagte sie zu den Jungs.
„Das gibt sich“, sagte Kalle. „Und wie fühlst du dich sonst so?“
„Müde zu sein ist ein geiles Gefühl. Die ganze Scheiße ist mit einem Mal weg. Kein »It is too late« mehr. So toll habe ich mich noch nie gefühlt.“
Die Jungs gingen in das Auto eines Fixers, um sich den Druck zu setzen, während Nina zum Sound vorausging. Es machte ihr nichts mehr aus, allein zu sein. Im Gegenteil, sie fühlte sich wahnsinnig stark. Chrissi, ihre beste Freundin, kam zu ihr, sah sie an und fragte: „Hey, bist du auf H?“
Nina rastete aus. „Dämliche Frage! Was willst du von mir? Hau einfach ab, Mensch! Ich will dich nicht mehr sehen!“
Nina wusste nicht, weshalb sie so ausflippte, und Chrissi stand ratlos vor dieser völlig unerwarteten Reaktion ihrer besten Freundin. Später kamen die Jungs, waren völlig breit und machten einen total coolen Eindruck. Mit keinem Funken dachte Nina an Helle, er war in diesem Moment einfach nicht präsent; sie hatte Durst und holte sich einen Apfelsaft nach dem anderen.
Morgens gegen fünf fragte Perry, wie der Bekannte von Kalle hieß, ob sie nicht noch zu ihm nachhause auf einen Tee wollten. Sie gingen, und Nina hakte sich zwischen den beiden ein. Der viele Apfelsaft machte sich an der frischen Luft bemerkbar, rumorte wild in Ninas Bauch und drängte zum Überlaufen. Sie übergab sich im Gehen auf die Jungs, was die wohl nicht bemerkten, denn sie gingen wie in Trance weiter, während Ninas Kotze an ihnen abtropfte. Nina kümmerte es nicht. Alle Drei waren einfach nur happy.
Überhaupt war da für Nina plötzlich ein völlig neues Gefühl. Ihr kam es vor, als lebe sie in einer neuen kleinen Familie. Man redete auf dem Weg zu Perrys Wohnung kaum, aber Nina hatte den Eindruck, mit den beiden über alles in der Welt reden zu können, unbefangen und offen, ohne sich verstellen zu müssen. Das H hatte sie zu Geschwistern gemacht; sie waren alle gleich. Nina hätte den neuen Geschwistern ihre geheimsten Gedanken anvertraut, wenn sie denn Geheimnisse gehabt hätte. So glücklich hatte sie sich in den letzten Monaten noch nie gefühlt.
Nina schlief zusammen mit Perry im Bett, ohne dass er sie anfasste. Schließlich waren sie Geschwister, H-Geschwister. Kalle schlief auf dem steinharten Boden, eine dünne Decke über seinen Beinen, und hatte seinen Kopf völlig abgeknickt auf Perrys vollgestopftem Rucksack abgelegt. So schlief er wie ein Toter mit steifem Genick bis zum späten Mittag. Dann stand er mürrisch auf, weil er wieder auf Turkey kam und sich rechtzeitig einen Druck besorgen musste. Ein echter Stress.
Nina spürte nach dem Aufwachen ein fürchterliches Jucken überall. Sie zog alle Klamotten aus; die Jungs kümmerten sich nicht darum, dass sie nackig vor ihnen stand und begann, sich mit einer Haarbürste aus Perrys Bad blutig zu kratzen. Sie kratzte wie besessen ihre Beine auf. Sie wusste ja, dass das Jucken und Kratzen für Fixer normal war, denn daran hatte sie die Fixer schon früher im Sound erkannt. Kalle hatte völlig aufgekratzte Waden, aber er kratzte sich nicht mit einer Bürste, sondern mit seinem Taschenmesser.
Als Kalle ging, sagte er zu Nina: „Morgen kriegst du das Dope natürlich wieder, dass du mir gegeben hast.“ Also war für ihn sonnenklar, dass sie jetzt eine echte Fixerbraut geworden war, die sich spätestens am nächsten Tag wieder einen Druck setzen würde. Das machte sie fast stolz, und sie tat recht cool. Um ihm zu beweisen, dass sie von dem einen Mal nicht abhängig geworden war, antwortete sie: „Lass mal gut sein. Ich brauch‘ in den nächsten Tagen nichts. Kannst es mir ja in einigen Wochen wiedergeben.“
Dann schlief sie noch einmal zufrieden ein. Am Abend auf dem Nachhauseweg dämmerte es ihr und sie dachte: „Oh Gott, du bist fünfzehn und schon auf Heroin. Ist doch echt Scheiße.“ Doch dieser Gedanke verflog schneller, als er gekommen war; ihr Glücksgefühl verdrängte alle Bedenken, jeglichen selbstkritischen und ängstlichen Ansatz.
Wenn man mit H anfängt, das wusste sie aus den Erzählungen ihrer Freunde aus dem Sound, gibt es noch keine Entzugserscheinungen. Das coole Glücksfeeling hielt bei ihr die ganze Woche über an. Es setzte sich die nächsten Wochen fort. Der Alltag war plötzlich keine Last mehr, alles lief wie von selbst. Mit ihrer Mutter blieb es friedlich, der Zoff schien Jahrhunderte her zu sein. Nina nahm die Schule völlig relaxed, meldete sich manchmal zur Mitarbeit und erhielt gute Noten. Mit der Zeit verbesserte sie sich sogar in einigen Fächern um zwei Zensuren.
Zu Doro sagte Nina: „Plötzlich schwebte ich auf Wolke Sieben. Mit allen Leuten schien ich jetzt wundersamer Weise klar zu kommen. Nur mit Helle gab es am Wochenende, nach meinem ersten H-Snief, Krach.“
„Wie das?“, fragte Doro. „Helle war doch selbst eifriger Fixer.“
„Am Wochenende nach meinem ersten Heroin-Snief traf ich Helle vor dem Sound. Sofort bellte er mich an. Ich hätte wahnsinnige Scheiße gebaut und sei total verrückt geworden. Er hatte von Chrissi alles erfahren.“
„Wie hast du darauf reagiert?“, hatte Doro gefragt.
„Ich habe ihn angebrüllt, dass er ruhig sein soll, und wer damit angefangen hat! Das war nämlich er. Und dass ich nicht so ein Fixer wie er werden würde, habe ich gebrüllt. Denn dass es bei mir soweit kommt, das habe ich nicht geglaubt.“
Helle hatte darauf nichts erwidern können. Er war überhaupt nicht in guter Stimmung, weil er auf einen Schuss aus war. Er hatte noch keinen Affen, denn er war noch nicht wie Kalle körperlich abhängig. Schließlich gestand er Nina, dass er keine Kohle habe, sich aber unbedingt H besorgen müsse. Nina hatte ihren kleinen Triumph und sagte: „Da siehst du mal, wer hier von uns beiden abhängig ist.“
Dann schlug sie ihm vor, gemeinsam das Geld für H zu schlauchen. Die attraktive Nina mit ihrer unschuldig-teeniehaften Erscheinung sah sich vor dem Sound um und fing einzelne ältere Disco-Besucher ab, um ihnen irgendein kurzes Märchen zu erzählen. Innerhalb einer Viertelstunde hatte sie vierundzwanzig Mark beisammen, während Helle nur sechs Mark und fünfzig Pfennige ergattert hatte. Es reichte jedoch für beide, denn noch wurden sie von einer recht kleinen Dosis schon gut angetörnt. Ohne jegliches weitere Wort war klar, dass Nina und Helle sich das Dope teilten.
Als Helle seinen Druck setzte und seine Freundin sich einen Snief nahm, wurde ihr mit einem Mal klar, dass nichts aus ihrem Vorsatz geworden war, erst in einigen Wochen wieder H zu probieren, wie sie es Kalle angekündigt hatte.
Nina bildete sich ein, sie würde eine Wochenend-Fixerin bleiben. Das war klar, denn jeder, der mit Dope begann, war überzeugt davon, dass er Gelegenheits-Fixer blieb und nur mal am Wochenende zu H greifen würde. Aber jeder wusste, dass es niemanden gab, der Wochenend-Fixer geblieben ist.
Ich konnte, wenn ich an Svea dachte, davon ein Lied singen. Ich stand aus meinem Wipp-Sessel auf und ging ans Fenster, um hinauszusehen. Ich dachte an Lutz, war gespannt, was er zu berichten hatte und ob es Neuigkeiten von Nina gab, die erfreulicher waren, als die Erinnerungen an sie.
Frisco-Freaks & das Hippie-Berkeley
Seit meiner Ankunft in Frisco waren fünf Wochen vergangen. Ich hatte mich inzwischen in den Sound der Amis „eingegroovt“, hatte mich an allerlei Neuigkeiten, an angenehme oder auch weniger angenehme Kuriositäten gewöhnt. Da besaßen Vicky und Mary eigenartige Reisekoffer, in denen sie ihre Kunst-Utensilien verstauten. Auf ihnen waren großformatig die beiden Punk-Mädels abgebildet. Koffer mit eigenem Porträt waren mir bis dahin nicht bekannt.
An das »coffee-refill« hatte ich mich gewöhnt, nachdem ich anfangs bei der Bestellung einer zweiten Tasse immer völlig umsonst das Portemonnaie gezückt hatte. Das Straßen-Schlachtschiff meiner Nachbar-WG, natürlich mit Automatikschaltung, war knallgelb und hatte nicht nur hinten eine Sitzbank, sondern auch vorne. Der Beifahrer saß neben dem Driver zusammen auf einer wohlig-weichen Couch. Ich konnte, wenn ich gelegentlich mitfuhr, meine Beine unendlich ausstrecken und mich sogar querlegen.
„Isn’t it comfortable?“, fragte dann Mary, weil ich ihr von den engen, platzsparenden Autos auf dem europäischen Kontinent berichtet hatte. Auch mein Ford Station Wagon war von einer unglaublichen Geräumigkeit und komfortablen elektronischen Ausstattung, die es bei uns lange noch nicht gab. Die dezent-vornehme, schwach-grüne Beleuchtung des Armaturenbretts; die schick eingebetteten Details wie Zigarettenanzünder, Drehzahlmesser, Tacho und Uhr ließen mich am Anfang staunen. Doch irgendwann staunte ich über mich, wie schnell ich dies alles als selbstverständlich verinnerlichte und bald schon als Normalität ansah. Am Armaturenbrett, in den Türen und auf der Rückseite der Vordersitzreihe gab es Tabletts und ausklappbare Haltevorrichtungen, um Flaschen oder Becher abzustellen. Wahnsinn!
Bei Nacht war in Frisco alles hell, die Tankstellen, die Drive-ins, die Motels. Jedes Fast-Food-Restaurant glänzte im Licht, und alle für Autofahrer relevanten Anlaufpunkte waren illuminiert wie Landesbahnen auf einem Flughafen.
Alles war hier anders, die Größe und Farbe der Straßenschilder, der ruhig fließende Verkehr, die Meilenangaben, die ich in den ersten Wochen immer im Kopf umrechnen musste, um ein Gefühl für die Entfernungen zu bekommen. Dann die groß auf die Straßen gemalten Pfeile und Zahlen der „Routes“; die wuchtigen, knallig-bunten, allgegenwärtigen großen Reklameschilder. Amerika flashte.