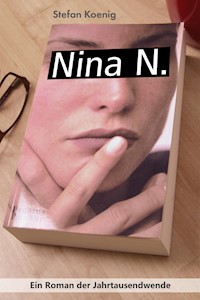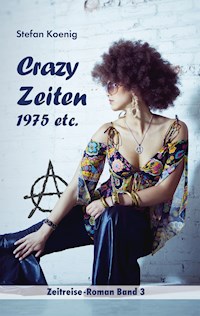Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Zeitreise-Serie
- Sprache: Deutsch
Lich, 2023. Fast hätte die Pandemie zum Bürgerkrieg geführt. Bevor es dazu kam, zerfiel die Bundesrepublik Deutschland in drei Teile: die Südstaaten, den Nordost- und den Westbund. Nur uns, in Deutschlands Mitte, hatten die Generalstäbe vergessen. Für sie waren wir Niemandsland. Wir machten das Beste daraus und riefen die Freie Republik aus. Und Arnold Aurora, dieser charismatische junge Mann in Jesuslatschen, wurde unser Staatschef. Nun mussten wir sehen, wie wir mit dem Logistikmonster klarkamen. Die Wüst AG hatte einen starken Sicherheitsdienst engagiert. Aber wir hatten eine kluge Verteidigungsministerin und eine tapfere Bürgerwehr – und dann kam plötzlich dieser schreckliche Nebel … zum Glück! "Der Thriller bewegt sich zwischen beißender Satire und grausamer Realpolitik. Nichts für schwache Nerven" (MAZ, 31. März 2033)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 468
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stefan Koenig
Freie Republik Lich - 2023
Fantastischer Zeitreise-Roman ins Jahr 2023
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Statt eines Vorwortes
Was sagt der Autor zu seinem Roman?
Das heimliche Vorwort
Wie alles war und wie alles begann
Damals 2018
Damals 2019
Damals 2020
Damals 2021
Damals 2022
Damals 2023
Als der Sturm aufkam
Als der Nebel kam
Das Notstromaggregat
Diese Biester!
Der Verein der Unbelehrbaren
Toi! Toi! Toi!
Zwei Offiziere
Das Grauen nimmt kein Ende
Postscriptum
Nachbetrachtung
Dank
Impressum neobooks
Statt eines Vorwortes
Stefan Koenig
Freie RepublikLich
Eine phantastische
Roman-Zeitreise
ins Jahr 2023
Pegasus Bücher
Viele Worte
Kein Inhaltsverzeichnis
Prasselnde Leerverkäufe
Prahlereien
Keine Worte
Viel Inhalt
Ergebt euch
Widerstand zwecklos
Die Macht des Geldes
Prasselnde Leerversprechungen
Die Macht der Wähler
Zu spät
Da gehe ich zu einem
Friedhof
Autofriedhof
Suche das Auto
Lausche und orte den Ort
Wo das alte
Autoradio
Es mir zuflüsterte
Das eine kleine Wort
Wenn ich es nur gehört hatte
Durch das Rauschen im Äther
Wenn
Nur ein Wort
Ein einziges Wort
….. »Hope« …..
Die Hoffnung ist wie
Zucker im Kaffee.
Auch wenn sie klein ist,
versüßt sie alles.
Was sagt der Autor zu seinem Roman?
Stefan Koenig, geboren in Frankfurt am Main, Studium der Politik-, Verwaltungs- und philosophischen Wissenschaften in Berlin, Berkeley und Frankfurt: „Diese Story ist einfach unglaublich, selbst für mich, der ich all dies miterlebt habe. Wenn Sie Probleme damit haben, dass sich das, was Sie hier lesen, erst in ferner Zukunft abspielt – allerdings in nicht allzu ferner Zukunft –, so möchte ich Sie auf Albert Einstein verweisen. Recherchieren Sie ruhig selbst, Stichwort: »Relativitätstheorie«.
Ich kann Ihnen das nicht vollumfänglich erklären, sonst würde dieses Buch unlesbar dick, gewissermaßen ein »adipositivity book«. Das wollen weder Sie noch ich. Jedenfalls gibt es Dinge, die man für unmöglich hält – wie der Zerfall eines großen Staates.
Und es gibt Dinge im Universum, die sind einzigartig. Wie dieser unheimliche Nebel, der das Althergebrachte sprengte und unseren Ort zu einem Brennpunkt der Finsternis und Verworrenheit, von Schrecken und Unglaublichkeit, aber auch von Hoffnung und Neuaufbau machte. Ja sicher, es gibt Dinge, die einfach nicht durch das enge Nadelöhr unseres gutwilligen demokratischen Verstandes passen – übrigens unabhängig davon, wen Sie wählen.“
Das heimliche Vorwort
Aufräumen mit Vorurteilen
Vorab: Ich hasse Vorworte. Ich lese sie nie, wenn sie mich in einem Buch belästigen. Nun aber schreibe ich selbst solch unnötige Worte, heimlich, allein deshalb, weil mein zweites Ich mir zuflüstert: »Verdammt noch mal, schreib ein Vorwort!«.
Nun gut. Ich schreibe hier und kann nicht anders. Wenn Sie an meinem Verstand zweifeln, dann legen Sie los. Ich kann und werde es nicht verhindern. Halten Sie mich für bekloppt oder zum Schreiben völlig unbegabt, stecken Sie mich in irgendeine beliebige Schublade, vorurteilbeladen. Stecken Sie Mottenpapier oder Abflussfrei dazu. Verladen Sie mich, wo immer Sie mögen – doch ich bleibe dabei: Ich schreibe hier und kann nicht anders. Ich fühle mich, wie jeder wahre Irre, der Wahrheit verpflichtet.
Wenn ich bedenke, mit wie viel Eitelkeiten die Welt bestückt ist, mit wie vielen selbstsüchtigen Auftritten und medialen Rechtfertigungen sich die Protagonisten unserer realen Welt umgeben, dann habe ich das Gefühl, einen Beitrag hinzufügen zu sollen. Ist es nicht im Sinne unserer korrupten Selbstdarsteller, wenn man sie als Romanfiguren mit völlig neuen Identitäten ein anderes Leben, ein Leben in der Freien Republik Lich leben lässt? Ich habe mich dazu entschlossen, weil Personen der Zeitgeschichte es würdig sind, dass man sie über die Zeitgeschichte hinaus in immer neuen Märchen und in immer neuem Gewande weiterleben lässt.
So lange die Lastwagenkolonnen an uns vorüberrauschen, wollen wir ihrer ewig gedenken. In meinem Bericht über damals – das Jahr 2023 –, spielen die Namen keine Rolle. Sie mögen austauschbar sein, so wie der Tod – man tauscht das Leben gegen ihn. Oder umgekehrt. Worum ich Sie bitten möchte: Räumen Sie gefälligst auf mit Vorurteilen gegen Zeitreisen. Wenn ich demnächst mein Zeitreisebüro in Lich eröffne, lade ich Sie zur großen Eröffnungsparty ein.
Ischwör!
Ihr Stefan Koenig
Im Juli 2021
Bitte vergessen Sie nicht,
dass es sich bei dem vorliegenden Werk
um eine frei erfundene Story handelt.
Keine Angst also!
Namen, die Ihnen vielleicht
durchaus bekannt vorkommen mögen,
gehören nicht zu real existierenden Personen.
Jedenfalls gibt es sie so nicht, nicht so!
Orte, Ereignisse und Romanfiguren
sind allesamt Erfindungen.
Nackte Illusionen.
Faktische Fiktionen.
Fiktive Fakten.
Lich – gibt es diesen Ort wirklich?
Ich bin mir in nichts mehr sicher.
Stefan Koenig
Freie RepublikLich
Bericht über das Jahr 2023
Dieses Buch widme ich all jenen Licher Bürgern,
die sich nicht damit abfinden können,
dass über ihre Interessen hinweg
entschieden wurde
Und natürlich widme ich es meinen treuen
Leserinnen und Lesern, immer in der Hoffnung,
dass sie noch gut schlafen können.
Pegasus Bücher
Wie alles war und wie alles begann
Die Freie Republik Lich ist nicht mehr auffindbar. Es ist lange her, und insoweit ist der Hinweis auf das Jahr 2023 eventuell irreführend. Tatsächlich ist nun schon ein volles Jahrzehnt verstrichen, seit wir die Republik aufgelöst haben. Fast scheint es, als hätten gewisse Kreise ein Interesse daran gehabt, alle Erinnerung an sie zu eliminieren. So, als wäre unsere damalige demokratische Eigeninitiative, geleitet von ehrlichen und nichtkorrumpierten Bürgern, eine Art Krankheit, ein böser Virus gewesen, den man vollständig besiegen musste.
Viele vermuten einen unmittelbaren Zusammenhang mit dem Logistikzentrum und seinen katastrophalen Nebenwirkungen. Es stimmt auch. Es stimmt absolut. Ich kann es bestätigen. Und doch war es komplizierter.
Die Zeitumstände zwischen 2020 und 2023 waren sehr merkwürdig. Wenn man heute, aus dem Jahr 2033, mit einem Jahrzehnt Abstand, zurückblickt, erscheint vieles unglaublich und widersinnig. Aber es war so. Unglaublich widersinnig. Genau so war es. Die Corona-Pandemie hatte das Land zerrissen. Näheres möchte man fast nicht mehr ausführen, wenn man bedenkt, welch irrwitzige Ausmaße – und Anmaßungen – die Politik in jenen Tagen angenommen hatte. Jedenfalls hatten bürgerkriegsähnliche Zustände gedroht. Doch bevor es zum Äußersten kam, zerfiel die Bundesrepublik Deutschland im Herbst 2022 und es schälten sich drei neue staatliche Gebilde heraus. Wir in Lich befanden uns allerdings im Niemandsland, waren gewissermaßen die Vierte – aber unsichtbare – Republik jener Zeit.
Bayern besetzte Baden-Württemberg sowie die südlichen Landesteile der Pfalz und Hessens. Sie nannten sich »Deutsche Südstaaten«. Söder war damals noch ein junger Mann von Mitte Fünfzig, wenn man bei dieser Art Politiker überhaupt jemals von »jung« sprechen konnte. Schon als zwanzigjähriger Jungpolitiker war er im Kopf so alt wie Helmut Kohl am Ende seiner politischen Weisheit im Jahr 1998, als ihn Angie stürzte. Aber egal. Jedenfalls war Söder der starke Mann der neu etablierten Südstaaten. Für die wirklich Jungen – die im Bunde mit mir der Freien Republik Lich auf die Beine halfen – war Söder natürlich ein uralter Mann. Ich selbst war bereits Ende Fünfzig.
Der ehemalige bayrische Ministerpräsident ließ Hessen bis zu unserer Stadtgrenze und etwas darüber hinaus besetzen. Warum er gerade an unserer Grenze Halt machte, konnte man – jedenfalls offiziell – niemals restlos ermitteln. Wahrscheinlich hatte sein Generalstab gewürfelt, sagte man sich. Aber ich wusste es besser. Dazu später. Jedenfalls bildete die A45 auf der Linie Münzenberg – Berstadt die Südwestgrenze. Vom südwestlichen Besatzungsgebiet kommend, bildete die A5 – vom Gambacher Kreuz in nördlicher Richtung über Fernwald nach Reiskirchen verlaufend – den nordwestlichen Grenzverlauf. Berstadt und Hungen begrenzten unser Staatsgebiet im Süd-Osten.
Im Nord-Osten hatte sich unter der Regie des alten Berlins der »Nordbund« gebildet. Sein Terrain berührte unsere hessische Heimat nur an der alten thüringischen Grenze im Osten des ehemaligen Hessen. Unsere Freie Republik Lich hingegen reichte im Osten von Villingen in nördlicher Richtung bis nach Laubach und Ettingshausen. Die beiden letztgenannten Ortschaften lagen zwar außerhalb unserer Staatsgrenze, aber es herrschte immerhin ein kontrollierter Grenzverkehr. Villingen hatte einen Sonderstatus, wovon Sie noch rechtzeitig erfahren werden. Von großer Bedeutung war unsere geheime Verbindung über Hattenrod zur Flugplatzsiedlung Ettinghausen, von der aus wir mit einem Flieger operieren konnten, was den rundum stationierten Besatzungsmächten glücklicher Weise eine Zeit lang entging.
So also sah die Grenzziehung rund um unseren kleinen, aber freien Volksstaat aus. Einige mieden diesen Begriff und sagten dazu »Bürgerstaat« – aber fragen Sie sich bitte selbst: Worin liegt der Unterschied?
Der große und mächtige »Westbund« war unter dem Düsseldorfer Kö-Regime unser unmittelbarer nordwestlicher Nachbar, ein »Nachbar der untergehenden Sonne«, wie unser neuer Bürgermeister, Arnold Aurora, zugleich Staatschef der Freien Republik Lich, die Westzone gelegentlich nannte. Dass wir so frei und unbehelligt agieren konnten, lag eindeutig daran, dass man uns bei der Aufteilung der Zonen einfach vergessen hatte. Wir bedeuteten für unsere angrenzenden Nachbarn mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit so etwas wie jenes bereits erwähnte Niemandsland. Ich kann auch erklären, wie das gekommen sein mag – aber nicht jetzt.
Zwischen der Hauptstadt Lich und unseren Außengrenzen war unser Freistaat mit einer prächtigen Natur und lebenswichtiger Landwirtschaft gesegnet. Wir lebten im Herzen der Natur. Alles war bestens. Bis zu dem Tag, als jener blaugraue Monsterklotz aus dem Boden schoss, der mit Beginn des Jahres 2021 alles schrill zerstörte. Ihn anfangs zu verhindern, dann zu beseitigen, waren wir bereits zwei Jahre zuvor angetreten.
Unser schönes Lich lag nicht nur im Herzen der Natur, es war vielmehr das Herz selbst, pulsierte für Tourismus und Kultur und produzierte vorwiegend Naturprodukte. Und es hatte eine engagierte Jugend hervorgebracht. Landrebellen.
Apropos »im Herzen der Natur« – der Freund meines Bruders und mein Bruder selbst, beide zehn Jahre älter als ich, hatten für das Licher Bier den Werbespruch »Aus dem Herzen der Natur« geprägt, inklusive eines lieblichen Gezwitschers des blau-gelben Eisvogels. Rudi Schreiber und mein Bruder Günter waren dem idyllischen Lich mit Leib und Seele verbunden, auch wenn sie fernab in der Rhein-Main-Metropole der späteren Südstaaten wohnten. Und so vermarkteten sie das Licher Bier samt Slogan über Funk und Fernsehen bereits seit Ende der 1970er-Jahre.
Rudi, mein Bruder und ihre Frankfurter Werbeagentur Pro Natur lebten davon gut und gerne drei Jahrzehnte. Jetzt aber, im Februar 2019, war Rudi erschüttert, als ich ihm am Telefon von den sich anbahnenden Entwicklungen berichtete.
Doch recht schnell streifte er seine Besorgnis ab und meinte: „Stefan, sei beruhigt! Damit kommen die nicht durch. Da wird kein Klotz mitten in eure schöne Natur gesetzt. Wie kommst du nur darauf! Und diese vielen LKW, vierhundert oder gar fünfhundert Lastwagen pro Tag …“ Er lachte hellauf. „So verrückt sind eure Politiker nicht. Ich kenne einige eurer Entscheidungsträger und Abgeordneten, ich habe mit denen zusammen gefeiert und gesoffen, nein, die Sache ist eine Luftnummer! Eine Totgeburt! Da geht nichts schief! Keine Sorge!“ Rudi lachte noch einmal laut auf, und ich lachte mit ihm.
Auch mein Bruder musste herzlich lachen, als ich ihm meine Bedenken beichtete. Er hatte mich in früheren Zeiten manchmal als überzogenen Bedenkenträger bezeichnet, was mir natürlich gar nicht gefiel, denn das wäre so, als würde man einen Polizisten dafür rügen, dass er wachsam die Bürger schützt. Das Wort »Bedenken« hängt doch irgendwie mit »Verantwortung« und insbesondere mit dem Wort »denken« zusammen, oder täusche ich mich? Und vorausgedacht haben damals viele der Licher Bedenkenträger.
„Nein, da wird ganz sicher nichts hingebaut, was dem Charakter eures lieblichen Heimatstädtchens widerspricht oder gar die Luft- und Lebensqualität ruiniert. Nein, das läuft nicht!“, meinte mein Bruderherz kurz und bündig.
Aber es lief und es ging schief und der Klotz kam und siegte. Doch dann kamen wir, die Entrüsteten, wir sahen – und auch wir siegten. Nur war es ein Sieg auf Messers Schneide, wie man so schön und lapidar zu sagen pflegt. Manche sprachen von einem Pyrrhussieg, was ich persönlich für unzutreffend halte.
Ist ein Glas halb voll oder halb leer? Es entscheidet der Blickwinkel und der Standpunkt. Und manchmal entscheidet keines von beidem, sondern ausschließlich das Schicksal.
Ich berichte wahrscheinlich eine Spur zu schnell, ich weiß. Ich zügele mich und werde ab jetzt langsamer berichten. Sie wollen schließlich alles nachvollziehen. Sie lieben die Gewissenhaftigkeit, jedenfalls seitdem Sie mitbekommen haben, wie gewissenlos und flüchtig bahnbrechende politische Entscheidungen getroffen werden können. Nun gut. Neuer Anlauf ...
Unsere friedliche Revolution hatte schließlich gesiegt. Aber ohne gewisse äußere Umstände und Zufälle hätte es auch anders ausgehen können. Wir hatten Glück. Wir hatten eine komplette Bahnstrecke von Ost nach West unter unsere Regie gebracht. Dazu jenen Flugplatz, wie schon erwähnt, ein Wasserwerk, den Busverkehr und alles andere, was man zum Leben braucht. Die Energieversorgung stellte uns vor besonders hohe Hürden. Aber wir sprangen darüber hinweg und hatten fabelhafte Ingenieure. Dazu später. Und natürlich gehörte uns das Rathaus, und Arnold Aurora war jetzt unser Mann.
Und jetzt endlich wollen Sie wahrscheinlich wissen, wie es dazu gekommen war. Die Geschichte der Freien Republik Lich ist, wie soll man sagen, ein Nicht-Ereignis geworden. Kein Buch dazu in unserer Stadtbibliothek, kein Vermerk im Stadtarchiv, kein Wort über sie wird laut im Schulunterricht. Ich muss es wiederholen: Einige wollen unseren damaligen Erfolg kleinreden oder sich an diesen fürchterlichen Nebel nicht mehr erinnern. Mag sein, dass es für die schwachen Nerven und feinen Gemüter mancher Beteiligten zu viel war und eine Art Trauma hinterließ. Hauptsächlich aber vermute ich dahinter eine Strategie der damals Entmachteten, die ihr hochheiliges Logistikzentrum und ihre Felle davonschwimmen sahen. Und das alles schwamm ja auch davon.
Es verschwamm in der Zeit, als uns wütende Monster aufsuchten. Es verschwamm in den Tagen zwischen dem 16. und 19. Dezember 2023 in jenem unheimlichen Nebel, der uns alle überraschte und unserer Revolution folgte oder mit ihr Schritt hielt – oder wie immer man die Sache einzuordnen gedenkt. Ich kann mich auch täuschen, wenn ich hinter der Verdrängung unseres selbstgeschriebenen Stücks Geschichte eine Absicht vermute. Natürlich, und dies liegt in der Natur der Sache, wäre es eine politische Absicht. Welche Personenkreise jedoch könnten dahinterstecken?
Müssten es, wenn die Logik logischerweise der Logik folgen würde, nicht diejenigen sein, die den Monsterbau befördert und bewilligt haben? Jener Ex-Bürgermeister, Arturo Groß, mit seinen großmundigen Versprechungen? Jener unseriöse Bauaufsichts-Beamte, Rüdiger Halbersach, der in einem außergewöhnlichen Hauruckverfahren seiner tatsächlichen Aufsicht unzureichend, man möchte sagen: bewusst unzureichend, nachkam, sich ungeachtet dessen aber als Held von Lich rühmen ließ? Jene willfährige Erste Stadträtin, Ingrid Steegher, die sich Groß und einem Immobilienhai verpflichtet fühlte und die es verstand, rechtlich klare Linien zu einer rasanten Schlangenlinie umzubiegen?
Müssten es nicht die vielen bedenkenlosen Mitläufer sein? Jene kleinkarierten Stadtverordneten mit ihrer grenzenlosen Naivität und offensichtlich angeborenen Unterwürfigkeit? Jene, die sich von den sogenannten Profis und Experten gnadenlos überrumpeln ließen? Jene gewählten Bürgervertreter, die es geschehen ließen, dass man ihnen gerade mal drei Tage Zeit ließ, um volle 650 Seiten zu einem komplizierten Bewilligungsverfahrens zu lesen, zu verstehen und letztlich kritisch zu überprüfen?
Müssten es nicht jene sein, die aus christ- und sozialdemokratischer Bequemlichkeit das Nachfragen unterließen und Gott einen guten Mann sein ließen? Jene, mit all dem Gottvertrauen in die angeblich soziale Macht des Geldes, welche ihnen »ungeahnte Steuereinnahmen« – und natürlich viele, viele Arbeitsplätze, was sonst! – vorflunkerte? Ich sage nur: Tanz um das Goldene Kalb! Politische Halluzinationen! Lassen wir das. Ich möchte der brisanten Geschichte nicht vorgreifen.
Wie also begann das alles?
Damals 2018
In jenem Jahr arbeitete ich in einem Licher Verlag und übernachtete gelegentlich bei meiner Freundin. Sie hatte eine Wohnung inmitten der historischen Altstadt. Stella und ich saßen beim Mittagessen auf ihrem Balkon. Wir schauten über die Dächer von Lich in östlicher Richtung des niedlichen Wiener Cafès, das sich unterhalb des Wohnhauses befand. Dort gab es die leckersten Torten, aber Stella und ich achteten auf unsere Linie. In diesem Sinne waren wir absolut linientreu. Ansonsten waren wir, wenn man so will, Freigeister.
Es war Donnerstag, der 5. Juli, die Sonne brannte vom Himmel, und ich freute mich wie ein Zaunkönig – wenn denn Zaunkönige sich wirklich und sichtbar freuen können. Ich freute mich, weil Stella heute nicht im Geschäft sein musste. Endlich mal Zeit für uns zwei.
Sie war Optikerin mit Herz und Seele und hörte sich täglich die Lebensgeschichten der Kundschaft geduldig an. Aber seit zwei Wochen war ihre Kraft erschöpft. Den letzten erholsamen Urlaub – es war ein Kurzurlaub von sieben Tagen – hatte sie um die Osterzeit herum genehmigt bekommen. Ab heute konnte sie reinen Gewissens für ganze zwei Wochen ihren anstrengenden Aufgaben fern bleiben. Ihre Vertretung war geregelt.
Ich hatte gerade in zwanzigminütiger Vorarbeit ein italienisches Menü mit Spaghetti Carbonara sowie einen Tomatensalat mit Mozzarella und Basilikum zubereitet, wozu wir einen Rotwein tranken. Urlaubszeit eben.
Auch ich hatte mir für ein paar Tage freigenommen, was man als Freiberufler mühelos hinkriegt, wenn man als freischaffender Künstler und Honorar-Mitarbeiter eines Verlages sowieso ein vogelfreies Leben führt. Vogelfrei. Haben Sie darüber einmal nachgedacht? Man sagt: „Frei wie ein Vogel.“ Aber kann man einen Vogel frei nennen?
Es ist richtig, er hat Flügel, die ihn über Wälder, Seen und Berge tragen. Wenn im Herbst die Zugvögel, Störche, Kraniche und andere gen Süden fliegen, beneidet sie mancher von uns und denkt: „Glückliche Vögel – fliegen, wohin sie wollen!“
Aber ist es so? Machen die Vögel diese weiten Flüge, weil sie, wie wir, das Reisen lieben? Weil sie „Reisefreiheit“ genießen? Mein Gott, ich schweife ab. Aber genau darüber habe ich mich fünf Jahre später, in der Zeit unserer Freien Republik, mit dem damals fast 86-jährigen Ludwig Henrich, einem alteingesessenen Licher Bürger, unterhalten. Ich lernte ihn bei einer Bürgerinitiative kennen, ein sehr engagierter Mann, trotz – oder wegen? – seines hohen Alters. Vielleicht komme ich auf das Thema mit der Freiheit und den Vögeln zurück.
Aber was heißt vielleicht? Ich muss darauf zurückkommen – es war einer der strittigen Punkte in unserem neuen Bürgerparlament. Und es hatte weiß Gott mit dem Logistikzentrum zu tun.
Stella und ich saßen da und genossen das herrliche Wetter, den Blick ins Weite, das Essen und die Ruhe. Stella erklärte mir, in welcher Himmelsrichtung das Kloster Arnsburg und in welcher mein Sportstudio in Hungen liege. Sie deutete nach Osten und sagte: „Hier kann man gut über die Langsdorfer Höhe radeln. Auf einem ausgebauten Fahrradweg geht’s direkt zu deinem Sportpark, und von dort aus kann man in zehn Minuten weiter zum Inheidener Badesee fahren.“
„Sollten wir mal machen“, antwortete ich.
„Allerdings haben wir das Waldschwimmbad gerade hier um die Ecke“, sagte sie schmunzelnd.
„Bist wohl ein bissi faul.“
„Bei dem schwülen Wetter schon“, gestand sie.
Ich prostete Stella zu, wir stießen an und nahmen einen Schluck Chianti. Ich sah Stella nachdenklich an, während sie versonnen auf ihr Glas schaute. Chianti, mein guter traditioneller Lieblingsrotwein, noch aus der Zeit, als die erste Pizzeria in Deutschland eröffnet worden war. Aber Stella hatte diese Zeit nicht erlebt, uns trennen fast fünfundzwanzig Jahre.
Auch ich schaute jetzt auf mein Glas, fast ein wenig betreten wegen der immer wieder aufkommenden Gedanken, wenn mir unser Altersunterschied bewusst wurde. Unsere Gläser waren halbleer oder halbvoll; hier griff wieder einmal das Sprichwort vom Blickwinkel. Was wir kurze Zeit später sahen, war jedoch – ich möchte es vorweg betonen – nicht diesem Gläschen Rotwein geschuldet.
Ich liebe das italienische Essen und Stella nicht minder. Als Dessert holte ich in der gegenüber liegenden Eisdiele das von meinen italienischen Freunden selbst kreierte Stracciatella-Eis; einfach köstlich. Als ich in unserer Lounge-Ecke neben meiner Liebsten auf dem Balkon wieder Platz genommen hatte, sah ich das erste Mal diese komische Naturerscheinung. Und plötzlich spürte man sie auch. Wie aus heiterem Himmel fauchte ein Wind durch die Bäume, und am Horizont zog blitzschnell auf breiter Front ein rabenschwarzes Gewitterband auf. Es war plötzlich einfach da. Und dann bewegte es sich langsam aber stetig auf uns zu. Kurze Zeit später schien es dort, wo es war, zu verharren. Der starke Wind legte sich abrupt. Jetzt lastete mit einem Mal wieder diese drückende Hitze auf uns.
„Diese Gewitterfront ist uns jetzt ziemlich nahe“, meinte Stella.
„Das Wolkenband dürfte genau über der Langsdorfer Höhe liegen“, antwortete ich.
Gerüchteweise hatte Stella vor zwei Tagen von einem ihrer älteren Dauerkunden, einem siebzigjährigen Stadtverordneten, etwas unter dem Siegel der absoluten Verschwiegenheit erfahren. Optiker, Physiotherapeuten und andere Gesundheitshandwerker sind mehr oder minder psychologische Ratgeber. Und sie sind – ähnlich wie Ärzte – hervorragende Ausheul-Objekte. Manche Patienten beziehungsweise Kunden tun sich, nebenbei bemerkt, auch gerne etwas wichtig. Der Christdemokrat Detlef Hofbauer saß als Vorsitzender des städtischen Bauausschusses an einer der entscheidenden Stellen. Zweifellos ein wichtiger Mann.
„Er muss ja schließlich wissen, ob die Sache Hand und Fuß hat“, antwortete Stella auf meine Frage, ob das ernst gemeint sei. Ein großes Bauvorhaben sei am Start – und zwar ginge es genau um jenen Naturabschnitt, über dem jetzt das furios anmutende Gewitterband drohend zum Stillstand gekommen war. Ein Lager- und Verteilzentrum mit 110.000 Quadratmetern Lagerfläche sei dort geplant.
„So viele Quadratmeter? Du hast dich gewiss verhört“, sagte ich ungläubig.
„Keine Ahnung. Aber damit du es weißt: Ich höre eigentlich sehr gut. Die Sache, so sagte er, würde noch intern diskutiert. Deshalb habe er mir dies lediglich »inoffiziell« mitgeteilt, wie er es ein wenig nebulös formulierte.“
Stella schaute mich abwartend an, aber ich starrte gebannt in den Himmel. Das merkwürdige Wolkenband bewegte sich keinen sichtbaren Meter. Natürlich kann man das auf solch eine Entfernung nicht wirklich exakt feststellen. Aber ich hatte mir die Kreuzspitze auf dem Turm der Sankt Paulus Kirche gemerkt. Die Wolken hingen immer noch genau in der alten Position wie festgenagelt.
Ich schaute zu Stella, die jetzt einen fast prüfenden Blick auf mich warf. Wahrscheinlich dachte sie, ich hätte ihr nicht zugehört. Aber Zuhören war eine meiner Spitzeneigenschaften. „Und weiter?“, fragte ich.
„Na ja, ich hätte ja dort kein Grundstück, wie er wüsste, und damit sei ich keine der Betroffenen, die unberechtigter Weise gleich in Panik ausbrechen würden. Deshalb möge ich bitte kein Wort gegenüber anderen äußern und so weiter. Außerdem glaube er, dass ich gewiss die Schaffung neuer Arbeitsplätze befürworte. Auch gegen eine grandiose Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen für die Stadt und somit für uns Bürger habe ich sicherlich nichts einzuwenden.“
„Du hast zustimmend genickt, wie ich dich kenne“, warf ich ein.
„Na klar. Deshalb war er ja sehr gesprächig und unterbreitete mir dabei tatsächlich so etwas wie eine Familienplanung, die er mir subtil ans Herz legte. Später, zu einer Zeit, wenn ich vielleicht einmal eine Familie gründen und Kinder haben würde – na, wann wird es denn soweit sein, junge Frau?, hat er gefragt – könnten aus diesen Mehreinnahmen die Kindergärten und Schulen modernisiert, digitalisiert und personell besser ausgerüstet werden.“ Stella hatte es mit dem mir so sexy anmutenden Amüsement, das um ihre schönen Lippen spielte, berichtet.
Ich musste laut lachen und sagte: „Und morgen erzähle ich Ihnen ein anderes Märchen, junge Frau.“ Ich ahmte die wichtigtuerische Stimme eines Christdemokraten nach, wenn er sich besonders versiert fühlt. Wenn ich mich recht erinnere, traf ich die sonore Stimme des Herrn Altmaier.
Stella ergänzte: „Und wenn Sie nicht gestorben sind, Herr Stadtverordneter, dann leben Sie noch lange und dürfen das von Ihnen angerichtete Naturdesaster ausbaden.“
„Naturdesaster?“, warf ich ein. „Wir wissen doch nichts! Rein gar nichts. Da sollten wir das Inferno nicht an die Wand malen!“
Stella schaute mich an und sagte trocken: „110.000 Quadratmeter!“
„Bin ja nicht begriffsstutzig“, entgegnete ich. „Dafür sind Ausgleichsflächen vorgesehen, glaube ich.“
„Hier in Lich?“
„Was weiß ich.“
„Wo etwas gelagert und verteilt wird, wird etwas angeliefert und abgeholt. Ein dauerndes Kommen und Gehen. Machen das die unsichtbaren Geisterfahrzeuge der Heinzelmännchen?“
Ich stöhnte auf. Sie hatte ja, wie immer, so recht. Wir gingen zum Schmusen ins Wohnzimmer. Urlaub eben. Wenigstens ein- oder zwei- oder drei Mal im Jahr, sorry, ich meine natürlich im Monat. Wir waren eingeschlafen und als wir eine Stunde später aufwachten, erinnerten wir uns der Gewitterwolken und eilten nach draußen, denn wir hatten vor lauter liebesbedürftigem Eifer vergessen, den Tisch abzuräumen und den Sonnenschirm zusammenzuklappen. Aber alles war trocken und windstill, und der italienische Chianti stand immer noch stolz und aufrecht neben meinem Glas. Stella und ich blickten zeitgleich nach oben Richtung Osten – der Himmel war hellblau und völlig frei von irgendwelchen Wolken.
Komisch, dachte ich. Sehr komisch.
Genau eine Woche später, am 12. Juli, erschien ein erster offizieller Hinweis auf das geplante neue Verteilzentrum im Licher Wochenanzeiger: »Lagerhallen statt Ackerflächen – SPD nimmt Entwicklung der Gewerbegebiete in Blick – Unfallschwerpunkt auf B467 durch mehr LKW?«
Ich las den Artikel durch, mehr widerwillig als interessiert. Da standen nun tatsächlich die 110.000 Quadratmeter drin und fünfhundert neue Arbeitsplätze würden geschaffen und die Stadt würde zwei Millionen Verlust durch den Verkauf der Fläche wettmachen – ein Verlust, der ihr durch die unbewirtschaftete Natur dort entstehe. Unbewirtschaftete Natur verursacht Kosten?, zuckte es durch meinen Kopf.
„Verstehe das wer will“, sagte ich zu Stella.
„Versteht kein Mensch! Wer hat da wieder irgendwelche Zahlen zusammengerechnet, um auf ein ominöses Minus von zwei Milliönchen zu kommen? Nur um damit zu sagen, wir sollten froh sein, wenn da jemand einen Monsterklotz hinbaut. Im Erfinden von Schein-Legitimationen sind unsere bundesdeutschen Politiker traditionell Spitzenklasse! Denk mal an Stuttgart 21 oder andere Monsterwerke!“
„Bürgermeister Groß meint sogar, ein 24-Stunden-Betrieb sei möglich. Das wäre ja … uiii … Will ich gar nicht dran denken!“
„Steht das da drin?“
„Genau, und da steht noch etwas: Der Bürgermeister möchte das gesamte Areal von 20,5 Hektar am liebsten auf einen Schlag an den Mann bringen. Und zwar an einen einzigen Mann.“
„Er denkt da wohl an Jeff Bezos, den Chef von Amazon“, sagte Stella und grinste verschwörerisch. „Meinst du das funktioniert?“
„Amazon wird eine Nummer zu groß sein, aber wer weiß! Ob das funktioniert mit dem »einen Schlag an einen Mann«? Der Bürgermeister bejaht das. Mr. Groß ist sich zu achtzig Prozent sicher, dass das klappt. Er hofft, dass schon nach der Sommerpause der Kaufvertrag mit irgendeinem Großinvestor abgeschlossen werden kann.“
„So schnell? Das geht doch gar nicht! Müssen da nicht andere Gremien mitentscheiden?“, stieß Stella ungläubig hervor, und sie sah mich – ich kann es nicht anders beschreiben – entsetzt an. „Solche Verfahren mit all den notwendigen Umwelt- und Bauauflagen dauern doch normaler Weise einige Jahre, und die Bürger erhalten ausreichend Zeit, um Einwände zu erheben. Das muss doch rechtsstaatlich ablaufen!“
„Sieht mir aber eher nach Hauruck-Verfahren aus, als wolle man etwas hinter dem Rücken der Bürger durchpeitschen“, antwortete ich.
„Wer ist eigentlich der besagte Investor?“, fragte Stella.
„Steht nirgendwo. Scheint ein Betriebsgeheimnis zu sein.“
Bei nächster Gelegenheit fragte ich Andrea, Stellas beste Freundin, die einen schnuckeligen, schicken Schuhladen namens »Schuhsalon« betrieb. „Hast du etwas über den geheimnisumwitterten Investor gehört?“
Obwohl Andrea jede Menge Kundenkontakte hatte, war sie ratlos. „Scheint ein Rätsel zu sein, an das der kleine dumme Bürger erst in Kreuzworträtselform herangeführt werden muss“, meinte sie augenzwinkernd.
Auch Stella selbst hatte sich in der Zwischenzeit umgehört, konnte jedoch nicht in Erfahrung bringen, wer gemeint sei. So vergingen die Monate, bis ich am letzten Tag im November zufällig im Licher Wochenanzeiger einen Leserbrief entdeckte.
»110.000 Quadratmeter groß und 20 Meter hoch! Wer braucht so ein Monster?«
Unser Lich ist eine wunderschöne historische Kleinstadt – und jetzt das! Man will uns ein bauliches Monstrum mit einer Höhe von 20 Metern vor die Nase setzen, mit all den sozialen, ökologischen und gesundheitlichen Nebenwirkungen. Glauben Sie nicht? Aber bitte: Fragen Sie doch Ihren Arzt oder Apotheker!
Der Bürgermeister verlässt uns zwar im nächsten Jahr, aber sein monströses Vermächtnis wird uns damit immer vor Augen bleiben. Er will jetzt schnell noch alles unter Dach und Fach bringen. Will er auch seine Schäfchen ins Trockene bringen? Lässt er uns Bürger noch genügend Zeit mitzuentscheiden? Haben unsere gewählten Vertreter genügend Zeit zur sachlichen Prüfung? Ich empfehle den Stadtverordneten einen Besuch in Nieder-Mockstadt. Hier steht nämlich ein abschreckendes Beispiel für ein Hochregallager. Fragen Sie die dortigen Bürger nach dem LKW-Verkehr! Dann weiß man, was uns hier erwartet. Verhindern Sie, verehrte Abgeordnete, eine falsche Entscheidung, bevor es zu spät ist.
Wir sollten den Focus auf das, was unsere Stadt wirklich ausmacht, nicht verlieren. Lich ist keine Industriestadt. Es geht um den Werterhalt von historischem Kulturgut, um eine lebenswerte Umwelt, eine intakte Natur – es geht um unsere Lebensqualität.
Edith Neuer-Süß
Wer so engagiert für sein Städtchen eintrat, wusste gewiss etwas über den Investor zu sagen, wenn …, tja, wenn inzwischen zumindest der Name bekannt war. Also beschloss ich, die Dame anzurufen. Vielleicht wusste sie Näheres. Aber da erhielt ich einen dringenden Rechercheauftrag von meinem Verlag – es ging um die vielbesungene Pressefreiheit und den Fall Julian Assange – und so vergingen drei Wochen, bis ich Frau Neuer-Süß endlich an der Strippe hatte.
„Ich glaube, wenn ich meinem Informanten vertrauen kann, dass der Großinvestor, von dem der Bürgermeister so lange schon geheimnisumwittert spricht, »Wüst AG« heißt. Aber man kann der Sache nicht trauen. Es ist jedenfalls noch nicht offiziell“, sagte sie mit einer durchaus freundlichen Telefonstimme.
„Wissen Sie zufällig, wo und was diese »Wüst AG« ansonsten macht?“
„Ob ich das zufällig weiß?“, fragte sie mit einem lachenden Unterton, um mir gleich darauf zu erläutern: „Nein, nicht zufällig, sondern durch umständliches Nachforschen habe ich herausgefunden, was für ein Laden das ist.“
„Ah, das Bürgerbüro hat Ihnen – vielleicht eher etwas widerwillig – die Auskunft erteilt“, warf ich gutgläubig ein.
„Was denken Sie! Die haben wohl immer noch striktes Geheimhaltungsgebot, oder die Damen vom Bürgerservice wissen tatsächlich von nichts. Ich habe einen Maulwurf in der Golf-Connection. Der weiß Bescheid. Die Wüst AG ist ein bundesweit tätiger Logistikmoloch, der für andere Handelskonzerne die Infrastruktur bereitstellt und ihnen die umstandslose Verteilung ihrer Waren ermöglicht. Das macht er geschickt und fies zugleich.“
Am Telefon entstand eine Pause und ich rief „Hallo?“ in den Hörer.
„Musste nur kurz Luft holen“, sagte die Frau am anderen Ende der Leitung, bevor sie etwas schnaufend fortfuhr: „Dieser Investor kauft also zu Billigstkonditionen Land auf, handelt mit kleinen Bürgermeisterlein, die mit solch großen Geschäften völlig unerfahren sind, alles zu seinen Gunsten aus. Natürlich – wie es in diesen Kreisen üblich ist – gegen ein angemessenes Taschengeld für das Bürgermeisterlein und weitere Angebote. Wie ich in Erfahrung bringen konnte, arbeitet das Unternehmen überall nach dem gleichen Muster und nutzt dazu ein ausgefeiltes und breitgefächertes Lobby-System.“
Puhh – Logistikmoloch, Lobby-System, Taschengeld, weitere Angebote, Schweigegebot, Golf-Connection, Geheimhaltung. Sollte ich mich für all diesen Kram interessieren? Ich wusste es nicht.
*
Trotz all des städtischen Weihnachtsschmucks lag das Rathaus an diesem Tag in einem tristen Grau, und ein ungemütlicher Regen prasselte gegen die Fassade. Um acht Uhr gingen die ersten Lichter in den Büros an. Langsam aber stetig belebte sich der historische Bau. Bürger kamen und gingen. Mitarbeiter huschten über die Flure. Türen schlugen und der Hausmeister schloss alle gekippten Fenster, da der Regen mit Wucht gegen die Scheiben klatschte.
Um zehn Uhr war Frühstückszeit, und etwa um diese Zeit herum öffnete Frau Demuth die Tür zum Bürgermeisterbüro einen kleinen Spalt und sagte halblaut: „Ich möchte nicht stören, Herr Groß, aber Ihr angekündigter Besuch, Herr Dr. Wüst, verspätet sich wahrscheinlich um eine Stunde und bittet um Entschuldigung. Ein Stau zwischen Friedberg und dem Gambacher Kreuz, zwei LKW aufeinander gefahren, schwerer Unfall. FFH hat schon berichtet. Kann sogar länger dauern, vermute ich.“
„Kommen Sie bitte einen Moment herein.“ Der Bürgermeister zog seine blau-grau gestreifte Krawatte auseinander, aber irgendetwas klemmte. Er bekam den Knoten nicht auf. „Nun gut, dann habe ich also noch ein wenig Luft zum Atmen ...“ Er rüttelte an seiner Krawatte, bis er sie endlich gelockert und erleichtert über den Kopf gestreift hatte, und beendete den Satz: „... und genügend Zeit zur Vorbereitung.“ Er sah jetzt auffordernd seine Mitarbeiterin an: „Noch etwas zur Wüst-AG herausgefunden, wo, wie und mit wem die welche Projekte betreiben?“
Die Vorzimmersekretärin trat vollends in das Groß-Büro ein. „Ich habe nur den Prospekt mit den vertraulichen Referenzen, den Projektbeschreibungen und Skizzen angeschaut. Sieht ja sehr solide aus. Überzeugend, würde ich sagen.“
„Ja, das finde ich auch. Sehr solides Unternehmen mit offensichtlich starkem Kapitalengagement.“ Das Wort, so fand Bürgermeister Groß, war großartig; er hatte es erst kürzlich gehört – Kapitalengagement. „Die sind dick im Immobiliengeschäft. Dahinter steht wohl auch ein arabischer Großinvestor.“
„Ein Wüstensohn“, warf Daniela Demuth lächelnd ein. Die blonde Mittvierzigerin warf sich in die Brust, denn sie war stolz auf ihre Assoziation: Wüst-AG und Wüstensohn.
Arturo Groß, Anfang Fünfzig, der im Dienst selten lächelte, konnte ein Schmunzeln nicht verhindern. „Jedenfalls haben die große Fische am Haken, ganz große Fische, Versandhäuser und Großhändler und so Zeugs. Ähnlich wie Amazon.“
„Was macht so ein Logistikzentrum im Einzelnen? Das wollte ich Sie schon letztes Mal fragen …“
„Wie gesagt, das ist ein Zentrum, von dem aus alles Mögliche verteilt wird. In diesem Fall geht es speziell um Kloschüsseln ...“ Er stockte kurz und sagte dann: „Dr. Wüst hat wohl ein Faible für Toiletten …“ Jetzt lachte Groß kurz und künstlich auf, bevor er mit ernster Miene fortfuhr: „Also, er hat connections zu einem Großhändler, der auf Kloschüsseln spezialisiert ist. Fragen Sie mich bitte nicht wie, was und warum.“
„Ach, die Wüst AG vertreibt die Dinger gar nicht in Eigenregie?“
„Nein, nein, die betreiben – wenn man so will – nur die Immobilie, investieren alles Nötige und vermieten dann gewinnbringend weiter. In diesem Fall wollen Sie an MyClo vermieten. Wie gesagt: ein Distributor von Kloschüsseln, von Dixi-Häuschen und allen möglichen Aborten. Europaweit werden Kloschüsseln geliefert. Also, ich nehme an, da die sich nur auf diese Scheißhäuschen konzentrieren, werden sie bald schon zur Liga der Global Player gehören. Und dann wird es in unserer Stadtkasse brummen, aber so richtig brummen.“
Arturo rieb sich mit freudig-geheimnisvoller Miene die Hände.
„Und die Toiletten werden auf der Langsdorfer Höhe produziert und dann verschickt?“
„Keine Produktion, kein lästiger Lärm und keine lästigen Emissionen, nein, da wird nur der Kram hingefahren, aufeinandergestapelt und wieder weggefahren.“
„Und das alles nur, um unseren Stuhlgang …“ Frau Demuth schaute ratlos den Rathauschef an.
„Raten Sie mal!“, sagte er grinsend. „Aber sicher, nur dafür! Das wird weltweit gebraucht. Das Geschäft läuft auf Jahrhunderte. Scheißhäuser! Eine krisenfeste Sache!“
So ordinär hatte Frau Demuth ihren Chef noch nie reden gehört. Für einen kleinen Moment stürzte ihr feines Männerbild vom tadellosen Chef ein, aber dann – sie dachte nach: War die Wortwahl nicht absolut verständlich, schließlich lag es an der Ware selbst, dass man das böse Wort auf die Zunge bekam. Sie schaute auf den mit Zetteln übersäten Schreibtisch des sozialdemokratischen Rathauschefs. Er bemerkte ihren suchenden Blick und sagte mit einer gewissen reuigen Demut: „Ich konnte mir heute meinen Kaffee noch nicht selbst machen. Ich mache mir jetzt ein Tässchen. Und Ihnen eine Tasse mit?“
„Bleiben Sie nur, ich mache das schon. Sie brauchen Ihre Zeit jetzt für Wichtigeres. Es ist Ihr erstes Treffen mit dem Chef der Wüst AG, da sollten Sie gut vorbereitet sein.“
Groß sah sie fragend an.
Ihre Stirn legte sich in nachdenkliche Falten, dann fuhr sie fort: „Es geht doch sicherlich um zig Millionen. Aber wem sage ich das! Vielleicht sollten Sie vorsichtshalber mit dem Pachtinteressenten der Wüst AG Kontakt aufnehmen, jener Firma mit diesem amerikanischen Namen ...“
Groß schnippte mit den Fingern und sagte: „MyClo! MyClo heißen die. Nebenbei bemerkt: Schicker Name für solch ein Geschäft, finden Sie nicht auch?“
„Ja, ja“, fuhr seine Mitarbeiterin fort. „Rufen Sie dort doch mal an.“
„Meinen Sie wirklich? Warum?“
„Nur so!“
„Nur so?“
„Na ja, ich meine eigentlich ...“ Sie druckste etwas herum, gab sich schließlich einen Ruck und sagte: „Und fragen Sie, ob es wirklich ein ernsthaftes Interesse an unserem Standort gibt. Nicht dass Dr. Wüst sich vertan hat. Alles klingt zu phantastisch. Diese enormen Gewerbesteuer-Einnahmen, von denen Sie mir letztlich eine Schätzung unterbreiteten. Ich habe die Zahlen übrigens wie gewünscht an die beiden Journalisten per Mail verschickt! Natürlich mit vorläufiger Veröffentlichungssperre. Dazu die Grundsteuer. Da kommt ja was zusammen! Das glaubt einem ja keiner! Sie wollen ja das Stadtparlament baldmöglichst auf Ihre Seite bringen, sobald Sie selbst von dem Vorhaben hundertprozentig überzeugt sind.“
Groß nickte nichtssagend. Er war bereits hundertprozentig überzeugt, wollte es aber noch nicht zeigen. Schon gar nicht gegenüber einer einfachen Schreibkraft.
Die Chefsekretärin bewunderte das Stadtoberhaupt. „Warum eigentlich?“, hatte kürzlich ihr eifersüchtiger Mann gefragt.
„Weil er zielstrebig ist. Weil er eine steile Karriere hingelegt hat“, hatte sie geantwortet. Sie hatte nicht einmal ihrem Ehemann von dem geheimen Vorhaben und dem in Aussicht stehenden Geldregen berichtet, obwohl es ihr auf der Zunge brannte.
Der Rathauschef hatte sie in die Geheimhaltungspflicht genommen. „Wenn etwas über die konkreten Absichten der Wüst AG vorzeitig herauskommt, Frau Demuth, kann das gesamte Projekt scheitern. Ich muss Sie ausdrücklich bitten, hundertprozentige Vertraulichkeit zu gewährleisten. Selbst Ihr Mann darf keine Einzelheiten von diesem Projekt erfahren.“
Daniela Demut hatte ihrem Chef in die Hand versprochen, eisern zu schweigen, damit das gute Vorhaben nicht vorzeitig von nörgelnden, aber völlig unwissenden Bürgern zum Scheitern gebracht werden konnte.
Ihr Mann war im Sinne von Arturo Groß tatsächlich ein Sicherheitsrisiko. Er mochte Groß nicht; er konnte ihn auf den Tod nicht leiden. Neulich hatte er ihn als einen typischen Politkarrieristen bezeichnet. „Menschen ohne echte politische Ideale versauen unsere politische Landschaft“, hatte er gemeint. „Sie denken nur an sich, nur an ihr eigenes Vorankommen, boxen die parteiinternen Idealisten aus dem Rennen, wenn es um Parlamentssitze geht. Die verkaufen ihre Seele und selbst ihre Großmutter, wenn es um ihre Karriere geht.“
Daniela Demuth schüttelte den lästigen Gedanken an jenen Disput mit ihrem eifersüchtigen Gatten ab und schaute den Rathauschef abwartend an. Groß warf ihr einen Vertrauen heischenden Blick zu. Frau Demuth lächelte beflissen zurück. Sie vertraute ihrem Vorgesetzten hundertfünfzigprozentig. Sie hielt ihn keinesfalls für einen Karrieristen. Oder aber nur dann, wenn man alle Parteileute zu Karrieristen erklärte, was jedoch nicht sein konnte, denn sie kannte darunter eine Menge armer Schweine. Sie hielt Herrn Groß für einen großartigen Politiker, weil er viel besser reden konnte als ihr Mann.
„Soll ich Ihnen außer dem Kaffee noch irgendeine Lektüre oder die Rufnummer von MyClo besorgen?“, fragte sie in der ihr eigenen Beflissenheit.
Bürgermeister Groß nickte dankend. Schon in ein paar Tagen würde er die Dame aus dienstlichen Gründen versetzen. Ein Personalkarussell war angesagt. „Wechseln Sie in nächster Zeit Ihre Sekretärin aus, ohne sie zu verprellen“, hatte ihm Dr. Wüst empfohlen. „Geben Sie ihr irgend einen ruhigeren Job ohne Gehaltseinbußen. Es ist in solchen Fällen wichtig, dass niemand aus der näheren Umgebung die Entwicklung in ihren gesamten Zusammenhängen erkennen kann. Sonst könnte man später leicht zum Opfer von Erpressungsversuchen werden.“
Als Frau Demuth die Tür hinter sich zugezogen hatte, steckte er sich die von Dr. Wüst spendierte Havanna an. Ein entspanntes, ja frohes Lächeln umspielte seine schmalen Lippen. Er rieb sich die Augen, eine der Kontaktlinsen saß nicht richtig. Während er vor dem Spiegel im Innenteil des Büroschrankes die Linse wechselte, ging ihm die Abmachung mit dem Investor durch den Kopf.
Gut, dass Wüst und ich das alles längst privat eingetütet haben. Man muss in diesem Land Theater spielen. Und es muss überzeugend sein. Und übrigens, seine Frau hatte es richtig auf den Punkt gebracht: Machen es die andern nicht genauso? Sogar in Berliner Kreisen wird gemauschelt und man ist sich gegenseitig beim Erklettern der Karriereleiter behilflich. Ist doch alles ganz normal. Er gab sich einen Ruck und berichtigte seine Gedanken: Mauscheln ist ein völlig falscher Begriff. Es geht um Geschäftsgeheimnisse, um nichts weiter! Groß war sich keiner Schuld bewusst. Er hat Probleme beim Anzünden der Zigarre; aber nun fiel ihm ein, dass er sie vorne etwas anschneiden muss.
Schon vor einem dreiviertel Jahr hatte das erste Geheimtreffen im Steigenberger stattgefunden, im legendären »Frankfurter Hof«. Das zweite Treffen war im Sommer erfolgt und war für Groß ausreichend großzügig verlaufen. „Ist nur eine kleine Aufmerksamkeit“, hatte der Investor gesagt. Bei der dann folgenden diskreten Begegnung, der bisher letzten, hatte Groß bereits die Ehre, die Kronberger Villa des Dr. Werner Wüst von innen kennen lernen zu dürfen. Nach ein wenig Palaver und einem alten Scotch waren sie per Du, und sie waren sich einig geworden. Der Deal sollte einfach und praktikabel sein.
Was beide wussten: Die zweite sechsjährige Licher Amtszeit für Groß lief bereits in knapp drei Jahren ab. Wiederwahl wäre zwar möglich gewesen, aber sie hatten andere Pläne … Groß musste aus dem Schussfeld genommen werden. Ein scheinbar neuer, unverdächtiger Mann musste her. Die verbleibenden Monate würden schnell vorbeiziehen. Es musste gehandelt werden; Groß musste jetzt handeln, schnell und umsichtig und sehr gut abgestimmt mit seinen parteiinternen Freunden und Feinden. Wenn er bis zum Ende seiner Amtszeit die Weichen für den Mammutbau im Stadtparlament durchgedrückt hatte, war ihm ein Managementposten im Wüst-Imperium gewiss.
„Aber wie kann ich sicher sein, dass Sie sich an unsere Absprache halten?“, hatte Groß gefragt und seinen Kopf skeptisch zur Seite geneigt.
„Ganz einfach“, hatte der AG-Boss lächelnd geantwortet. „Sie bekommen ab sofort, gewissermaßen auf Vorkasse, einen Beratervertrag, von dem niemand außer uns beiden und meinem Steuerberater, der ab sofort auch Ihr Steuerberater sein könnte, etwas erfährt. Die Steuerbüro-Kosten gehen natürlich auf meine Kappe. Das alles bleibt unter uns. Immerhin gilt noch das Steuergeheimnis. Und dieser Vertrag wird die Klausel enthalten, dass er hinfällig wird, sobald Sie auf einen Managementposten bei der Wüst-AG berufen werden. So handhaben wir das seit Jahren zur Zufriedenheit aller Beteiligten.“
Groß schaute jetzt auf seine To-do-Liste. Er musste zügig handeln. Heute das Show-Treffen mit Dr. Wüst. Morgen würde er dann den Fraktionsvorsitzenden seiner Partei informieren ebenso wie die Erste Stadträtin – noch unter dem Siegel der Verschwiegenheit. Dann wird er mit der Landrätin telefonieren, die er noch aus guten alten gemeinsamen Zeiten kannte – mit der Bitte um Vertraulichkeit, da dies nur als persönliche Vorab-Info verstanden sein sollte. Danach ein Gespräch mit dem Chef der Bauaufsicht des Landkreises, ein guter Parteifreund aus dem Nachbarort – ebenso streng vertraulich. Auf diese Weise, das war der Rat von Dr. Wüst, würde er ein geeignetes Netzwerk flechten können, um später auf genau dieser Vertrauensbasis zu den gewünschten Entscheidungen zu gelangen.
„Ein einfacher psychologischer Trick“, hatte Wüst schmunzelnd gemeint, jedoch ernsthaft hinzugefügt: „So funktioniert Netzwerk! Und zwar zum gemeinsamen Wohl von Politik und Wirtschaft. Niemand kann sich übergangen fühlen, wenn auf solch ehrliche und vorinformelle Weise verfahren wird. Das ist ein unabdingbarer demokratischer Wert. Und so ähnlich sollten wir …“ Er hatte einen Moment innegehalten, um die Reaktion des Bürgermeisters auf das unvermittelte »wir« zu testen, aber der Rathauschef hatte es gelassen hingenommen. „… so also sollten wir später auch mit den Fraktionsspitzen und behördlichen Entscheidungsträgern vorgehen. Man muss Vertrauen aufbauen!“
Mehr als eine Stunde war vergangen. Noch immer lag das Rathaus in einem tristen Grau, und der Regen prasselte gegen die Fassade. Die an den historischen Laternen befestigten Weihnachtssterne schaukelten im Wind und leuchteten noch nicht, obwohl der tief bewölkte Himmel keinen Lichtstrahl durchließ. Für Besucher wurde die Rathaustür abgeschlossen. Jetzt herrschte Mittagsruhe.
Um diese Zeit herum erreichte Dr. Wüst, der unmittelbar zuvor seine verspätete Ankunft telefonisch angekündigt hatte, das Rathausportal. Frau Demuth machte sich erwartungsvoll auf den kurzen Dienstweg zum Eingangsbereich. Gleich würde sie einem bedeutenden Investor die Tür öffnen. Solch einem wichtigen Menschen war sie noch nie in ihrem Leben begegnet.
Der Mittfünfziger beeindruckte Daniela bereits in den ersten drei Sekunden, obwohl er ihr nur bis zur Schulter ging. Klein, aber oho, dachte sie in diesem ersten Moment. Gewiss sehr durchsetzungsfähig. Es ist dieser kurze Moment, in dem man den wichtigen, den bleibenden Eindruck gewinnt. Der Mann war charmant, hatte ein gewinnendes Lächeln, wenngleich die Entschlossenheit in seinem Blick dem Lächeln die echte Offenheit nahm. Sie mochte ihn auf Anhieb. Der Mann machte etwas her. Er trug einen schwarzen Aktenkoffer bei sich.
*
Das Jahr neigte sich dem Ende zu. Ein ungewöhnlich warmer Sommer mit einer lang anhaltenden Dürreperiode lag hinter uns. Das Gipfeltreffen zwischen zwei Rocket-Men hatte stattgefunden. Grobes Thema der zwei Grobiane: Weg mit den Atomraketen. Donald Trump und Kim Jong-un waren sich fast um den Hals gefallen, taten der Welt aber nicht den erhofften Gefallen.
Im Gegenteil, sie rüsteten ihr Atomarsenal nicht ab sondern auf. Trump modernisierte seine Atombomben, brachte der Effektivität zuliebe seine Nuklearstreitmacht auf Vordermann. Kim spielte weiter mit seinen Mittelstreckenraketen, um sie für Langstreckentests weiterzuentwickeln und zum letzten Gefecht einsatzbereit zu machen.
Anfang Dezember zeigte AKK vollen Einsatz und erkletterte mit Angies Anschubhilfe den Parteivorsitz der Christenunion. Besondere Vorkommnisse? Nein. Oder waren nicht alles besondere Vorkommnisse? Im Jahresrückblick wurde das Wort des Jahres erwähnt. Die Gesellschaft für deutsche Sprache hatte entschieden: Wegen der monatelangen Trockenheit in Deutschland hatte es »Heißzeit« auf Platz eins geschafft. Auf Platz zwei landete die »Funklochrepublik«.
Der Moderator der Sendung erläuterte den Begriff, den ich zuerst für ein erfundenes Wortspiel in Anlehnung an »Eiszeit« hielt. Doch von »Heißzeit« reden Wissenschaftler tatsächlich, wenn die globale Durchschnittstemperatur langfristig um etwa vier bis fünf Grad Celsius steigt. Das Wetter war ungewöhnlich heiß gewesen, ich hatte es erlebt, wie auch diese merkwürdigen Gewitterkapriolen. „Am Himmel braute sich das düstere Szenario des Klimawandels zusammen“, fasste der Moderator zusammen. Ich konnte es bestätigen.
Silvester feierte ich nicht in meinem guten alten Heimatstädtchen Laubach, wo ich noch immer mein Zuhause hatte und manchmal meinem Hobby frönte und an Zeitreise-Romanen schrieb. Zu Beginn des Jahres hatte ich den ersten Serienband über die1968er-Jahre abgeschlossen: »Sexy Zeiten – 1968 etc.« Es waren schließlich entscheidende Aufbruch- und Umbruchjahre gewesen. Der Muff der alten Zeit wurde von der Jugend hinweggefegt. Auch die penetrante Prüderie wurde durch die sogenannte sexuelle Revolution ins Abseits gedrängt. Beate Use, Uschi Glas, Oswalt Kolle und solche Typen rückten ins Licht der Öffentlichkeit.
Die Frauenbewegung entstand und selbst der damalige Regierungschef, Willy Brandt von der SPD, forderte, man müsse endlich mehr Demokratie wagen. Es gab also viel zu berichten, Amüsantes wie Tragisches, Hoffnungsloses wie Hoffnungsvolles. Das Jahr 1968 feierte 2018 seinen Fünfzigsten. Und wie bei jedem Fünfzigjährigen, türmte sich mit den Jahren das eine oder andere Problem auf, an das in früheren Zeiten nicht gedacht worden war.
Gerade aber hatte ich den Folgeband über die Hippie-Zeit im Visier: »Wilde Zeiten – 1970 etc.« Die ersten 30 Seiten hatte ich heruntergetippt, aber mehrmals überarbeiten müssen. Das erste Kapitel war immer eine große Hürde, eine erste kritische Schwelle. Aber dann hatte ich die flippige, hippie-mäßige Covergestaltung samt den damaligen Jugendsprüchen entworfen, und das ließ mich vorwärts blicken. Wenn ich den Einband vor Augen hatte, stieg die Motivation zum Schreiben.
Auf dem Cover sollten typische Sprüche der damaligen Jugendkultur stehen: * Love & Peace * Keine Macht für niemand * Lieber gute Hippiefeten als US-Atomraketen * Behaltet euer Tränengas, es gibt genug zum Heulen! … Nun gut, wahrscheinlich kennen Sie das alles.
Aber dann unterbrach ich mein Hobby und ich verbrachte die Tage zwischen den Jahren bei meiner Liebsten in Lich. Am letzten Tag im Jahr saßen wir gemütlich vor ihrem Kamin. Und dann dachte ich spontan an eine TV-Sendung – ob es die noch gab?
Es gab sie noch. Nach Jahren der Abstinenz sah ich gemeinsam mit Stella wieder einmal »Dinner for one«. Es war wirklich immer wieder „the same procedure as every year.“ Wir schauten den Silvester-Klassiker, den wir seit unserer Jugend kannten und genossen – ohne rot zu werden.
Da stolperte der gute alte Butler James elfmal über den Kopf eines ausgelegten Tigerfells und Miss Sophie erwartete, dass James als Admiral von Schneider mit dem schwedischen Ausruf für Prost – Skål! – die Hacken zusammenschlug.
„Muss ich es dieses Jahr sagen, Miss Sophie?“
Miss Sophie: „Mir zuliebe, James!“
James: „Nur Ihnen zuliebe. Sehr wohl, ja, ja. Skål!“ Als die Füße des schon angetrunkenen James einander verfehlten, ließ es ihn straucheln, und Stella und ich amüsierten uns kindlich köstlich.
Dann waren Dinner, Tigerfell, James und Miss Sophie »over«. Und der anschließend ins Bild tretende Moderator zählte in altbewährter Routine wieder die Sekunden herunter. Wir stießen mit Sekt an, küssten uns und wünschten uns für die Zukunft viel Glück, Liebe und ein frohes Schaffen.
Hurra. Das Neue Jahr war da.
Damals 2019
Das Jahr begann mit einem Dienstag und endete ebenfalls mit einem Dienstag. Dazwischen gab es die Klimakrise, und wie im Jahr zuvor plagten lang anhaltende Hitze- und Dürrewellen, die zu neuen Rekordtemperaturen führten, die Welt. Ich hielt mich Anfang des Jahres des Öfteren in Lich auf; und dort arbeitete ich gelegentlich für den erwähnten Verlag noch einige Zeit später.
Im Städtchen wie auch anderswo schlug die Klimakrise hohe Wellen. Der Eissalon hatte Hochkonjunktur. Ansonsten blieb man Zuhause oder besuchte frühmorgens das Waldschwimmbad, wenn das Wasser noch relativ kühl und erfrischend war. Stella beschaffte sich eine mobile Klimaanlage. Die Maschine fraß viel Strom, kühlte jedoch merklich ihre Wohnung. Auch das geplante Logistikzentrum mit seinen gigantischen Ausmaßen und prognostizierten Nebenwirkungen sorgte für überschießende Hitze – bei den Gemütern. Doch dagegen half keine Klimaanlage. Die Bürger erregten sich zusehends und ihre Gemüter kühlten nicht ab.
Im Licher Wochenanzeiger las ich Anfang Mai erneut einen Leserbrief von jener Dame, die ich damals angerufen hatte.
Wer braucht so ein Monster?
Ein derart gigantisches Logistikzentrum am Ostrand unserer Stadt passt einfach nicht zu unserem kulturellen Selbstverständnis. Die Aufgabe unserer Stadtpolitik sollte es sein, ein 20 Meter hohes Monstrum zu verhindern und damit die Qualität einer historischen Kleinstadt wie Lich zu sichern und weiter auszubauen. »Binnen-Tourismus« könnte das Schlagwort der Zukunft lauten.
Wir verschandeln unser schönes Stadtbild, wir verpesten unsere Luft und werden eine CO2-Supermacht, eine Dreckschleuder. Was haben wir davon? Nichts außer einer Menge Schäden und Probleme! Das Brauerei-Areal umfasst 30 000 qm. Das geplante Monster aber verschlingt das Dreifache. Denkt nach, Stadtverordnete, und lasst euch nicht einwickeln! Und eine große Bitte: Verschaukelt uns nicht!
Edith Neuer-Süß, Lich
Ich las es Stella vor und sagte: „Die Frau ist irgendwie zu bewundern. Obwohl sie schon in Erfahrung gebracht hat, wer der Investor ist und was er so treibt, erwähnt sie ihn mit keinem Wort.“
„Vielleicht ist sie einfach nur feige.“
„Glaube ich nicht. Sie will das Pferd nur nicht von hinten aufzäumen. Im Moment hat die Stadt ja noch nichts über den Investor und seinen Namen verlauten lassen. Würde der von außerhalb ins Gespräch gebracht, würde die Diskussion darauf gelenkt, woher man das weiß, wo die undichte Stelle sitzt, und wie schrecklich unehrlich es sei, mit nicht gesicherten Auskünften zu hantieren und dergleichen. Ist schon klug von ihr.“
„Magst recht haben, Herr Superanalytiker“, sagte Stella und gab mir einen Kuss.
Ich drückte sie fest an mich. Dann nahm ich einen Schluck aus meiner Kaffeetasse, setzte den analytischen Superblick auf und sagte: „Es wäre ungewöhnlich, wenn sich jetzt nicht eine trotzige Gegenstimme hierzu äußern würde.“
„Wer will sich schon als Kaputtmacher outen? Ich bezweifele, dass sich auch nur ein einziger Monster-Befürworter öffentlich äußern wird.“
Eine Zeit lang blieb der Leserbrief der Frau Neuer-Süß unbeantwortet. In der Zwischenzeit hatten sich auch andere Leser gegen den Baukoloss ausgesprochen. Aber dann traute sich die Gegenstimme doch heraus. Sie kam. Und sie schlug ein wie eine Briefbombe.
Zum Leserbrief »Wer braucht so ein Monster?«
Kurze Antwort: Wir in Lich! Warum? Darum: Es gibt einen Großinvestor, der sämtliche Nebenkosten bezahlt, der sogar bereit ist, für einen teuren Verkehrskreisel am geplanten Logistikzentrum und dessen jährlichen Pflegeunterhalt aufzukommen. Diese Chance muss genutzt werden, sie kommt nicht alle Tage. Es ist ein Geschenk an uns. Wir müssen nur zugreifen und es dankbar annehmen.
Wollen wir verarmen? Keiner will von seinem Lebensstandard runter! Am wenigsten alle die, die grün angehaucht sind. Wer nutzt denn das Internet und die Handys und lässt sich die Pakete bis vor die Haustür liefern?
Das „Monster“-Vorhaben wird unsere Stadt nicht nur nichts kosten, sondern viel bringen: Steuer-Mehreinnahmen, neue Bürger, damit kommt Kaufkraftstärkung usw. Dieses Objekt müssen wir markt- und zukunftsorientiert betrachten, und wir sollten nicht den optischen Gefühlsausbrüchen der Ewiggestrigen unterliegen. Grüne Phantastereien sind jetzt völlig deplatziert. Im Leserbrief vom 2. Mai 2019 suggeriert uns die Schreiberin 20 Meter hohe Lagerhallen. Davon kann absolut keine Rede sein. Es geht um eine Gesamthöhe von höchstens 12 Metern für die Lagerhallen.
Der vielleicht etwas erhöhte Verkehr (es ist alles noch völlig offen!) wird unsere Innenstadt sowieso nicht tangieren. Ja, alle Veränderungen und Erfindungen in der Vergangenheit haben etwas Neues geschaffen und wurden anfangs skeptisch aufgenommen oder sogar abgelehnt, um nach einiger Zeit von Akzeptanz und Erfolg belohnt zu werden.
Ja, Lich braucht diesen Investor!
Ja, Lich kann mit dem »Monster« leben!
Gerald Alt, Lich
„Sehr lustig!“, meinte Stella. „Ein Ewiggestriger spricht in der ihm eigenen Betriebsblindheit von Andersdenkenden als den »Ewiggestrigen«. Als sei es altbacken, wenn man sich gegen ein Projekt ausspricht, das die Umwelt, unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden gefährdet. Ist es altbacken, wenn man etwas, was alte Kapitalistensäcke an ihrem Roulette-Tisch aushecken, ablehnt? Profit contra Menschen, sag ich nur!“
Stella hatte sich in Rage geredet. So kannte ich sie nicht. Sie starrte angewidert auf die Zeitung, aus der sie mir gerade den Leserbrief vorgelesen hatte.
„Rege dich bitte nicht auf. Nicht deswegen!“, versuchte ich sie zu beruhigen.
„Nun ist die Leserbriefschlacht eröffnet“, entgegnete sie, ohne auf meinen Versuch einzugehen.
„Willst du dich vielleicht mit einem eigenen Leserbrief einmischen?“ Ich sah sie fragend an. Und einen kurzen Augenblick lang blickte mich Stella mit ihren großen braunen Augen an, zweifelnd, ob sie es tun sollte.
Dann schüttelte sie entschieden den Kopf und meinte: „Bringt eh alles nichts. Was kümmert die Monstertypen die Meinung von uns Kapital- und Namenlosen?“
Ende Mai antwortete Leserbriefschreiberin Edith dem Monsterbefürworter Gerald in der gleichen Zeitung.
Der Leserbrief des Herrn Alt bedarf einiger Klarstellungen. Ich suggeriere keine 20 Meter hohen Lagerhallen – diese Höhe ist im Entwurf des Bebauungsplans als mögliche Höhe angegeben. Warum sollte sie der Investor nicht ausschöpfen, wenn man es ihm freiwillig anbietet? Je mehr Quadratmeter pro Fläche desto höher sein Gewinn.
Noch immer ist die Frage nicht geklärt, wer der tatsächliche Nutzer sein wird. Warum die Geheimniskrämerei? Und machen wir uns nichts vor: Das GESAMTE Stadtgebiet samt Umgebung, samt Stadtteilen und Zufahrtsstraßen für unsere Pendler wird vom LKW-Verkehrsfluss berührt werden.
Ein Geldsegen steht bei solchen Logistikzentren für unsere Stadt überhaupt nicht in Aussicht. Der Geldsegen regnet nur auf den Investor herab, für uns bleiben Brotkrumen übrig, wenn überhaupt. Vielleicht zahlen wir noch drauf, wie es an anderer Stelle bereits der Fall war. Und wer glaubt überhaupt, dass die oder das Pachtunternehmen seinen Firmensitz in Lich haben wird? Hier wird nur die billige Zwischenlagerung betrieben und der Verkehrsdreck auf uns abgeladen. Mehreinnahmen? Da lachen ja die Hühner. Nur die Rebhühner lachen nicht mehr, denn die sind dann von der Langsdorfer Höhe vertrieben.
Wer sich meiner Kritik mit einem Appell an unsere gewählten Stadtverordneten anschließen möchte, den bitte ich, sich in die demnächst ausliegenden Unterschriftslisten einzutragen.
Edith Neuer-Süß, Lich
Es war ein fast schon hochsommerlicher Samstag, als mein Arbeitskollege und neuer Freund Benjamin Carl und ich den ersten Sturm kurz nach fünf Uhr aus Richtung des Klosters Arnsburg heraufziehen sahen. Wir dachten jedenfalls, dass es ein Sturm werden würde. Das Wolkenband wirkte außerordentlich bedrohlich. Ben strich sich mit bedenklicher Miene über die Haare, die ich nicht hatte. Er rasierte sich im Gegensatz zu mir keine Glatze, was mich morgens viel Zeit kostete. Er trug die erstaunlich vielen Überbleibsel seiner graumelierten Haare als „jugendlichen Restbestand meiner ehemaligen Beatles-Mähne“ mit Stolz, wie er mir einmal lachend gestanden hatte. Dabei hätte er überhaupt nichts gestehen müssen. Eine Beatles-Mähne war damals ein halbes Verbrechen, aber heute?
Ben trug einen akkuraten Vollbart, so ein Mittelding zwischen Rauschebart und Drei-Tage-Bart, ganz im Gegensatz zu mir, der ich auf so wenig Behaarung wie möglich Wert legte. Es war mir zu nervig, einen Bart zu trimmen und zu pflegen und außerdem juckte er immer.
Ben war fünf Jahre älter als ich, setzte sich wie ich beim kleinsten Sonnenschein stets eine Sonnenbrille auf die Nase, und er war ein echter Kumpel. Er hatte früher als Vermessungsingenieur gearbeitet und half nun nebenbei, nach seiner Verrentung, im Verlagswesen mit. Korrekturen, Recherchen, Ablage- und Archivarbeiten, Zusammenstellung von Dokumentationen und all solch feine Sachen übernahm er. Was immer an Arbeit anfiel, erledigte er im Handumdrehen, gewissenhaft wie er war.
Wir hatten gerade unsere zehn Abschlussrunden im Waldschwimmbad gedreht. Noch eine Stunde vorher war es völlig windstill gewesen. Die Hitze lastete schwer und drückend auf uns und auf den anderen Schwimmbadgästen. Vier der anderen Gäste, bei denen Ben und ich gesessen hatten, luden uns zu ihrem Grillabend nahe des Bürgerhauses ein. Ben kannte sie seit mehreren Monaten, genauer gesagt: seit den ersten Nachrichten über das geplante neue Verteilzentrum.
Bens Freunde waren allesamt gegen den Koloss, den man mitten in die Natur pflanzen wollte. Thema des Abends sollte also das Logistikzentrum sein, gegen das seit Anfang des Jahres unentwegt protestiert wurde. Man hatte eine Bürgerinitiative gegründet. Irgendwie interessierte mich das Thema zwar – auch weil Stella letztlich so energisch Partei ergriffen hatte. Aber ehrlich gesagt, berührte es mich nicht sonderlich. Nun gut, immerhin, es wurde ja am Abend gegrillt.
„Wird wohl nix mit dem Grillabend“, rief Ben in diesem Augenblick dem Vorsitzenden der neuen Bürgerinitiative, Lothar Balser, zu und deutete in Richtung der Gewitterwolken.