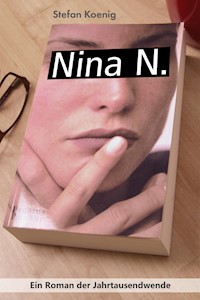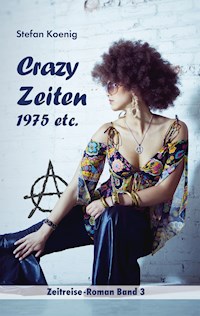9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Zeitreise-Roman
- Sprache: Deutsch
Die Jahrtausendwende. Was würde sie uns bringen? Die Hell- und Schwarzseher hatten Hochkonjunktur. Aber das Internet und die Computer hielten dem Jahrtausend-Virus und der Änderung der digitalen Zeitangabe stand. Der Weltuntergang blieb aus. Wir feierten im Laubacher Schloss. Die Mittelaltermärkte blühten auf. Dort zahlte man in Taler. Doch schon stand der Euro vor der Tür. Das Schul- und Bildungssystem stand auf dem Prüfstand. Ein Schulroman schlug Wellen. Der grüne Außenminister bekam einen roten Farbbeutel ab. Prinz Philip trat ins übliche Fettnäpfchen. Kanzler Kohl verkohlte uns mit dem Ehrenwort. Banken halfen beim Steuerbetrug. Ehen scheiterten. Betrüger feierten Partys. In Washington tagte die Fünferbande des neu gewählten Präsidenten in geheimer Mission. Nostradamus ist ihr Berater. Wir sind mit unseren Pubertieren und dem Älterwerden beschäftigt. Hält uns die Musik jung?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 437
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Stefan Koenig
Kuriose Zeiten - 1999 etc.
Zeitreise-Roman
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Kuriose Zeiten - 1999 etc.
Einen spannenden Roman schreiben
Gert Postels Prozess
Verlassen im Verlies
Würdelos im Gericht
Natascha Kampusch
Teletubbies, NATO & Familienbetriebsrat
Romanfiguren führen ein Eigenleben
Gustl Mollath in Nürnberg
Jugoslawien & der kollektive Westen
Warmer Sommerregen
Verlies in Wien
Monika Böttchers letzter Prozess
Party & Peterchens Mondfahrt
Grünes Gras und hoher Himmel
Kohls Blackout
Der Fall Barschel zieht sich hin
Maschendrahtzaun
Postels zweiter Brief
Silvesterparty im Schloss
2000
Eklat um Nina N.
Über sieben Brücken …
Ein Pubertiergeburtstag
Die Schule dreht durch
Maschendrahtzaum-Thriller sorgt für Furore
Betrüger in Südafrika & Entführer in Wien
Postels Prozessstory
Auf Verlagssuche
Oberstaatsanwalt Wille & Barschels Tod
Happy Pubertier-Day!
Die Fünferbande in Washington
Natascha als Haushaltshilfe
Unser Musiklehrer Witold
2001
Der Außenminister & das Mordwerkzeug
Unterwegs als Retter einer Fabrik
Leben wie ein Faultier
Vordenker einer Katastrophe
Osama Bin Laden
Die Einschulung
Richtig oder falsch oder nichts von beidem?
Statt einer Nachbemerkung
Dank
Falls es Sie interessiert …
Impressum neobooks
Kuriose Zeiten - 1999 etc.
Stefan Koenig
Kuriose Zeiten
1999 etc.
Zeitreise-Roman
Band 14
© 2023 by Stefan Koenig
Lektorat:
Markus Bender, Lohra
Mail-Kontakt
zum Autor:
Irgendwie irgendwo irgendwann
Im Sturz durch Raum und ZeitRichtung UnendlichkeitFliegen Motten in das LichtGenau wie du und ich
Irgendwie fängt irgendwannIrgendwo die Zukunft anIch warte nicht mehr langLiebe wird aus Mut gemachtDenk nicht lange nachWir fahren auf FeuerrädernRichtung Zukunft durch die Nacht
Gib mir die HandIch bau dir ein Schloss aus SandIrgendwie irgendwo irgendwannDie Zeit ist reif für ein bisschen ZärtlichkeitIrgendwie irgendwo irgendwann
Im Sturz durch Zeit und RaumErwacht aus einem TraumNur ein kurzer AugenblickDann kehrt die Nacht zurück
Irgendwie fängt irgendwannIrgendwo die Zukunft anIch warte nicht mehr langLiebe wird aus Mut gemachtDenk nicht lange nachWir fahren auf FeuerrädernRichtung Zukunft durch die Nacht
Gib mir die HandIch bau dir ein Schloss aus SandIrgendwie irgendwo irgendwannDie Zeit ist reif für ein bisschen ZärtlichkeitIrgendwie irgendwo irgendwann
Gib mir die HandIch bau dir ein Schloss aus SandIrgendwie irgendwo irgendwannDie Zeit ist reif für ein bisschen ZärtlichkeitIrgendwie irgendwo irgendwann
Irgendwie irgendwo irgendwannIrgendwie irgendwo irgendwannIrgendwie irgendwo irgendwann
Song von Nena, 1984
Es war März und ein Tag wie jeder andere. Mein Tag fängt in der Woche um Viertel vor sieben Uhr an, wenn der Wecker klingelt. An jenem Donnerstag fehlte die Viertelstunde und es war bereits sieben Uhr, weil eines der Kinder am Abend zuvor meinen Wecker in die Hand genommen hatte, um festzustellen, dass der ja noch gar nicht digital sei. War er aber. Jedenfalls wanderte er von Kinderhand zu Kinderhand. Von der sechzehnjährigen Karola zum fünfzehnjährigen Luca bis hin zur sechsjährigen Jenny.
Wer immer am Vorabend am Rädchen gedreht haben mochte, jetzt hatte ich den Salat. Ich hatte es verdammt eilig. Am frühen Morgen sind fünfzehn fehlende Minuten so lange wie die gefühlte Wartezimmerzeit beim Doktor.
Alle schliefen noch selig. Ich stand auf und schaute aus dem Fenster. Noch war dieser Märztag trocken, aber in den ZDF-Nachrichten von gestern Abend hatte man Regen angesagt. Als erstes machte ich Emma mit einem sanften Küsschen auf die Stirn wach und bat sie, Karo zu wecken und sich anschließend um Jenny zu kümmern, während ich den schläfrigen Luca ins Visier nahm. Ich weckte ihn das erste Mal um Punkt zwei Minuten nach sieben Uhr. Um diese Zeit drängeln bereits achtzig Prozent unserer Mitbürger vor Badezimmern und begehren Einlass oder befinden sich im Inneren des Badezimmers und ignorieren beharrlich das beharrliche Klopfen. Oder sie setzen in der Küche Kaffee- oder Teewasser auf und vergessen dabei den Herd anzustellen. Die restlichen zwanzig Prozent haben Urlaub oder befinden sich im Stau oder haben sich krankschreiben lassen und schaffen es einfach nicht aus dem Bett. Oder sie befinden sich in der Pubertät.
Ich schaltete die Deckenbeleuchtung in Lucas Zimmer an, aber das Pubertier reagierte darauf nicht, denn es befand sich zu neunzig Prozent unter der coolen Homer-Simpson-Bettdecke, unter der es noch stockduster sein musste. Ich ging nun auf das Bett zu und stolperte dabei über ein unter dem Bett hervorragendes Skateboard. Ich fing mich gerade noch ab und landete mit der rechten Hand jedoch in einer Plastikschüssel, in der sich entweder eine merkwürdig riechende Seifenlauge, garniert mit kleinen Gummistückchen, oder ein mehrere Tage altes Müsli befunden haben musste. Ich verzichtete bei Unterdrückung eines morgendlichen Würgegefühls auf eine Untersuchung und brach den Versuch, bis zu meinem schlafenden Pubertier vorzudringen, vorerst ab.
Stattdessen ging ich zum Fenster, öffnete es, zog den Rollladen hoch und sang dazu so schräg ich nur konnte den Nana-Mouskouri-Song »Guten Morgen Sonnenschein«. Schräg singen kann ich gut. Und Texte verhunzen gelingt mir auch, insbesondere, wenn ich damit Pubertiere ärgern kann. Also sang ich:
Guten Morgen, guten MorgenGuten Morgen, LucaleinDiese Nacht blieb dir verborgenDoch du darfst nicht traurig seinGuten Morgen, LucaleinNein du darfst nicht traurig seinUnd jetzt komm‘, oh SonnenscheinWeck ihn auf und komm herein
Alles kannst du ja sehen
Auf dieser Erde, auf dieser Erde
Doch nun ist es geschehen
Dass ich auch ohne dich glücklich werde
Die allerschönsten Stunden
In meinem Leben, in meinem Leben
Hab ich heut Nacht gefunden
Du hast geschlafen, so ist das eben
Spätestens bei dieser Strophe wäre ich als Fünfzehnjähriger damals hellwach geworden und hätte neugierig den Kopf aus der großen Homer-Simpson-Windel gewunden. Aber nein, Luca wälzte sich nur von einer zur anderen Seite, und ich hörte aus seiner Richtung ein fernes Murren und Knurren. Wahrscheinlich werde ich für diesen Song später zur Strafe nicht im Altenheim besucht. Oder man enthält mir die Enkel vor. Ich ging in die Küche und begann das Frühstück für uns alle vorzubereiten.
Fünf Minuten später stand ich wieder vor seinem Bett. Diesmal in rutschsicherer Entfernung. Das Pubertier schlief tief und fest. Ich stellte seinen CD-Player an und Xavier Naidoo erschallte mit seichtem Stimmlein »Sie sieht mich nicht«. Das passte irgendwie zur Situation, obwohl ich eindeutig ein Er bin. Aber jetzt wühlte ich mich todesmutig durch fremdes Gelände, durch Bettzeug, schmutzige Wäsche, frische Klamotten und eine Unmenge Magazine und Heftchen, um schließlich am Ende des Dschungels das Pubertier am Ohr zu kitzeln. Das wurde vom Pubertier als akzeptable Weckmethode nicht anerkannt. Es zog sich weiter in seine Bett-Windel zurück. Es war jetzt bereits 7:12 Uhr.
In hilfloser Verzweiflung erging drei Minuten später meine „letzte Aufforderung“, jetzt aber wirklich der Nacht gute Nacht zu sagen und dem Morgen einen guten Morgen zu wünschen. Um 7:17 Uhr erfolgte der dritte Weckversuch mittels Kitzeln der Fußsohle, was sieben tausendstel Sekunden später zur erhofften, explosionsartigen Aktivität des Pubertiers führte. Jetzt zeigte Luca seine sportliche Ader, indem er mit einer einzigen athletischen Bewegung die Decke zurückschlug, aufsprang und mit dem Kissen eine Korbball-Attacke ins Ziel, nämlich gegen meinen Kopf, startete. Aber ich war schneller. Ich gab ihm einen Korb und verschwand mit den Worten: „Das Frühstück steht schon auf dem Tisch und der Bus fährt in achtzehn Minuten.“
Natürlich gab es keine Busverbindung zwischen der Andree Allee 8, wo unser Zuhause war, und der Andree Allee 14, wo die Schule stand. Die eine Minute Gehweg war locker zu Fuß zu schaffen. Aber Luca konnte über meinen Scherz nicht lachen.
Emma und die beiden Mädels saßen derweil beim Frühstück und schauten mich fragend an. „Was ist?“, sagte ich und dachte an mein gerade beendetes Abenteuer.
„Warum hast du die Kochplatte nicht angestellt? Glaubst du, das Wasser wird von alleine heiß?“, fragte Karola.
Diesmal war ich schlagfertig, gestählt durch den Kurztrip in einen versifften Dschungel, und antwortete meiner computerbegabten Tochter, die diesbezüglich stets update war: „Ich dachte, dass du als hochtechnologisch-geschulte MacIntosh-Expertin einen Trick herausgefunden hättest, wie man den Herd automatisch ansteuern kann. Ich war davon ausgegangen, dass du unsere Frühstückszeit samt der Kochzeit des Wasser bereits einprogrammiert hast.“
„Du wirst dich wundern, aber in einigen Jahren funktioniert so etwas wirklich.“
Ich lachte. „Natürlich, du hast ja den Blick in die Zukunft abonniert. Hatte ich total vergessen.“
Emma entschärfte das kurze Wortgefecht und fragte: „Gibt es nicht mal etwas Schönes zu berichten?“
„Das männliche Pubertier hat offene Augen, sagt, man habe es viel zu früh geweckt und verbreitet neben Mundgeruch eine gute Portion schlechte Laune. Es ist also hellwach.“
Emma und Karo schüttelten verständnislos den Kopf, und Klein-Jenny schaute fragend zur Tür. Auch ich schaute hin – und dann begriff ich: Luca hatte sich noch einmal hingelegt. Genervt erschien ich erneut in seinem Zimmer, wagte ein paar Schritte ans Bett, riss die Bettdecke weg und schmiss mit Worten um mich, die keines Autors würdig sind. Das bereits angekleidete Pubertier sprang nun putz-munter aus dem Bett und verließ unter Protest, dass es nicht einmal in Ruhe frühstücken könne, das Haus.
Merkwürdiger Weise ist es noch nie zu spät in die Schule gekommen.
Nachdem die Kids außer Haus und – wie wir hofften – gut untergebracht waren, setzte ich mich traditionell mit Emma noch einmal an den Frühstückstisch, um bei einer Tasse Kaffee in Ruhe den vor uns liegenden Tag zu besprechen. Wir teilten die Arbeit ein und auf uns auf. Dieses Mal brauchte ich nicht darum kämpfen, dass meine Schreibarbeit tatsächlich Arbeit und kein Vergnügen ist. Emma sieht das manchmal anders, einfach deshalb, weil mir meine Arbeit Freude bereitet.
„Das ist ein Hobby und keine echte Arbeit, du könntest mal wieder die obere Etage putzen“, sagt sie dann.
Da ich erst vor drei Tagen alle drei Etagen gesaugt und die Treppen nass gewischt und dabei meine Klamotten total verschwitzt und sogleich in die Waschmaschine gestopft und aufgrund der unmäßigen Masse an verdreckter Kinderkleidung drei Waschgänge getätigt hatte, konnte ich heute also beruhigt meiner Schreibarbeit nachgehen. Meine Frau war nachsichtig.
Beunruhigend ist allerdings, dass selbst unsere klugen und ach so intellektuellen Freunde aus Laubachs Honoratiorenkreis meine Arbeit heimlich belächeln, weil auch sie denken, einen Roman zu schreiben sei so schrecklich einfach, so schrecklich schön, erholsam und so genüsslich, wie einen Film anzuschauen. Eigentlich eine Sache, die man aus dem Handgelenk schüttelt. Beim gestrigen Treffen hatte ich jedenfalls diesen Eindruck.
Da hat man jedoch meine Ausführungen offensichtlich gründlich missverstanden. Ich hatte gesagt, dass sich beim Schreiben ein Film abspult, den man jedoch als Regisseur samt seinen Romanfiguren – in der Rolle als Schauspieler – regelrecht vorab aufwendig planen muss. Sehr detailliert planen muss! Sonst erntet man Chaos. Und erst dann folgt die mühsame Umsetzung mittels Schreibarbeit. Erst wenn man als Autor im eigenen Kopf während des Schreibvorgangs eine bildhafte Sprache wie in einem Film entwickelt hat, kann sich später im Kopf des Lesers ein eigenständiger (Roman-)Film entwickeln. Das sei allemal kreativer und emotional tiefer gehend als einen Kino- oder TV-Film bloß zu konsumieren, dozierte ich. Denn im konsumreifen Film ist die Bildsprache bereits umgesetzt, gefiltert und wird dem bequemen Betrachter vorbereitet serviert. Beim Lesen eines Romans ist der Leser zwar ebenfalls Konsument, Text-Konsument, aber zugleich ist er eigenständiger Kopf-Film-Produzent – und das macht’s!
Ich hätte genauso gut vor einem Kreis aus Winterreifen dozieren können. Nur hätten die nicht so mild gelächelt, aber immerhin Profil gezeigt.
Der bisher trockene Märztag wandelte ab neun Uhr sein Gesicht und es begann zu schütten. Ich nahm mir ein Stövchen und eine Kanne Jasmin-Tee mit nach oben in die Schreibstube. Heute schrieb ich weiter an meinem Schulroman »Nina N.«. Ich hatte die Idee, meine Leserschaft mit auf die Reise des Schreibenlernens zu nehmen. Zugleich war ich selbst ja noch ziemlich unbedarft als Romanautor und hatte eine gute Portion zu lernen. Wenn ich meine Protagonistin Nina im Romangeschehen einen VHS-Schreibkurs besuchen ließ, weil sie ihre Memoiren niederschreiben wollte, dann würden meine Leser mitverfolgen können, was in solch einem Schreibkurs vermittelt wird – und Nina könnte ihre Zeit, bis sie einen Job als Lehrerin gefunden hat, sinnvoll füllen.
Einen spannenden Roman schreiben
Auch ich könnte mich somit parallel weiterbilden. Jedenfalls hinsichtlich der Frage, wie man einen spannenden Roman zu schreiben hat – also hätte ich wahrscheinlich drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich trank einen Schluck meines Lieblingstees und legte los:
***Es war kurz vor Kursbeginn, als Nina auf die kreisförmige Zufahrt des rotfarbenen Backstein-baus abbog. Die Sonne war bereits hinter den kleinen Fachwerkhäusern untergegangen, aber der Himmel war noch hell. Sie fühlte sich energiegeladen und stieß die Tür zum Seminarraum eine Spur zu kräftig auf. Alle Blicke richteten sich auf die Neue. Ihr Haar hatte sie heute zusammengebunden. Sie trug ein Kostüm in ihrer Lieblingsfarbe, dunkelblau, dazu in gleicher Farbe Wildlederschuhe mit dezenten, halbhohen Absätzen. Es war bereits der zweite Seminarabend. Nina setzte sich auf einen freien Platz in der ersten Reihe. Die Tische standen in einem geschlossenen Kreis. Vorne, an der Stirn-seite der Wand, wo das Flipchart vor den Bücher-regalen stand, saß der Dozent.
»Was glauben Sie, ist das Wichtigste an einer Geschichte?«, fragte er, nachdem er mit einem Kopfnicken die Neue auf seiner linken Seite registriert hatte. »Die Formalitäten erledigen wir im Anschluss«, flüsterte er ihr zu, denn sie saß nur zwei Sitze von ihm entfernt.
Auf dem Flipchart hinter ihm standen mehrere Begriffe und Stichworte, die mit Strichen und Einrahmungen in Verbindung standen – Fiktio-nale Literatur – Wetteifern mit Gott – Erschaffung faszinierender Menschen – Handlungsaufbau – Schmelztiegel – Span-nung.
»Dass die Geschichte stimmt, also die Glaub-würdigkeit der ganzen Sache«, antwortete eine brünette Mittzwanzigerin, die Nina gegenübersaß. Beide sahen sich an, und Nina nickte ihr zustim-mend zu.
»Richtig. Noch etwas?«, fragte der Dozent.
»Na ja, spannend muss die Story sein. Wenn es früher dem Medizinmann nicht gelang, seine Zu-hörer in gespannte Erwartung zu versetzen und er dennoch seinen Text herunterleierte, so wurde er zum Teufel gejagt. Und das ist heutzutage nicht anders«, meinte der dunkelhaarige Mann neben Nina. Er mochte so um die Dreißig sein.
Der Dozent nickte.
»Uns geht es viel besser als allen Medizinmän-nern zusammengenommen«, brummte der Mann neben Nina mit einem angenehmen Bass in der Stimme. »Wenn es uns nicht gelingt, das Interesse unserer Leser zu wecken, droht uns schlimmstenfalls das Schicksal, keinen Verleger für unser Manuskript zu finden.«
»Sie sind auf dem richtigen Weg«, ergänzte der Dozent, »auf dem Weg der Spannung, denn Spannung ist das A und O der Handlung einer jeden Geschichte.«
Der Dozent hieß Dr. Leo Breitenbach und war vierundfünfzig Jahre alt, hauptberuflich Abteilungs-leiter beim Staatlichen Schulamt, zuständig für Per-sonaleinstellungen an den örtlichen Grund- und Gesamtschulen sowie den Gymnasien. Seit dem Tod seiner Frau vor zwölf Jahren war er alleinstehend und besserte sein Gehalt, seinen Lebensinhalt und seine Selbstbestätigung durch diese Passion auf.
»Sie können eine fabelhafte Phantasie haben und mit faszinierendem Stil schreiben und Figuren der Superlative erfinden, aber wenn Sie den Leser nicht bald an seiner unersättlichen Neugier packen, wird er Ihre Geschichte zur Seite legen und nie wieder weiterlesen«, dozierte Dr. Breitenbach, und er fuhr mit den viel zu kurzen Beamtenfingern durch den Rest seines Haares.
Eine Teilnehmerin räusperte sich und wollte etwas sagen. Dr. Breitenbach ermunterte sie durch ein sanftes Nicken.
»Ich habe vor zwei Wochen einen Roman gelesen, den ich nicht mehr weglegen konnte.«
»Mir ging es so ähnlich«, ergänzte eine andere. »Ich konnte meinen Lieblingsroman immer erst dann aus der Hand legen, wenn ich aufs Klo musste.« Die Kursteilnehmer lachten und redeten für einen kurzen Moment durcheinander.
Der Dozent lächelte zufrieden. Das wollte er hören. »Genau darauf kommt es an. Der Leser muss sich so in Ihre Geschichte vertiefen, dass er das Buch nur aus der Hand legt, wenn sich die Realität mit Gewalt bemerkbar macht.«
»Aber ist es nicht unfair, den Leser irrezuführen und auf die Folter zu spannen, nur um Spannung zu erzeugen?«, fragte Nina Nowak. Doch die Unruhe im Raum machte ihr deutlich, dass sie den ersten Kurstermin versäumt hatte.
Dr. Breitenbach stand auf, sah sie an, blätterte eine Seite des Flipcharts zurück und zeigte aus zwei Metern Entfernung mit seinem silbergrauen Laser-pointer auf die mit grünem und rotem Stift geschriebenen Stichworte: Autor erzeugt Span-nung – nicht auflösen – drohende Gefahr nur überwinden, um unvermittelt mit noch größerer Gefahr zu konfrontieren – Auf-gabe des Autors ist es, boshaft zu sein – Leser Nervenkitzel verschaffen, den er im Buch sucht und im wirklichen Leben verabscheut – Erwartungen des Lesers immer wieder enttäuschen.
»Machen wir Schluss für heute«, sagte er. »Überlegen Sie sich bis zum nächsten Mal eine spannende Story, am besten etwas Fiktives, das real sein könnte – vielleicht eine mysteriöse Geschichte aus ihrem eigenen Leben.«
Was Dr. Breitenbach jedoch nicht wusste, war, dass eine seiner Teilnehmerinnen keine Geschichte erfinden musste. An diesem Abend, Ende April, als er von Nina die Kursanmeldung annahm und sie ansah, fing er das erste Mal nach Jahren der Abstinenz wieder Feuer.***
Es war jetzt zwölf Uhr. Ich war nun zwei geschlagene Stunden mit jenem Buch für angehende Romanautoren beschäftigt gewesen, das mir unsere Freundin Elke empfohlen hatte: »Wie schreibe ich einen spannenden Roman«. Dann hatte ich mit dem Schreiben begonnen und weitere sechzig Minuten für knapp drei Seiten gebraucht. Ich war vorerst zufrieden, aber ich hatte mir für heute zwanzig Seiten vorgenommen. Ich musste also noch mindestens sechs Stunden schreiben. Doch erfahrungsgemäß ging es auch flotter, wenn ich mich erst im Schreibfluss befand. Gerade wollte ich meinen Künstler-Freund Meise in Hamburg kurz anrufen, denn um diese Zeit war er ganz sicher wach und zu Hause noch gut erreichbar. Ich wollte ihn fragen, wann er hier aufzuschlagen gedenke, als ich Emma im Treppenhaus nach mir rufen hörte. Ich ging hinunter, wo sie aufgeregt an der Haustür stand.
„Ich glaube, Adele liegt im Sterben. Schau mal.“ Sie zeigte vor das Garagentor, und wir eilten sofort zu unserem Neufundländer-Liebling. Adele war es seit einigen Monaten nicht mehr gut gegangen, sie hatte häufig Urin verloren, war von Mal zu Mal orientierungsloser geworden und hatte noch nicht einmal mehr Lust auf ein kleines Gassi mit mir oder mit Emma über den nahegelegenen Ramsberg. Das war immer ihr bevorzugtes Revier gewesen. Seit zwei Tagen hatte sie das Fressen verweigert.
Unser Tierarzt in Freienseen hatte uns seelisch darauf vorbereitet, dass damit eine Abschiedszeit eingeläutet sei und er dann, wenn es für Adele quälend werden würde, die erlösende Spritze geben würde.
„Ich glaube, es ist so weit“, sagte Emma.
Ich nickte und kniete mit Emma neben Adele. Adele lag auf der Seite, atmete schwer und röchelnd und bewegte sich in einer völlig ungewohnten Weise, als wolle sie etwas aus sich herausdrücken. Es war offensichtlich, dass sie sich quälte. Wir riefen den Tierarzt an. Er wolle bald kommen, allerdings dauere es noch einen Moment, wir sollten bei Adele bleiben. Das war für uns selbstverständlich. Der Moment zog sich für uns hin, aber dann erschienen auch schon Karola und Luca, die Schulschluss hatten. Sie kamen sofort zu uns und wir klärten sie über die Situation auf. Beide knieten sich neben Adele, streichelten sie liebevoll und schmusten noch so lange mit ihr, bis der Arzt kam. Dann schickten wir sie ins Haus.
Adeles Erlösung erlöste auch uns, denn wir hätten ihre Qual nicht länger mitansehen können. Der Tag war damit gelaufen. Ich ließ das Schreiben an diesem Tag ruhen. Die Trauer war zu groß. Fünfzehn Jahre lang hatte uns das treue Tier begleitet und unser Familienleben mitgeprägt. Luca, der sich wohl am meisten mit Adele verbunden fühlte, war völlig daneben. Aber auch Karola und Jenny trauerten und gingen an diesem Tag nicht aus dem Haus bis Adele am Abend abgeholt wurde.
Mir fiel eine Songsequenz von Reinhard Mey ein, aus seinem 1987 veröffentlichten Antikriegslied »Nein, meine Söhne geb‘ ich nicht«. In dieser Sequenz erzählt er, was er seinen Söhnen mit auf den Lebensweg gegeben hatte: „Ich habe sie die Achtung vor dem Leben, vor jeder Kreatur als höchstem Wert gelehrt. Ich habe sie Erbarmen und Vergeben und – wo immer es ging – lieben gelehrt.“
Ja, alle drei Kinder liebten Tiere und die Natur. Was sie noch nicht kannten, waren Künstlertypen wie meinen zehn Jahre älteren Freund Meise.
Am nächsten Vormittag kündigte Meise seine Ankunft für das Wochenende an. Er strömte stets eine künstlerische Aura aus, ergänzt von seinem lockeren Humor. Gerade in diesen Tagen, wo uns Adele so arg fehlte, war es gut, ihn um uns zu haben.
„Hoffentlich hast du den angekündigten Brief von Gert Postel dabei“, sagte ich, denn Meise war manchmal vergesslich, und ich hatte ihn nicht mehr auf das Papier des inzwischen verurteilten Hochstaplers angesprochen. Postel, von Beruf Postbote, war ein Aufschneider und Possenreißer, über den man, wenn es nicht zum Nachteil mancher Zeitgenossen gewesen wäre, nur hätte lachen können. Zuletzt war „Dr. med.“ Postel, der gelernte Briefausträger, als leitender Oberarzt in einer psychiatrischen Klinik tätig gewesen.
„Na klar“, sagte Meise, „ich habe es dir versprochen! Es sind inzwischen übrigens drei Briefe, die er mir aus dem Knast geschrieben hat.“
Er hatte von Postel, den er seit langem kannte, ausführliche Berichte zu dessen Prozess erhalten. Postel suchte für seine Storys eine Veröffentlichungsplattform. Aber ich hatte zu dieser Zeit nur meinen kleinen „Eigentor-Verlag“ und keinerlei andere Verlagsverbindungen. So musste ich Meise bei dessen Marketinghilfe für Postel absagen.
Seit Tagen regnete es, und Meise sagte beim gemeinsamen familiären Abendbrot: „Wir werden eines Tages noch am steigenden Grundwasserspiegel ersaufen. Was im Südgürtel der Erde fehlt, haben wir hier im Übermaß.“
„Das muss nicht so bleiben“, wandte Karola ein. „Eines Tages könnte auch bei uns das Wasser knapp werden.“
„Unser Wasserreichtum in Mitteleuropa wird noch Jahrhunderte halten, das wette ich“, antwortete Meise.
„Erfolgreiche Wetten sind wohl nicht gerade die Stärken eines Künstlers“, sagte Karo etwas schnippisch, bevor sie fortfuhr: „Aber mich würde interessieren, wie man zur Kunst gelangt und welche Ideen und Ziele man dabei im Kopf hat.“
„Hast du künstlerisches Talent und willst eines Tages mal die Muse küssen?“ Meise sah Karo neugierig an.
Emma und ich zwinkerten uns zu.
„In Kunst gehöre ich nicht gerade zu den Vorzeigeformaten. Ich stehe eher auf die Naturwissenschaften“, sagte Karo.
„Natur ist Kunst pur“, meinte Meise.
Jedenfalls verstanden sich die beiden auf Anhieb und kamen in ein angeregtes Dauerplaudern. Auch unser sportbegeisterter Luca, der erst im letzten Zeugnis im Schulfach Kunst mit »sehr gut« abgeschnitten hatte, dem aber hauptsächlich die Kunst des Fußballspielens am Herzen lag, beteiligte sich an der Ausforschung des Künstlerlebens unseres Hamburger Freundes. Nur Jenny zog sich in ihr Zimmer zurück, um sich ein wenig in praktischer, aber urtümlicher Kunst zu üben – sie malte irgendwelche Dinosaurier, die sich zwischen Blitzen und Vulkanausbrüchen tummelten.
Später am Abend schickte ich Meise zu den Kindern in ihr Zimmer, die ihm vorm Schlafengehen noch viele Fragen zu seinem künstlerischen Werdegang und gegenwärtigen Leben stellen wollten. Gut, dass ich das nicht für ihn ertragen musste – es ging ja schließlich um sein Leben. Sollten sie ihn doch grillen. Ich war außen vor. Wahrscheinlich hätte ich auch viel zu viel in solch ein Comic-Kunst-Leben hineininterpretiert und damit Meises Leben vermutlich fehlinterpretiert.
Gert Postels Prozess
Dafür war ich nun mittendrin, was Gert Postels Prozess betraf. Ich las seinen Brief an Meise:
»Lieber Meise,
heute also mein erster Brief aus dem Knast an dich. Vorab: Keine Sorge, mir geht es den Umständen entsprechend gut. Kann hier jedoch karrieretechnisch leider nicht zum Gefängnisdirektor aufsteigen, da mir die Kopiermöglichkeiten und Stempel fehlen. Ansonsten wäre ich längst wieder draußen und säße bei dir auf der Couch. Dann könntest du mich mit deiner Comic-Kunst vielleicht sogar therapieren.
Zuletzt hatten wir uns gegen Ende meines Prozesses gesehen. Da lief übrigens nicht alles korrekt. Wäre es nach mir gegangen, so hätte mein Prozess praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit, auf jeden Fall in bescheidenem Rahmen, stattgefunden. Mir wäre es durchaus recht gewesen, wenn ich in einem kleinen Saal in Anwesenheit von dir und einigen schläfrigen Rentnern und eines halbinteressierten Lokalreporters vor meine Richter hätte treten können. Ich legte absolut keinen Wert darauf, fotografiert oder gar gefilmt zu werden. Das habe ich den Vorsitzenden auch mehrmals über meine Verteidiger wissen lassen.
Nicht, dass ich so etwa den Grundstein für neue Straftaten legen und verhindern wollte, dass aktuelle Portraitfotos von mir in Umlauf kämen, die mir meine künftige kriminelle Tätigkeit erheblich erschweren würden. Solche Gedanken waren mir angesichts meiner festen Vorsätze, späterhin ein straffreies Leben zu führen, vollkommen fremd. Ausgenommen natürlich die aktuelle karrieristische Idee in puncto Knastdirektor. Aber das war nur ein kurz aufflackerndes, durchaus legitimes Freiheits-Fanal, das sich vorzugsweise in eingeschränkten Lebensphasen bemerkbar macht.
Mir ging es einzig darum, den Prozess nicht zu einem Medienrummel ausarten zu lassen, dafür Sorge zu tragen, dass in der Hauptverhandlung wirklich der Angeklagte, also ich, als Mensch, der gefehlt hatte, im Mittelpunkt steht und dass meine Richter, mein Staatsanwalt und meine Verteidiger keine Fensterreden zu der versammelten Massenpresse hielten, sondern sich auf das konzentrierten, was ihnen unsere Rechtsordnung aufgab.
Leider, so muss ich gestehen, bin ich mit meinem Vorhaben, meinen Prozess dezent und bescheiden zu gestalten, vollkommen gescheitert. Meine Verteidiger ließen mir insoweit nur halbherzige Unterstützung zuteilwerden. Angesichts des schmalen Salärs, das der Freistaat Sachsen ihnen als Pflichtverteidiger zahlte, sahen sie sich offenbar nur durch eine gehörige Portion Scheinwerferlicht angemessen entschädigt. Damit will ich nicht sagen, dass ich gleichsam von zwei eitlen Fatzkes verteidigt worden wäre, die mein Mandat nur deshalb übernommen hätten, um sich in der öffentlichen Aufmerksamkeit ein wenig zu sonnen. Aber es ist nun einmal Tatsache, dass gerade bei Strafverteidigern Idealismus und Eigennutz eng beieinander liegen und dass sich die Vertreter dieser Zunft ab einem gewissen Qualitätslevel im Wesentlichen darin voneinander unterscheiden, mit welchem Grad an Eleganz sie den Dienst am Recht mit der Darbietung ihrer beeindruckenden Persönlichkeit und dem Füllen ihres Geldbeutels zu kombinieren wissen.
Wollte man eine Typologie der Strafverteidiger entwerfen, so fielen mir, der ich diesen Berufsstand auf meinen Reisen durch die Bundesrepublik immer wieder in diversen Hauptverhandlungen aufs genaueste beobachten konnte, folgende Charaktere ein (Ich hoffe, ich langweile dich nicht!):
Als erstes der große Schweiger. Aus unerfindlichen Gründen hoch angesehen. Er sagt wenig, aber wenn er etwas sagt, hat es Gewicht. Sogar Banales gewinnt aus seinem Mund Bedeutung. Er reist durch die Republik und verteidigt die Elite der deutschen Wirtschaft.
Der brillante Steuerexperte, moderat und durch und durch ein Meister des Common Sense. Er gibt sich beeindruckend bescheiden. Von den Gerichten verlangt er nie zu viel.
Der hanseatische Star, brillant und unerbittlich. Immer perfekt, aber ohne Maß.
Der exzentrische Vielfrager. Kein Prozess unter einem Jahr. Literarische Ambitionen.
Der sensible Beziehungsspezialist. Kann sich in die Tötung des Intimpartners immer von neuem richtig gut einfühlen.
Der gut aussehende Revisionsanwalt. Geht beim Bundesgerichtshof ein und aus. Maßvoll in seinen Ansichten, genial in seiner Technik und deshalb ungemein erfolgreich.
Der vulgäre Großverteidiger mit dem abgestandenen Pathos. Erscheint häufig nur zum ersten Verhandlungstag, um die Honneurs einzuheimsen. Hat schon bessere Tage gesehen.
Der hochintelligente Alkoholiker. Immer, wenn man ihn gerade unterschätzt, schlägt er zu.
Der linksliberale Warentermin-Experte. Kon-vertierter Terroristenverteidiger. Hat sich seine Überzeugungen im Innersten bewahrt.
Der protestantische Pfarrerssohn. Fundiertes Wissen, gediegene Schriftsätze, eine Spur zu innerlich. Neigt zu Rechthaberei.
Der Professor, ein Wissenschaftler, der den Kontakt zur Praxis sucht. Berühmt, leicht weltfremd, aber voller Charme.
Unterhalb dieser nationalen Elite residieren die Provinzfürsten, die es in ihrem Sprengel zu einem gewissen Ansehen gebracht haben, sich aber nicht dauerhaft überregional etablieren konnten. Es gibt unter ihnen recht ordentliche Verteidiger, aber man spürt schon, wie es an ihnen nagt, dass sie es nicht zu landesweiter Prominenz gebracht haben.
Aus dieser Liga kamen die beiden Herren, die mir beistanden. Dr. Fischer aus Frankfurt, mit der fundierten juristischen Bildung, in der er sich allerdings auch manchmal verhedderte, und Herr Becker aus Berlin, ein nicht uneitler Generalist mit einigem Situationsgespür.«
An dieser Stelle legte ich den Brief zur Seite und wartete auf Meise, denn ich kannte Dr. Fischer persönlich und hätte gerne gewusst, ob Meise ihn beim Prozess erlebt oder gar gesprochen hatte. Jürgen Fischer war Mandant und zugleich juristischer Berater der Hagenau Treuhand- und Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaft mbH, HTG, die mein alter Schulfreund und Alt-68er Ronny betrieb. Bei dieser Kanzlei war ich nunmehr seit zwei Jahren angestellt, und für sie war ich derzeit als Fonds-Betreuer von sogenannten Aufbau- und Steuerspar-Modellen in den neuen Bundesländern tätig. Es handelte sich um Immo-bilienfonds, Wohn- und Geschäftsanlagen, in Magdeburg, Halle und Halberstadt. Und einer der finanziell höchst engagiertesten Anleger dieser Fonds war der HTG-Sondermandant Jürgen Fischer. Dass er nebenbei auch noch Postel verteidigt hatte, war mir bisher nicht bekannt gewesen.
Gemeinsam mit seinem Mit-Investor aus dem Milieu der mehr oder minder seriösen Werbeagenturen, Herrn Ahnenhold, war mir Fischer allerdings bestens bekannt. Sie waren die einzigen beiden der rund 60 Investoren, die sich nicht scheuten, mich um Mitternacht aus dem Schlaf zu reißen und in aufputschenden Telefonaten ihrer Sorge Ausdruck zu verleihen, dass aus den Steuersparmodellen ein riesiges Verlustgeschäft werden könnte. Was dann auch so kam. Doch dazu später.
„Herr Koenig, was haben Sie in der letzten Woche gegen den Leerstand der Gewerbe-Immobilien unternommen?“, fragte zum Beispiel Fischer immer mal wieder.
„Herr Koenig, haben Sie eigentlich schon Makler kontaktiert?“, fragte Ahnenhold auch gerne zu mitternächtlicher Stunde.
„Haben Sie die Mieter vom Auszug abbringen können?“; „Haben Sie …?“; „Konnten Sie …?“ und so weiter
Dabei berichtete ich monatlich ausführlich in einem Anlage-Letter über den Sachstand und die unternommenen Aktivitäten, um den geldgierigen krähenden Hähnen und gackernden Hühnern etwas mehr Ruhe im Hühnerstall ihres Anlagevermögens zu verschaffen. Aber die Lage war nun einmal prob-lematisch. Das Fondsmodell sah vor, dass die Mietgarantie nach fünf Jahren auslief. Das bedeutete, dass im ersten halben Jahrzehnt die Knete im Übermaß floss. Nicht nur füllten die lukrativen Steuerrückerstattungen der Finanzämter die Konten der Anleger, es kamen darüber hinaus vom Fonds garantierte Vollmieten für die Objekte hinzu, obwohl diese keinesfalls vollständig vermietet waren. Diese für die Fonds entstehenden Mietverluste wiederum konnten die Fonds bei den Steuerbehörden geltend machen, sodass letztlich der Staat, sprich: die Steuerzahler, für sämtliche Investitionen aufkamen, von denen die reichen westlichen »Investoren« profitierten.
Doch nach fünf Jahren entfiel die Mietgarantie und die Verluste mussten von da an von den bisherigen Anlage-Profiteuren aus ihrem laufenden Einkommen ausgeglichen werden. Was sie zwar wiederum steuerlich geltend machen und absetzen konnten – aber Verlust bleibt Verlust. Und das tat den hauptberuflichen Geizhälsen überaus weh. Und ich war nun nicht mehr nur ihr Interessenvertreter gegenüber der Immobilienverwaltung, gegenüber Mietern, Hausmeistern und Maklern, sondern in gewisser Weise auch ihr psychologischer Betreuer. In Gottes und in Ronnys Namen. Gemäß Ronnys Anweisung sollte ich den weltfremden Geizhälsen vorgaukeln, dass alles in bester Butter sei und sich Ostland bald im Wirtschaftswunderrausch befinden würde wie dereinst nach dem Krieg die Westrepublik.
„Ich werde den Leuten keinesfalls blühende Landschaften vorgaukeln, wie es der Kanzler anno dazumal tat“, sagte ich zu Ronny.
„Nein, das meine ich nicht. Du sollst nur einige realistische Perspektiven immer wieder in deine Berichte einbauen. So ist es doch völlig logisch, dass zum Beispiel in Magdeburg der Wirtschaftssektor und damit der Bedarf an Gewerbeimmobilien wachsen wird.“
„Woher nimmst du diese Zuversicht?“
„Das stand erst kürzlich in der »Magdeburger Volksstimme«. Ein Bericht über eine IHK-Tagung“, sagte Ronny und schaute mich an, als sei ihm ein großer Coup gelungen.
Später, als ich wieder „on tour“ in Magdeburg war, gab ich mich als Journalist aus und interviewte den IHK-Geschäftsführer. Er legte mir Statistiken und Prognosen vor – und das sah alles andere als rosig aus. Er rechnete eher mit einer weiteren Abwanderungswelle von kreativen und unternehmerisch begabten jungen Leuten in den Speckgürtel von Berlin oder nach Bayern oder Sachsen.
Doch davon wollte Ronny nichts wissen, und das sollte ich bitte nicht in meinen Berichten erwähnen. Ich schrieb, dass meine Erkundigungen bei der IHK nicht zu eindeutigen Ergebnissen geführt hätten. Dafür seien im vergangenen Monat mit Hilfe von zwei Maklern vier Vermietungen von Büros zustande gekommen. Das stimmte zwar, aber der unausgesprochene, jedoch suggerierte Trugschluss, dass dies ein Trend sei, war – rein werbetechnisch gesehen – eine moralisch vielleicht nicht ganz lautere, aber gerade noch zulässige Methode positiver Selbstdarstellung.
Zurück zu den nächtlichen Ruhestörern, Dr. Fischer und seinem Werbefuzzi, Herrn Ahnenhold. Egal ob ich in jenen Nächten, in denen sie mich aus dem Schlaf der Gerechten rissen, gähnte oder die Aktivitäten akribisch aufzählte, sie waren in solchen Situationen nur schwer zu beruhigen. Ich nehme an, dass sie in jenen für sie beunruhigenden Zuständen unter schweren Albträumen litten, in denen ihnen Dagobert Duck begegnete und ihnen den Vogel zeigte, bevor er sich hämisch lachend in seinen von Golddukaten überquellenden Tresor stürzte. Natürlich unterdrückte ich mein Gähnen bei diesen nächtlichen Attacken und musste an Karolas Erlebnis von vor vier Wochen denken.
Sie hatte sich, wie ich annehme, in einen Jungen aus ihrer Klasse verguckt. Ich weiß es nicht sicher. Ansprechen darf ich so etwas nicht. Jedenfalls hörte ich zufällig ein Telefonat, das sie im Wohnzimmer des Erdgeschosses mit einem gewissen Jonas führte. Alle anderen Familienmitglieder waren ausgeflogen, außer mir. Und mich vermutete sie zwei Stockwerke höher im Büro. Also sprach sie völlig frei von der Leber weg.
Aber ich war auf dem Weg in die Küche gewesen, um mir meinen Lieblingstee zu holen. Da hörte ich den Satz: „Meine Eltern sind auch manchmal echt oberpeinlich.“ Daraufhin erstarrte ich zur Salzsäule und verharrte an Ort und Stelle, sah zufällig meine Schuhe vor der Garderobe stehen und zog sie an, ging in die Hocke und schnürte mir nun die Schuhe zu und wieder auf und wieder zu und wieder auf – so lange wie das Gespräch dauerte. Bei Entdeckung konnte ich unschuldig tun.
So bekam ich mit, dass sie Jonas eines ultraschweren Vergehens beschuldigte: Er hatte gegähnt, während sie ihm etwas erzählte. „So was geeeht überhaaauuupt nicht!“, sagte sie in rügender Dehnung des Satzes.
Ich hoffe, dass sie diesen aktuellen neuropsychologischen Wissensstand in Sachen Gähnen nicht von mir erfahren hat. Ich hatte gerade dazu nämlich im letzten P.M.-Monatsmagazin etwas aufregendes gelesen. Danach wird das Gähnen offenbar von ziemlich primitiven Hirnregionen gesteuert. Affen gähnen, Hunde gähnen, Wellensittiche und Quallen eher nicht. Dazu stand eine Menge mehr in dem Artikel, aber ich konnte ihn wieder mal nicht zu Ende lesen, weil jemand dringend auf die Toilette musste, obwohl noch drei andere Klos zur Verfügung standen.
Ich selbst gähne auch, das mag ich überhaupt nicht bestreiten. Ich kenne also diesen Zustand aus ureigener Erfahrung, auch wenn mir der wissenschaftliche Hintergrund noch immer verschlossen ist. Doch achten meine diversen herumliegenden Gehirnlappen gewissenhaft darauf, dass ich absolut nicht zur falschen Zeit – und wenn, dann nur in unterdrücktem Modus – gähne. Strafrechtler Fischer und der Werbefuzzi hätten mich wahrscheinlich verklagt oder mindestens beim HTG-Chef ange-schwärzt, wenn ich bei ihrem Mitternachtsplausch in irgendeiner Weise hörbar gegähnt hätte: „Er gähnt in wichtigen Besprechungen und wirkt wie abwesend …“ Dass diese „wichtigen Besprechung“ telefonisch mitten in der Nacht stattfinden, würden sie Ronny freilich vorenthalten.
Wenn mir wirklich mal ein Gähner herausrutscht, ist er garantiert geräuschlos und zeigt sich nur durch einen gequält zugekniffenen Mund. Von primitiv kann bei mir also keine Rede sein. Umgekehrt wird ein Schuh draus: Ich bin ein sehr schlauer Gähner, denn eines weiß mein Gehirn sehr genau: dass es mich niemals zum sicht- oder hörbaren Gähnen anstiften darf, wenn meine Frau etwas erzählt. Da könnte sich Jonas mal eine Scheibe von abschneiden: Niemals gähnen, wenn Frauen reden. Das gehört übrigens zum maskulinen Allgemeinwissen, aber wie soll der junge Bursche das in Erfahrung bringen, wenn er mich, den alten Hasen, noch nie kennen lernen durfte. Ich hätte es ihm hundert Pro als allererstes gesteckt.
Irgendwann beendete Karola das missglückte Telefonat abrupt und stolperte fast über mich, der ich gebückt vor der Tür hockte und am Schuhe schnüren war. „Wollte gerade mal einkaufen gehen“, stammelte ich verlegen, wie man halt so stammelt, wenn man gerade ertappt wurde. Um die Situation zu retten, fügte ich einen verhängnisvollen Satz hinzu: „Mir scheint, die Jungs sind heutzutage ultrakrasse endlaser.“ Mir war schnuppe, ob die Worte einen Sinn ergaben. Aber für Karo ergaben sie offenbar einen, denn sie sah mich zu Tode erschroc-ken an und sagte etwas, was sich etwa so anhörte: „Lass das, Papa, sag nie wieder so abscheuliche Worte!“
Das war nun einen Monat her, aber ich entsann mich sehr gut.
Als Meise jetzt gähnend aus dem Kinderzimmer kam und sich zu Emma und mir an den knisternden Kamin setzte, während der Regen an die Fenster prasselte, wurde er langsam wieder wacher. Ich berichtete von meinen Fischer-Postel-Erkenntnissen.
„Zufälle gibt’s“, sagte er trocken.
Ich nickte zustimmend und meinte: „Das kann man wohl sagen, denn in Fischers Kanzlei wirkt seit kurzem beiläufig auch noch Rupert von Plottnitz mit. Auch er ist HTG-Mandant. Und ihn kennen wir beide doch noch aus den Endsechziger Jahren, aus dem Club Voltaire, erinnerst du dich?“
„Ich kenne ihn sogar noch aus der Studienzeit. Gleichzeitig mit mir trat Rupert von Plottnitz 1968 dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund bei.“
„Ich habe diese aufregende Zeit, als das Land seine braun-graue Trübung verlor und bunter durch uns wurde, als Schüler erlebt“, sagte ich. „Den SDS kannte ich natürlich, aber wer von euch Älteren nun zu dieser Art revolutionärer Denkfabrik gehörte, konnten wir Gymnasiasten im Club nicht erkennen. Wir vermuteten, dass alle, die im Voltaire verkehrten, SDSler waren – aber so war es nicht.“
Emma kannte diese Zeit und die damaligen Großstadtereignisse nur vom Hörensagen, denn sie war sechs Jahre jünger als ich – eine entscheidende Zeitspanne in jenen Jahren. Und sie war in einem fränkischen Dorf groß geworden, das erst später durch sein kapital- und strahlungsbringendes AKW an Bedeutung erlangte: Neue Straßen, neue Laternen, eine neue Bibliothek, ein neues Kirchendach, neuer Kindergarten, neue Spielplätze. Alles strahlend neu in Grafenrheinfeld. Jetzt goss uns Emma Rotwein ein und wir prosteten uns zu und sie fragte Meise, ob die Kids anständig gewesen seien.
„Sie haben mich ausgequetscht wie eine Zitrone, und ich habe alles gegeben. Ich glaube, dass sie demnächst bei euch anfragen, wie man Künstler wird und ob ihr bereit seid, ihren Start ins Berufsleben als Künstler zu sponsern.“
„Weiter!“, sagte ich ungerührt.
„Nix weiter. Dann habe ich halt den Spieß umgedreht und sie ausgequetscht. Dazu hatte ich zufällig genügend Wissen im Zugabteil zwischen Hamburg und Gießen getankt. Da hatte ein Teenie seine »Bravo« vergessen. Ich habe sie durchgeblättert und fand sie eigentlich ganz schön fad gegenüber jener »Bravo« aus den 1970er-Jahren. Alles voll mit Robbie Williams und Britney Spears. Wenn unsere Jugend auch so öde gewesen wäre, wären wir heute wahrscheinlich cracksüchtig.“
„Soll ich Crackers aus der Küche holen?“, fragte Emma lachend.
„Jedenfalls konnte ich ganz schön mithalten mit meinem bravourösen Wissen. In der Rubrik »Stars unter vier Augen« hatte ich ein Interview mit Eminem gelesen und noch frisch in Erinnerung, und so fragte ich Luca und Karola, von wem wohl der Spruch stammt: »Gott hat mich gesandt, um die Welt anzupissen«. Karola tippte auf Madonna, und Luca tippte auf Lou Bega – aber beide lagen falsch. 1:0 für mich.“
„Entweder hassen sie dich jetzt dafür oder du steigst in ihrer Achtung weit über dein Künstlerdasein hinaus“, meinte ich.
„Dann fragte ich sie, ob sie mir sagen könnten, von wem jener Satz stammen würde: »Es ist wirklich schwer, ernste Songs auf der Bühne zu singen, wenn man dauernd BH’s und Slips an den Kopf geworfen bekommt.« Ich gab ihnen drei Auswahlmöglichkeiten: Ronan Keating, Robbie Williams oder Rex Gildo. Sie tippten auf letzteren, aber es war natürlich Robbie. Also stand es 2:0 für mich. Weiter wollte ich die Demütigung eurer lieben Kids allerdings nicht treiben. Bin hier ja nur als Gast.“
„Es spricht doch eigentlich für unsere beiden Teenager, dass sie die »Bravo« nicht auswendig kennen, oder?“, sagte Emma. Wir mussten alle lachen.
Eigentlich hatten wir unser Gespräch in Sachen Dr. Fischer und Rupert von Plottnitz unterbrochen, und mir war noch etwas dazu eingefallen: „Ich erinnere mich, dass Rupert von Plottnitz 1977/78 am »Internationalen Russell-Tribunal zur Situation der Menschenrechte in der Bundesrepublik Deutschland« mitwirkte. Daran hatten wir beide teilgenommen, damals in Frankfurt-Harheim, Meise, erinnerst du dich?“
„Stimmt“, bestätigte Meise. „Später schloss sich Plottnitz den Grünen an und wir beide hatten uns überlegt, dass wir keiner Partei beitreten wollten, obwohl wir die Grünen super und dringend notwendig fanden. Aber ich wollte mich als Künstler partout nicht parteipolitisch fesseln lassen. Und du als geborener …“
„… ich als geborener Freigeist und als unabhängiger Journalist und als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Wissenschaftszentrum Berlin wollte auf keinen Fall ein Parteiemblem am Revers tragen.“
„Du hast damals gewiss keine Anzüge getragen, wie ich vermute“, sagte meine Frau, und sie hatte natürlich recht.
Später, zu GTU-Zeiten, jener Zeit meiner Umweltbildungs-Institute, hatte ich gelegentlich Anzüge getragen, zum Beispiel zur Eröffnung des Umweltzentrums Rhein-Main. Von 1983 bis 1987 hatte Rupert von Plottnitz übrigens die Position eines ehrenamtlichen Stadtrats im Magistrat der Stadt Frankfurt am Main inne. Als Vertreter der Stadt Frankfurt hatte er im Oktober 1986 einen Gruß des Oberbürgermeisters an das von mir aus der Taufe gehobene Umweltbildungs-Institut, GTU, im Rahmen der Eröffnung des Umweltzentrums Rhein-Main ausgerichtet und eine ermutigende und ökologisch engagierte Rede gehalten. Er war bei der Landtagswahl in Hessen 1987 in den hessischen Landtag gewählt worden und war dort später Vorsitzender der Grünen-Fraktion gewesen.
Am nächsten Morgen konnte Meise das tägliche Elend einer intakten pubertär-infiltrierten Familie miterleben. Ich nehme an, dass es ihn in seinem künstlerischen Einsiedlerleben als „sexloser Endlaser“ auf Dauer bestärkt hat. Jedenfalls, so vermutete ich, würde er freiwillig niemals eine Familie gründen. Wenn Sie mich, liebe Leser, heute fragen, was ein »Endlaser« ist, so verweise ich auf meinen Sohn Luca, der mich aufklärte, dass dieses krass grassierende Jugendwort drei Bedeutungen habe, nämlich toll, geil und eingebildet. Aber meistens meine man geil und toll – doch das seien einfach viel zu abgedroschene Worte, »endlaser« sei einfach eindeutiger.
Na ja, was soll ich dazu sagen? Hätten meine Großeltern nicht auch verständnislos den Kopf geschüttelt, wenn ich von »geil« und »cool« geredet hätte?
Meise fuhr an jenem Tag von Laubach nach Frankfurt, um dort alte Bekannte zu treffen. Er wollte drei Tage dort bleiben und am Rückreisetag noch einmal bei uns Station machen.
„Darf ich Postels Briefe behalten?“, fragte ich.
„Ich habe Kopien davon, und du solltest überlegen, ob es nicht doch eine Möglichkeit der Veröffentlichung gibt, so Postels Bitte“, antwortete Meise.
„Ich werde sehen.“
„Hat ja auch Zeit. Er wird noch eine Weile im Knast schmoren und kann dort seine Erlebnisse niederschreiben. Dann lohnt sich eine Veröffentlichung wahrscheinlich eher.“
Als Meise nach Frankfurt abgedüst war, nahm ich mir am Abend die Briefe vor und las weiter, was Postel über seinen Prozess zu sagen hatte:
»Ich kann nicht sagen, dass ich meine beiden Anwälte, Dr. Fischer und Becker, bewundere, aber angesichts der Ebbe in meiner Kasse und der Weigerung meiner reichsten Freundin, einer Kiefer-Chirurgin, sich an dem Verteidigerhonorar zu beteiligen, waren sie immer noch das Beste, was ich bekommen konnte. Und in der Rückschau muss ich auch zugeben, dass die Qualität meiner Verteidigung für das Ergebnis des Verfahrens wahrscheinlich gar nicht ausschlaggebend war. Ich glaube nämlich, dass mein Vorsitzender Richter, ein listiger und besonnener Schwabe, ungeachtet aller von den Verteidigern vorgebrachten juristischen Finessen von Anfang an auf das Ergebnis zusteuerte, das letztlich im Namen des Volkes auch als Urteil verkündet wurde, nämlich vier Jahre Gefängnis und Haftfortdauer.
Ich hätte mich also auch von Rechtsanwalt Freyvogel aus Grimma verteidigen lassen können, ohne dass es einen Unterschied gemacht hätte. Aber vom Unterhaltungswert, von der gesamten Präsentation her, waren die beiden mir schon adäquater.
Merkwürdiger Weise sahen sich die beiden in der Vorbereitung auf den Prozess mehrfach dazu veranlasst, mir langatmige Moralpredigten zu halten, mich zur »Umkehr« aufzufordern, meine selbstgefällige Haltung in Bezug auf meine »ärztlichen Leistungen« zu brandmarken und mich immer wieder zu ermahnen, endlich eine einigermaßen realistische Zukunftsperspektive zu entwickeln. Diese humorlosen Predigten kamen hauptsächlich von Dr. Fischer, nachdem er sich Becker als Mitverteidiger zugesellte.«
Ich machte eine kurze Lesepause und schmunzelte, denn genauso kannte ich Jürgen Fischer, als ewig ernst und bedeutungsschwer dreinschauenden, humorlosen Anwalt. Dass er mir eines Tages im Gericht gegenüberstehen und gegen mich plädieren würde, konnte ich in diesem Moment nicht ahnen. Ich holte mir einen Tee und las weiter:
»Solange mich Becker alleine verteidigte, gab es bei den Mandantenbesprechungen immer genügend zu lachen. Auch er leugnete zwar nicht, ein Organ der Rechtspflege zu sein, aber er hatte nicht die Kraft angesichts des Gesprächsgegenstandes, dauernd ernst zu bleiben. Allerdings zeigte er bei der Vorbereitung große Angst, ich könnte als unerkannter Serientäter mit negativer Zukunftsprognose in Sicherungsverwahrung genommen, also auf unbestimmte Zeit weggeschlossen werden.
Ich teilte diese Sorge zunächst nicht, stimmte jedoch schließlich seinem Vorschlag zu, Dr. Fischer hinzuzuziehen, sozusagen als Rechtsexperten und als sachliche Versicherung gegen Beckers Ängste. Becker war es auch, der mir als Zielvorgabe für den Prozess einredete, es gelte in erster Linie die Sicherungsverwahrung zu vermeiden. Dafür müsse man auch bereit sein, eine etwas höhere Freiheitsstrafe in Kauf zu nehmen. An eine Schmunzelverteidigung, wie vor 15 Jahren in Flensburg, sei ohnehin nicht zu denken.
Vermutlich stand die gefürchtete Maßregel weder bei der Staatsanwaltschaft noch bei dem Leipziger Gericht je zur Debatte. Nicht unwahrscheinlich, dass meine famosen Verteidiger vor lauter Angst nicht einmal sauber geprüft hatten, ob die formellen Voraussetzungen dafür überhaupt vorlagen. Auf jeden Fall schafften sie es mit ihrem ständigen Gerede von der drohenden Sicherungsverwahrung, mir das wirklich bescheidene Ergebnis des Prozesses, zu-mindest vorübergehend, auch noch als Erfolg zu verkaufen. Die Institution des Verteidigers als Schmiermittel im Justizgetriebe ist wahrlich nicht zu unterschätzen.
Der Prozess war irgendwie eine Farce. Nicht dass wir etwa das exakte Ergebnis schon vorher gekannt und uns mit dem Gericht und der Staatsanwaltschaft vorher geeinigt hätten, wie die große Gisela Friedrichsen im »Spiegel« vermutete. Derartige Abreden gab es nicht. Aber wir kannten ungefähr den Korridor, in dem das Gericht eine gerechte Strafe finden wollte. Dieser Korridor war ziemlich eng. Er reichte von drei Jahren und sechs Monaten Gefängnis bis zu viereinhalb Jahren.
Lieber Meise, wie du weißt, besteht jede Gerechtigkeit eines Urteils darin, eine salomonische Entscheidung genau in der Mitte des Korridors zu finden, sozusagen den goldenen Schnitt im Strafmaß. Nun ist natürlich allgemein anerkannt, dass jede Strafzumessungsentscheidung ihre irrationalen Elemente in sich birgt, weil es mit Verstandesüberlegungen überhaupt nicht zu rechtfertigen ist, weshalb man anstelle von drei Jahren und elf Monaten jetzt zum Beispiel vier Jahre und einen Monat verhängt. Diese Differenz von zwei Monaten gehört in den Bereich, wo der Tatsachenrichter aus dem Bauch heraus entscheiden darf, ohne dass ihm irgendeine Berufungsinstanz ernsthaft hineinreden könnte.«
Meine Augenlider wurden allmählich schwer und bevor mir der Brief aus der Hand glitt, ging ich ins Bett. Demnächst könnte ich weiterlesen. Vielleicht morgen schon.
Verlassen im Verlies
Es war März und das Jahr, in dem die zehnjährige Natascha Kampusch entführt worden war, war seit drei Monaten vorüber, und sie war immer noch in einem Kellerverlies gefangen. Die Welt draußen rückte allmählich immer weiter weg. Die Erinnerungen an ihr früheres Leben wurden schemenhafter und schienen ihr immer unwirklicher. Es fiel ihr schwer zu glauben, dass sie noch vor weniger als einem Jahr ein Volksschulkind in einem Wiener Vorort gewesen war, das am Nachmittag spielte, Ausflüge mit seinen Eltern machte und ein normales Leben führte.
Sie versuchte, sich mit dem Leben, in das sie hineingezwungen worden war, so gut es ging abzufinden. Das war nicht immer leicht. Die Kontrolle des Täters war weiterhin absolut. Seine Stimme in der Gegensprechanlage raubte Natascha die Nerven. Sie fühlte sich in ihrem winzigen Verlies, als ob sie meilenweit unter der Erde und zugleich in einem Schaukasten leben würde, in dem man sie bei jeder Bewegung beobachten konnte.
Aber nun fanden ihre Besuche oben im Haus regelmäßiger statt. Etwa alle zwei Wochen durfte sie oben duschen und manchmal ließ sie ihr Entführer abends bei sich essen und fernsehen. Sie freute sich über jede Minute, die sie außerhalb des Verlieses verbringen durfte – doch im Haus hatte sie immer noch Angst.
Sie wusste zwar inzwischen, dass er dort allein wohnte und ihr kein Fremder auflauern würde, aber ihre Nervosität nahm kaum ab. Der Entführer sorgte mit seiner eigenen Paranoia dafür, dass selbst ein kurzer Moment der Entspannung unmöglich war. Wenn sie oben war, schien sie wie mit einer unsichtbaren Leine an den Täter gebunden. Sie musste immer im gleichen Abstand zu ihm stehen und gehen – einen Meter, nicht mehr, nicht weniger, sonst rastete er sofort aus. Er verlangte, dass sie immer den Kopf gesenkt hielt, den Blick nie hebe.
Natascha war nach den endlosen Stunden und Tagen, die sie völlig isoliert im Verlies verbrachte, sehr anfällig für seine Anweisungen und Manipulationen. Der Mangel an Licht und menschlichem Umgang hatten sie so geschwächt, dass sie ihm nicht mehr entgegensetzen konnte als einen gewissen Grundwiderstand, den sie nie aufgab und der ihr half, die Grenzen zu ziehen, die ihr selbst ihr kindlich geprägter Instinkt als unabdingbar signalisierte.
An Flucht dachte sie kaum noch. Es schien, als würde die unsichtbare Leine, an die er sie im obigen Wohnbereich legte, immer realer werden. Als wäre sie tatsächlich an ihn gekettet und physisch nicht imstande, sich mehr als einen Meter von ihm weg- oder zu ihm hinzubewegen. Er hatte die Angst vor der Welt da draußen, in der man sie nicht suchte, nicht liebte, sie nicht vermisste, so tief in ihr verankert, dass sie fast größer wurde als ihre Sehnsucht nach Freiheit.
Wenn sie im Verlies war, versuchte sie, sich so gut wie möglich zu beschäftigen. An den langen Wochenenden, die sie allein verbrachte, putzte und räumte sie nach wie vor stundenlang, bis alles glänzte und frisch duftete. Sie malte viel und nutzte noch das kleinste Fitzelchen Papier auf ihrem Block für Bilder: ihre Mutter in einem langen Rock, ihr Vater mit seinem dicken Bauch und seinem Schnurrbart, sie lachend dazwischen. Sie malte die strahlend gelbe Sonne, die sie seit vielen Monaten nicht mehr gesehen hatte, und Häuser mit rauchenden Schornsteinen, bunte Blumen und spielende Kinder, Phantasiewelten, die sie für Stunden vergessen ließen, wie ihre Wirklichkeit aussah.
Eines Tages brachte ihr Entführer ein Bastelbuch. Es war für Vorschulkinder und stimmte sie eher traurig, als dass es sie aufheiterte. Das lustige Papier-Flieger-Fangen war auf fünf Quadratmetern schlicht nicht möglich. Ein besseres Geschenk war die Barbie-Puppe, die sie wenig später bekam, und ein winziges Näh-Set, wie sie manchmal in Hotels ausliegen.
Natascha war unendlich dankbar für diese langbeinige Person aus Plastik, die ihr nun Gesellschaft leistete. Es war eine Reiter-Barbie mit hohen Stiefeln, weißer Hose, rotem Gilet und einer Gerte. Sie bat ihren Entführer tagelang, ihr ein paar Stoffreste zu besorgen. Es konnte manchmal sehr lange dauern, bis er einem solchen Wunsch nachkam. Und auch nur dann, wenn sie seine Anweisungen strikt befolgte. Wenn sie etwa weinte, strich er ihr für Tage alle Annehmlichkeiten wie die lebensnotwendigen Bücher und Videos. Sie musste, um etwas zu bekommen, Dankbarkeit zeigen und ihn für alles, was er tat, loben – bis hin zu der Tatsache, dass er sie eingesperrt hatte.
Schließlich hatte sie ihn so weit, dass er ihr ein altes T-Shirt brachte. Ein weißes Poloshirt aus weichem, glattem Jersey mit einem feinen blauen Muster. Es war das Shirt, das er am Tag ihrer Entführung getragen hatte. Sie wusste nicht, ob er das vergessen hatte oder das Shirt in seinem Verfolgungswahn einfach loswerden wollte. Aus dem Stoff des Shirts nähte Natascha für ihre Barbie ein Cocktailkleid mit feinen Spaghettiträgern aus Fäden und ein elegantes, asymmetrisches Top. Aus einem Ärmel bastelte sie sich mit Hilfe einer Schnur, die sie bei ihren Schulsachen gefunden hatte, ein Etui für ihre Brille. Später konnte sie den Täter noch überreden, ihr eine alte Stoffserviette zu überlassen, die beim Waschen blau geworden war und die er nun als Putzlappen verwendete. Daraus wurde ein Ballkleid für ihre Barbie, mit einem dünnen Gummiband um die Taille.
Später formte sie Topfuntersetzer aus Drähten und faltete kleine Kunstwerke aus Papier. Ihr Entführer brachte ihr Handarbeitsnadeln ins Verlies, mit denen sie häkeln und stricken übte. Draußen, als Volksschulkind, hatte sie das nie richtig gelernt. Wenn sie einen Fehler gemacht hatte, verlor man rasch die Geduld mit ihr. Nun hatte sie unendlich viel Zeit, niemand wies sie zurecht. Sie konnte immer wieder von vorne anfangen, bis ihre kleinen Arbeiten perfekt waren.
Diese Handarbeiten bewahrten sie vor dem Wahnsinn der einsamen Untätigkeit, zu der sie gezwungen war. Und sie konnte dabei beinahe meditativ an ihre Eltern denken, während sie kleine Geschenke für sie herstellte – für irgendwann, wenn sie wieder frei sein würde. Dem Täter gegenüber durfte sie allerdings mit keinem Wort erwähnen, dass sie etwas für ihre Eltern gebastelt hatte. Sie versteckte die Bilder vor ihm und sprach seltener von ihnen, denn er reagierte immer ungehaltener, wenn sie von ihrem Leben draußen und von der Gefangenschaft sprach.