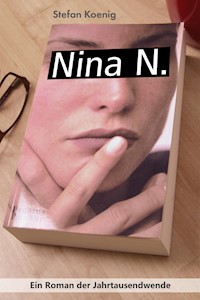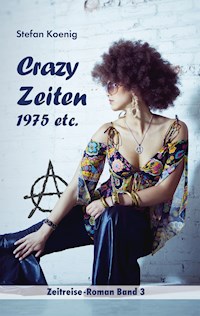12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Zeitreise-Roman
- Sprache: Deutsch
Es schien, als versickerten die Jahre zwischen 1993 und 1996 in den unterirdischen Kanälen der Geschichte. Aber so war es nicht. Das neue Deutschland plusterte sich auf. Hoffnung und Arbeitslosigkeit stiegen gleichermaßen. Die Wirtschaft schmierte ab. Unsere privaten Probleme blieben. Unser Glück, unsere Liebe, unsere Partner und Kinder gewannen an Bedeutung. Im irischen Honeybridge trafen sich alte Freunde aus aller Welt. Ein Mann aus der Freundesrunde, ein junger Mann, litt unter Depressionen und stand am Rand der atlantischen Klippen. John und Mara retteten ihn. Und viele retteten so manches, was im Großen und Ganzen unterzugehen droht. Stefan Koenig gelingt ein imposantes Zeitgemälde, dem es an Spannung, Information und erzählerischer Sanftmut wie Empörung nicht mangelt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 437
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Stefan Koenig
Verflixte Zeiten - 1994 etc.
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort
1993
Honeckers Anwalt
Ein lustiger Hochstapler
Die Akte Barschel
Partyzeit
Lehrer Kowalke
Pfadfinderzeiten
Fragen an die Zukunft
Die untreue Treuhand
Waffengeschäfte
Rio, der König von Deutschland
Donnerwetter & Lebensgefahr
Neuer Schwung durch viel Wind?
Der Albtraum
1994
Kruzifix nochmal!
Berlusconis TV-Sumpf
Wettersturz in den Alpen
Schuldlos schuldig
Prozess-Chancen
Prinzessin Diana
Ronnys Roth-Händle & das große Fressen
Ein Abschied kommt selten allein
1995
Prüfungen wohin man schaut
Postel hilft beim Aufbau Ost
Ab ins Abenteuerland
Harksen schlägt Haken
Monika Weimar in London
1996
Riesenwelle auf die Schnelle
Dolly, das Klonschaf
Warum starb der CIA-Chef?
Karl – neuer Freund & Kollege
Statt einer Nachbemerkung
Dank
Falls es Sie interessiert …
»Freie Republik Lich – 2023«
»Sturm über Lich - 2022«
»Der Fremde – Lich, 19. Januar 2022«
Die realistischen Zeitreise-Romane …
Sexy Zeiten – 1968 etc.
Wilde Zeiten – 1970 etc.
Crazy Zeiten – 1975 etc.
Bunte Zeiten – 1980 etc.
Rasante Zeiten – 1985 etc.
Blühende Zeiten – 1989 etc.
Neue Zeiten – 1990 etc.
Printbuch-Inhalt »Verflixte Zeiten – 1994 etc.«
Impressum neobooks
Vorwort
Stefan Koenig
Verflixte Zeiten
1994 etc.
Zeitreise-Roman
Band 12
Aus dem Deutschen
ins Deutsche übersetzt
von Jürgen Bodelle
© 2022 by Stefan Koenig
Mail-Kontakt
zu Verlag und Autor:
Postadresse:
Pegasus Bücher
Postfach 1111
D-35321 Laubach
Das Leben kann nur
in der Schau nach rückwärts verstanden,
aber nur in der Schau
nach vorwärts gelebt werden.
Sören Kierkegaard
Ich kann in drei Sekunden die Welt erobern
Den Himmel stürmen und in mir wohnen
In zwei Sekunden Frieden stiften, Liebe machen,
Den Feind vergiften
In einer Sekunde Schlösser bauen
Zwei Tage einziehen und alles kaputt hauen
Alles Geld der Welt verbrennen
Und heute die Zukunft kennen
Und das ist alles nur in meinem Kopf
Und das ist alles nur in meinem Kopf
Ich wäre gern länger dort geblieben
Doch die Gedanken kommen und fliegen
Alles nur in meinem Kopf
Und das ist alles nur in meinem Kopf
Wir sind für zwei Sekunden Ewigkeit unsichtbar
Ich stopp die Zeit
Kann in Sekunden fliegen lernen
Und weiß wie‘s sein kann, nie zu sterben
Die Welt durch deine Augen sehen
Augen zu und durch Wände gehen
Und das ist alles nur in meinem Kopf.
Und das ist alles nur in meinem Kopf.
Ich wär‘ gern länger dort geblieben
Doch die Gedanken kommen und fliegen
Alles nur in meinem Kopf
Und das ist alles nur in meinem Kopf
Du bist wie ich, ich bin wie du
Wir alle sind aus Fantasie
Wir sind aus Staub und Fantasie
Wir sind aus Staub und Fantasie
Doch das ist alles nur in meinem Kopf
Und die Gedanken kommen und fliegen
»Nur in meinem Kopf«
Von Andreas Bourani
„Wann geht es endlich mit Ihren realistischen Zeitreisen weiter?“ So lauteten in der einen oder anderen Variation die Fragen von Leserinnen und Lesern, denen ich die hier vorliegende Ausgabe bereits für November 2021 versprochen hatte. Es ist genau dies ein Grund, einem Autor niemals seinen Aussagen in Sachen „Fortsetzung“ zu trauen. Na ja, vielleicht gibt es doch zuverlässigere Kollegen als mich. Aber Männer und … zuverlässig? Fragen Sie mal eine Frau! Im Notfall fragen Sie sich selbst. Die Frauen, meine Kolleginnen, sind vielleicht zielsicherer in ihren Planungsvorhaben. Vielleicht … Ich jedenfalls habe Gottvertrauen, auch wenn Sie mir das niemals glauben werden.
Mir verhagelten allerdings vier fantastische Zeitreisen meine blauäugige Sternzeichen-Jungfrau-Planung. Wie Sie eventuell wissen, schob sich mit brachialem Aktualitätserfordernis die »Lich-Trilogie« dazwischen, in der es sich um das dämonische Gerangel um ein Logistikmonster, einige Polit- und diverse andere Monster handelt. Die Handlung spielt zwischen „Realismus“ und „Fantasy“. Beginnend mit »Freie Republik Lich – 2023« gefolgt von »Sturm über Lich« endet das dystopische Drama mit »Der Fremde«.
Danach befasste ich mich mit dem längst überfälligen Corona-Thema und blieb teilweise in der Fantasy-Welt hängen. Unbeabsichtigt war das ein genialer Schachzug … Sie wissen schon: Distanz & Nähe ... Im Rückblick aus einer totalitären Zeit, nämlich aus dem Jahr »2034«, erinnere ich mich an die Jetztzeit, Pandemie vorn, Pandemie hinten, schwere Corona-Verläufe, leichte Corona-Verläufe, Tod und Wiederauferstehung, wackelnde Statistiken, angemessene Schutzmaßnahmen, unangemessene staatliche Reaktionen, Lockdowns, Kinderimpfungen, Schulschließungen, neue Überwachungs- und Denunziationsmuster, unsere Presse, unsere Ärzte, unsere Politiker … und dazwischen wir. In diesem spannenden dystopischen Roman tauchte ich mit meiner Leserschaft in die Unwirklichkeit des folgenden Jahrzehnts ein. Natürlich bereitete es mir einige Mühe, wieder in die realistische Zeitreisewelt zurück zu tauchen. Aber was nölen Sie? Hier bin ich wieder!
Da Ihre Zeit wertvoll ist, meine auch, und wir beide wissen, dass die Zeit, in der wir hier im Vorwort herumpalavern, Zeit ist, die wir besser produktiv verbringen, will ich mich kurz fassen. Also: „Hasso, fass!“ Wenngleich auf dem Cover das Jahr 1994 ins Auge sticht, beginne ich dort, wo ich mit Band 7, »Neue Zeiten – 1990 etc.«, aufgehört habe – im Jahr 1993. Erst hatte ich vor, die Folgejahre im Schnelldurchgang zu beschreiben, um im vorliegenden Band bis zum Jahr 1999 zu gelangen. Denn dann hätte ich ihn wieder gehabt: meinen herkömmlichen, gewohnten Fünf-Jahres-Rhythmus. Aber als ich am Erzählen war, überschwemmten mich die Erinnerungen, die Dokumente und die Briefe, sodass ich dem Roman freien Lauf ließ.
Liebe Leserin & lieber Leser,
sind Sie gewillt, mir Ihr Vertrauen zu schenken? Möchten Sie schon in zwei oder drei Wochen
13 Millionen Dollar
auf Ihrem Konto haben? Okay. Dann glauben Sie mir bitte, dass ich alles dafür tun werde, um der ersten Person, deren Anfrage bei mir per Mail eingeht, nach Erfüllung kleinerer Formalien den Betrag in voller Höhe und ohne Gebrauchs- oder Eigentums-Vorbehalt zu überweisen.
Worum geht es? Mein Onkel mütterlicherseits, Stefano King, lebt seit über vierzig Jahren in der nigerianischen Küstenstadt Lagos, die bis 1991 Hauptstadt des Landes war. Mein Onkel ist dort seit Jahrzehnten äußerst erfolgreich im Ölhandel tätig und verfügt über ein Barvermögen von 192 Millionen Dollar, wovon 26 Millionen auf einem Sonderkonto in einer Sonderverwaltungszone angelegt sind. An dieses Geld möchte der nigerianische Staat, dem mein Onkel ansonsten keinen einzigen Steuercent schuldet, gerne herankommen – aber es funktioniert nicht, weil mein Onkel einen schlauen Anlageort und eine schlaue Anlageform gewählt hat.
Allerdings kann nun auch niemand anderes aus unserer Familie sich dieses Kontos bedienen. Deshalb sucht mein Onkel (über mich) eine vertrauenswürdige Person, die nicht aus Nigeria stammt und nicht mit seinem Namen in Verbindung gebracht werden kann. Günstig wäre es, wenn diese Person irgendein Gewerbe betreibt und die Entscheidung zur Teilnahme an der hier gebotenen Möglichkeit kurzfristig treffen kann.
Der Transfer des Geldes würde so ablaufen, dass nach Zahlung der erforderlichen Notargebühren für die Kontenumschreibung (ca. 5.000 Dollar), die 26 Millionen Dollar in voller Höhe dem Firmen- oder Privatkonto der europäischen Vertrauensperson gutgeschrieben würden. Nach Eingang dieses Betrages sollte – auf Vertrauensbasis! – die Hälfte des eingegangenen Betrages (also 13 Millionen Dollar) an meinen Onkel, den ursprünglichen Eigentümer, auf ein neues Konto außerhalb Nigerias zurückgezahlt werden. Die andere Hälfte verbleibt zur vollen und freien Verfügung bei der Vertrauensperson.
Da das Geld ohne fremde Hilfe als verloren angesehen werden müsse, wäre es für beide Seiten ein sehr vorteilhaftes Geschäft, schrieb mir mein Onkel. Er gibt mir übrigens dafür, dass ich dies für ihn hier organisiere, 1,5 Millionen Dollar ab. Wenn Sie, liebe Leserin, lieber Leser, sich also für dieses einmalige Angebot entscheiden, unterstützen Sie zugleich mich und meine brillante Literatur.
Bitte schenken Sie mir Ihr Vertrauen und mailen Sie mir noch heute! Ich verspreche, Ihren Antrag allen anderen vorzuziehen.
Hochachtungsvoll
Stefan Koenig
1993
Ein ähnliches, aber echtes Angebot hatte mich in meinem Frankfurter GTU-Büro in der letzten Woche des vergangenen Jahres erreicht. Frau Wenzel, die Sekretärin des Weiterbildungsinstitutes, hatte mir das Fax mit den Worten gereicht: „Jetzt endlich fließen mal ordentlich Dollars und nicht nur zaghafte Arbeitsamtszuschüsse!“ Das Fax hatte folgenden Wortlaut:
Guten Tag der Herr,
ich bin Rechtsanwalt Lawson Sogava, Ich habe Ihnen diesen Brief vor einem Monat geschickt, aber ich bin nicht sicher, ob Sie ihn erhalten haben. Ich möchte, dass Sie als Nachfolger meines verstorbenen Mandanten auftreten, der Staatsbürger Ihres Landes war und denselben Nachnamen wie Sie trägt.
Er starb bei einem Autounfall mit seiner Familie und hinterließ einen riesigen Geldbetrag (dreizehn Millionen fünfhundertachtzigtausend Dollar) auf der Bank. Nach einem erfolglosen Moment auf der Suche nach seinen Verwandten wegen des dringenden Auftrags, einen seiner Verwandten mit dem gleichen Nachnamen für die Überweisung und Einforderung des Geldes zu beauftragen, beschloss ich, Sie zu kontaktieren.
Ich werde Ihnen weitere Einzelheiten mitteilen, sobald ich Ihre positive Antwort erhalte.
Mit freundlichen Grüßen,
Rechtsanwalt Lawson Sogava
Ich hatte das Fax mit nach Hause genommen und las es erst heute, am dritten Tag des neuen Jahres, meiner Frau vor.
„Na, wenn das nicht wieder mal ein Versuch der nigerianischen Mafia ist, einen schönen Vorschussbetrug an den Mann oder an die Frau zu bringen“, sagte Emma und ging zu unserer CD-Sammlung. Dann legte sie einen Song der Prinzen auf.
Ich wär‘ so gerne Millionär
Dann wär mein Konto niemals leer
Ich wär‘ so gerne Millionär
Millionenschwer
Ich hab kein Geld, hab keine Ahnung
Doch ich hab ‘n großes Maul
Bin weder Doktor noch Professor
Aber ich bin stinkend faul
Ich habe keine reiche Freundin
Und keinen reichen Freund
Von viel Kohle hab ich bisher
Leider nur geträumt
Was soll ich tun, was soll ich machen?
Bin vor Kummer schon halb krank
Hab mir schon ‘n paarmal überlegt
Vielleicht knackst du eine Bank
Doch das ist leider sehr gefährlich
Bestimmt wird‘ ich gefasst
Außerdem bin ich doch ehrlich
Und will nicht in den Knast
Es gibt so viele reiche Witwen
Die begehr‘n mich sehr
Sie sind so scharf auf meinen Körper
Doch den geb‘ ich nicht her
Ich glaub, das würd ich nicht verkraften
Um keinen Preis der Welt
Deswegen werd‘ ich lieber Popstar
Und schwimm in meinem Geld
Ich wär‘ so gerne Millionär
Dann wär‘ mein Konto niemals leer
Wär‘ so gerne Millionär
Millionenschwer
Inzwischen hatte ich in verschiedenen Zeitungen gelesen, wie oft sich mittelständische Unternehmer auf solch – eigentlich offensichtliche – Betrugsmaschen der »Nigeria Connection« eingelassen und Vorschusskosten in Höhe von teilweise mehreren zig Tausend Mark geleistet hatten.
Ein Fall berührte mich besonders. Eine frisch verwitwete Frau eines Unternehmers (er hatte sich wegen der verzweifelten Lage seines Geschäftes erhängt) hatte bis auf 30.000 DM alle ihr nach dem Konkurs verbliebenen 60.000 Mark ratenweise an die Nigerianer überwiesen – immer in der Hoffnung, dass nach jeder Teilzahlung (erst für den angeblichen Notar, dann für den zu bestechenden Zollbeamten, für den Bankmitarbeiter, für den Finanzbeamten und schließlich für seine eigenen Bemühungen) der große Millionenbetrag an sie überwiesen würde. Als sie letztendlich begriff, dass sie das dämliche Opfer eines gar nicht mal so raffinierten Betruges geworden war, nahm sie sich nach dem tragischen Tod ihres Mannes ein Beispiel an ihm und folgte ihm. Vorher überwies sie die verbliebenen 30.000 Mäuse einem Tierschutzverein.
Was die Unterschlagungs- und Betrugsmasche meines Ex-Freundes Jan in unserer gemeinsamen Berliner Umweltbildungsfirma, der UTB, betraf, so war ich mir noch nicht sicher, wie es weitergehen würde. Müsste ich ihm, obwohl er mich reingelegt hatte, seinen Gesellschafteranteil auszahlen? Würde ich die UTB retten können? Die Berliner Arbeitsämter hatten Jan und Katrin bereits vor einem halben Jahr mitgeteilt, dass die Arbeitsverwaltungen einen Förderstopp für Umweltprojekte auferlegt bekommen hatten. Das hatten meine „Partner“ mir und dem gerichtlich bestellten Gutachter zur Wertermittlung der Firma verschwiegen. Demzufolge hatte ich Jan als meinem Co-Gesellschafter nach notarieller Beurkundung umgehend einen Kaufpreis in Höhe von 302.000 DM – nach Abzug der von ihm unterschlagenen Gelder – auszuzahlen. So viel Geld für eine nun so wertlose Bildungsgesellschaft!
Jedes Mal wenn ich in der Küche die Geschirrmaschine ein- oder ausräumte, musste ich seit Neuestem an Jan’s Coup denken. Wie konnte es geschehen, dass mich mein bester Freund hintergangen hatte? Warum hatte er Rechnungen fingiert und an eine heimlich gegründete eigene Firma überwiesen? Wie konnte er davon ausgehen, dass ich das nicht mitbekommen könnte? Hielt er mich für so schrecklich naiv? Für so blind und vertrauensselig? Welche Rolle hatte seine Frau dabei gespielt? Ich traute ihr ein simpel gestricktes Betrugsmotiv zu: „Das sind doch unsere Gelder, oder, Schatz? Was hat der Stefan eigentlich damit zu tun?“
Aber selbst wenn sie die dreiste treibende Kraft gewesen sein sollte, so war ihr intelligenter Göttergatte doch die zustimmende und aktiv an diesem galanten Betrug beteiligte Person. Mein Freund hatte mein Freundschaftsvertrauen schamlos ausgenutzt.
Natürlich fiel mir nach einer Weile auf, dass mich diese elenden Gedanken immer nur bei der Handhabung des Geschirrspülers beschlichen. Erst nach einigen Wochen fiel bei mir der Groschen: Na klar, als die Gerichtsvollzieherin klingelte, war ich gerade beim Ausräumen des Geschirrs gewesen. Die Psyche tickte nach ihrer eigenen Uhr. Trotz dieser Erkenntnis blieb es noch zehn Jahre dabei: Wann immer ich die Maschine ein- oder ausräumte, flammten unselige Gedanken an Jan und Katrin auf. Die Berliner UTB, ich ahnte es, sollte mir noch arge Kopfschmerzen bereiten.
Meine beiden Bad Langensalzaer Umweltinstitute und die Frankfurter Bildungseinrichtung hingegen liefen gut. Aber man musste sich auch hier „kümmern“. Immer noch grätschte uns Frau Söhnlein, die schräge und schroffe Nudel der Frankfurter Arbeitsamt-Förderstelle, dazwischen. Sie ließ uns monatelang auf die Bewilligungsbescheide warten, verzögerte Antworten auf Anfragen von uns oder von Kursteilnehmern oder von anderen Bewilligungsämtern außerhalb ihrer Zuständigkeitszone. Bürokratenkram. Bürokratenarroganz. Bürokratenignoranz. Es war zermürbend, wenn man es ernst nahm.
Doch gerade deshalb war ich ja im Frühsommer letzten Jahres auf jenem Zen-Seminar von Pater Willigis Jäger im Kloster St. Benedikt in Würzburg gewesen – wie entspanne ich und reflektiere den wahren Sinn des Lebens auch in stressigen oder scheinbar sinnlosen Situationen? Das dreitägige Schweigeseminar hatte mich im wahrsten Sinne des Worte zur Besinnung gebracht. Frau Söhnlein war nun nicht mehr mein „Feind“. Sie war auch kein „widerliches Beamtenarschloch“, keine „Unperson“ mehr, wie ich sie insgeheim in einer meiner gemeinen geistigen Schubladen abgelegt hatte. Ich begriff sie jetzt als das, was sie, unabhängig meiner persönlichen Betroffenheit, war: ein verbeamtetes Rädchen im großen Rad eines bürokratischen Getriebes, dessen Lauf ich zu keiner Zeit oder – wenn überhaupt – nur sehr begrenzt beeinflussen konnte.
Was ich tun konnte, tat ich. Unser Bildungsbetrieb musste ordnungsgemäß und strukturiert weiterlaufen – auch wenn mal die Finanzen wegen Söhnleins Verschleppungstaktik hinter unserem Bedarf hinterher hinkten. Auch deshalb musste ich persönlich bei der Bank eine Bürgschaftserklärung unterschreiben. Denn um die fälligen Gehälter und Sozialleistungen zu bezahlen, musste das Konto regelmäßig überzogen werden.
Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung hin oder her – in Sachen Kreditabsicherung war dies den Banken völlig schnuppe und sie kannten kein Erbarmen. Allein für die Fixkosten waren monatlich rund 140.000 DM fällig, für die ich als Geschäftsführer persönlich haften musste. Hinzu kamen Miete, Umlagen, Abonnements, Versicherungen, Büro- und Telefonkosten etc. – doch ich zerbrach mir nicht mehr den Kopf, auch wenn ich ihn hinhielt.
Ich hatte mit meiner Frau Gütertrennung vereinbart, sodass im Falle eines Falles nicht auf das Vermögen der gesamten Familie zurückgegriffen werden konnte. Mein Vermögen bestand in Form meines Frankfurter Elternhauses, einer kleinen Stadtvilla. Okay, das war in der Bankerstadt einen Batzen wert. Aber Emmas Vermögen bestand aus nichts weiter als aus ihrem Gehalt. Es war beruhigend zu wissen, dass man nicht nur einem nackten Mann, sondern auch einer nackten Frau nicht in die Taschen greifen konnte.
Am Abend eines kalten Wintertages, es war Sonntag, der 3. Januar, saßen Emma und ich vor dem wärmenden Kamin. Das Birkenholz knisterte, und auf dem Beistelltisch wartete auf uns ein heißer Punsch mit Orangen- und Zitronenscheiben, Kandis, Zimt und Kardamom. Die Kinder waren im Bett. Heute hatte ich ihnen etwas aus meiner uralten Pfadfinderzeit erzählt – die Geschichte vom Rehlein, das wir gerettet hatten. Die Story war für Karola und Luca ein Dauerbrenner. Emma hatte in der Zwischenzeit die Küche aufgeräumt und drang nun darauf, mit mir über „unsere Lebensplanung“ und über „diese Scheißsache mit deinem Verbrecherfreund“ zu sprechen.
*
An diesem Sonntagabend, dem 3. Januar 1993, sitzt Erich Honecker an dem kleinen Stahltisch seiner Zelle in Moabit und schreibt seiner Frau:
»Liebe Margot!
Es ist Sonntag. Seit gestern, meine Liebe, hat sich nichts ereignet, was hier festgehalten werden müsste. Nur eins ist sicher, wir müssen versuchen, dass der Prozess nicht weiter zu einem medizinischen Seminar verkommt. Es geht nicht um meine krebskranke Leber, sondern um die Verdammung der DDR. Es geht darum, von der Politik der Bundesrepublik abzulenken, um die weiter wachsenden positiven Gefühle zur DDR zu bekämpfen, in der es im Gegensatz zu heute Arbeit und Brot, mehr Gerechtigkeit, gesellschaftspolitisch und ökologisch neue Wege zur Lösung der Fragen gab, die heute die arbeitenden Menschen und die Menschen, die arbeiten wollen, bedrücken.
Habe den Programmentwurf der PDS zu ihrem Parteitag gelesen. Ich wollte sehen, wie sie zum demokratischen Sozialismus kommen wollen. Was sie sich darunter vorstellen. Die SPD war da schon einmal weiter. Aber das war vor 150 Jahren. Jeder Vergleich wird dies bestätigen, obwohl es heute andere Probleme gibt. Nicht zu verstehen ist, dass man das Gute der Vergangenheit pflegen will, sich aber von den Verbrechen der SED distanziert. Was soll das heißen? Welches Verbrechen hat denn die SED begangen? Man sollte sich beeilen, diese dem Staatsanwalt zu melden, dass er sie noch mit in meinen Prozess aufnimmt.
Dazu brauchen sie allerdings auch Spinner als Zeugen wie Schürer, Schabowski und Krolikowski. Wahre »Helden«. Sie konnten ja nicht einmal die überraschend aufgetauchten 50 Milliarden Auslandsschulden eintreiben, damit sie der DDR etwas bringen, für den Aufbau des Sozialismus.
Gestern kam die Meldung vom elektronischen Zaun, den Bonns CDU-Innenminister Seiters an der Grenze zu Polen und der Tschechoslowakei aufbauen will – aus, wie es heißt, den Beständen der Nationalen Volksarmee.
Es ist klar, Grenze ist nicht gleich Grenze. – Der Menschenstrom aus dem Osten und dem Südosten muss aufgehalten werden. Alle finden das in Ordnung. Die meisten finden es ja auch in Ordnung, für die Interessen des Kapitals in den Krieg zu ziehen. Da kann man wirklich nur sagen: Armes Deutschland!
Gestern gab es in Deutschland wieder sieben, vielleicht sogar neun Tote bei rassistischen kriminellen Aktionen. Was ist mit Deutschland los? Sollen künftig Mord und Totschlag das Leben bestimmen? Heute ist der Faschismus in dieser oder jener Form schon wieder Realität. Wer hätte gedacht, dass alles so schnell geht. Der »große Reformer« in Moskau kann sich wirklich gratulieren. Der deutsche Imperialismus und Militarismus ist von seinen Fesseln befreit, die der Sieg der Roten Armee ihm damals anlegte. Die ihm dabei geholfen haben, tragen die Verantwortung für die Kriege, die jetzt wieder möglich sind, sei es auf dem Balkan, im Nahen Osten oder in Fernost.
Die Toten von Sarajewo sind wichtig für die Propaganda gegen den Kommunismus.
Ich habe das unangenehme Gefühl, dass alles, was dem deutschen Imperialismus entgegenwirkt, als kommunistisch infiziert hingestellt werden soll. Die BRD ist kein Rechtsstaat, sondern ein Staat der Rechten. Je später dies die Menschen bemerken, desto besser für diesen »Rechtsstaat«.
Nun, wir werden es sehen. Morgen soll das Thema ja weitergehen.
So, liebe Margot, jetzt weiß ich, warum mir so komisch ist. Mein Blutdruck: 110/60, Puls 84. Du siehst, ich habe mich, was den Blutdruck betrifft, deiner Marke angenähert. Wie ich befürchte: zu sehr.
Das Buch habe ich weggelegt. Ich halte das Lesen nicht mehr durch. Ein besseres Buch würde da auch nicht helfen. Jetzt drückt mich der Kaffee.
Es scheint mit mir nun doch mit großem Tempo bergab zu gehen. Froh bin ich, dass meine Anwälte das immer wieder klargestellt haben. Aber das »medizinische Seminar« kann alles wieder im Orkus verschwinden lassen. Die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, hauptsächlich der 29.12., hat viel zutage gefördert.«
*
Sechs Tage zuvor hatte Honeckers Anwalt Becker den Erlass einer einstweiligen Anordnung beim Berliner Verfassungsgericht beantragt, verbunden mit einer Verfassungsbeschwerde:
»Die Fortführung eines Strafverfahrens und einer Hauptverhandlung gegen einen Angeklagten, von dem mit Sicherheit zu erwarten ist, dass er vor Abschluss der Hauptverhandlung und mithin vor einer Entscheidung über Schuld oder Unschuld sterben wird, verletzt die Menschenwürde des Betroffenen.
Die Menschenwürde beinhaltet insbesondere das Recht eines Menschen, in Würde sterben zu dürfen, sich zum Sterben zurückziehen zu dürfen und nur noch mit den von ihm gewünschten Personen zusammen zu sein. Die Tatsache, dass der Beschluss des Landgerichts vom 21.12.1992 bedeutet, dass der Gerichtssaal für den Angeklagten zum Sterbezimmer werden soll, dass eine große Öffentlichkeit an seinem ständigen Schwächerwerden teilhat, er im Sterben noch vor die Öffentlichkeit gezerrt wird und das Strafverfahren zur Strafe verkommt und seines Erkenntnischarakters entkleidet wird, verletzt die Menschenwürde des Angeklagten.«
Und noch jemand bangt in jenen Tagen um die Menschenwürde, weil man ihr entgegen aller Entlastungsbeweise den Mord an ihren beiden kleinen Töchtern angehängt hatte – samt lebenslangem Freiheitsentzug.
Fernab, 560 Kilometer südlich der Moabiter Gefängniszelle, sitzt Monika Weimar in der Frankfurter Frauenhaftanstalt und weint ihre nun seit langem trockenen Tränen. Sie sitzt in einer Einzelzelle und verfasst Anfang Januar einen Eintrag in ihr Tagebuch. Sie und ihr in solchen komplizierten Verfahren recht unerfahrener Anwalt waren in den letzten Jahren darum bemüht, die Wiederaufnahme des Verfahrens zu erreichen. Doch mit diesem bisherigen Anwalt schien es nicht zu funktionieren.
»Endlich habe ich im vergangenen Sommer einen neuen Verteidiger gefunden, der sich bei mir gemeldet hatte. Er, Dr. Gerhard Strate, habe sich meinen Fall zu eigen gemacht und wolle alles unternehmen, um eine Wiederaufnahme des Verfahrens und meinen Freispruch zu erwirken. Es sei keineswegs hoffnungslos, er habe meinen Fall verfolgt. Ich machte mich kundig und fand heraus, dass er ein bundesweit bekannter und sehr erfolgreicher Strafverteidiger ist. Er machte mir auf Anhieb einen kompetenten und entschiedenen Eindruck. Seine Art ist offen und direkt. Als Honorar nimmt er nur das, was der Staat mir als Prozesskostenhilfe zubilligt. Ich vertraue ihm.
Im Dezember reichte Dr. Strate den Antrag auf Wiederaufnahme meines Verfahrens beim Gießener Landgericht ein. Er hat inzwischen neue Zeugen aufgewiesen, die meinen Ex-Mann Reinhard belasten. Gleichzeitig hat er ein Fasergutachten anfertigen lassen, das zu anderen Ergebnissen kommt – was meine angebliche Tatkleidung betrifft – als das vom Landeskriminalamt, das das Fuldaer Gericht in Auftrag gegeben hatte.
Nun fängt also die Zeit des Wartens von Neuem an. Es ist jetzt die letzte Chance auf Gerechtigkeit, die ich habe. Meine innere Unruhe, die Verkrampfung durch das tägliche Warten, wie es weitergeht, meine Angst vor einer Ablehnung des Antrags, all das kehrt wieder zurück. Aber ich werde durchhalten – meinen toten Kindern zuliebe. Ich bin ihnen die Aufklärung schuldig. Ja, ich halte durch!«
*
Emma wollte die Veränderung. „Durchhalten ist zu diesem Zeitpunkt falsch“, meinte sie. Sie fand, es war Zeit, das Heft als Familie in die Hand zu nehmen und nicht die Geschichte über uns hinweg rollen zu lassen. Also setzten wir uns an einem ruhigen Abend zusammen und beratschlagten.
Es war gewiss Zeit, über unsere Zukunft zu reden, einen Plan zu schmieden. Dies auch deshalb, weil unsere beiden Kids im vergangenen Jahr bereits zwei Mal eine heftige Lungenentzündung davongetragen hatten. Wir sahen die Ursache in Frankfurts schlechter Luft, geschuldet dem Verkehr und dem Hoechster Chemiewerk.
Zudem war seit der Erfahrung mit den Berliner Arbeitsämtern damit zu rechnen, dass auch hier im wilden Westen in Sachen Umweltschutz mit Mittelkürzungen gerechnet werden musste. Oder damit, dass generell für Fortbildung und Umschulung aufgrund der hohen Wiedervereinigungskosten kein Geld mehr da sein sollte. Die Zukunft sah nicht rosig aus.
„Lass uns das Haus verkaufen“, sagte Emma. „Wir sollten aufs Land ziehen.“
„Du stellst dir das zu einfach vor“, entgegnete ich. „Wie wollen wir vom Land aus für unsere Institute arbeiten? Wie wird die Schulsituation für die Kinder sein? Was wird aus den Freundschaften der Kurzen? Wird das einen großen Knacks geben? Wie sieht es auf dem Land mit der ärztlichen Versorgung aus?“
„Lass uns darüber später reden. Ich glaube, die Kinder schaffen die Umstellung gut. Insbesondere, wenn wir zufrieden sind, wenn wir Eltern uns freuen und wenn Wohnumgebung, Schule und Freizeitangebote überzeugen. Und genau das scheint mir in Laubach gegeben zu sein.“
„Aber wie wird Lollo diese Nachricht verkraften?“, fragte ich.
„Deine Mutter hängt an unseren Kindern; sie wird jeden Tag hilfebedürftiger und die Frankfurter Luft tut ihr genauso wenig gut wie unseren Zwergen. Sie hat es seit drei Jahren mit den Bronchien, seit dem Tod deines Vaters. Landluft, Ruhe vor der Großstadthektik und die Freude mit ihren Enkelchen werden ihr den vorübergehenden Abschiedsschmerz ertragen helfen.“
„Vorübergehender Abschiedsschmerz? Und wenn er anhält? Heißt es nicht: Einen alten Baum verpflanzt man nicht?“
„Irgendwann, früher oder später, müsste sie in ein Seniorenheim, wenn sie in Frankfurt alleine zurückbleibt. Bei uns, in der Familie, ist sie gut aufgehoben. Sie wird sich noch gebraucht fühlen, das hält fit. Umgekehrt werden wir uns um sie kümmern, sie pflegen und versorgen, wenn es soweit ist. Das haben wir deinen Eltern versprochen.“
„Was machen wir aber, wenn sie wie ihre Freundin Friedel irgendwann an Demenz leidet?“ Ich kam darauf zu sprechen, weil ich erst kürzlich den Eindruck hatte, dass sich in ihrem Verhalten etwas verändert hatte. Wortfindungsstörungen waren dabei das Wenigste. Ich hatte Lollo in der Straßenbahn zu einem Arzttermin begleitet. Der Firmenwagen stand an diesem Vormittag wegen einer GTU-Exkursion nicht zur Verfügung. Ein GTU-Dozent hatte um meinen Wagen gebeten und ich hatte ihn versprochen.
Lollo setzte sich ans Fenster der Bahn. „Wohin fahren wir?“, fragte sie.
Wir waren gerade von zu Hause gekommen und eingestiegen. Die Tram hatte sich noch nicht bewegt.
„Zum Arzttermin, zu Dr. Kowiak an der Paulskirche.“
„Und wo sind wir gewesen?“
„Wir waren bis eben bei uns zu Hause.“
Sie hatte mich fragend angeschaut.
„Und wo wohnt der Dings, wie heißt er?“
„Dr. Kowiak?“
„Nein, ich meine den Arzt“, sagt sie entschlossen.
„Kowiak heißt der Arzt, das ist sein Name“, antwortete ich und ließ mir meine Verwunderung nicht anmerken.
„Stimmt“, sagt sie. „Das ist doch mein Zahnarzt, oder?“
„Nein, wir haben heute die Untersuchung bei einem Lungenfacharzt wegen deiner anhaltenden Bronchitis.“
Ich hatte Emma davon berichtet. Doch wir hatten Lollos Verhalten lediglich auf eine akute Überforderung zurückgeführt. Wahrscheinlich hatte sie den bevorstehenden Umbruch irgendwie mitgekriegt, vielleicht hatte sie Teile unserer Unterhaltung in Sachen UTB-Berlin mitgehört und sich ihre eigenen Gedanken gemacht. Außerdem hatte sie die Tage zuvor über Kopfschmerzen geklagt.
Jetzt goss uns meine Frau vom Punsch ein und sagte: „Was kommt, das kommt, man kann es nicht ändern – wir werden sehen …“ Und dann wartete sie mit einigen Überraschungen auf: „Ich habe Kontakt zur Familie Schmidt vom Panoramahof in Laubach aufgenommen. Sie kennen eine Familie Siegfried, die ihr Haus verkaufen möchte. Die Kinder sind schon lange aus dem Haus und das ältere Ehepaar möchte in ein kleineres Haus umziehen. Der Garten hat 2000 Quadratmeter, und die beiden Herrschaften können das nicht mehr bewirtschaften. Wollen wir uns das Haus einmal anschauen? Wir könnten die Siegfrieds schon morgen besuchen …“
Ich war baff. Und ich war nicht abgeneigt. Ich sah mir das Städtchen auf der Karte an – gewissermaßen ein Sackgassenstädtchen am Eingang zum Naturpark Hoher Vogelsberg. Das gefiel mir. Emma berichtete, dass es dort eine Grundschule, eine Gesamtschule bis zur 10. Klasse und ein Evangelisches Gymnasium, das Laubach-Kolleg, sowie eine kleine Klinik mit Geburtsabteilung gebe.
Im Schloss der Residenzstadt Laubach hat die gräfliche Familie Solms ihren Sitz, und die dortigen Pfadfinder tragen ihren Namen: »Solmser Pfadfinderschaft«. Das konnte ich noch an diesem Abend im Telefonat mit Frau Siegfried, der ich unseren Besuch für das Wochenende ankündigte, erfahren. Es erinnerte mich an meine eigene schöne Pfadfinder-Zeit und daran, dass ich Karola und Luca erst kürzlich versprochen hatte, für sie in Frankfurt eine Pfadfindergruppe ausfindig zu machen. Die Laubacher Verhältnisse und die gesamten Umgebungsbedingen schienen mir ideal.
„Danke, Schatz, dass du das alles bereits vorbereitet hast. Ich hoffe, dass wir dort ein in vielerlei Hinsicht gesünderes Leben führen können … Natürlich muss uns zu allererst das Haus gefallen!“
„Und das Residenzstädtchen liegt fast genau in der Mitte zwischen dem Umweltzentrum Bad Langensalza und dem Frankfurter Umweltzentrum. Du hast es nicht allzu weit nach Thüringen und kannst noch am gleichen Tag zurückkommen.“
„Und noch ein Vorteil: Wenn wir mein Elternhaus verkaufen und ich dir den Verkaufserlös übereigne, könntest du davon unser neues Haus in Laubach erwerben und der Besitz wäre erst einmal aus der pfändbaren Schusslinie, falls der Kaufvertrag mit Jan Hoffer nicht rückabgewickelt werden kann.“
*
»Moabit, 7. Januar 1993
Liebe Margot!
In dieser Nacht habe ich wieder von Dir und von Deinem Nest geträumt. Mein Gott, dass das alles so kam. Es ist kaum zu glauben, wie die Menschen manipuliert werden können. Dieser Hexenprozess, diese Sippenhaft. Diese, ich finde kaum Worte, um die Haltung und die Handlungen derer zu beschreiben, die das nicht nur uns, sondern auch dem ganzen Volk zufügen, was sich so täglich tut. Es sind nicht nur die Pharisäer und Schriftgelehrten.«
Der Brief Honeckers blieb unabgeschlossen. Die Verhandlung am 7. Januar endete mit der Verkündung des Beschlusses, das Verfahren gegen Erich Honecker abzutrennen. Es bedeutete eine Vorentscheidung, wie sein Anwalt Friedrich Wolff feststellte. Entsprechend verabschiedete sich Honecker von seinen Mitangeklagten in dem Bewusstsein, sie nicht mehr wiederzusehen. Wolff sagte gegenüber der Presse: „Der Abschied war allseits herzlich und bewegend.“
Dennoch sollte am Dienstag, dem 12. Januar, eine neue Untersuchung erfolgen. Am Tag zuvor waren die Anwälte Becker und Wolff bei ihrem Mandanten gewesen. Man erörterte die Situation. Honecker war mut- und lustlos. Er wollte auch keine Briefe an Familie und Freunde mehr schreiben. Am Dienstagmorgen war Wolff erneut bei Honecker.
Dort erreichte ihn der Anruf seines Kollegen Becker: „Das Verfassungsgericht hat den Beschluss des Kammergerichts vom 28. Dezember und den des Landgerichts vom 21. Dezember aufgehoben und die Sache an das Landgericht zurückverwiesen sowie die Einstellung des Verfahrens und die Aufhebung des Haftbefehls gefordert. Das ist das Ende des Prozesses!“
Friedrich Wolff erinnerte sich: „Honecker reagierte in einer Weise, die mich befürchten ließ, er würde die frohe Botschaft nicht überleben. Danach ging alles Schlag auf Schlag. Und dennoch, die Stunden vergingen langsam, die Entlassung ließ auf sich warten. Neue Ungewissheit kam auf. Dr. Rex stellte Honecker vorsorglich ein Attest über seine Flugfähigkeit aus. Ich wartete bei ihm in Moabit. Wir unterhielten uns noch einmal über die Moskauer Ereignisse von dem Abflug aus Deutschland bis zur Auslieferung an Deutschland. Irgendwann ließ ich ihn allein.“
Am Samstag jener Woche beschlossen Emma und ich, unsere vielleicht zukünftige Heimat zu besuchen und uns das Haus der Familie Siegfried anzuschauen. Wir packten die Kinder in den geräumigen Mitsubishi-Bus und fuhren los. Nach nur fünfzig Minuten erreichten wir das Ziel. Das Haus in der Andree Allee 8 war groß, die Fassade weiß und die Holzständerelemente aus dem späten Anfang des Jahrhunderts waren in einem dunklen Königsblau gestrichen. Über dem großräumigen Freisitz am Eingang zeigte sich ein rundum mit Holzelementen und Glas verzierter Wintergarten. Das Haus hatte etwas Einladendes.
Die beiden Hausbesitzer hatten Kaffee und selbstgebackenen Kuchen für uns vorbereitet. Aber zuvor wollten wir »das Objekt«, wie es ein Makler kühl und sachlich nennen würde, besichtigen; die Neugier war zu groß. Wir waren überwältigt von einem Gefühl, das Emma und mir, wie wir später übereinstimmend feststellten, sofort den Eindruck von „Heimat“, von „Angekommen-sein“ vermittelte.
Frau Siegfried erzählte uns die Geschichte des Hauses. Es war 1928 von Pfarrer Nebel gebaut worden, weshalb es im Städtchen das „Nebel-Haus“ genannt wurde. Als die Pfarrersfrau verstarb, bewohnten nur noch er und seine beiden Töchter das wunderschöne Landhaus. Nach seinem Tod und nach Kriegsende 1945 wurde es von seinen Töchtern erst als Flüchtlingsheim und dann als Kinderheim zur Verfügung gestellt. Mitte der 1950er-Jahre hatte das Ehepaar Siegfried mit ihren drei Töchtern das Haus erworben. Und jetzt, 43 Jahre später, waren sie bereit, sich von ihrem Familiensitz zu lösen und das Haus „in gute Hände“, wie sie sagten, zu geben.
Das dreistöckige Holzständerhaus verströmte eine angenehme Atmosphäre, man meinte noch die Lebendigkeit des ehemaligen Kinderheimes zu spüren. Es war großzügig und sehr stilvoll gebaut. Zimmeraufteilung und Hausklima waren ideal. Die Zwischenräume des Fachwerks bestanden aus Bimsstein und einem gestampften Stroh-Lehm-Gemisch – das sorgte für eine gute Dämmung im Winter und ein kühles Innenklima im heißen Sommer.
Unsere Kinder sagten zu den beiden Siegfrieds gleich »Oma« und »Opa«, und wir beschlossen, den Kaufvertrag so schnell wie möglich abzuschließen. Bereits eine Woche später verblüfften wir die Siegfrieds mit einem Vorvertrag, den unser Frankfurter Notar, Dr. Ruckel, ausgefertigt hatte. „Warum ein Vorvertrag, warum nicht gleich der endgültige Kaufvertrag?“, fragte Frau Siegfried.
„Wir wollten Sie nicht überrumpeln“, antwortete Emma. Und dann wurden wir uns einig und saßen allesamt eine Woche später vor dem Notar.
Bei ihm saßen wir einige Tage später noch einmal, denn zwischenzeitlich hatten wir das Frankfurter Haus zum Kauf ausgeschrieben und dem höchst bietenden Interessenten angeboten. Die Stadtvilla war sehr begehrt und der Verkauf erfolgte im Schnelldurchlauf. Mit dem Gedanken des Verkaufs hatte sich Lollo hatte erst schwer getan, lieber hätte sie das Haus nur vermietet. Ich erklärte ihr, dass wir mit dem Verkaufskapital das neue Haus finanzieren mussten. Sie sah das ein und sagte: „Allein wegen der Kinder ist es vernünftig, aufs Land zu ziehen.“ Dass zu dieser Zeit noch zwei Seelen in ihrer Brust kämpften, bekamen wir erst später mit.
Alleinige Eigentümerin unseres neuen Heims in der Residenzstadt am Tor zum Naturschutzpark Hoher Vogelsberg wurde meine Frau. Die beiden Siegfrieds schauten etwas irritiert, aber wir erklärten ihnen, dass mein unternehmerisches Risiko zu groß sei, um mich als Eigentümer einzubinden.
Als ich in dieser Sache vorab mit Dr. Ruckel telefonierte, sorgte er für eine unerwartete und enorm erleichternde Überraschung: „Was die UTB-Angelegenheit betrifft, so wollte ich Sie gerade in diesen Tagen über eine erstaunliche Wendung unterrichten: Der Kaufvertrag zwischen Dr. Hoffer und Ihnen wurde zu keinem Zeitpunkt rechtsgültig; er wurde rechtsfehlerhaft abgeschlossen, und daran bin ich schuld – zu Ihrem Glück. Denn ich hatte Herrn Hoffer versehentlich nur eine Ausfertigung der Kaufurkunde, also eine Kopie, und nicht die erforderliche Originalurkunde zugestellt. Das Original allein ist jedoch maßgebend. Damit ist kein Kauf zustande gekommen.“
„Echt nicht?“
„Ganz sicher! Ich werde jetzt die Kopie zurückfordern, was aber nicht zwingend notwendig ist, und dabei – und allein darauf kommt es an – den Kauf als nicht vollzogen erklären. Ihr Kaufangebot nehme ich gleichfalls durch Widerruf zurück. Somit sind Sie völlig aus dem Schneider.“
In Gedanken machte ich eintausend Freudensprünge und ein erleichterndes Jauchzen entfuhr mir.
„Dann wird er wohl an Sie herangehen und Sie in die Regresspflicht nehmen.“
„Da wird er sich die Zähne ausbeißen“, lachte Dr. Ruckel ins Telefon. „Aber wenn Sie wollten, könnten Sie unter diesen Umständen wieder Hausbesitzer werden.“
„Lieber nicht. Wer weiß, was die Arbeitsverwaltung noch an Kapriolen und Unzuverlässigkeiten bereit hält. Wenn etwas den Bach runtergehen sollte, steht die Familie nackt da. Das möchte ich nicht.“
„Aber Sie sind sich bewusst, dass vielleicht auch Sie nackt dastehen könnten.“
„Nicht zu verhindern“, sagte ich, und damit war für mich das Thema vom Tisch.
Honeckers Anwalt
Am Mittwoch, dem 13. Januar, war Rechtsanwalt Wolff wieder bei Honecker. Gegen elf Uhr faxte die 14. Große Strafkammer ihren Beschluss über die Ablehnung der Eröffnung des Hauptverfahrens wegen Vertrauensmissbrauchs in der Zeit von Januar 1972 bis Oktober 1989 sowie über die Aufhebung ihres Haftbefehls. Die Haftanstalt ließ wissen, die Entlassung stehe definitiv fest.
Doch die Gefängnistore öffneten sich für Honecker noch nicht.
Schließlich kam die Nachricht, dass er seine persönlichen Sachen in Empfang nehmen solle. Wolff begleitete ihn zur Kammer, wo er in Gegenwart des Bediensteten seine Krankenhauskleidung ablegte und seine persönlichen Sachen anzog.
Rechtsanwalt Wolff erinnert sich: „Ich stellte mir vor, wie sich wohl andere Staatsoberhäupter in einer entsprechenden Situation verhalten würden. Bei Honecker verlief die Szene ganz natürlich. Gegen 13 Uhr verabschiedeten wir uns. Wir dachten, nun sei endgültig alles geregelt. Hinter den Kulissen wurde jedoch eifrig weiter agiert, um aus der Prozessfarce noch ein deutsches Epos zu machen.“
Ein Staatsanwalt rief bei Rechtsanwalt Wolff an und ließ wissen, dass Honecker noch einmal auspacken müsse, weil er sich nun doch noch der Hauptverhandlung stellen müsse. In seinem naiven DDR-Juristengemüt konnte Wolff sich allerdings nicht vorstellen, dass da noch rechtsstaatlich etwas laufen könnte, was in die Richtung dieser staatsanwaltlichen Ambitionen ging. Für ihn stand fest, dass Honecker um 20.25 Uhr nach Chile flog. Alles andere hielt er für Spinnerei. Wahrheitsgemäß erklärte er dem Staatsanwalt, der ihn anscheinend zu seinem Vollzugsbeamten machen wollte, er wisse nicht, wo sein Mandant sei.
Auch Honnis zweiter Anwalt Becker erhielt einen ähnlichen Anruf, an den sich der Strafverteidiger erinnert: „Noch um 17.30 Uhr rief mich ein Staatsanwalt an, berichtete mir, das Kammergericht habe den Einstellungsbeschluss wegen eines Formfehlers aufgehoben. Jetzt müsse Honecker hierbleiben, da die Einstellung in der Hauptverhandlung verhandelt werden müsse. Aufgeregt wiederholte er immer wieder: ‚Jetzt ist er bösgläubig, jetzt ist er bösgläubig.‘ Gemeint war Honecker. Der Staatsanwalt las Honecker sogar telefonisch den Beschluss des Kammergerichts noch auf dem Flughafen vor, aber der interessierte sich nicht mehr für juristische Finessen.“
Erich Honecker flog planmäßig um 20.25 Uhr von Berlin-Tegel nach Santiago de Chile ab, wo seine Frau Margot und seine Tochter auf ihn warteten.
Am Kiosk erschien ein neues Nachrichtenmagazin. Es nannte sich »Focus«. Ich kaufte es aus Neugier und stellte enttäuscht fest, dass es wohl keine besonders hochwertige Errungenschaft eines unabhängigen und ausgewogenen Journalismus war. Die Berichte waren schon in der ersten Ausgabe tendenziös – nur ein weiteres Unternehmerblättchen.
Im Golfkrieg wurden vermehrt Angriffe der USA und anderer NATO-Staaten gegen den Südirak geflogen – aber das berührte uns hier nicht weiter, jedenfalls nicht die schöne bunte Medienwelt. Der Irak blieb weit weg; er konnte ja nicht zu uns herüberwandern.
Mein Freund Hörbi beschrieb es in einem Leserbrief an die Frankfurter Rundschau so: „Die Einflussnahme von kapitalorientierten Medienoligarchen auf die politische Meinungsbildung der Bevölkerung nimmt Fahrt auf. Die Öffentlich-Rechtlichen werden allmählich wohl abgedrängt.“
Am 2. Februar jährte sich der 50. Jahrestag der Beendigung der Schlacht von Stalingrad. In Russland wie in Deutschland fanden Gedenkfeiern statt. Der russische Präsident Boris Jelzin, dieses Mal ohne Wodka-Schwips, und Kanzler Helmut Kohl riefen in Ansprachen und in einem diplomatischen Briefwechsel zur Versöhnung und Partnerschaft zwischen ihren Völkern auf.
Am Ende der ersten Februarwoche ging das Laubacher Landhaus in unser Eigentum über. In einem überschäumenden, großen Liebestaumel sorgten Emma und ich für die zukünftige Auslastung der Wohn- und Nutzfläche, indem wir liebevoll alles dafür Notwendige unternahmen. Am Abend Brettspiele, danach Bettspiele. Seitdem war unser drittes Kind unterwegs, worüber wir uns bereits Anfang März im Klaren waren.
Frau Wenzel, unsere Frankfurter Sekretariatschefin, bemerkte Emmas Bäuchlein als erste, hielt aber dicht. Sie war sehr aufmerksam und immer diskret. Deshalb wohl sorgte sie sich auch um die von mir angeblich vernachlässigte Kommunikationstechnik. Noch immer schleppte ich den schweren Mobilfunkkasten im Geschäftswagen mit, wenn ich auf Dienstfahrt gen Osten fuhr.
„Dieses veraltete Funktelefon von Motorola führen Sie schon seit fünf Jahren mit sich herum. Es wird Zeit, dass ich Ihnen etwas Neues besorge.“
„Welchen Vorteil soll das bringen?“, fragte ich.
„Das Bosch-Handy CarTel SC ist ein Federgewicht der D-Netz-Telefone. Wiegt nur 285 Gramm. Mein Mann hat es, und man muss auf keinen Komfort verzichten.“
„Was brauche ich denn groß an Komfort?“
„Das merken Sie erst, wenn Sie ihn haben: Menügesteuerte Bedienerführung, ein 2-zeiliges LCD-Display, 100 Kurzwahlspeicher plus Telefonkartenspeicher, automatische Wahlwiederholung, Notizbuchfunktion, permanente Feldstärke- und Batterieanzeige, Betriebszeit ganze 60 Minuten. Also, was wollen Sie mehr?“
„Und was kostet der Spaß?“, fragte ich in meiner Funktion als Betriebsgeizhals.
„Ein kleines Sümmchen. Aber das rentiert sich, glauben Sie mir!“
„Wieviel?“
„1.198,00 Mark. Darin sind sogar die Freischaltgebühren für die D-Netzkarte und drei Monate Grundgebühr für das D1- oder das D2-Netz enthalten!“
Ich knickte ein. Sie bestellte per Post. Als ich nach Betriebsschluss nach Hause fuhr, sah mein telefongeschärftes Auge an fast jeder Straßenecke eine leuchtend gelbe Telefonzelle stehen, mit mindestens drei Seiten aus Glasscheiben, damit man schon von Weitem sah, ob die Zelle besetzt war und man seinen dringenden Anruf vielleicht doch lieber erst am nächsten Telefonhäuschen probierte.
Da fiel mir ein, dass Meise morgen zu Besuch kommen wollte, und es war kurz vor Ladenschluss. Also hielt ich an, um schnell noch Emma Bescheid zu geben, damit sie etwas einkaufen konnte. Mein altes, schweres Motorola-Kastentelefon musste hinten im Kofferraum sein. War es aber nicht; wahrscheinlich hatte ich es im Büro neben meinem Schreibtisch stehen gelassen.
Da kam mir der Münzfernsprecher an der Straßenecke gerade recht. Die Tür ging immer nach innen auf, schob sich dann mit der gesamten Breite die rechte Seitenwand entlang und federte selbsttätig zurück. Rechts neben dem Apparat hingen Telefonbücher, auf deren Rücken die Lässigeren unter den Dauer-Telefonierern schon mal Platz nahmen – den draußen Wartenden oft zum Hohn.
Ich sah eine etwas übergewichtige junge Dame mit qualmender Zigarette genau dort sitzen und umkreiste wartend das Häuschen, immer einen sehnsüchtigen Blick auf das Telefon in ihrer Hand werfend. Die Geschäfte schlossen in einer halben Stunde. Die junge Frau plapperte und plapperte, ich wurde unruhig. Schließlich klopfte ich nervös an die Glasscheibe. Das Mädel schaute mich abweisend an und plapperte unbekümmert weiter. Wie schön wäre jetzt ein kleines handliches Ding, das ich aus der Jackentasche ziehen und Emma anrufen könnte.
Ich sah der Zigarettenqualmerin an, dass es sinnlos war, auf ein frühzeitigeres Ende ihrer Mitteilungsbedürftigkeit zu warten und zog ab. Ich ging selbst einkaufen, füllte den REWE-eigenen Einkaufskorb aus rotem Plastik mit irgendetwas; quer durch den Laden hindurch nahm ich alles mit, was mir nötig erschien. Ich wusste ja nicht, was unser Haushalt derzeit noch hergab. Hätte ich jetzt nur ein Handy!
Alles war Bestens als ich zu Hause ankam; vieles war nun doppelt vorhanden, Butter, Käse, Wurst, Tomaten, der Kühlschrank quoll über. Und dann kam Meise aus Hamburg in seiner knallgelben Ente angefahren und wir aßen gemeinsam zu Mittag. Karola und Luca waren noch in der Schule. Ich erzählte Meise von meinem gestrigen Erlebnis an der Telefonzelle, und da fing Meise zu lachen an. Emma und ich sahen verwundert auf, als er schließlich einen Brief aus der Jacketttasche zog und ihn auffaltete.
Ein lustiger Hochstapler
„Ein lustiges Bekennerschreiben von meinem Lieblingshochstapler Gert Postel – das passt ja dann wie die Faust aufs Auge.“ Und dann las er uns daraus vor:
»Sehr geehrter Meister, verehrter Herr Künstler, lieber Alfred von Meysenbug, hallo Meise,
danke für die ausführliche Telefonberatung. Ich beherzige alle guten Ratschläge, die mir aus technisch einwandfreien Telefonapparaten übermittelt werden. Aber Technik alleine garantiert leider keine Güte der Beratung, meine Güte!
Technik & Güte! An dieser Stelle scheint es mir angebracht, ein paar grundsätzliche Bemerkungen zur Bedeutung des Telefons für den modernen Hochstapler vom Stapel zu lassen. Vielleicht ist diese Betrachtung auch für den beflissenen Comic-Künstler von Gebrauchswert. Ich denke an deine Verhandlungen mit Verlagen.
Zur Sache: Das Telefon ist, aus Sicht des Rechtsstaats betrachtet, ein wahres Teufelszeug. Es ermöglicht einem Betrüger, unter Aufwendung weniger Groschen eine soziale Situation auf Distanz zu inszenieren, für die in früheren Zeiten eben nicht nur eine Stimme, sondern im direkten Kontakt mit dem Betrugsopfer eine elegante Kutsche, livrierte Diener und feine Kleider vonnöten waren.
Heute brauche ich, um einen Universitätsprofessor mit angeschlossener Klinik darzustellen, nur noch ein Telefon und etwas soziale Intelligenz, also ein Gespür dafür, wie jemand in der Position, die er vorgibt, sprechen würde. Dabei müssen falsche Töne unbedingt vermieden und das Sachgebiet des Gesprächsthemas muss allgemein beherrscht werden. Wobei Halbwissen ausreicht. Der Gesprächsfluss muss ähnlich wie in der Gesprächstherapie durch affirmative, aber inhaltsleere Wiederholungen am Laufen gehalten werden. Werden ungewöhnliche Wünsche vom telefonierenden Betrüger geäußert, so muss gerade das Ungewöhnliche situativ plausibel erklärt werden.
Lieber Meise, ich weiß, du gierst jetzt nach einem Anschauungsbeispiel. Hier ist es: Vor langer Zeit verfolgte ich mit großer Unerbittlichkeit eine Bremer Staatsanwältin, wie du weißt. Dafür bin ich zu Recht bestraft worden. Ich habe diese Tat bitter bereut. Meine Unerbittlichkeit und mein Mangel an Ritterlichkeit gegenüber dieser Staatsdienerin haben meinem Ansehen in der Öffentlichkeit, insbesondere bei dem SPIEGEL-Gerichtsberichterstatter Gerhard Mauz sehr geschadet. Du kennst diesen ewigen Nörgelgeist ja aus persönlicher Nähe. Er fand, dass ich schlicht zu weit gegangen sei und dass meine Dauerstreiche mich vergessen ließen, dass auch hinter dem ärgsten Gegner immer noch ein Mensch steht. Wie recht er hat!
Einer meiner Dauerstreiche gegen die Bremer Staatsanwältin bestand darin, ständig falsche Meldungen über ihr berufliches Fortkommen zu lancieren. Nun stellt es keine besondere Schwierigkeit dar, in einer Bremer Lokalzeitung die Falschmeldung zum Abdruck zu bringen, die besagte Staatsanwältin sei zur Fledermausschutzbeauftragten bestellt worden.
Vor einer viel schwierigeren Aufgabe stand ich allerdings, als ich am Tage der Wahl des neuen Bremer Generalstaatsanwalts in der Neuen Juristischen Wochenschrift, der NJW, die Nachricht unterbringen wollte, meine Staatsanwältin sei in diese hohe Position gewählt worden, wovon selbstverständlich keine Rede sein konnte. Die NJW ist für Juristen mindestens das, was das Deutsche Ärzteblatt für Mediziner darstellt. Eine verehrungswürdige, autoritative, skrupulös redigierte, wöchentlich erscheinende Zeitschrift, herausgegeben von den bedeutendsten Anwälten der Republik.
Nachdem ich mich nach dem Redaktionsschluss erkundigt hatte, rief ich eine Stunde vor dessen Ablauf bei dem für Justizpersonalien zuständigen Redakteur an, stellte mich als Richter am Oberlandesgericht Bremen vor („Hier Dr. von Berg“) und fragte ihn, ob er mir ausnahmsweise einen großen Gefallen tun könne. Ich sei der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Richter im Präsidium des Oberlandesgerichts.
Mein Präsident habe mir schon vor einigen Tagen den Auftrag erteilt, dafür Sorge zu tragen, dass in der nächsten NJW die Wahl von Frau Soundso (also meiner Feindin) zur neuen Bremer Generalstaatsanwältin berichtet werde. Ich hätte die Sache einfach verschwitzt und jetzt stünde mir, wenn der Präsident mein Versäumnis bemerke, ein gehöriger Rüffel ins Haus. Zudem sei es das erste Mal, dass eine Frau in Bremen in diese Position gewählt worden sei. Ich befürchtete, dass mir wegen einer verspäteten Berichterstattung von interessierter Juristinnenseite gewisse Absichten unterstellt würden, was ich gerne vermeiden würde.
Der Redakteur bat mich, den Namen der Staatsanwältin zu buchstabieren. Selbstverständlich wolle man in einer solchen Situation unbürokratisch helfen. Ich bedankte mich, sagte noch, dass er mir eine große Last abgenommen habe, und konnte in der nächsten NJW meine eigene Falschmeldung lesen.
Ich bin auf die Täuschung dieses hilfreichen Redakteurs gewiss nicht stolz.
Mir ging es nur darum, dir an diesem Beispiel zu zeigen, wie man durch die plausible Schilderung einer Situation via Telefon auch ungewöhnliche Wünsche durchsetzen und bewährte Sicherungsmechanismen umgehen kann. Ich weiß, dass du so etwas nie machen würdest. Du, als Künstler, greifst zu feineren Mitteln. Du veralberst die Welt mit deinen Comics. Geschenkt!
Für den betrügerischen Rechtsbrecher jedenfalls hat das Telefon noch einen weiteren Vorteil. In der Regel lassen sich Telefonanrufe nicht so leicht zurückverfolgen. Auch die Identität des Anrufers ist in der Regel schwer festzustellen. Misslingt ein betrügerischer Anruf, kann gleichwohl der Täter in der Regel nicht auf frischer Tat ergriffen werden, weil er sich zum Tatzeitpunkt an einem unbekannten Ort aufhält. In der Kriminalistik nennt man Schusswaffen auch Distanzwaffen, im Gegensatz etwa zum Messerstich, wo Waffe und Opfer nahe beieinander sein müssen. Für den im Wesentlichen verbal agierenden Betrüger und Hochstapler ist das Telefon die moderne Distanzwaffe der Wahl. Deshalb Teufelszeug!
Ich hoffe, du willst es in Zukunft dennoch weiterhin mit mir auf einen Telefonplausch ankommen lassen – deine Ratschläge haben mich bisher stets vor weitergehenden Streichen bewahrt. Und damit hast du zugleich mein Telefon vom Zerschneiden der Telefonkabel bewahrt, denn das wäre die letzte Konsequenz gewesen, um mir diese Distanzwaffe aus der Hand zu schlagen …
Herzliche Grüße
Gert«
*
Im Preungesheimer Frauenknast erhielt Monika Weimar Mitte März einen Anruf. Die Zellentür wurde geöffnet.
„Ihr Anwalt“, sagte die Vollzugsbeamtin, führte sie ins Verwaltungsbüro und drückte ihr den Hörer in die Hand.
„Herr Strate?“
„Guten Tag, Frau Weimar, es gibt Erfreuliches zu berichten. Das Gießener Gericht hat unseren Antrag angenommen.“
Monika Weimar schrie auf vor Glück, aber Strate dämpfte sogleich ihre Freude: „Das ist zwar noch keine endgültige Entscheidung, es ist nur der erste Schritt zu einem Wiederaufnahmeverfahren. Doch wir können froh sein, diese schwierige Hürde schon einmal genommen zu haben. Wiederaufnahmeverfahren sind in nur sehr seltenen Fällen durchzusetzen, insoweit scheint das Gericht unseren Argumenten sehr aufgeschlossen gegenüber zu stehen. Die Verfahren sind aber auch sehr langwierig.“
Tatsächlich legte die Staatsanwaltschaft in Gießen gegen die Entscheidung des Landgerichts erst einmal Beschwerde ein. Diese Beschwerde und Weimars Akten gingen dann an das Oberlandesgericht in Frankfurt zur Entscheidung. In ihr Tagebuch schrieb Monika Weimar: „Das Zittern, die Ungewissheit, das Warten setzt nun erneut ein. Ich bin weder imstande zu lesen, noch kann ich in Ruhe Briefe schreiben, ich bin froh, mein Tagebuch führen zu können. Ich kann mich auch nicht tiefergehend unterhalten, denn immer sind meine Gedanken bei der Entscheidung. In diesem Zustand will ich mich nicht dazu zwingen, Briefe zu beantworten.“
Dadurch stapelte sich bei ihr die Post, die sie von vielen mitfühlenden Menschen fast regelmäßig bekam, seit diese nach ihrem ersten Prozess mit ihr in Kontakt getreten waren. Jedes Jahr kamen neue hinzu. Sie wollte allen antworten, und so legte sie meist am Wochenende richtiggehende Schreibtage ein. Wenn es ihr gut ging, beantwortete sie gleich alle auf einmal. Manchmal nahm sie dafür die Schreibmaschine, die sie von ihrer Schwester geschenkt bekommen hatte, denn mit dem Füller ging es zu langsam. Wenn sie Briefe länger liegen ließ, meldete sich ihr schlechtes Gewissen. Ihr waren die Menschen, die ihr das Schicksal erleichtern wollten, sehr wichtig. Doch das löste einen Druck in ihr aus, der sie oftmals ziemlich überforderte.
Das Schicksal von Monika Weimar berührte mich sehr, seitdem ich den Prozess gegen sie ab März 1987 lückenlos verfolgt hatte. Zwei Mal war ich als Prozessberichterstatter vor Ort in Fulda, eine Fahrtstunde von Laubach entfernt, um für zwei Magazine zu schreiben. Wann immer ich etwas zur »Mordsache Monika Weimar« erfuhr, kopierte ich mir die Unterlagen für meine Akte. Aufgrund der widersprüchlichen Aussagen von verschiedenen Zeugen schien mir vieles viel zu unschlüssig und jeglicher Logik widersprechend, als dass man der Mutter den Mord an ihren beiden Töchtern hätte anlasten können.
Aber man hat ja die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen und kann sich trotz aller scheinbaren Sicherheit und Logik irren. Also sammelte ich einfach sämtliche Nachrichten zu diesem Fall. Dass ich zwölf Jahre später einen Roman darüber schreiben und an ihren beiden letzten Prozessen in Gießen und in Frankfurt teilnehmen sollte, konnte ich zu diesem Zeitpunkt nicht einmal vermuten.
Auch Detlef Scheunert konnte nicht in die Zukunft blicken, obwohl er einen sehr geübten scharfen Blick für sich anbahnende gesellschaftliche und ökonomische Entwicklungen in den neuen Bundesländern besaß. Scheunert hatte eine typische DDR-Glanzkariere hinter sich und war vor der Wende zuletzt als persönlicher Referent des DDR-Ministers für Schwermaschinenbau beschäftigt gewesen Aber jetzt konnte auch er höchstens nur ahnen, wie es mit ihm, wie es mit den Beitrittsgebieten und mit der Treuhand weitergehen sollte. Vor einem Jahr hatte ihn sein damaliger Vorgesetzter Klaus-Peter Wild bei der Treuhand-Chefin Birgit Breuel für einen neu zu besetzenden Vorstandsposten vorgeschlagen.
Zuvor war folgendes geschehen: Kanzler Kohl, Birgit Breuel und der für das ehemalige Kombinat Carl Zeiss Jena zuständige Vorstandsdirektor Klaus-Peter Wild hatten sich im vergangenen Jahr heimlich darauf geeinigt, Kohls politischen CDU-Konkurrenten Lothar Späth das Werk Zeiss Jena sanieren zu lassen. Späth, der abgesägte Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg – gestolpert über Urlaubsflüge, die er sich von einem Konzern bezahlen ließ – wusste zwar nichts über das Unternehmen Carl Zeiss, wusste nichts über Optik, nichts über Unternehmensführung. Aber Kohl war jetzt einen lästigen Besserwisser los.
Der bisher für den Jenaer Optik-Betrieb zuständige Treuhand-Direktor hatte bei den Verhandlungen in den letzten Jahren kein gutes Bild abgegeben. Er wurde weichgepolstert gefeuert. Die neue Stelle vergab man nun auf Initiative seines Vorgesetzten Wild an Detlef Scheunert. Wild fand, es sei Zeit für einen Direktor aus dem Osten. Von den 46 Direktoren der Treuhand, die den einzelnen Vorständen unterstellt waren, kamen bisher alle aus dem Westen.
„Herr Scheunert hat in den schwierigsten und chaotischsten Zeiten immer den Kopf oben behalten und den Blick nach vorne gerichtet“, hatte Wild seine Empfehlung abgegeben. Breuel hatte zugestimmt. Scheunert ist nun einer der beiden mächtigsten Ostdeutschen in der Anstalt. Im Vorstand ist nur noch der ostdeutsche Wolfram Krause übrig, immer noch zuständig für die Finanzen. Alle anderen Positionen werden weiterhin von Westdeutschen besetzt.
Nachdem sie mehrere ihrer Niederlassungen scheinbar erfolgreich abgewickelt hat, gibt die Treuhandführung Anfang 1993 ein klares Ziel für die inzwischen 4.000 Mitarbeiter aus: Ende des Jahres soll das operative Geschäft abgeschlossen sein.
„Man kann trotz Wirtschaftskrise das Tempo beibehalten und sich nach zweieinhalb Jahren Arbeit selbst auflösen“, wird Frau Breuel in der Frankfurter Allgemeinen zitiert. Inzwischen hat die Treuhand von den knapp 13.000 übernommenen Unternehmen fast alle privatisiert und weiterverkauft – bis auf 2.900 Betriebe, von denen jedoch nur noch 1.500 aktiv im operativen Geschäft tätig sind.