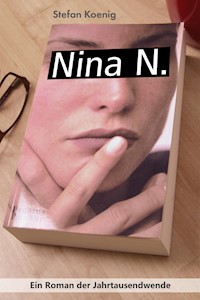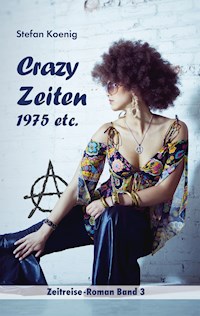Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Zeitreise-Roman Band 7
- Sprache: Deutsch
Die Jahre zwischen 1990 und 1992. Alles war neu. Hoch wurde gepokert. Hoch wurde gestapelt. Was war Treue wert? Wo war die treue Hand der Treuhand? Wer schützte wen? Und wem gehörte das Volkseigentum? Video-CD's waren auf dem Vormarsch. Die DM-Armee marschierte gen Osten. Alles wurde teurer, dafür bunter. Eine neue Kälte zog ein. Aber die heiße Liebe war nicht totzukriegen. Love & Peace waren aktuell wie nie. Udo Lindenberg besang die "Bunte Republik Deutschland". Und die Wendehälse reckten ihre Hälse empor und konnten sie nicht vollkriegen. In Leuna liefen tausende Arbeitslose zu den Ämtern. Unsere Kinder fanden neue Helden. Ein Hippiefestival erlebte ein Revival. Die Flower-Power-Geister von Burg Herzberg feierten weit über Mitternacht. Das erste Wacken fand statt – in Wacken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 522
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stefan Koenig
Neue Zeiten - 1990 etc.
Zeitreise-Roman
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
1990 Catch-as-catch-can
Die DDR im Lockdown
Hochstapler stapeln oft zu hoch
Deutsche Bank verpflanzt Konten
Urlaub in Honeybridge
Schnäppchenjäger & Einflüsterer
Unfaire Spiele, dafür alte Freunde
Fetter Brocken für die Allianz
John landet in Irland
Friss oder wähl
Ein schöner Ort – zum Verlieben
Postel fliegt auf
Wahlsieger & Kunsthaar & Barschel
Neue Liebe in Irland
Die DDR-zieht`s ins Blaue
Zauberkünstler am Werk
Schmetterlinge im Bauch
Versicherungs- & Volksvertreter
Unverhofftes Wiedersehen
Neue CD & runderneuerte DDR
Rausgemoppt in Ost wie West
Zen-Buddhismus & das Schweige-Seminar
Anlagebetrug & anderer Lug
Freundes-Briefe & Berliner Depressionen
Filzgefahr & Pink-Floyds „The Wall“
Währungsunion & Rohwedder & Fußball
Fußballweltmeister & die Berliner Flunkerer
Die D-Mark ist allgegenwärtig
Umweltinstitute im Osten
Autohändler im Paradies & Wacken in Wacken
Westliche Stromer unterwegs
„Bunte Republik Deutschland“
Ein Rednerpult im DDR-Parlament
Ein Brief & eine neue Bekanntschaft
Neue Kräfte braucht das neue alte Land
Das Jahresende naht
1991 Träume sind Schäume
Abwickeln, abwickeln, abwickeln
Torremolinos – wir kommen!
Als George in Afrika war
Der Stolz der DDR
Weiterfahrt nach Marokko
Thomas Münzers Wilder Haufen
Hotel Marseille in Marrakesch
Kommissar Hassan in Tanger
Kommando Ulrich Wessel
Machenschaften
Beschützerinstinkte & Herzberg
Inside DDR
1992 Schäume mit Wut
Untreue Treuhand & andere Untreue
Ganoven in Halle & allerlei Ungemach
Schauspielerei & Betrug & Lug
Tricksereien
What to do?
Bestechung auf hohem Niveau
Dagobert foppt die Bullen
Versilbern, verscheuern, verscherbeln & Honni sinniert
Gedanken im Knast & Theater
Wie alles begann
Heiße Eisen
Pechsträhnen
Täuschung oder Arglist?
Offene Posten
Impressum neobooks
1990 Catch-as-catch-can
Stefan Koenig
Neue Zeiten
1990 etc.
Zeitreise-Roman
Band 7
Aus dem Deutschen
ins Deutsche übersetzt
von Jürgen Bodelle
Geht‘s mal nach links
Dann bieg ich nicht ab
Ich fahr geradeaus
Und mach keinen Stopp
Geht‘s mal nach rechts
Ich fahr dran vorbei
Ich schau hinterher
Doch bleibe dabei
Und manchmal glaub ich
Ich geh wie auf Schienen
Ich folge dem Weg
Doch will da gar nicht hin
Ich weiß jetzt
Auf dem Weg, auf dem ich lauf
Bin ich an so vielen vorbeigerauscht
Auf dem Weg liegt
Was ich such
Ich schaue jetzt hin
Ich lass es endlich zu
Gibt‘s mal ‘nen Halt dann steig ich nicht aus
Ich bleib einfach drin
Und sitz es aus
Es kann kommen was will
Ich bleib auf der Bahn
Ich suche das Ziel
Und komme nicht an
(Song » Auf dem Weg«
von Mark Forster)
Stefan Koenig
Neue Zeiten
1990 etc.
Für
Alexa P.
Anja P.
Sonja D.
Karin W.
Herbert B.
Hans-Joachim K.
Mit freundlicher Unterstützung der
Hessischen Kulturstiftung
Wiesbaden
Pegasus Bücher
Wie lange lebt der Mensch, letzten Endes?
Lebt er tausend Tage oder einen einzigen?
Eine Woche oder mehrere Jahrhunderte?
Für wie lange Zeit stirbt der Mensch?
Was bedeutet »Für immer«?
(Pablo Neruda)
Vorwort
kein Vorwort
kein Wort
nirgendwo
oder doch
vielleicht
nur ein Wort
ein einziges Wort
auf einem Autofriedhof
ein Wort aus einem
alten Radio
ein einziges Wort
wenn ich es nur
tatsächlich gehört habe
wenn
das Wörtchen wenn
ein Wort nur
ein Wort
»hope«
(Dieses Gedicht widme ich
meiner guten Bekannten Carina Corona)
„Ich kann mir nicht vorstellen, dass er ein Betrüger ist“, sagte ich zu meiner Frau. Emma schaute mich mit großen Augen an, sprachlos. Ich verzog mein Gesicht in der Hoffnung, dass nun auch meine Augen die notwendige Erstaunensgröße hätten, wie ihre bernsteinfarbenen Augen.
Sie nahm einen Schluck aus dem Kaffee-Pott. „Jeder, der vom großen Geld träumt, kann auf krumme Gedanken kommen“, sagte sie. „Das liegt im Wesen der Sache. Ist doch völlig normal.“
„Du glaubst doch nicht, dass ein junger Mann in meinem Alter allein durch ein paar manipulierte Aktienkäufe ruckzuck zum Millionär wird! Er wird mit seinen Immobiliengeschäften und mit seinen Bank- und Börsenverbindungen ein echtes Fundament gelegt haben. Vielleicht sollten wir doch sein Angebot annehmen.“
„Ein junger Mann in deinem Alter?“ Emma lachte laut und etwas derb und sah mich gespielt mitleidig an. „Du wirst im September immerhin schon vierzig. Von wegen jung! Der Harksen ist inzwischen ein alter Hase an der Börse. Er hat gewiss schon eine Menge Tricks im Sandkasten des Kapitalismus mitgekriegt und …“
Ich unterbrach meine Liebste: „ … und genau das wird ihn eher zum ausgebufften Insider als zu einem Betrüger machen.“
Emma wiegte zweifelnd den Kopf. „Er mag zwar ein goldenes Händchen im Börsenzocken haben, ob er aber auch im trickreichen Immobiliengeschäft solide ist, kann doch niemand von uns überprüfen. Und überhaupt trau ich keinem der modischen Krawattenträger, die in Sachen Immobilien und Börse derzeit Kasse machen. Das sind schmierige Typen und sie machen schmierige Dinge in schmierigem Umfeld. Und dass Harksen deinen Freund Meise immer wieder als Türöffner bemüht, macht mich ehrlich gesagt mehr als stutzig.“
Jürgen Harksen hatte uns ein Hamburger Immobilienangebot unterbreitet. Ein Hochglanzprospekt hatte gestern im Briefkasten gelegen. Mein alter 68er-WG-Kumpel Meise, ein Comic-Künstler, hatte noch eine kleine Comic-Zeichnung dem Prospekt des Börsen-Newcomers beigelegt und drei Zeilen dazu geschrieben: „Ich soll euch von Jürgen grüßen und euch wissen lassen, dass ihr natürlich Vorzugskonditionen erhaltet. Kommt ihr demnächst mal nach Hamburg? Könnt bei mir übernachten. Übrigens liegt eine Einladung von Panik-Udo anbei. Auftritt erst im September in Halle.“
„Was hat Meise da eigentlich gezeichnet?“, fragte Emma. Da rief im Kinderzimmer Luca sein etwas kreischend klingendes „Maaammaa!“ Emma stand auf, ging um mich herum und sah mir kurz über die Schulter. „Ach, ein Porträt von Lindenberg mit Schlapphut, mit Mikro und Gitarre.“
„Und ein persönliches Geschenk von Udo. Zwei Tickets zum Lindenberg-Open-Air am 7. September in Halle, oder altdeutsch gesagt: Einlasskarten für ein Freilichtbühnen-Konzert“, rief ich Emma hinterher. Unsere Sprache nahm immer mehr Amerikanisch an. Mir fiel es auf, anderen scheinbar nicht. Es juckte keinen. Vielleicht weil alles so viel modischer als früher klang. Mir war es egal. Es gab Wichtigeres im Leben.
Hörbi, mein Freund aus alten Schul- und WG-Zeiten und jetziger Pädagogischer Leiter unserer Bildungseinrichtung, war da anderer Meinung. „Da schleicht sich mit der Amerikanisierung der Sprache ebenso wie bei den Hollywoodfilmen eine Menge transatlantischer Vasallendenke mit ein“, hatte er einmal gesagt, und er meinte, dass damit unbewusst eine gehörige Portion Loyalität, ein Gefühl wenig hinterfragter Verbundenheit, transportiert würde. Ich hatte ihm versprochen, das wir das ein andermal ausführlich diskutieren könnten. Bis heute war ich drumherum gekommen.
Die Freikarten vom Panikmeister interessierten mich mehr als jedes Vasallentheater. Denn seit ich unternehmerisch tätig war, hatte meine Teilnahme an Konzerten deutlich gelitten. Es war einfach keine Zeit geblieben für Musik und Kultur. Die Kultur hieß jetzt Arbeit und die Arbeit hieß Umweltschutz und Umweltschutz hieß Zukunft für unsere Kinder. Erst vier Jahre war Tschernobyl her. So ein Atomdesaster durfte nie mehr vorkommen, sonst wäre es aus und vorbei mit jeglichen Konzerten.
Vor drei Monaten hatte Udo Lindenberg seine DDR-Tournee in Suhl und Leipzig gestartet. Meise war als einer seiner besten Freund mitgereist. Er hatte mir telefonisch von den Konzerten vorgeschwärmt. Es war eine sehr erfolgreiche Tournee gewesen, man hatte Lindenbergs Panikorchester bejubelt, und er musste den »Sonderzug nach Pankow« mehrmals abfahren lassen. Bühnenzauber.
Emma und ich waren gegenüber dem Börsen- und Profitzauberer Jürgen Harksen bisher standhaft geblieben, hatten seinen zahlreichen Investmentangeboten tapfer widerstanden. Zwischendurch hatte zu allem Überfluss auch noch die inzwischen berüchtigte Nigeria-Connection versucht, deutsche Mittelständler mit fiesen Tricks um ihr Geld zu erleichtern. Einer dieser angeblichen nigerianischen Prinzen hatte es tatsächlich auch bis zu meinem Telefonanschluss geschafft. Doch ich hatte den Prinzen in Lagos zurückgerufen und schnell herausgefunden, dass es um Vorschussbetrug ging.
Der falsche Prinz hatte eine Provision in Millionenhöhe versprochen, wenn man seine Dollars aus Nigeria in Europa auf einem offiziellem Firmen-Konto zwischenlagere. Aber um die millionenschwere Provision zu erhalten, sollte der deutsche Michel vorab an viele zwischengeschaltete Komplizen scheibchenweise immer mehr Zahlungen leisten, um sodann am nächsten Straßenräuberposten noch einmal Zollgebühren zu blechen.
Danach ging das Zahlungs-Roulette erbarmungslos weiter mit angeblich notwendigem Bestechungsgeld für die Abstempelung der staatlichen Ausfuhr- beziehungsweise Transfer-Genehmigung, und für vieles andere, auch für Notarhonorar. „Nur zu Ihrer Sicherheit!“, hatte der angebliche Prinz bei den Betrogenen betont, wie später aus den Zeitungsberichten zu erfahren war. Dann hatte er noch von unabdingbaren Versicherungsgebühren gesprochen.
Natürlich hatte er die Zahlungskette nicht von vornherein offengelegt, sondern die gutgläubigen Betrugsopfer erst das eine zahlen lassen, bevor er mit der nächsten Zahlungshürde aufwartete. Die nigerianische Kreativität finanzieller Abschöpfmöglichkeiten schien so grenzenlos zu sein wie Reinhard Meys grenzenloser Himmel, hoch über den Wolken. Letzten Endes jedoch wurde – trotz aller hoffnungsvoll geleisteter Vorschussgelder – kein einziger Provisionsdollar gezahlt.
Ein relativ gut zu durchschauendes Spiel. Dennoch waren eine Menge Mittelständler auf diese Masche hereingefallen, wie dem SPIEGEL zu entnehmen war. Nur weil sie alle vom schnellen Mammut träumen, ging mir durch den Sinn. Doch auch ich hatte für einen kleinen Moment der Legende dieses betrügerischen Spiels mein Ohr geliehen, was offenbar bedeutete, dass ich insgeheim ebenfalls an die Existenz des „schnellen Geldes“ zu glauben bereit war. Die kapitalistischen Verlockungen hatten mich erfasst – aber nicht überrollt. Ich hatte rechtzeitig, auch dank Emmas kritischem Blick, die Bremse gezogen.
Emma kam zurück, auf ihrem Arm der fünfjährige Luca; hinter ihnen tapste die zwei Jahre ältere Karola in die Küche.
„Man kann sein Geld nur durch ehrliche Arbeit verdienen“, sagte Emma.
„Du wiederholst die Worte meines Vaters“, antwortete ich.
„Sind sie deshalb etwa nicht richtig?“
„Opa ist tot“, sagte Karola traurig.
„Ja, es geht ihm jetzt aber gut“, tröstete sie Emma. Mein Vater war nach einem Herzversagen vor einem halben Jahr verstorben. Es klingelte und klopfte an der Wohnungstür. Es war Sonntagvormittag. Das konnte nur Lollo sein.
Ich ging hin, öffnete und kam mit meiner Mutter zurück. Lollo bot sich an, mit den Kids zum Spielplatz zu gehen. Die Bezeichnung Kids kam gerade in Mode und so flötete es aus mir heraus: „Die Kids könnten mit Lollo in den Park gehen.“ Emma nickte zustimmend, und wir zogen Karola und Luca an.
Meine Frau sah mich erwartungsvoll an. Dann wiederholte sie: „Es ist doch eine richtige Sicht: Nur mit ehrlicher Arbeit kann man sein Geld verdienen.“
„Doch, doch, das meinte ich ja.“ Jetzt bloß keine Missverständnisse, dachte ich. Kein Ehestreit vor meiner Mutter. Wir hatten genügend Belastungen am Hals. Emma hatte sich in die Geschäftsführung der Frankfurter GTU, unserer Umweltbildungs- und Beratungseinrichtung, gestürzt. Sie machte mir in letzter Zeit einen ziemlich nervösen Eindruck. Einen Betrieb von außen zu sehen und zu kommentieren war leichter, als im Betrieb handeln und Entscheidungen treffen zu müssen. Sie musste sich mit den Mitarbeitern abstimmen, Vertrauen aufbauen, Ratschläge entgegennehmen und ohne Besserwisserei Ratschläge erteilen. Das war zweifellos eine andere Hausnummer.
Und ich hatte zwei Unternehmen zugleich aufzubauen – in Berlin, West wie Ost, und im thüringischem Bad Langensalza. Dazu die Kids und jede Menge Hausarbeit trotz Haushaltshilfe. Wegen Harksen streiten, war das Letzte, was wir heute brauchten. Wir hatten jetzt Urlaub nötig, aber die Umstände ließen es nicht zu. Es hieß durchackern was das Zeug hielt.
Auch ich brauchte keine unnötigen nervlichen Belastungen, mein Magen hatte in letzter Zeit rebelliert und mit Sodbrennen und gelegentlichen Magenkrämpfen aufgemuckt. In Immobilien spekulieren, nein, das kam nicht in Frage – auch wenn Harksen wie in früheren Zeiten mit über 300 Prozent Rendite winkte.
Meiner Mutter winkte unser Dank und unsere Anerkennung. Und es winkte ihr ein wenig Ablenkung von ihrer Trauer. Die drei gingen zum Spielplatz. Emma und ich unterhielten uns über Harksen und tranken unseren Kaffee zu Ende. Wir wussten viel zu wenig über ihn, aber genug, um misstrauisch zu sein. Vier Jahre später erfuhr ich von ihm, was er gerade zu jener Zeit erlebte, in dem wir über ihn sprachen.
Anders als die nigerianische Mafia, griff Jürgen Harksen auf eine subtilere Geschäftsmethode zurück. Aus kleinen Verhältnissen stammend, hatte er instinktiv begriffen, dass sich der westdeutsche Mittelständler, an den er sich traute, mit bunten und teuren Blendgranaten täuschen ließ. So hatte Harksen 1988 einen Porsche geleast. Der Chef der Leasingfirma, Herr Klaus, wurde zu einem seiner guten, treugläubigen Kunden. Als er Harksen den ersten Leasing-Porsche persönlich vorbeibrachte, sagte er: „Herr Harksen, von Ihnen nehme ich keine Anzahlung. Bei Ihrer Bonität wäre das eine Beleidigung.“
Harksen nickte wohlwollend und wissend, während er in sich hineinschmunzelte. Er dachte daran, dass seine Bonität lediglich auf den Anlagegeldern solcher Leute wie dem Leasing-Chef fußte. Geld, das also eigentlich nicht ihm, Harksen, gehörte. Als Herr Klaus beim Abschied einen Blick nach draußen auf die Straße warf, fragte er den Anlageprofi beiläufig: „Sehen Sie den da?“ Er wies mit dem Finger auf einen 735i BMW, blaumetallic. „Den fahre ich zurzeit selbst. Schickes Auto, nicht wahr?“
Harksen nickte.
„Wissen Sie was? Der wär‘ doch sicher was für Ihre Gattin.“
Da konnte Harksen ihm nicht widersprechen. Den BMW sollte er ebenfalls ohne Anzahlung bekommen. Ein triftiger Grund für Harksen, seine Leasingraten pünktlich zu zahlen. Einige Monate später tauschte er den BMW gegen einen Porsche 911 ein. Eines Tages rief ihn der Leasing-Chef wieder an: „Ich habe einen heißen Tipp für Sie. Ich kann Ihnen aus einem Konkurs nochmal günstig vier Luxusschlitten vermachen. Ich schnür Ihnen einfach ein Paket.“
Er riet Harksen, pro forma eine Autovermietung aufzumachen und die Autos dann an sich selbst zu vermieten. So konnte Harksen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, denn die Anschaffungs- oder Leasingkosten waren als Geschäftsausgaben absetzbar. Und die Miete, die er an sich selbst zahlen würde, wäre ebenfalls abzugsfähig. Das leuchtete Harksen sofort ein, und so ließ er sich von dem Leasingchef einen Schlitten nach dem anderen aufschwatzen. Bald schon hatte er mehr als fünfzehn Autos und musste eine Halle zum Unterstellen anmieten.
Mietverträge abschließen, das war für die letzten Tage auch mein Auftrag gewesen. Im Ostteil von Berlin hatten Jan und ich für unsere fünf geplanten Bildungsinstitute einige Großanmietungen getätigt. Es war dringend geworden. Immer mehr Wessis strömten gen Osten und besetzten Terrain. Zwar friedlich, aber mit Geld. Wir durften nicht zu spät kommen, unser Umweltbildungsunternehmen hatte immerhin schon die feste Zusage des Arbeitsamtes erhalten, Schulungsmaßnahmen für DDR-Beamte aus dem Natur-, Umwelt- und Immissionsschutz durchzuführen. Wir sollten im Oktober starten.
Bisher hatten wir einen teuren Miet-Standort im Technologie- und Innovations-Center im Westberliner Wedding. Ich fuhr nach Berlin, um mit Jan und unserer Geschäftsführerin Katrin weitere ins Auge gefasste Institutsstandorte zu besichtigen und Mietverträge abzuschließen. Als ich nach einer Woche zurück nach Frankfurt kam, hatten wir einen zusätzlichen Standort im Westteil Berlins, in Kreuzberg, sowie drei weitere Standorte im Ostteil preisgünstig gemietet: Adlershof, Weißensee und Marzahn-Hellersdorf. Jan und seine Frau Katrin waren überfreundlich und sehr bemüht gewesen, ihr Engagement zu betonen. Noch schöpfte ich keinen Verdacht.
In Berlin hatte ich mitbekommen, wie der Wahlkampf tobte. Die neu gegründete DDR-SPD schien das Rennen zu machen. Ihr uneinholbarer Vorsprung gegenüber dem Wahlbündnis der Konservativen war „dank BILD“, wie eine Genossin aus dem SPD-Parteivorstand meinte, ein klein wenig zusammengeschrumpft. CDU-Kanzler Kohl hatte auf die Schnelle einen Bund aus der bis vor Kurzem noch SED-treuen Blockpartei CDU-Ost, dem nach rechts gerutschten »Demokratischen Aufbruch« und dem CSU-Kind DSU, der Deutschen Sozialen Union, gezimmert. Aber die Erfolgs-Chance dieser Sturzgeburt hatte sich – trotz Springers monatelanger BILD-Interventionen – nur unwesentlich verbessert.
In diesen letzten drei Wochen vor der DDR-Wahl, die auf den 18. März datiert ist, begreift der westdeutsche Kanzler, dass er sein ganzes Gewicht selbst einbringen muss, um die Wählerstimmung im Osten zum Kippen zu bringen. Er geht auf Tour, auch wenn dies dem geltenden DDR-Wahlrecht und dem ausdrücklichen Verlangen der ostdeutschen Bürgerrechtsbewegung widerspricht.
In Karl-Marx-Stadt tritt er vor 200.000 Menschen auf und gibt kund, dass seine Regierung der DDR keine müde Mark zu geben bereit ist, solange sie von Sozialisten regiert wird. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er der Modrow-Regierung und ihrem mitregierenden „Runden Tisch“ immer wieder Geld in Aussicht gestellt. Es erinnerte mich an eine Möhre, die an einer langen Rute vor den Augen eines Esels geschwenkt wird, um ihn zum Laufen in die gewünschte Richtung zu bringen. In den nächsten Tagen wiederholt Kohl seine Drohung vor Hunderttausenden DDR-Bürgern in verschiedenen ostdeutschen Städten.
Die Wissenschaftler Artzt und Gebhardt wollen verhindern, dass die DDR-Wirtschaft zerstört und das über vier Jahrzehnte erarbeitete Wirtschaftsgut zu Billigstpreisen verscherbelt wird. Sie wollen, dass das Volkseigentum gerecht verteilt wird und müssen ihre Idee gegen die brachiale und finanzstarke CDU-Wahlkampfmaschine verteidigen. Anteilsscheine sollen die Teilhabe-Chancen der DDR-Bürger in einer zukünftigen Marktwirtschaft sichern.
Die beiden Bürgerrechtler haben, schon lange bevor die Titanic mit dem Schriftzug »DDR« auf den Eisberg zufuhr, vor dem Eisberg und dem zu erwartenden Aufprall gewarnt. Damals, Ende 1988, spielten noch die Arbeiterschalmaien und es wurde im Palast der Republik getanzt, während die zwei Wissenschaftler sich heimlich als Laubenpieper in Gebhardts Gartenhütte in Potsdam trafen, um zumindest gedanklich Vorkehrungen für den Fall der Fälle zu treffen. Jetzt wollen sie für das »Neue Forum«, dem sie zwar nicht angehören, für das sie aber werben, Wähler gewinnen. Sie erläutern auf Wahlveranstaltungen, dass man ohne Eigenkapital dem zu erwartenden Kapitalansturm aus dem Westen hoffnungslos unterlegen sei. Außerdem gehöre nun mal das in der DDR erwirtschaftete Kapital der DDR-Bevölkerung, wem sonst?
Manchmal werden die beiden Bürgerrechtler von den eigenen Landsleuten erstaunt gefragt: „Was, ich soll was bekommen? Wie viel denn? Ist das denn überhaupt so viel wert?“
Artzt antwortet dann: „Eigentum verpflichtet, das ist der Grundsatz der sozialen Marktwirtschaft. Wir wollen diesen Grundsatz mit Leben erfüllen, indem wir unser Volkseigentum auch an uns rechtsverbindlich überschreiben lassen.“
Und sein Kollege Gebhardt ergänzt, wenn ihn eine Wählerin kritisch fragt, was sie denn mit einem Anteilsschein anfangen könne: „Na liebe Frau, die Wohnung, in der sie jetzt wohnen, die werden Sie nicht mehr mit 26 Mark Miete bezahlen können. Wäre es dann nicht prima, wenn Ihre vier Familienmitglieder ihr Kapital zusammenlegen und diese Wohnung mit den von uns geforderten Kapitalanteilsscheinen erwerben? Dann wären Sie zumindest die eine Sorge los, dass Sie Ihre Wohnung nicht mehr bezahlen können.“
„Ach, das meinen Sie!“, sagt die Wählerin. „Davon habe ich noch nie etwas gehört. Wieso kommt das nicht in der Zeitung oder im Fernsehen?“
„Weil die Zeitungen und das Fernsehen nicht uns Bürgerrechtlern gehören, weil wir von denen noch keine Anteilsscheine haben“, lacht dann Gebhardt.
Und Artzt erläutert: „Wir sind neu am Start und haben weder die Organisation noch das Geld noch irgendeine große Zeitung wie die anderen.“
Allerdings bekommt die Idee der beiden Bürgerrechtler und ihrer Verbündeten zumindest Schützenhilfe vom DDR-Fernsehen. In einer Talkshow wird der Vorschlag von Artzt und Gebhardt ausführlich diskutiert. In der Sendung wird die Idee eines Anteilsscheins oder einer Volksaktie auch von einem erfolgreichen bundesdeutschen Vermögensberater mit Adelstitel, Albrecht Graf Matuschka, unterstützt. Der Graf gründete Ende der Sechziger Jahre die Matuschka-Gruppe in München und legte das Kapital vieler reicher Deutschen an. 1990 gilt er noch immer als Star der Anlagebranche.
Matuschka plädiert in der Talkshow vehement für eine Volksaktie, die jeder DDR-Bürger bekommen soll.
„Warum?“, fragt die Moderatorin.
„Ganz einfach“, antwortet Matuschka, „weil es sein gutes Recht ist. Weil jeder hier dafür Jahrzehnte gearbeitet hat!“
Jetzt legt er auch die Finger in eine westdeutsche Wunde: Man könnte die Wasser- und Energiewirtschaft in Ostdeutschland so effizient und günstig machen, wie sie anfangs auch in Westdeutschland organisiert war, aber nun durch die langjährige Privatisierung zerstört und von Konzernen und deren Preisgestaltung abhängig ist. Man dürfe nicht die Fehler der Bundesrepublik wiederholen. Kommunale Stromanbieter und kommunale Wasserwirtschaft sollten erhalten und vor der Privatisierung bewahrt werden.
Die Volksaktie wird plötzlich Thema im DDR-Wahlkampf. Die DDR-SPD und die PDS plädieren mit einem Mal ebenso wie das Neue Forum für Beteiligungsmodelle, die dem Matuschka- und dem Artzt/Gebhardt-Konzept ähneln. Doch um deren Funktionieren zu gewährleisten, müsste die DDR erst einmal unabhängig bleiben und eine zweite Chance erhalten. Dann jedoch müsste die deutsche Einheit einen Moment warten. Aber die Mehrheit der DDR-Bürger scheint nicht mehr die Energie aufzubringen, weiter unabhängig vom Westen zu bleiben.
Das gebeutelte Land schleppt sich zur Wahl nach dem Vorbild der Bundesrepublik. Die Wahlbeeinflussung aus dem Westen wird von vielen, aber nicht von allen, als störend empfunden. Noch immer sagen die meinungsmachenden und meinungsforschenden Institute einen Sieg der ostdeutschen Sozialdemokraten voraus. Doch wer Kanzler Kohl bei seinen Auftritten erlebt, kann diesen Prognosen jetzt keinen Glauben mehr schenken. Man fühlt sich in falscher Sicherheit gewogen.
Mit jedem Tag, der die Unsicherheit in Ostdeutschland offenbart, gewinnen die externen Kräfte an Meinungsführerschaft hinzu. Der Einfluss der Westparteien, der Westkonzerne und Westberater wächst – sie alle versuchen, vollendete Fakten zu schaffen. Die Wahl am 18. März sollte eigentlich ein Triumpf der DDR-Demokratiebewegung werden – nun steuert die Titanic auf einen Eisblock zu.
Jürgen Harksen interessierte das alles wenig, er hatte genug Wahlfreiheit in seiner eisfreien norddeutschen Enklave rund um Hamburg und in ganz Dänemark. Er musste sich um seinen neuen Autopark kümmern. Seine Haushälterin bat ihn eines Tages um einen Job für ihren Mann, der seine Stelle verloren hatte. Er wurde Harksens Autowart, der erste Angestellte der Firma VIP-Car-Rental.
Als Harksen fünfzehn Autos hatte, sah er keinen Grund, den Stall nicht noch mehr zu erweitern, zumal sein flüssiger Geldstrom unentwegt anschwoll und über die Ufer zu treten drohte. Das Geld musste angelegt werden. In Prestigeobjekten, in Oldtimer, in Sportkarossen. Gottseidank hielten sich die Auszahlungswünsche seiner Kunden im Vergleich zu den Anlage-Einzahlungen in Grenzen.
Anfang der Neunziger Jahre brach in Deutschland eine allgemeine Vermögenseuphorie aus. Die Reichen aller Bundesländer jubilierten unter dem Eindruck der nahenden Wiedervereinigung. Ab jetzt konnte es nur noch bergauf gehen. Die Wirtschaftskrisen der Vergangenheiten gerieten in Vergessenheit. Man durfte sich wieder ungeniert reich fühlen und gleichwohl bereichern. Das wirkte sich auch auf den Automarkt in den höherpreisigen Segmenten aus.
Zwischen 1989 und 1990 kam es auf dem Edelautomarkt zu einer Wertexplosion. Der Ferrari F40, Listenpreis 400.000 DM, war zu Spitzenzeiten nicht unter zwei Millionen zu haben, denn er galt als Rarität und wurde nicht mehr gebaut. Harksen schaffte sich das teuerste Auto an, das er ergattern konnte, einen Ferrari California Spider, der als Sammlerstück einen Wert von acht bis zwölf Millionen Mark hatte.
Ein Arzt aus Glücksburg an der Flensburger Förde, dem Harksen von Hören und Sagen bekannt war, hatte kein Glück, sondern ausgesprochenes Pech. Er war leidenschaftlicher Ferrari-Sammler und wollte seine Autos zu Phantasiepreisen verkaufen, fand aber partout keine Interessenten. In düsterer Vorahnung, sich womöglich verspekuliert zu haben, kam ihm Harksen mit seinem 1300-Prozent-Versprechen gerade recht. So glaubte er, seine Ferrari-Fehlspekulation wieder gutmachen zu können.
Da er bereits zu klamm war, um sich per Bareinlage oder Scheck Zutritt zum erlesenen Kreis der Begünstigten zu erkaufen, bot ihm Harksen großzügig einen Deal an. Statt einer Bareinlage würde Harksen dem Arzt seine Autos zu den geforderten – illusorischen – Verkaufssummen als Einlagen der Firma Nordanalyse gutschreiben. Mit den entsprechenden – illusorischen – Schuldverschreibungen war der Ferrari-Fan nun Teilhaber an einem sagenhaften – illusorischen – Reichtum.
Plötzlich hatte Harksen also einen Stapel Autopapiere in der Hand. Die Autos kosteten ihn außer dem Unterhalt, ein paar anteilnehmenden Worten und etwas Papier nichts. Und der Arzt hatte eine warme Phantasie mehr, auf die er sein ängstliches Haupt betten konnte.
Damit seine Fans ihrer Bewunderung Raum geben konnten, richtete Harksen einen Jour fixe ein. Jeden Samstag gab es Hackbrötchen in seinem Auto-Zoo. Harksens Fitnessclub-Betreiber und dessen Sohn waren zwei seiner Stammgäste. Eines Tages schlug er ihnen vor, sich fürs Wochenende zwei seiner Nobelkarossen auszuleihen und ihre Frauen mal richtig zu verwöhnen. Die seien schon verwöhnt genug, wehrten sie mit glänzenden Augen sein Angebot scheinheilig ab. Der Sohn bekam als Leihgabe einen Ferrari, der Vater einen dicken Mercedes. Am Montag brachten sie die Autos wohlbehalten mit der frohen Botschaft zurück: „Das Eis ist gebrochen. Du bist bei uns zum Essen eingeladen.“
Die Einladung nahm er gerne an, aber nie wahr. Dafür freute sich Harksen über die hunderttausend Mäuse, die Vater Clubbesitzer in der Woche darauf bei ihm ablieferte. Davon kaufte er voller Übermut gleich einen Ferrari Testarossa. Als der Clubbesitzer den zu Gesicht bekam, klopfte er Harksen anerkennend auf die Schulter: „Tolles Auto.“
„Hab ich von deinem Geld gekauft.“
Da lachte der Clubbesitzer, weil er glaubte, Harksen hätte einen besonders guten Scherz gemacht. Aber der Kapitalanlage-Zauberer wusste um die Macht der Illusionen. Und er wusste, dass man eben nicht besser als mit der Wahrheit lügen konnte.
Die DDR im Lockdown
In der zweiten Märzwoche wird in München ein großes Fest gefeiert. Die Allianz-Versicherung hat ins Prinzregententheater geladen. Sie feiert heute ihren hundertsten Geburtstag. Als erstes ist eine vieraktige Komödie im Geburtstagsangebot. „Der Barbier von Sevilla oder Die unnütze Vorsicht“. Beaumarchais Komödie von 1775 belustigt 1400 Gäste aus deutschen Landen und der ganzen Welt. In der ersten Reihe sitzt Richard von Weizsäcker, der Bundespräsident.
Als ich von der Veranstaltung im Radio höre, muss ich schmunzeln und denke: Die Geschichtsschreiber werden später schmunzeln. „Die unnütze Vorsicht“? Wer soll über „den Löffel barbiert“ werden?
Der Barbier von Sevilla hat ausbarbiert und nun kümmern sich über hundert Hostessen bei mehreren Banketten um die Gäste in den Festsälen. Wolfgang Schieren führt als Vorstandsvorsitzender seit zwanzig Jahren die Allianz AG Holding. In seiner Rede legt er jetzt stolz dar, wie es um den Konzern bestellt sei. Man verwalte Kapitalanlagen im Wert von 130 Milliarden DM und gehöre zu den größten Immobilienkonzernen des Kontinents. Doch wolle man weiter wachsen, Firmenübernahmen tätigen und neue Partnerschaften in der ganzen Welt aufbauen.
Schieren weist auf neue Geschäftsfelder in Russland, Japan, Thailand, Griechenland hin – und in der DDR. Gerade am Vortag habe man die Erlaubnis erhalten, in Ostberlin eine Repräsentanz zu eröffnen. Das ist ein maßloses Understatement, eine zweckgerichtete Verniedlichung eines eigentlich skandalösen Vorgangs. Denn er selbst hat bereits am 14. November 1989, also nur fünf Tage nach dem Fall der Mauer, dem Chef der Lebensversicherungssparte, Uwe Haasen, telefonisch den Eilauftrag erteilt, die »Staatliche Versicherung der DDR« zu akquirieren. Seitdem arbeitet Haasen, der aus Ostdeutschland stammt, an der Übernahme dieses fetten Sahnestücks.
Die »Staatliche«, wie sie Allianz-Mitarbeiter bald nur noch nennen, ist natürlich ein volkseigener Monopolist auf dem ostdeutschen Markt. Haasen weiß das zu schätzen und für das monopolistische Ziel der Allianz zu nutzen. In der Firma liebt man Tiervergleiche, der Stärkere schluckt den Schwachen oder wird Bruder des Gleichstarken. Der Tiger setzt zum Sprung an.
Und was mich betraf, so war ich zwar kein Tiger, wäre aber gerne ein einziges Mal der Stärkere gewesen und hätte zum Sprung angesetzt. Das Arbeitsamt hätte mich mal kennen lernen sollen. Ob ich je gesprungen wäre, war mir nicht klar. Aber ich teilte Emmas Wutausbruch.
„Diese Trickser! Verwaltungen sollten neutral und fair sein. So eine Schweinerei!“, fluchte Emma.
Meine Frau hatte absolut Recht. Unser gemeinnütziges Bildungsinstitut war mit dem allerersten ökologischen und umwelttechnischen Weiterbildungsangebot in der Bundesrepublik an den Start gegangen. Das war vor dreieinhalb Jahren gewesen, im Oktober 1986. Das zuständige Frankfurter Arbeitsamt hatte unsere Lehrgänge für arbeitslose Natur- und Ingenieurwissenschaftler begrüßt und bewilligt. Aber das Offenbacher Amt, in dessen Bezirk unsere GTU-Gründerzeit-Villa neben dem Deutschen Wetterdienst stand, versuchte alles, um uns loszuwerden.
Wir waren mit den mehrmonatigen Lehrgängen sehr erfolgreich; die Kursabsolventen fanden ihre Berufswege im angewandten Umweltschutz. Umwelttechnik und Umweltgesetzgebung waren zwischenzeitlich vorangeschritten. Noch Anfang der Achtziger Jahre bis hinein ins Jahr 1985 hatte bei den Arbeitsämtern die Ansicht vorgeherrscht, Umweltschutz vernichte Arbeitsplätze. Auch in Wirtschaftsmagazinen hatte man in dieses Horn geblasen. Doch das Gegenteil war der Fall. Inzwischen waren über 250.000 Arbeitsplätze im Umweltschutz entstanden.
Nun also befanden sich Umwelt, Wirtschaft und wir im Aufschwung. Doch da war diese ewige Drangsaliererei aus dem Offenbacher Amt. Die heimtückischen Amtsattacken machten uns arg zu schaffen. Nach zwei Jahren waren wir nach Frankfurt geflüchtet. Und jetzt mussten wir gegen das Offenbacher Amt klagen. Es ging um 320.000 Mark, um die man uns aus unserer Sicht geprellt hatte.
„Du solltest zuvor unbedingt mit dem Chef der Frankfurter Arbeitsverwaltung sprechen, damit die nichts in den falschen Hals bekommen. Mit denen verstehen wir uns gut, wenn die aber erfahren, dass wir gegen Offenbach klagen …“, sagte Emma.
Ich hatte bereits im Januar einen Termin vereinbart, denn wir rechneten jederzeit mit der Nachricht des Sozialgerichts. „Den in Aussicht stehenden Prozess würde ich gerne absagen und unsere Klage zurücknehmen“, antwortet ich Emma. „Doch ich befürchte, die Offenbacher bleiben unzugänglich. Meine letzte Hoffnung ist Direktor Griesheimer.“ Er war der Frankfurter Amtsleiter, und nun hatte ich in drei Tagen eine Vorsprache bei ihm. Vielleicht konnte er auf seinen Offenbacher Kollegen einwirken.
Frau Söhnlein, die Beamtin, die uns mit ihrem willkürlichen Verwaltungsgebaren aus dem Offenbacher Bezirk vertrieben hatte, hatte in Offenbach das Z-Büro geleitet; das war das zentrale Büro für die Bearbeitung von Fortbildungs- und Weiterbildungsangeboten. Unglücklicher Weise war uns diese angestaubte Beamtin wenige Monate nach unserer wirtschaftlich bedingten Flucht in den freundlichen Frankfurter Arbeitsamtsbezirk nachgefolgt. Nun hatten wir sie wieder auf der Pelle. Der Notausgang hatte sich als Sackgasse erwiesen.
Die von Emma angesprochene Schweinerei war gerade vor wenigen Monaten aufgeflogen. Parallel zu unserer neuen Frankfurter Einrichtung hatten wir weiterhin noch Kurse in der Offenbacher Villa laufen. So ganz waren wir dieses Amt also noch nicht los. Nun hatten die Offenbacher hinter unserem Rücken eine Auftragsmaßnahme ausgeschrieben.
„Das ist ein Ding der Unmöglichkeit“, hatte sich Herr Lewin entrüstet, als ich ihn in seinem Büro besuchte. Er war der fachliche Arbeitsamtsexperte aus Frankfurt und hatte den Zahn der Zeit rechtzeitig erkannt. Sein Revier war der FVD, der Fachvermittlungsdienst; somit war er für die Beurteilung der arbeitsmarktlichen Notwendigkeit der von uns angebotenen Umwelt-Maßnahmen zuständig.
„Hier, Sie sehen es doch! Die Anzeige ist uns rein zufällig in die Hände gefallen. Man hat haargenau unsere Inhalte abgekupfert und bietet sie nun irgendeinem x-beliebigen Bildungsträger an, egal, ob man dort über das Know-how und die zahlreichen Kapazitäten verfügt, die man für diese komplexen Lehrgänge benötigt“, hatte ich geantwortet.
Dann hatte ich mit einem Bildungsträger in NRW telefoniert, den ich vor drei Jahren auf dem Flur des Offenbacher Amtes kennen gelernt hatte. Er hatte damals ein Bündel Geldscheine gezückt und Andeutungen gemacht, die mich irritiert hatten. Der verschmitzte Geschäftsführer war dennoch nicht zum Zug gekommen.
Jetzt erklärte er, er würde sich nicht auf diese Maßnahme bewerben, denn es sei klar, dass man mit einem Stundensatz von fünf Mark keine vernünftige Maßnahme durchführen könne. Damit sei gerade mal ein Englisch-Sprachkurs finanzierbar. Er hätte bereits mit dem Offenbacher Amt telefoniert. Man habe ihm 7,80 DM angeboten, aber unter 8,50 DM würde er es nicht verantworten wollen.
Ob er das vor Gericht bezeugen würde, hatte ich gefragt.
„Aber sicher doch! Es ist die Wahrheit. Was ist daran problematisch?“
Problematisch war es nun für das Amt, denn bei uns war man nicht bereit gewesen, auch nur einen Pfennig über fünf Mark hinauszugehen. Alles war dokumentiert. Man wollte uns übervorteilen, wollte uns gegenüber anderen Trägern benachteiligen, wollte uns finanziell in die Enge treiben, wollte uns austrocknen und damit etwas Innovatives beseitigen, was einem nicht ins konservative Amtskonzept passte. Man wollte uns ruinieren. Dagegen hatte ich zum Schutz unserer gemeinnützigen Einrichtung Klage erheben müssen.
Doch jetzt hoffte ich auf eine Chance, ohne Klage zum Ziel zu gelangen. Der Frankfurter Amtsdirektor empfing mich freundlich und signalisierte mir sogleich sein Verständnis. Allerdings sei das Offenbacher Amt für dessen Amtshandeln selbst verantwortlich. Er könne auf keinen Fall in dieses laufende Verfahren eingreifen.
„Wäre es Ihnen eventuell möglich als Vermittler beim Offenbacher Amt anzuklopfen und zu fragen, ob zumindest der hier in Frankfurt genehmigte Stundensatz für die Offenbacher akzeptabel ist. Dann wäre ja die Kuh vom Eis“, bat ich fast flehend.
„Ich kümmere mich darum und rufe Sie dann an.“
Der Anruf erreichte mich zwei Tage später. Nein, leider habe er seinen Amtskollegen nicht umstimmen können. Offenbach bliebe hart, man lasse es auf einen Musterprozess ankommen.
Vor dem Frankfurter Römerberg steht der Gerechtigkeitsbrunnen. Der Justitia-Brunnen ist ein Wahrzeichen der Stadt. Die Justitia steht erhobenen Hauptes mit geschlossenen Augen auf einem Sockel. In der linken Hand hält sie eine beidseits ausgeglichene Waage, ihre Brüste sind entblößt, und in der rechten Hand trägt sie ein Schwert.
Die Richterin am Frankfurter Sozialgericht trug eine hochgeschlossene Robe, mit der linken Hand drehte sie an einem merkwürdigen Lesegerät für Akten, das wie ein kleiner Kopierer aussah. Es war über ein Kabel mit ihrem linken Ohr verbunden. Die Akten wurden von einem Justizmitarbeiter nach ihrer Anweisung aufgelegt. Die Finger ihrer rechten Hand trommelten auf den Richtertisch. Ihr leerer Blick pendelte zwischen uns, dem GTU-Anwalt und mir, und dem Anwalt der Offenbacher Arbeitsverwaltung hin und her. Sie war blind.
Leider war sie auch blind gegenüber unserem Anliegen. Sie sah keinerlei Amtswillkür. Unsere benannten Zeugen wollte sie erst gar nicht anhören, die Sache sei klar, da wir ja weiterhin mit dem Amt zusammenarbeiten würden. Auf freiwilliger Basis. Als freier Bildungsträger sei es uns ja freigestellt, auf die Förderung der Maßnahmen durch das Amt zu verzichten. Schließlich stehe es den Kursteilnehmern frei, sich auf eigene Kosten eine Weiterbildung angedeihen zu lassen.
Mit keinem Wort war die auf beiden Augen blinde Richterin auf unsere Begründungen eingegangen: Dass man dienstanweisungswidrig eine Auftragsmaßnahme ausgeschrieben hatte, obwohl dem Amt ein bundesweit akzeptiertes Angebot von uns vorlag. Dass man uns monatelang keinen Bescheid erteilt hatte. Dass man die anfragenden Kursinteressenten mit Falschauskünften abzuhalten versuchte. Dass man unser Know-how an Wettbewerber weitergab. Dass man Wettbewerbern, die weder Ahnung noch Erfahrung in diesem hochkomplexen Fortbildungsmilieu hatten, hinterrücks einen höheren Preis als uns angeboten hatte. Dass man uns mit allen möglichen Tricks unter Druck setzte, uns gewissermaßen ununterbrochen erpresste.
Kein Wort dazu im Prozess – außer von unserem Anwalt.
Kein Wort dazu im Urteil.
Der Urheberin aller Beschwerden, Frau Söhnlein, war klar gewesen, dass keines ihrer Argumente gegen unser umwelttechnisches und ökologisches Modellprojekt weder beim Landesarbeitsamt noch beim Gericht Beifall finden würde. Daher hatte sie auf die altbewährte bürokratische Methode des Hinhaltens und der Sabotage zurückgegriffen, um unser Vorhaben zu vereiteln. Es war ihr zwar nicht gelungen, und wir waren noch am Leben.
Aber unsere Klage gegen ihre so störende Sabotage fiel hier bei Gericht völlig hinten runter – mit dem widersinnigen Argument, wir lebten ja noch und hätten keinen existentiellen Schaden, denn sonst würden wir nicht mehr existieren.
Gott sei Dank hatte ich zwei Jahre zuvor eine positive Erfahrung beim Darmstädter Landgericht gemacht, wo man den irrwitzigen Wunsch mancher Teilnehmer aus unserem ersten Modelllehrgang abgeschmettert hatte: Die klagenden Teilnehmer sollten, wenn es nach ihnen gegangen wäre, ohne Berücksichtigung ihrer individuellen Leistung eine sehr gute Bewertung zertifiziert bekommen. „Jeder eine Eins!“, hieß ihre griffige, aber für mich unbegreifliche Formel. Das hätte unser Zertifikat auf dem Arbeitsmarkt absolut wertlos gemacht. Das Gericht hatte es ebenso gesehen. Vernunft hatte gewaltet.
Aber diese Prozessführung hier vorm Sozialgericht gegen das hochheilige Offenbacher Amt war einfach unterirdisch.
Die ungewollte juristische Weiterbildung im Laufe dieses dreistündigen Verfahrens bei der blinden Richterin führte mich zu der wenig erbaulichen Erkenntnis, dass die Blindheit der Justiz gelegentlich im mehrfachen Wortsinn zutreffend sein kann. Gegenüber unserer bundesdeutschen Justiz war ich seitdem zwar nicht voreingenommen, aber doch in gewissem Sinn geimpft.
Genau das berichtete ich unserer Sekretariatschefin.
„Lassen Sie sich ruhig noch mal impfen. Diesmal Grippe-Impfung!“, rief mir Frau Wenzel auf dem Flur zu. „Ich habe es seit Freitag hinter mir und das Wochenende gut überstanden.“
„Ich muss in den Unterricht. Nachher können wir sprechen“, antwortete ich und beeilte mich, um vor den Kursteilnehmern im Raum zu sein. Aber als ich den Unterrichtsraum betrat, saß bereits ein Teilnehmer breit grinsend dort. Es war mein alter Jugendfreund Veit in seinem Rollstuhl, und er feixte: „Na, du hast doch letztlich gemeint, du seist immer eine viertel Stunde vor Lehrbeginn zur Stelle. Verschlafen?“
Er hatte nicht unrecht, die Nacht war nicht gerade ruhig und erholsam gewesen. Meine Tochter Karola hatte Durchschlafschwierigkeiten gehabt und war kurz nach Mitternacht und dann noch einmal frühmorgens gegen fünf Uhr zu meiner Frau und mir ins Bett gekrochen gekommen.
Ich war etwas später dran als sonst. Normalerweise schaute ich in alle Unterrichtsräume, kontrollierte die Sauberkeit, schaute nach den Tafeln und Flipcharts, ob jeweils neues Papier aufgelegt war oder ob Stifte und Kreide noch ausreichend vorhanden waren. Ich kontrollierte die Beamer und Overheadprojektoren, die Leinwände und ob die Heizungen funktionierten und das Thermostat angemessen eingestellt waren.
„Kontrollieren Sie nicht zu viel“, hatte mein Hausarzt gemeint, als ich ihm über meine Magenbeschwerden unterrichtete. „Nehmen Sie Talcid. Das bindet die überschüssige Magensäure. Und denken Sie daran: Mehr an Ihre Mitarbeiter delegieren! Vertrauen Sie Ihren Leuten, das wird alles gut gehen, auch wenn Sie nicht überall kontrollieren!“
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, hieß meine Devise bisher. Nun also sollte ich den Spruch umkehren und mehr Betonung auf das Vertrauen legen. Dem Sekretariat mit Frau Wenzel vertraute ich blind. Nur nicht im Fall der Grippeimpfung. Da ließ ich mich von ihr nicht überzeugen.
Vor einigen Jahren hatte ich mich das erste Mal in meinem Leben gegen Influenza impfen lassen. Es war schiefgegangen.
„Sind Sie gesund?“, hatte mich mein Hausarzt gefragt.
„Topfit!“, hatte ich geantwortet. „Keinerlei Krankheitsanzeichen seit achtzehn Monaten. Die letzte Erkältung war im Februar Vierundachtzig.“
Aber ich hatte mich dann nur noch schlappe drei Stunden lang wacker gehalten. Danach begann der große, der ganz große Zirkus. Gliederschmerzen, wie ich sie noch nie im Leben hatte. Hohes Fieber – 39,8 Grad innerhalb kürzester Zeit. Beißende Halsschmerzen, gefolgt von einem lästigen und bald schon schmerzhaften trockenen Dauerhusten. Ein Schnupfen vom Besten hatte das Impfprogramm abgerundet. Und das Nachglühen der Influenza dauerte fast ein Vierteljahr.
Veit, der jetzt samt seinem Rollstuhl in einem unserer Umweltinformatik-Kurse gelandet war und mich eben begrüßt hatte, war seinem gut durchdachten Selbstmord vor einem Jahr nur knapp entronnen. Dafür musste er ein großes Opfer bringen und auf den Bahngleisen seine beiden Beine zurücklassen. Erst hatte er das Scheitern seines selbstgewählten Todes bedauert und neue Pläne ausgeheckt, um sich umzubringen. Doch seit er unsere Weiterbildung besuchte, stärkte sich sein Überlebenswille und langsam zog wieder Freude in sein bisher so deprimierendes Leben ein.
Frau Wenzel kam vorbei, um einen Foliensatz auf dem Dozententisch abzulegen. „Und? Bereit zur Impfung? Ich kann es nur empfehlen, die Saison soll heftig werden. Und wir brauchen Sie hier.“
„Entschuldigen Sie“, sagte ich zu ihr. „Ich dachte, ich hätte Ihnen von diesem Impf-Reinfall damals berichtet.“ Als sie mich unwissend anschaute, fuhr ich fort: „Ich werde den Teufel tun und mich impfen lassen. Nein, das mute ich mir nach meiner Erfahrung nicht mehr zu. Es ist zu gewagt. Nie wieder.“
„Vielleicht war es damals nur ein Zufall, eine verunreinigte Ampulle oder so.“ Ihr treuer Augenaufschlag und ihr zutrauliches und zuversichtlich wirkendes Lächeln sollten mir Mut machen. Doch ich hatte unüberwindbaren Schiss vor einer Grippeimpfung.
„Ob Zufall oder nicht, ich lasse mich auf nichts mehr ein, außer auf die Auffrischung von Tetanus und Polio und diesem üblichen Kram.“ Aus irgendeinem Grund strich ich mir bedächtig übers Haar.
„Und genau davon bekommen Männer Haarausfall“, sagte Frau Wenzel und lachte schallend.
Hochstapler stapeln oft zu hoch
Gert Postels Aufgabe besteht derzeit im Implantieren von Haaren. Er hat es mit seiner Hochstapelei bisher nicht allzu weit gebracht – nun gut, immerhin zum falschen Dermatologen. Er, der gelernte Postbote, ist vor einigen Wochen bei dem zu einem extravaganten Haarkünstler avancierten Friseurmeister, Herrn Richter, gelandet, dem er sich als Hautarzt vorgestellt hatte. Sein gefälschtes Zeugnis war dem eitlen Chef eines Institutes für Haar-Transplantation beim Einstellungsgespräch nicht aufgefallen. Postel ist nur hier, um für eine gewisse Zeit so viel Geld wie möglich abzukassieren.
Postels große Karriere als geschätzter Oberarzt für Klinische Psychiatrie in Sachsen steht ihm noch bevor. Er, der Postbote, wird psychiatrische Gutachten für Schwurgerichte schreiben – er wird in einigen Jahren selbst nicht begreifen, wie weit und hoch ihn seine Hochstapelei katapultiert hat.
Wie verabredet tritt Postel pünktlich am Montagmorgen seinen Dienst an und wird von Dr. Warga, dem zweiten Arzt des Haar-Institutes, in seine Tätigkeit eingeführt. Warga, ein ungefähr fünfzigjähriger Kettenraucher mit leichtem Tremor, ist kein Facharzt für Dermatologie, wie Postel es vortäuscht, sondern nur Allgemeinarzt. Er erhält deshalb auch nur die Hälfte des Honorars, das Postel einsackt. Das sind immer noch fast 9000 Mark bar auf die Kralle. Und darauf kam es Dr. Warga entscheidend an, denn er gab sich, wie Postel in Erfahrung bringen konnte, gegenüber seiner geschiedenen Frau, die ihn mit Unterhaltsklagen verfolgte, vermögens- und einkommenslos.
Schon beim ersten Patienten, einem Installateur-Meister mit großem Wagen und großen Händen, zeigt sich, dass sich Postels Trockenübungen am Wochenende unter Anleitung seiner neu angelachten Freundin gelohnt haben. Es gelingt ihm anstandslos im richtigen Winkel mit der Kanüle in die Kopfhaut des vierschrötigen Mannes zu stechen und die sich bildenden Hügel aus Anästhesieflüssigkeit gleichmäßig wegzudrücken, sodass bald die beiden Implanterinnen ihr Werk beginnen können.
Mit großem Geschick und in Windeseile – sie werden nach Akkord bezahlt – setzen sie Haar für Haar in die betäubte Kopfhaut. Postel zieht sich zurück, bleibt aber in Rufbereitschaft, um im Falle des Nachlassens der Betäubung nach zu spritzen.
Während Dr. Warga ihn im Aufenthaltsraum mit seinen zweijährigen Instituts-Erfahrungen vertraut macht, geschieht etwas Ungeheuerliches: In dieser Villa, in der es normalerweise so leise wie in einem Mönchskonvent zugeht, erhebt sich plötzlich ein schrecklicher Lärm. Jemand brüllt so entsetzlich, dass Dr. Warga und Postel zunächst annehmen, ihrem Installateur-Meister sei etwas zugestoßen, eine Implanterin habe versucht, ihm ein Kunsthaar ins Auge einzupflanzen oder etwas ähnliches.
Nach und nach lassen sich aus dem Lärm einzelne Satzbrocken aussondern und verstehen: „Schauen Sie her, wie ich aussehe … Sie Verbrecher! … Geben Sie mir die siebzig Mille zurück, und zwar sofort … Eher gehe ich hier nicht raus … Was? Sie wollen mir mit der Polizei drohen? … Die hol ich gleich selber … die nehmen Sie mit … dafür werde ich sorgen … Sie hätten mich gewarnt, Sie Rindvieh … nicht föhnen …“
Nach diesem letzten Ausruf sagt Dr. Waga ganz trocken: „Ach so, das ist ein Föhnfall.“
„Wie bitte?“, fragt Postel.
„Hat man das Ihnen nicht gesagt?“, erwidert Dr. Warga. „Sie dürfen die eingepflanzten Kunsthaare unter keinen Umständen föhnen, also mit hohen Temperaturen in Verbindung bringen. Das Kunsthaar kräuselt sich dann zu winzigen Korkenzieherlöckchen. Im Extremfall schmilzt es sogar zusammen. Wenn Sie so in wenigen Minuten siebzigtausend Mark vernichten und dann auch noch absolut verboten aussehen, dann kriegen Sie natürlich eine gehörige Wut.“
„Puhh, das verstehe ich!“, stöhnt Postel.
„Stellen Sie sich einen glatthaarigen, geschniegelten Manager vor, dessen früherer Glatzenbereich plötzlich nicht mehr von teuer erworbenem Kunsthaar, sondern von einer Art Afrogekröse besetzt ist“, fährt Warga fort. „Der kann sich auf keiner Vorstandssitzung mehr sehen lassen, ohne Heiterkeit zu erregen. Und wenn er sich alles abrasieren und die Kunsthaare entfernen lässt, dann bleiben hässliche Narben. Dann greifen Sie, siebzigtausend Mark ärmer, wieder zum guten alten Toupet und fühlen sich wie ein Esel.“
„Was macht denn der Chef“ – es war inzwischen ruhig geworden – „mit solchen Föhnkunden?“, fragt Wargas neuer Kollege.
„Entweder bietet er ihnen eine Neuimplantation zum halben Preis an, der aber dann auf jeden Fall in bar zu entrichten ist, oder kostenlose Entfernung der Implantate plus ein Toupet als Zugabe. Geld zurück, das gibt’s beim Chef nicht. Da ist er eisern“, sagt Dr. Warga.
Kurze Zeit später kommt der Chef zu den beiden in den Aufenthaltsraum. Er ist etwas verschwitzt und außer Atem: „Dieser Groß, der Automatenaufsteller, ist ein harter Brocken. Brandstiftung in einer seiner Spielhallen. Er rennt, geldgierig wie er ist, noch mal in das bereits brennende Hinterzimmer, um die Kasse zu retten, holt sich ein paar schlimme Brandwunden und ist wütend darüber, dass unser Kunsthaar solche waghalsigen Abenteuer nicht übersteht. Habe ihn mit zwei Toupets abgefunden.“
Dann wird Gert Postel zum Nachspritzen zum Installateur-Meister gerufen.
Auch in der DDR ist Nachspritzen angesagt. Aber Bundeskanzler Kohl weigert sich weiterhin. Die Regierung des Runden Tisches unter dem PDS-Politiker Hans Modrow steht unter vielfältigem Druck. Sie will einerseits verhindern, dass bisherige SED-Genossen unter der Hand das Tafelsilber verhökern und andererseits, dass das Volk der DDR enteignet wird, indem man das Volkseigentum westdeutschen Kapitalanlegern zu Billigpreisen vor die Füße wirft. Die Regierung bekommt nicht mit, dass genau das bereits schon wenige Tage nach dem Fall der Mauer vonstattengeht.
Uwe Haasen, der Chef der Allianz-Lebensversicherungssparte, versucht einige Tage nach der Grenzöffnung eine weitere »Grenzöffnung« ins Leben zu rufen; anders gesagt: er versucht einen Türöffner für die »Staatliche Versicherung der DDR« zu finden. Die mächtige Allianz will die monopolistische »Staatliche« schlucken. Er denkt an den Anwalt Wolfgang Vogel, der auch in Westdeutschland bekannt ist, weil er die Freikäufe von Häftlingen aus der DDR und im Kalten Krieg den Agentenhandel organisierte. Bis zum 9. November 1989 war er an der Freilassung von 150 Agenten aus 23 Ländern beteiligt. Zu den Freigelassenen zählte auch Günter Guillaume, der 1972 aufgeflogene DDR-Kundschafter bei Bundeskanzler Willy Brandt. Erich Honecker beurteilte den Spionage-Fall Guillaume als »größten Fehler des MfS«, des Ministeriums für Staatssicherheit.
Den Anwalt kennt und respektiert jede politische Seite. Doch für den Allianzmanager Uwe Haasen fällt Vogel derzeit als Unterhändler aus, da er inzwischen aufgrund von böswilligen Falschbeschuldigungen verhaftet wurde. Die Zeit drängt, man muss den Stier bei den Hörnern packen, jetzt ist die Gelegenheit günstig, man kann nicht auf Vogels Freilassung warten. Also muss Haasen selber tätig werden.
Zunächst trifft er nur die Stellvertreter des Generaldirektors, doch im Januar gelingt es ihm, seinen Allianzchef Wolfgang Schieren mit dem Chef der »Staatlichen«, Günter Hein, zusammenzubringen. Man verhandelt in den folgenden Wochen ziemlich verdeckt und einigt sich schließlich darauf, dass die Allianz exklusiver Partner der »Staatlichen« wird. Andere Interessenten aus der BRD, der Schweiz und Großbritannien werden von Hein und seinem Stellvertreter Ullrich hingehalten oder ignoriert.
Ende Januar bekommt das DDR-Finanzministerium Besuch vom stellvertretenden Generaldirektor Ullrich. Er legt die Karten auf den Tisch und unterbreitet den Vorschlag, die Allianz als Partner zu beteiligen. Das Ministerium stimmt zu.
Die Allianz-Vorstände sind positiv überrascht, weil alles so gut läuft. Ihr Chefunterhändler Haasen äußert die Vermutung, dies sei dem zunehmenden Verfall der »Staatlichen« geschuldet, denn immer mehr Betriebe zahlen einfach ihre Beiträge nicht mehr. Die DDR-Versicherung muss ihren Kunden und Mitarbeitern jedoch eine Perspektive bieten. Auch der Generaldirektor und sein Stellvertreter brauchen demnächst Jobs.
Im Februar gibt der Vorstand der Allianz-Holding grünes Licht für das Joint Venture, das eher einer Übernahme gleichkommt. Schieren betont auf der Vorstandssitzung, es sei unabdingbar, dass die Allianz der einzige westliche Partner der »Staatlichen« werden müsse. Ein Konkurrenzkonsortium aus fünf westdeutschen Versicherern ist bereits ausgestochen worden.
Der Ministerrat der DDR schafft am 8. März die gesetzliche Grundlage für den Deal – die Arbeit der staatlichen Versicherung wird auf marktwirtschaftliche Prinzipien umgestellt. Zum 1. Mai wird sie in eine Aktiengesellschaft umgewandelt werden, an der eine ausländische Firma bis zu 49 Prozent halten darf. Schon längst ist klar, dass das die Allianz aus München sein wird.
Im Unterschied zu ihren Gästen wissen es die Manager des Münchner Konzerns schon sehr genau, als sie das Hundertjährige ihres Multis feiern. Und so genießen sie die extravagante Großfeier im Prinzregententheater umso entspannter.
Privat entspannten Emma und ich uns im Kreis unserer zehn Nachbarn. Jede Woche fand bei uns eine kleine Saunafeier statt. Nicht immer war es unbedingt entspannend, hauptsächlich nicht, wenn die einen oder anderen fürs Abendessen sorgen wollten, ihr Versprechen aber vergessen hatten. Aber immer war es spannend. Jedenfalls war es etwas sehr Privates und nicht nur Job, Job, Job. Wer das Essen versemmelt hatte, musste eine große Pizza-Runde samt Lambrusco vom Bornheimer »Dick und Doof«, unserem ersten italienischen Lieferservice, spendieren.
Die Saunarunde fand nun jeweils Freitagabends statt. Wir alle legten zusammen und engagierten eine professionelle Masseurin. Steffi baute im Saunaraum ihre Spezialliege auf und knetete immer drei von uns für jeweils eine halbe Stunde durch, dann saunierte sie selbst, ruhte eine dreiviertel Stunde aus, um dann die nächsten eineinhalb Stunden ihr Durchwalk-Programm fortzusetzen.
Natürlich waren die Ereignisse in der DDR die Themen des Tages, wobei wir – wie alle Westdeutschen – nicht wirklich wissen konnten, was hinter dem Rücken von uns Bürgern alles verhandelt und veranstaltet wurde. Die heiße Luft der Sauna wurde durch die heiße Luft unserer wilden Spekulationen zusätzlich aufgeheizt. Wenn uns diese Diskussionen zu heiß wurden, musste ein Schiedsrichter eingreifen. Gunnar, mein Prokurist aus der Frankfurter GTU, war der Bestgeeignete. Er schlug dann vor, eine Runde Witze zu erzählen.
Als erster legte seine Frau Moni los: „Warum kann Helmut Kohl nicht in den Himmel kommen?“
Tobias und seine Frau Anne, beide eifrige CDU-Sympathisanten, schauten erst etwas konsterniert, dann spekulierten sie wild drauflos. Auch von den anderen folgten einige mehr oder weniger kreative Spekulationen in Richtung Saumagen, Oggersheim und Flick-Spenden-Skandal, bevor Moni die Frage auflöste: „Natürlich weil er nicht durchs Ozonloch passt.“
Dann rasselte Stefan, unser inzwischen gealterter Jungschauspieler, mit entsprechend theatralischer Gestik eine Latte ungelöster Fragen herunter: „Warum gibt’s im Flugzeug-Klo kein Fenster? Wer soll denn da reingucken?“ Er reckte seinen Hals so, als wolle er irgendwo reinschauen. Wir mussten lachen.
„Wenn ein Forscher sich ein Sandwich macht, ist das wissenschaftlich belegt?“ Stefan strich mit einem imaginären Messer etwas auf seine Hand.
„Da hätte ich auch eine Frage“, sagte Gitti, unsere Arznei-Expertin vom Paul-Ehrlich-Institut, die absolut Spitze im Kuchenbacken war: „Heißen Teigwaren Teigwaren, weil sie mal Teig waren?“
Wir hätten uns geschüttelt vor Lachen, wenn uns nicht die Schweißperlen um die Ohren geflogen wären.
Ich war kein Witze-Erzähler, aber einen hatte ich erst kürzlich gehört: „Wenn ich Buchstabensuppe wieder auskotze, ist das dann gebrochenes Deutsch?“
Stefan machte auf seiner Ruheliege eine Mimik, als müsse er sich übergeben.
„Ich hab auch einen auf Lager“, meinte Gunni: „Wenn mich die Polizei anhält und sagt »Papiere!« und ich sag »Schere!«, hab ich dann gewonnen?“
Stefan war wieder dran und warf unbedarft einen Witz in die Runde: „Wenn ein Zuckerkranker vom Blitz getroffen wird, entsteht dann Karamell?“ Unser Lachen gefror ein wenig zu einem höflichen Lächeln. Und das nicht, weil Tobias, unser Nachbarschaftsarzt, Diabetologe war. Eher dachten wir im Stillen an Arndt, unseren ehemaligen Nachbarn, der sich als brandneu etablierter und begehrter EDV-Experte von seiner ebenso brandneuen Firma hatte verschleißen lassen. Er war zuckerkrank gewesen und war bereits vor einem halben Jahrzehnt, 1986, im Alter von nur 37 Jahren einem Herzinfarkt erlegen.
Aber keiner sagte jetzt ein Wort.
Deutsche Bank verpflanzt Konten
Infarktzeit in der DDR, Zuckerbrot und Peitsche aus dem Westen, viele Worte und doch viel zu wenige ehrliche Sätze. Die Leipziger Frühjahrsmesse startet am 12. März und dauert dieses Jahr bis zum Samstag vor der Wahl. Die Messe erlebt die letzten Tage der sozialistischen DDR. Noch immer ist völlig ungewiss, wer die Wahl am kommenden Wochenende gewinnen könnte und was aus der DDR wird. Ob und wann und unter welchen Bedingungen die Einheit kommen wird, ist noch immer offen.
Seit der Ankündigung Helmut Kohls, dass die D-Mark in die DDR kommt, hat sich Leipzig schlagartig verändert. An den Häuserwänden hängen Plakate, auf denen westdeutsche Politiker abgebildet sind. Noch kennen die DDR-Bürger nicht die wahre Bedeutung des Loriot-Spruchs: „Ich liebe Politiker auf Wahlplakaten. Sie sind tragbar, geräuschlos und leicht zu entfernen.“
Auf den Straßenbahnen klebt Werbung für westdeutsche Produkte. In der ehemaligen Kantine der Stasi-Zentrale hat ein Ehepaar aus Rheinland-Pfalz eine Kneipe eröffnet. Die Straßen sind voller westdeutscher Autos der Marken BMW, Daimler, Audi. Siemens hat massenhaft Hochglanzprospekte in die Briefkästen werfen lassen. Über dem Messegelände kreisen Hubschrauber, die westdeutsche Vorstandsvorsitzende zum Messegelände fliegen.
Dort präsentieren sich die Branchengrößen aus dem Westen mit aufwendigen Ständen. Sie sind in Lauerstellung, wollen Kontakte knüpfen, Informationen sammeln und die kommenden Mächtigen beeindrucken. Der Transrapid wird vorgestellt. SEL Alcatel führt Computer vor, die Produktionsabläufe steuern können. Vertreter von Mannesmann berichten über das neue Mobilfunknetz, das ihr Unternehmen mit Erlaubnis der Deutschen Bundespost aufbauen darf. Das Netz soll einmal »D2« heißen.
Der Generaldirektor eines DDR-Werkzeugmaschinenbau-Kombinates wird am Rand der Messe interviewt: „Fühlen Sie sich von den Westdeutschen vereinnahmt?“
„Das ist keine Frage des Gefühls. Wir werden vereinnahmt“, antwortet der Ostmanager.
Auch Gerhard Cromme, der kaltschnäuzige Vorstandschef des Stahlkonzerns Krupp wird von der Kamera erfasst. Ich sehe ihn im Fernsehen, ich erinnere mich an seinen rigorosen Umgang mit der Arbeiterschaft im Ruhrpott. 6000 Arbeitsplätze hatte er mit einem Federstrich vernichtet. Die Proteste der Arbeitslosen bewegten ganz Westdeutschland und waren, wie Tamara mir berichtet hatte, auch im DDR-Fernsehen zu sehen gewesen. „Da sieht man, wie gnadenlos der Klassenfeind mit Arbeitern umspringt!“, hatte sie mir geschrieben.
Jetzt rückt Cromme vor der Kamera beiläufig seine Krawatte zurecht. „Die Chancen sind größer als die Risiken, und deshalb braucht die Bevölkerung keine Angst zu haben, denn man sieht es ja am Beispiel der Bundesrepublik, wohin die soziale Marktwirtschaft führen kann“, sagt Cromme ohne mit der Wimper zu zucken ins Mikrofon.
Der wesentlich kleinere Modrow steht neben ihm. Der DDR-Ministerpräsident wirkt müde und abgekämpft, wirkt wie ein Besucher auf exterritorialem Gelände. Cromme dagegen ist in seinem Element. Er redet fast aufgedreht von oben auf Modrow ein: „Herr Ministerpräsident, es sind Zeiten des Umbruchs, besondere Zeiten, neue Zeiten, in denen Informationen und Erfahrungsaustausch eine große Rolle spielen. Wir erwarten zu großen Abschlüssen zu kommen. Da sind für uns natürlich besonders die engen Beziehungen der DDR-Firmen zu den Firmen im RGW-Raum interessant.“
Modrow dreht sich leicht zur Kamera, dann sagt er in Richtung Bonn, gerichtet an den Chef des Bundeskanzleramtes: „Ich glaube, in der Politik wird im Moment viel Wahlkampf betrieben. Herr Seiters erklärt, dass Herr Modrow etwas bremst. Herr Modrow hat überhaupt nichts zu bremsen, im Gegenteil. Man möge sich mal anschauen, was in den zurückliegenden Wochen an Gesetzgebungen geschehen ist, um marktwirtschaftliche Bedingungen und Voraussetzungen zu schaffen.“
Modrow scheint zu ahnen, dass seine Stunde geschlagen hat. Er nimmt all die unnatürliche Aufregung, die rundum herrscht, wahr, kann sich ihr aber nur fügen. Seit einigen Wochen herrschen in Leipzig andere Verhältnisse. Jedenfalls keine sozialistischen. Noch halten sich die westdeutschen Industriellen und ihre Lobbyisten an Modrow. Man weiß ja nicht hundertprozentig, wie die Wahl in wenigen Tagen ausgehen wird. Man will nicht aufs falsche Pferd setzen. Dreistigkeit unter der Hand, ja. Aber nach außen hin gilt immer noch die alte Devise: »Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste«.
Vorsicht lässt auch die Deutsche Bank noch walten. Auf der Messe hat sie einen herausragenden Stand und lädt zu Crashkursen für Existenzgründer in der DDR ein. Sie selbst ist bestrebt, unauffällig ihre eigene Existenzgründung im Einzugsgebiet Ost vorzubereiten. Der »Big Deal« mit der bald ausgeschlachteten Staatsbank und ihrem Vize-Chef Edgar Most läuft weiter still im Hintergrund.
Most ist mit dem Chef der Deutschen Bank, Hilmar Kopper, und mit anderen Hohen Priestern des westdeutschen Finanzkapitals in einem Privatjet nach Leipzig eingeflogen. Auch dieser Flug soll geheim bleiben. Deshalb fährt man in getrennten Limousinen zu verschiedenen Veranstaltungen. Der heimlich abgeschlossene Vertrag über die teilweise Übernahme der Belegschaft, des Know-hows – also des internen Wissens über die DDR-Finanzströme – und der Filialen dieser wichtigsten DDR-Bank ist bereits in der Schublade.
Einen Tag nach der Wahl soll die Schublade herausgezogen werden und der Deal in Kraft treten.
Auch der junge Detlef Scheunert ist auf der Leipziger Messe. Offiziell ist er noch immer der persönliche Referent des Ministers für Schwermaschinenbau. Im November vergangenen Jahres hatte ihn ein Ministeriumskollege gefragt: „Und, machst du auch die Flatter? Denk mal darüber nach!“ Doch Scheunert hatte nicht im Entferntesten daran gedacht, schließlich hatte er nichts zu verbergen. Und jetzt, in dieser aufregenden und wichtigen Umbruchzeit, würde er erst recht nicht abwandern.
Er ist 29 Jahre alt, groß gewachsen, mit dunklen Haaren, Brille und DDR-typischem Schnauzbart. Er hat ein gewinnendes Lächeln, eine diplomatische Ader, aber er lässt sich auch nicht verbiegen. Einige seiner Kollegen haben sich bereits aus Berlin abgesetzt. Sie befürchten, in einer anderen DDR oder gar in einem vereinten Deutschland »zu kontaminiert« zu sein. Scheunert sieht das völlig anders. Er lebt mit seiner Frau, seinem Sohn und seiner Tochter für weniger als einem DDR-Hunni in einer Ostberliner Wohnung. Ist es ein Verbrechen, in einem sozialistischen Land Karriere gemacht zu haben, denkt er.
Er hört die Versprechungen der neu konstituierten konservativen Parteien, deren Parolen sich auf drei Worte reduzieren lassen: Bei Einheit Wohlstand.
Urlaub in Honeybridge
John hieß jetzt Stephen Carry und war in den Vereinigten Staaten ein berühmter Countrysänger geworden. Er musste so alt wie ich sein, knapp vierzig. Sogar bis nach Irland und Schottland hatten es seine Songs gebracht. Fast jeder englischsprachige Liebhaber amerikanischer Folksongs kannte ihn und sein bezauberndes Gitarrenspiel. Und dann war er in das Filmgeschäft eingestiegen; nicht in die großen Hollywoodproduktionen, aber er spielte in solchen amerikanischen Soaps wie Baywatch mit.
Jedermann jenseits des Atlantiks kannte sein Gesicht. Ich erkannte ihn nicht, obwohl ich ihn in seiner Jugendzeit kennen gelernt hatte. Damals, 1970, war ich dem Kalifornier im spanischen Süden, in Torremolinos, begegnet. Wir beide waren damals zwanzig Jahre jung. Er arbeitete hinter der Theke der angesagten Hippie-Bar »Alamo« als Barkeeper und war vor der Army desertiert, wie mir seine Freundin Svea erzählt hatte. An jenem Abend hatte ich ihn mir genauer angesehen.
Er war groß, schlank und athletisch gebaut; er trug »Gibran-Masche«, das heißt, er trug sein Haar im Jesusstil. Da passten die Jesuslatschen, wie ich beiläufig feststellte, haargenau. Ein wallender Bart umrahmte sein längliches Gesicht, aus dem kluge und entschlossene blaue Augen funkelten. Irgendwie passten seine abgewetzten Jeans und das Farmerhemd, worüber er eine jener beliebten Hippie-Westen trug, gut zusammen.
John war mir sofort sympathisch gewesen. Wir hatten von ihm erfahren, wie es an der amerikanischen Heimatfront aussah. Er war dem Einberufungsbefehl nicht gefolgt, war über Kanada geflüchtet und war von den US-Behörden über alle amerikanischen Konsulate und über alle Kontinente hinweg gesucht worden. Er war einer von Hunderttausenden auf einer langen Desertionsliste. Deshalb hatten ihm seine Freunde aus der Friedensbewegung einen falschen Pass besorgt. Er führte ein Leben im Untergrund. Keiner der rund um Torremolinos stationierten Ami-Soldaten, die sich gelegentlich im »Alamo« amüsierten, um über ihren trostlosen Alltag als ungeliebte Ausländer in Spanien hinwegzukommen, hatte seine wahre Identität gekannt.
Aber einer musste ihn ein Jahr später schließlich doch erkannt und verraten haben.
Was ihn Anfang der Siebziger Jahre zur Fahnenflucht bewegt hatte, hatte er uns sehr anschaulich geschildert. Fassungslos hatten er und seine Studienfreunde der Universität von Kent, Ohio, am 4. Mai 1970 auf die erschossene Kommilitonin geblickt. Aus ihrem Brustkorb in der Höhe des Herzens sickerte Blut. Da war nichts mehr zu machen; leblos lag das Mädchen, das eben noch mit ihnen zu einem Teach-in wegen Nixons Kambodscha-Überfalls gehen wollte, auf dem Pflaster. Die Nationalgarde hatte auf die Studenten ohne Vorwarnung geschossen. Das Kent-State-Massaker wurde für die amerikanische Jugend zum Fanal des Aufruhrs.
Auch Svea hatte ich im »Alamo« kennen gelernt. Die hübsche und kluge Dänin und er waren ein süßes Pärchen gewesen; sie hatten sich geliebt und waren füreinander da. Obgleich Svea mir beiläufig erklärt hatte, dass sie auch gut ohne ihn auskommen könne. Aber damals war sie erst siebzehn gewesen und hatte vielleicht noch andere Ideen im Kopf. Jedenfalls hatte sie die Verhaftung ihres Geliebten und sein Verschwinden von einem Tag auf den anderen so arg mitgenommen, dass sie in eine akute psychische Krise geraten war. Ein Jahr lang hatte sie einmal pro Woche die beschwerliche Busfahrt nach Malaga unternommen, um sich therapieren zu lassen.
Sie hatte John nicht besuchen können. Das amerikanische Konsulat hatte jegliche Auskunft über seinen Verbleib verweigert. Svea blieb in dieser brutalen Realität hilflos zurück. Sie wurde drogensüchtig, fuhr auf Heroin ab; es war eine Rutschbahn in den Tod.
Einige meiner Freunde von damals, auch Wolle und Quiny, und ich hatten uns einige Zeit später auf den Weg gemacht, um Svea auf den letzten Drücker zu retten. Sie war jedoch aus Torremolinos verschwunden. Ihre Spur hatte uns ins Hippieparadies Marokko, nach Tanger und nach Marrakesch geführt. Ich hatte damals John gesucht und ihn glücklicher Weise gefunden, bevor unsere strapaziöse Suchaktion in Sachen Svea gestartet war. John hatte die Spur zu ihr ebenso verloren wie meine Freunde und ich.
In jenen Tagen wollte ich mit ihm gemeinsam Svea aus ihrem tödlichen Sumpf befreien. Auf ihn hätte sie gewiss gehört. Für ihn hätte sie die Kraft aufgebracht, sich aus der Geiselhaft des Heroins zu lösen. Es war uns nicht gelungen. Wir hatten sie nur noch als Leiche den Behörden übergeben können. Es war eine todtraurige Sache. Die Dramatik jener Zeit wirkte lange nach. John kehrte zurück nach Torremolinos und auch seine Spur verwischte sich mit den Jahren. Ich hatte nie mehr etwas von ihm gehört.
John alias Stephen Carry wurde in diesen Märztagen, in denen sich das Schicksal Deutschlands wendete, von Stewardessen erst kurz vor dem Abflug von L.A. diskret an Bord geleitet. Er war nicht mehr so schlank wie einst, aber man sah seinem athletischen Körperbau an, dass er regelmäßig Sport trieb. Statt Gibran-Masche trug er nun sein Haar halblang und aus den Jesuslatschen waren feine braune Lederschuhe geworden. Der einst wallende Bart war total gestutzt und kurz getrimmt. Aus seinem länglichen Gesicht funkelten wie früher kluge und entschlossene blaue Augen. Aus den Hippieklamotten war ein modischer extravaganter Herren-Anzug geworden.