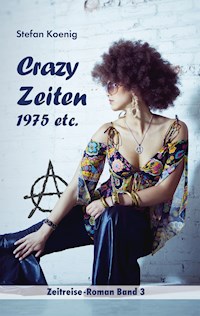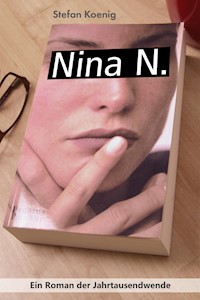
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als die achtunddreißigjährige Alice nach sechs Jahren Haft den siebzehnjährigen Tom kennen lernt, hat sie bereits ihre neue Identität – als Nina Nowak. Die willensstarke Frau, von deren Schicksal niemand ahnt, taucht mit illegalen Mitteln in eine ihr unbekannte Berufswelt ein. Aus Not und aus Sehnsucht nach einer verborgenen Liebe lässt sie sich auf das »Abenteuer Schule« ein. Aus der Schauspielerin wird eine geschätzte Sport- und Physik-Lehrerin. Tom zuliebe setzt sie ihre magische Begabung ein und traut sich an Einsteins Raum-Zeit-Theorie heran. In einem Schriftsteller-Seminar befreundet sie sich mit der siebenundzwanzigjährigen Nora. Und Nora lernt das Trauma ihrer neuen Freundin kennen. Gerüchte über die beliebte Lehrerin entstehen. Auch wenn diese schließlich zerplatzen, so erschweren sie doch Ninas Weg. Die Frauenfreundschaft hilft lindern, aber der ent-scheidende Schritt bleibt aus. Der Alltag eines dubiosen Schulgeschehens scheint Ninas Problem zu überdecken. Bis Nina bei Tom und seinem Vater Leo einzieht – Ninas Schulamtsvorgesetztem. Ein Pulverfass an Gefühlen ent-steht. Plötzlich taucht auf dem Höhepunkt ihrer schulischen Karriere ein dunkler Schatten aus ihrer Vergangenheit auf und zwingt zum Handeln. Wird sie durch Mauern gehen? Wird sie die Kraft fin-den, den Justizirrtum von damals aufzuklären? Aber da gibt es noch eine Doppelgängerin, die unge-schminkte Nina Nowak. Sie ist ebenfalls Lehrerin – aller-dings in einer siebzig Kilometer entfernten Großstadt. Als sie plötzlich verschwindet, beginnen die polizeilichen Ermittlungen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 798
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Stefan Koenig
Nina N.
Ein Roman der Jahrtausendwende
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Nina N.
Vorwort zur Neuauflage
Prolog
22. Oktober 1999
Teil I
Frühling 1999
Erstes Kapitel
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
Teil II
Frühsommer 1999
1
2
3
4
5
6
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Teil III
Sommer 1999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Teil IV
Sommerferien 1999
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
Teil V
Herbst 1999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Teil VI
Winter 1999
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
Herzlichen Dank
Nachbetrachtung
»2034«
»Freie Republik Lich – 2023«
Sturm über Lich - 2022
Der Fremde – Lich, 19. Januar 2022
Die realistischen Zeitreise-Romane …
Sexy Zeiten – 1968 etc.
Wilde Zeiten – 1970 etc.
Crazy Zeiten – 1975 etc.
Bunte Zeiten – 1980 etc.
Rasante Zeiten – 1985 etc.
Blühende Zeiten – 1989 etc.
Neue Zeiten – 1990 etc.
Verflixte Zeiten – 1994 etc.
Schöne Zeiten – 1997 etc.
Freitag,
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Worum es geht in:
Worum es geht in:
Worum es geht in:
Worum es geht in:
Impressum neobooks
Nina N.
Stefan Koenig
Nina N.
Roman
Pegasus Bücher
Dieses Buch
widme ich
allen tapferen Frauen,
insbesondere
Monika Böttcher
© 2022 by Stefan Koenig
Das Buch
Als die achtunddreißigjährige Alice nach sechs Jahren Haft den siebzehnjährigen Tom kennen lernt, hat sie bereits ihre neue Identität – als Nina Nowak. Die willensstarke Frau, von deren Schicksal niemand ahnt, taucht mit illegalen Mitteln in eine ihr unbekannte Berufswelt ein. Aus Not und aus Sehnsucht nach einer verborgenen Liebe lässt sie sich auf das »Abenteuer Schule« ein. Aus der Schauspielerin wird eine geschätzte Sport- und Physik-Lehrerin. Tom zuliebe setzt sie ihre magische Begabung ein und traut sich an Einsteins Raum-Zeit-Theorie heran.
In einem Schriftsteller-Seminar befreundet sie sich mit der siebenundzwanzigjährigen Nora. Und Nora lernt das Trauma ihrer neuen Freundin kennen. Gerüchte über die beliebte Lehrerin entstehen. Auch wenn diese schließlich zerplatzen, so erschweren sie doch Ninas Weg.
Die Frauenfreundschaft hilft lindern, aber der ent-scheidende Schritt bleibt aus. Der Alltag eines dubiosen Schulgeschehens scheint Ninas Problem zu überdecken. Bis Nina bei Tom und seinem Vater Leo einzieht – Ninas Schulamtsvorgesetztem. Ein Pulverfass an Gefühlen ent-steht. Plötzlich taucht auf dem Höhepunkt ihrer schulischen Karriere ein dunkler Schatten aus ihrer Vergangenheit auf und zwingt zum Handeln.
Wird sie durch Mauern gehen? Wird sie die Kraft fin-den, den Justizirrtum von damals aufzuklären?
Aber da gibt es noch eine Doppelgängerin, die unge-schminkte Nina Nowak. Sie ist ebenfalls Lehrerin – aller-dings in einer siebzig Kilometer entfernten Großstadt. Als sie plötzlich verschwindet, beginnen die polizeilichen Ermittlungen ...
Nichts in diesem Roman ist wahr.
Ähnlichkeiten sind rein zufällig.
Das Leben ist viel härter.
Vorwort zur Neuauflage
Dieser Roman hat aus besonderen Gründen zweiundzwan-zig Jahre geruht. Wenn Sie Näheres dazu erfahren möchten, dann lesen Sie bitte das Nachwort. Doch weder dieses Vor- noch das Nachwort sind so wichtig oder interessant wie die Geschichte selbst, die hier erzählt wird.
In der Erstveröffenlichung bezeichnete ich die damals 636 Seiten umfassende Erzählung als »Schulroman«. Aber das Buch enthält viel mehr. Mindestens drei Genre spielen hinein: eine Kriminalstory, eine gewaltiger Schuss an diver-sen gesellschaftskritischen Komponenten und – last not least – eine starke Frauengeschichte.
Die Mischung mag ungewöhnlich erscheinen, aber sie funktioniert. Wie mir eine erstaunlich große Zahl von Lese-rinnen und Lesern bestätigte, ist eine umfangreiche span-nende Geschichte entstanden, die man ungern aus der Hand legt, wenn man mit dem Lesen begonnen hat …
Wenn dem so ist, dann hat sich meine Zielvorstellung verwirklicht: Spannende Unterhaltung, Sach-Information und kritische Reflexion unserer sozialen Wirklichkeit in einer in sich geschlossenen Story zu vereinen.
Bei der Erstveröffentlichung hielt ich als Autor ein Frauen-Pseudonym für einen Frauenroman für angebracht – zumal mir der Börsenverein des Deutschen Buchhandels mitgeteilt hatte, dass 80 Prozent meiner Leserschaft Frauen sein werden. Männer lesen weniger Romane, vielmehr Fach-literatur. Allerdings war mein Pseudonym recht verräterisch: »Sandra Dornemann« – darin verbarg sich der »Mann«, aber auch der gesellschaftliche »Dorn« im Fleisch einer sich im Niedergang befindenden Bildungs- und Politiklandschaft.
Ich danke Ihnen für Ihre Lesetreue und wünsche Ihnen von Herzen alles Gute und ein inniges Verhältnis zum Buch schlechthin – denn Buch macht kluch …
Ihr
Stefan Koenig
Prolog
22. Oktober 1999
Der Herbst brach mit Stürmen und Hochwasser über das Land herein, wie es schlimmer nicht hätte kommen können – El Nino, das himmlische Kind, wütete über dem Pazifik vor Südamerikas Küste, und es streckte seine Arme bis zum fernen Europa aus. Die Unwetter tobten schon mehr als vier Tage über dem östlichen und südlichen Teil Mittel-europas. Rinnsale wurden zu reißenden Gewässern, Bäche zu gewaltigen Strömen, und Flüsse wurden zur Tiefen-strömung in einer weitgehend überfluteten Landschaft.
Vereinzelt flogen noch Kraniche Richtung Süden.
Zwei Tage später ging der Hochwasserpegel an Rhein, Mosel und Main zurück. Die Ufer wurden wieder sichtbar. Was blieb, waren Schlamm und Müll, entwurzelte Sträucher und Bäume, verwüstete Häuser und Verletzte.
Aus den Rettungsmaßnahmen von Technischem Hilfs-werk, Rotem Kreuz und Feuerwehr wurden Aufräumarbei-ten. Den Aufräumarbeiten schlossen sich Sanierungs- und Umbaumaßnahmen an. Die Versicherungen, sofern sie zahlten, wurden in diesen Tagen zur Investitionskurbel der Wirtschaft. Die Besitzer von Grundstücken, Miethäusern und Eigenheimen gingen daran, mit eigenen Händen oder mit Hilfe der örtlichen Bauwirtschaft die Schäden zu beheben.
Normalerweise stand Peter Kaußen freitags eine Stunde früher auf, morgens gegen vier Uhr, damit er nachmittags um drei zu Hause sein konnte – wenn nicht chefbedingte Überstunden dazwischen kommen würden. Er arbeitete als Vorarbeiter einer Baukolonne, und sein Chef war, was Überstunden anbetraf, ein Ekel.
Heute gibt‘s keinen Verhandlungsspielraum, dachte der Vor-arbeiter. Diesmal würde ihn niemand beschwätzen, noch eine Stunde länger auf der Baustelle zu bleiben. Heute durfte der Chef einfach keine Mehrarbeit anordnen. Heute würde Peter seinen Schäferhund mitnehmen, denn Punkt fünfzehn Uhr dreißig begann das Trainingsprogramm beim Rettungs-verein, und dies war der einzige Tag im Monat, an dem nichts, aber auch gar nichts dazwischen kommen durfte.
»Ohne Regelmäßigkeit kannst Du die Hundedressur vergessen«, hatte der Trainer der Schäferhund-Vereinigung gesagt. »Konsequenz und Beständigkeit sind die Schlüssel-worte einer guten Hundeschule«, meinte er. Peter liebte seinen Hund. Harro sollte einmal ein Rettungshund werden.
Es war bereits einige Minuten nach fünf Uhr.
Als er Harro rief und mit ihm aus dem Haus ging, hatte er im Radio die erfreuliche Nachricht vom zurückgehenden Hochwasser und von ausbleibenden Niederschlägen gehört. Um diese Uhrzeit waren die meisten Frankfurter noch im Bett. Peter und sein Schäferhund kamen schon nach fünf-undzwanzig Minuten auf der Baustelle nahe des Gymna-siums an. Der Vorarbeiter war immer der erste.
Es war ein Drei-Parteien-Haus, Erdgeschoss, erster und zweiter Stock. Aber die Baustelle lag hinter dem Haus, oder besser gesagt im Tiefgeschoss, denn die Bauherrin ließ ein Souterrain anbauen. Sie hatte dieses Stadtanwesen in bevor-zugter Lage vor kurzem gekauft. Der ehemalige Keller sollte zum Garten hin geöffnet, erweitert und in helle Wohnräume umgewandelt werden.
Nach der Überschwemmung im Garten hatten die Was-sermassen den Keller überflutet; seit vier Tagen liefen unun-terbrochen die Pumpen.
»Wenn jetzt die Baumaschinen nicht verrückt spielen, sind wir um zwei Uhr hier weg«, sagte Peter zu seinem Liebling. Er schloss das weitausladende Hoftor auf. Der Hund schoss an ihm vorbei Richtung Garten.
»Harro, bei Fuß«, befahl er.
Doch der Hund war weg.
An der Hausseite, wo er gestern die Garage abgerissen hatte, standen die Container, und dahinter stand sein Bob-cat, ein Minibagger, der es Peter erlauben würde, blitzschnell die Aufräumarbeiten vor dem Eingangsbereich des Kellers zu erledigen. Matsch und Bauschutt waren zu verladen, und zum Leidwesen der neuen Hausherrin mussten auch einige Beeren- und Ziersträucher beseitigt werden. Als erstes müsste er mit Harro Gassi gehen; am besten im nahen Park, wo sich sein Liebling austoben konnte. Dann würde Harro bis zum Arbeitsende seines Herrchens auf der braunen Wolldecke liegen und warten. Als Peter nach hinten in den Garten kam, war der Hund nirgendwo zu sehen.
»Harro?«, rief er halblaut, denn er wollte die Anwohner nicht vorzeitig wecken. Wenn in einer halben Stunde die Maschinen liefen, wäre es sowieso vorbei mit dem Schlaf. »Komm, Harro. Wir wollen weg, Gassi.«
Nichts rührte sich.
Der Vorarbeiter kniff die Augen zusammen und schob seine Schildmütze aus der Stirn. Doch im Dämmerlicht er-kannte er nur die herumstehenden Wannen, Bottiche, abge-deckten Zementsäcke und allerlei unaufgeräumtes Werk-zeug. Im offenen Kellerbereich, wo die Vorderfront gestern geöffnet und ausgebaggert worden war, vernahm er weit hinten, verdeckt von einem ausgehobenen Lehmberg, ein scharrendes Geräusch.
»Harro, bei Fuß, aber hopp!«, rief er.
Der einjährige Schäferhund hörte eigentlich aufs Wort. Als Rettungshund musste er zwar noch viel dazulernen, jedoch gehorchte er jedem Befehl seines Herrchens – zumal er stets mit liebevollem Streicheln oder gar mit einem kleinen Leckerli belohnt wurde. Diesmal dauerte es eine Zeit, bis er sich durch ein kurzes, erregtes Knurren bemerk-bar machte. Es kam von der hintersten Kellerfront, wo heute mit den Aushebearbeiten weitergemacht werden musste.
Der Vorarbeiter zog die dunkelbraunen Lederschuhe aus und tauschte sie gegen seine Gummistiefel. Eigentlich wollte er sich erst nach dem Spaziergang für die Baustelle umziehen, doch das Winseln und nervöse Knurren Harros erforderte die Durchquerung der vom Hochwasser durch-weichten Erde vor dem Kellereingang.
»Hierher, Harro!«, befahl Peter seinem Hund, denn es war zu befürchten, dass er eine Katze oder ein anderes Kleintier jagte.
Peter ging um den Lehmhügel herum, jetzt war der Hund vor einer Betonplatte zu sehen. Die Platte hatte er gestern mit einer Raupenseite des Minibaggers befahren, und sie war etwas angekippt liegengeblieben. Heute würde er den ein auf zwei Meter messenden Betonklotz, der seiner Schätzung nach mindestens zwanzig Zentimeter dick war, mit dem Bohrhammer zerlegen und die Teile mit dem Bobcat abfahren.
Ungefähr sechs Meter vor sich, im Halbdunkel, sah er Harros aufgeregt wedelnden Schwanz zwischen Lehm-matsch und dem Betonbrocken. Der Schäferhund sah zu ihm herüber, bellte nun laut und grub mit den Vorderpfoten am Rande der mächtigen Platte. Er kam nicht bei Fuß. Peter wurde ärgerlich.
»Bei Fuß, Harro, komm bei Fuß!«, schnauzte er ihn jetzt an. Es irritierte ihn, dass sein Hund nicht hören wollte. Das war unüblich, völlig außergewöhnlich. Eine gute Hunde-schule, Drill und Gehorsam waren wohl bitter nötig; mit Hunden wird nicht diskutiert.
Peter nahm die Hundeleine und machte noch ein paar Schritte auf den Betonklotz zu. Harro scharrte wie besessen seitlich eines abgesplitterten Brockens; ein Versteck für ein Kleintier war hier jedenfalls nicht. Die Luft schmeckte lehmig und feucht, fast roch es nach …
Peters Schritte stockten. Entsetzt erblickte er eine asch-graue, zementverschmierte Hand, die aus dem Betonbro-cken herausragte, als wolle sie nach dem Hund greifen. Harro leckte die Hand ab.
»Lass das, Harro!«, rief er und hielt Abstand von der schrecklichen Hand. Beim Gedanken, dass an ihr noch ein ganzer Mensch hing, eingegossen in Beton, wurde ihm flau im Magen, und dass er sich nicht übergab, verdankte er allein dem Umstand, noch nicht gefrühstückt zu haben.
Plötzlich spürte er die Kälte und Nässe des ungewöhn-lichen Herbstes. Beides kroch ihm in Sekundenschnelle unter die Jacke und schien ihn zu lähmen.
Dann leinte er den Schäferhund an und band die Leine am Gestell der Betonmischmaschine fest. »Harro, sitz!«, befahl er, »Herrchen geht Hilfe holen!«
Er rannte, so schnell es ging, zur Vorderseite des Ge-bäudes, da der Kellertreppenaufgang wegen der Umbau-arbeiten mit Brettern vernagelt war. Er wusste, dass die Hausbewohner noch schliefen, aber er hoffte, dass sie ihm auf sein Klingeln rasch öffnen würden.
»Warum so stürmisch, junger Mann?«, fuhr ihn die Be-wohnerin des ersten Stocks an. »Was ist los mit Ihnen?«
»Oh Gott«, stammelte Peter, »eine Leiche, im Keller ist eine Leiche!«
Die Dame in ihrem lila Morgenrock schrie erschrocken auf. Sie kannte den Vorarbeiter, dem sie gestern noch einen warmen Tee in den vermatschten Keller gebracht hatte.
»Kommen Sie rein, ich rufe die Rettungswache.«
»Da ist nichts mehr zu retten, rufen Sie die Polizei«, keuchte der Mann. Er griff sich an den Hals und räusperte sich. Ihm war schlecht. »Darf ich rauchen?«
»Wer liegt da unten?«, fragte sie. »Jemand aus dem Haus?«
»Man sieht nur eine Hand. Der Rest ist in Beton gegos-sen.«
Entsetzt sah sie ihn an. Peter unterdrückte die aufstei-gende Übelkeit. Endlich rief sie die Polizei. Er zündete sich eine Zigarette an. Sie zog sich an, und sie gingen hinunter, wo Harro winselte. Sie warteten noch fast fünfzehn Minu-ten, bis es vorne an der Haustür Sturm klingelte und ein Kriminalbeamter in Begleitung zweier kräftiger Polizisten erschien.
»Kriminalinspektor Momberg. Guten Morgen, wo liegt die Leiche?«
Peter deutete zu dem Betonklotz in der düsteren Keller-ecke. Noch immer ragte die Hand herausfordernd aus dem Brocken. Der Inspektor ging dicht heran und leuchtete sie mit einer Taschenlampe ab, während er zu den beiden Poli-zisten sagte: »Tatsächlich, nichts mehr zu machen. Infor-mieren Sie die Spurensicherung.«
In diesem Moment erfasste der Taschenlampenstrahl den golden funkelnden Ring am Finger der grauen, beton-verschmierten Hand. Doch der Beamte ließ den Ring unbe-rührt. Erst mussten die Spurenexperten ihr Werk verrichten. Dann entdeckte der Inspektor hinter der fahlen Hand ein großformatiges, flaches Buch auf dem Betongeröll.
Auf dem Aufkleber stand: Klassenbuch der G 10a.
Teil I
Frühling 1999
Übrigens bin ich der Ansicht,
dass Karthago zerstört werden muss
Cato der Ältere
Erstes Kapitel
1
Hinter Alice rastete das erste Schleusentor automatisch in seine stählerne Verankerung. Künstliches Licht durchflutete grell den Innenraum und blendete sie. Dann öffnete sich das zweite Tor. Sie trat hinaus und sah den wolkenlosen Him-mel.
Endlich frei.
Es war der 21. April, neun Uhr fünfzehn. Sechs Jahre hatte sie auf diesen Moment gewartet, ihn herbeigesehnt, herbeigeträumt, hatte ausgerechnet, zu welcher Jahreszeit es geschehen werde. Nun war der lange Winter verstrichen, der Frühling war nach Mitteleuropa gekommen. In der Main-Metropole blühten die Tulpen in Kübeln vor den Marmor-fassaden der Banken. Vor vier Wochen hatte sie der zustän-dige Psychologe in ihrer Zweierzelle besucht und ihr freudig mitgeteilt, dass die Entlassung kurz bevorstand. Alice hatte sich bei ihm nach der Möglichkeit erkundigt, wie sie zu einer neuen Identität kommen könne.
»Was bringt Ihnen das?« Er sah sie zweifelnd an.
»Ich möchte bloß Gewissheit haben, dass ich jederzeit ein neues Leben beginnen kann. Ohne Vorbehalte und ohne ständige Erklärung meiner Vorgeschichte!« hatte sie selbst-bewusst geantwortet. Sie kannten sich seit zwei Jahren. Er wusste alles über sie. Ihr war klar, dass er zum Thema Iden-tität jetzt groß ausholen würde. Deshalb hatte sie ihre Jacke angezogen und nach dem Aufseher geläutet.
»Ich brauche nur ein Stichwort, einen winzigen prak-tischen Tip«, sagte Alice, bevor sie in ihre Zelle geführt wurde.
»Standesamt«, rief er ihr nach. Sie dankte ihm mit einem kaum wahrnehmbaren Kopfnicken. Wahrscheinlich würde sie ihn nicht mehr wiedersehen. Sein Job war beendet.
Der Wachtmeister hatte sie zurück in ihre Zelle geführt. Wenn Alice in den folgenden Tagen über ihre Zukunft nachdachte, wurde ihr immer mehr klar, wie sehr sie das Vergangene erst einmal vergessen müsste. Es sollte ein vollkommener Neuanfang sein. Und dann, irgendwann in ferner Zukunft, gäbe es jene allumfassende Gerechtigkeit – den Ausgleich für das widerfahrene Unrecht. Darauf würde sie behutsam hinarbeiten.
Das letzte graue Tor schloss sich hinter ihr mit einer geräuschlosen Gleichförmigkeit. Sie schaute nicht mehr zurück, sondern sog die Frühlingseindrücke in sich auf. Die Ahornbäume entlang der S-Bahngleise und die hohen Pappeln, die Alice Schneider zuletzt nackt und in tristem Braun gesehen hatte, begannen ihre hellgrünen Blattkleider anzuziehen. Zwischen dem Schotter neben den Gleisen blühte in kräftigem Gelb der Löwenzahn, und unweit der Häuserreihen hatte sich das winterliche Beige der Parkan-lagen in ein üppiges Grün verwandelt.
Die etwas zu große Reisetasche, die ihre ganze Habe enthielt, hing über ihrer linken Schulter. In ihrer rechten Hand befand sich der Fahrplan; ihre Ankunft hatte sie für den Nachmittag geplant. Zuvor musste sie die Sache auf dem Standesamt regeln. Ob ihr Plan aufginge? Eine glän-zende Strähne ihres schulterlangen Haares verhedderte sich unter dem Trageriemen der Reisetasche. Schönheit hat ihren Preis, und Alice war als junge Frau eine bezaubernde Schönheit gewesen. Jetzt war sie zu einer ausdrucksvollen Frau gereift, mit den Spuren widersprüchlicher Lebens-erfahrung, und achtunddreißig Jahre alt.
»Sie sehen aus wie Anfang Dreißig«, hatte ihr der Anstaltspsychologe während einer dieser interpretations-strotzenden Sitzungen geschmeichelt, die ihr das Leben hinter Gittern wenigstens mit einem Schuss Abwechslung versüßten. »Und Sie sind intelligent wie Einstein, Einsteins Blondine.« Er wusste, dass Physik und Magie ihre Hobbies waren. Er hatte laut, aber nicht unangenehm gelacht und seinen Kopf mit den langen, zu einem Pferdeschwanz gebundenen Haaren schelmisch zurückgeworfen. Einsteins Blondine!
Ihr naturblondes Haar war schuld daran, dass ihr die einschlägigen Witze bestens bekannt waren. Alice war stets schlagfertig genug, die Pointen gegen ihre Nutzer zu ver-wenden, und was Einstein betraf, so hatte sie sich die Literatur in der Anstaltsbücherei besorgt. Schließlich be-wegt das Thema Raum und Zeit alle, die etwas länger einsitzen.
Die düstere Zeit in der Vollzugsanstalt hatte ihr starkes Selbstbewusstsein nicht brechen können. Auf ihre äußer-liche Erscheinung legte sie Wert, und ihr auffällig schönes Haar, die blauen Augen und die kecken Grübchen auf beiden Seiten ihrer vollen Lippen bildeten ein harmoni-sches Ganzes.
Und doch hatte sich über sie der trübe Dunst von sechs Jahren Haft gelegt. Das Haar schimmerte nicht mehr ganz so glänzend, die Augen leuchteten bei weitem nicht mehr so wie damals, doch genug, um zu zeigen, wie ungebrochen sie die Zeit überstanden hatte.
»Deine Willensstärke und dein Selbstbewusstsein gren-zen an Intoleranz«, waren die letzten Worte ihres Mannes, als sie sich während des Strafvollzugs scheiden ließen. Aber es war nicht der wirkliche Scheidungsgrund für ihn gewesen.
Warum nur hatte Alice noch nicht einmal ihn über-zeugen können? Die öffentliche Meinung stand gegen mich; es war wie ein Hexenprozess. Alice schüttelte sich, wenn sie daran denken musste.
Gewiss, sie war eine Frau ohne Komplexe, außeror-dentlich wissbegierig, von Natur aus neugierig, wie sie wäh-rend des Prozesses einmal gesagt hatte, und doch lag ihr die Welt der bloßen Theorien fern.
»Wähle den Lehrberuf«, hatte ihr Vater gesagt, der selbst Lehrer war.
Aber sie begann nach dem Abitur eine Ausbildung als Balletttänzerin, brach sie ab und begann eine Schauspiel-ausbildung, die sie kurz vor der Geburt ihres Sohnes ab-schließen konnte.
»Vergeude keine Zeit mit Männern, die kriegst du spä-ter noch allemal«, hatte ihre Mutter ihr eingeschärft. »Denk an deine Karriere, die machst du nur in jungen Jahren.«
Ja, räumte Alice ein, daran würde sie denken.
»Und möge der Herr im Himmel verhüten, dass du vor deinem dreißigsten schwanger wirst«, hatte ihre Mutter ihr eingebleut.
Aber dann hatte Alice Karsten kennen gelernt.
Es ging schneller, als sie je gedacht hatte; sie war un-sterblich verliebt, und ihr erstes Kind war da. Schauspiel-aufträge am örtlichen Theater konnte sie nur noch spora-disch annehmen. Doch ihr schauspielerisches Talent und ihre Sportlichkeit vernachlässigte sie nie.
Fürs Ballett war sie zu groß gewesen. Sie hatte ihr Traumgewicht von achtundfünfzig Kilo bei einer Größe von ein Meter zweiundsiebzig die letzten zehn Jahre gehalten, trug hohe Pumps und war ein Blickfang für Männer, was sie genoss. Sie faszinierte gerne ihre Umwelt. Und in dem Moment, als sich das Gefängnistor hinter ihr schloss, wäre sie am liebsten als verzauberter Vogel weit übers Land hinweggeflogen, um bald ein neues Nest zu bauen.
Aber zuvor war noch etwas zu regeln.
2
Bevor sie mit dem Zug zu dem weit abgelegenen Residenz-städtchen aufs Land fuhr, betrat sie das Verwaltungs-gebäude, in dem das Standesamt untergebracht war. Es war im Stil der fünfziger Jahre gebaut, hatte weiß verputzte Wände, die die endlosen Gänge links und rechts begleiteten, unterbrochen von grau angestrichenen Türen, die mit Schildern und Nummern versehen waren.
Alice betrat das Büro des Standesamtes und legte ihren Personalausweis auf den brusthohen Besuchertresen, der den Beamten vom Besucher trennte. Ein Mann mit Stirnglatze, grau-braun kariertem Hemd und sandfarbener Krawatte trat an den Tresen heran.
»Sie wollen ihren Personalausweis verlängern?«, fragte er mit dezentem Blick auf ihre Oberweite, die sich unter ihrer dunkelblauen Jacke abzeichnete.
»Ich heiße Alice Schneider und möchte meinen Namen ändern«, sagte sie mit einem bezaubernden Lächeln.
»Wie das?«, wollte der Beamte wissen. »Sie haben doch einen schönen Namen, der hübscher nicht passen könnte«, lächelte er zurück.
Und dann las er ihren Namen noch einmal, und sein Gesicht wurde steinern.
Seit er auf dem Standesamt arbeitete, hatte er es mit Namen und Personendaten zu tun, und sein Gedächtnis übte sich von Fall zu Fall. Am Abend, wenn er seine Akten aus dem Kurzzeitgedächtnis gelöscht hatte, trank er ein Glas Wein und sah sich die Nachrichten an. Was er an jenem Abend vor fast acht Jahren mitbekam, war Gesprächsthema des ganzen Landes geworden.
Er erinnerte sich jetzt daran, als er sie und ihren aus-geschriebenen Namen sah. Er wusste, dass auch ihre Akte im benachbarten Amtszimmer seines Kollegen stand. Schließlich war das Einwohnermeldeamt zuständig für die Frauen und Männer, deren gewöhnlicher Aufenthalt und deren zentraler Lebensmittelpunkt, wie es in der juristischen Amtssprache hieß, in seinem Bezirk lagen. Und in seinem Bezirk lag eine der berüchtigsten Vollzugsanstalten im Umkreis von zweihundert Kilometern.
»Sie müssen einen besonderen Anlass vortragen kön-nen. So schreibt es das Gesetz vor. Stellen Sie sich vor, jeder wollte seinen Namen ändern lassen.« Er ging an die Schrankwand, in denen nach Jahrgängen geordnet die Register in Hängevorrichtungen hingen, als würden sie geräuchert. Einem Seitenregal entnahm er schließlich einen Ordner und blätterte darin.
»Ich brauche zunächst Ihre Personenstandsangaben«, sagte er. »Also ganz von vorne: Name, Geburtsdatum. Wo wohnten Sie zum Stichtag Ende letzten Jahres?«
Sie deutete mit ihrem Zeigefinger auf den Ausweis. »Mein Name ist Alice Schneider, geboren am 7. November 1960. Ich wohnte in der Vollzugsanstalt Frankfurt-Preun-gesheim.«
Sie trägt keine Ringe. »Ich kann Ihnen nach gültigem Namensrecht keinen neuen Namen bewilligen, es tut mir sehr leid«, meinte er mit einem zweideutigen Bedauern.
»Was spricht gerade in meinem Fall dagegen, dass ich mir ein neues Leben aufbaue? Ich habe meine Strafe ver-büßt.« Sie beobachtete ihn genau.
Ob er sich noch an meinen Fall erinnern kann? Würde sie von wildfremden Menschen anhand ihres Namens wieder-erkannt werden? Ihre Haare hatte sie früher kurz getragen. Sie hatte sie immer in den verschiedensten Farben gefärbt. Ihr Naturblond trug sie erst seit ihrem Vollzugsleben.
Sie ist eine entschlossene Person, dachte er. Sie sieht mehr nach einem erfolgreichen Model, als nach einer langjährigen Knastschwester aus, was sie tatsächlich ist.
Als sie hereinkam, hatte er sofort ihre langen schlanken Beine wahrgenommen, die sie mit einem kurzen Kostüm zur Geltung brachte, ihre intelligenten blauen Augen, die ihn bis zum Aktenschrank und zurückverfolgten. Sie würde nicht so leicht aufgeben. Aber für ihn war es nur ein Spiel. Er telefonierte kurz mit dem Kollegen von nebenan, vom Einwohnermeldewesen. Kurz danach wurde eine Akte gebracht.
»Nein, es tut mir wirklich sehr leid, aber Paragraph 14 der Verordnung über die Namengebung ist eindeutig.«
»Sie haben wirklich keinen Ermessensspielraum?« Alice lehnte sich etwas über den Tresen. »Ich könnte mir vor-stellen, dass Sie meinen Fall kennen.«
»Sind Sie verheiratet, haben Sie Kinder?« fragte er und sah ihr nur kurz ins Gesicht.
»Geschieden, zwei Kinder«, antwortete sie knapp.
»Dann könnten Sie ihren Geburtsnamen führen, Alice Velten, nicht wahr?«, wandte der Standesbeamte ein.
»Kann ich nicht.« Eigentlich erwartete sie jetzt eine Gegenfrage.
Er blätterte bedeutungsvoll in der Akte und sah sie dann herausfordernd an.
»Die Auflagen des Gerichts müssen Sie weiterhin erfüllen, das ist Ihnen doch klar. Ein neues Namensetikett wird daran nichts ändern können«, ließ er fast süffisant über seine schmalen Lippen kommen.
Alice stieg selten das Blut ins Gesicht, doch jetzt wurde sie rot vor Zorn.
»Ich habe meine Kinder seit sieben Jahren nicht mehr gesehen und mich an die Kontaktsperre des Gerichts gehalten. Wissen Sie überhaupt, was das für eine Mutter bedeutet?« Sie schaute ihn wutentbrannt an. »Was haben meine Kinder mit meinem Wunsch zu tun, den Namen zu ändern?« stieß sie hervor.
»Ich wollte Sie nicht verletzen, aber es ist meine Pflicht, Sie an die Auflagen zu erinnern«, murmelte er.
Sie zuckte mit den Schultern. »Mein Mädchenname ging damals ebenso durch die Medien wie mein Ehename. Ohne einen neuen Namen habe ich keine Chance. Und es gibt verdammt wichtige Gründe, mir einen anderen Namen zu geben.« Alice atmete tief durch und seufzte.
Der Karierte holte einen roten Band aus dem Regal, blätterte und las ihr vor. »Ob die für die Namensänderung vorgebrachten Gründe als wichtig im Sinne des Paragra-phen 3 Namensänderungsgesetz anzusehen sind, hängt im Einzelfall von objektiven Merkmalen ab...«
»Welche Merkmale?« unterbrach sie ihn.
»Sie können sich wahrscheinlich denken, dass ich Ihren Fall aus verwaltungsrechtlicher Sicht noch einmal neu über-denken müsste. Denn grundsätzlich hat jeder Bürger den ihm überkommenen Namen zu führen, so dass eine Änderung eine Ausnahme zu bilden hat«, erklärte er ihr und richtete sich auf, ohne einen Zentimeter größer zu wirken.
»Aber genau darum geht es«, bemerkte sie, »dass mein Problem außergewöhnlich ist und ich eine neue Chance brauche.« Voller Grauen dachte sie daran, dass es diesem Trottel einfallen könnte, ihre ganzen Angelegenheiten von früher nur wegen einer Namensänderung aufzurollen. Sie wollte nichts aufrühren. Nicht jetzt.
»Ich muss mich an das Gesetz halten, und das Gesetz sieht nicht vor, Ihre Chancen zu beurteilen.«
»Aber ich habe doch einen wichtigen Grund, und ein Gesetz muss doch einen wichtigen Grund vorsehen«, pro-testierte sie.
»Für das Gesetz ist ein wichtiger Grund ein unbestimm-ter Rechtsbegriff«, triumphierte er auf. An seiner rechten Hand trug er einen dicken goldenen Ehering.
»Zeigen Sie mir das Gesetz«, verlangte Alice.
Der Standesbeamte sah sich hilfesuchend in dem großen kahlen Raum um. »Ich habe keine Zeit, Ihnen Gesetzestexte zu erklären. Dafür gibt es Rechtsberater.«
Sie griff über den Tresen und riss ihm den roten Band aus der Hand, den sie sogleich dicht an sich nahm. Schnell hatten ihre Augen den Absatz überflogen. Sie las die entscheidende Passage laut vor. »Ein wichtiger Grund liegt dann vor, wenn das Interesse des Namensträgers an der Namensänderung nach allgemeiner Verkehrsauffassung schutzwürdig ist …«
»Ist es das?« unterbrach er sie.
»Hören Sie doch, wie es hier heißt«, fuhr Alice fort. »Wenn seine Gründe, an Stelle seines Namens künftig einen anderen zu führen, so wesentlich sind, dass die Belange der Allgemeinheit zurücktreten müssen …«
Er fiel ihr schon wieder ins Wort. »Wo werden Sie zukünftig leben?«
»Hier jedenfalls nicht! Ich werde nach Australien auswandern, zu meiner Schwester.«
Seine Augen weiteten sich unmerklich, und es wurde mehr als ein Spiel für ihn. Zum Schein verhandelte er noch über dreißig Minuten mit ihr. Dann bat er sie in das Besprechungszimmer. Es war aus ihrer Sicht der reine Zufall, der das Ganze in ihrem Sinne entschied. Als ihr der rote Gesetzesband aus den Händen rutschte und auf den Boden fiel, bückte sie sich und achtzehn Tausendmark-scheine fielen aus ihrer Jackentasche, wobei ein Schein unter seinem Stuhl liegen blieb.
Sechs Jahre hatte sie mit Knastarbeit Pfennig für Pfen-nig für ihren Neuanfang zusammengespart, etwas über zehntausend Mark. Die übrigen achttausend Mark waren ihr nach der Scheidung geblieben.
Sie verließ das Standesamt gegen Mittag mit siebzehn-tausend Mark und dem Versprechen des karierten Herrn, sie könne am Nachmittag ihre neue Identität in Form einer vorläufigen Bescheinigung abholen.
»Damit können Sie sich beim Einwohnermeldeamt einen neuen Pass und Personalausweis ausstellen lassen. Aber kalkulieren Sie eine Wartezeit von sechs Wochen ein.« Allein die Umstände, den neuen Namen zu bestimmen, sollte Alice dem Standesbeamten überlassen.
Um fünfzehn Uhr betrat sie noch einmal sein Büro, nachdem sie diesmal das Namensschild an seiner Tür beachtet hatte.
»Hier bin ich, Herr Bayer. Hoffentlich nicht zu früh«, sagte sie mit erwartungsvollem Blick.
»Alles paletti, unser Amt schläft doch nicht. Hier ist Ihr Dokument. Ich hoffe, der Name gefällt Ihnen.«
Alice Schneider nahm die Bescheinigung entgegen und lächelte zufrieden, als sie ihren neuen Vornamen las – Nina. Sie nickte ihm zu.
»Tja, dann auf Wiedersehen, Frau Nowak, und machen Sie was draus.« Er strich sich bedächtig über den Kopf.
Sie bedankte sich, schüttelte ihm zum Abschied die Hand und dachte: Das Schwere ist geschafft, nun zum Schwierig-sten. Beim Hinausgehen las sie auf dem grauen, neonlicht-beleuchteten Gang noch einmal – Nina Nowak, geboren am 7. November 1960. Kompliment, der Name ist ihm gelungen.
Kaum hatte sie die Tür geschlossen, da fuhr sich der Standesbeamte erleichtert durchs schüttere Haar. Sein Plan war genial.
Jetzt beginnt mein Teil der Arbeit, jetzt beginnt ein Doppelleben. Der biedere Beamte lächelte in sich hinein, räumte pünktlich wie immer seinen Arbeitsplatz auf, kaufte noch einen Vierundsiebzig-Mark-Strauß Blumen für seine Lebens-gefährtin und schrieb auf das Kärtchen, das ihm die Blu-menverkäuferin reichte, mit schwungvoller Schrift: Für meine Nina.
3
Nina Nowak erreichte das Residenzstädtchen erst mit dem Spätzug. In so ein abgelegenes Nest fuhr die Bahn nur im Drei-Stunden-Takt und das nur werktags. Es war Donnerstag, und die Frühlingsstimmung hatte sie während der Fahrt begleitet. Natürlich wollte sie nicht nach Australien, schließlich hatte sie weder eine Schwester noch Lust und Laune auf ein fremdes Land. Zweiundsiebzig Monate hinter Gittern waren Fremde genug.
Was geht es schon den Standesbeamten an, wo ich mich zukünftig aufhalte? Sie summte ein Frühlingslied vor sich hin.
Das beruhigende Dahingleiten des Zuges, das inein-ander fließende Hellgrün der Wiesen mit dem Dunkelgrün der Wälder und das mit weißen Wölkchen durchsetzte Him-melblau, ließ sie den unangenehmen Behördengang und das Schmiergeld vergessen.
Das Gefühl eines Neuanfangs schien ihr Flügel zu ver-leihen, als sie nach dreistündiger Fahrt gegen neunzehn Uhr durch das sandsteinfarbene Bahnhofsportal von Lomberg ging und mit schwebenden Schritten den Weg zur historischen Altstadt nahm. Die neue Wohnung hatte ihr der Anstaltspfarrer besorgt. Er hatte ihr geraten, sich eine Legende zurecht zu legen. Die Wahrheit würde sie zurück-werfen. Hauptsächlich solle sie sich sofort eine Arbeit suchen und jeder Frage nach ihrem bisherigen Job auswei-chen. Oder eben eine Legende stricken, die für die Zukunft erweiterbar sei.
»Sie wohnen direkt am Marktplatz. Es ist ein gemütliches Fleckchen Erde«, hatte er ihr versprochen. Vor Jahren war er einmal Pfarrer in Lombergs protestantischer Gemeinde gewesen.
Nina erreichte den Marktplatz nach fünf Minuten. Sie schaute sich die antiken braunen Fachwerkfassaden mit ihren goldenen und rotblauen Inschriften minutenlang an. Der orangerote Abendhimmel warf sein Farbenspektrum auf die Fensterscheiben der kleinen Ladengeschäfte, die rund um die Linde des Marktplatzes wie auf einer Spielzeug-anlage für Modelleisenbahnen angelegt waren.
Alice alias Nina bereitete sich auf ihre Vorstellung bei den Vermietern vor. Innerlich hatte sie schon lange mit ihrer Vergangenheit gebrochen, was nicht bedeutete, dass sie sich nicht ihrer Herkunft bewusst war. Doch es schien ihr notwendig, sich noch einmal über ihren leicht geänderten Lebenslauf Klarheit zu verschaffen. Bis auf den Namen konnte alles bleiben, wie es war.
Was jedoch sollte sie sagen, wenn man sie nach ihrer bisherigen Arbeit fragte? Knasti, Mutter, Schauspielerin – es war zwar die Wahrheit, aber sie war völlig unbrauchbar; und einmal mehr überließ sie ihrer spontanen Intuition die Führung.
Marktplatz Nr. 3 war eine Modeboutique. Dicht ge-drängt an das benachbarte, einem modernisierten Fach-werk nachempfundenen, hellbraunen Versicherungsgebäu-de führte ein schmaler Pfad zum Hintereingang.
Es gab nur ein Namensschild – Lamenti. Alice klingelte. Nach einer Weile öffnete ihr eine hagere Nähnadel von Mann.
»Ich bin Ihre neue Mieterin, Nina Nowak, guten Abend«, sagte sie.
»Kenne nicht, nicht da«, antwortete ihr der Mann mit spanischem Akzent und wollte die Tür schließen.
Er hielt einen Besen in der Hand.
»Ist Ihre Frau da?« fragte sie.
»Wolle zu meiner Frau, kocht oben.« Er führte sie eine Treppe hinauf. Nina stellte sich in der nach Thunfisch riechenden Küche ihrer Vermieterin vor.
Frau Lamenti sah ihre zukünftige Mieterin von oben bis unten an. »Schön, Sie kennen zu lernen. Sie sehen phantas-tisch aus. Ich glaube, Sie werden hier nicht nur einziehen, sondern auch Model für meine Boutique.«
Alice lachte. »Ich dachte mir schon, dass Ihnen die Boutique gehört.«
»Was kann ich zu trinken anbieten?« fragte Elvira Lamenti. Sie war eine Frau Mitte Vierzig, die durch modi-sches Geschick jünger aussah. Sie trug ihre rotblond gefärb-ten Haare offen und fast so schulterlang wie Nina. Ihre Kleidung hatte sie der Boutique entnommen; heute trug sie schwarz und war müde.
»Ein Glas Wasser vielleicht«, antwortete Nina.
»Essen Sie eine Kleinigkeit mit? Es gibt Pasta mit Thun-fischsauce«, lud Elvira ihre zukünftige Mieterin ein.
»Gerne, ich habe seit heute Mittag nichts gegessen.« Tatsächlich hatte sie seit dem grässlichen Frühstück in der Kantine der Vollzugsanstalt nichts mehr gegessen.
»Deck mal den Tisch, Francico, Du hast ja gehört, wir essen zu dritt«, sagte Elvira beiläufig zu ihrem Mann.
Francico stellte den Besen in die Ecke, um das Ess-geschirr und eine Flasche spanischen Rotweins auf den Holztisch zu stellen. »Schöne Mieterin«, murmelte er und betatschte sie mit seinen Blicken.
Obwohl Nina einen Bärenhunger hatte, konnte sie doch nur eine kleine Portion hinunterbringen. Francico starrte sie unentwegt an und machte ihr pausenlos Komplimente, nachdem er aufgetaut war.
Elvira zwinkerte ihr hin und wieder zu, wenn seine Bemerkungen zu südländisch wurden, und sie versuchte Nina klarzumachen, dass ihr Mann nur so tue, als sei er ein Schürzenjäger. Erstaunlicherweise wurde Elvira Lamenti mit jedem Glas Rotwein wacher, während Alice alias Nina langsam zum Schluss kommen wollte.
Unvermittelt erkundigte sich die Vermieterin nach Ninas Arbeit. »Bevor wir den Mietvertrag unterschreiben, interessiert uns, was Sie arbeiten. Oder arbeiten Sie gar nicht?«
»Ich würde eigentlich gerne erst einmal mein Apparte-ment kennen lernen.«
»Wir dachte, Pfarrer hat …«, murmelte Francico, aber Elvira stand bereits auf und ging zur Tür.
»Nehmen wir die Weingläser mit hoch«, sagte sie. »Hat der Pfarrer Ihnen das Appartement nicht beschrieben?«
»Doch, er hat mir sogar den Grundriss aufgemalt, und ich bin gewiss, dass es mir gefällt.« Nina ging hinter Elvira her.
»Und Ihre Arbeit?«
»Jeder muss arbeiten«, lachte Nina unverfänglich. »Ich bin ein kleines bisschen vermögend.«
»Oh, Sie haben keine Ausbildung?«
»Ich bin für einige Zeit freigestellt.«
»In welcher Branche?«, fragte die Vermieterin, während sie die Treppe zum Appartement hochstiegen.
Nina strich über die Falten ihres Rockes. »Die Branche ist eine Behörde.«
»Iiih, Sie sind Beamtin«, sagte Francico, von dem sie inzwischen wusste, dass er der einzige Schuster des Ortes war.
»Haben Sie was gegen Beamte?«, fragte sie schnippisch und lenkte damit von der heiklen Frage ab.
»Sind alles faule Schweine und fressen mein Geld«, raunzte Francico. Er krempelte seine Ärmel die hageren Arme hoch, als wolle er sofort mit den Beamten aufräumen.
»Na, dann Prost«, lenkte Elvira ein, als sie die obere Diele betraten und trank einen kräftigen Schluck. Dann begann sie Nina indiskreterweise nach ihrem Alter zu befragen und ob sie häufig Männerbesuch habe. Es gehe ihr nur um die Bettwäsche, ob sie alle Woche oder alle vierzehn Tage gewaschen werden solle. Nachdem die beiden Frauen sich lachend darauf geeinigt hatten, dass es wirklich bloß ein Mietvertrag und kein Fürsorgevertrag werden solle, traten sie endlich in das Appartement ein.
Im Parterre, mit der Schaufensterfront zum Marktplatz, war die Modeboutique, die Elvira Lamenti führte, die aber ihrem Mann gehörte. In einem Nebenraum mit Blick auf die Hauptstraße und mit separatem Eingang hatte Francico Lamenti seine kleine Schusterei. Über der Boutique wohn-ten Lamentis mit ihrem zwölfjährigen Sohn.
Im obersten Geschoss, gemütlich eingeklemmt unterm Dach, war Ninas Fünfzig-Quadratmeter-Appartement, das aus einer kleinen Küche, einem Bad, einem geräumigen Wohn- und einem etwas kleineren Schlafzimmer bestand. Die Decken wurden von Eichenbalken gehalten, die Böden waren aus robusten alten Dielen, und durch zwei kleine bogenartige Fenster hatte man einen wunderschönen Aus-blick auf den Marktplatz, und in die entgegengesetzte Richtung blickte man durch das Südfenster auf einen Bauerngarten hinter dem Haus, wie Nina trotz der Dämme-rung erkennen konnte.
»Na und, glücklich?«, flüsterte Francico.
»Gefällt es Ihnen?«, fragte seine Frau.
Nina Nowak nickte und ihre Grübchen drückten sich zufrieden in ihre leicht geröteten Wangen. Bei einer Tasse Cappuccino plauderten die beiden Damen noch eine Stunde miteinander, während Francico Lamenti in seine Schusterei ging, um noch bis spät in den Abend hinein seinem Hand-werk und Gelderwerb nachzugehen. In sechzig Minuten erfuhr Nina Nowak alles, was man über Lomberg und seine Bürger, über Kultur und Gewerbe, über Bauern und Grafen wissen musste.
Hoffentlich geht sie mir mit ihrer Geschwätzigkeit nicht auf die Nerven. Nina verabschiedete sich, und wohl ahnte sie die Gefahr, die von Geschwätz und Intrigen ausgeht.
4
Der Mann saß in seiner Ecke und schwitzte.
Kein Angstschweiß … kein Schweiß vor Anstrengung … Schweiß vor …
Er beäugte die Menschen um ihn herum. Er kannte alle seine Kollegen, und doch kamen ihm alle schrecklich fremd vor. Dann verschwamm das Bild der realen Wahrnehmung, und wie ein Schleier legte sich eine andere Wirklichkeit vor seine Augen, die Gott ihm ins Gesicht gesetzt hatte. Aber er kniff die Augen fest zusammen.
Bleib weg, zischte er sich unhörbar zu. Bleib weg, verdammt noch mal. Nicht hier, nicht jetzt!
Doch dann sah er schon wieder eine Kollegin, völlig nackt unter einer Dusche, wie der Duschschaum an ihr entlangrann, wie sie sich vor ihm niederkauerte und um Gnade bat.
Während er beide Augen geschlossen hielt, öffnete er dasjenige, das Gott in seinen Verstand gesetzt hatte, das Sehorgan, das beharrlich auch Dinge wahrnahm, die er nicht sehen wollte. Er schaute ins Dunkel, und langsam ebbten die Geräusche rund um ihn ab.
Das Gesabber und Gequassele, das schrille, aufgeregte Schnattern dieser Pädagogenhühner war verstummt. Er beschwor ein Bild von sich herauf – ein Bild von seinem wirklichen ich, dem Mann, der mit ihm im Moment kei-nerlei Ähnlichkeit hatte.
Der Schweiß tropfte ihm auf den Handrücken, und er schlug die Augen wieder auf.
5
Am nächsten Morgen beantragte Alice alias Nina im Rat-haus ihren Personalausweis und meldete ihren Wohnsitz an. Niemand fragte sie nach früher, niemand wusste Bescheid, freundlich nahm man sie auf. Kurz danach kaufte sie einen Gebrauchtwagen für viertausend Mark und hatte jetzt nur noch dreizehn Tausendmarkscheine ihres Ersparten übrig.
Am darauffolgenden Tag waren es nur noch zehn-tausend Mark. Ihr Einkauf bei ikea hatte sich gelohnt, jetzt besaß sie einen halbrunden Schreibtisch aus nordischer Fichte, zwei dazu passende Naturholzstühle, drei Hänge-lampen, eine Stehlampe, zwei afghanische Teppiche und zwei Bilder aus den Gründerjahren, die sie auf einem be-nachbarten Trödelmarkt günstig erstanden hatte. Im Schlaf-zimmer richtete sie sich ein kleines Arbeitszimmer ein, und die uralte dunkelbraune, bäuerliche Holzregalwand benutzte sie als Bücherregal. Im Wohnzimmer schuf sie eine Wohn-Schlafgelegenheit und stellte dort die neue Schlafcouch an die Längsseite der Fensterfront.
Für ihr Bewerbungsschreiben benötigte sie zumindest eine Schreibmaschine. Doch wer kaufte heutzutage noch eine Schreibmaschine? Die Investition in einen bescheide-nen Computer und einen Drucker könnte auf Dauer von Vorteil sein. Den Umgang damit hatte sie schon vor Jahren bei Karsten gelernt; in die neuen Programme würde sie sich einarbeiten können. Und schon besaß sie nur noch acht-tausendfünfhundert Mark.
Beruflich hatte sie als Schauspielerin den Anschluss verloren, einzig eine Stelle im Verkauf oder Büro konnte sie sich vorstellen. Am Wochenende kaufte sie die Tages-zeitung mit den Stellenanzeigen und bewarb sich auf einige Stellen. Für ihre Zeit im Vollzug hatte ihr der Gefängnis-seelsorger eine Bescheinigung über einen Auslandsauf-enthalt im Auftrag einer karitativen Vereinigung geschrie-ben, für die sie als Organisatorin eines Entwicklungspro-jektes tätig gewesen sein sollte.
Noch am gleichen Wochenende probierte sie ihren neuen PC aus und entwarf darauf ein Anmeldeschreiben für die Volkshochschule. Du musst was tun, bis du einen Job findest.
»Integrieren Sie sich in ihre neue Umgebung möglichst schnell«, hatte der Anstaltspsychologe gemeint, als er sie auf ihre Entlassung vorbereitete. »Werden Sie am besten Mitglied in Sport- und Freizeitvereinen, betätigen Sie sich ehrenamtlich, wo immer es Ihnen passt. Nur bitte nicht in der Jugendarbeit«, war er nach einem Räuspern fortge-fahren.
»Ich würde mich gerne weiterbilden«, sagte Nina. Sie erinnerte sich ein wenig wehmütig an ihre autodidaktische Bildung während der langen Haftjahre, als es ihr mit kleinen Zaubereien gelang, sich und ihren Mithäftlingen das Leben zu versüßen. Magierin hatte man sie wegen ihrer Hexereien genannt. Doch die kleinen Zaubereien hatten sie weiterge-führt, hin zu einem tieferen Verständnis von Faszination, Träumen, Wünschen und Sehnsüchten. Am Anfang waren es noch einfache Fingerfertigkeiten und physikalische Tricks; erst im Laufe ihrer tieferen Beschäftigung mit der Geschichte der Zauberei, mit naturwissenschaftlich erklär-baren wie unerklärlichen Phänomenen, wuchs ihr Verlangen nach wahrer Magie.
»Besuchen Sie doch die Uni, zum Beispiel als Gasthöre-rin. Oder schreiben Sie sich bei einem VHS-Kurs ein!« hatte ihr der nette Knastpsychologe geraten. Zauberei war für ihn nur das Hilfsmittel, um Zeitbrücken zu schlagen.
Sie sah sich das Frühjahrsprogramm der Volkshoch-schule an. Es reichte vom Englisch für Anfänger bis zu Yoga für Fortgeschrittene, und irgendwo dazwischen fand sie das Angebot »Literarische Schreibwerkstatt: Schreibspie-le – Schreibkultur.«
Das war es.
Sie kreuzte im Anmeldebogen einen Kurs an, der im Spätfrühjahr begann – so hatte sie nicht viel versäumt. Am Montagabend nahm sie die Anmeldung mit, als sie das erste Mal in das zwanzig Minuten von Lomberg entfernte Lenna fuhr, wo das Bier mit viel Natur und Vogelgezwitscher gebraut wurde und wo der Kurs um neunzehn Uhr in der alten Stadtbücherei stattfand.
Es war kurz vor Kursbeginn, als Nina auf die kreisför-mige Zufahrt des rotfarbenen Backsteinbaus abbog. Die Sonne war bereits hinter den kleinen Fachwerkhäusern untergegangen, aber der Himmel war noch hell. Sie fühlte sich energiegeladen und stieß die Tür zum Seminarraum eine Spur zu kräftig auf. Alle Blicke richteten sich auf die Neue. Ihr Haar hatte sie heute zusammengebunden. Sie trug ein Kostüm in ihrer Lieblingsfarbe, dunkelblau, dazu in gleicher Farbe Wildlederschuhe mit dezenten, halbhohen Absätzen. Es war bereits der zweite Seminarabend. Nina setzte sich auf einen freien Platz in der ersten Reihe. Die Tische standen in einem geschlossenen Kreis. Vorne, an der Stirnseite der Wand, wo das Flipchart vor den Bücher-regalen stand, saß der Dozent.
»Was glauben Sie, ist das Wichtigste an einer Geschich-te?«, fragte er, nachdem er mit einem Kopfnicken die Neue auf seiner linken Seite registriert hatte. »Die Formalitäten erledigen wir im Anschluss«, flüsterte er ihr zu, denn sie saß nur zwei Sitze von ihm entfernt.
Auf dem Flipchart hinter ihm standen mehrere Begriffe und Stichworte, die mit Strichen und Einrahmungen in Verbindung standen – Fiktionale Literatur – Wett-eifern mit Gott – Erschaffung faszinierender Menschen – Handlungsaufbau – Schmelztiegel – Spannung.
»Dass die Geschichte stimmt, also die Glaubwürdigkeit der ganzen Sache«, antwortete eine brünette Mittzwanzi-gerin, die Nina gegenübersaß. Beide sahen sich an, und Nina nickte ihr zustimmend zu.
»Richtig. Noch etwas?«, fragte der Dozent.
»Na ja, spannend muss die Story sein. Wenn es früher dem Medizinmann nicht gelang, seine Zuhörer in gespannte Erwartung zu versetzen und er dennoch seinen Text herunterleierte, so wurde er zum Teufel gejagt. Und das ist heutzutage nicht anders«, meinte der dunkelhaarige Mann neben Nina. Er mochte so um die Dreißig sein.
Der Dozent nickte.
»Uns geht es viel besser als allen Medizinmännern zu-sammengenommen«, brummte der Mann neben Nina mit einem angenehmen Bass in der Stimme. »Wenn es uns nicht gelingt, das Interesse unserer Leser zu wecken, droht uns schlimmstenfalls das Schicksal, keinen Verleger für unser Manuskript zu finden.«
»Sie sind auf dem richtigen Weg«, ergänzte der Dozent, »auf dem Weg der Spannung, denn Spannung ist das A und O der Handlung einer jeden Geschichte.«
Der Dozent hieß Dr. Leo Breitenbach und war vier-undfünfzig Jahre alt, hauptberuflich Abteilungsleiter beim Staatlichen Schulamt, zuständig für Personaleinstellungen an den örtlichen Grund- und Gesamtschulen sowie den Gymnasien. Seit dem Tod seiner Frau vor zwölf Jahren war er alleinstehend und besserte sein Gehalt, seinen Lebens-inhalt und seine Selbstbestätigung durch dieses Hobby auf.
»Sie können eine fabelhafte Phantasie haben und mit faszinierendem Stil schreiben und Figuren der Superlative erfinden, aber wenn Sie den Leser nicht bald an seiner unersättlichen Neugier packen, wird er Ihre Geschichte zur Seite legen und nie wieder weiterlesen«, dozierte Dr. Breitenbach, und er fuhr mit den viel zu kurzen Beamten-fingern durch den Rest seines Haares.
Eine Teilnehmerin räusperte sich und wollte etwas sagen. Dr. Breitenbach ermunterte sie durch ein sanftes Nicken.
»Ich habe vor zwei Wochen einen Roman gelesen, den ich nicht mehr weglegen konnte.«
»Mir ging es so ähnlich«, ergänzte eine andere. »Ich konnte meinen Lieblingsroman immer erst dann aus der Hand legen, wenn ich aufs Klo musste.« Die Kursteil-nehmer lachten und redeten für einen kurzen Moment durcheinander.
Der Dozent lächelte zufrieden. Das wollte er hören. »Genau darauf kommt es an. Der Leser muss sich so in Ihre Geschichte vertiefen, dass er das Buch nur aus der Hand legt, wenn sich die Realität mit Gewalt bemerkbar macht.«
»Aber ist es nicht unfair, den Leser irrezuführen und auf die Folter zu spannen, nur um ein Spannungselement zu erzeugen?« fragte Nina Nowak. Doch die Unruhe im Raum machte ihr deutlich, dass sie den ersten Kurstermin versäumt hatte.
Dr. Breitenbach stand auf, sah sie an, blätterte eine Seite des Flipcharts zurück und zeigte aus zwei Metern Entfernung mit seinem silbergrauen Laserpointer auf die mit grünem und rotem Stift geschriebenen Stichworte: Autor erzeugt Spannung – nicht auflösen – drohende Gefahr nur überwinden, um unvermit-telt mit noch größerer Gefahr zu konfrontieren – Aufgabe des Autors ist es, boshaft zu sein – Leser Nervenkitzel verschaffen, den er in Büchern sucht und im wirklichen Leben verabscheut – Erwartungen des Lesers immer wieder ent-täuschen.
»Machen wir Schluss für heute«, sagte er. »Überlegen Sie sich bis zum nächsten Mal eine spannende Story, am besten etwas Fiktives, das real sein könnte – vielleicht eine myste-riöse Geschichte aus ihrem eigenen Leben.«
Was Dr. Breitenbach jedoch nicht wusste, war, dass eine seiner Teilnehmerinnen keine Geschichte erfinden musste. An diesem Abend, Ende April, als er von Nina die Kursanmeldung annahm und sie ansah, fing er das erste Mal nach Jahren der Abstinenz wieder Feuer.
1
Die echte Nina Nowak war dreiundvierzig Jahre alt, hatte dunkles Haar, das sie kurzgeschnitten trug, und lebte in einem Frankfurter Stadtteil. Die Großstadt der Banken, Frankfurt am Main, war nicht ihre Sache, auch wenn es hier nach Geld roch und sie diesen Geruch liebte. Aber wenn sie nur so oft wie möglich verreisen konnte, dann war auch diese Stadt und die ihr innewohnende Hektik hinnehmbar. Und verreisen konnte sie, mindestens vier Mal im Jahr.
Nina Nowak war Lehrerin am Helmholtz-Gymnasium, einer Oberstufenschule mit naturwissenschaftlich-techni-schem Schwerpunkt. Seit nunmehr sechzehn Jahren lebte die Oberstudienrätin im Rhein-Main-Gebiet, wo sie seither mit einem vier Jahre älteren Lebensgefährten und inzwi-schen mit einem A 14 - Gehalt ausgestattet war.
An diesem Abend brachte ihr Gerd Bayer etwas mit, womit er sie seit mindestens fünf Jahren nicht mehr be-glückt hatte – einen Strauß Blumen, etwas für die Seele, etwas für Liebende, etwas …
»Hat den ein Bräutigam vergessen?«, fragte sie ihn.
»Wir sollten unsere Beziehung verbessern«, sagte er und gab Nina einen sachten Kuss auf die linke Wange.
»Willst Du irgendetwas?« Sie ging nicht auf sein Ange-bot ein.
»Es ist Zeit, dass ich dir etwas verrate.« Er wickelte die Blumen aus dem Papier und reichte sie ihr. »Ich liebe dich immer noch so wie früher, als wir uns jeden Tag vor Liebe erdrückten.«
Sie musterte ihn kühl. »Was soll der kindische Unsinn?«, antwortete sie und zupfte an ihrer indischen Perlmuttweste herum. Dann nahm sie ein Senfgurkenglas und stellte die Blumen hinein.
Als Standesbeamter erwarteten ihn mehrmals in der Woche Überraschungen. Ehen platzten wenige Minuten, bevor sie geschlossen wurden; der Bräutigam kam betrun-ken oder überhaupt nicht zum Termin; Bräute fielen in Ohnmacht und Schwiegermütter erlitten Schreikrämpfe, während Brautvätern das Wasser aus den Augen schoss.
Nina jedoch bot ihm jedes Mal eine völlig neue Über-raschung. Immer wenn er dachte, eine Steigerung der Ereig-nisse sei nicht mehr möglich, dann bewies sie ihm das Gegenteil. Er hatte fest damit gerechnet, dass seine Blumen ihre Gefühle für ihn zumindest für eine Sekunde reani-mierten.
»Wenn mein Blumenstrauß dir Probleme bereitet«, bemerkte Gerd mit bissigem Unterton, »dann lass es uns vergessen. Ich wollte einen Neuanfang …«
»Neuanfang? Wie oft denn noch? Hör auf mit dem Quatsch, so wie es zwischen uns ist, ist alles in Ordnung.«
»In Ordnung, nennst Du das?«, murmelte er erstaunt. Er konnte es trotz all der lieblosen Jahre immer noch nicht glauben, dass sie sich mit der emotionalen Kälte abgefunden hatte.
Er machte einen Schritt auf sie zu und wollte sie um-armen, aber sie drehte sich um und ging ins Speisezimmer.
»Schau nach dem Rotkraut, es brennt an«, rief sie ihm über die Schulter zu.
Gerd ging zum Herd. Was hält uns eigentlich zusammen?
Gemeinsame Kinder hatten sie nicht. Reisen unter-nahm sie in den letzten Jahren ohne ihn. Und ihn drängte es auch nicht dazu, denn sobald er einmal in der Wohnung alleine war, fühlte er seine Lebensgeister zurückkehren. Dann ging er gelegentlich aus, wurde zur Freude alter Skatkumpane wieder amüsant und legte von Tag zu Tag mehr von seinem Beamtenmäntelchen ab.
Was ist es, weshalb wir nicht getrennte Wege gehen?
Aber eigentlich wusste er es genau – spätestens seit diese Alice Schneider aufgetaucht war. Ja, er würde seinen Plan umsetzen.
Es gab Rotkraut, Bratwurst und Salzkartoffeln, und beim Essen fielen Nina wieder all die Hässlichkeiten ihres Schulalltages ein. Lieber nicht dran denken! ging es ihr durch den Kopf. »Was besonderes bei Dir?«, fragte sie.
»Sagt dir der Name Alice Schneider noch etwas?«
Sie dachte an eine Alice aus ihrem Kollegium – aber sie hieß mit Nachnamen anders – eine impertinente Person, die alles besser wusste. »Nein«, sagte sie. »Warum? Was ist mit ihr?«
»Vielleicht erinnerst du dich, es ging vor sechs oder sieben Jahren durch die Presse. Du hast damals noch eine Sondersendung im Zweiten geschaut. Es war die …« Er goss sich eine Apfelschorle ein.
»Alice Schneider?«, unterbrach sie ihn und schaute von ihrem Teller auf. »Hast du gesagt Alice Schneider?«
»Ja, sie wurde heute entlassen.«
»Sie hat eine lange Zeit gesessen, und wer weiß, ob sie es wirklich getan hat«, sagte Nina Nowak. »Stand etwas über ihre Entlassung in der Zeitung?«
»Nein, ich erfuhr es zufällig von einem Kollegen des Meldeamtes.« Gerd Bayer trank die Apfelschorle leer. Es war ein Fehler, dieses Thema anzuschneiden. Beende es! Mein Plan gerät in Gefahr! Sie würde natürlich das Thema uner-bittlich ausweiten, und irgendwann würde er sich verplap-pern.
So war er froh, dass sie auf seine Nachfrage, ob es neue Probleme mit dem Kollegium gegeben habe, sofort an-sprang.
»Frau Nowak, bitte zum Schulleiter in der großen Pause – das hat mich schon auf hundertfünfzig gebracht«, spru-delte sie los. »Statt mich im Lehrerzimmer anzusprechen, muss die ganze Schule erfahren, dass ich zum Schulleiter soll. Er hat kein Gefühl für so etwas, kein Fingerspitzen-gefühl.« Sie tippte sich an die Stirn.
Die echte Nina Nowak war eine absolute Einzelerschei-nung, auch an ihrer Schule. Seit elf Monaten befand sie sich in einem Dauerclinch mit dem Schuldirektor. Seit das Ministerium eine Unterrichtsstunde als Mehrleistung ange-ordnet und die Aufsichtsbehörde empfohlen hatte, die Schulen auch für Nachmittagsangebote zu öffnen, verstand sie die Welt nicht mehr. Eines Tages war Direktor Kühn auf die Idee gekommen, sie, ausgerechnet sie, könne doch an einem Nachmittag in der Woche den Zusatzkurs Biologie anbieten. Von vierzehn Uhr bis fünfzehn Uhr dreißig. Als hätte sie nichts anderes zu tun! Aber in diesem Irrenhaus von Gymnasium musste man mit allem rechnen.
»Wieso ich?«, hatte sie gefragt.
»Ich habe bereits drei weitere Kollegen und eine Kolle-gin angesprochen«, antwortete er.
»Und wieso gerade ich?«, hatte sie weitergebohrt.
»Die anderen Kolleginnen haben Kinder, Frau Nowak«, wandte er ein, »und ich möchte gerne nach sozialen und fachlichen Kriterien entscheiden.« Es entstand eine Pause, in der sie ihn kopfschüttelnd ansah.
»Sie wissen sicherlich, dass ich befugt bin, die Entschei-dung zu fällen, wie ich sie letztendlich für richtig halte«, hatte er mit einem für sie als bedrohlich empfundenen Un-terton hinzugefügt.
Und er hatte das ich unverschämt lange betont. Sollte er doch entscheiden wie er wollte. Er würde schon sehen, was er davon hätte. Aber erst einmal galt es für sie, die aktuelle Gefahr abzuwenden.
»Sich in die Position des Stärkeren zu setzen, finde ich an dieser Schule nicht angemessen«, ließ sie ihn wissen. »Was sagt denn der Personalrat dazu?«
Der Schulchef hatte sie bissig angesehen. »Grundsätz-lich gibt es keinen Einwand dagegen, wenn Fächer, die in der Stundentafel zu kurz kommen, als Zusatzangebot in unser Nachmittagsprogramm aufgenommen werden, das wissen Sie doch, Frau Kollegin«, hatte er gekontert.
Jedenfalls führte das Hickhack dazu, dass sie nun schon fast zehn Monate um diesen idiotischen Nachmittag herum kam. Alle Nachmittage, außer dem für die Kollegin Nowak vorgesehenen, waren mit großem Erfolg zustande gekom-men, und Schüler wie Eltern äußerten sich lobend über die Initiative der Schule.
Nina Nowak ärgerte, dass alleine sie vom Schulleiter für den Ausfallnachmittag verantwortlich gemacht wurde und Hinz und Kunz sie mittlerweile ziemlich schräg ansahen.
Als ob nicht die anderen dreizehn Kolleginnen und Kollegen genauso in die Pflicht genommen werden könn-ten.
Kinder. Kinder. Als ob sie nicht den ganzen Tag Kinder im Kopf habe, und als ob sie nur für die Schule lebe.
»Weißt Du, Gerd«, sagte sie jetzt beim Abendessen, als sie sich zu zweit gegenüber saßen, neben sich auf dem Boden den großen Blumenstrauß im Gurkenglas, »ich hab’ von der Schule die Schnauze voll. Ich steig‘ aus. Mir reicht‘s.«
»Hat er dich wieder wegen des Nachmittagsunterrichts genervt?«, fragte Gerd.
»Wir sind achtzehn Studien- und Oberstudienräte. Vier von denen hat der Kühn rumgekriegt, ich weiß nicht wie. Aber sie machen diesen Firlefanz mit. Und was meinst Du, was die anderen dreizehn Kollegen machen? Sie zeigen mit dem Finger auf mich und fragen völlig unschuldig, warum ich der Schule nicht den Dienst erweise!«, empörte sie sich.
»Du hast drei Miethäuser zu verwalten. Du hast sechs-unddreißig Mietparteien am Hals. Du musst sechsunddrei-ßig Familien funktionierende Wohnungen und Gebäude bereitstellen«, unterstützte er sie. »Du tust wahrlich genug Gutes für die Gesellschaft.«
»Übrigens, bei Wellers ist schon wieder die Badearma-tur kaputt. Könntest du dich darum kümmern?«
Wenn sie sich schulisch überlastet fühlte, spannte sie ihren Lebenspartner stets für die Verwaltungsarbeiten ihrer Miethäuser – Produkt aus einer Erbschaft – ein; und weil sich das Leben der Oberstudienrätin Nina Nowak in einem Dauerüberlastungszustand befand, hatte Gerd Bayer die Häuser seit Anfang ihrer Beziehung zu verwalten.
Seitdem beide ihre Lebensgemeinschaft wegen der Erbschaftsregelung notariell besiegelt hatten und sich am darauffolgenden Abend im feinsten Restaurant der Banken-stadt, einem exquisiten Japanrestaurant, dicke goldene Ringe an die Finger steckten, die man gewöhnlich als Ehe-ringe zu bezeichnen pflegte, seitdem hatte der Standesbe-amte für seine Lehrerin die Nebentätigkeiten zu erledigen.
»Ja klar, Schatz, das mach ich«, sagte Gerd Bayer. »Wellers schick ich wie immer den Rühl vorbei. Der baut ihnen die Armatur von den Wilhelms ein, die letzte Woche ausgezogen sind.«
»Und was kommt in das Bad der Wilhelm-Wohnung?«, fragte sie.
»Den neuen Mietern schreiben wir in den Vertrag, dass sie für die Badearmaturen selbst verantwortlich sind, ganz einfach.« Gerd Bayer lächelte sein Standesbeamtenlächeln und klopfte mit dem Zeigefinger auf den Tisch. »Nun sag mal, wie ging denn das Gespräch mit dem Direx aus?«
»Zum x-ten Mal hat er versucht, mir eine Grundsatzdis-kussion über den Auftrag der Schule aufzuzwingen«, erwi-derte Nina. »Allerdings biss er da bei mir auf Granit. Ich habe ihn soweit gebracht, bis er explodierte. Wenn es für ihn eine Möglichkeit gäbe, mich rauszuschmeißen und mir durch die Schulsekretärin die Papiere aushändigen zu lassen, dann trüge er als Beamter wieder den Kopf oben, hat er gebrüllt.«
»Und das hast du dir gefallen lassen?«, fragte Gerd.
»Natürlich nicht. Ich schalte den Personalrat ein, habe ich ihm geantwortet und bin gegangen.«
»Und dann?«
»Dann bin ich zur Dömmrath, die ist auch im Gesamt-personalrat beim Schulamt«, sagte Nina und tippte sich mit dem Finger bedeutungsvoll unters Auge. »Ich soll ihr eine Beschwerde schreiben. Sie brauche etwas Schriftliches in der Hand. Der Kühn sei ihr sowieso zuwider. Der mache seit Jahren alle gewerkschaftlichen Bestrebungen kaputt. Gottseidank, sagte sie, gibt es nur selten solche Mistkerle, die unterm Deckmäntelchen des Leistungsprinzips versu-chen, die gewerkschaftlichen Rechte abzubauen.«
Nina Nowak holte tief Luft und stand auf, wobei sie über das große Gurkenglas mit dem Vierundsiebzig-Mark-Strauß stolperte und der Länge nach hinfiel. Sie lag mitten in einer Wasserpfütze. Da schoss es dem Standesbeamten Gerd Bayer wie ein Blitz durch den Kopf. Er sah plötzlich die Konto-Auszüge auf dem Boden und holte den Fön und steckte ihn in die nächstbeste Steckdose.
2
Alice Schneider alias Nina Nowak erhielt bereits wenige Tage, nachdem sie ihre Bewerbungen aufs Postamt gegeben hatte, die ersten Rücksendungen ihrer Unterlagen, verbun-den mit höflichen Absagen, denen man auf hundert Metern gegen den Wind den Geruch von Heuchelei anmerkte. Die eleganteste Formulierung konnte noch deprimierend genug auf jemanden wirken.
Nina, die sich das berufliche Leben in der Freiheit leichter vorgestellt hatte, schluckte, als sie die Schreiben las. »Wie Sie wissen«, so hieß es in einer Absage, »pflegen auf eine Stellenausschreibung zahlreiche Bewerbungen einzuge-hen und nur für eine konnten wir uns entscheiden. Unsere Wahl ist diesmal auf eine Mitbewerberin gefallen. Bitte fas-sen Sie diese Entscheidung nicht als Wertung Ihrer Person oder Qualifikation auf.«
Nina neigte keinesfalls zu Depressionen, dazu war sie zu kämpferisch. Sechs Jahre hatte sie die Sonne fast nur durch ein kleines vergittertes Fenster gesehen. Wenn der Mond in sternenklaren Nächten einmal zufällig in einen Winkel ihrer Zelle Einlass fand, gingen ihr Lieder durch den Kopf, und wenn sie sicher war, dass die Lady schlief, mit der sie ihren außergewöhnlichen Aufenthaltsort so schrecklich gewöhnlich teilte, dann summte Nina ein altes Kinderlied vor sich hin. Guter Mond, du gehst so stille durch die Abendwolken hin, und Nina träumte dann von der Zukunft. Selbstmitleid war ihr fremd.
Doch als sie über Tage hinweg nur Absageschreiben erhielt, dachte sie schon daran, den guten alten Pfarrers-bruder anzurufen. Vielleicht hatte er noch Kontakte, die ihr helfen konnten. Sie verwarf diesen Plan, als sie an die Worte des Anstaltsseelsorgers dachte, mit denen er sie so liebevoll verabschiedet hatte.
»Laufen Sie auch draußen weiter auf ihren eigenen Bei-nen. Lassen Sie sich keine Prothesen andrehen. Ihre Beine sind schlank, gesund und schön. Und Sie werden mit ihrem Elan ein neues Kapitel aufschlagen. Selbstverständlich kön-nen Sie mich anrufen, wenn nichts mehr geht«, hatte er an-gefügt.
Den Abend vor dem nächsten Kurstermin kroch Nina frühzeitig ins Bett, nachdem sie sich ein heißes Bad gegönnt hatte. Sie richtete die Kopfkissen auf und knipste die gemütliche Bettlampe an; sie liebte dieses etwas schum-merige Licht des kleinen Lämpchens. Dann nahm sie einen Block und begann ihre Hausaufgaben für Dr. Breitenbach zu erledigen. Sie lag da und dachte nach.
Sie hatte eine zwar behütete, aber dennoch recht freie Kindheit verbracht und verfügte dank ihrer Eltern über einen ausgeprägten Realitätssinn. Ihre Mutter hatte ihr früh-zeitig nahegebracht, ältere Männer seien nur mit Vorsicht zu genießen, was sicherlich daher kam, dass Ninas Vater zwanzig Jahre älter war als ihre Mutter.
Er war Lehrer an einer Schule in einem dreißig Straßen-bahnminuten entfernten Stadtteil und hatte die Nachmit-tage viel Zeit. Nina konnte sich nicht mehr erinnern, warum es so schrecklich oft Konflikte zwischen ihren Eltern gege-ben hatte, doch schien es ihr stets mit den freien Nachmit-tagen in Verbindung zu stehen. Es war allerdings niemals zu dramatischen Zwischenfällen oder Scheidungsdrohungen gekommen. Als Kind fühlte sie sich zwischen all den All-tagskonflikten geborgen, wenn auch manchmal etwas ein-sam.
Einmal meinte Mutters beste Freundin, die fast jedes Wochenende zu Besuch war, Alice sei wohl zu schüchtern, weil sie nicht mit gleichaltrigen Kindern spielen mochte. Tante Maja war sogar der Auffassung, man solle sie unter-suchen lassen, und dann murmelte sie etwas in Mamas Ohr, und die Mutter schaute ihr Töchterlein besorgt an. Aber Alice konnte mit den Nachbarskindern nichts anfangen, weil sie gleichaltrig waren – lieber langweilte sie sich; kamen ältere Kinder zu Besuch, dann funktionierte der Kontakt blendend. Doch da war Tante Maja nicht da und sah es nicht.
Alice‘s Vater hatte ihr stets ein Gefühl der Sicherheit gegeben, und er strahlte bis in sein hohes Alter hinein Stärke und Erfahrung aus. Aber seine Dominanz empfand sie häufig als bedrückend. Oft zog sie sich dann in ihr Kinder-zimmer zurück und spielte mit den Puppen-Jungs.
Es gab da ein Ereignis in ihrer Kindheit, an dessen Beginn sie sich nur verschwommen erinnerte, wenngleich es für sie ein tiefer Einschnitt war. Doch dieser Punkt tauchte jedes Mal vor ihrem Auge auf, wenn sie darüber nachdachte, wie es hatte geschehen können.
Eines Tages sagten ihre Eltern, sie würden mit ihr zu einem netten Onkel Doktor gehen, der ihr keine Spritzen geben würde. Er wolle sich mit ihr nur unterhalten, und sie möge doch bitte alles beantworten und recht artig sein. Sie mochte acht oder neun Jahre alt gewesen sein.
Sie erinnerte sich daran, wie sie plötzlich einem Herrn mit Honigmiene und dichtem schwarzen Haar gegen-übersaß.