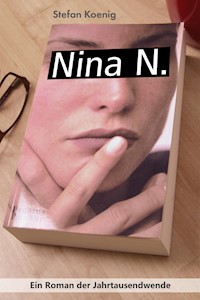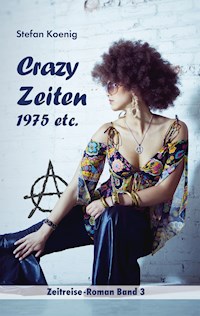Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Das Buch führt auf leicht lesbare Art in die komplexe Evolutions-, Philosophie-, Glaubens- und Wissenschaftsgeschichte der Menschheit ein. Dieses umfängliche Lesebuch führt uns auf über 500 Seiten von der Menschwerdung, von der Urgesellschaft über die Antike zum Mittelalter bis hin zur Frühen Neuzeit. Es wirft die altbekannten Fragen in neuem Licht auf: Woher wir kommen, wer wir sind. Wie der Mensch zum Mensch wurde. Wie Arbeit, Schöpfertum und Wissen in Jahrhunderttausenden erarbeitet wurden. Wie wir einst im unsichtbaren Gefängnis der Natur lebten - und wie wir uns von ihren Fesseln befreien konnten. Einst waren wir "Zwerge", heute sind wir "Riesen" - und in der Lage, den blauen Planeten zu zerstören. Die Hoffnung auf ein höheres Wesen darf uns nicht verführen, die ganz persönliche Verantwortung für die Erde und für die Menschheit smart zu umgehen. In diesem Sinne ist "Tag 1 – Als Gott entstand" ein interessantes aktuelles Lesebuch der Menschheitsgeschichte für Jung und Alt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 625
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stefan Koenig
Tag 1 - Als Gott entstand
Glaube. Wissenschaft. Evolution. Die Geschichte unserer Vorfahren
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Erster Teil
Die Menschwerdung
Vorlesung 1
Vorlesung 2
Vorlesung 3
Vorlesung 4
Vorlesung 5
Vorlesung 6
Vorlesung 7
Vorlesung 8
Vorlesung 9
Vorlesung 10
Vorlesung 11
Vorlesung 12
Zweiter Teil
Der Mensch lernt und wächst
Vorlesung 13
Vorlesung 14
Vorlesung 15
Vorlesung 16
Vorlesung 17
Vorlesung 18
Vorlesung 19
Vorlesung 20
Vorlesung 21
Vorlesung 22
Vorlesung 23
Vorlesung 24
Vorlesung 25
Dritter Teil
Der Mensch macht einen Salto rückwärts
Vorlesung 26
Vorlesung 27
Vorlesung 28
Vorlesung 29
Vorlesung 30
Vorlesung 31
Vorlesung 32
Vorlesung 33
Vorlesung 34
Vierter Teil
Der Mensch wird wieder kühn
Vorlesung 35
Vorlesung 36
Vorlesung 37
Vorlesung 38
Vorlesung 39
Fünfter Teil
in sechs Foren
Forum 1
Forum 2
Forum 3
Forum 4
Forum 5
Forum 6
Stichworte
Aktuelle Romane von Stefan Koenig
Nachbemerkungen und Resümee
Impressum neobooks
Erster Teil
Tag 1
Als Gott entstand
Glaube. Wissenschaft. Evolution.
Die Geschichte unserer Vorfahren
Herausgegeben, bearbeitet
und kommentiert von Stefan Koenig
Tag 1
Als Gott entstand
Woher wir kommen
Wer wir sind
Gewidmet der Vernunft
Gewidmet der Aufklärung
Gewidmet der Wissenschaft
Pegasus Bücher
© 2018 by Stefan Koenig
Verlag Pegasus Bücher
Druck und Umschlaggestaltung
GRAPHIC-FACTORY, Hungen
ISBN: 978-3-9817877-2-6
Kontakt zum Herausgeber:
Pegasus Bücher
Postfach 1111
D-35321 Laubach
Die Menschwerdung
Vorlesung 1
Ein Nebel im Universum. Eine größere Molekülwolke, geimpft mit dem radioaktiven Fall-Out einer nahen Supernova-Explosion. Ein kollabierender Kern aus der Molekülwolke. Die interstellare Materie verdichtet sich. Ein Feuerball, der zum Stern wird. Die Entstehungsgeschichte unserer Erde ist mit der Geschichte des Universums, des Milchstraßensystems und unseres Sonnensystems verknüpft. Woher wir das wissen? Die Erkenntnisse der Planetologie über die Entstehung der Erde stammen aus geologischen Befunden, aus der Untersuchung von Meteoriten und Mondgesteinen sowie aus astrophysikalischen Daten etwa zu solaren Elementhäufigkeiten.
Doch dies ist kein Buch nur für Naturwissenschaftler, kein Buch nur für Spezialisten – es ist ein Buch für jeden von uns, der wissen will, woher wir kommen. Ein Buch für alle, die wissen wollen, wer wir sind. Wer waren unsere Ur-Vorfahren? Wie lebten sie? Wer war ihr Gott? Und wo war ihr Gott? Wir spielen uns heute als Riesen auf. Tatsächlich sind wir es auch. Wir wurden es in jenem Moment, als wir uns durch unsere Entdeckungen in die Lage brachten, diesen über Milliarden Jahren entstandenen Klumpen Materie, der sich mühsam unterschied in unbelebt und belebt, atomar in die Luft zu jagen, zu zerstören. Aber waren wir schon immer Riesen?
Nein, es gab eine Zeit, da war der Mensch kein Riese, kein Natur-Beherrscher, sondern ein Zwerg, er war höriger Untertan der Erde. Er besaß ebenso wenig Macht über die Natur, ebenso wenig Freiheit wie irgendein Tier im Wald oder irgendein Vogel in der Luft.
Man sagt: „Frei wie ein Vogel.“ Aber kann man einen Vogel frei nennen? Es ist richtig, er hat Flügel, die ihn über Wälder, Seen und Berge tragen. Wenn jetzt im Herbst die Zugvögel, Störche, Kraniche und andere gen Süden fliegen, beneidet sie mancher von uns und denkt: „Glückliche Vögel: fliegen, wohin sie wollen!“
Aber ist es so? Machen die Vögel diese weiten Flüge, weil sie wie wir das Reisen lieben? Weil sie „Reisefreiheit“ genießen?
Nein, die Vögel fliegen nicht aus freier Lust, sondern aus Zwang. Diese Vogelzüge sind im Kampf ums Leben entstanden, während unzähliger Generationen, in Abertausenden von Jahren.
Für einen Vogel ist es so leicht, von einem Ort zum anderen zu fliegen, dass eigentlich jede Vogelart überall auf der Erde zu finden sein könnte. Wäre es aber so, dann würden wir in unseren Fichtenwäldern und Birkenhainen Papageien treffen. Dann würden wir, wenn wir ins Dickicht des Waldes eindringen, über unserem Kopf das Trillern der Feldlerche oder das Kreischen der Möven hören.
Das gibt es jedoch nicht und kann es nicht geben, denn die Vögel sind nicht so frei, wie es uns scheint. Jeder Vogel hat seinen Platz in der Welt. Der eine lebt am Ufer des Meeres, der andere in der Steppe oder Taiga. Wie stark sind doch die Flügel des Adlers! Aber auch er hält sich in bestimmten Grenzen, wenn er seinen Nistplatz aussucht, Grenzen, die man auf der Karte einzeichnen könnte.
Der Steinadler wird seinen Horst nicht in der freien, unbewaldeten Steppe bauen. Der Steppenadler dagegen wird nicht im Waldesinnern oder in den Bergen hausen. Es scheint, als sei der Wald von der Steppe durch eine unsichtbare Wand getrennt, durch die nicht jedes Tier und nicht jeder Vogel hindurchkommt.
Ihr werdet die typischen Waldbewohner nicht in der Prärie antreffen, keinen Zaunkönig, kein Eichhörnchen. Und im Wald werdet ihr keine Präriebewohner finden.
Aber auch Wald, Prärie und Steppe sind wieder in einzelne Lebensgebiete unterteilt. Wenn ihr durch den Wald geht, durchschreitet ihr immer wieder jene unsichtbaren Wände. Und wenn ihr auf Bäume klettert, stoßt ihr mit dem Kopf durch unsichtbare Decken. Der ganze Wald ist wie ein großes Haus, eingeteilt in Stockwerke und Wohnungen, obwohl ihr nichts davon seht.
Die Menschen wechseln oft ihre Wohnungen, ziehen um von einem Haus ins andere, aus einer Etage in die andere. Im Wald ist es für die Bewohner einer Etage sehr schwierig bzw. unmöglich, ihre Wohnung mit dem Mieter einer anderen Etage zu tauschen. Die Waldschnepfe wird ihr feuchtes und dunkles Heim nicht gegen ein trockenes und sonniges eintauschen. Der Bewohner des Dachbodens, der Habicht, wird sein Nest nicht am Fuße der Bäume bauen.
Jede Tierart hat im Laufe ihrer Entwicklungsgeschichte andere Überlebensmerkmale und andere körperliche Gegebenheiten entwickelt. Wenn Eichhörnchen und Springmaus ihre Wohnungen tauschen wollten, Wald gegen Steppe, Baumhöhle gegen Erdloch, dann müssten sie auch ihre Schwänze und ihre Pfoten tauschen. Wenn wir noch andere Steppen- oder Waldbewohner kennen lernen, sehen wir, dass jeder von ihnen mit unsichtbaren Ketten an seinen Platz in der Welt gefesselt ist.
Schauen wir uns eine der Ketten an: Der Specht klopft am Stamm einer Tanne. Was sucht er in der Rinde? Wenn wir die Rinde von der Tanne abschälen, sehen wir gewundene Gänge, die ein ständiger Schmarotzer dort genagt hat – der Tannenborkenkäfer. Jeder Gang endet in einem Kämmerchen, und dort verwandelt sich die Larve des Borkenkäfers zunächst in eine Puppe und dann in ein Käferchen. Das Käferchen hat sich der Tanne angepasst – der Specht hat sich dem Käferchen angepasst. Der Specht hat einen kräftigen, festen Schnabel, mit dem er leicht die Rinde aufmeißelt, und seine Zunge ist so lang und biegsam, dass er die Larven in ihren Gängen erreicht und sie sich herausfischt.
Hier haben wir beispielhaft eine dieser Ketten: Tanne – Borkenkäfer – Specht. Das ist aber nur eine von den Ketten, die den Specht an den Baum und an den Wald fesseln.
Auf dem Baum findet der Specht sein Fressen: Nicht nur den Borkenkäfer, sondern auch andere Insekten und ihre Larven. Im Winter zieht er sich geschickt die Samen aus den Kiefernzapfen. Er klemmt dabei den Zapfen zwischen Stamm und Ast. Aus dem Stamm des Baumes meißelt er sich eine Höhle für sein Nest. Sein elastischer Schwanz und seine Greifkrallen machen es ihm möglich, am Stamm auf und ab zu klettern.
Wie sollte sich der Specht nach alledem von seinem Baum trennen können?
Und so ergibt sich, dass der Specht und das Eichhörnchen nicht freiwillige Mieter, sondern eigentlich Gefangene des Waldes sind.
Die einzelnen Welten des Waldes sind nur ein Teil der vielen Welten, die die Welt zusammensetzen. Auf der Erdkugel gibt es nicht nur Wälder und Steppen, sondern auch Berge, Tundren, Seen und Meere. Auf jedem Berg trennen unsichtbare Wände mehrere Bergwelten voneinander. Jedes Meer ist durch unsichtbare Böden in unterseeische Stockwerke eingeteilt. Die Steine am Ufer, auf dem Streifen zwischen Ebbe und Flut, sind mit zahllosen kleinen Muscheln übersät, die so fest sitzen, dass kein Sturm sie wegspült.
Im Wasser, soweit die Sonne hineinscheint, tummeln sich zwischen braunen und grünen Algen allerlei Fische, schaukeln durchsichtige Medusen; am Grund kriechen langsam die Seesterne. Auf den Felsen im Wasser stehen wunderliche Tiere, festgewachsen wie Pflanzen. Sie brauchen ihre Nahrung nicht zu suchen. Sie kommt ihnen von selbst in den Mund. Rote Aszidien, die wie doppelhalsige Flaschen aussehen, saugen ihre Nahrung mit dem Wasser ein. Bunte Aktinien fangen vorüberschwimmende Fischchen mit ihren Armen, die Blumenblättern gleichen.
Ganz anders wird die Welt in den niedrigeren, dunklen Stockwerken des Meeres, wo die Nacht nie vom Tag abgelöst wird. Hier schwimmen breitmäulige Fische in der totalen Finsternis; manche tragen feurige Punkte auf ihren Körpern, wie kleine Dampfer mit grell erleuchteten Fenstern. Wie wenig Ähnlichkeit hat diese seltsame Welt mit der Welt, in der wir leben.
Aber auch im seichten Wasser am Strand herrscht keine Ähnlichkeit mit dem Land, obwohl beide nur durch eine schmale Linie, die Linie des Ufers, getrennt sind.
Kann der Bewohner einer solchen Welt sich in einer anderen Umgebung ansiedeln? Kann der Fisch aus der See herauskommen und Festlandbewohner werden?
Das scheint unmöglich. Der Fisch ist doch dem Leben im Wasser angepasst. Um auf dem trockenen Land zu leben, brauchte er eine Lunge und keine Kiemen, Füße und keine Flossen. Die See könnte der Fisch mit dem Festland nur vertauschen, wenn er aufhörte, ein Fisch zu sein. Kann der Fisch aufhören, ein Fisch zu sein?
Fragt die Naturwissenschaftler, sie werden euch sagen, dass tatsächlich in sehr frühen Zeiten Fische ans Ufer kletterten und aufhörten, Fische zu sein. Dieser Übergang vom Wasser zum Land dauerte aber nicht ein oder zwei oder zehn Jahre, sondern Millionen von Jahren.
Das geschah in wasserarmen, austrocknenden Meeren und Seen. Fische, die sich dem Leben in solchen Gewässern nicht anpassen konnten, gingen zugrunde. Nur solche konnten weiterleben, die längere Zeit ohne Wasser auszukommen vermochten. Zur Zeit der Dürre, wenn das Wasser versiegte, krochen sie im Schlamm zu einer nahen Pfütze und gebrauchten dabei ihre Flossen wie Beine. Das Leben begünstigte jede kleine Veränderung des Körpers, die auf dem Land von Nutzen sein konnte. Aus der Schwimmblase entwickelte sich allmählich die Lunge. Aus den paarigen Flossen wurden Beine.
In manchen australischen Flüssen, die regelmäßig austrocknen, gibt es noch heute einen Fisch, dessen Schwimmblase einer Lunge sehr ähnlich ist. Wenn sich der Fluss zur Zeit der Dürre in eine Kette von schlammigen Pfützen verwandelt, gehen alle übrigen Fische zugrunde und verpesten das Wasser mit ihren faulenden Leichen. Aber unserem Fisch macht die Trockenheit nichts aus. Er braucht nur den Kopf aus dem Wasser zu strecken, um frische Luft zu atmen, denn er besitzt außer den Kiemen noch Lungen.
Auch in Afrika und Südamerika gibt es Fische, die fast ohne Wasser existieren können; sie liegen, mit der Lunge atmend, im Schlamm vergraben, bis der Regen kommt.
Es konnte also geschehen, dass sich bei den Fischen Lungen entwickelten.
Nun die Füße! Auch dafür gibt es ein lebendes Beispiel. In tropischen Ländern gibt es einen „Kletterfisch“, der nicht nur ans Ufer springt, sondern sogar auf Bäume krabbelt. Als Füße dienen ihm seine weiterentwickelten Flossen. Diese sonderbaren Wesen sind lebende Beweise dafür, dass die Fische die Möglichkeit haben, aus dem Wasser ans Land zu steigen. Aber woher wissen wir, dass sie es tatsächlich getan haben?
Das zeigen uns die Knochen der ausgestorbenen Tiere. In alten Sedimentgesteinen hat man die Knochen eines Tieres gefunden, das in vielem an einen Fisch erinnert – es war aber schon kein Fisch mehr, sondern ein Amphibium, ähnlich einem Frosch oder Molch. Und diese Tiere – Stegozephalen – hatten keine Flossen, sondern richtige Beine. Mit diesen Beinen konnten sie sich, wenn auch langsam, auf dem Land bewegen.
Und sehr anschaulich sieht man es bei unserem gewöhnlichen Frosch. In seiner Jugend, als Kaulquappe, unterscheidet er sich doch wenig von einem Fisch. Das alles führt uns zu einer Schlussfolgerung: Manche Fische haben vor sehr langen Zeiten die Grenze überschritten, die die See vom Land trennte. Aber sie mussten sich dabei verändern.
Von den Fischen stammen die Amphibien ab. Aus den Amphibien entwickelten sich die Echsen, und von den Echsen stammen Säugetiere und Vögel ab – auch jene, die nichts mehr mit der See verbindet.
Die unsichtbaren Wände, die das Meer vom Land, den Wald von der Steppe trennen, sind keine ewigen Wände. Die Seen trocknen aus oder überfluten das Land. Die Steppen werden zu Wüsten. Die Bewohner der Seen kommen ans Ufer. Die Bewohner der Wälder verwandeln sich in Bewohner der Steppe.
Da ist zum Beispiel das Pferd. Man wird kaum glauben, dass es von einem kleinen, im Waldesdickicht lebenden Tier abstammt, das sehr geschickt über gestürzte Stämme kletterte. Dieses Tierchen hatte nicht Hufe wie ein Pferd, sondern fünfzehige Pfoten mit Krallen. Diese Pfoten und Krallen waren zum Lauf über die Unebenheiten des Waldbodens sehr geeignet.
Die Wälder wurden immer lichter und machten der Steppe Platz. Immer häufiger waren die Waldvorfahren des Pferdes gezwungen, auf offene Lichtungen hinauszutreten. Im Falle einer Gefahr konnten sie sich nicht mehr verstecken, sie mussten sich durch Flucht retten. Aus dem Versteckspiel im Wald wurde ein Fangenspiel im freien Gelände. Für viele Waldtiere nahm dieses Spiel ein trauriges Ende. Nur sehr schnellfüßige und langbeinige vermochten den Raubtieren zu entkommen.
Das Leben nahm auch hier eine Auslese vor: Erhalten blieb, was die Schnelligkeit erhöhte; alles, was behinderte, wurde entfernt. Diese Prüfung, der die Pferdevorfahren unterzogen wurden, ergab, dass viele Zehen unnötig waren. Es genügte eine einzige, dafür aber feste und harte Zehe. Und so tauchten zuerst dreizehige und dann einzehige Pferde auf. Unser heutiges Pferd hat nur einen harten Huf.
Aber nicht nur die Füße, auch das übrige Aussehen veränderte sich in der Steppe. Sehen wir uns den Hals an. Wäre der Hals kurz geblieben, während die Beine länger wurden, dann hätte das Pferd schließlich nicht mehr das Gras zu seinen Hufen erreichen können. Dazu kam es aber nicht, weil kurzhalsige und kurzbeinige Pferde bei der Prüfung durch das Leben ausgeschaltet wurden.
Auch die Zähne haben sich verändert. Die Steppe zwang die Pferde, sich an ein hartes, raues und grobes Futter zu gewöhnen, das erst mit den Zähnen zermahlen werden musste. Dafür wurden nun die geeignetsten Zähne ausgesucht. Die Zähne der jetzigen Pferde sind wie Mühlsteine oder Reibeisen, die nicht nur raues Gras, sondern sogar Stroh ganz fein zermahlen.
Diese gewaltige, riesige Arbeit der Selektion, der Auswahl, nahm nicht wenig Zeit in Anspruch – volle 50 Millionen Jahre. Und wieviel lebendes Material hat dieser Prozess erfordert!
Es ist sehr schwierig für ein Tier, seine bisherige Umwelt zu verlassen, die Ketten der Natur, die es fesseln, zu zerreißen. Aber selbst wenn es diese Ketten sprengt, wird es nicht frei. Aus einem unsichtbaren Käfig gerät es in einen anderen. Als das Pferd vom Wald in die Steppe hinaustrat, hörte es auf, ein Waldtier zu sein und wurde ein Steppentier. Als die Fische ans Land stiegen, schnitten sie sich den Rückweg ins Wasser ab.
Um in die See zurückzukehren, mussten sie sich abermals verändern. Jene Festlandtiere, die wieder ins Meer zurückgingen, mussten ihre Beine wieder in Flossen verwandeln, wie zum Beispiel der Wal, den manche „Walfisch“ nennen, obwohl er mit einem Fisch nur das Aussehen und die Lebensweise gemeinsam hat.
Auf der Erde gibt es ungefähr eine Million verschiedener Tierarten. Jede Art lebt in ihrer eigenen Umwelt, der sie sich angepasst hat. Dort, wo für manche Arten die Tafel aufgestellt ist: „Eintritt verboten“, heißt es für andere: „Herzlich willkommen!“
Woher aber kommt nun der Mensch? Gehörte er in alten Vorzeiten zu den Steppen-, Wald- oder Bergtieren? Kann man einen Menschen, der im Wald lebt, einen Waldmenschen nennen, einen Menschen, der am Moor lebt, einen Moormenschen? Natürlich nicht.
Der Mensch, der im Wald lebt, könnte auch in der Steppe leben, und der Mensch, der am Moor lebt, würde sich nur freuen, auf ein trockenes Fleckchen zu übersiedeln. Der Mensch lebt überall. Für ihn gibt es auf der Erde fast keinen Ort mehr, wohin er nicht vordringen könnte und wo eine Tafel aufgestellt wäre: „Eintritt für Menschen verboten.“
Die Teilnehmer der Papanin-Expedition haben neun Monate auf einer schwimmenden Eisscholle gelebt. Hätten sie aber durch die heißeste Wüste reisen müssen, wären sie nicht weniger erfolgreich gewesen. Um aus der Steppe in den Wald oder aus dem Wald in die Steppe zu ziehen, hat es der Mensch nicht nötig, seine Hände, Füße oder Zähne zu verändern. Wenn er aus dem Süden in den Norden kommt, wird er nicht zugrunde gehen, obwohl sein Körper nicht mit Wolle bedeckt ist. Ein Wintermantel, eine Kopfbedeckung und Stiefel schützen ihn ebenso gut vor dem Frost wie die Tiere ihr Fell.
Der Mensch hat gelernt, schneller zu laufen als ein Pferd, und er musste dafür keine einzige Zehe opfern. Der Mensch hat gelernt, besser im Wasser zu schwimmen als die Fische; und er brauchte dazu weder Hände noch Füße gegen Flossen einzutauschen. Die Echsen, die sich die Luft eroberten, brauchten viele Millionen Jahre, um Vögel zu werden, und sie haben dafür einen hohen Preis bezahlt: sie verloren ihre Vorderbeine, die sich in Flügel verwandelten. Der Mensch hat die Luft in wenigen Jahrhunderten erobert, und er musste keineswegs seine Arme dafür hergeben.
Der Mensch hat ein Mittel gefunden, er selbst zu bleiben und doch die unsichtbaren Mauern zu durchschreiten, welche die Tiere in Gefangenschaft halten. Er steigt zu Höhen auf, in denen die Luft nicht mehr zum Atmen ausreicht, und er kehrt lebend und gesund zurück. Als die russischen und amerikanischen Stratosphärenflieger erstmals den Höhenrekord aufstellten, gingen sie damit über die Grenzen der von Lebewesen bewohnten Welt hinaus.
Alle Lebewesen der Welt stehen in sklavischer Abhängigkeit von der Natur, die sie umgibt. Das Tier ist in allem von den Existenzbedingungen seiner Umwelt abhängig; es funktioniert nach der vorgegebenen natürlichen „Gebrauchsanleitung“. Der Mensch aber schafft sich diese Bedingungen selbst. Er reißt der Natur immer häufiger die Gebrauchsanleitung aus der Hand und schreibt sie selbst. Er streicht aus der vorhandenen Anleitung jene Bedingungen, die ihm nicht passen.
Wenn die Naturbedingung vorgibt: „In der Wüste gibt es wenig Wasser“, dann streicht der Mensch diese Bedingung, indem er durch die Wüste die gerade Linien der Kanäle zieht. Wenn die Natur vorgibt: „Der Boden ist im Norden unfruchtbar“, dann korrigiert der Mensch diese Bedingung, indem er den Boden düngt. Wenn es im Aufgabenbuch der Natur heißt: „Im Winter ist es kalt, in der Nacht ist es dunkel“, dann richtet sich der Mensch nicht danach; er verwandelt in seinem Hause den Winter in den Sommer, macht die Nacht zum Tag. Mehr und mehr ändert der Mensch die ihn umgebende Natur.
Unsere heutigen Wälder sind gänzlich umgestaltet durch Baumschlag und Aufforstung. Unsere Steppen sind nicht mehr die früheren Steppen. Sie sind vom Menschen durchpflügt und bebaut. Unsere Haustiere – Pferde, Kühe, Schafe – sind Tiere, die es in der freien Natur nicht gibt. Sie wurden vom Menschen nach Maß gezüchtet. Ja, sogar die wilden Tiere haben des Menschen wegen ihre Gewohnheiten verändert. Einige halten sich in der Nähe der menschlichen Behausungen, der bepflanzten Felder auf und suchen dabei ihren Vorteil. Andere dagegen verstecken sich vor dem Menschen in unzugänglichen Gegenden, in denen sie früher nicht vorkamen.
Heutzutage wird die wilde, vom Menschen unveränderte Natur nur noch in Reservaten erhalten bleiben. Wenn der Mensch die Grenze eines solchen Reservates zieht, sagt er gleichsam der Natur: „Hier gebe ich dir die Erlaubnis zu wirtschaften, das übrige ist MEINE Wirtschaft.“
Der Mensch hat mehr und mehr die Herrschaft über die Natur errungen. – Das war aber nicht immer so. Unsere Urvorfahren lebten ebenso als Sklaven der Natur wie ihre Verwandten, die übrigen Tiere.
Vorlesung 2
Die bis hier geschilderten Ereignisse der Entwicklung des Lebens stehen für sich. Noch reden wir nicht von Gott, von Religion, von Welterkenntnis, von Bewusstsein und Gehirn, von Glauben und Wissen. Noch sind wir entwicklungsgeschichtlich äußerst weit von diesen „Dingen“ entfernt. Wir bewegen uns immer noch ca. 5 Millionen Jahre vor unserer Zeit. Erst später werden wir uns an den entscheidenden evolutionären Knotenpunkten über die „Erfindung der Welt“ detaillierte Erkenntnisse verschaffen können.
Vor Millionen Jahren standen an der Stelle unserer heutigen Gehölze und Wälder ganz andere, mit anderen Bäumen, mit anderen Tieren und anderen Kräutern. In jenen Wäldern wuchsen außer Ahorn, Birken und Linden noch Myrten, Lorbeer und Magnolien. Neben dem Nussbaum wuchs die Weinrebe. Nicht weit von der bescheidenen Trauerweide blühten Kampfer- und Ambra-Bäume. Neben den gigantischen Mammutbäumen wirkten die Rieseneichen wie Zwerge.
Wenn wir unseren Wald von heute mit einem Haus vergleichen, dann war jener Urwald kein einfaches Haus, sondern ein richtiger Wolkenkratzer. In den oberen Etagen dieses Wolkenkratzers war es hell und laut. Bunte Vögel flogen mit Geschrei zwischen Riesenblüten. Affen schaukelten auf den Ästen und sprangen schwingend von einem Baum zum anderen. Da läuft eine Affenherde über die Äste wie über eine Brücke. Die Mütter halten die Jüngsten an die Brust gedrückt und stecken ihnen vorgekaute Früchte und Nüsse in den Mund. Größere Kinder hängen an den Beinen. Ein alter Affe mit zottigem Fell klettert flink den Stamm hinauf, und die ganze Herde eilt hinter ihm her.
Was sind denn das für Affen? Wir finden sie heute in keinem Zoologischen Garten. Es sind jene Affen, von denen gleichermaßen die Vorfahren des Menschen, des Schimpansen und des Gorillas abstammen. Es sind unsere Wald- und Baumvorfahren.
Unsere Ahnen wohnten in den oberen Stockwerken. Sie lebten in der Höhe, mehrere Dutzend Meter über dem Boden, wie auf Brücken, Galerien und Terrassen. Der Wald war ihr Haus. Die Nacht verbrachten sie in einem Nest aus Zweigen, in den Astgabeln der Bäume. Der Wald war zugleich ihre Festung. Oben auf den Bäumen waren sie sicher vor den dolchscharfen Eckzähnen ihres Erzfeindes, des Tigers Machairod.
Der Wald war ihre Speisekammer. Dort auf den Zweigen hing ihre Nahrung: Früchte und Nüsse. Um aber unter dem Dach des Waldes zu leben, musste man an Ästen hängen, Stämme erklettern, von Baum zu Baum springen, Früchte greifen und pflücken und Nüsse aufbrechen können. Dazu brauchte man eine Greifhand, ein scharfes Auge und harte Zähne.
So war unser Vorfahr nicht nur mit einer Fessel, sondern mit vielen Fesseln an den Wald gebunden, und zwar nicht an den Wald im Allgemeinen, sondern an dessen obere Regionen.
Wie kam es nun dazu, dass der Mensch diese Ketten sprengte? Wie fand das Waldtier den Mut, aus seinem Käfig auszubrechen, herauszutreten aus den Grenzen des Waldes?
Dazu müssen wir sowohl die entfernten Vorfahren unseres Protagonisten als auch seine nächsten Verwandten ermitteln. Wir gehen an den Ort, an dem er das Licht der Welt erblickte, werden erkunden, wie er gehen, sprechen und denken lernte. Wir verfolgen seine ersten Ideen und Vorstellungen von der sichtbaren Welt und dem darüber hängenden Himmel, seinen Lebenskampf; wir verfolgen, wie er die Fesseln und unsichtbaren Mauern überwand, erfahren von seinem Unglück, seinen Freuden, seinen Siegen, seinen Niederlagen.
Aber hier, ganz zu Anfang, stoßen wir auf große Schwierigkeiten.
Wie sollen wir die Ahnin des Helden beschreiben – jene Großmutter-Äffin, von der wir unsere Familie herleiten –, da sie doch schon lange nicht mehr auf der Welt ist? Ihr Porträt ist uns nicht erhalten, da die Affen bekanntlich nicht zeichnen können. Jene Begegnung mit unseren Vorfahren kann nur in einem Museum stattfinden. Aber auch im Museum ist es nicht möglich, unsere Großmutter im Ganzen zu sehen, da von ihr nur einige Knöchlein und zwei Handvoll Zähne übriggeblieben sind, die an verschiedenen Orten Afrikas, Asiens und Europas gefunden wurden. Gewöhnlich besitzen die Großmütter keine Zähne, hier sind die Zähne ohne Großmütter.
Besser steht es mit den übrigen Verwandten unseres Protagonisten, mit seinen „Cousins“ und „Schwestern“. Seit jener Zeit nämlich, da der Mensch aus dem Tropenwald herausgetreten ist und auf seinen beiden Füßen steht – im wahrsten Sinne des Wortes –, sind seine nächsten Verwandten, die Gorillas, Schimpansen, Gibbons und Orang-Utans, wilde Waldbewohner geblieben. Der Mensch wird nicht gern an seine armen Verwandten erinnert. Manchmal versucht er sogar voller Empörung, sie zu verleugnen. Es gibt Leute, die jede Anspielung darauf, dass der Mensch und der Schimpanse die gleiche Ur-Großmutter hatten, als Verleumdung betrachten.
Das riecht nach einer Verleumdungsklage. Und tatsächlich: Vor rund 80 Jahren kam es wegen dieser Angelegenheit in den USA zu einem Gerichtsverfahren. Man verurteilte einen Volksschullehrer, weil er den Mut gehabt hatte, den Kindern von der Verwandtschaft des Menschen mit den Affen zu berichten. Im Gerichtssaal erschienen mehrere honorige Bürger mit Armbinden, auf denen stand: „Wir sind keine Affen, und wir lassen uns nicht zu Affen machen.“
Der arme Volksschullehrer, der diese Esel und Affen ja gar nicht verwandeln wollte, war von den auf ihn niederhagelnden Beschuldigungen zutiefst erschüttert. Während er auf die drohenden Fragen des Richters antwortete, dachten Freunde von ihm: „Ist der Richter denn verrückt geworden? Ebenso gut könnte man ja auch fürs kleine Einmaleins verurteilt werden!“
Die Verhandlung wurde nach allen Regeln der juristischen Kunst geführt. Zeugen wurden vernommen, dem Angeklagten ein letztes Wort gewährt. Und endlich verlas der Richter das Urteil:
„1. Es wird festgestellt, dass Mensch und Affe nicht miteinander verwandt sind.
2. Der Lehrer hat eine Strafe von hundert Dollar zu zahlen.“
So hob der amerikanische Richter die ganze Wissenschaft über die Entstehung des Menschen kurzerhand auf, die von Darwin und anderen Denkern und Forschern geschaffen und von nachfolgenden Forschergenerationen bis heute weiterentwickelt wurde. Aber die Wahrheit ist starrköpfig, sie lässt sich durch Gerichtsurteile nicht aufheben. Wären heutzutage zu dieser Verhandlung Wissenschaftler eingeladen worden, so hätten sie mit Hunderten von Tatsachen bewiesen, dass der Volksschullehrer im Recht war, und dass nicht jeder Richter Recht sprechen kann, wenn Fragen der Wissenschaft verhandelt werden. Andererseits hätten heutige Kritiker der Evolutionstheorie mit klug klingenden Worten das einfache Urteil jenes einfachen US-Richters von damals irgendwie rechtfertigt.
Wir wollen hier noch nicht auf die Motivationslage beider Seiten eingehen, denn wir befinden uns im Moment lediglich auf der Vorstufe einer viel weitergehenden Erkenntnis. Auch Grundsatzfragen sind im Moment nicht zu klären. Es mag sicher jetzt schon äußerst interessant sein zu fragen, wer Gott geschaffen hat, ob also hinter dem „Schöpfer“ ein weiterer „Schöpfer“ steht – und hinter diesem wiederum eine unendliche Zahl vorangegangener Schöpfungsakte mit jeweiligen „Urschöpfern“. Doch üben wir uns in Geduld.
Wir könnten hier das ganze Buch mit unzähligen Beweisen für die Verwandtschaft von Mensch und Affe füllen. Aber sogar ohne alle wissenschaftlichen Überlegungen ist die Familienähnlichkeit zwischen Mensch und Affe für jeden ersichtlich, der sich auch nur eine Stunde in der Gesellschaft eines Schimpansen oder Orang-Utans befunden hat.
Vielleicht erinnern sich einige Leser an eine Studie aus der Jetztzeit, vor ca. 90 Jahren:
Es handelt sich um das erste und altbekannte Pawlow‘sche Experiment im Laboratorium von Koltuschi mit den beiden Schimpansen Rafael und Rosa. Inzwischen wurden mehrere gleichartige Experimente mit den gleichen Erkenntnissen durchgeführt. Gewöhnlich sind die Menschen nicht sehr gastfreundlich zu ihren armen Verwandten aus dem Wald; man bringt sie sofort hinter Gittern. Hier aber, in Koltuschi, begrüßte man die Gäste aus den Wäldern Afrikas mit zuvorkommender Herzlichkeit. Man stellte ihnen eine ganze Wohnung zur Verfügung, mit Schlaf-, Speise- und Badezimmer sowie mit einem Spiel- und Aufenthaltsraum. Ins Schlafzimmer brachte man bequeme Betten mit Nachttischchen daneben. Im Speisezimmer wurde der Tisch mit einem weißen Tischtuch gedeckt und das Buffet mit Speisen gefüllt.
Nichts in dieser gemütlichen Wohnung erinnerte daran, dass die Bewohner keine Menschen, sondern Affen waren. Zum Essen standen Teller mit Löffeln auf dem Tisch. Für die Nacht wurden die Betten abgedeckt und die Kissen sorgfältig aufgeschüttelt. Manchmal benahmen sich die Gäste allerdings nicht so, wie es sich gehört. Beim Essen legten sie die Löffel weg und schlürften einfach das Kompott aus dem Teller. Beim Einschlafen legten sie nicht den Kopf auf das Kissen, sondern das Kissen auf den Kopf. Und doch benahmen sich Rosa und Rafael, wenn auch nicht ganz, so doch fast wie Menschen.
Rosa konnte zum Beispiel nicht schlechter als irgendeine Hausfrau mit den Schlüsseln des Buffets umgehen. Gewöhnlich befanden sich die Schlüssel in der Tasche des Wärters. Rosa schlich sich unbemerkt von hinten an ihn heran und steckte die Hand in seine Tasche. Im nächsten Moment war sie im Speisezimmer vor dem Buffet. Sie klettert auf einen Stuhl und steckt behutsam den Schlüssel ins Schlüsselloch. Hinter dem Glastürchen liegen auf einer Schale leuchtend gelbe Aprikosen und verlockende Weintrauben. Ein rascher Griff, und die Trauben sind in Rosas Händen.
Jetzt beobachten wir Rafael bei seiner Beschäftigung: Als Lehrmittel dienen ein Eimerchen voller Aprikosen und verschiedene Würfel. Diese Würfel sind viel größer als jene, mit denen sonst die Kinder spielen. Der größte ist so hoch wie ein Schemel, der kleinste nicht niedriger als eine Fußbank. Das Aprikoseneimerchen hängt oben an der Decke, und die Aufgabe besteht darin, die Aprikosen zu erreichen und aufzuessen.
Zunächst vermochte Rafael diese schwere Aufgabe nicht zu lösen. In seiner Heimat war er oft auf Bäume geklettert, um Obst zu pflücken. Hier aber hingen die Früchte nicht an einem Ast, sondern in der Luft. Außer Würfeln gab es nichts, worauf er hätte klettern können. Aber auch vom größten Würfel aus konnte er nicht bis zu den Aprikosen langen.
Während Rafael die Würfel hin und her drehte, machte er ganz ZUFÄLLIG eine Entdeckung: Stellte er zwei Würfel aufeinander, so kam er den Aprikosen etwas näher. Allmählich baute Rafael eine Pyramide aus drei, vier, schließlich aus fünf Würfeln. Das war gar nicht so einfach. Man konnte die Würfel nicht beliebig aufeinanderstellen, sondern sie mussten eine bestimmte Reihenfolge haben: zuunterst große, dann kleinere, oben ganz kleine.
Oft machte Rafael den Fehler, die größeren Würfel auf kleinere zu stellen. Dann begann die ganze Konstruktion bedenklich zu wackeln. Im nächsten Augenblick drohte die ganze Pyramide mit Rafael zusammenzustürzen. Dazu kam es aber nicht, da Rafael geschickt wie ein Affe war. Bald war die Aufgabe gelöst. Er hatte alle sieben Würfel der Größe nach aufeinandergestellt, so, als hätte er die angeschriebenen Nummern lesen können – was natürlich nicht der Fall war.
Endlich, auf der Spitze der Pyramide, hält er nun das Eimerchen und frisst mit größtem Vergnügen die ehrlich verdienten Aprikosen. Welches andere Tier vermag sich so menschenähnlich zu benehmen? Könnte man einem Hund den Bau einer Pyramide zutrauen? Und dabei ist doch der Hund ein äußerst verständiges Tier.
Wenn Rafael „arbeitet“, ist seine Menschenähnlichkeit geradezu verblüffend. Er packt einen Würfel, nimmt ihn auf die Schulter und trägt ihn zur Pyramide. Aber der Würfel passt nicht. Da stellt er ihn auf die Erde, setzt sich darauf und überlegt. Nachdem er sich erholt hat, fängt er von vorne an – und vermeidet den begangenen Fehler.
Wenn dem aber so ist, könnte man dann nicht dem Schimpansen beibringen, menschlich zu gehen, zu denken, (an Gott zu glauben) und zu arbeiten? Dies zu erreichen war der Traum des berühmten Dresseurs Durow. Er ließ seinem Liebling Mimus die denkbar sorgfältigste Erziehung zuteilwerden, und Mimus erwies sich als ein sehr verständiger Schüler: Er lernte den Löffel richtig zu benützen, sich eine Serviette umzubinden, auf dem Stuhl zu sitzen, beim Suppe essen keine Flecken zu machen und schließlich auf einem Schlitten den Berg hinunter zu rodeln.
Und doch ist aus Mimus kein Mensch geworden.
Das war auch nicht anders zu erwarten. Denn die Wege des Menschen und des Schimpansen haben sich vor langer Zeit voneinander getrennt. Die Vorfahren des Menschen stiegen von den Bäumen auf die Erde hinab, begannen auf zwei Füßen zu gehen und mit den Händen zu arbeiten. Dagegen blieben die Vorfahren des Schimpansen auf den Bäumen und passten sich dem dortigen Leben noch weiter an.
Daher ist der Schimpanse auch anders gebaut als der Mensch. Er hat andere Hände, andere Füße, kein solches Gehirn und nicht die gleiche Zunge. Sehen wir uns die Hand des Schimpansen an: Sie ist anders eingerichtet als die des Menschen. Der Daumen steht nicht so weit seitwärts wie beim Menschen, und er ist kleiner als dessen kleiner Finger. Bei uns ist der Daumen der wichtigste in jenem Team von fünf Arbeitern, die man die Hand nennt. Er vermag mit jedem einzelnen der übrigen vier und mit allen gemeinsam zu arbeiten. Deshalb kann unsere Hand so geschickt mit den verschiedenartigsten Werkzeugen umgehen.
Wenn sich der Schimpanse eine Frucht pflücken will, hält er sich häufig mit den Händen an einem Ast fest, um mit dem Fuß danach zu greifen. Geht er dagegen auf der Erde, so stützt er sich auf die zusammengebogenen Finger der Hände. Er benützt also oft seine Hände als Füße und die Füße als Hände. Aber nicht nur die Verschiedenartigkeit im Bau der Hände und Füße, sondern noch etwas anderes, sehr Wichtiges lassen jene Dresseure außeracht, die aus Schimpansen Menschen zu machen suchen. Sie vergessen, dass das Gehirn des Schimpansen viel kleiner und unkomplizierter ist als das des Menschen.
Pawlow, der während langer Jahre die Arbeitsweise des menschlichen Gehirns studiert hatte, beobachtete mit dem größten Interesse das Benehmen seiner Gäste Rosa und Rafael. Er verbrachte lange Zeit im Affenstall, studierte ihr Verhalten und stellte fest, dass es ungeordnet und weitgehend verständnislos war. Ehe sie eine Sache beendeten, begannen sie schon eine neue.
Voller Ernstes sehen wir Rafael damit beschäftigt, seine Pyramide zu bauen. Plötzlich bemerkt er einen Ball, wirft die Würfel um und lässt den Ball zwischen dem Boden und seiner langen, behaarten Hand hin- und herspringen. Im nächsten Augenblick ist der Ball vergessen: Rafaels ganze Aufmerksamkeit gilt einer Fliege, die am Boden kriecht. In den chaotischen Handlungen des Affen spiegelt sich deutlich die chaotische Arbeit seines Gehirns, während die Arbeit des menschlichen Gehirns gar nicht ungeordnet, sondern gesammelt und konzentriert ist. Und doch ist der Affe dem Leben im Wald ausreichend angepasst und besitzt genug Verständigkeit für jene Welt, an die er durch viele unsichtbare Ketten gebunden ist.
Einmal kam ein Filmregisseur in die Wohnung von Rosa und Rafael, um die Beiden zu filmen. Nach seinem Drehbuch sollten die Affen für kurze Zeit aus dem Haus gelassen werden. Kaum waren sie frei, kletterten sie sofort auf einen nahen Baum und begannen voller Begeisterung, mit den Händen an einem Ast hängend, zu schaukeln. Auf dem Baum fanden sie es viel gemütlicher als zu Hause in ihrer gut eingerichteten Wohnung.
In Afrika lebt der Schimpanse in den oberen Stockwerken des Waldes. In den Zweigen baut er sich sein Nest. Er klettert auf den Baum, wenn er vor einem Feind flüchtet. Auf dem Baum findet er sein Essen – Früchte und Nüsse. Er hat sich den Bäumen so angepasst, dass er sich auf einem senkrechten Stamm viel besser bewegt als auf ebener Erde. Wo kein Wald ist, findet man auch keine Schimpansen.
In den 1980er-Jahren flog eine Forscherin nach Kamerun in Afrika, um wieder einmal das Leben der Schimpansen in ihrer Heimat zu studieren. Sie fing zehn Schimpansen ein und siedelte sie in der Nähe ihres Hauses im Wald an, so dass sie sich ganz ungestört fühlten. Damit sie nicht weglaufen konnten, baute sie ihnen einen unsichtbaren Käfig. Zur Herstellung dieses Käfigs genügte ein Werkzeug: eine Motorsäge. Die Holzfäller brauchten nur die Bäume rings um eine abgesteckte Fläche zu fällen, so dass eine kleine Wald-Insel inmitten einer Lichtung übrigblieb. In dieses Wäldchen kamen die Affen.
Die Berechnung der Forscherin war richtig. Der Affe ist ein Waldtier. Freiwillig würde er den Wald nicht verlassen. So wie es dem Eisbären unmöglich ist, in der Wüste zu leben, so kann ein Affe nicht auf einer Lichtung existieren.
Aber wenn der Schimpanse den Wald nicht verlassen kann, wie gelang dies seinem Verwandten, dem Menschen?
Unsere Waldvorfahren verließen ihren Käfig nicht innerhalb eines Tages oder eines Jahres. Hunderttausende von Jahren vergingen, bis sie sich soweit frei gemacht hatten, dass sie aus dem Wald in die Steppe und auf die wenig bewachsene Ebene hinaustreten konnten. Wenn es einem Baumtier gelingen sollte, die Kette, die es an den Wald fesselte, zu zerreißen, musste es vor allem vom Baum herabsteigen und lernen, auf ebener Erde zu gehen.
Auch heute fällt es dem Menschen schwer, gehen zu lernen. Wer von uns kennt sie nicht, die Kriechkinder aus der Krabbelstube. Krabbelkinder sind Kinder, die nicht mehr an ihrem Platz bleiben wollen, aber noch nicht gehen können. Es dauert fast einen Monat (bei einigen etwas kürzer, bei anderen etwas länger), bis sich das kriechende Kind in einen Fußgänger verwandelt hat. Aufrecht zu gehen, ohne sich mit den Händen auf den Boden zu stützen oder sich an anderen Gegenständen festzuhalten, ist gar nicht einfach. Da hat es das Fohlen und fast alle anderen Tiernachkömmlinge einfacher. Hierin wiederspiegelt sich unser Jahrtausende langer Kampf ums aufrechte Gehen.
Gehen zu lernen ist viel schwieriger, als Rad fahren zu lernen. Während ein Kind Monate braucht, um sicher aufrecht laufen zu lernen, brauchten unsere Vorfahren zu diesem wichtigen Entwicklungsschritt Jahrtausende. Zu jener Zeit, als unsere Ahnen noch auf Bäumen lebten, geschah es zuweilen, dass sie auf den Boden hinabstiegen. Und es ist möglich, dass sie sich dabei nicht immer mit den Händen auf die Erde stützten, sondern zwei oder drei Schritte nur auf den Hinterbeinen machten, wie das der Schimpanse manchmal tut. Aber es sind zwei ganz verschiedene Dinge, zwei, drei Schritte zu machen – oder fünfzig oder hundert.
Als unsere Vorfahren noch auf den Bäumen lebten, lernten sie schon, die Hände anders zu gebrauchen als die Füße. Mit den Händen griffen sie nach Früchten und Nüssen, bauten sie ihre Nester auf den Stämmen. Die gleiche Hand aber, die eine Nuss greifen konnte, vermochte auch einen Stein und einen Stock zu greifen. Und einen Stein oder einen Stock in der Hand zu halten, das bedeutete eine KRÄFTIGERE und LÄNGERE Hand.
Mit einem Stein kann man eine Nuss zerschlagen, deren Schale so hart ist, dass die Zähne sie nicht mehr aufknacken können. Mit dem Stock vermag man in der Erde nach essbaren, proteinhaltigen Wurzeln zu graben. Und nun begann der Menschenvorfahr, sich die Nahrung immer häufiger mit den neuen Hilfsmitteln zu verschaffen. Mit dem Stock grub er aus der Erde Knollen und Wurzelgemüse. Mit Hilfe des Steines zerbröckelte er morsche Baumstümpfe und verschaffte sich die Larven von Insekten.
Aber damit die Hände arbeiten konnten, mussten sie von anderen Tätigkeiten freigehalten werden. Je mehr die Hände beschäftigt waren, desto häufiger mussten die Füße versuchen, allein zu gehen. So wurden die Füße von der Hand gezwungen, gehen zu lernen, und die Hand wurde von den Füßen vom Gehen befreit, um arbeiten zu können. Auf der Erde erschien ein neues Wesen, das es früher nicht gegeben hatte, das sich auf den Hinterbeinen bewegte und mit den Vorderbeinen arbeitete.
Äußerlich war dieses Wesen einem Tier sehr ähnlich. Aber könntet ihr sehen, wie es mit einem Stock oder einem Stein hantierte, würdet ihr sofort sagen: Dieses Tier müsste man eigentlich als einen vorzeitlichen Menschen bezeichnen. In der Tat, nur der Mensch versteht es, mit Werkzeugen umzugehen. Tiere haben keine Werkzeuge.
Wenn eine Springmaus oder ein Maulwurf in der Erde graben, so tun sie das nicht mit einem Spaten, sondern mit ihren eigenen Pfoten. Wenn eine Maus die Wurzel eines Baumes durchschneidet, so tut sie das nicht mit einem Messer, sondern mit ihren Zähnen. Und wenn der Specht die Borke des Baumes abmeißelt, so benutzt er keinen Meißel, sondern seinen Schnabel.
Unser Vorfahre hatte weder einen Meißel-Schnabel noch Spaten-Pfoten noch Nagezähne, scharf wie Messer. Er hatte etwas viel Besseres als alle Schneide- und Eckzähne. Er hatte seine Hand, mit der er sich aus einem vom Boden aufgelesenen Stein eine Schneide und aus einem vom Baum gebrochenen Ast einen Grabstock machte.
Während all dieser Ereignisse änderte sich allmählich auf der Erde das Klima. Vom Norden rückte das Eis langsam nach Süden vor. Die Berge drückten sich die Schneekappen tiefer in die Stirn. Dort, wo unsere Waldvorfahren lebten, wurden die Nächte immer kühler, die Winter immer kälter. Noch war das Klima warm, aber man konnte es nicht mehr heiß nennen. Auf den Nordabhängen der Hügel machten die immergrünen Palmen, Magnolien und Lorbeerbäume den Eichen und Linden Platz. Noch heute findet man in den Strandablagerungen Abdrücke von Eichen- und Lindenblättern, die irgendwann durch starke Regefälle in die Flüsse gespült wurden.
Der Urmensch mied die kalten Winde, er zog sich in Höhlen auf den südlichen Abhängen zurück, wo noch Feigenbaum und Weinstock wuchsen. Die Grenze der tropischen Wälder zog sich immer weiter nach Süden zurück. Und gemeinsam mit diesen Wäldern zogen auch ihre Bewohner. Der urzeitliche Elefant ging fort, und immer seltener wurde der Säbeltiger Machairod.
Wo einst undurchdringliches Dickicht war, traten die Bäume auseinander und bildeten Lichtungen, auf denen gigantische Hirsche und Nashorne weideten. Manche Affen zogen fort, andere starben aus. Im Wald fanden sich immer weniger Weintrauben, immer seltener wurden die Feigen- und Nussbäume. Es war auch nicht mehr so leicht, sich durch den Wald zu bewegen. Er lichtete sich: von einer Baumgruppe zur anderen konnte man nicht mehr springen, man musste über die Erde laufen. Für einen Baumbewohner war das nicht ohne Gefahr. Jeden Augenblick konnte es geschehen, dass ihn die Zähne irgendeines flinkeren Raubtieres packten.
Aber da war nichts zu machen. Der Hunger jagte unsere Vorfahren von den Bäumen. Immer häufiger mussten sie auf die Erde steigen und dort auf Nahrungssuche gehen. Was bedeutet es aber für ein lebendiges Wesen, aus seinem gewohnten Käfig heraus zu treten, aus der Welt des Waldes, an die es sich Jahrtausende lang angepasst hat?
Es bedeutet die Durchbrechung der Gesetze des Waldes, die Zerreißung der Ketten, die das Tier an seinen Platz in der Natur fesseln.
Gewiss verändern sich auch Land- und Wassertiere und Vögel. Nichts in der Welt ist unveränderlich. Aber es ist nicht so einfach, sich zu verändern. Millionen Jahre vergingen, ehe jenes Waldtierchen mit den Krallen an den Pfoten zum Pferd wurde. Jedes Kind unterscheidet sich nur wenig von seinen Eltern. Viele Generationen sind nötig, damit sich eine neue Art bildet, die sich von der früheren unterscheidet.
Nun, und unsere Vorfahren?
Wenn es ihnen nicht gelungen wäre, ihre Tätigkeiten und Gewohnheiten zu ändern, so wären sie genötigt gewesen, gemeinsam mit den Affen nach Süden zu ziehen. Zu jener Zeit aber unterschieden sie sich von den Affen schon dadurch, dass sie sich ihre Nahrung mit Hilfe von künstlichen „Eckzähnen“ und „Krallen“ verschaffen konnten, die sie aus Steinen und Ästen machten. Notfalls konnten sie ohne jene saftigen Südfrüchte auskommen, die in den Wäldern immer seltener wurde. Dass sich die Wälder lichteten, war daher für sie nicht so schlimm. Da sie auch schon gelernt hatten, auf den Füßen zu laufen, hatten sie keine Angst mehr vor den offenen, unbewaldeten Stellen. Und wenn ihnen ein Feind begegnete, begann die ganze Horde der Urmenschen sich mit Steinen und Stöcken zu verteidigen. Die harten Zeiten, die unser affenähnlicher Vorfahr durchmachte, konnten ihn weder vernichten noch zwingen, sich gemeinsam mit den tropischen Wäldern zurückzuziehen; sie beschleunigten nur seine Umwandlung zum Menschen.
Und was geschah mit jenem Teil unserer Vorfahren, die Affen blieben? Sie blieben Waldbewohner und wichen mit den Wäldern nach Süden aus. Da sie die Entwicklung der Urmenschen nicht durchgemacht hatten, konnten sie keine Werkzeuge benutzen. Die geschicktesten unter ihnen lebten weiterhin in den obersten Etagen der Wälder, lernten noch besser auf den Bäumen zu klettern und sich an den Ästen schwingend zu bewegen.
Ganz anders war das Schicksal der Affen, die nicht so flink waren und sich dem Baumleben nicht weiter anpassen konnten. Von ihnen sind nur die größten und kräftigsten am Leben geblieben. Aber je massiger und größer ein Tier war, desto schwerer fiel es ihm, auf dem Baum zu leben. Wohl oder übel mussten diese großen Affen auf die Erde herunterkommen. So leben zum Beispiel auch die heutigen Gorillas in den unteren Stockwerken des Waldes. Gegen Feinde verteidigen sie sich auf der Erde, aber nicht mit Steinen und Stöcken, sondern mit riesigen Eckzähnen, mit denen ihre mächtigen Kiefer bewaffnet sind.
So gingen die Wege des Menschen und seiner verschiedenen Verwandten auseinander.
In der nächsten Vorlesung werden wir erkunden, wie die Urmenschen wohnten, wie sie arbeiteten und lebten – und dann schon nähern wir uns zusehends jenem Zustand, in dem sie sich ihrer selbst, ihrer Eigenexistenz bewusst werden und sich als Schöpfer von Werkzeugen und „Produkten“ begreifen – lasst uns erkunden, ob wir vielleicht hier auf die Spur des Schöpfungsgedankens kommen. Aber nicht zu stürmisch, bitte. Noch befinden wir uns Jahrtausende vor diesen Entwicklungen …
Vorlesung 3
Bisher beschäftigten wir uns mit der Umwelt und den Vorfahren und Seitenlinien des Urmenschen, mit den Schimpansen, Gorillas und anderen Affen. Wir verfolgten ihre Lebenswege bis zu dem Zeitpunkt vor 5 Millionen Jahren, als sich die Wege des Menschen und seiner verschiedenen Verwandten trennten. Die Haupttrennlinie war folgende: Durch den Rückzug des Waldes nach Süden waren jene Affen, die ausschließlich auf den Bäumen wohnten und Hände und Füße gleichermaßen zum Laufen und Pflücken nutzten, gezwungen dem Umzug des Waldes zu folgen, während jene Wesen, die bereits durch die Freigabe ihrer Hände das Laufen und Benutzen von Hilfswerkzeugen gelernt hatten, in der Lage waren, auch auf dem Boden, in der Steppe, ihr Auskommen und ihren Schutz zu finden. Ich sage „gelernt hatten“ und meine: „lernen mussten“ und nicht „lernen konnten“, denn selbst dies, die Freigabe der Hand durch die Unabhängigkeit des Fußes, war durchaus kein freiwilliger Akt, sondern ein durch die Umstände bedingter Zwang.
Heute und in der Folgevorlesung wollen wir erkunden, wie die Urmenschen lebten, wie sie wohnten und arbeiteten, wie sie den Gebrauch des Feuers und damit hochwertigere Proteine entdeckten, wie sich dadurch und durch die aufrechte Haltung und durch den Blick in die Ferne und durch das Fertigen immer komplizierterer Werkzeuge in Hunderttausenden von Jahren ihr Gehirn weiterentwickelte. Im später folgenden Vorlesungen geht es sodann um die Fragen, die uns immer näher und näher an unser Thema heranführen: Wie sich der Mensch als Produzent selbst entdeckte. Wie er sich des Unterschieds zu den anderen Lebewesen bewusst wurde. Wie er die Zeit entdeckte und wie er die planetarischen Weltuhren, Sonne und Mond, als lebenswichtige „Lebewesen“ empfand und sie verehrte. Wie er seine Lebensmittel bewusst entdeckte, wie er sie anzubauen, zu schätzen und zu ehren wusste und wie er diesen Lebensmitteln erste Opfergaben darbrachte. Noch kennt er keine Götter, noch reicht weder seine Phantasie noch sein Wissen so weit, dass er „andere Lebewesen“ hinter allem vermutet. Aber dann lernt er nachbarschaftliche Verwandtenstämme kennen und beginnt zu ahnen, dass seine Welt aus mehr als nur ihm und dem Ort seiner Geburt besteht. Nun stehen unsere Vorfahren kurz vor der Geburt Gottes.
Der Mensch lernte nicht plötzlich auf zwei Füßen zu gehen. In der ersten Zeit ging er wahrscheinlich nur zeitweilig und unbeholfen aufrecht. Wie hat der Mensch – oder richtiger: der Affenmensch – damals ausgesehen? Lebend ist der Affenmensch nirgends erhalten geblieben. Aber sind nicht wenigstens seine Knochen erhalten?
Wenn man diese Knochen nur finden würde, fragten sich bereits vor rund 160 Jahren die Zoologen, die Biologen, Archäologen und Philosophen, dann könnte man endgültig beweisen, dass der Mensch vom Affen abstammt. Der Affenmensch ist der urälteste Mensch, das Verbindungsglied in jener Kette, die vom Affen zum heutigen Menschen führt. Und dieses Glied soll spurlos in Lehm und Sand, in den Ablagerungen der Flüsse verloren gegangen sein?
Die Archäologen verstehen sich darauf, in der Erde herumzuwühlen. Aber bevor man zu graben anfängt, muss man wissen, wo man graben soll, wo dieses verschwundene Kettenglied zu suchen ist. Es ist wohl noch schwieriger, die Knochen des Urmenschen in der Erde als eine Stecknadel im Heuhaufen zu suchen. Am Ende des 19. Jahrhunderts hat der Naturforscher Ernst Haeckel erstmals die Vermutung ausgesprochen, dass die Knochen des Affenmenschen – oder, in der Sprache der Wissenschaft: des Pithekanthropus – wahrscheinlich in Südasien zu finden wären. Und er bezeichnete auch die Gegend, in der nach seiner Meinung die Knochen des Pithekanthropus erhalten sein könnten: die Malaiischen Inseln.
Haeckels Gedanke schien vielen zu schwach begründet. Aber es fand sich doch einer, der so fest daran glaubte, dass er alles stehen und liegen ließ und beschloss, nach dem Malaiischen Archipel zu reisen, um den dort vermuteten Pithekanthropus zu suchen. Das war Dr. Eugen Dubois, der bis dahin Vorlesungen über Anatomie an der Amsterdamer Universität gehalten hatte. Viele seiner Arbeitskollegen und die Professoren der Universität schüttelten die Köpfe: Ein Mensch mit normalen geistigen Fähigkeiten dürfe doch nicht so leichtfertig sein. Es waren eben würdevolle Leute, und die einzige Reise, die sie dazumal zu machen pflegten, war der tägliche Weg durch die ruhigen Amsterdamer Straßen mit dem Regenschirm in der Hand von Zuhause in die Universität und zurück.
Um seinen kühnen Gedanken zu verwirklichen, verließ Dubois die Universität, trat als Militärarzt in den Dienst der holländischen Kolonialtruppen und fuhr von Amsterdam ans „Ende der Welt“ – nach der Insel Sumatra. Sobald er dort angekommen war, machte er sich auf die Suche. Ganze Berge wurden nach seinen Anweisungen umgegraben und durchwühlt. Es verging ein Monat, ein zweiter, ein dritter, aber die Knochen des Pithekanthropus waren nicht zu finden.
Wenn ein Mensch sucht, was er verloren hat, so weiß er wenigstens, dass der verlorene Gegenstand irgendwo ist und dass man ihn bei genügend eifrigem Suchen finden kann. Dubois aber war wesentlich schlechter dran: Er konnte ja nicht mit Sicherheit behaupten, sondern nahm nur an, dass die Knochen des Pithekanthropus existierten. Dennoch setzte er seine Suche mit unerschütterlicher Hartnäckigkeit fort. Es vergingen ein, zwei, drei Jahre, aber das verschwundene Zwischenglied war noch immer nicht gefunden. Jeder andere hätte die vergebliche Suche längst aufgegeben. Dubois plagten zwischenzeitlich Zweifel. Aber er gehörte nicht zu den Menschen, die sich von einmal gefassten Entschlüssen so leicht abbringen lassen.
Da Dubois den Pithekanthropus in Sumatra nicht fand, beschloss er, sein Glück auf einer anderen Insel des Malaiischen Archipels zu versuchen – auf Java.
Und hier hatte er endlich Glück.
Unweit des Dorfes Trinil fand er eine Schädeldecke, den Rest eines Unterkiefers, einige Zähne und einen Schenkelknochen des Pithekanthropus. Später wurden noch einige Fragmente von Schenkelknochen gefunden. Dubois versuchte, das Gesicht seines Ahnen zu rekonstruieren und man erkannte eine niedrige, nach hinten fliehende Stirn, dicke Augenbrauenbögen, unter denen die Augen geschützt lagen. Dieses Gesicht ähnelte eher dem eines Affen als dem eines Menschen – aber es war eben auch kein „reines“ Affengesicht mehr. Die nähere Untersuchung der Schädeldecke überzeugte ihn davon, dass der Pithekanthropus klüger gewesen sein musste als ein Affe: sein Gehirn war wesentlich größer als das Gehirn der dem Menschen am nächsten stehenden Affen.
Ein Schädeldach, Zähne, einige Knochentrümmer – das ist nicht viel. Und doch gelang es Dubois, aus diesen Bruchstücken vieles zu rekonstruieren – und er wurde später durch weitere Funde, durch andere Expeditionen und Forscher in allem bestätigt. Die heutige DNA-/RNA-Forschung bestätigt all diese „Hardware“-Funde. Als Dubois den Schenkel und die kaum sichtbaren Ansatzstellen der Muskeln und Sehnen untersuchte, kam er zu dem Schluss, dass der Pithekanthropus zur Not auf zwei Beinen zu gehen vermochte. Das ist schon kein Affe mehr, aber auch noch kein richtiger Mensch. Dubois beschloss, seinem Findling einen Namen zu geben und taufte ihn: „Pithekanthropus erectus“, der Aufrechte. Im Vergleich mit den Affen ging er tatsächlich – wie sich im Fortgang der Funde bestätigte – aufrecht.
Das Ziel schien erreicht. Pithekanthropus war gefunden. Aber nun begannen gegen Ende des 19. Jahrhunderts für Dubois erst die schwierigsten Tage und Jahre. Es ist leichter, sich durch eine zähe Lehmschicht hindurch zu graben, als die Zähigkeit menschlichen Aberglaubens und menschlicher Vorurteile mit Jahrtausende alter Prägungs- und Glaubenstradition zu durchdringen. Alle jene, die nicht anerkennen wollten, dass der Mensch vom Affen abstammt, begegneten Dubois‘ Entdeckung mit zahlreichen Einwänden. Archäologen in Priesterröcken suchten zu beweisen, dass der Schädel, den Dubois gefunden hatte, dem Gibbon-Affen gehöre und dass der Schenkel der eines gewöhnlichen Menschen sei. So verwandelten Dubois‘ Gegner den Affenmenschen in die arithmetische Summe eines Affen und eines Menschen, und selbst dabei ließen sie es nicht bewenden. Sie zogen das Alter des Fundes in Zweifel und behaupteten, die von Dubois gefundenen Knochen hätten nicht viele hunderttausend, sondern nur wenige Jahre in der Erde gelegen. Mit einem Wort, man tat alles, um den Pithekanthropus aufs Neue zu begraben, ihn wieder in die Erde einzuscharren und der Vergessenheit anheimfallen zu lassen.
Dubois verteidigte sich tapfer. Diejenigen, denen die Bedeutung seiner Entdeckung für die Wissenschaft einleuchtete, unterstützten ihn. Er antwortete seinen Gegnern, dass der Pithekanthropus-Schädel keineswegs dem Gibbon gehören könne: der Gibbon besitzt keine Stirnhöhlen. Beim Pithekanthropus aber sind sie vorhanden.
Die Jahre vergingen, und die Echtheit des Pithekanthropus wurde noch immer bezweifelt. Da fanden die Naturwissenschaftler plötzlich einen neuen Affenmenschen, ganz ähnlich dem Pithekanthropus. 1912 ging ein Naturforscher durch die Straßen Pekings; er trat in eine Apotheke, um die chinesischen Arzneien kennen zu lernen. Da lagen auf dem Ladentisch sehr sonderbare Sachen: eine Heilwurzel, ganz ähnlich einer menschlichen Figur, die Zähne verschiedener Tiere und allerlei Knochen und Amulette. Unter den Knochen fand der Gelehrte einen Zahn, der keinem Tier gehören konnte, sich aber gleichzeitig von den Zähnen des heutigen Menschen unterschied.
Der Mann kaufte den Zahn und sandte ihn einem europäischen Museum. Dort trug man diesen Fund in den Katalog ein, unter der sehr vorsichtigen Bezeichnung: „Chinesischer Zahn.“
Wieder waren mehr als zwanzig Jahre vergangen, als man in einer Höhle in der Nähe von Peking zwei weitere Zähne fand und schließlich auch ihren Besitzer, den die Naturwissenschaft Sinanthropus nannte. Man fand ihn nicht in einem Stück, sondern als einen Haufen verschiedenartigster Knochen. Hier einige Dutzend Zähne, drei komplette Schädel, elf Kiefer, das Stück eines Schenkels, dort ein Wirbel, ein Schlüsselbein, ein Handgelenk, das Stück eines Fußes.
Das bedeutet natürlich nicht, dass der Bewohner jener Höhle drei Köpfe und nur einen Fuß besaß.
In der Höhle lebte vielmehr nicht nur ein einzelner Sinanthropus, sondern eine ganze Horde. In weit über einhunderttausend Jahren gingen viele Knochen verloren, wurden von wilden Tieren verschleppt. Aber auch die restlichen Knochen genügten, um sich ein Bild vom Aussehen des Bewohners zu machen: Gib den Naturwissenschaftlern einen Finger, sie machen daraus den ganzen Menschen.
Wie sah unser Held in jener längst vergangenen Epoche seines Lebens aus? Jedenfalls war er nach heutigen Maßstäben keine Schönheit (schon gar, wenn wir Heidi Klum zu Rate ziehen). Wäret ihr ihm begegnet, ihr wärt vor Entsetzen zurückgewichen, so sehr glich dieser Mensch einem Affen, vornübergebeugt, mit wildem Gesicht und herabhängenden zottigen Armen. Aber wenn ihr ihn auch im ersten Augenblick für einen Affen gehalten hättet, wärt ihr euch bald über euren Irrtum klar geworden: Der Affe hat keinen solchen aufrechten, menschlichen Gang, kein so menschenähnliches Gesicht.
Endgültig schwinden alle Zweifel, wenn man dem Sinanthropus zu seiner Höhle folgt: Da humpelt er plump auf seinen krummen Beinen am Rand eines Flusses entlang. Plötzlich setzt er sich auf den Sand. Ein großer Stein hat seine Aufmerksamkeit erregt. Er hebt ihn auf, betrachtet ihn, schlägt mit ihm gegen einen anderen Stein. Dann steht er auf und nimmt seinen Fund mit sich. Wir folgen ihm und klettern auf das steile Ufer. Da, beim Eingang zur Höhle, sind alle Bewohner versammelt. Sie drängen sich um einen bärtigen, zottigen Alten, der mit einem steinernen Werkzeug eine Antilope ausweidet. Einige Frauen neben ihm zerreißen das Fleisch mit den Händen, Kinder erbetteln davon ein paar Stücke. Und der Schein eines Lagerfeuers, das im Hintergrund der Höhle brennt, beleuchtet die ganze Szene.
Nun muss jeder Zweifel schwinden: Könnte ein Affe ein Feuer entzünden und ein steinernes Werkzeug gebrauchen?
Aber der Vorlesungsteilnehmer hat ein Recht zu fragen, woher man denn weiß, dass der Sinanthropus den Gebrauch der Werkzeuge und des Feuers kannte. Darüber gibt uns die Höhle Auskunft. Bei den Ausgrabungen fand man nicht nur Knochen, sondern auch vieles andere: eine dicke Schicht Asche, vermischt mit Erde, und einen Haufen grober, steinerner Werkzeuge. Mehr als zweitausend Werkzeuge waren da, und die Aschenschicht war sieben Meter dick.
Man sieht, dass die Sinanthropus-Herde lange Zeit in der Höhle lebte und dass sie das Feuer während vieler Jahre – vielleicht sogar Generationen übergreifend während vieler Jahrzehnte – unterhalten haben musste. Offenbar war der Sinanthropus noch nicht imstande, selbst Feuer zu machen, sondern er sammelte es, genauso, wie er Wurzeln zum Essen und Steine für seine Werkzeuge sammelte. Irgendwo bei einem Waldbrand konnte er das Feuer finden. Der Sinanthropus nahm einen glimmenden Ast und trug ihn behutsam nach Hause. Und hier, in der Höhle, geschützt vor Regen und Wind, bewahrte und hütete er das Feuer als größte Kostbarkeit.
Unser Protagonist nahm den Stein oder den Stock in die Hand. Dadurch wurde er mit einem Mal kräftiger und unabhängiger. Nun war es nicht mehr so wichtig, dass er sich in der unmittelbaren Nähe eines Obst- oder eines Nussbaumes aufhielt. Er entfernte sich auf der Nahrungssuche von seinen heimatlichen Plätzen, suchte immer neue Umgebungen auf, verweilte in waldlosen Gebieten und kostete alles Mögliche, um dabei vielleicht etwas Genießbares und Schmackhaftes zu finden.
So verletzt der Mensch am Beginn seines abenteuerlichen Daseins alle Regeln, die sonst in der Natur gelten. Er verletzt die Regeln seines ursprünglichen „Paradieses“ … ein Paradies, das ihn bis dahin – wie alle Tiere – in unsichtbaren Fesseln gefangen gehalten hatte. Der Waldbewohner steigt von den Bäumen und fängt an, auf der Erde zu laufen. Außerdem hebt er sich auf die Hinterbeine und beginnt zu gehen. Sogar mit der Nahrung, die ihm bislang zustand, begnügte er sich nicht, er verschafft sich neues Essen auf völlig neue Weise.
In der Natur sind alle Pflanzen und Tiere durch „Ketten der Ernährung“ miteinander verbunden. Die Eichhörnchen im Wald fressen Tannensamen und werden selbst von Mardern gefressen. Es ergibt sich eine Kette: Tannensamen, Eichhörnchen, Marder. Außer Tannensamen frisst das Eichhörnchen aber noch manches andere, zum Beispiel Pilze und Nüsse. Und außer vom Marder wird es auch von anderen Raubtieren, zum Beispiel vom Habicht, gefressen. Das ergibt eine zweite Kette: Pilze/Nüsse, Eichhörnchen, Habicht. Durch solche Ketten sind alle Lebewesen miteinander verbunden.
Auch unser Held war bisher Glied einer solchen Kette: Er aß Früchte und wurde selbst vom Tiger gefressen.
Nun beginnt er diese Kette plötzlich zu zerreißen. Er isst Dinge, die er bisher nicht gegessen hat, und weigert sich, weiterhin die Nahrung des Säbeltigers Machairod zu sein, wie es seine Vorfahren Hundertausende von Jahren gewesen sind. Woher nahm er den Mut dazu? Wie konnte er sich entschließen, vom Baum auf die Erde zu steigen, wo ihm die scharfen Zähne der Raubtiere drohten? Das war doch für ihn das Gleiche, wie wenn eine Katze vom Baum herabklettert, während sie unten ein scharfer Hund erwartet.
Diesen Mut bekam der Mensch durch seine Hand. Der gleiche Stein oder Stock, der zur Beschaffung der Nahrung diente, eignete sich auch zur Verteidigung. Das erste Werkzeug des Menschen war auch seine erste Waffe. Außerdem streifte der Mensch nie einzeln durch die Wälder. Die Raubtiere stießen auf den Widerstand der ganzen – jetzt bewaffneten – Horde.
Wenn die Katze nicht allein auf dem Baum säße und sich mit einem Stock bewaffnen könnte, würde sie sich wahrscheinlich auch nicht ängstigen, sondern vom Baum herabsteigen und selbst den wütenden Hund verjagen. Und schließlich darf das Feuer nicht vergessen werden, mit dessen Hilfe der Mensch die wildesten Tiere erschrecken und verscheuchen konnte. Vom Baum auf die Erde, aus dem Wald in die Flusstäler richtete sich der Weg des Menschen, nachdem es ihm gelungen war, seine Ketten zu sprengen.
Woher wissen wir, dass der Weg des Menschen in die Flusstäler führte? Seine Spuren weisen dorthin. Aber wie konnten sich denn die Spuren des Menschen bis auf unsere Zeit erhalten?
Wir sprechen nicht von gewöhnlichen Spuren, von Fußspuren, sondern von den Spuren, die seine Hände hinterlassen haben. Vor ungefähr hundertsechzig Jahren arbeiteten in Frankreich, im Tal der Somme, Erdarbeiter. Sie gewannen dort aus den Flussanschwemmungen Sand, Kies und Steine. Vor langer, langer Zeit, als die Somme noch jung war und sich ihren Weg bahnte, war sie so schnell und stark, dass sie große Steine mit sich tragen konnte. Im Bett des Flusses schlug Stein an Stein, alle Unebenheiten der Felstrümmer wurden abgeschliffen, und es entstanden glatte, runde Kiesel. Später, als sich der Fluss beruhigte, blieben die Kieselsteine im Sand und Lehm liegen.
Aus diesen Lehm- und Sandbänken gruben die Spaten der Erdarbeiter die schönen, gleichmäßigen Kiesel aus. Aber sonderbar: manche Steine waren gar nicht eben und glatt, sondern im Gegenteil ungleichmäßig, so als ob sie von beiden Seiten zurechtgeschlagen wären. Wer konnte ihnen diese Form gegeben haben? Sicherlich nicht der Fluss, der die Steine schleift. Diese merkwürdigen Steine kamen Herrn Boucher de Perthes zu Gesicht.
Boucher de Perthes war ein Gelehrter, der in der Nähe des Fundortes wohnte. Er besaß eine reiche Sammlung verschiedener Funde, die er in der Erde am Ufer der Somme aufgelesen hatte. Da waren Eckzähne des Mammuts, Hörner des Nashorns und Schädel des Höhlenbären. Boucher de Perthes sammelte und studierte liebevoll die Überreste jener Ungeheuer, die irgendwann einmal zur Tränke an die Somme gekommen waren, ebenso häufig wie heute die Pferde und Schafe der Bauern. Aber wo war der Urmensch selbst? Von ihm konnte Boucher de Perthes keinerlei Knochen finden.