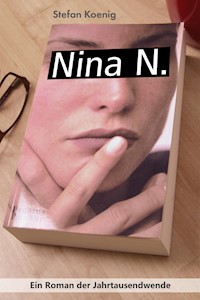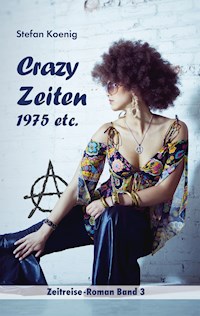Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Zeitreise-Roman
- Sprache: Deutsch
Das Jahr 1989. Irgendwas veränderte sich. Irgendwas rumorte. Hier wie dort. Im Privaten. Im öffentlichen Raum. Herzflimmern. Die Mauer fiel, die Mauer blieb. Dann diese Treuhand. Es gab Verrat. Und die Wendehälse. Und die Kalte-Kriegs-Gewinnler. Die Im-Stich-Gelassenen. Die falschen Versprechungen. Die Tricks. Die Morde. Die Verschwörungen. Dann die Folgejahre. Und die Folgen. Blühende Landschaften? Unsere Kinder wurden älter und alte Probleme blühten neu auf. Manche von uns wurden arbeitslos. Einige machten Karriere. Viele hatten zu viel um die Ohren. Andere wussten den Tag nicht zu füllen. Wir hörten Musik und schalteten ab, wenn es zu heftig wurde. Wir suchten neue Kontakte, fanden neue Freunde und manche teilten die Welt neu auf. In Ossis und Wessis. Aber die alte Teilung blieb – in Oben und Unten. In eine Welt des Friedens und eine des Krieges. In Reich und Arm.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 517
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stefan Koenig
Blühende Zeiten - 1989 etc.
Zeitreise-Roman Band 6
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Blühende Zeiten - 1989 etc.
Ein Suizid sollte reichen
Locker bleiben bei Lockerbie
Ein Toter wacht auf
Und ich düse, düse im Sauseschritt
Hundekacke ist Scheiße
Lebenselixiere
Brillanten-Mia
Der Amts-Choleriker & der Uhrmacher
Mai 1989
Das Quandt-Imperium
Das Sams & Herr Taschenbier
Oberstaatsanwalt mit festem Willen
Ein bisschen Frieden
August 1989
Onkel Podger
Die Ereignisse überschlagen sich
Die Welt dreht sich weiter
November 1989
Monika Weimars Tagebuch
Trauer, Verrat & Flucht
Neue Kontakte, neue Möglichkeiten
Die Welt in unserem Kopf
Alexanderplatz 3
Hotel Neptun & Warnemünde
Januar 1990
Alles wird besser & schlimmer
Februar & März 1990
Wiedersehen macht Freude
Hochstapeleien & Betrügereien
Viel Wirrwarr & der kleine Hitler
Genf, der Japaner & Mömpel
Globalisierte Schummeleien
Der Haar-Transplantateur
Geständnisse & Charly Chaplin
Dank & Nachbetrachtung
Worte für Julian Assange
Impressum neobooks
Blühende Zeiten - 1989 etc.
Stefan Koenig
Blühende Zeiten
1989 etc.
Zeitreise-Roman
Band 6
In schwierigen Corona-Zeiten gefördert von der Hessischen Kulturstiftung
in Wiesbaden
Aus dem Deutschen
ins Deutsche übersetzt
von Jürgen Bodelle
Wir können das Buch selber schreibenEs gibt genug freie SeitenFür immer bunteste ZeitenIch weiß, für uns wird‘s so bleibenWir fliegen weg, denn wir leben hochGewinnen alles und geh‘n k.o.Wir brechen auf, lass die Leinen losDie Welt ist klein und wir sind groß
Und für uns bleibt das soFür immer jung und zeitlosWir fliegen weg, denn wir leben hochDie Welt ist klein und wir sind großImmer da, ohne RückspiegelKeine Fragen, einfach mitzieh‘nDir fallen die Augen zu, dann gib das Steuer herPaar Stunden Richtung Süden und wir seh‘n das MeerUnsre besten Fehler, ich lass‘ sie laminierenPack‘ sie in die Jeans, trag‘ sie nah bei mirLass uns rauf auf‘s Dach, da ist der Himmel näherEy, die Zeit ist knapp, zusammen haben wir mehrWir können das Buch selber schreibenEs gibt genug freie SeitenFür immer bunteste ZeitenIch weiß, für uns wird‘s so bleiben(Aus: Mark Forster, Wir sind groß)
© 2020 by Stefan Koenig
Mail-Kontakt
zu Verlag und Autor:
Postadresse:
Pegasus Bücher
Postfach 1111
D-35321 Laubach
Vorbemerkung
Blühende Zeiten und blühende Landschaften. Die Zeit zwischen 1989 und 1994. Ich hatte mir vorgenommen, jene fünf Jahre in diesem Band zu vereinen. Diese Vereinigung ging schief. Im Laufe des Recherchefortschritts wurde mir zusehends klar, dass alleine das Jahr 1989 mit so vielen Ereignissen vollgepackt war, dass die vorliegenden 432 Seiten leicht zu füllen wären, ginge ich auf alle spannenden Einzelheiten ein. In der Mitte meiner Arbeit angelangt, wurde mir bewusst, dass ich das Vereinigungsjahr 1990 zwar beginnen, aber sicherlich nicht beenden könnte – es sei denn, ich weitete den Seitenumfang aus. Das aber wollte ich nicht.
1989, das historische Jahr. Viele Überraschungen, Enttäuschungen, Hoffnungen. Politikerworte, leere Worte, falsche Versprechungen, Hohlbirnen und Birne als Kanzler. Raffgier, Goldgräberstimmung, Besatzermentalität, die Heilsarmee der Wessis. Die blauäugigen, angeblich lebensunerfahrenen Ossis. Das Millionengrab im Osten und der blutende Westen. Verlockung und Verheißung und der Weg in die neue Abhängigkeit. Die Chance auf ein neues Deutschland und die vertanen Möglichkeiten. Alte Politik in neuen Schläuchen. Blendung und Erblindung.
Der Stichworte sind es viele, die uns einfallen, wenn wir über die Wendezeit und die Wendehälse nachdenken. Wollen wir heute noch viele Worte über all die Enttäuschungen verlieren? Ja, wir wollen. Und: Yes we can. We can change if we want! Aber wollen wir zurück in die Zeit von damals? Nicht wirklich. Jedoch in Gedanken. In Gedanken müssen wir zurück, müssen uns an jene Umbruchzeit erinnern, wenn wir aus Fehlern lernen wollen. Und wollen wir lernen? Na klar, wir wollen.
Geschichte ist nicht zum Umschreiben da, auch wenn es nach Orwellscher Vision Mächte gibt, die genau davon leben. Erinnerung dient vielmehr der humanen Vorausschau. Ohne einen realistischen Blick zurück, gibt es keinen realistischen Blick in eine lebenswerte, humane und ökologische Zukunft. Meine Zeitreise führt noch einmal quer durch jene Zeiten, die dem damals nahenden neuen Jahrtausend alte Probleme mit auf den Weg gaben. Probleme der Besitzverhältnisse und der sozialen Teilhabe. Probleme der Umwelt und der Mitmenschlichkeit. Probleme des Friedens, der Abrüstung und der Kriegführung der Eliten. Die Eliten selbst zogen dabei nicht in den Krieg, auch nicht ihre Söhne und Töchter. Die modernen Eliten lassen das einfache Volk ziehen, lassen die Bürger „mehr Verantwortung übernehmen“ – wie Krieg führen heutzutage genannt wird.
Viel geschah in den fünf Jahren nach der Wende und stellte die Weichen für die Zukunft. Viele Weichen führten ins Abseits. Einige Weichen weichten das Anliegen der DDR-Bürgerrechtsbewegung vollständig auf. Hardcore-Kapitalismus machte sich breit und die Gewerkschaften machten sich klein. Oder sie wurden klein gemacht. Hier entscheidet der Blickwinkel.
Verschiedene Blickwinkel erleichtern die Beurteilung der Lage. Manchmal dient die Vielfalt der Blickwinkel jedoch der Vernebelung. Lassen Sie, liebe Leserschaft, sich nicht verwirren. Sie haben ihren eigenen Kompass. Behalten Sie ihn im Auge.
Wenn ich mich erinnere und meine zahlreichen Dokumente aus jenen Zeiten zur Hand nehme und sichte, habe ich meinen ganz persönlichen Blick auf die Geschehnisse. Das ist normal und legitim. Niemals würde ich deshalb aber in Anspruch nehmen, den einzig richtigen Blickwinkel eingenommen zu haben. Als Autor stehe ich hingegen in der Pflicht, den Blick auf die historischen Begebenheiten so umfassend wie möglich frei zu geben.
Bedenken Sie bitte bei alledem, dass ich einen Roman schreibe. Einen hoffentlich lesbaren, unterhaltsamen, aufschlussreichen und spannenden Roman über jene Epoche. Wenn er Ihnen gefällt, bin ich für eine Weiterempfehlung dankbar. Schenken Sie zu den Geburtstagen ruhig wieder einmal ein Buch. Bücher sind in Existenznot. Zumal, wenn es Bücher sind, die dem Mainstream nicht nach dem Mund plappern. Die Verflachung der Buchthemen ist für mich ein Graus.
Ich bin so glücklich, wenn ich in unserer Gegenwartsliteratur hin und wieder einen Autor oder eine Autorin mit einem kritischen Blick entdecke. Noch besser, wenn dabei ein kritischer Text herauskommt. Völlig entgeistert bin und bleibe ich, wenn ich wieder einmal feststellen muss, wie unsäglich scheintot sich unsere Intellektuellen stellen oder wie mundtot sie sich machen ließen.
Wo gibt es noch große kritische Geister, die sich dem Wahnsinn der Aufrüstung und der katastrophalen sozialen Ungleichheit öffentlich entgegenstellen? Früher haben die bundesdeutschen Intellektuellen, Schriftsteller wie Wissenschaftler, Lehrende wie Künstler, die Friedensbewegung mitgetragen und mit befeuert. Früher sind sie aufgestanden. Früher haben sie sich gerührt.
Und heute? Wo sind sie geblieben?
Warum sind sie eingeschlafen?
Wer hat ihnen Schlafmittel verabreicht?
Früher, ja, früher war alles besser, oder? Nein, war es nicht. Damals war alles anders. Vieles war besser, vieles schlechter. Und was bewegte uns damals noch, neben den gravierenden Fragen der Menschheitsgeschichte?
Heino feierte sein erstes Comeback, nachdem er eine Zeitlang nicht mehr in den neuen Zeitgeist gepasst und „hoch überm Tale“ seine Zelte aufgeschlagen hatte. Schwarz-braun war zwar die Haselnuss, aber die schwarz-braune Zeit war endgültig passé. Dachte man.
Tausende blutjunger Mädchen litten unter unsterblichem Liebeskummer. Die Boygroup »Take That« machte sie wild. Massenhysterie drohte, wo die »Kelly Family« auftauchte. Nichts mehr ging ohne Claudia Schiffer. Trendy in den 1990er Jahren: der Walker, die Modedroge Ecstasy sowie Volvic und San Pellegrino.
-Die Klatschjournaille ließ sich über Harald Juhnkes Alkohol-Problem aus. Und während man früher im Smoking in die Oper ging, taten es nun auch Jeans und Pulli. Immer noch jagte Arnold Schwarzenegger als Terminator seine gegnerischen Kriegsmaschinen durch Gitter und Wände. Der Computer hatte das Kino erobert.
Und heute? Unsere Herrschaftseliten, die in Wahrheit keine wirklichen Eliten sind, haben mit ihren Medien die Gehirne der Menschen erobert.
Ist alles verloren? Nein!
Viel Lesespaß wünscht Ihnen
Stefan Koenig
Post Scriptum:
Wir haben Corona-Zeiten – und natürlich schreibe und sammle ich Informationen hierzu mit der Absicht, zu gegebener Zeit einen zeitgerechten Roman hierüber zu verfassen. Zeitgerecht, das heißt, der Zeit, in der wir heute leben, gerecht zu werden. Eine so zerrissene Zeit, solch zerrissene Umstände und eine solch zerrissene Gesellschaft hab‘ ich mein Lebtag nicht erlebt, würde Onkel Podger sagen … und er hatte wahrlich einige Jahre auf dem Buckel. Aber er hat die Gegenwart nicht mehr erlebt.
Darf ich Ihnen die Wahrheit sagen? Ja? Nun gut, mir hat noch nie so viel vorm Schreiben gegraut, wie vor diesem Thema. Wenn ich 2020 in Schriftform hinter mir habe, habe ich das Schlimmste geschafft … denke ich heute.
Wenn Sie dieses Buch lesen, müsste das Urteil im unmenschlichen und menschenrechtswidrigen Auslieferungsverfahren gegen den leidenden Helden Julian Assange gefallen sein. Ich drücke ihm die Daumen. Er verteidigt für uns alle die demokratischen Freiheitsrechte. Und bezahlt mit seiner Gesundheit – und hoffentlich nicht noch mit seinem Leben. Ihm widme ich den Text ganz am Ende dieses Buches.
Dieses Buch ist den ost- und westdeutschen
Oppositionellen aus der Wendezeit gewidmet.
Es ist jenen gewidmet,
die ihren sozialen Ideen und Hoffnungen
und der Wahrheit verpflichtet blieben
Nur wenige im Osten hatten mit
der erbarmungslosen Invasion
der Deutschen Mark gerechnet
Die, die wussten, was kommen würde,
wurden nicht gehört.
Ihre Alternativen
verhallten in der
Wüste des erweiterten
Wilden Westens
* Gewidmet auch meinen unerschütterlichen Unterstützerinnen *
* Alexandra & Anja *
„Die ganze Welt besteht aus Lug und Trug!“, rief Emma in die Runde. Meine Frau empörte sich über ein Spekulationsgeschäft, das wir beide abgeschlossen hatten. Wir hatten um die Gefahr des Totalverlustes gewusst. 3.000 Mark waren flöten, immerhin ein halber Familien-Urlaub. Noch vor drei Jahren wäre es unser gesamtes Gespartes gewesen. Nun waren wir mit unserem Unternehmer-Einkommen übermütig geworden.
Ich kramte ein beliebtes und zutreffendes Karl-Marx-Zitate aus meiner Erinnerung hervor: „Mit entsprechendem Profit wird Kapital kühn. 10 Prozent sicher, und man kann es überall anwenden; 20 Prozent, es wird lebhaft; 50 Prozent, positiv waghalsig; für 100 Prozent stampft es alle menschlichen Gesetze unter seinen Fuß; 300 Prozent und es existiert kein Verbrechen, das es nicht riskiert, selbst auf die Gefahr des Galgens.“
„Das Marx-Zitat hat aber wenig mit eurer Situation zu tun. Ihr seid ja die Geschädigten“, sagte mein Bruder. „Wenn du mit deinem Kapitaleinsatz Schaden anrichten würdest, indem du übermütig wirst …“
Ich ließ ihn nicht ausreden und räumte reumütig ein: „Ja, ja, sich auf ein Spekulationsgeschäft einzulassen, war ein Fehler. Immerhin sind wir nicht auf das »großzügige« 20.000-DM-Angebot eingegangen. Dem Broker zufolge hätten wir innerhalb von nur vier bis sechs Monaten eine Rendite von 300 Prozent erreicht.“
„Das erschien uns aber sehr unrealistisch“, warf meine Frau ein, und an meinen Bruder gewandt: „Sag‘ mal ehrlich, Günter, wie hättest du auf solch ein Angebot reagiert?“
Anfang Oktober letzten Jahres hatte mich in meinem Bildungsinstitut ein Anruf erreicht. „Herr Koenig, ein scheinbar wichtiger Mensch ist am Apparat. Es lässt sich nicht entlocken, was er konkret will. Er sagt, es sei existentiell, und er könne es nur mit dem Geschäftsführer persönlich bereden. Ein einmaliges Angebot.“
Ich hatte Frau Wenzel im Zentralsekretariat der GTU gebeten, stets nur dann durchzustellen, wenn es wirklich meine Entscheidungsebene und nicht vielleicht Dozenten oder Mitarbeiter aus der ökologischen Beratungssparte betraf. Seit nunmehr fast drei Jahren war die »Gesellschaft für Umweltschutz und Technologieberatung«, die ich Mitte 1986 gegründet hatte, aktiv und regional wie überregional bekannt.
„Na gut, dann stellen Sie ihn mir bitte durch.“
Der gute Mann am anderen Ende der Leitung war ein Börsenbroker. Damit hatte ich am wenigsten gerechnet. Er stellte sich mit Namen und Funktion vor, berichtete über sein Börsendasein, dessen hektische Geräusche im Hintergrund herauszuhören waren. Er klang durchaus seriös, gab Informationen, ohne dass ich mich übertölpelt oder als Börsen-Depp fühlen musste. Rückfragen beantwortete er glaubwürdig, und er machte ein Superangebot.
„Wenn Ihr Unternehmen aus seiner stillen Reserve 20.000 Mark in eine Getreideoption investiert, können Sie nach allen bisherigen Erfahrungen innerhalb der nächsten vier bis sechs Monate das Dreifache daraus machen.“
„Wir sind eine gemeinnützige Bildungs- und Beratungseinrichtung und Spekulationsgeschäfte sind völlig ausgeschlossen.“
„In diesem Fall biete ich es Ihnen als Privatmann an, was hier in meiner Abteilung allerdings ungern gesehen wird. Aber ich mache für Sie eine Ausnahme.“
Wie er darauf komme, weshalb er gerade die GTU und mich ausfindig gemacht habe, weshalb er nicht selber investiere, ob er es auch seinen Freunden empfehle, um sie glücklich zu machen … So ging es hin und her. Ich hatte natürlich arge Zweifel. Er versprach mir, die offiziell gehandelten Titel per Fax zuzusenden, was auch umgehend geschah. Charts, Tabellen, Kontostände, Gewinnausschüttungen – alles war dabei, irgendwie recht beeindruckend. Ich brauchte nur zu überweisen. Aber Emmas und meine privaten Rücklagen betrugen gerade mal die Hälfte der erforderlichen Summe. Ich machte ihm klar, dass ich niemals die gesamte Rücklage in ein Börsengeschäft, das ich nicht selbst steuern könne, einbringen würde.
„Sie können zu jedem Zeitpunkt aussteigen. Allerdings erfolgt die Auszahlung erst zum Fälligkeitszeitpunkt“, ließ mich der Broker wissen.
„Ich investiere nur einen Probebetrag in Höhe von 1.000 DM. Wie hoch wird der Gewinn nach vier Wochen sein?“
„Normalerweise handeln wir nicht mit einem solchen Minibetrag, aber weil Sie es sind …“
„Was heißt: »Weil Sie es sind«? Was genau, finden Sie denn an mir so außergewöhnlich, dass Sie mir Sonderkonditionen einräumen wollen? Das macht mich, ehrlich gesagt, etwas stutzig.“
Er erzählte mir dann, wie er auf die GTU aufmerksam geworden sei. Und es wäre doch offensichtlich, dass der technische und ökologische Umweltschutz ein Zukunftsprojekt sei, und ich als Gesellschafter und Geschäftsführer … bla bla bla. Das war haufenweise Honig ums Maul geschmiert. Aber es wirkte. Ich war bereit, weiter zuzuhören.
„Nach jetzigem Stand des Getreidepreises erhalten sie schon nach rund einem Monat das Dreifache.“
„Okay, dann lasse ich mich mal darauf ein.“
Gesagt getan. Natürlich stimmte ich mich am Abend mit Emma ab. Ein Monat verging, und dann kündigte ich die Börsen-Option per Fax, um den anvisierten Gewinn aus den 1.000 investierten Mark zu realisieren.
Der Broker meldete sich telefonisch: „Sie haben ein gutes Geschäft gemacht, gratuliere! Ihr Investment hat sich etwas mehr als verdreifacht. Ihr Konto steht bei 3.152,64 Mark!“
„Super. Und wie kommt das Geld auf mein Privatkonto?“
„Wir können es Ihnen sofort überweisen.“
„Gerne. Sie haben ja meine Bankverbindung.“
„Ja. Sie können natürlich auch gerne investiert bleiben. Das steht Ihnen offen. Wenn Sie das Investment mit 2.000 DM auffüllen, steht Ihr Getreidekonto bei rund 5.000 und wirft in den nächsten vier bis sechs Wochen 300 Prozent ab. Dann können wir Ihnen demnächst 15.000 auf Ihr Konto überweisen.“
Am Abend hatte ich mit meiner Frau darüber gesprochen; wir wollten den Versuch wagen. Und dann, kurz vor Weihnachten, als wir den Gewinn zu realisieren gedachten, kam der Aufwachmoment. Die Getreidepreise seien unerwartet stark gefallen, leider stehe unser Börsenkonto gerade bei minus 232,58 Mark und wir müssten entweder noch abwarten oder nachschießen. Da fiel es uns wie Schuppen von den Augen.
Und gerade jetzt, nur zwei Wochen nach der Börsen-Ernüchterung, kündigte sich mein alter WG-Kumpel Meise aus Hamburg zu Besuch an. Im Schlepptau ein Mann namens Jürgen Harksen.
„Er ist ein ausgemachter Anlageprofi“, flötete Meise in die Muschel. Wie konnte Meise, mein gutgläubiger Künstler und Comic-Zeichner, für den Finanzen und Betriebswirtschaft immer Fremdworte aus einer Lichtjahre entfernten Galaxie waren, alleine schon das Wort Anlageprofi in den Mund nehmen?
„Anlageprofis sind Profis in Sachen Beschiss“, sagte ich.
„Zuhören hat noch nie geschadet“, antwortete Meise. „Wir bleiben ja nicht lange. Ich will noch meine Schwester besuchen. Harksen hat halt echt gute Angebote.“
Wir erwarteten die beiden für die zweite Januarwoche. Emma und ich würden Harksen auf Herz und Nieren prüfen.
Heute, am Sonntag, dem 1. Januar des neuen Jahres, saßen wir in familiärer Runde zusammen und Günter antwortete auf Emmas Frage, wie er sich bei dem Broker-Angebot verhalten hätte, mit einem Achselzucken. „Mir hätte wohl niemand ein solches Angebot unterbreitet. Es ging offensichtlich darum, irgendwann an das große Unternehmensgeld heran zu kommen.“
„Das große Unternehmensgeld!“, wiederholte ich ironisch. „Wer weiß, wie lange alles überhaupt noch gut geht und was uns in diesem Jahr noch alles bevorsteht. 365 Tage können manchmal sehr lang sein.“
Von heute bis zum Mauerfall-Donnerstag, dem 9. November 1989, waren es nur 313 Tage, was zu diesem Zeitpunkt niemand aus unserer Runde ausrechnete, weil niemand auch nur das Geringste davon ahnte. Und beide Tage lagen so weit auseinander wie die ägyptische Hochkultur vom römischen Imperium. Kein Mensch dachte an die dramatischen Ereignisse, die das Jahr prägen sollten.
Gestern, am letzten Tag des Jahres, hatten Emma und ich meine Eltern zu Gast. Das war selbstverständlich. Schließlich wohnten sie ein Stockwerk über uns und freuten sich, weil sie nicht kochen mussten. Dazu hatten wir die Familie meines Bruders und meine Nichte samt Mann und Sohn eingeladen. Man hatte über die Zukunft gesprochen, wie das so oft an Silvesterabenden üblich ist. Wir hatten uns alles Gute gewünscht und gemeinsam Urlaubspläne geschmiedet.
Meine Frau hatte eigentlich einen Städtebesuch in der Schweiz mit einer Woche Urlaub am Genfer See geplant. Aber in Anbetracht der Schmälerung durch unseren börsennotierten Verlust, schminkten wir uns das luxuriöse Vorhaben ab.
„Ich hätte ja gerne mal Zimmer 317 im Hotel Beau-Rivage in Genf besucht“, sagte ich.
Emma, mein Bruder und meine Nichte Petra wussten sofort, dass ich auf den angeblichen Freitod des prominenten CDU-Politikers Uwe Barschel anspielte.
„Da hättest du weiß Gott keine Aufklärungsarbeit mehr betreiben können“, lachte Günter.
„Eher hättest du dich wieder mal in deinen Geheimdienstmärchen verrannt und Emma hätte sich den ganzen Urlaub über deine abstrusen Waffenschiebergeschichten anhören müssen.“
Wir alle lachten – auch Otto, mein Vater, der immer weniger mitbekam, worüber wir redeten. Mit seinen 80 Jahren war er nicht mehr der Fitteste. Noch vor fünf Jahren hatte er als Alterssportler bei Leichtathletik-Wettkämpfen mitgemacht und oft den ersten Platz belegt. Die Zeit war rum. Wir merkten es von Tag zu Tag mehr.
Nun gut, das Hotel Beau-Rivage und Zimmer 317 war nun für mich mangels gefüllter Reisekasse passé. Am nächsten Morgen, am ersten Tag des neuen Jahres, musste ich ernüchtert daran denken.
Was Uwe Barschels mysteriösen Tod in der Badewanne betraf, so sitzt an diesem Tag in Lübeck ein Oberstaatsanwalt über einem Stapel alter Zeitungsberichte und amtsinterner Notizen. Sein Name ist Heinrich Wille. Er schüttelt den Kopf, wenn er über all die Widersprüche nachdenkt, die sich vor seinem geistigen Auge auftun. Er kennt die Politik, kennt Politiker und politische und wirtschaftliche Zusammenhänge. Heinrich Wille ist ein politisch interessierter Mann. Hauptsächlich ärgert er sich an diesem Tag aber über die schlampige Arbeitsweise der schweizerischen Kollegen. Er macht Aufzeichnungen über die exemplarischen Versäumnisse der dortigen Ermittlungsbehörden und begutachtenden Stellen. Er fragt sich, wofür er das eigentlich macht, denn er hat mit dem Fall Barschel nichts zu tun. Doch irgendwie drängt es ihn, die Dinge, die er heute sieht, schriftlich festzuhalten.
Wille notiert, was ihm auf den ersten Blick an Defiziten auffällt:
Mangelhafte kriminalistische Tatorterhebungen: keine Tatortfotos, kein Messen der Badewassertemperatur
Zögerliche kriminalistische Folgeermittlungen: unzureichende Recherche nach dem Taxifahrer vom Flughafen zum Hotel, keine Überprüfung der unmittelbaren Vorgeschichte – Gran Canaria und Flug
Rechtsmedizinische Versäumnisse: keine Dokumentation des Mageninhalts und Aufbewahrung zumindest nur eines geringen Teils davon; keine Sicherstellung nur einer geringen Menge Urin
Fragmentarische Folgeuntersuchungen: »die Flecken auf dem Badeteppich sind keine Rotweinflecken«; weiße Flecken auf der Hose von Uwe Barschel: vermutlich Talkumspuren des Präparators der Genfer Gerichtsmedizin
Keine Aufklärung über Barschels Rolle bei internationalen Waffengeschäften unter der Regie der CIA
Keine Aufklärung über Barschels häufige Besuche in der DDR
Oberstaatsanwalt Heinrich Wille wundert sich, dass der deutsche Bundesanwalt die Sache Barschel nicht an sich zieht. Er ahnt am 1. Januar 1989 noch nicht, dass er bereits in zwei Jahren den Fall übernehmen und völlig neu aufrollen muss. Zwei Jahre, in denen sich Spuren verlaufen und verwischt werden können.
Ein Suizid sollte reichen
Am selben Neujahrstag wirft sich Veit, mein gleichaltriger Freund aus alten Jugendzeiten, vor einen S-Bahn-Zug. Ich habe ihn zuletzt vor circa fünfzehn Jahren getroffen. Damals ging es ihm scheinbar gut. Er hatte eine Freundin und war immer noch in Opposition zum kapitalistischen Schweinesystem. Noch einmal acht Jahre zuvor – es war 1966 – hatten wir als Gymnasiasten in der Schreinerei seines Vaters kleine Hoppe-Hoppe-Holzpferdchen gebastelt, um mit einer lieblichen Provo-Reiterarmee der rücksichtslosen Reiterstaffel der gehassten Bullen Paroli zu bieten. Und natürlich, um das brutale System lächerlich zu machen. Und um mit unseren guten Argumenten in die böse Presse zu kommen.
An dem Nachmittag, an dem er entschieden hatte, dass er seinem Leben ein Ende setzen würde, klingelt das Telefon. Gerade jetzt klingelt es, als Veit seine Jacke angezogen und seine Schlüssel vom Haken genommen hat Er nimmt an, dass es seine Eltern sind, die sich wegen seiner zunehmenden Depressionen Sorgen machen. Aber Veit will mit niemandem mehr reden. Nach all den verzweifelten Jahren ist er endlich so weit. Heute würde er einen Punkt hinter alles setzen. Da will er nicht das Risiko eingehen, von irgendwem oder durch irgendetwas abgehalten zu werden.
Bevor er seine Wohnung verlässt, klebt er ein Briefkuvert an die Wohnungstür. Am Neujahrsabend will er nämlich mit einer Clique ehemaliger Arbeitskollegen und Kolleginnen essen gehen und anschließend ins Schiller-Theater. Ich hatte ihm einmal erzählt, dass ich in meiner frühen Studentenzeit in Westberlin am Schiller-Theater als Komparse gearbeitet hatte. Seitdem, so hatte er mir vor Jahren telefonisch berichtet, sei er Fan des Schiller-Theaters geworden und besuche mindestens zwei Vorstellungen im Jahr. Wir hatten darüber herzlich gelacht.
Markus, Veits ehemaliger Bürokollege, würde ihn heute abholen. Veit will ihn nicht vor geschlossener Tür endlos warten lassen. Veit geht davon aus, dass er gegen achtzehn Uhr tot sein wird und findet es daher nicht mehr als höflich und rücksichtsvoll, seinen Kumpel darüber zu informieren, dass er nicht zu warten brauche.
„Für MARKUS“, steht auf dem Briefkuvert, das er mit Tesa an die Tür klebt. Innen steht: „Bitte warte nicht. Wenn du das hier liest, habe ich mich zu einem Entschluss durchgerungen, der mein Leben für immer beeinflusst. Lebe wohl!“
Er geht zu Fuß zum S-Bahnhof Bellevue. Das ist genau die Station, an der ich früher immer ausgestiegen war, um im Dr.-Duwe-Verlag mein Volontariat und später meine journalistische Arbeit an der dort herausgegebenen Publikation, »bundesdeutsche tabus«, anzutreten. Der Fußweg dorthin beträgt für Veit knapp fünfzehn Minuten, und er sagt sich, dass er auf gar keinen Fall wieder umdrehen darf.
Vor einigen Jahren hatte er sich schon einmal auf seinen »letzten Weg« begeben und dann auf halbem Weg kehrt gemacht. Dieses Mal musste er es durchziehen. Um zu verhindern, dass er im letzten Moment Muffensausen bekommt, macht er einen unbedeutenden Umweg und kauft bei einem kleinen russischen 24-Stunden-Kiosk eine Flasche Wodka. Da er normalerweise wenig Alkohol trinkt, rechnet er sich aus, dass ihm die Flasche ausreichend Mut verleihen würde, den Sprung in den S-Bahn-Schacht zu wagen. An der Kasse fragt sich Veit, ob der kahlköpfige Russe, der ihn kurz mustert, als er ihm das Wechselgeld herausgibt, sich an ihn erinnern wird. Wahrscheinlich steht morgen in der BILD: »Junger Mann springt alkoholisiert vor Zug. Er roch nach Wodka. Stundenlanger S-Bahn-Ausfall.«
Veit bekommt ein schlechtes Gewissen – wegen dem Ausfall der Verkehrsverbindung, wegen der Rettungskräfte, die seine Reste aufsammeln müssen, wegen der Passagiere, die seinen Sprung vielleicht hilflos mitansehen müssen, wegen des Zugführers, der ihn springen sieht und einen Schock erleidet. Aber Veit will nicht mehr zurück. Sein Leben ist nur noch eine Qual. Täglich denkt er an den Tod. Eine Lösung muss her. Eine Erlösung.
„Und erlöse mich von dem Leid und dem Übel und all der trügerischen Herrlichkeit“, betet er vor sich hin. Doch er glaubt nicht an einen Gott, der ihm ein solch erbärmliches Leben geschenkt hat. Dabei war alles einmal ganz anders gewesen. Daran denkt Veit jetzt nicht. Er konzentriert sich auf das für ihn Wesentliche. Er steigt die Stufen zur Fahrtrasse empor und schlendert ohne Fahrkarte auf den Bahnsteig.
Oben angekommen, sieht er auf der Uhr, dass die nächste Bahn Richtung Grenzübergang Friedrichstraße schon in zwei Minuten kommt. Das ist ihm zu schnell. Noch weitere acht Fahrgäste warten auf die S-Bahn. Er geht weiter weg von ihnen bis ans Ende des Bahnsteigs, wo der Führerstand der Bahn zum Halten kommen wird. Als die Bahn kommt, hält die Zugmaschine genau vor ihm, und der Zugführer und Veit schauen sich einen Moment eindringlich in die Augen.
Dieser Mann wird sich an mich erinnern, denkt Veit. Schließlich wird die nächste Bahn morgen in der Zeitung erwähnt werden – und ihm, Veit, zur Erlösung verholfen haben. Der Zugführer schaut noch einmal kurz zu Veit, dann rauscht die S-Bahn ab.
Ein Signal ertönt. Auf der Anzeigetafel erscheint plötzlich ein Text, der Veit in Erregung versetzt. Er hat gesehen, wie relativ langsam die Bahn in die Station eingefahren ist. Eigentlich müsste er am Anfang des Bahnsteigs springen, wo die Bahn einfährt, denn dort hat sie noch genügend Geschwindigkeit, um auf keinen Fall abrupt stoppen zu können. Zumindest ist es für ihn in seiner Vorstellung angenehmer, wenn sich alles in Sekundenbruchteilen abspielt.
Auf der Anzeigetafel aber steht jetzt: „Von der Bahnsteigkante zurücktreten! Der nachfolgende Zug macht keinen Halt und fährt bis Friedrichstraße durch!“
Ideal, denkt Veit, diese Bahn soll meine sein! Er steht immer noch am Bahnsteig-Ende in Richtung Ausfahrt. Da keine Zeitangabe auf der Tafel erscheint, muss er nach Gehör gehen. Veit muss schnell handeln, deshalb nimmt er jetzt einen großen Schluck Wodka aus der Flasche und geht strammen Schritts über den leeren Bahnsteig. In der Mitte der Station nimmt er einen noch größeren Schluck, Feuerwasser, denkt er. Und er spürt, wie ihm übel wird. Trotzdem beschließt er, Schluck für Schluck weiter zu trinken, bis er schließlich am Beginn der Zugeinfahrt angelangt ist. Die Flasche ist nun leer. Er stellt sie neben einen Abfallbehälter. Er schaut in das Gleisbett und verlässt sich auf sein Gehör. Der Wodka wirkt, sein Zeitgefühl schwindet.
Veit setzt sich auf die letzte Bank am Bahnsteig, wo der Zug bald einfahren wird. Noch ist kein Geräusch zu hören. Er weiß, dass es gleich so weit ist und schaut mit glasigem Blick auf die Uhr. Es ist 17:14 Uhr, vielleicht auch 17:18 Uhr; das Ziffernblatt verschwimmt etwas vor seinen Augen, es ist ihm egal. Wenn er die Bahn kommen hört und der Luftzug zu spüren ist, wird er vortreten und springen. Heute, am Neujahrstag, sind wenige Leute unterwegs; Veit sieht gerade ein Pärchen am anderen Ende der Bahnstation die Treppe heraufkommen.
Sein Blick fällt auf eine Litfaßsäule mitten auf dem Bahnsteig, sie erscheint ihm wie eine Telefonzelle. Er überlegt kurz, ob er doch noch seine Ex-Freundin anrufen soll. Erst vor sechs Wochen getrennt, telefonieren die beiden recht oft miteinander und sind nun »gute Freunde«, wie man so schön sagt, wenn man die ganze Wahrheit nicht besser auszudrücken vermag. Er verwirft den Gedanken sofort, weil er dann die Chance verpassen würde, von dem durchrauschenden Zug erfasst zu werden. Besser, ich unterlasse den Anruf, sagt er sich.
Veit steht auf, gleich wird es so weit sein. Er verspürt keine Panik; der Wodka hat seinen Zweck bisher erfüllt, er fühlt die Bestätigung dessen, was er die ganze Zeit über gewusst hatte – es ist so weit. Er ist bereit. Ohne Reue. Ohne Bedenken. Er müsste in wenigen Minuten nur noch ein paar Schritte tun. Während er hin und her geht, schließt er die Augen, stöhnt leise und öffnet sie schnell wieder. Er ist ein wenig benommen. Sobald sich der nahende Zug ankündigte, würde er nach vorne gehen, bedächtig und ohne Anzeichen irgendeiner Aufregung. Er würde dort warten, bis die Zugschnauze in der Kurve vor der langen Einfahrt zu sehen ist. Dann würde er einfach springen. Ein Sprung, das war‘s.
Veit hört das Rauschen des nahenden Zuges. Die S-Bahn kommt, nimmt die Kurve, rast auf ihn zu. Er geht bis an die Bahnsteigkante. Er ist sich absolut sicher, dass er das hier tun sollte. Veit schaut nicht mehr nach anderen Leuten, schaut nicht mehr nach links oder rechts oder zurück. Er wartet die Bruchteile von Sekunden, bis der Moment da ist, an dem er die Augen schließt und sich nach vorne fallen lässt. Doch im letzten Moment beschließt er, es mit einem Kopfsprung wie vom Drei-Meter-Brett zu machen.
Er springt.
Mit einem harten Schlag, ähnlich einem Bauchplatscher, landet Veit auf den Gleisen. Er spürt nichts, keinen Schmerz, keine Angst. Er hebt den Kopf etwas und blickt zur Seite, wo er den Zug direkt auf sich zurasen sieht, ganz nah. Er kneift die Augen fest zu und schreit, so laut er kann, während er auf den tödlichen Schlag wartet.
Er hört zu schreien auf, als die Bahn über ihn hinwegrast und der Schock ihn aus dem Wodkarausch wachrüttelt. Blitzschnell wird ihm klar, dass er noch nicht tot ist. Er riecht erhitztes Metall und ist noch zu einer Überlegung in der Lage. Er muss nur noch kurz den Kopf aufrichten, um von der Unterseite der über ihn hinwegschießenden Bahn erfasst zu werden.
Er will sich zwar aufrichten, kann es aber nicht. Er bemerkt, wie sich die Bahn verlangsamt und hört das Kreischen der Bremsen. Und dann kommt der Schmerz mitsamt einem starken Ohrensausen. Der Schmerz ist unmenschlich. Solch einen Schmerz hat Veit noch nie verspürt. Er versucht die Lippen zu bewegen, um etwas herauszuschreien, aber er kann nur flüstern: „Helft mir … Hilfe …“
Dann plötzlich verschwinden die Schmerzen wie von Zauberhand, und er spürt eine ungeheure, wohltuende Wärme, die ihn flutet und beruhigt. Er weiß, dass er jetzt endlich sterben wird und schließt erleichtert seine Augen. Es ist vollbracht, aus und vorbei. Endgültig. Gott sei Dank.
Um diese Zeit herum, zwischen fünf und sechs Uhr abends am Neujahrstag, verabschiedeten Emma und ich unsere Verwandten und wünschten ihnen noch einmal ein glückliches und gesundes neues Jahr. Meine Eltern gingen nach oben, Lollo musste meinen Vater stützen, weil er ihr wackelig vorkam. Emma und mir war es nicht aufgefallen.
„Sie ist überbesorgt“, meinte Emma.
„Er baut rapide ab“, sagte ich. Ich schaute nachdenklich aus dem Fenster. Die Außentemperatur betrug 3,8 Grad, wie unser Thermometer am äußeren Fenstersims anzeigte. Es war regnerisch, ein ungemütliches Wetter. Ich dachte nicht an Veit, der im Gleisbett seinen Tod sehnlich erwartete. Warum auch? Ich dachte nicht an früher, nicht an alte Freundschaften. Ich wusste nichts von Veits Schicksal, hatte jahrelang nichts von ihm gehört.
Meine Gedanken waren schon in der unmittelbaren Zukunft, bei der GTU; ich dachte an unternehmerische Ausbaumöglichkeiten, an neue Kursangebote und an das zukünftige Umweltzentrum, das ich schon in drei Monaten gründen würde. Eine Gästeliste und ein Kulturprogramm waren zu erstellen, und ich musste die Einladungen an die vorgesehen Redner zur Einweihung des Zentrums vorbereiten. Ich dachte an meinen morgigen nächsten Arbeitstag, denn ich hatte im Gegensatz zu meinen Mitarbeitern keine Weihnachtsferien. Aber ich würde mir die Arbeitszeit familienfreundlich einteilen.
Morgen würde ich erst nach einem ausgiebigen Frühstück ins Büro fahren. Die Fahrt durch die Stadt würde stressfrei sein. Keine langen Autoschlangen vor Ampeln, kein Wettbewerb darum, wer bereits bei Orange einen fulminanten Start hinlegen würde, um mit kreischenden Reifen eine Nasenlänge vor mir die Spur zu wechseln. Um sodann festzustellen, dass vor der kommenden Kreuzung genau auf dieser Spur bereits ein Auto steht, um schließlich noch einmal schnittig die Spur zu wechseln, um endlich an der nächsten Kreuzung mit langgezogener Fresse und angezogener Handbremse genau neben mir wieder zum Stehen zu kommen.
Wie es meine Art war, legte ich mir ausführlich meine Planung stichpunktartig zurecht. Ich würde gegen ein Uhr zum Mittagessen nach Hause fahren. Dann wieder zurück ins Büro und bis zum Nachmittagskaffee arbeiten. Danach werde ich Emma kurz im Haushalt helfen. Ich werde mit Karola und Luca spielen, sie später gegen neunzehn Uhr ins Bett bringen, ihnen etwas vorlesen, und wenn sie schlafen, werde ich mit meiner Frau die Kursplanungen für das kommende Jahr zu Papier bringen. Dazu werde ich aus dem Büro einen großen Papierkalender mitbringen, obwohl Pinkus, mein guter alter Klassenkamerad und Freund und jetziger EDV-Berater, meinte, wir könnten das viel praktischer auf dem Macintosh machen. Aber Emma und ich trauten uns noch nicht. Grafik, Tabellen und Diagramme – das waren für uns noch heilige Kühe, an die wir uns nicht heranwagten.
Ich nahm mir vor, in den nächsten Tagen die Eröffnung des Umweltzentrums Rhein-Main auch inhaltlich exakt vorzubereiten. Meine Rede musste ich endlich konzipieren. Nächste Woche würde ein neues Umweltunternehmen unter dem Dach der GTU in Angriff genommen. Vier Dozenten hatten sich selbständig gemacht und das Umweltinstitut Offenbach als GmbH gegründet. Sie wollen Planungsaufgaben, Gutachten und Laboranalysen für Kommunen, für Klein- und Mittelbetriebe anbieten.
„Wir werden eine tolle Kooperationsgemeinschaft bilden“, hatte ich zu Emma gesagt.
„Aber wie willst du die Lehrkräfte auf Dauer ersetzen? Die vier fallen ja weg.“
„Sie bleiben ja für ein halbes Jahr noch als GTU-Beschäftigte dem Unterricht erhalten. Damit haben sie einen leichteren Start in die Selbständigkeit und wir haben somit keine akuten Nachwuchssorgen. Denn Dozenten wachsen in unseren Akademikerkursen nach wie in einem ökologischen Treibhaus. Darum ist mir nicht bange.“
Locker bleiben bei Lockerbie
Eigentlich begann für uns das neue Jahr harmlos und unschuldig, wenn man von einigen Merkwürdigkeiten absah. Eine dieser Ungereimtheiten kam zutage, als ich erfuhr, wer sich an Bord der am 21. Dezember 1988 abgestürzten Pan Am 103 über dem schottischen Lockerbie befunden hatte. Eine Bombenexplosion hatte den Absturz des »Jumbo«-Großraumflugzeugs herbeigeführt. 281 Menschen waren dabei ums Leben gekommen. Darunter war Olof Palmes engster Vertrauter und politischer Weggefährte, der schwedische Diplomat Bernt Carlsson.
Ich hatte den Mord am schwedischen Ministerpräsidenten Olof Palme, jenem aufrechten politischen Fanal für Frieden und Antiimperialismus, für weltweite soziale Gerechtigkeit und Ost-West-Ausgleich, nicht nur zutiefst bedauert, sondern auch jede kleine Meldung zu den Ermittlungen verfolgt und in meinem Archiv gesammelt.
Schließlich fiel in diesem Mordfall nicht nur die Nähe der NATO-Geheimarmee Gladio zum Mordgeschehen auf. Der schwedische Arm dieser antisozialistischen Terrortruppe hatte im Skandia-Gebäude, ein paar Schritte vom Attentatsort entfernt, jahrelang seine Zentrale. Schwedische Investigativ-Journalisten waren zu der Auffassung gelangt, das Gebäude habe zu dieser Zeit ein CIA-Verbindungsbüro beherbergt.
Der führende CIA-Offizier Vincent Cannistraro sei während des Mordes im Skandia-Gebäude gewesen und habe von dort aus die Überwachungsoperation geleitet. Einer der Stay-behind-Kommandanten habe zur Zeit des Attentates auf Palme einige Meter vom Tatort entfernt eine Tür zum Gebäude offengehalten – als ob man jemandem eine Fluchtmöglichkeit geben wollte. In den offiziellen Ermittlungen heißt der Unbekannte nur „der Skandia-Mann“ – seine wahre Identität wurde nie ermittelt.
Olof Palmes Vertrauter, der schwedische Diplomat Bernt Carlsson, hatte mehreren Personen erzählt, er kenne die Hintergründe des Palme-Mordes und werde sie demnächst preisgeben. Er kenne die Geheimdienstagenten jener Staaten, die gemeinsam den Mord an dem schwedischen Friedenspolitiker geplant hätten. Und eben dieser Diplomat hatte sich an Bord der abgestürzten Maschine befunden. Das war es, was mich auf Anhieb stutzig machte. Er hatte zu Palmes engsten Weggefährten gehört und war Mitglied seines persönlichen Stammtisches gewesen.
In den ersten beiden Wochen des neuen Jahres überschattete das Lockerbie-Attentat alle anderen weltpolitischen Ereignisse. Hintergrund war die Auseinandersetzung, die Großbritannien und die USA gegen das blockunabhängige Libyen führten. Die westlichen Großmächte bezichtigten Muammar al-Gaddafi als Drahtzieher des Flugzeuganschlags; es habe sich um einen Racheakt für die amerikanische Bombardierung von Tripolis im April 1986 gehandelt.
Gegen diese Version setzten Kritiker der CIA eine andere: Die Bombe sei bereits in Malta von einem geheimdienstlich geführten Drogenschmuggler als Transitgepäck an Bord einer Zubringermaschine geschmuggelt worden, um dann mit anderen Gepäckstücken umgeladen zu werden und auf dem Weg von Frankfurt nach London zu explodieren.
Für mich stellte sich die Frage, ob die Bombe an Bord der Pan Am 103 geschmuggelt wurde, um gezielt Bernt Carlsson zu töten, damit er sein Wissen über den Mord an dem ehemaligen schwedischen Ministerpräsidenten nicht mehr preisgeben könne. War alles andere nur Vernebelungstaktik? Dann las ich einen anderen Hinweis, der meine Mutmaßung bestärkte: Der CIA-Whistleblower Chip Tatum ging davon aus, dass die USA und Israel selbst hinter dem Attentat steckten und die Bombe tatsächlich für Carlsson bestimmt war. Sie sei im Auftrag der Amerikaner und Israelis vom britischen Geheimdienst in London heimlich an Bord gebracht worden.
Nun ja, ich notierte mir die Informationen, schnitt die Quellen aus und heftete alles fein säuberlich in meiner Archivakte ab.
Meine politologische Spürnase schnüffelte in diesen ersten Wochen des neuen Jahres etwas, was nach weltweiter Veränderung roch, oder roch es doch eher nach Kaffeesatz? Wenn ich in diesen Tagen an meine Korrespondenzen mit DDR-Freunden und Kumpels aus Westberlin dachte, glaubte ich allerdings wirklich an mein Gespür für grundlegende Veränderungen. Seit langem demonstrierten Mitte Januar wieder einmal Studenten in beeindruckender Zahl. In verschiedenen Städten der BRD rebellierten sie gegen schlechte Studienbedingungen und gegen die seit Jahren bekannte Wohnungsnot. Bundesbildungsminister Möllemann kündigte eine Aufstockung der Finanzmittel an.
„Wer daran glaubt, wird selig!“, schrieb mir dazu mein früherer WG-Freund Richy, der immer noch Taxi fuhr. Warum hatte er nicht studiert? Diese Frage hatte ich mir immer gestellt, wenn ich an ihn dachte. Es war wie eine Dauerschleife in meinem Kopf. Schließlich war ich ihm seit Ewigkeiten freundschaftlich verbunden. Aber hatte ich überhaupt das – wenn auch gut gemeinte – Recht, diese Frage zu stellen? Hatte ich nicht einfach zu akzeptieren, dass zum Einen nicht alle studieren mussten, um ihre persönliche Erfüllung zu finden? Und zum Anderen: Hatte ich in meinem Berufsleben nicht selbst äußerst eigenwillige Wege eingeschlagen? Aber Richy war so klug und begabt; es schien mir eine Vergeudung, dass er seine Talente der Menschheitsfamilie vorenthielt.
Als ich diese Meinung gegenüber Emma einmal ausgesprochen hatte, hatte sie mich verwundert angeschaut und gesagt: „Eine Nummer größer geht’s wohl nicht, was? Menschheitsfamilie! Hat dein Freund irgendeinen Vertrag mit der »Menschheitsfamilie« unterschrieben?“
Ich ging in mich und nahm mir vor, ihn nicht mehr darauf anzusprechen. Wollte ich, dass mich jemand aus meinen alten Freundschaftskreisen fragte, warum ich, der ich mich als Antikapitalist verstand, nun als Unternehmer tätig war?
Dann musste ich plötzlich an Rolf denken, der durch das Saufen Invalide geworden war. Richy kümmerte sich um unseren ehemaligen WG-Alkoholiker so gut er konnte. Dafür war ich Richy insgeheim unendlich dankbar, denn ich, als alter „Ursprungsfreund“ von Rolf, konnte es nicht stemmen. Nicht nur, weil ich fernab von Berlin zu Hause war. Nein, auch mit Familienanhang und mit meiner beruflichen Laufbahn war es mir einfach unmöglich. Ich wusste, dass sich neben Richy noch immer die Zeugen Jehovas um Rolf, den ex-dogmatischen Ex-Marxisten, liebevoll kümmerten. Irgendwie nahm mir dieser Gläubigen-Bund das schlechte Gewissen.
Erst neulich hatte ich den »Wachtturm« der Sekte in meinem Briefkasten gefunden. Wie so oft warf ich einen Blick hinein, bevor ich ihn wegwarf. Und immer wieder fand ich darin wunderliche, kindische Dinge, von denen ich nicht glauben konnte, dass erwachsene Menschen mit normaler Schulbildung und normalem Verstand sie glauben konnten. Dieses Mal avancierte der Wachtturm, gleich neben „Asterix und Obelix“, zu meiner bevorzugten Klolektüre. Mich interessierte natürlich, was unser Schöpfer mit uns vorhat. Und so las ich: „Unser Schöpfer hat von Anfang an durch Engel und Propheten mit den Menschen kommuniziert. Und er hat das, was er uns sagen will, aufschreiben lassen.“ Aha, dachte ich, dann ist der Gepriesene vor ein paar Jahrtausenden doch noch nicht so allmächtig gewesen, um das Internet zu erfinden und musste sich von solchen Leuten wie Timotheus, Petrus und Matthäus abhängig machen. Wie hat er das überhaupt gemacht?
„Gott hat den Propheten seine Gedanken in den Sinn gegeben. Es ist ähnlich wie bei einem Assistenten, der für seinen Chef einen Brief verfasst. Auch wenn der Assistent der Schreiber ist, gilt doch der Chef als Verfasser. Dieses Prinzip lässt sich auch auf die heiligen Schriften übertragen. Gott hat zwar menschliche Schreiber gebraucht, doch der Autor ist er. Seine Botschaft berührt unsere Zukunft.“ Uff, das war eine Erklärung, die mir als Schreiber verschiedener Texte, die mir einfach so in den Sinn gekommen waren, plötzlich eine Erleuchtung bescherte. Sie brachte mich ohne mein willentliches Zutun zum Schmunzeln. Vielleicht war ich ja, ohne es zu wissen, auch ein gottbegnadeter Schreiber dieses omnipräsenten Allmächtigen, der alles über die Zukunft wusste.
Wenn es um die Zukunft ging, war ich derzeit sehr hellhörig. Würde die GTU die Stürme der Zeit – also die knappe Kasse der Arbeitsverwaltung – und die Marotten eines hinterrücks intrigierenden Arbeitsamts-Abteilungsleiters überstehen? Da gab es neuerdings einen neuen Vorgesetzten unserer Erzfeindin, Frau Söhnlein, die uns bei jedem Kurs-Neuantrag Steine in den Weg legte und die Amts-Zahlungen bis zu sechs Monaten verzögerte. Sie schien ihren neuen Abteilungsleiter, Dr. Braun, gegen unser Bildungsinstitut gebrieft und ihm viel Mist erzählt zu haben. Jedenfalls warnten mich Herr Lewin und Herr Scherwarth vor ihm. Beide waren als Arbeitsberater für die fachliche Beurteilung unserer Umweltkurse zuständig.
„Er ist ein scharfer Hund und spielt sich gerne auf. Er hat mich bereits über Ihr Institut ausgefragt und das in einem sehr merkwürdigen Ton. Mir schwant da nichts Gutes. Er ist ein typischer Aufsteiger, der sich jetzt irgendwie beweisen muss“, hatte Lewin gemeint.
„Kann er denn der GTU etwas?“
„Nur, wenn er grundlegende Kritikpunkte findet. Aber solange die Vermittlungsergebnisse Ihrer Absolventen auf dem neuen Umweltarbeitsmarkt so hervorragend sind und solange ich die arbeitsmarktliche Zweckmäßigkeit attestiere, kann er eigentlich wenig machen.“
„Eigentlich“. Das Wörtchen sollte schon bald Bedeutung erhalten.
Meine Gedanken floppten zurück zum FDP-Minister Möllemann und seinem Versprechen, mehr Finanzmittel für Bafög und Bildung und bezahlbaren Wohnraum bereit zu stellen. Es war klar, dass dieses Versprechen nicht eingelöst würde. Aber wen juckte es, wenn die Studenten nicht unüberhörbaren Rabatz machten?
Doch wären sie so zäh und mutig wie die Studenten der 68er-Zeit? Wahrscheinlich würde das Politikversprechen im Archiv des Bonner Bildungsministeriums von Motten zerfressen enden. Und in Sachen Hinhaltetaktik hatten unsere Politiker seit damals enorm dazugelernt. Wahrscheinlich würde die jetzige studentische Erhebungswelle wieder mit allerlei wortreichen Streicheleinheiten aus Bonn hingehalten werden, damit sie im Laufe der Zeit hoffnungslos abebbt.
Dann schwappte eine Nachricht von Ost nach West. Am 19. Januar versicherte DDR-Staats- und Parteichef Erich Honecker, die Mauer werde „in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben, wenn die dazu vorhandenen Gründe noch nicht beseitigt sind.“
Die Zahl der Ausreisewilligen in der DDR schien mir in letzter Zeit rasant zu steigen. Es gab hierzu keine Statistiken, aber mein Bauchgefühl entstand aus den bruchstückhaften Alltagsnachrichten. Tamara, meine Freundin aus Ostberlin, schrieb dazu eine Ansichtskarte mit einem Aussichtsturm, dazu einen einzigen Satz: „C’est la vie.“
In den USA löste der Ölmagnat George Bush den Staatsschauspieler Ronald Reagan als 41. Präsidenten ab. Was weder Gewinn noch Verlust war. Ein kultureller Verlust war hingegen der Tod des surrealistischen Malers, Bildhauers und Grafikers Salvador Dali, der im nordspanischen Figueras starb. Später, als Emma und ich überraschend im September beschlossen, einen Kurzurlaub in Figueras zu machen und Dalis Haus zu besuchen, sollte dies zu einem beinahe tödlichen Urlaub für unsere beiden Kinder geraten – aber das war im Januar noch weit entfernte Zukunft.
In meinem kleinen Universum jedenfalls jagte eine Supernova die andere. Große politische Überlegungen wurden zunehmend von meinem bürgerlichen Unternehmeralltag verdrängt. Als erstes verdrängte Mitte Januar der Besuch von Meise und diesem merkwürdigen Anlageberater namens Jürgen Harksen meine politische Kaffeesatzleserei.
„Darf ich Sie wirklich wie eine Zitrone ausquetschen?“, fragte ich völlig unverhohlen, denn Herr Harksen hatte mir dies gerade angeboten. Meise, der unbescholtene, von ständiger Geldabwesenheit gesegnete Künstler, saß als stiller Zuhörer in unserer Runde.
„Immer zu! Ohne Fragen kann man nichts wagen“, lächelte mich der Mann im dunkelblauen Zwirn an. „Investments sind immer Wagniskapital, aber glauben Sie mir: Meine Börsenentscheidungen beruhen auf jahrelangem Erfolg!“
„Mich interessiert natürlich Ihre berufliche Qualifikation, wenn ich Ihnen einige tausend Mark anvertrauen soll.“ Wohlweislich hatte ich mit Emma besprochen, dass wir keinerlei Auskünfte über unsere Investitionsschlappe in Sachen Getreide geben würden. Wir wollten uns schlicht und einfach völlig dumm stellen und wissen wollen, wie Harksen gedenke, aus wenig Geld ein Vermögen zu machen.
„Ich habe mich ganz privat in das Geschäft der Anlageberatung eingearbeitet. Wie alles begann?“ Harksen sah mich fragend an, und ich nickte. „Aus unseren ersparten 15.000 Mark erwirtschaftete ich durch den Kauf und Verkauf von Aktien über meine Bank eine Rendite im zweistelligen Prozentbereich. Weil meine Frau von meiner Begabung als Aktienprofi ihren Sportkameraden vorschwärmte, kamen die bald zu mir und legten einige tausend Mark an, auf dass ich mehr daraus mache. Für mich selbst fielen zehn Prozent des Gewinns als Beteiligung ab.“
„Und daraus entwickelte sich in so kurzer Zeit Ihr Anlageimperium?“, fragte ich. Harksen hatte zuvor berichtet, dass er große Investmentfirmen in Dänemark und Norddeutschland besitze, dazu Immobilien in finanziellen Größenordnungen, die seine Börsengeschäfte mit Millionenbeträgen absicherten.
Der Finanzmann fuhr fort: „Natürlich dauerte alles seine Zeit. Nach den Sportkameraden meiner Frau kam eines Tages der Besitzer des Fitnessclubs und wollte auch bei mir investieren. Zu dieser Zeit begannen die Börsengeschäfte deutschlandweit zu boomen. Der Fitnesschef fragte mich, ob ich eine Firma mit Gewerbeerlaubnis besäße. Ich schüttelte den Kopf. Der neue Kunde überzeugte mich, dass ich die Anmeldung als seriöses Aushängeschild bräuchte und kannte jemanden bei der Handelskammer. Es dauerte keine zwei Wochen, schon besaß ich eine eingetragene Firma mit dem schlichten Namen »Nordanalyse« und die Gewerbeerlaubnis.“
Das interessierte mich. „Benötigten Sie dazu irgendeinen Qualifikationsnachweis?“
Harksen schüttelte lächelnd den Kopf. „Anlageberatung ist kein Ausbildungsberuf. Es ist eine Begabung.“
Emma schaute etwas verwundert. Ich war von Harksens unbedarfter Ehrlichkeit überrascht. Dass auch dies nur eine Masche war, durchblickten wir erst viel später.
„Der Fitnessclubbesitzer sammelte in seiner Familie, es kamen 7.000 Mark zusammen“, fuhr Harksen mit entwaffnender Offenheit fort. „Ich gab ihm das Geld nach wenigen Monaten mit zehnprozentiger Verzinsung zurück. Das sprach sich in Windeseile im Freundes- und Bekanntenkreis der Familie herum. Nun hatte ich schon zehn Kunden. Die Börse boomte weiter. Da ich den Kunden regelmäßig selbst erstellte Kontoauszüge gab, waren sie beruhigt und ließen ihr Geld stehen. So konnte ich mit immer größeren Beträgen handeln.“
„Selbst erstellte Kontoauszüge?“, fragte ich.
„Selbstverständlich! Weil ich ja individuelle Anlagen tätige und meinen Kunden entsprechende treuhänderische Sicherheiten gebe.“
Was Harksen Meise, Emma und mir zu dieser Zeit verschwieg, war folgendes: Ende 1987 hatte er seinen ersten gebrauchten Jaguar für 11.000 Mark gekauft, wusste aber nicht, wovon er ihn innerhalb der vereinbarten Zahlungsfrist bezahlen sollte. Er wollte unbedingt den Jaguar – und zwar als Renommierobjekt, denn er hatte sehr schnell erkannt, dass seine gierigen Kunden auf schnelle Geschosse abfuhren. Dass sie also leicht mit Statussymbolen zu blenden waren.
Auf die Idee, eine Anleihe bei den geparkten Termingeldern der Kunden zu machen, brachte ihn ausgerechnet ein Banker. Ohne zu wissen, dass dieses Geld gar nicht Harksen gehörte, schlug er ihm eine simple Umbuchung vor. Nun war der Damm gebrochen. Da die realen Gewinne und auch Teile der Einlagen nun formal in Harksens Privateigentum übergegangen und bereits ausgegeben waren, fing er an, auf seinen individuellen Kontoauszügen für die Kunden fiktive Gewinne gutzuschreiben.
Wenn Anlagen gekündigt wurden, waren es meist kleinere vierstellige Summen, die er problemlos aus frischen Einlagegeldern bedienen konnte. Jahre später wird mir Harksen gestehen, dass ihm manchmal mulmig bei dem Gedanken geworden sei, dass alle seine Kunden gleichzeitig kündigen könnten. Doch die Stimme seines Gewissens hatte damals offenbar keine Chance.
Wir verabschiedeten Meise und Harksen am Abend. Sie übernachteten im noblen Frankfurter Hof, mit dem ich aus einem ganz und gar anderen Grund sehr bald schon zu tun haben würde. Emma und ich wollten Harksens Angebot überschlafen. Er versprach treuherzig, aber durchaus mit Argumenten, die uns überzeugend erschienen, einen Gewinnfaktor von 300 Prozent nach eineinhalb Jahren Anlagezeit bei einer Mindest-Anlagesumme von 50.000 Mark. Kaum waren die beiden zur Tür hinaus, waren Emma und ich uns einig, dass solch eine unseriöse Sache nicht in Frage kommt. Ich gab ihm am nächsten Morgen nach dem Frühstück telefonisch Bescheid. Er nahm es gelassen.
„Wenn Sie es sich doch noch anders überlegen – Sie können mich jederzeit anrufen!“
„Vielen Dank. Vielleicht kommen wir auf Ihr Angebot zurück. Aber im Moment wissen wir nicht, woher wir ein solche Summe nehmen sollten.“
„Sie können bei Ihrer Bonität und Ihrem Gehalt doch problemlos einen Kredit aufnehmen.“
Da sprach Harksen etwas an, was mich seit langem drückte. Für jede Konto-Überziehung, für jede Zahlungsverzögerung durch das Förderbüro der Arbeitsverwaltung musste ich als Geschäftsführer privat bürgen. Da nutzte mir die Haftungsbeschränkung der gemeinnützigen GmbH herzlich wenig. Ich selbst musste dran glauben, falls ein Kredit platzte. Für Harksens Risiko-Blanko-Scheck war da absolut kein Raum. Schon jetzt wachte ich nachts oft genug schweißgebadet auf, weil durch die unregelmäßigen und verzögerten Zahlungen des Arbeitsamtes im Nu enorme Liquiditätsengpässe zustande kamen. Denn Gehälter, Mieten, diverse Nebenkosten, Sozialbeiträge, Laborbestellungen, Lehrbücher-Ausgaben, Zeitungs-Abonnements und Versicherungskosten liefen fix und flott weiter.
Am Abend schalteten Emma und ich ab. Emma hörte Musik und ich las ein wenig in Zeitschriften. Karola und Luca hatte ich eine Gute-Nacht-Geschichte vorgelesen. Ihr derzeitiges Lieblingsbuch trug den Titel »Ich habe einen Freund …« Ich kannte den Text inzwischen auswendig, ohne einen Blick auf die Seite werfen zu müssen. Auch Karola konnte ihn in einer Art Singsang bereits vortragen: König und Königin luden mich ein/ am Sonntag zum Tee ihr Gast zu sein./ Ich sagte zur Königin: „Bitte frag deinen Mann,/ ob ich einen Freund dazu mitbringen kann.“/ Da sagte der König: „Ach, das wäre fein!/ Jeder Freund unsres Freundes soll uns willkommen sein.“/ Und ich brachte meinen Freund mit … (Es war eine haushohe Giraffe). Mein Freund nahm Platz gleich neben mir,/ dann gab es Tee für uns alle vier.
Und so gelangten im Laufe des Bilderbuchabends noch einige Tierfreunde an den königlichen Hof, an jedem Wochentag ein neuer Freund, das Nilpferd, eine Horde Affen, ein Elefant, ein Löwenpärchen, ein Seelöwe und ein Krokodil. Zum Schluss, nach einer durchreisten gastfreundlichen Bilderbuchwoche, sagte Karola den Text alleine auf: König und Königin baten mich:/ „Komm Samstag zum Tee! Wir erwarten dich.“/ „Nein, Nein! Meine Freunde laden ein. Diesmal sollt IHR die Gäste sein!“ Das Bild dazu zeigte einen Zoo-Käfig, in dem alle – samt König und Königin – gemütlich beisammen saßen, und der Text lautete: Wir saßen froh beim Tee im Zoo.
Da musste ich in mich hinein lächeln, denn ich stellte mir Königin Elisabeth II. und Prinzgemahl Philip, Duke of Edinburgh, vor – wie sie hinter Zoo-Gittern inmitten einer Affenhorde ihre Tea-Time abhielten.
Endlich war Feierabend und ich froh, nicht nach dem Vorlesen eingeschlafen zu sein.
Emma und ich machten uns einen gemütlichen Abend und schalteten das Fernsehen an. „Schau mal, da läuft was über Ton Stein Scherben“, rief Emma. Es lief gerade ein Beitrag über die Scherben, hauptsächlich aber über Rio Reiser. Ich schaute fasziniert in den Kasten, sah ich doch nach Ewigkeiten wieder einmal meinen alten Bekannten aus Berliner Zeiten.
Da sitzt Rio mit seiner Gitarre unter einem Baum, schaut versonnen in die Kamera und antwortet auf die Frage des Reporters, wo er seine Heimat hat: „Falls mich jemand sucht, meine Heimatadresse kann ich angeben: Ich wohne am äußeren Ende eines Spiralnebels namens Milchstraße im System Sonne, Planet Erde.“
Natürlich wussten wir, wo sein Zuhause war, nachdem er Westberlin verlassen hatte. Er wohnte jetzt im Norden Deutschlands, in Fresenhagen. Seine echte Heimat aber war es nicht, die musste er sich ersingen. Er hatte es getan, und über den Tag hinaus waren seine Lieder für viele zu einer Heimat geworden, die es früher nur als Schnulze gab. Wir hörten uns noch seine Songs an, die zwischendurch und im Abspann gespielt wurden. Ich fand seine Ballade Für immer und Dich am schönsten. Dann spielte er aus dem Album »Blinder Passagier« den Song Ich denk an Dich.
Ein Toter wacht auf
Ich konnte nicht an meinen ein Jahr älteren Kumpel Veit Herrmann denken, weil ich nicht wusste, was geschehen war. Auch hatte er niemals mit mir über Suizid gesprochen. Er war mir als lebenslustiger Kumpel in Erinnerung.
Zwei Wochen sind inzwischen vergangen. Veit hört eine Stimme. Nein, es sind mehrere. Er bemüht sich herauszufinden, woher sie kommen, kann sie aber nicht lokalisieren. Langsam öffnet er die Augen; alles um ihn herum erscheint verschwommen. Wieder hört er diese eine Stimme, die Stimme einer Frau, ganz in seiner Nähe.
„Ich glaube, er kommt zu sich …“
Er begreift sofort, dass er von »irgendwo« zu sich kommt, aber nicht von woher und warum und weshalb er überhaupt etwas hört und nicht sieht. Wo könnte er sein?
„Herr Herrmann? Können Sie mich hören?“
Die Stimme klingt amtlich und bemüht sachlich. Was will diese Frau von ihm, wer ist sie, in wessen Auftrag handelt sie? In den grauen Schleiern, die ihn umgeben, bewegt sich ein Schatten. Er könnte zu der Stimme gehören, die zu ihm spricht.
„Verspüren Sie Schmerzen?“
Veit versucht nachzudenken, aber das Denken fällt ihm schrecklich schwer. Er fragt sich, warum er Schmerzen haben sollte. Er fühlt sich unergründlich schwach, aber Schmerzen? Nein, ihm tut nichts weh. Also schüttelt er den Kopf, was ihm genauso schwer fällt wie Denken.
„Herr Herrmann, Sie haben sich vor zwei Wochen vor einen Zug geworfen …“
Wohin hat er was geworfen? Veit muss lange und tief in seinem Gedächtnis buddeln, ehe es Klick macht. Ja, er wollte springen. Vor eine S-Bahn wollte er springen. Wann? Er weiß es nicht mehr. Alles scheint eine Ewigkeit her zu sein. Tatsächlich, so dämmert ihm, hat er sich schließlich vor einen durchrauschenden Zug geworfen.
„Sie waren lange im Koma. Sie sind jetzt sicher. Sie sind im Krankenhaus. Wir haben Sie operiert“, sagt die Frau, die Veit immer noch nicht sehen kann und von der er nichts weiß, außer dass sie mit ihm spricht wie eine Krankenschwester. Eine Krankenschwester! Sie wird eine Krankenschwester sein. Oder eine Ärztin.
Im Schneckentempo entwickelt sich ein Szenario in seinem Kopf. Er begreift, dass er irgendwann tatsächlich gesprungen war und der Zug über ihn hinweg gerast war. Und jetzt war er im Krankenhaus. Er war nicht tot.
„Wir mussten Sie operieren. An den Beinen.“
Diese fast gütig klingende Bemerkung jagt ihm einen ungeheuerlichen Schrecken ein. Veit hat sich die oft leidvollen Jahre hindurch mit regelmäßigem Joggen und Schwimmen emotional über Wasser gehalten und den tiefen Depressionen tapfer die Stirn geboten. Sein Leben konnte er nur noch mit Sport halbwegs am Laufen halten – alles andere war eine tägliche Qual. Diese OP kann gewiss nichts Problematisches gewesen sein, denkt er. Seine Beine haben immer viel ausgehalten.
Die Augen fallen ihm zu, und Veit döst weg. Als er sie wieder öffnet, weiß er nicht, ob er ein paar Sekunden, einige Minuten oder vielleicht auch länger geschlafen hat. Er verspürt starken Durst und versucht etwas zu sagen.
„Sie sind an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Sprechen geht im Moment noch nicht“, sagt die weibliche Person. „Ich gebe Ihnen einen Stift. Augenblick bitte.“
Etwas raschelt, er hört Schritte. Dann drückt ihm jemand einen Stift in die linke Hand. Er stöhnt und versucht den rechten Arm zu heben.
„Das geht noch nicht, Herr Herrmann. Ihr rechter Arm ist gebrochen, aber er heilt gut.“
Man hat an meinen Beinen rumgedoktert, mein rechter Arm ist gebrochen und ich kann nicht sprechen, denkt Veit. Er kann sich nicht vorstellen, dass es ihm irgendwie schlecht gehen soll; er spürt noch immer keine Schmerzen. Die grauen Schleier rund um ihn herum lösen sich allmählich auf und mit ihnen verwandelt sich der Schatten, der immer deutlicher als eine konkrete Person in einem weißen Kittel zu erkennen ist. Die Frau ist eine Krankenschwester, wie Veit vermutet hatte, und sie drückt ihm jetzt einen Stift in die Hand und hält ihm einen Schreibblock hin.
Veit strengt sich übermenschlich an. Ganz langsam, unregelmäßig auf dem Papier abrutschend, kristallisiert sich ein Wort heraus: »Kaff …«.
„Wünschen Sie Kaffee?“, fragt die Schwester.
Veit versucht zu nicken und weiß nicht, ob sie es sieht.
„Du brauchst jetzt nichts sagen“, sagt plötzlich eine ihm sehr bekannte Stimme. „Veit, kannst du mich sehen und meine Stimme erkennen?“, fragt die Stimme, die früher, in seinem anderen Leben, zu seiner Freundin gehört hatte.
Die Stimme kommt von der anderen Seite des Krankenbettes. Er dreht den Kopf zu ihr.
Ja, ich nehme dich wahr!, will er sagen. Obwohl es sinnlos ist, versucht er es.
„Liebster, ich bin es, Mariola; du brauchst nichts zu sagen“, sagt sie leise. „Es geht noch nicht mit dem Sprechen, weil du einen Schlauch im Mund hast. Aber ich bin hier mit deinen Eltern.“
Wer hat sie informiert?, denkt Veit. Er will dringend etwas fragen und schreibt »Bein« auf den Schreibblock, den jetzt Mariola festhält, während seine Mutter ihm den Stift abnimmt und seine Hand hält. Dann hört er seine Mutter sagen: „Mein Sohn, wir müssen dir sagen, dass deine Beine nicht mehr da sind.“
Veit glaubt, sie nicht richtig verstanden zu haben. Wie können seine Beine weg sein, während er noch lebt?
„Die Bahn ist über deine Beine gefahren und sie sind weg“, sagt seine Mutter und streichelt ihm die Hand.
Er erkennt seinen Vater, der hinter der Mutter steht und still weint, aber nichts sagt. Veit ist schockiert und von der Vorstellung, ohne Beine zu sein, völlig überrascht. Auch er weint jetzt, beruhigt sich aber gleich darauf wieder. Er will es seinen drei Besuchern nicht so schwer machen. Die Schmerzpumpe, an die er angeschlossen ist, verhindert eine totale Panikattacke.
Mariola nimmt jetzt den Platz der Krankenschwester ein und streichelt über Veits Wange. „Alles wird wieder gut“, sagt sie. „Wie früher. Du bist ein Kämpfer und schaffst es auch im Rollstuhl.“
Veit nickt, und beiden läuft eine Träne die Wange hinunter. Die Krankenschwester kommt ins Zimmer und bringt den Kaffee mit einem Strohhalm, aber Veit mag nicht mehr. Er ist angekommen bei Kapitel Null seines neuen Lebens.
Ein Jahr später wird er mir davon berichten.
Und ich düse, düse im Sauseschritt
Salman Rushdie ist ein indisch-britischer Schriftsteller, und ich weiß, dass er zu den zeitgenössischen Vertretern der britischen Literatur gehört. Ich mochte seine Erzählungen nicht sonderlich.
„Literatur ist Geschmackssache, daran kann man nicht rütteln“, antwortete ich in der Saunarunde mit unseren Nachbarn, als Gunnar mich fragte, was ich von Rushdie halte.
„Ich meine doch nicht seine Literatur“, sagte Gunnar.
„Und ich meine nur seine Schreibe“, antwortete ich. „Irgendwie komme ich damit nicht klar. Seine Erzählungen schwanken zwischen einer Märchenwelt und unserer Wirklichkeit, sodass ich manchmal nicht weiß, worum es sich handelt. Sein Stil ist mir einfach zu anstrengend. Ich lese gerne, um mich zu entspannen. Wenn dabei etwas Wissen abfällt, umso besser. Rushdie ist da nichts für mich.“
„Ja, er vermischt Mythos und Fantasie mit dem realen Leben. Dieser sogenannte »magische Realismus« ist nicht jedermanns Sache, okay.“ Gunnar läuft der Schweiß über das Gesicht, und er schaut auf das Thermometer. „Wir haben hier drin 86 Grad, puh.“
Im Iran hat Ajatollah Khomeini alle Moslems zur Ermordung von Rushdie aufgerufen. Fatma heißt das auf Islamistisch, das klingt irgendwie sachlicher. Der Autor hätte mit seinem Roman „Die Satanischen Verse“ den Propheten Mohammed verunglimpft.
„Jetzt sind wir schon so weit, dass die religiösen Fanatiker im Ausland unsere Schriftsteller im Westen bedrohen und zum Abschuss freigeben. Wo wird das noch enden?“, empörte sich Tobias.
Auch mir war es zu heiß, und ich stieß die Sauna-Tür nach außen auf, um mich gleich unter der eiskalten Schwalldusche abzukühlen.
Tobias und seine Frau Anne waren stark christlich ausgerichtet, und natürlich lag er mit seiner Bemerkung richtig. Spontan dachte ich dennoch an jene radikalen Christen, die Abtreibungen für Teufelswerk hielten. Sie scheuten sich nicht davor, selbst vergewaltigten minderjährigen Mädchen und deren Abtreibungsärzten mit Tod und Teufel zu drohen. Sie fügten ihnen, ohne mit der Wimper zu zucken, seelischen und körperlichen Schmerz zu, weil nach ihrer fanatischen Auffassung der heranwachsende Fötus unbedingten Vorrang habe – selbst unter Bedingungen einer Vergewaltigung.
Ich hielt meine Meinung zurück, weil der Vergleich in diesem Fall hinkte. Es war freilich etwas ganz anderes, wenn ein Staatsführer seine weltweite Anhängerschar zu einem gezielten Mord aufrief.
„Salman Rushdie wird sich ein Leben lang verstecken müssen“, sagte ich. „Ein Leben in der persönlichen und materiellen Isolation. Schrecklich!“
„Schon gehört? In Ungarn verzichten die Kommunisten auf ihren Führungsanspruch. Freiwillig!“, wechselte Gunnar das Thema.
„Und die Volkskammer hat den ständig in der DDR lebenden Ausländern, den Mozambikanern, Vietnamesen und Kubanern das aktive und passive kommunale Wahlrecht eingeräumt“, sagte ich, da mir Tamara aus Ostberlin gerade einen Brief geschrieben hatte, in dem sie darauf hinwies. Ich verstand ihre Anspielung, denn wir hier in der BRD taten uns noch schwer mit der Integration, insbesondere mit der kommunalen Wahlbeteiligung unserer Gastarbeiter und ihrer Nachfolge-Generationen.
„Na, heute sind wir ja allumfassend über das wichtigste Weltgeschehen informiert“, lachte Gunnars Frau Moni. Und dann legte sie in ihrer unverwechselbaren mütterlichen Art nach und kam auf das Thema Kindererziehung zu sprechen.
Wie so oft ging es auch heute wieder einmal bei den Frauen um das Leistungsprinzip bei unseren Kids. Was durfte man von den Kleinen fordern, was war eine Überforderung? Sie diskutierten in der Küche, wo sie die Salate für unser gemeinsames Essen nach der Sauna vorbereiteten.