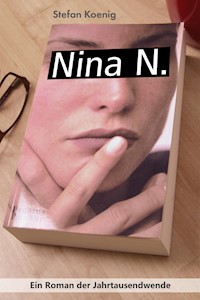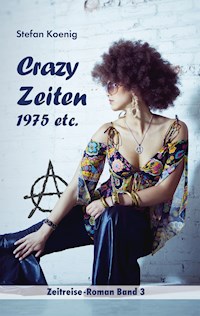Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Stefan Koenigs neuer Roman »Der Fremde« gleicht einer postmodernen Parabel, versetzt mit Elementen eines mystischen Thrillers – und dreht sich erwartungsgemäß um politische Doppelmoral, um Schuld, um Sühne und um Naturdesaster, von denen wir seit 40 Jahren wissen und die uns heute fluten. Überraschung? Überraschend nimmt Koenigs Geschichte eine Wende, als der jung erscheinende, gut aussehende Fremde sein wahres, uraltes Gesicht zeigt. Ein Jahrhundertsturm wütet. Und jener Fremde, ein unheimlicher Mensch – wenn er denn ein Mensch ist – hält eine Kleinstadt in Atem. Sein Name ist Niko Lamor, aber er hat kein Dokument, das ihn ausweisen könnte, kein Ausweis, keine Kranken- oder Kreditkarte, einfach nichts. Dafür verfügt er über das Talent eines dämonischen Zauberers mit der Gabe, die Bürger gegeneinander auszuspielen und Misstrauen und Zwietracht zu säen. Ist er der Urheber eines monströsen Zerstörungsprojektes, das sich als Logistikmonster darstellt? Die Gemeinschaft der Bürger wird auf eine harte Probe gestellt. Als mysteriöse Selbstmorde geschehen und das winterliche Unwetter Opfer fordert, hat man Lamor in Verdacht. Der Fremde hat ein Ziel – aber welches? Verlangt er ein Menschenopfer? Er hat ein Auge auf die Kinder der Gemeinde …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 257
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stefan Koenig
Der Fremde - Lich, 19. Januar 2022
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Der Fremde - Lich, 19. Januar 2022
Der Fremde
Kein Vorwort
Pro forma
Die Vorgeschichte
Magie oder Maggi?
Die Prediger & die Träume
Ab ins Wasser!
Aufräumen im Kinderland
Dauerhupen
Kinderbesuch in der Villa
Die Wählerversammlung
Die Abstimmung
Die Entscheidung
Zehn Jahre später
Noch ein paar Monate später
Dank
Statt eines Nachwortes:
Falls es Sie interessiert …
Inhaltsverzeichnis des gedruckten Buches
Impressum neobooks
Der Fremde - Lich, 19. Januar 2022
Stefan Koenig
Der Fremde
Lich, 19. Januar 2022
Eine fantastische
Roman-Zeitreise
(Fortsetzung von
»Sturm über Lich – 2022«)
© 2021 by Stefan Koenig
Mail-Kontakt
zu Verlag und Autor:
Postadresse:
Pegasus Bücher
Postfach 1111
D-35321 Laubach
Wie Sie bereits wissen:
Die Geschichte zählt,
nicht der Erzähler.
Irgendwo in Kanada
Macht ein Schmetterling nur ein‘ Flügelschlag
Ein paar Stunden später dann
Jagt mich hier bei uns ein Sturmtief durch den Tag
Früher war scheinbar alles leichter
Sonderbar, wenn ei‘m die große weite Welt
Plötzlich auf die Füße fällt
Ich halt‘ die Luft an, bis alles wieder stimmt
Die Wolken sich verziehen, ‘ne gute Zeit beginnt
Ich halt‘ die Luft an, bis alles wieder geht
Die Welt, wie ich sie kenn‘, sich einfach weiterdreht
Oh-oh-oh-oh
Ich halt' die Luft an, bis ich nicht mehr kann
Jemand twittert irgendwas
Und am nächsten Tag ist alles nichts mehr wert
Einer sprengt was in die Luft
Weil ihn meine Art zu leben so sehr stört
Grenzenlos fluten mich die Bilder übergroß
Ganz egal, was auch passiert
Passiert ab jetzt auch immer hier
Ich halt‘ die Luft an, bis alles wieder stimmt
Die Wolken sich verziehen, ‘ne gute Zeit beginnt
Ich halt‘ die Luft an, bis alles wieder geht
Die Welt, wie ich sie kenn‘, sich einfach weiterdreht
Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh
Ich halt‘ die Luft an, bis ich nicht mehr kann
(Ina Müller)
Stefan Koenig
Der Fremde
Bericht über das Ereignis in Lich
am Mittwoch,
dem 19. Januar 2022
Auf ewig widme ich das Buch
all jenen Licher Bürgern,
die sich niemals damit abfinden können,
dass über ihre Interessen hinweg
entschieden wurde.
Und natürlich widme ich es meinen treuen
Leserinnen und Lesern, immer in der Hoffnung,
dass sie noch gut schlafen können.
Kein Vorwort
Nicht hier
Nicht jetzt
Ich weiß, dass Sie mich verstehen.
Dafür ein herzliches Dankeschön!
Ihr Stefan Koenig
Anfang Dezember 2021
Pro forma
Und dennoch völlig im Ernst:
Bitte vergessen Sie nicht,
dass es sich bei dem vorliegenden Werk
um eine frei erfundene Story handelt.
Keine Angst also!
Personen-Namen, Straßen-Namen,
die Ihnen vielleicht
durchaus bekannt vorkommen mögen,
gehören nicht
zu real existierenden Personen oder Orten.
Jedenfalls gibt es sie so nicht, nicht so!
Orte, Ereignisse und Romanfiguren
sind allesamt Erfindungen.
Nackte Illusionen.
Faktische Fiktionen.
Fiktive Fakten.
Lich – gibt es diesen Ort wirklich?
Ich bin mir in nichts mehr sicher.
Vielleicht wissen Sie mehr.
Die Vorgeschichte
Ich bin bei meiner Freundin in einer lieblichen Kleinstadt und mache einen Spaziergang. Es ist Juni, eigentlich ein Sommermonat im Jahr 2021. Zwei kleine Jungs bauen vor meinem Lieblingscafé einen Schneemann aus Holz. Es ist zwar kalendarischer Sommer, aber doch kein richtiger Sommer; irgendwas ist falsch. In Frau Knauers merkwürdigem Trödel-Laden in Lich schneit es aus einem Winterbild und auf ihrer Märklin-Anlage liegen Tote neben eingestürzten Häusern und fortgespülten Brücken in einem engen, überschwemmten Tal.
Vier junge Leute ertrinken in einem Badesee, zwei Mädels und zwei Jungs. Die jungen Frauen haben in der Buchhaltung eines Logistikkonzerns gearbeitet und sind auf eine Merkwürdigkeit gestoßen. Ein Fremder mit Maske und schwarzem Hut steht am Uferrand und lächelt.
In einer geheimnisvollen Villa in Lich treffen sich Männer, um sich merkwürdige Geschichten zu erzählen. Im Garten des Anwesens sehe ich eine Gestalt mit schwarzem Hut und schwarzem Mund-Nasen-Schutz. Ich bin neu in diesem Herren-Club, wenn es denn ein Club ist, aber diesen Fremden sehe ich dort nie wieder.
Ein großes Unwetterereignis, eine unvorstellbar heftige Flut, bringt Tod, Leid und Zerstörung in den Westen Deutschlands. Der Fremde hält sich dort eine Weile auf. Ein alter Mann, der Gynäkologe Herbert Kotschmann aus dem Teilnehmerkreis des Herren-Clubs, der seine Tochter im Ahrtal besucht, kommt auf tragische Weise in den Wassermassen ums Leben. Er hinterlässt eine Geschichte, die uns sein Freund, Dr. Harry Stiebert, zu Weihnachten vortragen möchte.
Inzwischen verlässt der Fremde das Ahrtal und fährt mit der Bahn gen Süden, in Richtung Offenbach – sein Ziel ist der Deutsche Wetterdienst. Zwei Zugschaffner, die ihn kontrollieren wollen, liegen am Ende der Fahrt tot in ihren Dienstabteilen. Später können die Gerichtsmediziner keine Fremdeinwirkung feststellen.
Kurz vor Weihnachten erzählt Stiebert die Geschichte Kotschmanns. Es ist die Geschichte einer verfluchten jungen Frau und einer verfluchten Geburt. Die Villa, die Männer und die Geschichten machen mich nachdenklich. Und dann plötzlich naht ein unerwartetes Unwetter. Am 17. Januar 2022 beginnt ein ungewöhnlich starker Schneesturm und die Wetterfee des Deutschen Wetterdienstes warnt ebenso wie ihre Kollegen vor einem außergewöhnlich heftigen meteorologischen Ereignis über der Mitte Deutschlands. Zentrum des Jahrhundertsturms soll Lich sein. Man fordert die Politiker und Bürger auf, Vorsorge zu treffen.
Bürgermeister Jonas Cäsar, seine Sekretärin und die Rettungsdienste treffen diese Vorsorge. Doch dann tritt ein Fremder in Erscheinung, der das hübsche Fachwerkstädtchen und das Rathaus, in dem die Menschen vor dem Sturm Zuflucht suchen, zur Hölle macht. Der Mord an einer alten Dame, der Selbstmord eines Drogendealers, ein weiterer Suizid eines Sanitäters und die anscheinend hellseherischen Fähigkeiten des Fremden lassen die Menschen an ihrem Verstand zweifeln. Die beiden Stadtpolizisten bringen den Mann hinter Gittern. Ich schreibe das Verhör-Protokoll.
Als der Fremde schließlich die Gitter seiner Zelle zu Fall bringt und mit Zauberhand eine blendende Lichtflut im Polizeibüro entstehen lässt, ahnen wir, dass er kein gewöhnlicher Mensch sein kann.
Jetzt gilt es, die Kinder vor den Klauen jenes Fremden in Sicherheit zu bringen.
Magie oder Maggi?
Nicht lange, nachdem ich den Thriller »Freie Republik Lich – 2023« veröffentlicht hatte, sprach ich mit einer Leserin, die mir versicherte, wie gut er ihr gefallen habe. Es war ihr gelungen, die 412 Seiten in drei Tagen zu lesen. Wie zauberhaft!
Mensch Meier, dachte ich, was haben die Leute doch verdammt viel Zeit, während mir selbst die Zeit unaufhörlich durch die Finger rinnt und ich nur auf dem Klo mal für lange fünf Minuten ein oder zwei Artikel aus Stellas verdammt informativer GALA durchlesen kann, bevor ich nach notwendiger Verrichtung der notdürftigen Angelegenheit über den Zeitschriftenstapel stolpere und mir ein Hörnchen hole.
„Aber Ihre Anmerkungen, wie Sie was und warum schreiben, Herr Koenig, die überlese ich“, sagte sie und behielt mich dabei scharf im Auge. Ich glaube, sie hielt es für möglich, dass ich sie in meinem nächsten Buch vom Dank an meine treuen Leserinnen und Laser namentlich ausschloss. Und genau das tue ich, verehrte Frau Meier …
… natürlich nicht.
Wie hatten Sie Ihr Geständnis noch mal begründet? Das, liebe Frau Meier, hatten Sie gesagt: „Ich gehöre zu den Leuten, die nicht wissen wollen, wie der Zauberer seine Tricks bewerkstelligt.“
Eigentlich wollte ich Ihnen damals dazu noch einiges sagen, aber es war abends, kurz vor Geschäftsschluss, und ich musste noch dringend einiges an Besorgungen erledigen. Deshalb nickte ich nur und versicherte Ihnen, das wäre durchaus in Ordnung.
Aber heute Morgen habe ich keine Besorgungen zu erledigen und will zwei Dinge ein für alle Mal klarstellen. Es ist mir gleich, ob Sie meine Erläuterungen lesen oder nicht. Es ist Ihr Buch, und meinetwegen können Sie es während Ihrer Morgenmeditation in der Mitte des Logistik-Kreisels auf dem Kopf balancieren, während hunderte LKW um Sie kreisen. Natürlich weiß ich, dass Sie das Logistikmonster genauso ablehnen wie mehrere tausend Licher. Aber mir geht es hier um etwas anderes, nämlich – und das zum Zweiten – darum: Ich bin kein Zauberer, und meine Schreibe besteht nicht aus einer Aneinanderreihung von Tricks.
Das soll nicht heißen, dass beim Schreiben keine Magie im Spiel wäre. Ich glaube in der Tat, dass es so ist, und dass sie sich besonders üppig um erzählende Literatur rankt … Geschichten, die sich wiederholen, die auf abgeänderte Weise neue, zauberhafte Wege in eine neue Gegenwart finden … wie magische Zauberwesen, die uns auf ewig begleiten – egal, wer sie wann und warum und auf welche Weise geboren, gehört und weitererzählt hat.
Ja, Magie ist auf alle Fälle beim Schreiben im Spiel. Paradox ist nur dies: Zauberer haben nicht das Geringste mit Magie zu tun, wie die meisten dieser Taschenspieler bereitwillig zugeben werden. Eher haben Hausfrauen und Kochsendungs-Köche etwas mit Magie zu tun, wenn sie ihre Speisen mit Maggi würzen.
Die unbestreitbaren Wunder der Zauberer – Häschen aus dem Zylinder, Münzen aus leeren Gläsern, Tauben aus dem Ärmel, Seidenschals aus leeren Händen … und natürlich Frauen verschwinden oder in aufreizender Wäsche hinter einem Vorhang erscheinen zu lassen – bewerkstelligen sie durch ständige Übung, geschickte Ablenkungsmanöver und andere billige Hütchenspieler-Tricks.
Das Gerede dieser Trickser von den „uralten Geheimnissen des Orients“, von „Aladins Wunderlampe“ oder von „den vergessenen Legenden des untergegangenen Atlantis“ ist nur Beiwerk.
*
Darüber hatte ich mit Ben, meinem guten Freund und Arbeitskollegen, gesprochen, als wir gegen Ende Oktober vergangenen Jahres ein besonderes Event in Laubach besucht hatten. Es heißt »Winterzauber«, und es fand zu jener Zeit am 30. und 31. Oktober im Schlosshof und der Schlossumgebung statt.
Heute, am Mittwoch, dem 19. Januar 2022, zweieinhalb Monate danach, sitzt Ben neben mir und wir schieben Wache wegen jenem Fremden, der sich in der Vernehmung mit dem Namen »Niko Lamor« vorstellte. Sie, verehrte Frau Meier und alle anderen Leserinnen, kennen ihn und seinen angeblichen Zwillingsbruder, Okin Ramol, bereits aus meinem Bericht »Sturm über Lich – 2022«. Aber jetzt erinnert mich Ben gerade an diesen herrlichen Vorweihnachtsmarkt in Laubach namens »Winterzauber«. Und er erinnert mich eben just an dieses Gespräch mit Ihnen, Frau Meier – jenes Gespräch über den Unterschied zwischen Taschenspielertricks und wahrer Magie.
„Mir scheint es ein Jahrhundert her, dass wir dieses zauberhafte Event genießen durften – vorbei der Duft der Stollenspezialitäten aus dem Erzgebirge, der Lebkuchen und der gefüllten Spitzen aus der fernen Bäckerei und Konditorei. Vorbei die Zeit des leckeren finnischen Flammlachses, der frisch über dem Buchenholz geflammt wird. Ich glaube, es ist für immer vorbei, mein Freund …“ Dabei schaut mich Ben traurig an.
„Jedenfalls wäre jetzt ein wärmender Punsch äußerst hilfreich“, antworte ich Ben – und nur für mich denke ich: Oder wäre selbst das jetzt nichts weiter als billige Magie? Ein wärmender Punsch statt der Befreiung von all der Last der letzten Tage?
„Es scheint, als sei uns ein solcher »Winterzauber« in unserem ganzen Leben nicht mehr vergönnt, bis zum Tag des Jüngsten Gerichts“, sagt Benjamin.
Bis auf eine Wachmannschaft von zehn Leuten sind alle schlafen gegangen. Auch Frau Meier und alle anderen Leserinnen meines Thrillers „Freie Republik Lich – 2023“ schlafen jetzt tief und fest. Ben und ich haben angeboten, Wache zu schieben, obwohl wir bereits 24 Stunden auf den Beinen sind – aber jeder von uns hat vor einer Stunde einen Energy-Drink zu sich genommen, und so fühlen wir uns jetzt recht fit.
Wir sitzen im Untergeschoss in einer Couch-Sitzgruppe, die im Eingangsbereich der großen Schlafräume steht. In der Sitzecke läuft mit leiser Lautstärke ein kleiner Fernseher, in dem es zum x-ten Mal um das Unwetter geht. Außer, dass sich der Sturm noch einmal steigern wird, erzählen uns die Wetterfrösche nichts Neues. Wir schalten innerlich ab, schauen aber dennoch zum TV hin, während wir uns unterhalten – eine unschöne Angewohnheit. Aber Sie kennen das gewiss: Ein laufender Fernsehapparat nimmt einen gefangen; ob man will oder nicht, man schaut immer wieder zum Bild. Nur wenn man das Gerät abschaltet, hat man wieder einen freien Blick zum Gesprächspartner.
Ben interessiert sich für meine Diskussion mit jener Frau Meier und ich schildere ihm, wie es weiterging, als ich ihr im Herbst im Kunkel-Café im RUWE-Markt begegnet war.
„Wir haben nicht groß herumdiskutiert oder irgendein Palaver wegen dieser verdammten Magie gehabt“, erkläre ich Ben. „Ich habe ihr gegenüber einfach meine Vermutung geäußert, dass sich Bühnenzauberer gewiss mit dem Witz über den Ortsfremden identifizieren können, der vor der Licher Brauerei steht und einen Ortskundigen fragt, wie er zur Brauerei kommt. »Üben, Mann, üben!, antwortet der Ortskundige.“
Ben lächelt etwas unsicher und ich sehe ihm an, dass er nicht wirklich verstanden hat, was ich damit meine – nun ja, es ist bereits zwei Uhr morgens.
„Verstanden?“, frage ich.
Er schüttelt – trotz Energy-Drink – müde den Kopf.
„Was ich damit meine: Dasselbe gilt auch für Schriftsteller.“
„Du meinst: Üben, üben, üben?“
Jetzt nicke ich, bemerke aber, dass er mich überhaupt nicht anschaut, sondern zu Jens Köller hinsieht, der sich gerade zehn Meter vor uns im Schlaf unruhig in seinem Feldbett neben dem Bett seiner Frau hin- und herwirft, als würde er etwas Beunruhigendes träumen.
„Der hatte heute keinen leichten Tag“, sagt Ben, und ich stimme ihm zu.
Ben sieht mich mit müden Augen an und sagt: „Du meinst also: Übung macht den Meister und nicht irgendeine Magie, stimmt‘s?
„Nachdem ich seit zwanzig Jahren Unterhaltungsliteratur schreibe und von den intellektuellen Kritikern als billiger Schundschreiber abgetan werde – diese netten Intellektuellen scheinen Schundschreiber zu definieren als »Autoren, die verständlich schreiben und dessen Werk von zu vielen Leuten geschätzt wird« – kann ich nur bestätigen, dass handwerkliches Können dazugehört. Ja, der häufig nervtötende Vorgang von Niederschreiben, Umschreiben und nochmaligem Umschreiben ist erforderlich, um gute Arbeit hervorzubringen. Und nochmal ja: Harte Arbeit ist das einzig akzeptable Training für diejenigen unter uns, die ein gewisses Talent besitzen, aber wenig oder gar kein Genie.“
„Danke für diesen privaten VHS-Vortrag, guter Freund, wie freue ich mich doch, bald abgelöst zu werden und schlafen gehen zu können“, murmelt Ben noch und keine fünf Minuten später hängt er längs auf der Couch mit abgeknicktem Kopf und schnarcht vor sich hin, während gegenüber immer noch das kleine Fernsehgerät läuft.
Bei mir wirkt ein Energy-Drink zwei, drei Stunden lang – in Bens Adern dagegen versanden die wach haltenden Alkaloide der Teeblätter und Kaffeebohnen wohl schon nach einer Stunde. Sei’s drum. Ich war in Gedanken noch bei dem, was ich Frau Müller zu erklären versucht hatte. Sie brauche keine Angst davor zu haben, meine Anmerkungen zu lesen, weil sie denken würde, ich würde die Magie zerstören, indem ich ihr verrate, wie der Trick des Schreibens funktioniert. Echte Magie kennt keine Tricks. Wenn es um echte Magie geht, gibt es nur eines: die Geschichte.
Natürlich ist es möglich, eine Geschichte zu verderben, bevor man sie gelesen hat. An Frau Meier gewandt hatte ich gesagt: „Wenn Sie zu den Leuten gehören (zu den grässlichen Leuten), die den Zwang verspüren, die letzten Seiten eines Buches zuerst zu lesen – wie ein eigensinniges Kind, das seinen Schokoladenpudding vor seinem Spiegelei mit Spinat essen will –, dann fordere ich Sie an dieser Stelle auf, sofort damit aufzuhören. Sonst werden Sie den schlimmsten aller Flüche erleben: Entzauberung.“
Als ich jetzt darüber nachdenke, wird mir bewusst, wie hart diese dahingeschleuderten Worte in den Ohren der armen Frau Meier geklungen haben mögen und erst recht, wenn sie tatsächlich zuerst die letzten Seiten eines Romans liest, bevor sie vorne beginnt.
Ich stelle meine Gedanken ab, jedenfalls so gut es geht. Neulich sagte mir Stella bei einem Glas Rotwein, als ich sie wieder einmal mit einer meiner Räuberpistolen zum »Logistikmonster auf dem Wüstenberg« belästigte: „Du bist das Opfer deiner Gedanken!“ Das gab mir zu denken – und ich denke bis heute darüber nach, was ich ihr in zirka zwölf Monaten darauf erwidern werde. (Und bis dahin heißt es: Üben, üben, üben.)
Jetzt decke ich den sanft dahinschnarchenden Ben mit einer beige-farbenen Wolldecke zu, und mache einen Rundgang. Ich muss an Martha Weis denken – sie wurde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von Niko Lamor erschlagen. Sein blutiger Merkurstock sollte Zeugnis genug sein. Ihr mit einem Tischtuch bedeckter Leichnam lag noch immer in ihrem Haus an der Wetter.
Und dort würde die alte Pendeluhr jetzt zwei Uhr schlagen. Es sind die ersten zwei Stunden eines neu angebrochen Tages. Es ist Mittwoch, der 19. Januar 2022. Ich weiß nicht, wie ich gerade darauf komme: Aber an einem 19. Januar 1905 wurde in Wien das Kindertotenlied von Gustav Mahler uraufgeführt.
Und an noch etwas denke ich.
Ich denke an Peter Machey, der sich vor einigen Stunden erhängt hat und dessen Leichnam Hubert Seifried und ich in einen Läufer eingewickelt und am Hintereingang des Rathauses in einer weniger verschneiten Ecke abgelegt haben, damit die hier versammelte Bürgerschaft nicht unmittelbar mit diesem merkwürdigen Selbstmord konfrontiert ist – obwohl ich mir (ebenso wie Seifried) nicht sicher bin, ob es wirklich Suizid war oder ob Lamor seine Hände im Spiel gehabt hat.
Die Außenwache hat sich vor einer halben Stunde hier im Inneren des Rathauses aufgewärmt und eine Thermoskanne mit nach draußen genommen. Ich habe meine Bedenken geäußert, mehr kann ich nicht tun, ich bin hier nur der Protokollant – aber ich finde den Außendienst äußerst riskant. Wie man mir berichtete, sind inzwischen die Schneewehen höher denn je und mehrere Schaufenster wurden von den Schneemassen eingedrückt. Die Straßen sind jetzt selbst für Geländewagen unpassierbar. Die Laternenpfähle stecken bis halb zu ihren Lichtkugeln hinauf im Schnee.
Ich muss plötzlich an die achtjährige Julia denken. Sie war im letzten Herbst, am Sonntag, dem 10. Oktober 2021, mit ihren Eltern, ihrem sechsjährigen Bruder und einem neunjährigen Cousin beim Wandern im bayrisch-tschechischen Grenzgebiet verloren gegangen. Es gab zu dieser Jahreszeit noch keinen Schnee. Aber Kälte und Nässe. Zwei Tage und zwei Nächte war sie allein im Wald umhergeirrt. Am Sonntagnachmittag gegen vier Uhr saß sie noch auf dem Rücksitz des Familienautos. Um halb sechs hatte sie sich beim Versteckspiel mit den beiden Jungs im Wald verirrt.
Um sieben Uhr, als die Dämmerung hereinbrach, versuchte sie, sich nicht zu fürchten. Versuchte, nicht zu denken „Es ist schlimm, es ist sehr schlimm.“
Das Mädchen irrt durch die Wälder. Sie ist mutterseelenallein. Sie ist vom Weg abgekommen. Noch hat niemand bemerkt, dass sie verschwunden ist – Bruder und Cousin denken, es gehört zum Spiel. Nur sie weiß, dass sie sich verirrt hat und keiner da ist, der sie beschützen kann – vor dem Hunger und dem Durst, vor der Kälte und dem Nebel, vor den wilden Tieren, vor der Einsamkeit und der Dunkelheit.
Um neun Uhr, als es stockfinster ist, versucht sie nicht daran zu denken, dass manchmal Leute, die sich im Wald verirren, ernsthaft verletzt werden. Oder niemals wieder zurückkehren. Eine Baseballkappe, ein Taschentuch, ein kleiner hellbrauner Stummelbleistift von IKEA und die Erinnerung an die Gespräche mit ihrem Vater über dessen alte Pfadfinderzeiten sind die einzige Ausrüstung, die Julia mit sich führt. Mehr hat sie dem Grauen der Wälder nicht entgegenzusetzen. Und das ist sehr, sehr wenig.
Ich muss mich schütteln, als ich jetzt daran denke. Aber da die Geschichte mit Julia gut ausging und sie nach zwei langen Tagen und noch längeren Nächten im Wald lebend gefunden worden war, schöpfte auch ich Hoffnung, dass wir aus der Katastrophensituation unserer Stadt lebend herauskommen würden.
Einer der Außenposten hatte berichtet, dass die Scheiben der Hof-Apotheke vom Schnee eingedrückt worden waren und das Apothekeninnere sich zu einer kältestarrenden Tundra verwandelt habe. Eis glitzere auf den Buchstaben des Wortes »Arzneimittel« im hinteren Teil des Ladens. Weiter vorn sei das Schild mit der Aufschrift »Besiegen Sie den alten Mann namens Winter mit einer Heizdecke von IMETEC« mit Eiskristallen besetzt, die dem Schild ein spöttisches Aussehen bescherten. Die Pendeluhr im Verkaufsraum – ähnlich der Uhr von Martha – sei so zugeschneit, dass man sie nicht mehr ablesen könne, aber sie funktioniere wohl noch.
Der Eissalon von Morandin sei inzwischen ein einziger Eisklotz, ähnlich dem Eisberg, der die Titanic am 14. April 1912 kurz vor Mitternacht unsanft streichelte.
Ich komme bei meinem Kontroll-Rundgang ins gespenstisch ruhig anmutende »Sonnenschein«-Kinderland, wo noch bis in die Abendstunden hinein Remmidemmi geherrscht hatte. Ein Kuckuck, den die »Sonnenschein«-Kinder bestimmt heiß und innig lieben, schnellt immer wieder aus der Uhr an der Wand, unverschämt wie eine herausgestreckte Zunge. Diesmal kommt er nur drei Mal aus seinem Häuschen und ruft »Kuckuck«. Damit verschwindet der Vogel wieder in seinem Versteck. Der Kindergarten selbst ist makellos sauber, wirkt aber unheimlich – die kleinen Tische und Stühle, die Kinderbilder an den Wänden, die Tafel, auf der »Wir sagen Bitte« und »Wir sagen Danke« geschrieben steht.
Zu viele Schatten, zu viel Stille.
Ich gehe hoch in das Polizeibüro, wo bis vor kurzem noch Herr Lamor hinter Gittern gefangen war und auf seiner Pritsche mit angezogenen Beinen saß, um uns zu belauern. Der Boden ist nach wie vor mit Papier und Büroartikeln übersät, und die herausgefallenen Gitterstäbe liegen noch dort, wo sie hingefallen waren, aber der Raum ist leer. Auf der großen Batterie-Uhr über Köllers leergefegtem Schreibtisch ist es jetzt vier Minuten nach drei.
Mein Rundgang führt mich in die Rathaus-Küche im Untergeschoss. Sie wirkt wie aus dem Ei gepellt – die Arbeitsplatten sauber, der Fußboden gewischt, die gespülten Töpfe in den Abtropfkörben gestapelt. Eine kleine Armee von Frauen hat Ordnung geschaffen – zweifellos unter Frau Demuths Oberbefehl. Ich sehe, dass alles bereit fürs Frühstück ist, das es in vier Stunden gibt, so Gott will: Pfannkuchenteig für rund dreihundert Personen. An der Wanduhr ist es inzwischen zwanzig Minuten nach drei. Wie der »Sonnenschein«-Kindergarten wirkt auch dieser Raum unheimlich – die vom Generator gespeiste Beleuchtung ist minimal, und draußen heult schrill der Wind.
Carlo Mannschmidt und sein Sohn Michel sitzen auf Hockern am Hintereingang der Küche vor einer Tür mit dickem Fensterglas. Sie haben Jagdgewehre auf dem Schoß und starren ins undurchdringliche Weiß. Beide sind kurz davor, einzunicken.
„Wie sollen wir da draußen irgendwas sehen?“, fragt der Neunzehnjährige seinen Vater.
Carlo schüttelt den Kopf. Er weiß es nicht.
Ich wünsche den beiden noch einen ruhigen Abend und gehe weiter zum Gemeindebüro im Erdgeschoss, wo an normalen Tagen Frau Kranz-Mai die Ja-Sager bis zu ihrem Tod mit dem Fluch einer unglücklichen Ehe belegt. Manchmal, wenn sie ihren guten Tag hat (aber nur dann), wünscht sie den frisch Getrauten von Herzen alles Gute – und in diesen äußerst seltenen Fällen geht dann tatsächlich alles gut.
Vor dem Büro des Standesamtes sitzen Hubert Seifried und Bernardo, beide ebenfalls mit Jagdgewehren bewaffnet, und halten an der offenen Bürotür Wache. Das heißt – Bernardo hält Wache. Hubert döst vor sich hin. Ich sehe, dass Frau Kranz-Mai und Michaela Wiese nebeneinander auf Feldbetten schlafen und flüstere Bernardo zu: „Alles in Ordnung? Oder hat sich Herr Lamor als der graue Kardinal entpuppt?“
Er lächelt müde, schüttelt den Kopf und sagt: „Ich wäre jetzt gerne mal Mäuschen und würde wissen, wie die da in ihrem großen, kalten und einsamen Schloss eine solche Situation alleine meistern …“
„Jedenfalls haben sie gewiss genug Vorräte und eine warme Stube“, antworte ich, bevor ich auf den knisternden CB-Funk aus Frau Kranz-Mais Büro höre. Aber das Knistern hat nichts zu bedeuten, wie Bernardo sagt: „Es ist nur atmosphärisches Rauschen!“
Die Prediger & die Träume
Das Merkwürdige ist, dass ich – nachdem ich meinen Rundgang fortsetze und die Treppe wieder hinunter gehe, um zu Ben zurückzukehren – durch das nachklingende atmosphärische Rauschen hindurch eine leise Stimme höre. Es ist – dem Inhalt und der predigenden Tonlage nach zu urteilen – die Stimme eines Geistlichen:
„Wie ihr wisst, Freunde, ist es schwer, rechtschaffen zu sein, aber leicht, sich von sogenannten Freunden einreden zu lassen, dass es in Ordnung ist, zu sündigen und eure Pflichten zu vernachlässigen, weil angeblich kein Gott euch zusieht und weil ihr auch weiterhin alles tun könnt, womit ihr glaubt davon kommen zu können. Sprecht mir nach: »Halleluja«.“
Als ich in diesem Augenblick im Gemeindesaal ankomme, höre ich eine vielstimmig gemurmelte Antwort der Schlafenden: „Halleluja.“
Es sind noch ungefähr zehn Leute im Fernsehbereich. Sie haben sich auf die wenigen bequemen Sessel und ein paar Flohmarktsofas, die vor dem Sturm schnell herbei geschafft worden waren, verteilt. Alle, außer dem Bürgermeister, schlafen. Auf dem Bildschirm, kaum sichtbar hinter den Störungen, ist der Geistliche mit den geschniegelten Haaren zu sehen, der einen so vertrauenswürdigen Eindruck macht wie der Immobilienhai Dr. Werner Wüst im Hof eines Stundenhotels.
Mit Verwunderung sehe ich, dass Jonas Cäsar mit dem Fernseher redet: „Halleluja, Bruder. Sprich weiter.“
Cäsar sitzt in einem Ohrensessel, ähnlich dem, in dem erst Martha Weis und danach Niko Lamor gesessen haben. Er sitzt ein bisschen abseits von den anderen und sieht sehr müde aus. Ich denke mir, dass er wahrscheinlich nicht mehr lange wach sein wird. Im Moment scheint er sich auf die Worte des Geistlichen zu konzentrieren:
„Brüder, heute Nacht möchte ich vor allem über die Sünde der Verschwiegenheit mit euch sprechen. Heute Nacht möchte ich euch daran erinnern – sagt Halleluja –, dass die Sünde auf den Lippen süß, auf der Zunge jedoch bitter schmeckt und den Rechtschaffenen Bauchgrummeln verursacht. Gott segne euch, und nun sprecht mir nach: Amen.“
Jonas Cäsar spricht ihm nun allerdings nicht mehr nach. Das Kinn ist ihm auf die Brust gesunken, und ihm sind die Augen zugefallen.
Auf der Couch sitzt in halb liegender Schlafstellung die Erste Stadträtin der CDU, Ingrid Steegher. Ihr Gesichtsausdruck scheint misstrauisch, aber auch so, als würde sie gespannt dem Prediger zuhören.
Der Geistliche redet weiter zu seiner unsichtbaren Gemeinde: „Oh ja, die Sünde der Verschwiegenheit! Das selbstsüchtige Herz, das sagt: »Ich brauche mich nicht zu öffnen; ich kann alles für mich behalten, und niemand wird es je erfahren.« Denkt daran, Brüder und Schwestern! Es ist leicht zu sagen: »Oh, ich kann dieses schmutzige kleine Geheimnis bewahren, es geht niemanden etwas an, und mir tut es nicht weh«, und dann die Augen vor dem Krebsgeschwür der Verderbtheit zu verschließen, das drum herum zu wachsen beginnt … vor dieser Krankheit der Seele, die sich drum herum auszubreiten beginnt …“
Währenddessen gehe ich die Treppe hinunter, und hinter mir verklingt die Stimme des Predigers. Er spricht weiter über Geheimnisse, Verschwiegenheit, Sünde und Selbstsucht. Ich betrete den großen Schlafsaal und sehe unter anderem Martin Kurz, den jungen Rettungssanitäter, der im Feldbett neben Lilli schläft, die ihren Sohn Felix in ihren Armen hält. Die Wirtsleute Tom und Britta Kruse liegen mit aneinandergelegten Köpfen auf zwei zusammengerückten Feldbetten.
Ich komme an Udo Müller, dem RUWE-Chef, vorbei, der mit gerunzelter Stirn auf dem Rücken schläft. Ein Bett weiter schläft seine Frau Petra; sie trägt noch immer das gelbe Shirt der Deutschen Post und hat die Wolldecke bis zu den Augen hochgezogen. Hier im Schlafbereich höre ich Geräusche, die man in jedem Raum hört, in dem viele Menschen schlafen: Husten, pfeifendes Atmen, leises und lautes Schnarchen.
Ich sehe Anja Kühn, ihren vierjährigen Sohn Moritz und ihre Tante, Frau Fremdel – sie schlafen tief und fest. Nach Ninos Dahinscheiden durch eine Todesspritze liegen sie so nah beieinander, wie es nur geht. Der kleine Moritz schläft gewiss recht gut, denn noch weiß er nichts vom Tod seines Vaters. Sein gleichaltriger Freund Jan Köller schlummert in den Armen seiner träumenden Mutter.
Ich gehe hinüber in den Bereich, in dem die ersten Kinder zu Bett gebracht worden sind, und eine ganze Menge von ihnen sind nach wie vor dort – Tina Kruse, Petty Wecker, Lisa Wiese, Clara Cäsar, Charly Seifried, Nena Gründler, Marco Schmidt und Bernardos Sohn Jonas.
Die Einwohner von Lich schlafen. Ihr Schlaf ist unruhig, aber sie schlafen.
Jonas Cäsar schläft jetzt – ob tief und fest kann man nicht beurteilen. Im Moment murmelt er jedenfalls etwas Unzusammenhängendes. Seine Augäpfel bewegen sich schnell hinter den geschlossenen Lidern. Er träumt.
Er träumt von einem Fernsehreporter.
Auf der Straße – oder vielmehr über deren Asphaltdecke, da die Gießener Straße unter mindestens einem Meter Schnee begraben liegt – steht ein Fernsehreporter. Er ist jung und sieht auf konventionelle Weise gut aus. Er trägt einen leuchtend purpurroten Ski-Anzug von Bergson mit den dazu passenden purpurroten Handschuhen und hat Skier unter den Füßen … vermutlich die einzige Möglichkeit, dorthin zu gelangen, wo er jetzt steht.
Auf den Straßen liegt, wie erwähnt, über ein Meter Schnee, aber das ist nur der Anfang. Die Geschäfte sind geradezu begraben unter gewaltigen Schneewehen. Heruntergerissene Stromleitungen verschwinden wie abgerissene Spinnwebfäden im Schnee.
Der Fernsehreporter berichtet ziemlich unaufgeregt: „Die Landstriche nördlich Hessens haben die Ausläufer des sogenannten Jahrhundertsturms nun hinter sich. Von Hamburg bis Kassel graben sich die Leute durch Schneemengen ans Tageslicht, die die Bücher der Rekorde nicht nur um neue Einträge, sondern um ganze neue Seiten bereichern werden.“
Der Reporter setzt sich auf seinen Skiern in Bewegung und fährt langsam die Gießener Straße entlang, an Mehtaps Bäckerei Inbrunst entlang, biegt »Am Wall« um die Ecke, kommt an Sedelmayrs Hörgeräte- und Optik-Geschäft und dann am Restaurant Moustaki vorbei.
Er spricht weiter: „Das heißt, sie graben sich überall durch, nur hier in Lich nicht – einer Kleinstadt samt ihren dörflichen Stadtteilen, von einer Raumkapsel aus gesehen ein winziger Fleck –, auf dem der letzten Volkszählung zufolge ungefähr 15000 Seelen beheimatet sind. Nur dreihundert von ihnen haben im Rathaus Schutz gesucht, als sich herausstellte, dass dieser Sturm die Stadt wirklich treffen würde, und zwar hart. Dazu gehören einige Kinder der Stadt, vom Kindergarten- bis zum Teenageralter. Aber genau diese fast dreihundert Männer und Frauen samt der dazu gehörigen Kinder … sind verschwunden. Es gibt Ausnahmen, aber die sind noch rätselhafter und beunruhigender.“
Die Augen des schlafenden Bürgermeisters bewegen sich hinter den geschlossenen Lidern rasch hin und her.
Der Fernsehreporter berichtet: „Bisher hat man in Lich drei Leichen gefunden. In zwei Fällen handelt es sich möglicherweise um Selbstmord, wie aus Polizeikreisen verlautet. Doch im anderen Fall handelt es sich mit Sicherheit um eine Mordsache, denn das Opfer wurde mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen.“
Cäsar erkennt im Traum ziemlich bald den Mann in seinem purpurroten Ski-Anzug – es ist Lamor. Aber statt der purpurroten Handschuhe hat er jetzt leuchtend gelbe an.
Lamor – als Reporter – berichtet weiter: „Die Identität der Toten wird nicht bekannt gegeben, ehe man nicht die nächsten Verwandten benachrichtigt hat. Aber wie es heißt, sind die Opfer alle langjährige Bewohner von Lich. Und die verblüfften Polizisten stellen sich immer wieder eine Frage: »Wo sind die anderen Menschen hin, die im Rathaus Schutz suchten?« Wo ist Jonas Cäsar, der Bürgermeister? Wo ist Jens Köller, der Erste Stadtpolizist? Wo ist der neunzehnjährige Michel Mannschmidt, der seine Ausbildung als Koch unterbrach, um im Rathaus auszuhelfen? Wo sind die Ladenbesitzer, die Künstler und Ratsherrn? Niemand weiß es. In der gesamten hessischen Landesgeschichte hat es bisher nur einen einzigen solchen Fall gegeben.“
Ich gehe weiter durch den Schlafsaal und schaue mir fasziniert die dort Liegenden an, deren Gesichter sich keinesfalls in der entspannten Ruheposition von tief Schlafenden befinden. Irgendwie bewegen sich die Augen unter ihren Lidern. Das ist es, was mich zu diesem Zeitpunkt stutzig macht, auch als ich bei Maria Köller vorbei komme.
Maria sieht in ihrem mysteriösem Traum eine uralte Karte von Dorf Güll, einem südwestlich von Lich gelegenen Örtchen. Und sie hört und sieht eine Fernsehreporterin: „So sah Dorf Güll im Jahr 1527 während des Deutschen Bauernkrieges aus, bevor die gesamte Einwohnerschaft verschwand – jeder Mann, jede Frau, jedes Kind. Man hat nie herausgefunden, was mit ihnen geschehen ist. Man fand nur einen einzigen möglichen Hinweis, nämlich ein Wort, das in einen Baum geschnitzt war …“