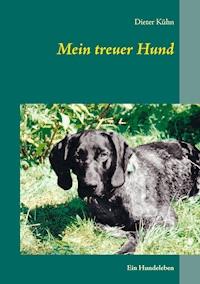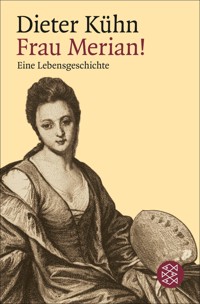14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Clara Schumanns Lebensgeschichte ist Legende geworden. Ihre entsagungsreiche Kindheit, ihr enormes Talent als Pianistin und Komponistin, die frühe, gegen den Vater durchgesetzte Liebe zu Robert Schumann und die Erziehung von sieben Kindern geben genug Stoff für Mythen ab. Clara Schumann gilt als musikalisches Wunderkind, Ideal romantisch verklärter Liebesvorstellungen, als vorbildliche Mutter und oft verkannte Komponistin. Dieter Kühn geht in seiner großen Biographie den Lebensweg von Clara Schumann nach und erschafft mit Faktenkenntnis und Phantasie das Porträt einer hochsensiblen und selbstbewussten Frau, in deren Leben sich fast das ganze 19. Jahrhundert spiegelt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1192
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Dieter Kühn
Clara Schumann, Klavier
Ein Lebensbuch
Über dieses Buch
Clara Schumanns Lebensgeschichte ist Legende geworden. Ihre entsagungsreiche Kindheit, ihr außergewöhnliches Talent, die frühe, gegen den Vater durchgesetzte Liebe zu Robert Schumann und die Erziehung von sieben Kindern geben genug Stoff für Mythen und Klischees ab. Clara Schumann gilt seither als musikalisches Wunderkind, Idol romantisch-verklärter Liebesvorstellungen, als vorbildliche Mutter und oft verkannte Komponistin.
Dieter Kühn zeichnet, halb als Roman, halb als Biographie, den Lebensweg von Clara Schumann jenseits der tradierten Vorurteile nach, horcht auf feine Zwischentöne und entdeckt oftmals überraschende Disharmonien. Angeregt durch neueste Forschungsergebnisse, gelingt es Kühn in dieser erweiterten Neufassung seines Buches, auch die Zeit nach Robert Schumanns Tod genauer zu beleuchten und so das Porträt einer hochsensiblen und selbstbewußten Frau zu vervollständigen, in deren Leben sich das 19. Jahrhundert aufs genaueste widerspiegelt.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Covergestaltung: Buchholz/Hinsch/Hensinger
Coverabbildung: Franz Hanfstaengl, ›Clara Schumann‹. München © Robert-Schumann-Haus, Zwickau
Erschienen bei FISCHER E-Books
S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 1996
Für die erweiterte Neufassung: © Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1998
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403417-1
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Der Vater; eine Skizze
Claras Mutter, Pianistin
Stadtbild Leipzig
Messen in Leipzig
Die Eltern trennen sich
Das Kind verstummt
Eine Fibel für Clara
Besichtigung einer Wohnung
Der vertriebene Kaiser
Vater und Übervater
Clara beginnt zu lernen
Clara Wieck, Klavier
Zwei Jahre im Zeitraffer
Paganini tritt auf!
Premiere in Dresden
Wunschbilder, Wunderkinder
Tonleitern nicht vergessen!
Schumann; eine Skizze
Schumann im Hause Wieck
Schmerz und Schwärmerei
Eine häßliche Szene
Allererste Annäherung
Mühsal des Reisens
Kleine Clara, großer Goethe
Was wurde gespielt?
Grobheit und Nepperei
Ein Reisebrief von Wieck
Kinderarbeit ist noch üblich
Claras Konzerte in Paris
Robert, Clara, Christel
Die ersten großen Briefe
Ein tauber Musikkritiker
Emilie wird zur Freundin
Konzertbesorgungen
Ein robustes Mädchen
Clara wird eigensinnig
Robert und Ernestine
Clara wird sechzehn
Der erste Kuß!
Heimlicher Besuch
Die Breslauer Lektion
Schumann zeigt Gelassenheit
Karlsbader Beschlüsse
Reglementierte Besuche
Das Tagebuch als Forum
Erfolge in Berlin
Redakteur und Komponist
Die heimliche Verlobung
Claras Triumphe in Wien
Dichter huldigt Pianistin
Fortsetzung der Erfolge
Vater bespitzelt Tochter
Lobeshymnen auf Clara Wieck
Claras frühe Kompositionen
Das Publikum spielt mit
Clara trifft Franz Liszt
Auftritt des Franz Liszt
Eine Liebe bleibt verboten
Robert scheitert in Wien
Wie verschickte man Briefe?
Küsse und abermals Küsse
Die große Reise nach Paris
Balzac, ein Textzeichen
Ankunft in der Metropole
Clara und drei Flügel
Eine pragmatische Entscheidung
Exilanten: List und Heine
Triumph in Paris
Drei Mädchen am Fluß
Rollenverhalten
Charakterschilderungen?!
Robert wird aktiv
Vergebliche Briefaktion
Ein Kapitelchen Revolution
Die Eingabe ans Gericht
Clara als Wunschbild
Sie muß zurückkehren
Das Wiedersehen, endlich!
Geplatzter Termin
Dramatis personae
Wieck redet Klartext
Trauriges Familienleben
Ein Kritiker verstummt
Neuromantische Verklärung
Eingabe des Wieck
Sie wagt sich zu weit vor
Und wo bleibt Robert?!
In Sachen Schumann . . .
Sie plant Reisen ins Ausland
Pianistin besucht Schumann
Der Konsens wird erteilt
Die Hochzeit wird gefeiert
Eröffnung des Ehetagebuchs
Wieck wird verurteilt
Die Pianistin klagt
Geburtsanzeige Marie
Clara Schumann, Klavier
Hie Bellini! Hie Bach!
Neuigkeiten für die Freundin
Clara setzt eine Priorität
Lokomotiven unter Dampf
Angststunde einer Reisenden
Ihre Fahrt nach Kopenhagen
Robert; zweite Skizze
Kurze Audienz bei Metternich
Versöhnung mit dem Vater
Geburtsanzeige Elise
Clara Schumann, Klavier
Zwei Komponistinnen
Felix Mendelssohn Bartholdy
Blick in die Familienkasse
Die Reise nach Rußland
Gogol, ein Textzeichen
Triumph in St. Petersburg
Ein Sack voll Silbergeld
Weiterreise nach Moskau
Sie ziehen nach Dresden
Carl Gustav Carus
Geburtsanzeige Julie
Clara Schumann, Klavier
Disziplinierung durch Fugen
Dienstbare Geister
Bendemann; eine Skizze
Das Thema Waisenkinder
Geburtsanzeige Emil
Weitere Kinder erwünscht?
Hormone und Harmonien
Die zweite Reise nach Wien
Jenny Lind; eine Skizze
Trauriger Zwischenbericht
Hauskonzert mit Fanny Hensel
Lamentationes
Geburtsanzeige Ludwig
Clara Schumann, Klavier
Kinderszenen
Revolution, auch in Berlin
Brutale Gewalt
Reaktion, auch in Berlin
Maikämpfe in Dresden
Geburtsanzeige Ferdinand
Clara Schumann, Klavier
Sie assistiert Robert
Eine Russin sieht Clara
Eine Frau mit Ängsten
Liebt die Freundin Musik?
Hiller kommt zu Wort
Schumann erhält ein Angebot
Stadtbild Düsseldorf
Sie kommen an, leben sich ein
Zweiter Blick in die Kasse
Claras neues Image
Sie wird eng verschnürt
Das erste Jahr im Zeitraffer
Clara hilft beim Dirigieren
Geburtsanzeige Eugenie
Clara Schumann, Klavier
Leiden und Probleme
Abgesang der Komponistin
Brahms; eine Skizze
Die erste Begegnung
Die Personen der Handlung
Brahms im Hause Schumann
Zur Sexualbuchhaltung
Weiter imText
Triumph in Holland
Ausbruch derKrankheit
Krankheit und Partnerschaft
Schumann halluziniert
Deformation der Partnerschaft?
Der Selbstmordversuch
Rekonstruktion der Vorgeschichte
Claras Flucht zur Freundin
Brahms taucht wieder auf
Robert Schumann wehrt sich
Die Anstalt und ihr Arzt
Clara stilisiert
Eine Legende wird geschaffen
Keine Fahrt nach Endenich
Brieflein an denArzt
Progressive Paralyse
Geburtsanzeige Felix
Clara Schumann, Klavier
Clara liberata!
Gesucht: Reisemotive
Clara wirbt für Brahms
Liebte sie Johannes?
Beginn einer Liebesgeschichte
Die Wohngemeinschaft
Selbstrechtfertigung
Brahms besucht Schumann
Therapeutische Zensur
Entfaltung einer Liebe
Clara und ein Klavier
Liebesbriefe aus Düsseldorf
Wasgeschieht in Endenich?
Vergeblicher Appell
Vergebliche Intervention
Joseph Joachim; eine Skizze
Eine Wanderung am Rhein
Post aus der Poststraße
Triumphe in Wien und Prag
Undwoliegt Endenich?
Die Liebenden kommen sich näher
Dickens, ein Textzeichen
Hotelleben einer Virtuosin
Schlechte Nachrichten
Was spielt sie in England?
Intermezzo als Chorsängerin
Kassensturz
Rückkehr und Zögern
Besuch beim Sterbenden
Reise in die Schweiz
Ein Familienarrangement
KarlsruherApotheose
Das Ende einer Liebe
Eine indiskrete Frage
Die große Selbstrechtfertigung
Doch ein neuer Anfang?
Clara, ohne Brille
Ein Inbild der Treue
Zum Image der Priesterin
Clara, ohne Zigarre
Sie zieht nach Berlin
Neues Familienarrangement
Marie, ein Lebenslauf
Clara Schumann, Klavier
Laßt Blumen sprechen?
Nur nicht alt werden!
Relativierte Hungertour
Ein Jahr im Zeitraffer
Angebote aus dem Nachlaß
Ein erster Nachruf
Schiffeunter Dampf
Reisen mit der Eisenbahn
Dinner für Clara
Besuch beiElise
Elise, ein Lebenslauf
Clara Schumann, Klavier
Rückblick ausWildbad
Zu Besuch bei reichen Leuten
Konzerthetze, fortgesetzt
Als Gast bei reichen Leuten
Neue Wohnung in Berlin
Ihr wird viel Geld angeboten
Geradehalter für Julie
Julie, ein Lebenslauf
Das Hauptwort Pflicht
Clara Schumann, Klavier
Ein Haus in Baden-Baden
WelcheLandschaft paßt zu ihr?
Ruhe, was ist das?
Tonleitern nicht vergessen!
TheodorKirchner; eine Skizze
Der dritte Mann
Auflösung einer Familie
Die zweite Reise nach Rußland
Carroll, eine Textmarkierung
Konzerte in Petersburg
Wie spielte sie eigentlich?
Geselliges Treiben im Kurort
Undsie erteilt Unterricht
Dostojevskij, eine Textmarkierung
Clara im Kristallpalast
Sie spielt auch Kammermusik
Ludwig wird zum Thema
Ludwig, einLebenslauf
Ein Vergleich soll helfen
Clara Schumann, Klavier
Brahms wiederholt seine Frage
Besessenheit als Antwort?
Der Solist tritt auf
Angststunde einer Virtuosin
Ein hochbrisantes Gemisch!
Woldemar Bargiel; eine Skizze
Der Krieg wird hörbar
Ferdinand wird eingezogen
Ferdinand, ein Lebenslauf
Clara Schumann, Klavier
Ein Gemisch von Charakteren
Der inthronisierte Kaiser
Clara ans Konservatorium?
Nachruf auf die Mutter
Spaziergänge in London
Eine Königin blamiert sich
Viel Geld und: gute Worte
Undeine weitere Dotation!
Josephine Lang; eine Skizze
Eugenie wird zum Thema
Eugenie, ein Lebenslauf
Clara Schumann, Klavier
Kritischer Nachwuchs
Ende eines Lebenskapitels
Berlin-Ouvertüre
Die schöne Wohnung
Nachruf auf den Vater
Die große Zwangspause
Schwere Flügel
Claras Berlinkrise
Bei Brahms in Ziegelhausen
Clara ist nicht zu halten
Es geht weiter!
Zwei Jahre im Zeitraffer
Verhandlungen in Frankfurt
So könnte ihr Leben sein
Das Haus in der Myliusstraße
Felix als Patient
Felix, ein Lebenslauf
Clara Schumann, Klavier
Das Künstlerjubiläum
Alltag im Haus
Die Avantgarde altert
Rückblick auf Roberts Jugend
Zwei Jahre im Zeitraffer
Stichwort Konservatorium
Braucht sie eine Alarmanlage?
Drei Töchter in Frankfurt!
Ein Luftschiff hebt ab
Kein bleicher Nachlaßschatten
Sie hört schlecht, spielt gut
London again!
Nachruf auf Jenny Lind
Der verstorbene Kaiser
Verspätete Italienreise
Zwei Schülerinnen schwärmen
Das Julchen im Haus
Geld kommt zu Geld!
Erziehung zur Sparsamkeit
Das letzte Konzert
Verstummter Flügel
Erinnerungsstücke
Sie fühlt sich als Greisin
Enkel Ferdinand zieht ein
Clara Schumann, Klavier
Ferien in Interlaken
Telefon und Phonograph
Todund Beerdigung; Klage
Anhang
Warum diese Neufassung?
Clara und Oswald
Zur Technik des Zitierens
Biographie und Diskretion
Das Geld für die Kunst
Rückblick 2014
Bibliographie
Bildteil
Der Vater! Zwanzig Jahre lang beherrscht er das Leben seiner Tochter Clara. Mit ihm muß dieses Buch beginnen.
Als Clara geboren wird, ist er Mitte Dreißig. Was hat er in diesen dreieinhalb Jahrzehnten erlebt, was könnte ihn geprägt haben, was könnte prägend weiterwirken?
Friedrich Wieck, Jahrgang 1785. Sein Vater Kaufmann, die Mutter Pastorentochter. Über den Kaufmann in Pretzsch bei Torgau wurde in der Familie nicht viel erzählt; die Geschäfte des Carl Friedrich Gotthelf Wieck schienen anfangs recht gut, zuletzt ziemlich schlecht zu gehen – das bekam der Sohn zu spüren. Seine Eltern konnten die Weiterbildung am Gymnasium nicht bezahlen, doch fanden sich Helfer, Gönner. »Ich war sehr arm und lebte kalt von Butter und Brot etc., was mir meine arme Mutter, die noch für fünf Jungen sorgen sollte, aus Pretzsch mit dem Salzwagen zuschickte. Doch Sonnabends schickten mir die guten Schmidts und der arme Palm warme Suppe auf die Stube, worauf ich mich immer einige Tage vorher freute. Doch bald bekam ich bei dem Advokaten Schultze einen reellen Eßtisch, auf den ich mich als schwächlicher, empfindsamer junger Mensch die ganze Woche durch freute, und wo mein Leibessen – Schöpsenbraten mit Bohnen oder Schoten – fast den ganzen Sommer hindurch mich erquickte, tröstete, aufrichtete.« Der Junge wirkte schwach, schwindsüchtig.
Er wollte Musiker werden. Dafür hatten seine Eltern in der mittlerweile chronischen Notlage kein Verständnis, sie bestanden auf einem Brotberuf. Auch die Gönner brachten kein Geld auf für Musikunterricht – so wurde Wieck Autodidakt. Das Klavierspielen lernte er auf einem »alten Klavier, welches auf den Tisch gelegt werden mußte«, so lese ich bei Kohut – ein Clavichord? Zusätzlich lernte er Harfe und Horn, probierte auch Geige und Kontrabaß aus. In den Chor des Gymnasiums konnte er nicht aufgenommen werden – er wurde zu rasch heiser.
Kurzer Lichtblick: der Münchner Klavierlehrer Johann Peter Milchmeyer, ein Schwergewicht, das mit einer Maschinerie aus dem Bett gehievt werden mußte, erteilte Unterricht in der Familie eines Oberforstmeisters; Wieck suchte Milchmeyer auf, spielte ihm vor, erhielt einige Freistunden.
An ein Musikstudium war dennoch nicht zu denken, also studierte Wieck Theologie in Wittenberg. Vor dem Königlich Sächsischen Oberkonsistorium bestand der Studiosus Theologiae Johann Gottlob Friedrich Wieck das Examen; seine Probepredigt wurde als »genüglich« bezeichnet. Das reichte offenbar nicht für eine Pfarrstelle. So wurde er Hauslehrer, in Adelsfamilien. Wieck besaß pädagogischen Eros, in Aufzeichnungen reflektierte er über intellektuelle Erziehung und moralische Bildung. Neun Jahre lang war er »Hofmeister« auf Landgütern. Dann mußte er aufgeben: »Gesichtsschmerzen«, Trigeminus. Ihm wurde ein Arzt empfohlen, Samuel Hahnemann, der Begründer der Homöopathie. Der heilte ihn nicht nur, der lehrte ihn auch gesunde Lebensweise. Vor allem: viel spazierengehen!
Wieck blieb in Leipzig. Er gründete, noch keine dreißig, eine »Pianoforte-Fabrik« und eine »Musikalien-Leihanstalt«. Das Startkapital lieh ihm der frühere Kommilitone Streubel, amtierender Polizeipräsident von Leipzig. Kein verlorenes Geld – Wieck wurde ein tüchtiger Kaufmann. Er importierte Flügel, vor allem aus Wien, von den führenden Firmen Graf, Stein, Tomaschek, brachte Verbesserungen ein, vor allem in der Mechanik, intonierte die Flügel. Er baute auch eigene Instrumente. Stolz pries er sie an: »Die Kästen sind viel solider als alle anderen, welche hier gemacht werden, z.B. die Böden inwendig mit Eichenholz furniert – durchgängig zweichörig und mit einer schulgerechten Spielart versehen, daß sie jedem Kenner genügen müssen und werden.« Er versprach sechs Jahre Garantie.
Der erfolgreiche Geschäftsmann gab zudem Klavierunterricht. Auch hier wieder: begleitende Reflexionen. »Ein Klavierlehrer von Geist und Herz muß die Gesangskunst verstehen, wenigstens soll er ein hohes Interesse dafür haben.« Einer seiner Leitsätze, Schlüsselsätze: »In vielen Dingen müssen sich Gesang und Klavier gegenseitig erklären und ergänzen.« Wieck griff auf und führte weiter, was (auch) Milchmeyer lehrte (heute als »Wegbereiter einer modernen Klaviermethodik« bezeichnet): den »schönsten Gesangston« auf dem Klavier, den »singenden Anschlag«. Dies wird später Clara von ihm lernen, man wird ihren »singenden Anschlag« rühmen …
Wieck komponierte auch, vor allem Lieder. Seinem verehrten Vorbild Carl Maria von Weber legte der Dreißigjährige acht Probestücke vor. Weber antwortete aus München: »Empfangen Sie vor allem meinen besten Dank für Ihre schön gefühlten Gesänge. (…) Ihre Melodien sind zart und innig gedacht und fassen meist glücklich den Dichter auf.« Es schloß sich produktive Detailkritik an. Wieck, der »Weber-Narr«, war beglückt, dedizierte dem Meister die Acht Gesänge.
Doch Wieck wurde nicht Komponist, sondern Unternehmer. In seiner kleinen Firma, in seiner wachsenden Familie wurde er bald zur dominierenden Figur. Wieck erfindet später einen merkwürdigen Spitznamen für sich: DAS. Die Anfangsbuchstaben von: Der Alte Schulmeister. Daß die Abkürzung zugleich der neutrale Artikel ist, wird diesem Mann mit Sprachwitz bewußt sein.
An den Titeln seiner Publikationen läßt sich Charakteristisches ablesen über DAS: Mehrere grobe Briefe; Über den gänzlichen und plötzlichen Verfall der Gesangskunst in Europa; Musikalische Bauernsprüche aus dem groben Tagebuche eines alten Musikmachers. Er war, was man damals einen »Originaltypus« nannte. Ein Mann mit ausgeprägten Konturen, prägnanter Physiognomik. Man erzählte gern Anekdoten über ihn. Wie Fritze Wieck zu Hause im Schaukelstuhl saß und Schülerinnen zuhörte: je rascher sich der Schaukelstuhl bewegte, desto größer seine Zustimmung; schlimm wurde es, wenn er reglos saß. Oder: Fritze Wieck als Gastgeber. Gegen neun Uhr verließ er den Salon, kam nach »zwei Minuten« wieder, mit »brennender Zigarre im Munde, den Hut tief in die Stirn gedrückt, in einen Pelz gehüllt und den Stock in der Hand. Schweigend, ohne nach rechts oder links zu blicken, schritt er den Salon entlang der Ausgangstüre zu und – war verschwunden. Er liebte langes Lebewohlsagen nicht und wandte sich nun seiner Gewohnheit gemäß dem Kreise einiger auserwählter, ihn erwartender Freunde zu, um mit diesen beim Glase Bier in geistsprühender Unterhaltung seine Ideen auszutauschen.« So berichtete eine Schülerin über den alten Wieck. Aber hier ist auch der Mann von Mitte Dreißig und Mitte Vierzig charakterisiert.
Claras Mutter: leider muß das Kapitel über sie etwas kürzer werden, die Überlieferung bietet nicht viele Informationen an.
Wichtig ist ihr Jahrgang: 1797. Sie war also ein Dutzend Jahre jünger als Wieck. Eine Zeitlang war sie seine Schülerin. Also eine klassische Konstellation: Lehrer heiratet Schülerin. Diese Schülerin hatte wahrscheinlich noch einen zweiten Lehrer: Adolph Bargiel, Jahrgang 83, also vierzehn Jahre älter.
Marianne (in der Schreibweise ihrer Zeit: Mariane) war eine geborene Tromlitz. Ihr Vater: Kantor in Plauen. Ihr Großvater: der bekannte Musiker Johann Georg Tromlitz. Er spielte Flöte, baute Instrumente, komponierte, unterrichtete. Als Flötist trat er auch in Leipzig auf. Marianne, seine Enkelin, Marianne, die Kantorentochter, sie erhielt eine gute musikalische Ausbildung, wurde konzertreife Sängerin und konzertreife Pianistin. Beispielsweise trat sie auf im Gewandhaus bei Mozarts Requiem und bei Beethovens C-Dur-Messe. Die junge Frau des ehrgeizigen, aufstrebenden Musikalienhändlers Wieck war also bekannt in Leipzig. Das wiederum förderte den Ruf und die Umsätze Wiecks.
Marianne erteilte Klavierunterricht. Das setzte sich auch fort zwischen den Geburten. Das erste Kind war ein Mädchen: Adelheid. Es starb »am Durchbruch der Zähne«. Ein Jahr später, am 13. September 1819, wurde Clara geboren. Nach wiederum zwei Jahren: Alwin wurde geboren. Knapp zwei Monate nach der Entbindung trat Marianne wieder als Solistin auf im Gewandhaus. Anderthalb Jahre später: Gustav wurde geboren. Als Mutter von ursprünglich vier, nun drei Kindern trat sie weiterhin im Gewandhaus auf, als Pianistin. Bei ihrem letzten Auftritt im Dezember 23 war sie hochschwanger.
Leipzig! Daß Clara in Leipzig geboren wurde, in Leipzig aufwuchs, es darf nicht nur erwähnt werden, dies ist ein eigenes Kapitel wert. Bilder der Stadt der kleinen Clara vermittelt mir ein von Wolfgang Schneider herausgegebener Großband, »printed in the German Democratic Republic«, zur Zeit der Wende: dieses Buch, das Leipziger Vergangenheit dokumentiert, ist Dokument geworden im jähen Wechsel der politischen Konstellationen.
Ich sehe die Stadt auf dem reproduzierten Foto eines Modells, das Johann Christoph Merzdorf 1823 gefertigt hat: damals war Clara vier. Der erste Eindruck: die Stadt als klar umgrenztes Gebilde. Die Stadtmauer, jahrhundertelang ein strenger Rahmen, sie ist abgerissen, bestimmt aber weiterhin den Umriß von Leipzig: die Altstadt ist nun umfaßt von mehrstöckigen Häusern, die früheren Eckbastionen werden akzentuiert von repräsentativen Bauten. Der ehemalige Stadtgraben ist zugeschüttet; damit sind Grünzonen entstanden; sie umschließen gut tausend Häuser mit etwa 40000 Einwohnern.
Daß man Leipzig durch die noch erhaltenen Stadttore leicht und rasch verlassen konnte, das gehörte, wie man heute sagen würde, zur Lebensqualität. Dies waren keine Selbstverständlichkeiten, hier wurde bewußt wahrgenommen. Die Vororte, die das Stadtgebiet umgaben, sie waren damals noch Dörfer, ja Weiler. Man spazierte auf Feld- und Waldwegen zu ihnen hinaus, fuhr mit dem Stechkahn auf der Elster … Es lockten Kaffeegärten, es lockten Angebote: Sauerbraten, Merseburger Bier, Obstwein … Wer in der Stadt lebte, war dem Land noch nicht fern. Und viel Grün wuchs in die Stadt hinein, das zeigt die Bildüberlieferung. Die »Parkanlagen im englischen Stil mit Schwanenteich auf dem Gelände der ehemaligen Festungswerke« … »Gotisches Tor in der neuen Parkanlage« … Sehr wichtig war schon im 18. Jahrhundert die »Promenade«.
Clara wuchs auf in einer überschaubaren Stadt, in der nach 22 Uhr die Stunden ausgerufen wurden; dabei mußte ein Nachtwächter, ein »Stundenrufer« eine Schnarre schwingen. In der Dienstordnung für Nachtwächter war weiter festgehalten, daß sie sich nicht betrinken durften des Nachts, und sie durften keine der Dienststunden verschlafen. Den Gassenmeistern mußten die Stundenrufer alles Auffällige, alle Besonderheiten melden. Ab 22 Uhr mußten Haustüren verschlossen sein, die Nachtwächter hatten das zu überprüfen; war eine Tür nicht verschlossen, so mußten sie abschließen: offenbar hatten sie Nachschlüssel; wer später nach Hause kam, seinen Schlüssel vergessen hatte, fand sich ausgesperrt, mußte den zuständigen Nachtwächter suchen, das war nicht immer einfach. So ergaben sich unfreiwillige Übernachtungen im Freien oder bei Gastgebern. Übrigens waren auch die (nicht abgerissenen) Stadttore bewacht, Tag und Nacht.
In dieser Stadt der schnarrenschwingenden, stundenrufenden Nachtwächter, der gepflegten Grünanlagen nahm die Angst vor Arbeitslosigkeit zu, und hier müssen wir schon sagen: vor struktureller Arbeitslosigkeit.
Beispielsweise führte der Buchdrucker und Verleger Brockhaus die erste Schnellpresse in Leipzig ein; Buchdruckergesellen waren deshalb besorgt, wendeten sich mit einer Denkschrift an die Stadtväter. So sehr sie das »Meisterstück« bewunderten, sie sahen hier Gefahren: »Ein Beispiel hat in der jüngstverflossenen Zeit uns England dargeboten, wo Tausende von Menschen früher ihr Brot hatten und jetzt nach Errichtung von Maschinen zu dem äußersten Grad der Verzweiflung gebracht worden sind. Steht nicht auch uns ein gleiches Schicksal bevor? Würde nicht die Zahl der Armen bedeutend vermehrt und diese, da in unsern Tagen der Broterwerb so beschränkt ist, der Verzweiflung preisgegeben werden?« So alt schon sind die Probleme, die sich nun auswachsen …
Leipzig, also auch: Leipziger Messen! Die gewannen wieder an Bedeutung nach den Kriegen der Napoleonzeit, nach dem Wiener Kongreß. Wirkten die Messen, zumindest atmosphärisch, auf das Mädchen ein, das in Leipzig heranwuchs? Animation, Stimulation …?
Die Leipziger Messen waren in den dreißiger, vierziger Jahren noch Warenmessen. Erst mit der Industrialisierung der Gründerjahre (wenn sich Produkte der Serienfertigung nicht mehr unterscheiden) wird die Mustermesse eingeführt: Exponate, die für sich werben, die man nicht erwerben kann.
In Claras Kinderjahren zogen die Messen eine bunte Vielfalt von Menschen und Waren in die Stadt. Und zwar in ihr Zentrum, auf den weiten Marktplatz, den repräsentative Häuser umrahmten – es gab noch kein Messegelände am Stadtrand. Buden, Verkaufsstände waren auf dem Markt gereiht, dicht an dicht. Zwischen Verkaufsbuden, Verkaufszelten: Gedrängel. In fast allen Straßen die Planwagen. Ich sehe ein halbes Dutzend auf einer alten Fotografie: die Wagen tunnelförmig überwölbt, das Holzgerüst mit beinah weißem Segeltuch bespannt. Diese Wagen (die Planwagen aus Westernfilmen gleichen) wurden »Weiße Elefanten« genannt. Weiße Elefanten kamen zu Hunderten, zu Tausenden in die Stadt, brachten Waren mit in Mengen, in Massen, die sich kaum noch zwischenlagern ließen – Hunderttausende von Zentnern.
Kind Clara, in der Innenstadt wohnend, wird also dieses bunte, vielstimmige, auch vielsprachige Gedrängel miterlebt haben. In Begleitung der Mutter könnte sie zum Markt gegangen sein oder zu einem der anderen Plätze mit Buden, Ständen, Zelten. Was hätte sie dort sehen können? Russen, beispielsweise Russen, die mit besonders robusten Planwagen in die Stadt gekommen waren, Männer in Stiefeln und Kitteln, und fast jeder hatte einen Vollbart. Und Kaufleute aus dem Vorderen Orient gruppierten sich zu malerischen Ensembles, sogen an Pfeifen, die bestimmt doppelt so lang waren wie die Pfeifen von Vätern in der Stadt. Diese orientalischen Händler trugen graue Hüte, die in der Form den Mützen heutiger Köche gleichen; mancher hatte einen roten Fez auf, und breit waren die Gürtel über den oft dicken Bäuchen. Und Pluderhosen, echte Pluderhosen …
Es kamen sogar Kaufleute aus dem fernen, fernen Indien! Man sprach viel über sie in der Stadt. Im Getümmel, im Gewimmel, im Gedrängel Ausschau halten nach den Männern aus Indien …! So fern, so exotisch, so verlockend exotisch: Indien! Man sollte mal eine Geschichte lesen, die im fernen Indien spielt! Gleich nachschauen an einem der Stände von Buchhändlern?
Die hatten Wagen mit kastenförmigem Aufbau; hinten wurde eine Tür aufgeschwenkt, Bücher wurden gleich vom Wagen weg verkauft. Oder man stellte einen Tisch auf, an dessen Vorderkante Landkarten herunterhingen, und einige Bücher auf der Tischfläche, etwa ein Dutzend, und an einer Hauswand ein Regal mit drei oder vier Borden, auf denen, senkrecht und schräg, Bücher standen, auf denen Bücher lagen, ein paar Dutzend. Und Buchhändler in hohen, schwarzen Stiefeln, in weißen Anzügen, mit schwarzen Zylindern.
Weiter … Gedrängel, Gewimmel, Geschrei. Und plötzlich: Musikklänge! Die locken das Kind, die Mutter an. Schließlich sehen sie: »Harfenmädchen«! Drei junge Frauen, ein Mädchen und ein Mann. Der trägt einen taubengrauen Frack, einen taubengrauen Zylinder, spielt eine Bratsche. Oder ist es eine Geige? Müßte der Größe nach eine Viola sein. Und eine der jungen Frauen in knöchellangem Kleid spielt Querflöte. Und eine junge Frau mit hochgesteckter Frisur, mit langer, roter Stola in der Armbeuge, sie spielt eine Harfe, die auf dem Kopfsteinpflaster steht und der Musikantin fast bis zum Kinn reicht. Und eine junge Frau, tatsächlich, spielt Waldhorn, das wir Naturhorn nennen würden, denn es hat keine Ventile. Ein großer Pudel hinter dieser Hornistin im dunkelblauen Kleid. Und das kleine Mädchen hält in der rechten Hand ein aufgeschlagenes Liederbuch, hält in der Linken ein Tamburin, und ein junger Herr, wohl Student, legt eine Münze aufs Buch. Harfenmädchen – sie spielen abends auch in Gaststätten und Weinlokalen, zum Beispiel in Auerbachs Keller. Und es wird über sie gemunkelt, was Kind Clara nicht zu Ohren kommt.
Weiter … Ein Wagen, auf dessen Heck ein Mann sitzt; ein Dachaufbau ist schräg zur Seite geklappt; so kommt Licht ins Gehäuse; vier kreisrunde, tellerrunde Öffnungen in Augenhöhe von Erwachsenen: Guckkästen! Blick in den Urwald von Südamerika?! Blick in die Wüste von Afrika?! Blick in einen Palast des fernen Indien?! Die Mutter will Kind Clara wohl nicht hochheben – ist sowieso genug Gedrängel dort!
Weiter … Auf Plakaten werden Vorstellungen eines Zauberes angekündigt: »Große Kunst-Produktionen aus dem Reiche der natürlichen Magie und ägyptischen Zauberei«.
Weiter … Köstlichkeiten werden angeboten! Fette und süße Krapfen … Spritzkuchen … Saure Heringe, saure Gurken … Wacholder-Saft …
Weiter … Ein Plakat, für eine Tierschau werbend! Eine Riesenschlange umwickelt einen Stier! Ein Krokodil hat einen dunkelhäutigen Menschen im Maul! Im Hintergrund wird ein Krokodil von einem dunkelhäutigen Menschen mit einer hochgerissenen schweren Keule erschlagen!
Erneut Musikanten: ein Mann in Stiefeln, einer sehr engen gelben Hose, mit roter Weste, grüner Jacke, an einem Nackengurt eine Drehleier, die gekurbelt wird, und eine junge Frau tanzt, spielt dabei Tamburin, hält zusätzlich die linke Hand auf.
Im Februar 1824 wurde Claras dritter Bruder geboren: Viktor. Zu dieser Zeit aber waren Marianne und Friedrich Wieck bereits getrennt.
Für Wieck war der Scheidungsgrund klar: seine Frau hatte ein Verhältnis mit dem Kollegen Bargiel. Es wurde Wieck vorgeworfen, er habe seine Frau zu oft allein gelassen: häufig Geschäftsreisen, vor allem nach Wien, zum Einkauf von Instrumenten. Es wurde Wieck allerdings nicht vorgeworfen, daß er zu herrisch, zu hart, zu grob war. Es war schwierig, äußerst schwierig, mit ihm zusammenzuleben – es sei denn, man unterwarf sich. Marianne war zu selbstbewußt, um sich auf Dauer zu unterwerfen, die Sängerin und Pianistin demonstrierte Selbständigkeit. Sie konnte mit diesem Friedrich Wieck nicht mehr leben! Adolph Bargiel war ganz anders: freundlich, sanft. Und Wieck? Er gefiel sich in cholerischem Gebrüll, glaubte ein Anrecht zu haben auf Direktheit und Grobheit. Doch Marianne nahm das nicht passiv hin, und so wurden die Auseinandersetzungen sehr heftig.
In dieser Konstellation begann Claras Lebensgeschichte. Als Marianne auszog, nach Plauen zu ihren Eltern zurückkehrte, war Clara viereinhalb. Wieck erlaubte Marianne, das Mädchen und den Säugling mitzunehmen; die Buben blieben im Haus im Salzgäßchen. Allerdings wurde von Wieck eine Frist von vier Monaten gesetzt: am fünften Geburtstag mußte Clara nach Leipzig zurückgebracht werden. Marianne wollte sich von Clara nicht trennen, Wieck aber hatte die damalige sächsische Gesetzgebung und Rechtsprechung auf seiner Seite: die drei älteren Kinder waren ihm zugesprochen. Marianne resignierte: »Du bestehst darauf, die Clara jetzt zu haben, nun sei es, in Gottesnamen; ich habe alles versucht, dich zu erweichen, mag das Herz mir brechen, Du sollst sie haben; jedoch meiner Mutterrechte begebe ich mich nicht.«
Wiecks Haushälterin, Johanna Strobel, reiste dem Mädchen entgegen, das von Mutter und Großmutter begleitet wurde; in Altenburg, auf halbem Weg zwischen Leipzig und Plauen, erfolgte die Übergabe des Kindes. Es muß ein tränenreicher Abschied gewesen sein.
Im Januar 25 wurde die Ehe offiziell geschieden, kurze Zeit später heirateten Adolph Bargiel und Marianne Wieck. Sie wohnten vorerst in der Nähe von Leipzig; Marianne bestand darauf, Clara wenigstens hin und wieder zu sehen. Im Kommandoton bestimmte Wieck die Konditionen. »Madame! Ich schicke Ihnen hier das Teuerste, was ich im Leben noch habe, setze aber voraus, daß Sie alles, womöglich, mit Stillschweigen übergehen oder sich so einfach und so ohne Falsch, ingleichen so unbestimmt ausdrücken, daß dieses unschuldige, harmlose und so ganz natürlich erzogene Wesen nichts höre, worüber es in Zweifel geraten könne. Übrigens werden Sie dem Kinde wenig Gebackenes geben und keine Unart nachsehen, wie desgleichen wohl in Plauen geschehen. – Wenn sie spielt, so lassen Sie nicht eilen. Der strengsten Befolgung meiner Wünsche sehe ich entgegen, wenn ich es nicht übelnehmen soll.« Es folgt das Datum, die Unterschrift.
Die neue Lebenssituation sollte also nicht zum Thema werden zwischen Mutter und Tochter; Wieck befürchtete offenbar Parteinahme.
Und eine scheinbar beiläufige Anmerkung: Clara solle beim Klavierspiel nicht »eilen«. Offenbar neigte sie schon als Kind zu raschen Tempi. Das wird bis zum Ende ihrer Karriere immer wieder hervorgehoben: wie rasch sie oft die Tempi nimmt.
Die grimmig gestatteten Besuche des Kindes bei der Mutter waren bald nicht mehr möglich: Marianne und Adolph zogen nach Berlin. Dort übernahm Bargiel die Leitung der Klavierschule, die Johann Bernhard Logier gegründet hatte. Charakteristisch für seine Methode: Unterricht in kleinen Gruppen.
Kind Clara konnte in der Zeit der Auseinandersetzungen und der Trennung noch immer nicht sprechen, und es schien nicht zu hören. Die Vierjährige stellte sich nicht taub, sie schien wirklich taub zu sein. Erst über Klangproben am Klavier stellte Wieck fest, daß sie nicht organisch taub war. Es ist leicht, die Augen zu schließen, die Ohren jedoch können wir nicht schließen, wir können höchstens die Gehörgänge zustopfen; Clara jedoch scheint es gelungen zu sein, die Ohren zu verschließen, zumindest vor der Sprache. Sie hörte nicht, was sie nicht hören wollte. Clara war, in wörtlichem Sinne: nicht ansprechbar. Und: sie wollte nicht heraus mit der Sprache. Für Verwandte und Bekannte schien alles klar: das Kind war taub, und es war »langsam« – heute würden wir sagen: retardiert. Aber es war keine allgemeine Entwicklungsstörung, denn das Klavierspielen lernte sie rasch und leicht. Etwas pointiert: sie lernte eher das Klavierspielen als das Sprechen.
Friedrich Wieck hatte eine simple Erklärung für dieses auffällige Verhalten; er schrieb seine Version eigenhändig in das Tagebuch, das er für Clara angelegt hatte. »Weil nun mein Vater zugleich mit der Mutter viel Unterricht gab, und letztere selbst täglich 1–2 Stunden spielte, so wurde ich meist der Magd überlassen. Diese war eben nicht sprachselig, und daher mochte es wohl kommen, daß ich erst zwischen dem 4ten und 5ten Jahre einzelne Worte zu sprechen anfing und zu dieser Zeit auch ebenso wenig verstehen konnte. Klavierspielen hörte ich jedoch sehr viel, und mein Gehör bildete sich dadurch leichter für musikalische Töne als für die Sprache aus. Ich lernte aber zeitig laufen, so daß ich schon im 3. u. 4ten Jahre mit meinen Eltern spazieren gehen und stundenlange Wege zurücklegen konnte.
Da ich so wenig sprechen hörte und selbst dazu so wenig Lust bezeigte, auch mehr in mich verschlossen war, unbekümmert, was um mich sich zutrug, so klagten meine Eltern oft, besonders als ich anfing zu sprechen, daß ich schwer höre und dies hatte sich noch nicht ganz im 8ten Jahre verloren, ob es sich gleich besserte, je mehr ich selbst zu sprechen anfing und je mehr ich bemerkte, was um mich geschah.«
Dies, noch einmal, schrieb der Vater. Ob das Kind auch der Mutter, der Großmutter, den Hausangestellten gegenüber stumm blieb, ist nicht überliefert, auch nicht, wie sich Clara anderen Kindern gegenüber verhielt. Vielleicht bestand eine temporäre, eine partielle Stummheit. Doch schlimm genug: das Kind konnte sich offenbar erst artikulieren, als es schulpflichtig wurde.
Dieses verstörende Erleiden der Trennung, es muß Auswirkungen haben auf Claras späteres Verhalten …
Clara, stummes Kind, scheinbar taubes Kind. Fünf Tage nach dem fünften Geburtstag begann Friedrich Wieck mit dem Klavierunterricht »nach der Logierschen Methode«, in einem Dreiergrüppchen. Die allgemeine Schulbildung sollte hinter der musikalischen Ausbildung freilich nicht zurückbleiben – bevor Clara in eine Schule geschickt oder einem Hauslehrer übergeben wurde, war noch einiges nachzuholen, aufzuarbeiten beim verstörten, beim zurückgebliebenen Kind. Gab ihr Wieck eine Fibel für Kinder im Vorschulalter? Mit Bildern und Texten, die Sprachfähigkeit wecken?
Die Fibel, die Wieck seiner Clara überreichen konnte, sie liegt vor mir als Reprint. Der vollständige Titel: Erstes Bilder- und Lehrbuch zur zweckmäßigen Beschäftigung des Verstandes und zur angenehmen Unterhaltung für Kinder, welche noch nicht lesen können. Gedruckt in Leipzig. Ein Buch mit 50 »Kupfern«, und diese Drucke waren koloriert. Rechts jeweils das Bild, links der Text. Der Verfasser war Johannes Andreas Christian Löhr; er lebte noch zum Zeitpunkt, an dem Wieck mit dem Hausunterricht beginnen konnte.
Diese Fibel führt in verschiedenste Bereiche: Sachkunde. Ich weise freilich nur hin auf Abbildungen, nach denen sich ein Mädchen wie Clara ein Bild von einem Mädchen machen mußte, wie es in eine Fibel paßte.
So sitzt im dritten Kapitelchen ein »Mädchen unter seinen Spielsachen«. Das Kind ist gekleidet wie eine Frau: rote Bluse mit Ausschnitt, knöchellanger brauner Rock, mehr als knielange weiße Schürze. »Sieh hin, was ist da alles neben dem Kinde. Da steht eine große Puppe auf einem Tische; unten sind noch zwei; da ist auf einem kleinen Tischchen ein Topf, ein Löffel, eine Schüssel. Auf dem Boden stehen und liegen ein Asch, eine Lase, Kohlenkriken, Leuchter, eine Schüssel und ein Napf, alles unordentlich und zerstreut.« Was ein Asch, eine Lase, was Kohlenkriken sind, das wird Wieck gewußt haben, das wird Kind Clara wissen oder erfahren, ich muß das nicht wissen, ich lasse die fremden Wörter fremde Wörter bleiben, sie markieren Zeitdistanz. Asch, Lase, Krike …
Das Kind hat sich müde gespielt, mit Kochen und Backen. »Das kleine Mädchen hätte besser getan, es hätte auch ein bißchen, ein Viertelstündchen am Strickstrumpf gestrickt.«
Dennoch, es werden auch Kinder beim Spiel gezeigt. Drei Mädchen an einem kleinen Tisch, eins hat eine Waage, sie spielen Kaufen und Verkaufen. Dazu werden benutzt: Steinchen, Läppchen, Apfelscheiben, Kuchenbrocken. Auf einem anderen Tisch steht ein metallenes Kohlenbecken, darauf ein Töpfchen: es wird gekocht. Weitere Kinder spielen Blindekuh. Und Knaben schlagen Ball mit dem Schläger, treiben Kreisel, schaukeln auf improvisierter Balkenwippe – vor solch einem Spiel wird gewarnt.
Gleich danach: »Nützlich beschäftigte Kinder«. Ein Knabe an einem Tisch mit zwei anderen Knaben, gekleidet wie junge Herren, in gelber, grüner, grauer Hose, in grüner, blauer, roter Jacke, mit Halstüchern und weißen Hemden. Einer der vorbildlichen Knaben liest in einem Buch, ein Bein lässig über das andre geschlagen, einer übt in einem Schreibheft, einer rechnet auf einer holzgerahmten Schiefertafel, an einer Schnur hängt ein Schwämmchen.
Das letzte Bild, koloriert: ein Mädchen, in knöchellangem, blauem Kleid, mit Haushäubchen, es sitzt an einem Tisch, strickt und schaut dabei in ein Buch. »Wenn es nicht schon recht fertig lesen und stricken könnte, so würde das nicht angehen. Es ist gewiß ein fleißiges und wißbegieriges Kind, sonst würde es nicht beide Dinge zugleich tun – es würde das Stricken allein und das Lesen allein treiben; aber so ist es viel besser. Da das Kind so willig ist, nützliche Dinge zu tun und zu lernen, so wird es sich künftig wohl ernähren können.«
Und gleich die Nutzanwendung: für ein halbes Jahr erhielt Clara auch »Strickstunden«.
Friedrich Wieck führt seine etwa fünfjährige Tochter mit pädagogischen Absichten durch die Wohnung. Lektion in Sachkunde: Clara soll lernen, die Umgebung mit wachen Augen zu sehen.
Der Fußboden, auf dem Wieck geht, auf dem ihm Clara leichtfüßig folgt, dieser Boden ist gedielt. Allerdings sind die Bretter nicht mit Sand bestreut, das ist höchstens bei einfachen Leuten üblich; der Haushalt Wieck gehört zur gehobenen Kategorie.
Die Wände sind tapeziert, die Decke ist geweißt. Im Flügel jedes Fensters drei Glasscheiben, durch Sprossen getrennt. Mit geschärftem Blick registriert das Mädchen die Möbelstücke aus poliertem Kirschholz. Schnitzwerk ist dort nicht zu sehen; die Möbel sind betont schlicht, aus Prinzip. Auf dem Boden, darauf weist Friedrich Wieck seine Tochter hin (und er folgt dabei dem kleinen Buch von Dr. Otto Bähr), auf dem Boden liegt noch kein Teppich, nicht mal ein kleiner, auch nicht vor dem Sofa, das zwischen zwei Fenstern steht. Deren Vorhänge sind übrigens weiß: noch keine dunklen oder zumindest düsteren Portieren.
Bilder in Holzrahmen, braun und poliert. Goldrahmen waren Ölgemälden vorbehalten, aber hängt hier im Haus ein Ölgemälde? Zumindest ein Druck, beispielsweise mit dem Bildtitel: Der vertriebene Kaiser.
Und der Vater schreitet vor der Tochter zum Ofen. Es ist ein »aufgemauerter Ofen«, eine Vorform des Kachelofens. Verbreitet dieser Ofen in der Heizsaison gemütliche Wärme? Auch im Hause Wieck konnte das beinah Übliche zutreffen: daß der Schornstein nicht recht zog. Es wurde damals häufig geklagt über die Schwierigkeiten, Wohnräume zu heizen. Wieck läßt, zum Vergleich, seine Tochter ins Nebenzimmer schauen, in sein Arbeitszimmer, Herrenzimmer: dort steht ein Kanonenofen, auch Windofen genannt – wird rasch heiß, kühlt schnell aus. Wenn der Ofen qualmt und stinkt, gießt der Hausherr etwas Essig auf die Ofenplatte, gleich riecht es frischer.
Ein Blick in die Küche, in der das Dienstmädchen den Kaffee aufbrüht: Zusatzduft von Zichorie. Die Kaffeekanne auf dem Herd. Der ist ein »gemauerter Aufsatz«: die Feuerstelle eingesenkt, obendrauf ein Eisenrost. Rund um das offene Feuer stehen Töpfe, also wird das Mittagessen vorbereitet. Riecht es bereits nach Suppenfleisch? Die »Magd«, Johanna Strobel, sowieso nicht gesprächig, zudem noch morgenmuffelig, sie schüttet einen Topf aus über dem »Gossenstein« – das Wasser gluckert in die Gosse. Der Vater betont: Diese Feuerstelle ist kein Küchenherd. So etwas ist noch selten, ist eher in Berlin als in Leipzig zu finden; in Berlin nennt man den Herd »Maschine« – das macht die Eisenplatte.
Was gibt es in der Küche noch zu sehen? Ja, an einer Wand ein Fliegenschrank: Holzkonstruktion, mit Leinwand bespannt. Vater Wieck öffnet ihn: auf dem untersten Bord liegt Weißbrot bereit für das Frühstück. Butter steht nicht dort, Butter ist zu teuer, statt dessen ein kleiner Napf mit Schmalz. Und ein wenig Speck. Bevor Clara sehen kann, was auf den beiden oberen Brettern liegt, hat Vater Wieck den Schrank bereits geschlossen, denn es sind zahlreiche Fliegen in der düsteren, offenbar auch zugigen Küche. Johanna zeigt ihnen weiterhin den Rücken, schweigt sich aus. Und wo steckt August, der Diener?
Sie gehen in den Flur. Als Mann von System öffnet Wieck dort kurz auch die Tür zum Klo, das Clara sonst kaum mit wachem Blick fürs Detail betritt: der Holzkasten, der Deckel aus Holz, die bereitliegenden, zerschnittenen Zeitungen. Das Klo ist »nach hinten raus«. Wieck schließt rasch wieder die Tür, es ist schon warm an diesem Morgen, das riecht man.
Vater und Tochter gehen ins Schlafzimmer – selbstverständlich in das der Kinder. Weil das Bett für Clara etwas so Selbstverständliches ist, daß sie sich reinlegt, ohne weiter hinzuschauen, macht Vater Wieck deutlich, somit bewußt: keine Sprungfedern, dieses Wort kennt er nicht mal, keine Roßhaar-Matratze, sondern der übliche Strohsack, darauf das Federbett, gemütlich dick, und darüber (je nach Jahreszeit) das Plumeau oder eine Decke. Jetzt ist es eine Decke. Die ist auch über dem Ungeziefer ausgebreitet, das sich im Strohsack einzunisten pflegt und mit dessen Beseitigung man überall die gleichen Probleme hat; noch ist das »Persische Pulver« nicht im Handel. Also hilft manchmal nur eins: das Dienstmädchen oder der Diener muß den Strohsack verbrennen. Und wenn sich Wanzen in Holzritzen des Bettgestells eingenistet haben, ist es ebenfalls reif fürs Feuer.
Zurück ins Wohnzimmer. Weil Tag ist, achtet Clara nicht auf Beleuchtung, also müssen Wieck & Bähr nachhelfen: keine Kerzen, es sind auch in diesem Bürgerhaus Talglichter üblich. Oder steht hier schon eine Petroleumlampe? Im Hause Wieck wurde sparsam gewirtschaftet, also wird es eher eine Talgleuchte sein. Die steht mitten auf dem Tisch, an den man sich abends setzt, um zu plaudern, zu lesen oder zu singen. Neben dem Talglicht eine Lichtschere, abgelegt in einem Schiffchen aus Blech. Fast jede Viertelstunde beginnt das Talglicht zu blaken, wird schwächer, das Talglicht muß »geputzt« werden. Und wie löscht man das Talglicht? Auspusten? Falsch, das würde mit Gestank bestraft, den Dr. Bähr als häßlich bezeichnet. Man spießt mit der Lichtschere ein Klümpchen Talg auf, erstickt damit das Lichtlein.
Nun, da es hell genug ist an diesem frühen Morgen, nun soll das Mädchen an sich herabblicken: Was trägt es? Ein Baumwollkleid, in schlichter Ausführung, schließlich ist Werktag. Woher kommt das Kleid? So etwas kann nirgendwo fertig gekauft werden, es wurde noch von der Mutter geschneidert.
Und was trägt ein Vater? Die Tochter sieht: eine helle, straffe Hose. Aber keinen mittelblauen oder mittelgrünen Frack, sondern eine bequeme Jacke fürs Haus.
Vater Wieck und Tochter Clara setzen sich an den Tisch. Noch keine neue Frau im Haus, die Brüder sind bei einer Madame »in Pension« gegeben. Zum Frühstück wird von August oder von Johanna hereingetragen: Kaffee mit Zichorie, geschmälztes Brot.
Die Haushälterin ist zugleich Köchin. Sie braucht keine Kochbücher. Es gibt Gemüse der Saison aus dem Garten oder vom Markt. Und Suppenfleisch, meist Suppenfleisch, falls überhaupt. Im Winter kommen die Beilagen aus dem Keller: Sauerkraut aus dem Faß, »Strünke« aus dem Faß (und die definiert Bähr als »die geschnittenen Stengel von Sommer-Endivien«), Schnippelbohnen aus dem Faß. Und hinterher, für den lieben Vater und die brave Tochter: eingemachtes Obst.
Und was trinkt man am Abendtisch? Wasser. Bekommt Vater Wieck denn kein Bier? Der Bierverbrauch ist noch nicht in die hohen Zahlen gekommen. Das hat verschiedene Gründe. Das Gerstenbier ist meistens dünn, dafür billig; es ist billig, deshalb dünn. Weizenbier ist etwas teurer und damit besser. Üblich ist das »Füllbier«: man kauft halb gegorenes Bier, verdünnt es mit Wasser, stellt es in die Sonne über Leipzig, läßt es nachgären in Krügen, die fest verkorkt werden, denn es entwickelt sich Kohlensäure, die das leichte Getränk zu einem erfrischenden Getränk macht. Füllbier, das wird auch Vater Wieck trinken, da bleibt der Kopf klar. So richtig auf den Biergeschmack kommen die Deutschen erst durch bayerisches Bier. Das wird jemand besonders gern trinken, den Clara noch nicht kennt; er geht noch auf das Gymnasium in Zwickau.
Der vertriebene Kaiser: Titel eines Kupferstichs (zeitgenössisch, gerahmt, hinter Glas), wie er in der Wohnung Wieck hängen könnte. Napoleon: noch Zeitgenosse der ganz kleinen Clara, bis zum Jahr 1821. Zeitmarkierung, die Claras Lebensspanne bewußt machen soll.
Der vertriebene Kaiser: im Exil zwischen Afrika und Südamerika, auf der winzigen Insel St. Helena, an einem Tisch, der im Freien steht, so daß man auch die nähere Umgebung des letzten Wohnsitzes des Kaisers der Franzosen sehen kann: Haus, Wiese, Bäume, Hügel und über dem Hügel Wolken. An der Grenze des umzäumten Anwesens ein englischer Soldat mit langem Gewehr, etwas näher ein weiterer Soldat mit langem Gewehr und, an einen Baum gelehnt, einige Yards vom Tisch entfernt, der englische Offizier, der für Napoleon unmittelbar verantwortlich war, Sir Hudson Lowe. Seiner Körperhaltung könnte man ansehen, daß er seine Pflicht schon lange wahrnimmt. Mit am Tisch sitzt ein Offizier, dessen Uniform sich deutlich von der Uniform des Engländers unterscheidet, und dieser Offizier im Gespräch mit Napoleon. Halb dem Gesprächspartner zugewendet, halb dem Bildbetrachter, sitzt Napoleon breitbeinig in der Bildmitte in weißer, hautenger Hose, ein Unterarm lässig auf dem Tisch, der andere Arm in Brusthöhe, denn einige Finger sind zwischen zwei Knöpfe der Jacke ohne Ehrenzeichen geschoben, damit man Napoleon sofort als Napoleon erkennt, auch ohne den großen Ordensstern auf der Brust, auch ohne den legendären Hut. Die Frisur aber in bekannter Manier gekämmt, mit der Napoleonlocke, die freilich keine Locke ist, sondern ein Büschel flach und spitz nach vorn gekämmter Haare. Auf dem Tisch Kartenrollen und Bücher, denn Napoleon arbeitet an seinen Memoiren, und der Offizier erstattet Bericht zu irgendeiner vergangenen Lage. Der Kaiser, l’Empereur, im Exil, aber die Theatralik, in der das Sonnenlicht von der Wolke über der Hügelkuppe in ausgefächerte Strahlen aufgeteilt wird, sie zeigt an, daß er zwar geschlagen, nicht aber besiegt worden ist, auch nicht nach Waterloo, daß er immer noch und weiterhin von sich selbst überzeugt ist, diese Selbstüberzeugung auch ausstrahlt, und das soll sich auf politisch fromme Betrachter übertragen, auch im Hause Wieck.
Nach den Kriegen der Ära Napoleons wollte man wieder in überschaubaren und geordneten Bereichen leben. Heinrich Heine formulierte das so: »Nach großen Kämpfen und Enttäuschungen« mußte der »Sinn für große Gesamtinteressen in den Hintergrund zurückweichen«, und so konnten »die Gefühle der Ichheit wieder in ihre legitimen Rechte eintreten«. Die Ichheit fand Spielraum der Entfaltung vor allem in der Familie, in der schön und zweckmäßig eingerichteten Wohnung, oder noch besser: im Haus mit Garten. Das Biedermeier, die Restauration als Zeitalter, in dem das Private, das Häusliche dominierte.
Im trauten Heim spielte der Vater die Hauptrolle, war er Autorität. Der Vater bestimmte, was in der Familie geschah, der Vater hatte Anspruch auf Gehorsam. Hier war ein Leitbegriff der Restauration: Gehorsam der Frau und des Kindes gegenüber dem Vater, der wiederum der Obrigkeit Gehorsam schuldete. So wurde Obrigkeitsdenken unmittelbar in Familien übertragen.
Claras Sozialisation fand statt in einer Zeit, in der es neben dem übermächtigen Vater einen fast allmächtigen Übervater gab: in Europa dominierte nun Fürst Metternich. Nach ihm wird zuweilen die Ära benannt zwischen dem Wiener Kongreß von 1815 und der Revolution von 1848. Metternich herrschte als Kanzler im fernen Wien, hatte nicht direkten Einfluß auf die heranwachsende neue Bürgerin Clara Wieck zu Leipzig, doch über die Könige und Fürsten, die in den Ländern des Deutschen Bundes regierten, bestimmte auch er Lebensformen.
Vater und Übervater kooperierten ohne direkte Verabredung, die Abstimmung ergab sich wie von selbst: der Vater war durch die eigene Geschichte der Sozialisation (in napoleonischer Zeit) darauf vorbereitet worden, in seiner Wohnung zu Leipzig die Stellvertretung des Kanzlers in Wien zu übernehmen.
Graphisch dargestellt: Clara wuchs nicht nur auf im »Kreis der Familie«, mit dem mächtigen Vater in der Mitte des (zur Zeit noch nicht wieder geschlossenen) Kreises, sie wuchs auf in einer Ellipse mit zwei Brennpunkten: Vater und Übervater.
Als Vater und Lehrer besaß Wieck doppelte Autorität. Er war in dieser Doppelrolle gesellschaftlich zweifach legitimiert. So verkörperte auch er die Restauration: Macht, die Kritik nicht zuließ, nicht an sich heranließ.
Im Alter von sechs Jahren kam Clara in eine Schule, das Noack’sche Institut. »Dieses Institut besuchte ich jedoch den Tag über nur 3–5 Stunden, weil mein Vater mich von diesem Jahre an täglich 2 Stunden Klavier spielen ließ und fast ohne Ausnahme mir täglich eine Stunde gab.« Das Kind, vom Vater im Tagebuch als »unruhiges Temperament« beschrieben, als »eigensinnig« und »unbändig«, es machte in jeder Hinsicht rasche Fortschritte. »Allein, mein Sprachvermögen bildete sich nun schnell aus und damit ein außerordentliches Gedächtnis besonders für musikalische Phrasen, so daß ich jedes kleine Stück nach einige Male spielen, ohne die Noten zu können, auswendig spielte und lange Zeit im Gedächtnis behielt. Aber während dieses Unterrichts gab sich mein Vater noch viel privatim mit mir ab und unterrichtete mich nach seiner eigenen, von ihm erfundenen und erprobten Methode.«
Systematisch setzte Wieck den Klavierunterricht fort. Die jüngeren Brüder erhielten ebenfalls Musikunterricht, aber der Vater konzentrierte sich auf seine Tochter, die beiden Söhne waren ihm nicht so wichtig. Ein Augenzeuge berichtet von einer sehr viel späteren Unterrichtsstunde; hier könnte es freilich Entsprechungen geben zur frühen Phase: »Clara, diese Stelle ist noch nicht schön akzentuiert, die drei letzten Noten sind nicht bedeutungsvoll genug, diese Stelle muß leichter genommen werden, hier fehlt es noch an schöner Verbindung, hier mußt du mehr retardieren, hier bewegter werden, um den Effekt zu verstärken. Clara, hör doch auf das, was dir dein Vater sagt, er muß es doch besser verstehen!« Ende des Zitats. Erstaunlicherweise wird auch dies überliefert: »Wieck hat eine charmante Art, zu unterrichten. Seine Weise, den Ausdruck oder Vortrag zu bezeichnen, ist sehr verständlich, fast handgreiflich. Er bedient sich der Gesten dazu u.die Kantilene führt er gern auf Gesangesgesetze, Atemholen usw. zurück.«
Wieck hat sich wiederholt verteidigen müssen gegen besorgte Vorwürfe, Kind Clara werde überlastet. Er verteidigte sich vor allem mit dem Hinweis, daß er Clara genügend Zeit lasse zur Erholung. Andere Väter und Lehrer scheinen in der Tat musikalische Kinder erheblich stärker belastet zu haben im Wunsch, mit deren möglichst frühen Auftritten selbst an Glanz und Rang zu gewinnen. Es sind Fälle dokumentiert, in denen Kinder auf diese Rollen gleichsam dressiert wurden – die kleinen »Musikautomaten«!
So etwas war im Hause Wieck unerwünscht. Der Vater im gemeinsam geführten Tagebuch: »Mein Vater läßt mich nicht musikalisch zu Tode üben, sondern bildet mit Vorsicht mich für ein seelenvolles Spiel aus. Über diesen Punkt sprach sich mein Vater gegen seinen vieljährigen Freund Andreas Stein in Wien einmal so aus: ›Meine Tochter Clara wird, nach meinem Dafürhalten, eine gute Klavierspielerin werden, da sie jetzt schon einen guten Anschlag und Tongefühl und Geschick für schönen Vortrag zeigt und ein feines Gehör hat; übrigens von einem musikalischen Talente und starkem Gedächtnis unterstützt wird, und der Vater sie vielleicht auch, was Ton, Instrumente etc. etc. anlangt, weiter ausbilden kann. Sie spielt bereits schwere Etüden rund und rein, alles mit musikalischer Art. Doch möchte ich sie nicht lassen sich musikalisch zu Tode üben – das ist nun einmal mein Ausdruck. Denn fast alle unsere Virtuosen haben sich musikalisch zu Tode geübt und gespielt (besonders von Klavierspielern ist hier die Rede), d.h. sie haben eigentlich kein Gefühl und wohl gar keinen Sinn mehr dafür, sondern bloß Gefallen an ihrem eignen mechanischen Fingerspiel – können daher auch nicht gut andere spielen hören, sondern nur – sich selbst!‹«
Bei der relativ vernünftigen Behandlung Claras durch »Papa Wieck« spielte wohl auch Berechnung mit: Das Kind, das sich zwischendurch erholen darf, kann letztlich höhere Leistungen erbringen. Viel Wert wurde, wie schon erwähnt, auf den täglichen Spaziergang gelegt. Dies wird Clara lebenslang so fortsetzen, konsequent, dies wird sie als Lehre weitergeben, wird damit noch Enkelkinder zum Stöhnen bringen. Wieck achtete sehr darauf, daß seine Tochter in Form blieb, daß sie haushielt mit ihren Kräften. Kinderspiele wurden allerdings klein geschrieben. Die Lehren des Vaters verinnerlichend, wird Clara später behaupten, es sei ihr auch gar nicht so wichtig gewesen, mit Puppen zu spielen.
Und wie war es mit den Katzen? Franz Liszt wird später mitleidig feststellen, sie hätte nicht einmal mit ihren Katzen spielen dürfen, hätte das höchstens mal rasch zwischendurch hinter dem Rücken des Vaters tun können. Claras Halbschwester Marie dagegen wird erklären, daran sei nichts wahr, es hätte überhaupt keine Katzen gegeben im Hause Wieck.
In allem, was Wieck forderte, was er voraussetzte, war er von der unerschütterlichen Überzeugung geleitet, nur das Beste, das Allerbeste für seine Tochter zu wollen. Die Grundtendenz: Ich tue alles für dich, dafür mußt du mir dankbar sein. Also kein Nörgeln, kein Maulen, hier wird gearbeitet!
Clara Wieck, Klavier. Doch das Klavier, auf dem sie spielen lernt, unterscheidet sich sehr vom Instrument, das wir als Klavier bezeichnen. Das Instrument, das Clara spielt, wird in ihrer Zeit noch mit C geschrieben. Sehr verschiedene Tasteninstrumente werden Clavier genannt.
Vor ihrer Zeit war ein Clavier ein Cembalo: »Wohltemperiertes Clavier«. Ein Cembalo wird Clara auch in diesen frühen Jahren nicht spielen: Cembali sind nicht im Angebot der Firma Wieck, Cembali müssen noch auf ihre Wiederentdeckung warten. So wird Clara auf einem Flügel spielen. Und die Saiten werden nicht mehr, wie beim Cembalo, vom Federkiel angerissen, sie werden angeschlagen, über die Hammermechanik. Weil dieses Wort so wuchtig klingt, muß hier gleich relativiert werden: es waren kleine, beinah zarte Hämmerchen, die nach dem Anschlag zur Saite hochschnellten. Die Tasten waren schmaler, der Anschlag war leichter, die Klänge waren reicher an Obertönen. Der Holzrahmen, der Resonanzboden: alles leichter ausgeführt – ein Flügel besaß nur etwa ein Viertel des Gewichts eines heutigen Konzertflügels. Also hatten die Instrumente ein erheblich geringeres Klangvolumen.
Die Jahre 1828 und 1829 im Zeitraffer: die wichtigsten privaten Ereignisse gebündelt.
Im April 28 heiratete Friedrich Wieck erneut – nach vier Jahren im Status des Geschiedenen. Die zweite Frau stammte ebenfalls aus dem kirchlichen Bereich: nach der Kantorentochter nun eine Pfarrerstochter. Clementine Fechner war damals 23, Wieck 43. Clementine, auch Tinchen genannt: intelligent, tüchtig, fügsam, angepaßt. Sie führt den Haushalt, sie vertritt Wieck im Geschäft, wenn er auf Reisen geht.
Mit der neuen Frau eine neue Wohnung: man zog um in das Eckhaus Reichsstraße/Grimmaische Gasse. Die offizielle Anschrift: Grimmaische Gasse Nr. 36. Hier war mehr Platz, nicht nur für die weitere Entfaltung der Familie, auch für die zahlreichen Besucher und Gäste des Hauses, das bald zu einem der gesellschaftlichen Mittelpunkte der Stadt wird. Ein Besucher berichtet später: »Wiecks Haus war zu jener Zeit der Sammelplatz von einheimischen und fremden Musikfreunden. Jeder Komponist und Virtuos, der nach Leipzig kam, fand dort in den Vormittags- oder Abendunterhaltungen die beste Gelegenheit, sich hören zu lassen und selbst Neues zu hören. Die Gesellschaft, welcher auch häufig Damen (z.B. des amerikanischen Konsuls List höchst talentvolle Töchter) beiwohnten, war auch außerhalb Wiecks Hause teils auf Spaziergängen und Landpartien, teils in bestimmten Lokalen in der Stadt öfter zusammen, um ihre Ideen auszutauschen. Die Seele des Ganzen war Vater Wieck, der stets bei sprudelndem Humor war.«
Zeitsprung ins letzte Jahresdrittel: am 20. Oktober fand im Gewandhaus der erste öffentliche Auftritt Claras statt, nach einigen Vorspielterminen vor geladenen Gästen. Die Neunjährige war allerdings noch nicht »Konzertgeberin«, sie spielte eine kurze Gastrolle im Konzert einer Pianistin aus Graz. Clara mußte sich den ersten Auftritt auch noch teilen mit einer anderen Schülerin Wiecks: vierhändig spielten sie ein Werk von Kalkbrenner; Clara saß stimmführend rechts. Und sie fiel sofort auf. Die Leipziger Allgemeine Musikalische Zeitung: »In demselben Konzerte war es uns noch besonders angenehm, die erst neunjährige, mit vielen Musikanlagen ausgestattete Clara Wieck und Demoiselle Emilie Reichold vierhändige Variationen über einen Marsch aus Moses, von Kalkbrenner, mit allgemeinem und verdientem Beifalle vortragen zu hören. Unter der Leitung ihres musikerfahrenen, die Kunst des Pianofortespieles wohl verstehenden und dafür mit Liebe sehr tätigen Vaters, dürfen wir von ihr die größten Hoffnungen hegen.« Die sollten in der Tat erfüllt werden.
Wie die neunjährige Clara sich nach dem Auftritt fühlte, das könnte eine Äußerung von Dietrich Fischer-Dieskau indirekt vermitteln. Er sagte in einem gedruckten Interview: »Mit sieben wußte ich schon: Konzertsaal, Publikum, die Atmosphäre, Beifall. Ich war mir sicher, daß das eines Tages mein Beruf sein würde.«
Schon eine Woche nach der Konzertpremiere sah sich Wieck gezwungen, seiner Tochter ins Tagebuch zu schreiben, was auf ein gesteigertes Selbstbewußtsein, damit auf Eigensinn schließen läßt: »Mein Vater, der schon längst vergebens auf eine Sinnesänderung von meiner Seite gehofft hatte, bemerkte heute nochmals, daß ich immer noch so faul, nachlässig, unordentlich, eigensinnig, unfolgsam etc. sei, daß ich dies namentlich auch im Klavierspiel und Studieren desselben sei, und weil ich Hüntens neue Variationen op. 26 in seiner Gegenwart so schlecht spielte und nicht einmal den ersten Teil der 1. Variation wiederholte, so zerriß er das Exemplar vor meinen Augen, und von heute an will er mir keine Stunde mehr geben, und ich darf nichts weiter mehr spielen als die Tonleitern, Cramer-Etüden und Czerny-Trillerübungen.«
Zeitsprung ins letzte Quartal des Jahres 29: Auftritt des berühmtesten aller damaligen Künstler. Er stellte sich werbend so vor: »Ritter Niccolò Paganini, Kaiserlich-Königlicher Österreichischer Kammer-Virtuose und Königlich Preußischer Konzertmeister«. Er gab vier Konzerte in Leipzig, folgte zuvor einer Einladung in das Haus Wieck. Der Vater in ihrem Tagebuch: »Am 30. September abends ist Paganini angekommen, und nun werde ich also den größten aller Künstler auch hören. Ich mußte ihm auf einem alten, schlechten Pianoforte mit schwarzer Klaviatur (was ein Student zurückgelassen hatte) die von mir komponierte Polonaise in Es vorspielen, was ihn sehr erfreute und meinem Vater mit den Worten andeutete: ich habe Beruf zur Kunst, weil ich Empfindung hätte.«
Clara und Friedrich Wieck besuchten alle vier Konzerte; zweimal durfte Clara mit auf der Bühne sitzen, als besonderer Gast des Maestro. Weil Wieck direkte Verbindung zu Paganini hatte, bat ihn Karl Krägen, Pianist und Komponist in Dresden, um freundschaftliche Vermittlung: »Es trifft sich eben, daß ich ein vierhändiges Rondo Polonais auf 4 schöne Themata aus Paganinis großartigen Konzerten in Arbeit genommen und zur Hälfte beendigt hatte. Ich darf nicht säumen, Dir solches zu schicken, soweit es fertig ist, da ich die Absicht habe, meine Arbeit Paganini zu dedizieren.« Diese neue Komposition spielten Clara und Friedrich Wieck dem italienischen Gast vor, auf einem neuen, gut intonierten Flügel der Firma Wieck, und Paganini war wieder einmal über Clara begeistert. Doch ausgerechnet dieser Geiger mit seiner ins Exzentrische gesteigerten Körpersprache, er gab Clara den Rat, sie solle »nicht zu unruhig und mit zu viel Bewegung des Körpers spielen«. Also: sich zurücknehmen – gestisch, nicht musikalisch.
Nach den vier auch in Leipzig frenetisch gefeierten Konzerten der Abschied. Paganini schrieb Clara Freundliches ins Stammbuch, mit Noten: »al merito singulare di Madamigella Clara Wieck«. Und Clara schenkte dem vierjährigen Sohn des Maestro Weintrauben. Und die Väter küßten sich: zwei lange, hagere Männer. Der lange, hagere Mann aus Leipzig wird sich später zuweilen zum Ebenbild, zum Doppelgänger Paganinis stilisieren, in öffentlichen Auftritten; sein Instrument wird seine Tochter.
Auftritt des Niccolò Paganini …! Der Saal überfüllt, wie immer, die Eintrittspreise überhöht, wie immer, die Erwartungen gespannt, wie immer.
Auftrittsapplaus, sobald ein Schatten zu sehen ist im Hintergrund der Opernbühne, auf der ein kleines Orchester Platz genommen hat, der Dirigent sitzt am Klavier. Es erscheint nicht der Maestro, es ist ein schwarz gekleideter Orchesterdiener, der ein Pult hereinträgt, es aufstellt an der Rampe.
Von Paganini wird viel erzählt, auch im Saal dieses idealtypischen Konzerts – der berühmte Geiger ist Ende Vierzig. Was wird alles über ihn gemunkelt? Zum Beispiel: Er hat ein Verbrechen begangen, hat lange im Gefängnis gesessen, im Kellergewölbe, nur die Violine war bei ihm, und so hat er in dieser Zeit die unvergleichliche Geschicklichkeit, das diabolische Können entwickelt! Allerdings hat er dabei im Laufe der Haftzeit eine Saite nach der anderen zerfetzt, übrig blieb allein die G-Saite; das wirkte so prägend, daß er viele Kompositionen und Improvisationen nur auf dieser Saite spielt …
Wieder ein Schatten im Hintergrund der Opernbühne, wieder aufbrausender Beifall, doch es erscheint ein Livrierter mit zwei Kerzen, die er am Pult des Solisten befestigt und ansteckt. Er tritt ab, Gelächter begleitet ihn.
Ja, man erzählt viel über Paganini. Zum Beispiel: Als seine Mutter starb, saß er an ihrem Bett; als er spürte, daß ihr letzter Atemzug bevorstand, hielt er seine Geige dicht vor ihren Mund, und sie hauchte an seiner Violine ihr Leben aus.
Ich nehme dies als Stichwort für die Anmerkung, daß ich hier keine biographische Skizze des Geigers vorlege, der bei den Hauptfiguren dieses Buchs einen starken, lang nachwirkenden Eindruck hinterließ und der im Publikum Vorstellungen prägte über einen genialen Musiker; ich skizziere nur sein Öffentlichkeitsbild. Keine ergänzenden oder korrigierenden Anmerkungen also zu den Stichworten Mutter und Gefängnis. Entscheidend: Was man über ihn erzählte, das lockte Publikum an. Saiten zerfetzen im Kerker … Sterbende Mutter behaucht Violine …
Wieder ein Schatten im Bühnenhintergrund, wieder Beifall, und der verdichtet sich rasch, von Rufen akzentuiert – jetzt wird es wirklich Paganini sein! Und er ist es! Ist es tatsächlich! Der Geiger scheint durch den brausenden Beifall verwirrt, er stutzt, schlurft weiter zu seinem Pult, verbeugt sich. Alle mustern den berühmten Mann. Franz Xaver Schneider von Wartensee: »Sein Äußeres war von abstoßender Häßlichkeit. Ein üppiger schwarzer Haarschopf fiel ihm auf die schmalen Schultern; sein abgezehrtes Gesicht war ausdruckslos; sein magerer Leib wurde von dünnen Beinen getragen, was einen langsamen und unsicheren Gang zur Folge hatte.« Eduard von Bauernfeld, Schuberts Freund, schreibt im Tagebuch von »den unglaublichen Kratzfüßen der dämonischen Gestalt, die einer an Drähten gezogenen, mageren, schwarzen Puppe glich«. Und Heinrich Heine: »Der schwarze Frack und die schwarze Weste von einem entsetzlichen Zuschnitt, wie er vielleicht am Hofe Proserpinens von der höllischen Etikette vorgeschrieben ist. Die schwarzen Hosen ängstlich schlotternd um die dünnen Beine. Die langen Arme schienen noch verlängert, indem er in der einen Hand die Violine und in der anderen den Bogen gesenkt hielt und damit fast die Erde berührte, als er vor dem Publikum seine unerhörten Verbeugungen auskramte. In den eckigen Krümmungen seines Leibes lag eine schauerliche Hölzernheit und zugleich etwas närrisch Tierisches, daß uns bei diesen Verbeugungen eine sonderbare Lachlust anwandeln mußte; aber sein Gesicht, das durch die grelle Orchesterbeleuchtung noch leichenartig weißer erschien, hatte alsdann so etwas Flehendes, so etwas blödsinnig Demütiges, daß ein grauenhaftes Mitleid unsere Lachlust niederdrückte. Hat er diese Komplimente einem Automaten abgelernt oder einem Hunde? Ist dieser bittende Blick der eines Todkranken, oder lauert dahinter der Spott eines schlauen Geizhalses? Ist das ein Lebender, der im Verscheiden begriffen ist und der das Publikum in der Kunstarena, wie ein sterbender Fechter, mit seinen Zuckungen ergötzen will? Oder ist es ein Toter, der aus dem Grabe gestiegen, ein Vampir mit der Violine, der uns, wo nicht das Blut aus dem Herzen, doch auf jeden Fall das Geld aus den Taschen saugt?«