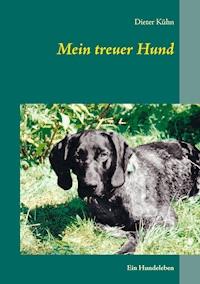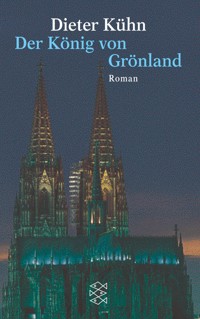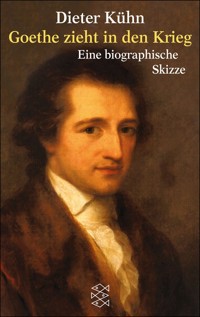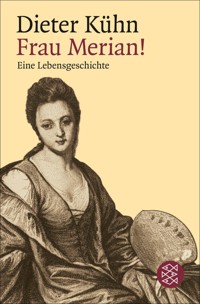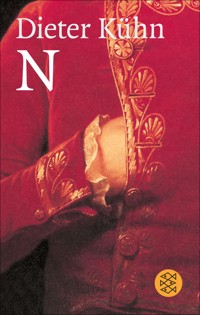8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieter Kühn gehört zu den bedeutendsten Biographen unserer Zeit. Elegant verbindet er historische Genauigkeit mit der Verve eines großen Erzählers und entwickelt für jeden seiner Helden eine neue Form der Annäherung. In diesem Band berichtet Kühn aus dem Leben von Künstlern, Naturwissenschaftlern, Politikern – vom Ende des 18. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Die Zeit Napoleons beleuchtet Kühn aus dem Blickwinkel des gefürchteten Polizeiministers Fouché, des Attentäters Staps und des Marschalls Ney. Er hinterfragt kritisch die öffentliche Biographie Josephine Bakers und widmet sich eingehend Robert Musil und dem Komponisten Max Schillings, der die Gleichschaltung des Musikbetriebs unter den Nationalsozialisten organisierte. Grenzen der Vernunft zeigen sich bei einigen Figuren des Dritten Reichs: dem konservativen Widerständler Goerdeler, dem gefeierten Jagdflieger Hartmann, dem Rüstungsminister Speer. Besonders hervorzuheben ist das Portrait Annemarie Bölls, der beeindruckenden und selbstbewussten Frau an der Seite des Nobelpreisträgers Heinrich Böll.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 834
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Dieter Kühn
Portraitstudien schwarz auf weiß
FISCHER E-Books
Inhalt
Erster Teil
Josephine
Aus der öffentlichen Biographie der Josephine Baker
DA IST EINE ZAHL, mit der sich beginnen ließe, das Geburtsdatum: 3. Juni 1906. Ein Geburtsort läßt sich angeben: St. Louis. Und bekannt ist, daß die Mutter eine Schwarze aus dem Senegal war und der Vater ein Weißer, ein spanischer Landarbeiter, der seine Familie im Stich ließ. Aber ist das nicht schon ein Detail, das nach Vorlagen erfunden sein könnte? In wie vielen Lebensgeschichten, Lebensromanen wiederholt sich dies: Der Mann, der seine Frau sitzenläßt, mit dem Kind, das er ihr gemacht hat, womöglich mit mehreren Kindern?
Wenn wir erfahren, wie sich Josephine Bakers Kindheitsgeschichte fortsetzt, so geraten wir noch tiefer in Geschichten, die wir längst kennen: Geschichten, die schon oft erzählt wurden und immer wieder erzählt werden, beispielsweise in Unterhaltungsromanen über bunte, abenteuerliche Lebensläufe, die in Armut, in bekanntlich bitterer Armut beginnen und hinaufführen in Höhen, in bekanntlich oft schwindelnde Höhen; Geschichten von leidvollen Erfahrungen und glücklichen Wendungen, von Rückschlägen, vom Aufstieg, vom Triumph zu guter Letzt. Das Märchen vom Aschenputtel oder vom häßlichen Entlein; die Story vom Tellerwäscher, der mehrfacher Millionär wurde; der Lebensroman des bettelarmen Einwanderer- oder Waisenjungen, der Filmstar wurde. Und nach gleichem Muster: die märchenhafte Story, der bunte Lebensroman vom Aufstieg der Josephine Baker.
Wollen wir dieses Lebensmärchen, diesen Lebensroman der Josephine Baker kennenlernen oder Fakten ihrer Biographie? Solch eine Frage, gleich zu Anfang eines Textes gestellt, dürfte leicht zu beantworten sein: Selbstverständlich wollen wir die biographischen Fakten kennenlernen.
DABEI KÖNNTE ein Buch helfen, das den Titel Memoiren trägt. Als Verfasserin ist groß und deutlich Josephine Baker genannt. Auf der Impressumseite der deutschen Erstausgabe von 1928 steht kleingedruckt unter anderem: Herausgegeben von Marcel Sauvage. Dies ist nicht bloß der Name des Herausgebers, auch nicht der Name eines Ghostwriters, der einen schriftlich vorgelegten Text überarbeitet hat: Sauvage ist der Macher dieses Buchs.
Es beginnt damit, daß er berichtet, wie sich die Baker »vor Lachen ausschütten« wollte, als er ihr vorschlug, ihre Memoiren zu schreiben. Da war sie gerade zwanzig und wohnte in einer »ruhigen Familienpension« in der Nähe des Parc Monceau, in sage und schreibe zwei (allerdings großen) Zimmern. Der Tanzstar als bürgerliches Mädchen, ein bürgerliches Mädchen als Tanzstar?
Diesen ersten Eindruck verwischt Sauvage sofort wieder, indem er erzählt, wie er sie mittags um zwölf besucht, und sie muß erst geweckt werden, zieht einen Morgenmantel an, einen rosa Morgenmantel, schlüpft in rosa Pantöffelchen: also doch bürgerlich? »Groß, schlank, beweglich, lachend steht sie vor mir, und der Morgenrock ist durchaus nicht immer fest geschlossen.« Aha! soll der Leser hier denken … Und sein Nicken soll sich fortsetzen, wenn nun der Kopf dieser jungen Tänzerin als der Kopf eines »ungebärdigen kleinen Mädchens« bezeichnet wird, »reizend und schelmisch«, mit 32 (zweiunddreißig) gesunden Zähnen, und ihr Haar ist geölt, liegt dicht am Kopf an, und ihre Fingernägel sind versilbert. Nun sieht man sie schon deutlicher, wie man sie damals zu sehen gewohnt war, bei Auftritten und auf Bildern in der Presse. Und wenn Sauvage nun auch noch erzählt, daß in ihrem Wohnraum in der Familienpension eine Büste von Ludwig XIV. neben einem Käfig mit Sittichen steht, daß auf einem Empiremöbel eine Stoffpuppe sitzt, auf dem Plattenteller eines Grammophons ein »Haufen zusammengeknüllter Hundertfrancscheine« liegt, so kann man sich noch besser das Bild machen, das man sich hier machen soll.
Auf welchen Voraussetzungen der nun folgende Lebensbericht entwickelt wird, das verrät der Verfasser selbst: Die amerikanische Tänzerin spricht nur ein paar Worte Französisch, der französische Autor spricht nur wenige Worte Englisch, also ist man auf einen Übersetzer angewiesen. Keine gute Basis für eine differenzierte Verständigung, die bei einer gemeinsamen Arbeit notwendig wäre. Nach überraschend kurzer Zeit freilich hat die Baker, so lesen wir, derart viel Französisch gelernt, daß man auf den Dolmetscher verzichten zu können glaubt. Um welchen Zeitraum es sich hier handelt, erfahren wir nicht. Nach Inhalt und Umfang der Gesprächsäußerungen, die in diesem Büchlein »wiedergegeben« werden, kann die Baker höchstens an einigen Nachmittagen von sich erzählt haben.
Und zwar erzählte sie im Plauderton. Oder richtiger: Der Verfasser läßt sie im Plauderton erzählen. Ich bezweifle nicht, daß die junge Tänzerin und Sängerin aus ihrem Leben plauderte; die spätere Baker jedenfalls, das bezeugen Tonaufnahmen, hat stets im Plauderton aus ihrem Leben erzählt. Nur muß man sich fragen, ob die Plaudereien oder Plappereien, die Sauvage in seinem Buch (auf-)schreibt, identisch sind mit dem Plaudern und Plappern der jungen Baker: Es gab damals keine Möglichkeit der Tonaufzeichnung, Sauvage konnte sich höchstens Stichwörter notiert haben, aus denen er nachträglich wieder Sätze machte zwischen Anführungsstrichen. Ein spontanes Verstehen, Notieren, Wiedergeben solcher Plaudereien, noch dazu beim Sprechtempo der quirligen Baker, das war kaum möglich – schon gar nicht bei der Vermittlung eines Dolmetschers, dessen Anwesenheit Sätze eher steif macht als lockert. Und danach, als man auf den Dolmetscher verzichtete: Wie soll da, bei wechselseitigen Verständigungsschwierigkeiten, ein spontanes Verstehen möglich gewesen sein? Was die Baker sagte, das hat Sauvage geschrieben; das zeigt schon die Gleichheit der Schreibweise in Vorwort und Hauptteil. Das »Ich«, das in diesen Memoiren Ich sagt, munter drauflosplaudernd, wie schon im Vorbericht Sauvage munter drauflosplauderte, dieses »Ich« kann also nur teilweise identisch sein mit dem Ich der Josephine Baker des Jahres 1926.
Also: dieses Buch weglegen und kein Wort mehr darüber verlieren? Wir werden noch einige Seiten lang bei diesen Memoiren bleiben müssen, denn sie vermitteln durchaus Informationen: freilich weniger zur Person Josephine Bakers als zu einer öffentlichen Figur mit dem Namen Josephine Baker; Sauvage hat hier den Grundstein gelegt zu ihrer öffentlichen Biographie.
DAS LEBEN DIESER SHOWFIGUR beginnt auch in diesem Buch in St. Louis. »Da bin ich geboren, Benard Street, im Staate Missouri, Vereinigte Staaten. – Very beautiful and funny – schön und sehr amüsant.«
Es werden nun einige Angaben zur Familie gemacht: Der Vater war Spanier; er trennte sich von der Familie, diese Familie war sehr arm. Das kleine Mädchen träumte viel, und zwar von Königinnen: spitze Schuhe, lange Mäntel, Gold und blonde Haare. »Immer steigen sie große Treppen herunter, Stufen und Stufen, unendlich viele Stufen.« Ein Traum, der offenbar bereits Showelemente verarbeitete, im Kopf von Josephine Baker oder im Kopf von Marcel Sauvage: das königliche Herabschreiten von Revuestars auf großen Kulissentreppen, und rechts und links reiht sich Statisterie – so sahen schon damals, 1926, einige ihrer Auftritte aus. Von diesem auf Revuebühnen ständig reproduzierten Bild wird nun der Traum der kleinen Baker abgeleitet; damit zeigt sich die Herstellungsweise solch eines Buchs der Unterhaltungsbranche: ein Zusammenfügen von Versatzstükken.
Der »Traum« vom Auftritt als »Revuekönigin«, wie die Baker – unter anderem – genannt wurde: Wie kam sie auf die Bretter, die die Welt verstellen? Das Büchlein nennt als Motiv, als Impuls: »Weil ich in einer kalten Stadt geboren bin, weil ich während meiner ganzen Kindheit entsetzlich gefroren habe, weil ich mir immer gewünscht habe, auf der Bühne zu tanzen.« Und einige Seiten weiter: »Ich hatte keine Strümpfe, ich fror und ich tanzte, um warm zu werden.« Dieses St. Louis liegt offenbar in Alaska, immer nur Winter, immer nur Kälte, und die kleine Josephine ohne Strümpfe, da hat sie denn getanzt, um warm zu werden – so wurde das in diesen Memoiren geschrieben, das konnte die Baker nachlesen: »Ich tanzte, um warm zu werden.« Vielleicht auch wurde es ihr wieder von Lesern der Memoiren zugetragen, als Frage, ob sie denn wirklich … Und da gab es für sie nur eine Antwort: »Ja, ich tanzte, um warm zu werden.« Und das wiederum wurde aufgegriffen, weitergegeben, vervielfältigt in Zeitungsberichten über die junge Tänzerin, die in St. Louis gefroren hat und tanzte, um warm zu werden. Und weil man immer wieder von ihr hören wollte, daß sie tanzte, weil sie so gefroren hat, so hat sie es immer wieder bestätigt: »Ich tanzte, um warm zu werden.« Ein Satz, der jahrzehntelang wiederholt wurde: »Ich tanzte, um warm zu werden.« Ein Satz, der in verschiedenste Sprachen übersetzt wurde: Sie tanzte, um warm zu werden. Ein Satz, der kaum noch andere Sätze über ihre Kindheit zuließ: Sie tanzte, um warm zu werden. Ein Satz, der sich selbständig machte: »Ich tanzte, um warm zu werden.« Ja, sie tanzte, um warm zu werden, und das kann man sich eigentlich gut vorstellen in den Kreisen und Gruppen, für die solche Bücher produziert werden: die heitere Art der »Neger«, speziell der armen »Neger«, mit Problemen fertig zu werden: Haben sie im Winter nicht genug Kleidung und Brennstoff, nun, so tanzen sie eben, tanzen offenbar stundenlang, tagelang, da kann ihnen Kälte nichts anhaben …
AUS SOLCHEM STOFF wird die (Selbst-)Biographie der Josephine Baker gemacht; nach der Vorlage vor allem dieses Buchs wird die Story ihrer ersten Lebensjahre von Zeitungen und Zeitschriften reproduziert, deren Stories von weiteren Zeitungen und Zeitschriften reproduziert werden, deren Stories wiederum von Zeitungen und Zeitschriften reproduziert werden, das läßt sich nachweisen. An dieser Reproduktion beteiligte sich auch die Baker selbst: So, wie sie erfolgreiche Gesten jahrzehntelang wiederholte (das schelmisch-koboldhafte Winken oder ihr Hochwerfen der Arme bei Ovationen), so wiederholte sie auch Sätze und Satzfolgen, die sich als erfolgreich, als wirkungsvoll erwiesen hatten: »In St. Louis ist es im Sommer sehr warm und im Winter sehr kalt. Ich habe oft gefroren. Und da habe ich mich eben warmgetanzt.«
Freilich gerieten die Muster schon mal durcheinander. Zum Beispiel gibt es auch die Vorlage der zwar armen, aber glücklichen Kindheit; da wäre denn das Tanzen Ausdruck dieses kindlichen Glückszustands. Manchmal reproduzierte die Baker auch dieses Muster, etwa in den fünfziger, sechziger Jahren, bei Interviews, bei Lebensrückblicken, etwa anläßlich eines neuen Comeback. Da teilte sie denn plaudernd mit, was auf Tonband aufgezeichnet wurde, sich ständig reproduzieren läßt: Daß sie das älteste von vier Kindern war, drei Mädchen, ein Junge, und ihre Mutter war Wäscherin, ging jeden Morgen früh aus dem Haus, und der Vater war Spanier, er »arbeitete weit weg«, und sie sieht weder dem Vater noch der Mutter ähnlich, und alle zigtausend »Neger« in St. Louis sind so schön braun wie sie, auch der Mississippi, der an der Stadt vorbeifließt, ist manchmal so braun, aber meistens ist er schlammig-gelb, und auf ihm fahren viele Schiffe und bringen die Baumwolle zum Meer hinunter, die Seine ist gegen den Mississippi wie ein kleines Kind, und es gibt auch viele Fabriken in St. Louis und Rauch und Schmutz, so viel, daß die Leute davon traurig werden, they get the blues, aber St. Louis und der Blues gehören zusammen wie St. Louis und der Mississippi, und mit fünf Jahren ging sie zur Schule, aber sie mußte auch arbeiten, putzen, meistens Treppen, jedenfalls: Sie sei damals sehr glücklich gewesen, werde St. Louis nie vergessen.
Und gleich der springende Punkt: »Warum ich Tänzerin geworden bin? In St. Louis ist das Tanzen nichts Besonderes, dort wird man auch nicht geboren wie anderswo, nein, dort tanzt man auf die Welt, ganz gleich, ob man dann glücklich oder unglücklich ist. Und man kommt mit sehr viel Liebe auf die Welt; Liebe zu Blumen, Liebe zu Tieren und natürlich: Liebe zu den Menschen, mal mehr, mal weniger Liebe. Doch ohne Liebe, ohne ein bißchen Zärtlichkeit, was wäre ich geworden ohne ein Herz, das mich tröstet, das bei mir ist, das man nicht vergißt, wenn alles traurig ist …« Hier geht ihr gesprochener Text schon über in Texte, wie sie jahrzehntelang für sie geschrieben wurden; und diesen unmerklichen Übergang von biographischem Stoff in Songstoff und von Songstoff wieder zurück in biographischen Stoff werden wir bei der Baker noch öfter beobachten.
ZURÜCK zu den Memoiren: Hier erzählt die zwanzigjährige Baker als nächstes von ihrer Liebe zu Tieren, hier läßt sie Marcel Sauvage als nächstes von ihrer Liebe zu Tieren sprechen, in seiner Ich-Form. Schon im Vorwort war erwähnt worden, daß sie »zwischen zwei Tänzen« ihrer Ziege Toutoute die Saugflasche gab. Das geschah nicht vor einem zuschauenden Publikum, das geschieht nun vor einem Lesepublikum, ist damit ebenfalls ein öffentlicher Akt: zwischen zwei Tänzen jeweils das Nähren der offenbar die ganze Nacht über milchdurstigen kleinen Ziege. Wahrscheinlich mußte die Tänzerin, die vielleicht noch nackte Tänzerin dabei vor Toutoute hinknien, um den Gummischnuller in Höhe des Ziegenmäulchens zu halten – ein Bild, das sich einprägen soll. So erfüllte das Nähren der Ziege einen doppelten Zweck: Es nährte auch ihr Image.
Einprägsam auch das Bild der Vielzahl von Tieren, die sie liebte: »Katzen, Hunde, Affen, Papageien, Kälber und die Ziegen. Alle Tiere, sogar die Schlangen!« Beim Wort Schlangen sollen sich wohl Assoziationen einstellen: die schlangengleiche Gelenkigkeit, fast Gelenklosigkeit, das schlangenartig Bannende, Hypnotisierende ihres Tanzes – lauter zahlende Kaninchen vor ihr …
Wie also in ihrer Kindheit schon die Lust zum Tanz da war, so auch die Liebe zu Tieren. Das werden die meisten Leser solcher Memoiren akzeptieren: Wer hat in seiner Kindheit nicht irgendein Tier geliebt? Die Mutter von Josephine freilich wollte – so was ist sattsam bekannt – keine Hunde und Katzen in der kleinen und ärmlichen Wohnung haben, das Kind aber – so was ist sattsam bekannt – wollte auf seine Tiere nicht verzichten, also »schlief ich oft im Keller mit meinen Hunden und Katzen, nachdem ich mein Brot mit ihnen geteilt hatte«. Nun sind brotfressende Hunde recht selten, und Katzen fressen Brot eigentlich nur, wenn es in Milch getunkt ist – hier muß also wohl symbolisch vom trockenen Brot der Armut die Rede sein, oder? Wie auch immer, wichtig ist allein das Bild, das sich einprägen soll: Das tanzfrohe Kind, das sein Brot mit Tieren teilt … Einprägsam auch das Bild der berühmten Tänzerin, die (in ihren zwei Zimmern der Familienpension?) umgeben ist von etlichen Tieren. »Momentan besitze ich sieben Hunde, drei Katzen, ein Schwein, einen Papagei, zwei Sittiche, zwei Ziegen, einen Goldfisch und eine Schlange.« Ich bezweifle nicht, daß die Baker Tiere besaß, vielleicht sogar in dieser Zahl und Mischung. Mit öffentlichen Hinweisen auf diese Tierliebe kommt sie freilich sehr dem Publikum entgegen, oder: kommt Sauvage dem Publikum entgegen.
Die Tänzerin und ihre Menagerie, ihr Privatzoo – als offenbar routinierter Autor stellt hier Sauvage gleich eine Beziehung her zu ihrem Tanz: »Puppen und Tiere sind meine liebsten Vorbilder.« Bei den Puppen ist hier natürlich an Stoffpuppen zu denken, Puppen, die man schlenkern kann, gelenklos. Und bei den Tieren ist es die Gelöstheit der Bewegungen. »Finden Sie nicht, daß ihre Bewegungen schöner sind als unsere?« Und sie vergleicht in diesem Text die Bewegungen ihres Schweinchens Albert mit den Bewegungen eines Oberkellners namens Albert, aber da scheint in der Grazie und Gelöstheit der Bewegungen das Schweinchen Albert doch besser abzuschneiden.
WIE WIRD NUN das bettelarme, tierliebende Kind zur berühmten Tänzerin, zum »schwarzen Idol«? So wie es in vielen Unterhaltungsromanen und unterhaltenden Berichten über den Aufstieg großer Künstler steht: durch Kämpfe und Wunder. Dazu Details, die man schon kennt. Etwa: Die kindliche Tänzerin gibt sich für älter aus, man nimmt das hin, stellt sie ein, bezahlt sie, wenn auch vorerst nur gering. Dann ein Entschluß, eine Zäsur: Die Sechzehnjährige läßt sich erstens die Haare kurz schneiden, verläßt zweitens die Familie, die sie auf dem Weg zum Erfolg behindert. Ja, ein wenig Rücksichtslosigkeit, Härte gehört schon zum Weg nach vorn, nach oben – diese »Enthüllung« durch Sauvage wird kaum einen seiner Leser überraschen.
Die kleine Josephine hat sich also in den Kopf gesetzt, aus Armut und Namenlosigkeit herauszukommen, und was eine Josephine sich in den Kopf setzt, das setzt sie auch durch, das läßt sich denken, das zeigt schon ihr rascher und steiler Aufstieg.
So wird denn von Baker-Sauvage erzählt, wie die kleine, magere Josephine nach New York fährt, wie sie immer wieder beim Direktor einer Music-Hall vorspricht, bis er sie endlich einstellt, nur um Ruhe zu haben vor dieser lästigen, zähen Person. Josephine kommt in die zweite Truppe, die auf Tournee geschickt wird. Die bekanntlich harte Tournee-Arbeit. Dennoch, man lernt sehen, wer da tanzt, wie man tanzt – das wird von Kolleginnen verspottet, selbstverständlich, kein Leser solch eines unterhaltenden Buchs würde das anders erwarten. Aber es gibt ja nicht nur die letztlich bloß neidischen Kolleginnen, da ist auch ein Mann, der einen Blick, ein Gespür, eine Witterung, eine Nase, einen sechsten Sinn hat für das Besondere, ein Regisseur, ein Direktor, der ihr die Chance gibt, sich nach vorn zu tanzen.
Hier wird nun ein Titel genannt in diesem Buch, das sonst wenig konkrete Angaben enthält: Von 1923 bis 1924 tanzte sie drei Spielzeiten lang in Shuffle Along, einer musikalischen Komödie in drei Akten. Sauvage läßt seine Buchfigur berichten: »Ich bin aus der zweiten Reihe in die erste gekommen wegen meines musikalischen Schielens und wegen meiner Art, dem Publikum Arme und Beine an den Kopf zu werfen.« Das tat sie auch in Chocolate Dandies.
Und dann die Chance, die große, die einmalige Chance, von der man in unterhaltenden Lebensromanen über den Aufstieg unbekannter Personen zu sehr bekannten Persönlichkeiten immer wieder liest: »Unser Star konnte eines Abends nicht auftreten. Ich durfte ihn ersetzen. Ich hatte viel mehr Erfolg als der Star.« Glück und Können – beides bringt einen voran, nach oben. Entsprechend wachsen die Einkünfte: erst soundso wenig, dann soundsoviel Dollar pro Woche. So geht das nun mal, im Showgeschäft.
Wie es im Showgeschäft zugeht, darüber erfährt man in diesen Memoiren nur Allgemeines, das man sowieso schon weiß: Man macht allerlei mit, es kommt allerhand vor, aber wer zäh ist und entsprechend Glück hat, der schafft es schon … Was die Baker in späteren Jahren zu diesem wichtigen biographischen Abschnitt erzählte, vor Mikrophonen und Kameras, das war meist nur (mit geringen Variationen hier und dort) eine Reproduktion dieses Abschnitts der Memoiren, die für sie geschrieben wurden: Daß sie eigentlich immer schon wußte, was sie wollte, und so schnitt sie sich mit 16 die Haare ab, lief von zu Hause weg, begann ihre Karriere in Philadelphia, auf einer kleinen Bühne (dem Standard Theatre) in einer Revue, verdiente zehn Dollar die Woche, aber das Geld wurde kaum einmal ausgezahlt, sie hat gehungert, war dürr zum Anbrennen, reiste eines schönen Tages nach New York, ging dort schnurstracks zur 63. Straße, zur Music-Hall, stellte sich dem Direktor vor, der sagte ihr, sie solle am nächsten Tag wiederkommen, das sagte er eine ganze Woche lang, sie wußte nicht, wo sie schlafen, was sie essen sollte, aber sie ließ nicht locker, bis der Direktor sie eines Tages anschrie, sie sei zu jung, außerdem sei sie häßlich, ihre Figur sei mies, ihr Gesicht sei mies, sie solle verschwinden! Das war hart, aber sie war auch hart und rückte ihm wieder auf die Pelle, bis er sie anstellte, in seiner Ersatztruppe, die zog durch das Land, ein halbes Jahr war sie unterwegs, die Jungs waren nett, die Mädchen konnten sie nicht riechen, sie tanze wie ein Affe, ihr Name stand nie im Programm, und sie kam nach Brooklyn zurück, dort sah sie der Direktor, er sagte ihr, sie solle am nächsten Tag in sein Büro kommen, es sei wichtig, und es war wichtig, er schloß einen neuen Vertrag mit ihr, sie bekam nun 20 Dollar die Woche, tanzte in Shuffle Along, zwei Jahre lang, »und dann kam der Europavertrag«.
Der große Sprung! Dies zumindest scheint klar: Sie kam nach Frankreich als Mitglied einer Theatergruppe, der Revue Nègre, die eine Tournee oder zumindest Gastspiele machte. Fuhr sie schon in der Absicht mit, für die nächsten Jahre oder gar endgültig in Europa zu bleiben?
Keine Angabe, kein Hinweis zu diesem Punkt. Statt dessen wird in den Memoiren der Abfahrtstermin genannt: der 15. September 1925, abends; der Name des Schiffs wird genannt: Berengaria; der Name des Kapitäns wird genannt: D.R.D. Irving; Gründe, Motive aber werden nicht genannt. Hatte es doch Schwierigkeiten in New York gegeben? Hatte sie von besseren Chancen in Europa gehört? Oder war da ein spontaner Entschluß, war da Lust auf ein Abenteuer, das in solch einer Lebensgeschichte nicht fehlen darf?
Abenteuer – ein wichtiges Stichwort in diesem Lebensroman! »Josephine verkörpert für uns die fremdartige Poesie aller Abenteuerromane, die wir seit zwanzig Jahren lesen«, schreibt Sauvage. Fast möchte ich diesen Satz als Schlüsselsatz der Memoiren bezeichnen, als Leitsatz, Richtsatz: Was Josephine erlebt, das ist bereits vorgelebt von Frauenfiguren unterhaltender, abenteuerlicher Romane, und indem sie es ähnlich so nachlebt, noch einmal lebt, bestätigt sie dieses Muster: Das Kind, das aus kleinen Verhältnissen kommt, früh schon seinen Willen durchsetzt, sich rechtzeitig von der Familie löst, sich hochkämpft durch Zähigkeit und mit Hilfe gelegentlicher Wunder, und dann der große Aufbruch, der sich einprägt: »Als die Statue der Freiheit am Horizont verschwand, war ich frei! Ich begann, vor mich hin zu singen. Ein Lied, leiser als das Lied des Salzwassers an den Eisenwänden der Berengaria.« Diese Beschreibung könnte Vorlage sein für einen Liedtext, könnte Echo eines Liedtextes sein …
In diesem konsequent aufgebauten Wort-Arrangement nun eine Überraschung: Es wird etwas ausgesprochen, das nicht schon vorformuliert ist – die Baker redet von Körperverstümmelung, von Amputation.
Der Anlaß: Während der Überfahrt wird eine Treibmine gesichtet, alle Passagiere müssen an Deck, und dort denkt die junge Tänzerin an den Krieg, von dem sie nichts versteht, aber den sie entsetzlich findet, auch in den Folgen: »Ich habe so schreckliche Angst vor Männern, die nur noch einen Arm, ein Bein oder ein Auge haben. Sie tun mir von ganzem Herzen leid, aber ich habe einen Widerwillen gegen alles Krüppelhafte.« Bei allem Vorbehalt gegen Zitate des Herrn Sauvage – sinngemäß könnte sie sich durchaus so geäußert haben. Widerwillen gegen alles Krüppelhafte: Hier, plötzlich, ist etwas erkennbar wie Wahrheit. Spielt hier die Angst mit, sie könnte selbst einmal (etwa durch einen Unfall) die fabelhafte Gelenkigkeit, Beweglichkeit einbüßen? Eine individuelle und zugleich kollektive Angst. Daß sie hier artikuliert wird, überrascht in diesem Text: als würde in einer Ausstattungsnummer der Folies-Bergère eine Wunde bloßgelegt.
DIESER WUNDE PUNKT wird in den Memoiren rasch wieder verdeckt – es wird über die Landung in Cherbourg geschrieben, über die Ankunft in Paris. Und hier scheint ein Flair, ein Fluidum die Tänzerin und die Stadt sofort zu verbinden: Entzückt entdeckt sie Paris, entzückt entdeckt Paris sie. »Ich habe Paris sofort begriffen und liebe es leidenschaftlich. Paris hat mich vom ersten Abend an mit offenen Armen aufgenommen und mich mit Beifall überschüttet, und ich hoffe, es liebt mich.« Das »hoffen« ist Koketterie, denn zum Zeitpunkt dieser Äußerung, zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung ist längst offenkundig, daß Paris sie liebt, zumindest das »tout Paris«, das es sich leisten kann, Eintrittskarten für das Théâtre des Champs Elysées, für die Folies-Bergère zu bezahlen oder die Getränke in Kabaretts und Bars, in denen sie ebenfalls auftritt. »Ach, ich liebe Paris, seine Bewegung, seinen Lärm, sein Geheimnis, seine vielen Geheimnisse, alle seine Geheimnisse.« Was Sauvage hier im Namen oder Auftrag der Baker formuliert, das ist beinah auch wieder Liedtext, hier der Text eins der Lieder, mit denen die Baker recht bald schon ihre Liebe zu Paris besang, was wiederum die Liebe des Pariser Publikums zur Baker steigerte. Die Vereinigung mit Paris vollzogen in Liedtexten, in Zeitungstexten, in diesem Buchtext: »Paris ist Tanz, und ich bin Tänzerin.« Und Hochrufe auf Paris, das ihr zujubelt.
Und auf Berlin, das sie feiert, bei ihrem ersten Gastspiel: »Berlin, das ist schon toll! Ein Triumphzug. Man trägt mich auf Händen.« Ein Berlin, in dem sie durchgefallen wäre – diesem Berlin hätte das Flair gefehlt, das Fluidum, das Paris, die Stätte ihrer Erfolge auszeichnet, da wäre man preußisch-hölzern gewesen, die bekannte Tradition der Soldatenkönige, kein Wunder, daß man dort keinen Sinn hat für ihre exotisch-erotischen Tänze. Glücklicherweise müssen sich die Baker und Sauvage, Sauvage und die Baker so negativ nicht äußern. »Wenn ich ein großes Tanzlokal betrete, hört die Musik auf zu spielen, alle stehen auf und begrüßen mich.« Nicht allein dies: sie wird auch im höheren Kulturbereich anerkannt, und so etwas ist vielen Showstars wichtig, zusätzlich, zur Abrundung des Öffentlichkeitsbildes. »Max Reinhardt, der große Regisseur, kam zu mir und hatte gleich einen Kontrakt bei sich. ›Ich engagiere Sie für drei Jahre ans Deutsche Theater. Und glauben Sie mir, ich mache die erste Schauspielerin Europas aus Ihnen.‹«
Max Reinhardt war nun in der Tat von der Baker fasziniert; in einem kleinen, privaten Kreis, zu dem er gehörte, ließ man sie wiederholt tanzen, plante ein Ballett für sie: Als Sulamith sollte sie nackt vor König Salomo tanzen. Aber es blieb bei solchen Mitternachtsplänen. An Auftritte der »kleinen Baker« in Sprechrollen war dagegen wohl kaum gedacht worden. Aber gleichgültig, ob Reinhardt sie als Schauspielerin haben wollte oder nicht – diese »Äußerung« paßt in diesen Text, wie maßgeschneidert. Ein bißchen schielt die Unterhaltungsindustrie ja nach »oben«, zum Kulturbereich, man möchte teilhaben an höheren Motivationen, an größeren Wörtern zumindest. Warum soll Sauvage also nicht auch erwähnen, daß die Baker in deutschen Zeitschriften als Ausdruck, als Figur des Expressionismus bezeichnet wurde, des neuen Primitivismus? Hier mögen durchaus Zusammenhänge bestehen: eine Zeit damals, in der man vielfach »Negerkunst« sammelte, Statuen, Masken, sie beeinflußten Malerei und Bildhauerei, und nun ihr Auftritt, als lebendige Bestätigung: »Das schwarze Idol«.
Ehe wir an diesem Punkt nachdenklich werden können, führt uns die rasche Textbewegung schon weiter; es wird erzählt, beim Stichwort Berlin, was die Baker alles so geschenkt bekommt: »antike« Ohrgehänge, die eine Herzogin anderthalb Jahrhunderte zuvor getragen haben soll, und Perlen, haselnußgroß wie in morgenländischen Märchen, und farbenprächtige Blumen aus Italien, in Moos gebettet. Und dann ein schön-barbarischer Wunsch, den sie hoffentlich tatsächlich geäußert hat: »Ich wollte auch Blumen haben, die Fliegen fressen und richtiges Fleisch, die innen kleben und große Haare im Kelch haben.« Aber wie konnte sie das mit ihren geringen Kenntnissen der französischen Sprache so genau artikulieren? Inzwischen ist mehr als die Hälfte der Seitenzahl der Memoiren erreicht, da dürfte der Dolmetscher längst entlassen sein. Wieviel an Josephine Baker hat Marcel Sauvage erfunden? Aber: warum hier nach dem Wirklichen, dem »Wirklichen« in der Biographie dieser Showfigur fragen? Ist nicht sinnvoller herauszustellen, was für die Darstellung einer Showfigur typisch ist?
Zu solch einer Showfigur gehört viel Nippes und Tinnef, der teure, nutzlose Kleinkram, der so dekorativ wirkt auf Fotos in Zeitungen, Illustrierten. Hier sind es kleine Elefanten aus russischem Elfenbein, »geschnitzt von den armen Leuten am Nordpol« (also wohl von Märchenfiguren!), sind es Schuhe aus Gold (auch sie aus Märchenbüchern!), ist es ein gläsernes Pferd mit Parfum im Bauch – und so weiter. Natürlich gehört auch ein Auto zur öffentlichen Ausstattung der Tänzerin, ein ganz besonderes Auto, das ihr geschenkt, selbstverständlich geschenkt wird, ein »Spezialmodell, ganz mit Schlangenhaut überzogen«. Das erinnert an die märchenhaften Spezialausführungen damaliger Maharadschas oder an das bastumflochtene Auto des Nabob Gulbenkian: hier also die Kotflügel mit Schlangenhaut überzogen, die Kühlerhaube mit Schlangenhaut überzogen, die Türen mit Schlangenhaut überzogen, das Heck mit Schlangenhaut überzogen – oder war es doch nur innen mit Schlangenhaut überzogen, die Sitze, die Seitenwände?
In all diesem Ausstattungs-Talmi plötzlich wieder eine Äußerung, die sich einhakt, sich festfrißt: »Ich bin nicht Tänzerin, nicht Schauspielerin, nicht mal schwarz: Josephine Baker, das bin ich!« Der Kern ihrer Äußerung dürften diese drei Wörter sein: »nicht mal schwarz«. Auch hier so etwas wie ein wunder Punkt. Denn sie war ja nun Mischling, Mulattin, dennoch wurde sie gefeiert als »schwarzes Idol«, als »schwarze Venus«, als Inkarnation einer schwarzen Schönheit, die sich erst Jahrzehnte später als black beauty artikulierte, kämpferisch. Mehrfach läßt Sauvage sie in seinem Buch betonen, daß sie mit »Negern« auftritt, in der berühmten Revue Nègre, daß sie vielfach »Negerlieder« singt, und der Tanz, den sie so berühmt macht, der sie so berühmt macht, der Charleston, gilt als typischer »Negertanz«. Und nun sagt die gleiche Baker, die in diesem Buch als »schwarze Perle, schwarze Poesie« bezeichnet wird, sie sei »nicht mal schwarz«?
Der Frage, die sich hier stellt, weicht Sauvage aus; er läßt seine Buchfigur weiterplaudern, daß sie gern ißt, und zwar vorzugsweise Kaviarpfannkuchen, er läßt sie kosmetische Tips geben, und da preist sie Regenwasser an, Gurkenpomade, Bananensaft, Erdbeerbrei. In dieser Kosmetikplauderei taucht plötzlich wieder das Stichwort auf, das eben noch verdrängt oder übersprungen worden war: »Man hat mich für schwärzer ausgeben wollen, als ich bin, aber ich möchte weder weißer noch schwärzer sein.« Dieser doppelte Hinweis läßt aufhorchen: Ist hier etwas nicht so selbstverständlich, wie es den Anschein hat?
In den Memoiren erfahren wir nichts weiter zu diesem Punkt. Aber Paul Duval, seinerzeit Direktor der Folies-Bergère, berichtet dies über die junge Baker: »Damals hatte Josephine Baker noch nicht begriffen, daß ihre Hautfarbe ein wesentlicher Bestandteil ihrer Erscheinung war. Jeden Tag bemühte sie sich eine geschlagene Stunde darum, weiß zu werden. Um ihr Kraushaar zu glätten, hatte sie eine Spezialflüssigkeit erfunden, sie schloß sich jedesmal ein, wenn sie die herstellte, und rieb sich jeden Morgen mit Zitronensaft ab, weil sie hoffte, sie würde auf diese Weise heller.«
Die kappenartige, wie gelackte Frisur der Baker also nicht bloß ein modischer Einfall, sondern der Versuch, das Kraushaar glattzulegen? Wenn sie damit eine neue Mode vielleicht auch nicht ausgelöst hat, so hat sie diese Haarmode zumindest gefördert: viel verkauft wurde damals das »Bakerfix«.
In diesem Büchlein werden so manche »Geständnisse« der Baker publiziert, etwa über ihren Talisman, eine Hasenpfote – zu diesem Punkt aber nur eine Erklärung, die ein Problem aufdeckt, indem sie es zu verbergen sucht. Mischlinge werden oft hart mit den Vorurteilen eines großen Teils der Bevölkerung konfrontiert: die alten, immer wiederholten Abfälligkeiten über Mestizen und Mulatten. So scheint es vielen Mischlingen notwendig, sich für eine der »Farben« zu entscheiden. Das zeigt sich etwa bei der Red power in Nordamerika: Sprecher und Vorkämpfer des neuen Indianer-Nationalismus sind zum Teil Mischlinge; das Solidarisieren als Identifikationsversuch.
Ein Mischling zu sein, das hat sicher auch die junge Baker belastet. Hier ist nun eine Situation, eine Erfahrung, die nicht schon vorgeprägt ist von unterhaltenden biographischen Mustern. Aber selbst diese Störstelle wurde integriert und damit neutralisiert: Die ambivalente Situation des Mischlings Baker wurde zum Liedtext gemacht! Da sang sie denn, sie wäre gern weiß, das sei ihr Traum – kaum vorstellbar, wie sie dann erst den Leuten gefallen würde, jede Puppe in jedem Warenhaus sei weiß, und der Montblanc sei weiß, ach, wäre sie doch auch nur weiß! Sie träume davon, mit weißer Haut durch die Straßen zu gehen und den Leuten von Paris zu gefallen – oder täusche sie sich? Solle sie ihre kaffeebraune Haut ruhig zeigen, ohne sich dessen zu schämen? Nur: würde sie nicht vielleicht noch mehr Leuten gefallen, wenn sie weiß wäre? Jedoch: Wer mich mag, der mag mich auch braun, so braun wie ich geboren bin …
Letztlich braucht sie hier keine eigene Entscheidung zu treffen, es wurde über sie entschieden: Direktoren, Regisseure und Publikum machten sie zur Inkarnation der schwarzen Rasse. Und sie akzeptierte diese Rolle, wird es bald wohl aufgegeben haben, mit Zitronenwasser und Puder die Haut aufzuhellen. Denn verkaufen ließ sich nur die »sexuelle Ausstrahlung« des »schwarzen Idols«, der »schwarzen Venus«. Der Beifall, mit dem sie in dieser Rolle gefeiert wurde, wirkte bestätigend auf sie zurück, ließ sie betonen, was als typisch erwartet wurde bei einer tanzenden »Negerin«: das tierhaft Anmutige und auch Aggressive.
In diesem Buch, in dem sich ihr (zumindest teilweise) von außen geprägtes Selbstverständnis bestätigte, beziehungsweise: von Sauvage bestätigt wurde, preist sie, rollengerecht, die »Negerlieder«. Die Begründung durch Baker-Sauvage ist bezeichnend: »Es sind Lieder voller Heilkraft, gemacht, um die Müdigkeit zu vertreiben und den Gram, um die Trauer einzuwiegen und den Groll, um die Ängste zu besänftigen, die Sonne und Mond erwecken, um die Wunden zu lindern, die inneren und äußeren Wunden des Negers.« Das entspricht einmal der »Mission« der Unterhaltungsindustrie, wie sie von Repräsentanten der Unterhaltungsindustrie unablässig herausgestellt wird: den Menschen Vergessen schenken. Gerade die »Negerlieder« aber sind vielfach Lieder, die das Vergessen verhindern wollen. Die »Negerlieder«, von denen in diesem Büchlein gesprochen wird, von denen auch einige in Übersetzung abgedruckt werden, sie sind keine echten Blues-Lieder, sondern Produkte der U-Musik-Industrie, getextet von Profis. Was die Baker an »Negerliedern« sang, das waren Schlager mit Blues-Elementen, geschrieben und arrangiert von Weißen für Schwarze, die auftraten vor Weißen.
NATÜRLICH ERZÄHLT die Baker in diesem Buch von den Erfolgen der Baker, denn erst diese Erfolge motivieren solch ein Buch. Erzählt wird beispielsweise von einem Gastspiel in der Oper, »als alle 40000 goldenen Lampen brannten«, von ihrem Tanz vor Poincaré, von ihrem Auftritt in einer großen Weihnachtsveranstaltung für Kinder. Und weil das Tanzen sie so erfolgreich gemacht hat, will sie weitertanzen, nur tanzen, immer nur tanzen. »Ja, ich werde mein ganzes Leben tanzen. Ich bin geboren, um zu tanzen. Nur dafür. Tanzen ist Leben. Ich möchte einmal sterben, atemlos, völlig erschöpft, am Ende eines Tanzes, aber nicht auf der Bühne.« Der Bühnentod also hinter den Kulissen.
Aber zugleich, das ist man auch Lesern unterhaltender Texte schuldig, werden ernstere Aspekte ins Spiel gebracht. So heißt es beispielsweise im Namen der Baker: »Man muß an Gott glauben.« Das wird bestätigt durch Anekdotisches: Wie die Baker in der Garderobe der Folies-Bergère kniete, nackt, und der Inspizient platzte herein, aber ganz still ging er wieder hinaus, offenbar überwältigt von der Macht oder zumindest von der Ausstrahlung dieses Glaubens. So wird eine Person zur Persönlichkeit.
Daß man eine Persönlichkeit ist, das soll auch ein anderes Klischee beweisen: Sie will sich nicht völlig mit ihrer Tätigkeit identifizieren, auch wenn sie glanzvoll und lukrativ ist: »Ich habe dieses ganze künstliche Leben satt. Immer gepeitscht von Scheinwerfern. Scheußlich. Das Leben eines Stars widerstrebt mir. Dieser Kampf und diese Intrigen. Ich finde das ekelhaft. Was so ein Star in jedem Augenblick tun muß, ertragen muß, ekelt mich an, häßliche Dinge, traurige Dinge.« Ach ja, das liest man in vielen Illustrierten immer wieder: daß ein Star gar nicht so glücklich ist, wie man vielfach meint, daß er ebenfalls Sorgen hat, Probleme und Nöte, daß diese Sorgen, Probleme, Nöte vielfach sogar durch den Beruf geschaffen werden, der bekannte Verlust an Privatleben zum Beispiel, wie gut hat es in dieser Beziehung das Publikum, das steht nicht dauernd im Scheinwerferlicht, in dem der Star als Verkörperung der Wünsche des Publikums steht. Schaut her, ich habe ein Herz, das kann leiden, ich habe einen Kopf, der kann nachdenken: Macht mich diese Menschlichkeit nicht noch attraktiver, damit erfolgreicher?
Das allgemeine Klagen bleibt so lange rhetorisch, wie es nicht bestätigt wird durch Details. Was ist am Showbusiness ekelhaft? Welche häßlichen, traurigen Dinge muß man tun und erleiden? Kein Wort darüber – nur eine Bühnengeste! In diesem sehr typischen Text wird Realität durch immer neue Showkulissen verstellt.
Das zeigt auch der Wunsch, einmal etwas ganz anderes zu tun: »Ich will noch drei oder vier Jahre arbeiten, und dann will ich von der Bühne abgehen. Dann werde ich nach Italien ziehen oder nach Südfrankreich. Ich werde mir ein Stück Land kaufen.« Und gleich weiter: »Ich werde mich verheiraten, so einfach wie möglich. Ich werde Kinder haben und viele Tiere. Die liebe ich, und ich will in Frieden leben zwischen Kindern und Tieren.« Dieser öffentlich vorgetragene Wunsch, sich einmal aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, in ein einfaches, schlichtes, letztlich namenloses Leben, diese Äußerung gehört ebenfalls zum öffentlichen Auftritt.
Doch mit dem Stichwort »abtreten« sind wir schon weit in der Zukunft, die Sauvage damals noch nicht kannte, die er aber durchaus so hätte entwerfen können, wie sie sich dann verwirklichte, als konsequente Fortsetzung der unterhaltsamen Geschichte vom Aufstieg der Josephine Baker.
WIE SEHR ihre bisherige Lebensgeschichte Mustern der Unterhaltungsindustrie entspricht, das bestätigen Produkte der Unterhaltungsindustrie. Da ist etwa der französische Spielfilm Zouzou, 1936 gedreht, mit Josephine Baker in der Hauptrolle, mit Jean Gabin als Partner. In diesem Film wird, was Unterhaltungsfilme und Unterhaltungsromane gern tun, der Aufstieg einer Figur aus Armut und Anonymität zu Reichtum und Ruhm geschildert. Die Lebensgeschichte, die über die Baker erzählt wird, sie wird hier ein wenig verändert, bleibt aber als Muster erkennbar.
Die Armut der kleinen Zouzou am Filmanfang ist denn auch keine bittere Armut, sondern eine lustige: Das dunkelhäutige Mädchen muß einfach tanzen und singen, so wie die kleine Josephine einfach tanzen und singen mußte – nicht zufällig, daß eine deutsche Zeitung einmal schrieb, ihr habe mehr Musik im Blut gesteckt als Revolution. Solange die armen Leute tanzen und singen, denken sie nicht an eine Änderung der Verhältnisse; um zu diesem Tanzen und Singen zu animieren, zeigen Unterhaltungsprodukte immer wieder Menschen, die trotz Armut tanzen und singen, weil ihnen bekanntlich Musik im Blut liegt. So wird die politisch sedativ wirkende Vorstellung von den armen, aber glücklichen Menschen bestätigt.
Die arme und fröhliche Zouzou erhält eine Chance: Sie wird aufgenommen als Girl einer Revuetruppe. Also steht sie schon mal auf der Bühne. Jetzt muß ihr nur noch der Sprung nach vorn gelingen, an die Rampe. Das setzt voraus, daß sie die Stelle der Person einnimmt, die sie während der Shows meist von hinten sieht: Der Star an der Rampe, der Star in der Mitte, der Star mit viel betonendem Leerraum um sich her, während der Abstand von Girl zu Girl möglichst gering sein soll: Schulter an Schulter, Arm in Arm. In diesem Film ist der Star der Truppe eine Schönheit, die man zwar bestaunt, aber nicht so recht mag, auch die beiden Direktoren des Theaters sind mit ihr nicht mehr ganz zufrieden, aber welche Alternative bietet sich ihnen?
Dieser Star wird in diesem Film nicht krank, damit die junge, temperamentvolle Zouzou erfolgreich einspringen kann, der Zufall spielt hier sein Spiel auf etwas andere Weise: Die junge Tänzerin probiert in der Theatergarderobe ein neues Kostüm an, so etwas wie einen einteiligen Badeanzug aus Glitzerlamé; ein bißchen geniert sie sich, weil dieses Kostüm so viel Haut freiläßt, die versucht sie abzudecken mit den Handflächen, aber die Kolleginnen reden ihr gut zu, das neue Kostüm stehe ihr ausgezeichnet; das gibt ihr Mut, sie will sich mal ein bißchen darin bewegen, geht auf die Bühne, und ihr Freund, der Bühnenelektriker, macht für sie einen Scheinwerfer an, wieder geniert sie sich ein bißchen, aber dann beginnt sie doch zu tanzen; hinter dem Bühnenvorhang probt glücklicherweise das Orchester, der Tanz steigert und beschleunigt sich; wie durch Zufall wird nun der Vorhang geöffnet, im fast völlig dunklen Zuschauerraum sitzen die beiden unzufriedenen Theaterdirektoren, und sie glauben, sie sehen nicht richtig, sie wollen ihren Augen nicht trauen, denn ungeheuer gelenkig wirbelt eine Tänzerin über die Bühne, im Glitzerkostüm und zugleich als riesiger Schatten auf dem Bühnenhintergrund, das macht der Scheinwerfer des Elektrikerfreundes. Plötzlich fühlt die Tänzerin sich entdeckt, rennt von der Bühne, klettert wie in Panik eine Eisenleiter hoch, die Direktoren rufend hinter ihr her: Sie ahnt noch nicht, daß sie in sehr positivem Sinne entdeckt worden ist, der Glücksfall ihres Lebens.
Dieser glückliche Zufall wird gern eingesetzt in den Lebensgeschichten, die der Unterhaltungsindustrie nützlich sind, die sich verwerten lassen in immer neuen Produkten nach kaum veränderten Mustern: Dieser glückliche Zufall kürzt die Geschichten entschieden ab, erspart Umständlichkeiten, Einzelheiten, Peinlichkeiten. Gleichsam im Zustand der Unschuld, die man im Showgeschäft so gern spielt, gelingt der Übergang aus der Statisterie zur Star-Rolle. Keine Intrigen, keine Depressionen, keine Prostitution, keine Frustration, sondern: der oft mühsame, langwierige Weg verkürzt sich zum Sprung. Das Einspringen, unerwartet, für eine erkrankte Darstellerin; das Herumspringen, Herumtanzen auf der Bühne, auf der man sich nicht beobachtet glaubt – schon ist alles zum Guten gewendet, schon ist der Erfolg da.
So zeigt das auch dieser Film, und bald sieht man die neu entdeckte Tänzerin und Sängerin Zouzou bei Auftritten, die den Auftritten der Tänzerin und Sängerin Josephine zumindest ähnlich sind: Zouzou-Josephine in einem transparenten, bizarren Käfig, als Singvogel, Paradiesvogel auf einer Schaukel; sanft hin- und herpendelnd singt sie vom paradiesischen Haiti – das konnten Zeitgenossen auch auf einer Schallplatte hören. So wurde die dargestellte dunkelhäutige Sängerin und Tänzerin vom Publikum fast zwangsläufig identifiziert mit der darstellenden dunkelhäutigen Sängerin und Tänzerin. Von hier aus zog man sicher auch Rückschlüsse auf die Lebensgeschichte, die da gezeigt wurde: War dies nicht »eigentlich« die Geschichte der Baker? So wirkt solch ein Film zurück auf öffentliche Vorstellungen über die Showfigur, und vielleicht identifiziert sich diese Showfigur auch öffentlich mit ihrer Rolle, wie sich ja öfter Showfiguren mit Rollen identifizieren, die ihnen »auf den Leib geschrieben« werden. Damit findet wieder eine Rückkoppelung statt, ein Bestätigungs- und Verfestigungseffekt in der öffentlichen Biographie einer öffentlichen Figur.
EINE ÖFFENTLICHE BIOGRAPHIE: hier entsprechen die Darstellungsmuster so weit wie möglich den Erwartungen der Öffentlichkeit, für die sie produziert, reproduziert werden. Diese Erwartungen sind wiederum vorgesteuert durch den Konsum von Produkten der Unterhaltungsindustrie. Am Beispiel Josephine Baker wird besonders deutlich, was öffentlich geträumt wird – Träume, Tagträume, die mitgeprägt werden durch Vorgeträumtes. Eine öffentliche Biographie verrät mehr über die Öffentlichkeit, für die sie produziert, von der sie konsumiert wird, als über den Schreibanlaß: Josephine Baker als Sammelpunkt von Versatzstücken.
Die öffentliche Biographie trägt dazu bei, und zwar entschieden, daß eine Josephine Baker in der Unterhaltungsindustrie attraktiv und damit lukrativ bleibt. Josephine Baker als internationaler Markenartikel – hier hat sie bezeichnenderweise den Accent aigu ihres Vornamens verloren, der könnte die Distribution auf dem Weltmarkt nur erschweren; selbst auf den Umschlägen französischer Schallplatten erscheint ihr Vorname ohne Akzent. Würde ich eine Biographie der Joséphine Baker schreiben, ich gäbe ihr den Akzent zurück. Hier aber geht es um die Machart von öffentlichen Biographien, am Beispiel der Josephine Baker: so bleibt es bei der Schreibweise, die für diesen Markenartikel durchgesetzt wurde.
Es muß in diesem Zusammenhang betont werden, daß ich nicht voraussetze, die Baker selbst hätte ihre öffentliche Biographie kühl berechnend entworfen. Zugleich muß ich hier aber auch betonen: ich will damit nicht das vielfach benutzte, weil bewährte Muster vom eigentlich naiven, ja gutherzigen Star nachbeten, der nicht recht durchschaut, was mit ihm geschieht. Ich halte die Baker für naiv und clever zugleich.
Ich habe sie nie original gesehen, sie ist für mich eine fast historische Person, auch wenn ich im gleichen Jahr über sie schreibe, in dem sie gestorben ist. Ich habe einen großen Teil der Fotografien gesehen, die es von ihr gibt, in Publikationen, in Presseagenturen, ich habe alles erreichbare Filmmaterial über sie gesichtet; bei diesen Vorarbeiten entstand der Eindruck, daß diese Frau sympathisch war, sympathisch gewirkt hat. Sie gehörte noch nicht zu den amerikanischen Glamour-Show-Maschinen, die heute weithin den Markt beherrschen; die lassen mich gleichgültig, die kann ich zum Teil nicht ausstehn.
Gewiß, schon bei der jungen Baker war viel Glamour, kommerzielle Showgeste. Aber zugleich war da Clownerie: ihr Schielen, Faxenmachen, Grimassenschneiden. Das wurde natürlich rasch kommerzialisiert – als Zouzou etwa mußte sie zuerst mal ein naives, vom Showgeschäft unberührtes Mädchen verkörpern, das einem Kind ein Faxenprogramm vorführt. Aber auch hier, nach mindestens zehn Jahren Faxenmachen, Augenrollen, Grimassenschneiden – das Spiel der Baker wirkte erstaunlich frisch und spontan.
Diese Mischung von Spontaneität und kommerziell gesteuerter Darstellung von Spontaneität zeigte sich auch später immer wieder. Etwa, wenn die Baker der fünfziger oder sechziger Jahre in einer ihrer pompösen Showroben auftrat, und sie setzte sich an der Rampe auf eine Stufe, um mit dem Publikum zu plaudern, um ein Lied im Sitzen zu singen, als wirkungsvolle Abwechslung – wenn sie dabei die weiten Röcke ordnete, so tat sie das seufzend über diese Umständlichkeit, beim Bananenröckchen sei das noch nicht notwendig gewesen, ach ja. Das war einerseits clever: sie drapierte eine technische Vorbereitung mit Wörtern. Zugleich aber erinnerte sie hier die Besucher ihrer Show an ihre frühen Auftritte im Bananenröckchen: dieses Bild der Baker hatte wohl jeder Besucher im Kopf, und die Baker selbst stellte nun eine Verbindung her zwischen solchen Erinnerungsbildern und ihrer gegenwärtigen Erscheinung, präsentierte sich damit als die berühmte, fast schon legendäre Josephine Baker.
Bei all solcher Berechnung – man glaubte aber doch zu spüren, daß dieses Seufzen teilweise echt sein könnte: dieses Brimborium, dieser Klimbim, und so fix wie früher bin ich auch nicht mehr, schaut mal, wie lang das dauert, bis ich fertig bin.
Sicher, das war Kokettieren, aber nur zum Teil. Sie kokettierte dagegen sehr deutlich, wenn sie in Shows einen der teuren oder teuer aussehenden Pelze auf den Bühnenboden fallen und da nicht bloß liegen ließ, achtlos, sondern noch einen Fuß draufsetzte, und das teure oder teuer aussehende Stück mitschleifte, während sie umherging, sprechend, singend. Vielleicht aber zeigte sich in diesen sichtlich eingeübten Bewegungen, daß ihr, wenigstens gelegentlich, dieses wallende, wogende, glitzernde Zeug ein bißchen seltsam vorkam, als Showglamour, den eine Person, eine Persönlichkeit wie sie eigentlich nicht nötig hätte. Und mit dieser scheinbaren Abwertung des Showglamours wertete sie sich selbst auf, als Person, als Persönlichkeit, um sich dann doch wieder in den vielfältigen Betonungen des Showplunders zu präsentieren: das Goldlamé, die Federboas, die teuren oder wie teuer aussehenden Pelze …
JOSEPHINE BAKER, als Tanzstar gefeiert: das schwarze Idol, die Venus aus Ebenholz, die schwarze Venus, die braune Venus, die dunkle Venus, der Triumph des schwarzen Geschlechts – Josephine Baker, auch als Gesangsstar gefeiert: der Goldene Vogel aus der Neuen Welt – Josephine Baker als Revuestar, bald schon als Revuegöttin gefeiert: immer wieder, bestätigend, das Herabschreiten, königlich, von der Großen Treppe, in Kostümen, die als märchenhaft bezeichnet werden, wiederholt als märchenhaft – Josephine Baker als Hauptfigur einer öffentlichen Biographie, nach Mustern der Unterhaltungsromanindustrie erzählt und weitergeführt vor allem von Journalisten – diese Josephine Baker wird Zeitgenossin des Dritten Reichs, des Zweiten Weltkriegs.
Nun müßte eigentlich Realität einbrechen in diese Biographie aus vorgefertigten Versatzstücken, aus Showgesten, nun müßte sich die Sprache dieser öffentlichen Biographie ändern, denn nun herrschen in der Öffentlichkeit schlagzeilendick Wörter vor wie: BÜRGERKRIEGSGEFAHR, NOTVERORDNUNG, MILITÄRISCHE NACHTRAGSKREDITE, FLOTTENBAUPROGRAMM, KOLLEKTIVE SICHERHEIT, FINANZKRISE, FASCHISMUS, JUDENVERFOLGUNGEN, REICHSKRISTALLNACHT, MÜNCHNER ABKOMMEN.
Und tatsächlich: in der öffentlichen Biographie der Josephine Baker wird erzählt, sie sei unter dem Eindruck der nationalsozialistischen Judenverfolgungen, speziell der Reichskristallnacht, Mitglied geworden der »Liga gegen Rassismus und Antisemitismus«. Und das nicht bloß formell, sondern sie habe sich auch öffentlich gegen den Rassismus des Dritten Reichs geäußert. Freilich, in welcher Form das geschah, ob auf einer Pressekonferenz, in einem Rundfunkinterview, in einem Zeitungsartikel, in einer Rede, in einem Offenen Brief, das ist in der öffentlichen Biographie nicht zu erfahren. Auch habe ich hier nicht gefunden, was sie gesagt hat. Das ließe sich vielleicht aber ableiten von dem, was sie in den fünfziger und sechziger Jahren des öfteren gesagt hat: Feindschaft unter den Rassen lehne sie ab, Freundschaft und Friede unter den Rassen bejahe sie. Und vielleicht auch schon: Wir sind alle eine große Familie.
Erneut Wörter, die zur Herausforderung werden müßten für die Mitarbeiter an ihrer öffentlichen Biographie, aber in keinem ihrer zahlreichen Beiträge habe ich solche Wörter gefunden: GENERALMOBILMACHUNG, KRIEGSKABINETT, VERTEIDIGUNGSMINISTER, AUFMARSCH DER ARMEE, KATASTROPHE BEI SEDAN, DURCHBRUCH AN DER MAAS, KATASTROPHE IN FLANDERN, DER FALL VON PARIS. Und danach drängten sich andere Wörter vor, vor allem Städtenamen, Personennamen: BORDEAUX, PÉTAIN, VICHY, DE GAULLE. Solche Namen werden in ihrer öffentlichen Biographie höchstens mal genannt; geschrieben wird fast nichts zu ihnen. Denn solche Namen bleiben Fremdwörter, Fremdkörper in dieser öffentlichen Biographie; Sätze mit solchen Namen könnten hier als Sprengsätze wirken. Also bleibt es bei Hinweisen, die nichts sichtbar, nichts erkennbar machen von damaliger Realität.
Vor diesem ungenauen Hintergrund nur vage Vorgänge: Josephine Baker als »Widerstandskämpferin«, Josephine Baker als »Mitarbeiterin des Französischen Geheimdienstes«, Josephine Baker »in geheimer Mission in Nordafrika und in Italien«, Josephine Baker »persönlich beauftragt von Charles de Gaulle« – Vorgänge hier, die aus dem Rahmen dieser Lebensrevue, dieses Lebensromans, dieses Lebensfilms herausfallen, aber nur beinah. Denn sogleich bildet sich hier eine Assoziation: zu einer ebenfalls weltberühmten Tänzerin, die ebenfalls erotischer Skandal ihrer Zeit war, die ebenfalls für den französischen Geheimdienst arbeitete – Mata Hari!
Ist hier das Muster, das diesen Abschnitt der öffentlichen Biographie der Josephine Baker prägt? So fiktiv hier vieles klingt – es bleiben Fakten, die sich nicht leicht einarbeiten lassen in die bewährten Muster. Beispielsweise die Tatsache, daß Josephine Baker mit militärischen Orden ausgezeichnet wurde, durch General Charles Vallin: Er verlieh ihr die Rosette der Légion d’honneur, nachdem sie bereits mit dem Croix de Guerre ausgezeichnet worden war; zu dieser Ordensverleihung gibt es eine Reihe von Fotografien. Etwas mußte die Baker also wohl geleistet haben! Warum aber wurde sie erst sechzehn Jahre nach Kriegsende ausgezeichnet? Sollte es nur eine der Auszeichnungen gewesen sein, mit denen das Militär sich selbst dekoriert?
Hungrig auf Details durchsuche ich die Sammlung von Zeitungsausschnitten, finde aber nur geheimnisvoll vage Hinweise auf Josephines Tätigkeit für Résistance und Geheimdienst. Irgendeine Story muß aber doch die Zeitlücke füllen zwischen ihren letzten Auftritten im Paris des Herbstes 1939 und ihren ersten Auftritten nach dem Krieg, in Frankreich und in Deutschland, in der französischen Besatzungszone.
Ich überlege mir einige Möglichkeiten für Josephine Baker. Erste Möglichkeit: Sie blieb im besetzten Paris, trat vor Landsleuten auf, vor deutschen Besatzungssoldaten, sang Lieder, die sie berühmt gemacht hatten, etwa J’ai deux amours, mon pays et Paris. Daß sie ihre Doppelliebe zu Paris und ihrem Land besang, das konnte denn später als versteckte Form von Opposition gedeutet werden: eine öffentlich hinausgesungene Liebeserklärung an ein Land, das Krieg mit Deutschland führte. Zu solch kasuistischen Auslegungen gab die Baker jedoch keinen Anlaß, sie hatte Paris rechtzeitig verlassen.
Zweite Möglichkeit: Die Baker zog sich zurück in den unbesetzten Teil Frankreichs, in das Frankreich der Vichy-Regierung unter Marschall Pétain, erlebte hier mit, wie gegen alle Abmachungen auch dieses Gebiet von deutschen Truppen besetzt wurde, obwohl die Vichy-Regierung nach besten Kräften kollaborierte; dieser Überfall geschah Ende 1942.
Daß sich diese zweite Möglichkeit verwirklicht haben könnte, dazu finde ich einen Hinweis in einer österreichischen Zeitung. Ich lese, daß die Baker schon während der Kriegsjahre ihr später so berühmt gewordenes Schloß Les Milandes in der Dordogne besaß und daß sie hier Franzosen versteckt hielt, die von den Deutschen gesucht wurden.
Und hier wird nun eine Story entwickelt, die sehr gut in die öffentliche Biographie der Baker hineinpaßt: Eine Gruppe deutscher Soldaten taucht auf vor dem schönen Schloß in der Dordogne; wollen sie nach Versteckten, Untergetauchten suchen? Die Baker, so lese ich, hat Angst, aber sie kann selbstverständlich diese Angst überspielen, sie begrüßt freundlich, charmant die deutschen Soldaten, bietet ihnen Platz an, läßt Champagner auftragen und Geflügel, tanzt und singt den trinkenden und essenden Soldaten etwas vor, macht sie zum Publikum, das sie – wie immer – bezaubert, in Bann schlägt; sie verlassen das Schloß, ohne es durchsucht zu haben.
Diese Episode also liegt vor in ihrer öffentlichen Biographie, und dieser Episode kann wohl nur die Jahreszahl etwas anhaben, die eine andere Zeitung anbietet: daß Josefine und ihr vierter Mann, Jo
Bouillon, dieses südfranzösische Schloß erst nach dem Krieg gekauft haben, 1947. Sollte sich diese Zahl in ihrer öffentlichen Biographie durchsetzen, so müßte eine andere Geschichte erfunden werden, um Josephines Kampf für Résistance und Geheimdienst plastisch zu machen. Vorlagen zu solch einer Geschichte gibt es reichlich.
Sie alle setzen die dritte Möglichkeit voraus: Die Baker verließ auch das unbesetzte, dann doch besetzte Vichy-Frankreich, fuhr über das Mittelmeer in eines der Gebiete, die vom Freien Frankreich erobert wurden, in Nordafrika, im Nahen Osten. Dieses Freie Frankreich als Gründung von Charles de Gaulle, der bereits zwei Tage nach der Kapitulation Frankreichs im Londoner Rundfunk erklärt hatte, der Kampf werde weitergeführt, wenn auch vorerst außerhalb Frankreichs, alle Exilfranzosen sollten sich um ihn scharen.
Die von France Libre schließlich fast völlig beherrschten französischen Kolonialgebiete als Aktionsfeld der Baker? Darauf läßt sich schließen, denn: General Vallin, der sie auszeichnete, war Commandant en chef der Forces françaises libres. Nun wird schon verständlicher, wieso es heißen konnte, sie habe im Auftrag von Charles de Gaulle gehandelt. Und was hat sie gemacht, konkret? Darüber ist Verschiedenes zu lesen. Erst einmal: sie machte den Pilotenschein. Und: sie wurde Leutnant. Diese auf geheimnisvolle Weise zusammengehörenden Informationen sollen meiner Phantasie wohl Impulse geben, die mich auf die Spur dieser öffentlichen Biographie bringen: flog Leutnant Baker womöglich in geheimem Auftrag des General de Gaulle? Beispielsweise als Kurierfliegerin? Als Kurierfliegerin über der Wüste?
Daß Josephine Baker etwas mit Flugzeugen zu tun hatte, das zeigen Fotografien, die allerdings erst nach dem Krieg gemacht wurden, in den fünfziger Jahren etwa: Da steht Josephine vor einem einmotorigen Flugzeug, macht in verschiedenen Körperhaltungen ihre Beziehung zur Maschine sichtbar, legt mal eine Handfläche an die Motorhaube, legt ihre Hand auch anderen Stellen der Maschine auf, so wie das in Unterhaltungsromanen über Luftkrieg die Helden tun, wenn sie aus dem Urlaub an die Front zurückkehren. Hier aber bleibt die Frage: Hat die Baker wirklich solche Maschinen geflogen, im Krieg? Wenn ja, mit welchen Aufträgen, mit welchen Zielen?
Das bleibt offen. Es gibt allerdings auch ein anderes Angebot für diesen Zeitraum: Josephine Baker bewährt sich als Rote-Kreuz-Schwester. Hier können erfahrene Leser unterhaltsamer Lebensgeschichten nur nicken: Wie oft haben sie schon gelesen oder in Filmen gesehen, daß angesehene Personen armen Verwundeten halfen, sich huldreich zu ihnen hinabbeugend: Fürstinnen, Schauspielerinnen, Sängerinnen. Bei der Beschreibung solch huldvoll hilfsbereiten Hinabneigens wird es in einer öffentlichen Biographie wohl bleiben, wird kaum zu lesen sein, daß Schwester Baker Bettpfannen und Bettflaschen reichte, Schweiß, Eiter, Scheiße abwischte, das ginge denn doch zu weit. Überhaupt ist ja die Frage, ob sie im Krankenhausbereich aktiv war oder nicht viel eher passiv: Die Kombination Baker/ Krankenhaus könnte auch entstanden sein, weil die Sängerin und Tänzerin in den vierziger Jahren eine schwere, hartnäckige Bauchfellentzündung hatte, rund ein Jahr im Krankenhaus liegen mußte, und danach verschiedene Rückfälle.
Ich bin sicher, die beiden doch recht mageren Ansätze: Josephine als Fliegerin, Josephine als Rote-Kreuz-Schwester, sie werden sich in ihrer öffentlichen Biographie nicht auswachsen zu bunten Lebenskapiteln. Eher schon diese Story, die ihre ja nun unbestreitbare Ordensverleihung motivieren könnte: daß sie Schmuck verkaufte, Schmuck im Wert von einer halben Million, und diese halbe Million hat sie der Résistance, der France Libre zur Verfügung gestellt. Ja, das fügt sich wie von selbst in eine öffentliche Biographie, hier wird die Notwendigkeit umgangen, die Sprache zu ändern, die auch ihre Biographie ändern würde, hier ist alles wie gehabt, wie längst schon bekannt: Die berühmte Frau, die sich hochherzig von ihrem Schmuck trennt, den sie sich wohl sauer genug ersungen und ertanzt hat, Schmuck, den man sich als fürstlichen, beinah königlichen Schmuck vorzustellen hat, der die Phantasie mit Edelsteinblitzen kitzelt, und den gibt sie weg, so, wie schon im Krieg davor Herzoginnen, Fürstinnen Wertvolles weggaben, um die notwendige, die große, die gemeinsame Sache zu unterstützen …
Hier hat die öffentliche Biographie, die in dieser Zeitphase beinah aus dem Tritt gekommen wäre, wieder zu sich selbst gefunden, nun kann sie weiterschnurren: Die Baker unterstützte die gemeinsame, große, notwendige Sache nicht allein mit dem Verkaufserlös des Schmucks, sie opferte auch die Gagen ihrer Tourneen in Nordafrika und im Nahen Osten. Hier lassen sich Städtenamen aufreihen wie: Kairo, Tripolis, Bengasi, Tobruk, Alexandria. Dort und in vielen weiteren Städten und Orten trat sie auf, in Kairo beispielsweise in der Oper, auch in Clubs und Bars dieser Stadt, vor hohen Offizieren, vor dem fetten Faruk. Aber die Baker sang auch in Lazaretten vor französischen und englischen Verwundeten: Denen wollte sie – das brauchte sie später in einem Interview gar nicht mehr auszusprechen, das versteht sich von selbst, das sagt und schreibt sich von selbst – denen wollte sie Mut machen, Lebensmut, sie sollten wieder lachen, zumindest lächeln. Natürlich wollte sie auch die kämpfende Truppe ermutigen, stärken: Fronttheater. Oft mehrere Auftritte täglich.
Hier könnte die Antwort sein auf die Frage, weshalb die Baker militärisch ausgezeichnet wurde: Sie hat psychologisch den Kampf des Freien Frankreich unterstützt, hat ihn auch materiell gefördert, indem sie ihre Gagen zurückgab, und das sollen insgesamt drei Millionen gewesen sein. Was kann ein Star auch anderes verdienen als Millionen, selbst in mageren Kriegszeiten, selbst bei Auftritten vor Offizieren in Clubs, vor Verwundeten in Lazaretten? Wie auch immer: Wenn eine Figur einer öffentlichen Biographie Geld für eine notwendige Sache spendiert, so kann es sich nur um Millionen handeln …
Dennoch: für die öffentliche Biographie einer Josephine Baker dürfte das letztlich nicht ausreichen. Denn Josephine wird in der öffentlichen Biographie ja nun wiederholt mit Charles de Gaulle zusammengebracht, sie soll für ihn gearbeitet haben, während des Kriegs, und zwar als AGENTIN.
Ein Wort, zu dem sich sofort Assoziationen einstellen bei Lesern einer öffentlichen Biographie: Kurierdienst … geheime Treffs … Aushorchen und Fotografieren … Kontaktmänner, V-Männer … verschlüsselte Botschaften … Hier ist etwas, das die Hersteller der öffentlichen Biographie stimulieren müßte, denn durch ein Wort wie AGENTIN wird öffentliche Aufmerksamkeit fast automatisch angezogen, ja angesogen.
Und was hat nun AGENTIN BAKER getan, konkret? Noch liegen hier keine (selbstverständlich sensationellen!) Enthüllungen vor, aber die können noch kommen, postum. Fest steht schon jetzt: Es wird etwas Besonderes sein müssen innerhalb der farbenprächtigen, handlungsreichen öffentlichen Biographie – eine Story wie die vom Tanz vor deutschen Soldaten in Les Milandes müßte hier noch übertroffen werden.
Wäre hier nicht beispielsweise ein Vorgang folgender Art denkbar? General de Gaulle schätzt, ja bewundert Josephine Baker als Mensch, Künstler und Patriot, er hat sich überzeugt von ihrem glühenden Engagement für seinen und für Frankreichs Kampf. Und so schickt er, weil seine Aktionsfähigkeit etwas eingeschränkt ist, die Mitkämpferin Josephine zum Kollegen Montgomery, der darum bittet, sie ihm kurzfristig zu überlassen: er will sie nämlich als Agentin einsetzen, und zwar direkt beim großen Gegenspieler, dem »Wüstenfuchs« Rommel.
Man hört und liest in unterhaltenden Kriegsgeschichten ja zuweilen, daß es zwischen Offizieren gegenüberliegender Frontabschnitte besondere Abmachungen gab, man tauschte eroberten Sekt oder Champagner aus, Fasane oder Wildenten: warum sollte man sich nach diesem bewährten Muster nicht vorstellen können, daß Montgomery die Baker seinem Kollegen Rommel weitervermittelte, zu einem völlig geheimen, in keiner Kriegsgeschichte verzeichneten Auftritt? Natürlich hätte »Monty« dabei seine Hintergedanken, fuchsschlau auch er, und die würde er der Baker mitteilen, in vertraulichem Gespräch, abends in seinem Zelt, bevor der Frontwechsel stattfindet, auf den bekannten geheimen Bahnen, auf denen so etwas immer gelingt. Beispielsweise in Beduinenkleidung könnte Josephine in Rommels Arbeitszelt geschmuggelt werden, nachts, wenn alle Adjutanten schlafen. Und in diesem Zelt der Kartentisch, von dem die mit Pfeilen und Zeichen versehene Generalstabskarte nicht weggenommen wurde, auch ist sie nicht mit einem Laken verdeckt, weil Rommel diese Frau für völlig unpolitisch hält, ein schwarzes Idol, ein goldener Vogel, mit dem er nun allein ist, und eigenhändig dreht er das Grammophon auf, eigenhändig setzt er den Tonabnehmer auf Platten, nach denen sie tanzt, weil sie nicht singen darf, englisch oder französisch, das wäre in einer hellhörigen Zeltstadt zu auffällig. Bei ihrem lautlosen Tanz zieht sie sich vor Rommel vielleicht ein wenig mehr aus als vor den Soldaten in Les Milandes, tanzt katzenhaft, gewandt immer wieder am Kartentisch vorbei, ihre nackten Füße im Wüstensand, der auch in diesem Zelt noch warm ist, und sie prägt sich dick durchgezogene und auch dünn gestrichelte Pfeile ein, Zahlen, Chiffren, während sie Rommel hinreißt, verzaubert, bannt – so könnte sie ihre allergeheimste Mission erfüllen. Nach bewährten Mustern ließe es sich in solch einer Story auch arrangieren, daß sie sich Rommels entschiedeneren Umwerbungen entzieht, schon damit die in ihrem Kopf eingezeichneten Pfeile, eingetragenen Chiffren nicht durcheinandergeraten, und vor Morgengrauen ist sie wieder bei Montgomery, trägt dick durchgezogene und dünn gestrichelte Pfeile auf seiner Karte ein, Zeichen und Chiffren, bricht danach beinah zusammen, die Erregung, die Konzentration, die Spannung.
Ich habe mir diese Story ausgedacht, nach bewährten Mustern, um die Machart der öffentlichen Biographie zu verdeutlichen: hier bekäme die Baker das MATA-HARI-Format, das ihr angemessen wäre!
Nach diesem Abstecher kehre ich zurück zur öffentlichen Biographie: hier setzt die Baker ihre Fronttheater-Tournee fort, läßt ihre Zuschauer, Zuhörer für eine Stunde oder für länger die Kriegsrealität vergessen, teilweise vergessen, und damit ist auch ihre öffentliche Biographie davor geschützt, Kriegsrealität in sich aufnehmen zu müssen, mit störenden Wörtern, verstörenden Sätzen.
Und so, wie ihre öffentlich gesprochenen Sätze, die von geschriebenen Sätzen vielfach vorgeformt waren, oft übergingen in Texte von Liedern, die für sie geschrieben wurden, so konnte auch dieser Lebensabschnitt übergehen in Showdarstellungen ihres Lebens: in ihrer letzten großen Show, in der Stationen ihres Showlebens die Dekorationen, Kulissen, Kostüme hergaben für die Darstellung ihrer Lebensrevue, in dieser Show mit dem Titel JOSEPHINE gab es auch die Nummer: Joséphine chante la France. Und vor der Hintergrundkulisse eines besonders prachtvollen Sternenhimmels Girls in khakibraunen Uniformen, mit Schirmmützen, sie stehen im Halbkreis, halten je zweimal zwei weiße, zweimal zwei rote, zweimal zwei blaue Fahnen schräg, die in Farbflächen aufgeteilte Trikolore, und in der Mitte dieses Uniformen- und Fahnenhalbkreises ein Jeep, ein Girl in Uniform als Fahrer, auf der Nummernschildfläche steht: JOSIE-JEEP, und auf der heruntergeklappten Windschutzscheibe sitzt denn auch JOSIE
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: