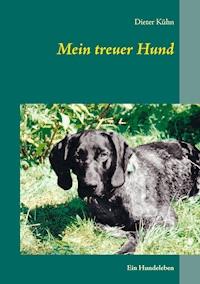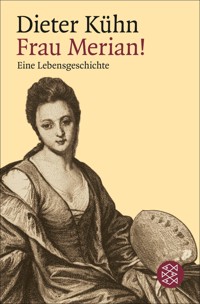9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gertrud Kolmar, geboren 1894 in Berlin, ermordet 1943 in Auschwitz, führte die deutschsprachige Lyrik zu einem Höhepunkt. Biographisch begann alles unspektakulär: sie war Hauslehrerin in verschiedenen Familien, wurde Sekretärin ihres Vaters, eines Staranwalts der wilhelminischen Ära. In Berlin, sodann in Finkenkrug, Osthavelland, wuchs ihr Werk heran: vorwiegend Gedichte, auch Erzählungen, Schauspiele, ein Roman. Walter Benjamin, ihr Cousin, verhalf zur Publikation von Gedichten in Zeitschriften. Auch während des Dritten Reichs schrieb sie weiter – der dritte Gedichtband erschien noch 1938 in einem jüdischen Verlag. Nicht veröffentlicht hingegen: Gedichte mit vehementen Anklagen gegen den NS-Terror. Etwa zur gleichen Zeit führte ein Briefwechsel zur Begegnung mit einem völkischen Lyriker. Nach dem Zwangsverkauf der Villa in Finkenkrug lebte sie mit ihrem Vater in Berlin-Schöneberg. Einer der wenigen Besucher im »Judenhaus«: Hilde Benjamin, später gefürchtet als Justizministerin der DDR. Gertrud Kolmar, zur Zwangsarbeit verpflichtet, verliebte sich in einen jungen Kollegen. Dieter Kühns große, vielstimmige Biographie erzählt die Geschichte der bedeutenden Dichterin und ihrer jüdischen Familie, die in die ganze Welt emigrieren musste. In Dokumenten, Berichten von Zeitzeugen und Briefen wird die gesamte literarische und politische Szene präsent – »ein atemberaubendes Zeitpanorama« (Denis Scheck, Deutschlandradio Kultur).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1002
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Dieter Kühn
Gertrud Kolmar
Leben und Werk, Zeit und Tod
Biographie
Über dieses Buch
Gertrud Kolmar, 1894 in Berlin geboren, führte die deutschsprachige Lyrik zu einem Höhepunkt. Biographisch begann alles unspektakulär: sie war Hauslehrerin in verschiedenen Familien, wurde Sekretärin ihres Vaters, eines Staranwalts der wilhelminischen Ära. In Berlin, sodann in Finkenkrug, Osthavelland, wuchs ihr Werk heran: vorwiegend Gedichte, auch Erzählungen, Schauspiele, ein Roman. Walter Benjamin, ihr Cousin, verhalf zur Publikation von Gedichten in Zeitschriften. Auch während des Dritten Reichs schrieb sie weiter – der dritte Gedichtband erschien 1938 in einem jüdischen Verlag. Nicht veröffentlicht hingegen: Gedichte mit vehementen Anklagen gegen den NS-Terror. Etwa zur gleichen Zeit führte ein Briefwechsel zur Begegnung mit einem völkischen Lyriker. Nach dem Zwangsverkauf der Villa in Finkenkrug lebte sie mit ihrem Vater in Berlin-Schöneberg. Eine der wenigen Besucher im »Judenhaus«: Hilde Benjamin, die später gefürchtete Justizministerin der DDR. Gertrud Kolmar, zur Zwangsarbeit verpflichtet, verliebte sich in einen jungen Kollegen. Nach der sogenannten Fabrik-Aktion im Februar 1943 wurde sie deportiert und in Auschwitz ermordet. Ihr Werk konnte von Schwester und Schwager gerettet werden.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Covergestaltung: Hißmann & Heilmann, Hamburg
Coverabbildung: akg-images, Berlin
Für die Rechte am Werk von Gertrud Kolmar:
© Suhrkamp Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2008
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 2008
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-400054-1
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Kapitel]
Ihr lebt ja, ihr [...]
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
81. Kapitel
82. Kapitel
83. Kapitel
84. Kapitel
85. Kapitel
86. Kapitel
87. Kapitel
88. Kapitel
89. Kapitel
90. Kapitel
91. Kapitel
92. Kapitel
93. Kapitel
94. Kapitel
95. Kapitel
96. Kapitel
97. Kapitel
98. Kapitel
99. Kapitel
100. Kapitel
101. Kapitel
102. Kapitel
103. Kapitel
104. Kapitel
105. Kapitel
106. Kapitel
107. Kapitel
108. Kapitel
109. Kapitel
110. Kapitel
111. Kapitel
112. Kapitel
113. Kapitel
114. Kapitel
115. Kapitel
116. Kapitel
117. Kapitel
118. Kapitel
119. Kapitel
120. Kapitel
121. Kapitel
122. Kapitel
123. Kapitel
124. Kapitel
125. Kapitel
126. Kapitel
127. Kapitel
128. Kapitel
129. Kapitel
130. Kapitel
131. Kapitel
132. Kapitel
133. Kapitel
134. Kapitel
135. Kapitel
136. Kapitel
137. Kapitel
138. Kapitel
139. Kapitel
140. Kapitel
141. Kapitel
142. Kapitel
143. Kapitel
144. Kapitel
145. Kapitel
146. Kapitel
147. Kapitel
148. Kapitel
149. Kapitel
150. Kapitel
151. Kapitel
152. Kapitel
153. Kapitel
154. Kapitel
155. Kapitel
156. Kapitel
157. Kapitel
158. Kapitel
159. Kapitel
160. Kapitel
161. Kapitel
162. Kapitel
Solch ein Buch braucht [...]
Ihr lebt ja, ihr Toten, ihr lebt; denn heut lebe ich. Einmal wohl mögt ihr gestorben, mögt anders gewesen sein; Nun seid ihr und seid so: für mich.
Gertrud Kolmar
1
SPÄTER WIRD MAN GEWISS FRAGEN: Wer war der Vater der großen Dichterin? Genauer: Welch eine Persönlichkeit war es, mit der Gertrud so viele Jahre nicht nur unter einem Dach gelebt, sondern eng zusammengearbeitet hat?
Ich habe ja schon seit langem vor, meine Erinnerungen niederzuschreiben – Du hast Dich erst kürzlich wieder danach erkundigt. Ich habe darauf eine eher aufschiebende als ausweichende Antwort gegeben. Nun aber duldet das Vorhaben keinen Aufschub mehr.
Eines aber kann ich gleich mit Brief und Siegel versichern: Ich werde keine Memoiren verfassen, werde es vielmehr Dir, liebe Hilde, überlassen, die Chronik unserer Familie zu schreiben, vor allem mit Blick auf Gertrud. Ich kann lediglich Vorarbeit hierzu leisten – soweit die Arbeit in der Kanzlei das erlaubt. Was ich Dir sukzessive vorlege, darüber kannst Du frei verfügen.
So wird dieser Brief zugleich eine Art Werkschrift, eine Arbeitsunterlage. Was ich hier als erstes festhalte, ist Dir bekannt, sei dennoch vermerkt – ich muß mich als Jurist in diese letztlich ungewohnte Art von Schriftsatz erst hineinfinden. Wie auch immer das ausfallen mag, ich erspare Dir damit einige Mühe, suchen und fragen zu müssen. Und mir führe ich die eigene Ausgangsposition vor Augen, indem ich mit Bekanntem beginne, zumindest: Mit dem, was innerhalb unserer Familie bekannt ist.
Ich habe Gertrud für heute freigegeben, die Reinschrift meines Gutachtens kann bis morgen warten, sie nutzt die freundliche Witterung, macht ihre Waldwanderung mit Hund, das wird sich noch ein, zwei Stündchen hinziehen, ich kann also ein wenig ausholen, mir die Anfänge meiner Existenz vergegenwärtigend, die nun mal eng mit der Existenz Deiner Schwestern und Deines Bruders verbunden ist und verbunden bleiben wird. Ob Du den gleichen Ansatzpunkt wählen wirst, bleibe – wie gesagt – dahingestellt, ich lege nur so etwas wie Baumaterial vor, zur freien Verwertung und Verwendung.
Nun denn, einleitend: Die üblichen Angaben zur Person! Wir Chodziesners leiteten unseren Namen ab von der kleinen Stadt Chodziez – nördlich vom heutigen Poznan.
Hier muß ich schon innehalten, mir Einhalt gebieten, es darf nicht bei der bloßen, der gleichsam nackten Erwähnung bleiben, schließlich trägt Gertrud mit dazu bei, daß unser Name bekannt wird über den Familienkreis hinaus. Ich habe euch gegenüber bisher nur andeutungsweise darüber gesprochen, hole jetzt nach. Allerdings, so muß ich ergänzend festhalten, habt ihr nie so recht danach gefragt, Du so wenig wie Deine Schwester Margot, wie Dein Bruder Georg. Nun denn, ich trage nach, ohne nachtragend zu sein – dies kleine Wortspiel sei mir gestattet, mit ähnlichen Einlagen habe ich früher meine großen Plädoyers gewürzt.
Chodziez, das uns den Namen gegeben hat, es liegt etwa hundert Kilometer nördlich von Posen. Um kurz daran zu erinnern: Die gesamte Provinz wurde mit der ersten Teilung Polens anno 1772 von Preußen annektiert, absorbiert, resorbiert. Unser Chodziez allerdings lag in der östlichen Hälfte der Provinz, in der überwiegend Polnisch gesprochen wurde, gesprochen wird, und so behielt es fürs erste den polnischen Namen. Bis sich, etwa achtzehn Jahre nach meiner Geburt, ein Landrat namens »von Colmar« nachdrücklich dafür einsetzte, daß die neugeplante Bahnlinie von Posen nach Schneidemühl möglichst dicht an Chodziez heranführte, der Ort damit angebunden wurde – dies nicht mit einem Bahnhof draußen in der Steppe, sondern in vernünftiger Nähe zum Kern unseres – freilich kleinen – Städtchens. Aus Dankbarkeit entschloß sich die Bürgerschaft, den Namen des Landrats in den Stadtnamen zu transformieren, mit einer kleinen Änderung: Damit wir uns von Colmar bei Straßburg unterschieden, wurde das C durch ein K ersetzt. So entstand der Stadtname, der wiederum zum Personennamen wurde, zumindest als Künstlername unserer Gertrud. Bleibt nur nachzutragen, daß mittlerweile, gemäß dem schändlichen Vertrag von Versailles, Kolmar wieder zu Chodziez wurde und Posen zu Poznan. Doch immerhin anderthalb Jahrhunderte lang war das Gebiet preußisch; dies hat stark eingewirkt auf das Bild des dorfgroßen Städtchens mit dem rechteckigen Marktplatz, der weithin sichtbaren Kirche.
Eigentlich sollte in Chodziez dereinst mal ein Familientag angesetzt werden – da kämen denn so einige zusammen: ihr erwachsenen »Kinder« im Quartett, dazu die Familien meiner Schwester, meiner drei Brüder. Ich würde euch, lufthungrig und bewegungshungrig wie ich das nun mal bin (was gelegentlich euren Spott erweckt), ich würde euch als erstes zum Stadtsee führen, den Miejskie-See, der seinerseits zur Chodziezkie-Seenplatte gehört. Was wiederum heißt: reichlich Schilf, zahlreiche Holzstege, zumeist für Angler, dichte Baumumrandung. Ach ja, und die Seerosen, die in manchen Uferzonen dicht wachsenden, von Gertrud so geliebten Seerosen. Insgesamt: wunderschöne Angebote zum Schwimmen, Rudern, Segeln. Da es in der Umgebung auch Hügel gibt, die von Bewohnern des Flachlands gleich Berge genannt werden, ist alles versammelt, was die Bezeichnung »Schweiz von Chodziez« rechtfertigt.
Ich notiere dies in der Hoffnung, ja Erwartung, daß Du diese Ausführungen einbringst in die Chronik. Unser letztlich etwas spröder, ja sperriger Familienname könnte damit ein wenig an Glanz und Duft gewinnen.
Über meinen Geburtsort Obersitzko hingegen läßt sich kaum ausführlicher schreiben, es verlohnt kaum der Mühe. Du könntest es dabei belassen, zu erwähnen: Obersitzko, wie Posen an der Warthe gelegen, hat etwa anderthalbtausend Einwohner. Und steht im Zeichen der Textilien: Wolle wird gesponnen, Strümpfe werden fabriziert. So ist es nicht weiter verwunderlich, daß mein Vater als Kurzwarenhändler diverse Erzeugnisse im Angebot hatte, die sich mit der Verarbeitung von Stoffen und Tuchen verbinden, kurzum: mit Näharbeiten.
Sein Laden dürfte in der ersten Zeit ein Bauchladen gewesen sein. Das ist nicht eindeutig so überliefert, aber Welt- und Menschenkenntnis berechtigen mich dazu, dies anzunehmen.
Du mußt Dir meinen Vater Julius, Deinen Großvater, als wetterfestes Mannsbild vorstellen. Einer wie er war ja nicht nur bei strahlendem Sonnenschein unterwegs, er hätte sonst erhebliche Einbußen hinnehmen müssen und mit ihm die Familie, er zog, vom Hund begleitet, auch bei schlechtem Wetter los. Wie viele Kilometer, wie viele Meilen mag er insgesamt durch die Provinz Posen gezogen sein, zumindest in seinem Areal, in seiner Region? Ausgreifenden Schritts, frei durchatmend, so sehe ich ihn dahinmarschieren, das Gesicht von Wind und Wetter gegerbt. Auch jetzt, während ich dies niederschreibe, sehe ich ihn dahinziehen im Umland von Obersitzko, und weil er in Anbetracht der Entfernungen nicht jeweils nach Hause zurückkehren konnte, sehe ich ihn zuweilen in Scheunen übernachten oder in Ställen oder in kleinen, karg eingerichteten Zimmern. Und erneut sein Aufbruch zum jeweils nächsten Dorf, mit einem kastenförmigen Korb auf dem Rücken. Am Dorfeingang wurde jeweils der kleine Bauchladen bestückt und geschmückt, mit dem er, von Haus zu Haus ziehend, seine Knöpfe, Schnallen, Nadeln anbot, das Garn, den Zwirn, zuweilen wohl auch Spielzeug – aus Holz, damit wurde das Gewicht nicht zur Last.
Möglicherweise setze ich mich in Deinen Augen dem Verdacht aus, ich würde hier ein wenig idealisieren – dessen möchte ich mich beileibe nicht bezichtigen lassen! So frage ich mich denn, ohne kritischen Zwischenruf Deinerseits, ob Vater auf seinen Handelswegen nicht schon mal mit Steinen beworfen oder von Hunden gehetzt wurde, zumindest, ob ihm nicht Gehässiges nachgerufen wurde wie »krumme Nas, jüdische Plattfüße«, ob besoffene Dorfburschen schon mal den Kastenkorb ausgekippt oder sonst einen Übergriff gewagt haben. Mit seinem Knüttelstock dürfte er sich indes gewehrt, auch könnte der Hund für Respektabstand gesorgt haben, was aber auch nicht immer geholfen hätte, schließlich wird man in solchen Fällen durchweg von einer Gruppe angegriffen. Jedoch, Vater hat nie von derartigen Zwischenfällen erzählt – warum soll ich als Sohn das zum Thema machen?
Wie auch immer: Ich wuchs weithin ohne Vater auf. Um so wichtiger waren mir als Kind die Hühner und Enten, die hinter dem Häuschen ihren Auslauf hatten. Und es kamen Karnickel hinzu, wie sich das gehört. Ah, und die Gänse nicht zu vergessen! Wenn ich durch den Hintereingang das Haus verließ, durchquerte ich quasi einen Kleintierzoo.
Natürlich haperte es im Dorf an vielem, das uns in der Großstadt selbstverständlich scheint. Stichwort: ärztliche Versorgung. Es gab einen Landarzt im Ort, der oft weite Fahrten unternehmen mußte mit seinem Gespann, der zugleich eine kleine Apotheke führte und notfalls auch einen Zahn zog – dagegen war auch Vater Julius nicht gefeit. Gegen sein Rheuma hingegen gab es kein Heilmittel – ich kann ihm zuweilen nachfühlen, wie sehr ihm ein zumindest linderndes Mittelchen fehlte. Bei den langen Märschen auch in Regen oder Schneeregen gab es keinen wirksamen Schutz gegen die Nässe, die denn in altbekannter Weise auf seine Gelenke einwirkte. Wenn er infolgedessen schon mal hinkte, kam es wohl eher vor, daß ihm etwas nachgerufen wurde wie »Zydzie idz do Palestyny!« Das kriegte ich ebenfalls zu hören: »Zydzie idz do Palestyny!« Was aber nicht der Grund war, weshalb wir schließlich Obersitzko / Obrzycko verließen.
Ich war noch, wie man hier in Berlin sagen würde, ein Steppke, als die Eltern nach Woldenberg zogen. Auch hier wäre es unergiebig, bloß den Ortsnamen zu nennen, es sollten sich Vorstellungen, zumindest Assoziationen einstellen. So möchte ich hervorheben: Mit Woldenberg läßt sich meine Vorliebe für kleine Siedlungsformen in Naturnähe erklären. Zwar ist Berlin nach wie vor mein Haupt-Aktionsfeld, richtig wohl aber fühle ich mich nur in überschaubaren Siedlungsformen, womöglich mit Wald und Wasser in der Nähe.
Nun denn: Woldenberg ist eine Bahnstation der Strecke Stettin–Posen. Das Städtchen (mit seinen höchstens viereinhalbtausend Einwohnern) liegt in einem Gebiet, in dem Flüsse (eher Flüßchen) und Seen zahlreich sind: die Kroner Seenplatte. Wie Chodziez liegt der Ort unmittelbar an einem See, dem Woldenberger Großen See. Am höchsten Punkt des Dorfes die Marienpfarrkirche, Backsteingotik. Enge Gassen, kleine Häuser, jedoch ein stattliches Rathaus. Das Woldenberger Fließ, Seen verbindend, mit Schilf und Bootsstegen, Anglerplattformen. Eine Holzbrücke über die Bahnlinie hinweg, eingeschnitten in einen Hügel. Weiter draußen unberührte Natur – nicht bebaubar, nicht zu bewirtschaften, weil weithin sumpfig, dies zumindest am Saum der langsam fließenden Gewässer. Soviel, vorerst, zu meinem zweiten Kindheitsort.
Und es stellt sich die Frage: Warum zogen meine Eltern dorthin? Woldenberg ist Schnittpunkt diverser Handelsstraßen. Vor allem: es liegt an der Chaussee von Berlin nach Königsberg. So haben sich im Ort etliche Kaufleute angesiedelt. Hinzu kamen Tuchmacher. Insofern das rechte Ambiente für den Kurzwarenhändler Chodziesner. Der gab seinen Bauchladen auf (so ordne ich jedenfalls die Abläufe) und mietete einen Laden – sein Mercerieladen, wie man in der Schweiz sagen würde. Kunden kamen oft von weither. Ob Schulterpolster oder Nähnadeln, alles war ausgelegt, angeboten. Das Geschäft lief gut, und Vater konnte Erspartes zurücklegen, was mir als Ältestem zugute kam in der Ausbildung.
Apropos Ausbildung: Es gab im Ort eine evangelische und eine katholische Schule – Judenkinder gingen auf die evangelische. Ob evangelisch oder katholisch – zu jener Zeit war das allerwichtigste Erziehungsmittel der Rohrstock. Der tanzte am ehesten auf den Rücken von Kleinhäuslern, verschonte jedoch den Sohn des Gutsinspektors. Obwohl die meisten Kinder polnisch waren: die Unterrichtssprache (übrigens auch Amtssprache) war Deutsch, auf Grund Allerhöchstderselben Direktive.
Folgerichtig nun die Stichworte Wongrowitz und Gymnasium. Auch das klänge, bei purer Benennung, reichlich dürftig, also tu mir den Gefallen und führe das ein wenig aus. Ich meine nicht ausschmücken, sondern ausführen. Leser unserer Chronik werden sich ja nicht vorwiegend aus Wongrowitz/Wongrowiece rekrutieren. Also ein paar Hinweise, wenn ich bitten darf.
Das Städtchen liegt etwa 50 Kilometer nördlich von Posen. Zirka 4500 Einwohner. Zisterzienserkloster, Amtsgericht, humanistisches Gymnasium. Weitere Angaben gefällig im Stil eines Konversationslexikons? Bitte sehr: Getreide- und Schweinehandel.
Nun wirst Du vielleicht auflachen: auch Wongrowitz liegt an einem See! Name: Durowskie-See. Kein größerer Teich oder Weiher, sondern ein See, der sich weit hinaus besegeln läßt, ein See mit dichtem Waldgebiet am Gegenufer des Städtchens. Dieser See mit anderen Seen verbunden durch ein Flüßchen, das durchs Städtchen führt: Wongrowitz an der Welna. Städtchen, Seen, Wälder: Gerade in den Fortsetzungen hat mich diese Grundkonstellation einigermaßen geprägt – was entsprechend herausgearbeitet oder herausgestellt werden sollte unter dem Vorzeichen: Wie ich wurde, was ich bin. Was wiederum Auswirkungen respektive Rückwirkungen hat auf Gertrud. Wer sie verstehen will, muß erst einmal den Vater verstehen, dem die älteste Tochter in mehrfacher Hinsicht gefolgt ist.
Nun können wir ansetzen zum Sprung nach Berlin. Der See- und Waldbub als Student. Hier sollte man sich dessen bewußt bleiben: Gesellschaftlicher Aufstieg war für einen Juden damals nur möglich, wenn er die Provinz verließ – in meinem Fall zum Studium der Jurisprudenz. Es muß bei diesem Stichwort keineswegs verschwiegen werden, daß ich mich zu einem überaus erfolgreichen, höchst renommierten Rechtsanwalt (und Notar) mauserte. Mir fällt hier ein Spruch ein, den ich nicht weiter zuordnen kann: Nur die Lumpe sind bescheiden. Ich habe es (so wenig wie meine tüchtigen, wenn auch nicht ganz so erfolgreichen Brüder) kaum nötig, mein Licht unter den Scheffel zu stellen, schon gar nicht in Anbetracht so vieler verdüsternder Zustände und Entwicklungen dieser Jahre.
Zum Ausgleich ein paar aufhellende Farbtupfer im Bild eures Vaters? Ich kann mich dabei auf mich selbst berufen: In einem Brief an meine Schwester Rebecka habe ich mich seinerzeit, als Endzwanziger, skizziert als Mann mit kurzgeschorenem Haupthaar, elegantem Hut, patentem Stock. Man hat damals schon in der Familie gern betont, ich gliche Kaiser Wilhelm: ähnliche Statur, ähnliche Frisur, ähnlicher Schnurrbart. Wenn ich durch den Grunewald radelte, sahen Kinder in mir den Kaiser auf dem Velo. Unternahm ich einen Ausritt, folgte mir der Ruf: »Der Kaiser, der Kaiser!« Es waren nicht nur Kinder, denen diese Ähnlichkeit auffiel. In einer Illustrierten, die ich gelegentlich für Dich heraussuchen werde, gab es eine Serie über »Berühmte Doppelgänger«, und hier wurden wir nebeneinander abgebildet: Kaiser Wilhelm der Zweite und der renommierte Strafverteidiger Ludwig Chodziesner.
Zugleich sollte hervorgehoben werden, was uns unterscheidet: Wilhelm zwo ließ sich, solange er als Kaiser amtierte, besonders gern im Automobil kutschieren, ich hingegen lehne, wie Du weißt, Autos als Vehikel von Parvenüs ab. Die schönste Form beschleunigter Fortbewegung erfolgt für mich auf dem Rücken von Pferden – sofern ich nicht mit der Eisenbahn fahre. Dies nur en passant.
Ich komme zum Schluß der heutigen Ausführungen: Dreißigjährig wurde ich Sozius in der hiesigen Anwalts- und Notariatskanzlei Max Wronker (er stammt übrigens gleichfalls aus der Posener Region). Ich darf mit Fug und Recht von mir vermelden, ich hätte mir rasch einen Namen gemacht, als stimmgewaltiger Redner im Gerichtssaal.
Hier gleich die Frage: Warum Anwalt und nicht Richter? Daran waren gesellschaftliche Konstellationen und Konventionen schuld: Auch im Rechtswesen herrschte Antisemitismus, schon zu Beginn des Jahrhunderts. Ich würde mich als »Reformjuden« bezeichnen, oder, spitzer formuliert: als assimilierten »Feiertagsjuden«. Für den ist und bleibt charakteristisch, daß er lediglich zu hohen Festen in der Synagoge erscheint. Freilich, so feine Unterschiede wie Glaubensjude und nichtarischer Christ wurden in der wilhelminischen Gesellschaft kaum gemacht: Jud war Jud und Jud blieb Jud, egal, ob getauft oder nicht, die Nase bleibt. Juden wurde der Zugang zum Richteramt weithin verwehrt. So blieb mir nach dem Jura-Studium allein die Möglichkeit, mich als Anwalt (und Notar) zu etablieren.
Ich würde an Deiner Stelle einen bedeutsamen Kontrast hervorheben: Die meisten Juristen stammen aus (relativ) wohlhabenden Familien, aus einem gehobenen bürgerlichen, liberalen Milieu. Daß der Sohn eines kleinen jüdischen Gewerbetreibenden als Anwalt zu Rang und Namen kam, daß auch meine Brüder Anwälte und Notare wurden, dies dürfte Rückschlüsse zulassen auf die Energie, mit der wir Chodziesners uns wortwörtlich nach oben arbeiteten.
Das wurde schließlich auch nach außen hin bestätigt durch die Kanzlei der Sozietät, im Briefkopf wie folgt präsentiert: »Max Wronker, Rechtsanwalt und Notar; Ludwig Chodziesner, Rechtsanwalt; Kaiser-Wilhelmstraße 49, Ecke Burg-Str.« Wir galten in Berlin bald, mit Verlaub, als König und Vize-König der Strafverteidigung.
2
ES IST NICHT ÜBERLIEFERT, daß Ludwig Chodziesner so sprach, so schrieb, doch wird dies entworfen in Sichtverbindung mit der Überlieferung. Was sich belegen läßt mit zwei Auszügen aus authentischen autobiographischen Ausführungen.
Stichwort Woldenberg: »Die Hauptstraße, in der wir wohnten, heißt die Richtstraße. Wenn man vom Bahnhof her hineinkommt, kann man am unteren Ende gleich wieder ins Grüne schauen. Das Städtchen ist schachbrettartig gebaut, sechs Längsstraßen werden von ungefähr ebensoviel Querstraßen geschnitten. Die eine Längsseite begrenzt ein schöner, großer See, die andere bewaldete Hügel; das Ganze war von einer hohen Mauer, auch an der Seeseite, umgeben.«
Stichwort Wongrowitz: »Ostern 1876 kam ich auf das Gymnasium in Wongrowitz. (...) Sieben lange Jahre lebte ich in diesem Städtchen. (...) Die Räume der Schule gab ein altes Cistercienser-Kloster her, in welchem zugleich das Kreisgericht untergebracht war. Dicht neben dem Kloster erhob sich die schöne alte Klosterkirche mit dem Pfarrhof. (...)
Mein bestes Fach war Deklamation. Ich erhielt hier in der Censur – wo dafür eine besondere Note vorgesehen war – ›sehr gut‹. Damit war mein Schicksal als Deklamator besiegelt. Ich bin der Redner und Deklamator geblieben bis zur Abschiedsrede als Abiturient. Angefangen hatte ich schon viel früher in der Stadtschule, wo ich 1870 bei der Schulfeier für die Capitulation von Strassburg deklamieren mußte, zur Sedanfeier und an Kaisers Geburtstag, wo mir mein Mütterchen in einer Tasse immer ein Gelbei mit Zucker quirlte, damit ich eine reine, kräftige Stimme hätte. Und diese Stimme ist kräftig geblieben durch die vierzig Verteidigerjahre bis auf den heutigen Tag. Sie ist Erbteil meines Vaters, der, wenn er sich am Obertor mit einem Nachbarn unterhielt, am Untertor gut zu verstehen war.«
»Mein Vater hatte eine lebhafte Phantasie, ein wunderbares Gedächtnis und den Drang nach Wissen. Alles, was ihm zu erreichen unmöglich war, suchte er durch seine Söhne zu erreichen, eine angesehene Lebensstellung durch Lernen, durch Studieren. Er sparte jeden Pfennig, er suchte ein Streichholz zweimal zu brauchen, er rauchte nie, nie sah ihn ein Gasthaus in seinen Räumen, und der Höhepunkt seines Lebens, der einzige Rausch, den er je gehabt hatte, waren jene Novemberwochen des Jahres 1903, wo der Name seines ältesten Sohnes, sein und Euer Name, in aller Munde, in allen Zeitungen als der erfolgreiche Verteidiger der Gräfin Kwilecka, Isabella geb. Bininska, genannt und gefeiert wurde. Als die Leute in der kleinen Synagoge in der Schulstraße zu Charlottenburg sich um ihn drängten, als jeder ihm gratulieren und die Hand schütteln wollte, da fühlte er: ›Ich habe nicht umsonst viele, viele Jahre einsam gelebt, gearbeitet und gedarbt, ich habe nicht umsonst gelebt.‹ Und erhobenen Hauptes, frohen Herzens kam er aus der Synagoge nach Haus, in seinen Augen standen Freudentränen, und er erzählte meinem stillen Mütterchen, welches Heil ihm widerfahren. Sie nickte, sie strahlte, aber sie sprach kein Wort. Sie faltete nur ihre ausgearbeiteten, mit dicken Gichtknoten versehenen Hände und betete zu Gott. ›Gelobt sei Schem-boruch-hu!‹«
Einige Sätze zu seiner Mutter: Sie »hatte nicht die Phantasie, die aus den dunklen Augen des Vaters blickte, nicht sein lebhaftes, ja leidenschaftliches Temperament. Aus ihren blauen, milden Augen sprach die Güte, die durch nichts erschüttert wird, der klare Verstand, der alles in Ruhe erwägt, ihr gebeugter Rücken sprach von der schweren Arbeit langer Jahre, von den vielen Mühen und Lasten, die sie für vier Söhne und eine Tochter mit Geduld ertragen. Was für ein Wille, welche Energie waltete in diesem gebrechlichen Körper! So waren die Eltern beschaffen, die drei Söhne studieren ließen, obwohl sie an einem Ort wohnten, der keine höhere Schule besaß.«
Biographische Notizen und Ansätze zu einer Autobiographie: »In meinem Schreibtisch liegen manche Manuskripte und mancherlei Zeitungsaufsätze und gedruckte Skizzen, die einen Einblick in mein Leben gewähren, wohl mehr allerdings in den äußeren Gang als in das innere Erleben. In einem schwarzen Glanzlederheft ist sogar schon ein Anfang zu einer regelrechten Biographie gemacht.
Die Hauptarbeit meines Lebens bestand in dem Erleichtern, in dem Entwirren der Verstrickungen, in die andere Menschen sich verfangen hatten, und darüber darf ich auch heute und nimmer sprechen. Darüber, was ich da für Einblicke in die Tiefen oder richtiger Untiefen der Seelen getan habe, muß ich schweigen wie ein Beichtvater.«
Der gefeierte Anwalt, nach heutigen Begriffen ein Staranwalt, schrieb zuweilen auch Erzähltexte, mal veröffentlicht im Berliner Tageblatt des Jahrgangs 1904, mal in der Unterhaltungsbeilage der Berliner Morgen-Zeitung. Da spielt jeweils Juristisches mit herein.
Die Obduktion, Eine Erinnerung. Zwei Textproben. Der Anfang: »Es war vor zwanzig Jahren im Herbst. Da saß in der Amtsstube des königlichen Amtsgerichts zu Schwachenhagen der alte Rat Humbert an einem langen, mit grünem Tuche ausgeschlagenen Tische und ihm gegenüber sein Referendarius, der sich noch in den Flitterwochen des Refendariats befand.
Es war bereits spät am Nachmittage, als der Gerichtsdiener in das Zimmer trat und dem Herrn Rat einen dicken Eilbrief der königlichen Staatsanwaltschaft überreichte. Der Gerichtsbote Wacker oder, wie er sich gern nennen hörte, der ›Herr Nuntius‹ trug eine fuchsige Perücke und einen kriegerischen Schnurrbart von ähnlicher Farbe.«
Und die Schlußsequenz: »Der Tagelöhner schwieg, die Vernehmung war beendet. Seine Aussage wurde vorgelesen und von ihm unterschrieben.
Der Rat erteilte ihm die zur Beerdigung erforderliche schriftliche Genehmigung.
Darauf nahm Krenz den kleinen braungestrichenen Sarg unter den Arm, grüßte linkisch und entfernte sich mit der Leiche seines Kindes.«
Gleich zwei weitere Textproben, diesmal aus der Skizze Der Kuppler. Die Eröffnung:
»Der Schloßkastellan a.D. Wilhelm Biehl war einst der schmuckste und lustigste Unteroffizier der 4. Kürassiere. Das sieht ihm heute freilich niemand mehr an. Sein Schädel ist kahl, sein schwarzer Schnurrbart ist grau geworden, die dunkelen Augen blicken ernst unter den starken Brauen hervor. Er ist Witwer schon seit vielen Jahren. Dieselbe Stunde, die ihm sein einziges Töchterchen schenkte, dieselbe Stunde nahm ihm sein geliebtes Weib.
Er sitzt in einem alten, mit bunter Perlenstickerei verzierten Korbstuhl und raucht aus einer kurzen Pfeife, deren weißer Porzellankopf das Bild Kaiser Friedrichs zeigt. Zu seinen Füßen spielt seiner Tochter Kind, der kleine Franz, und sucht die Lichter zu erhaschen, die die Nachmittagssonne durch die weißen Mullgardinen auf den abgetretenen Teppich wirft. Trotz aller Mühe will es dem Kleinen nicht gelingen, einen der goldigen Schmetterlinge zu fangen. Wenn er zuschlägt, setzen sie sich auf seine Hand, huschen an seinem Arm entlang, verschwinden, kommen wieder und fliegen ihm ins Auge, so daß er es mit den Händchen reiben muß. Ärgerlich holt er des Großvaters alte Soldatenmütze von der Mahagonikommode. Aber selbst unter dieser Mütze wollen die schimmernden Schmetterlinge nicht sitzen bleiben. Da reißt ihm die Geduld, er gibt das Spiel auf, klettert auf Großvaters Schoß und bittet, ihm etwas zu erzählen.«
Und der Text setzt sich fort, etwa vier (heutige) Druckseiten lang. Hier wieder die Schlußsequenz der melodramatischen Story.
»In diesem Augenblick erdröhnte im Nebenzimmer ein Schuß. Fritz und Margarethe stürzten hinein. Sie fanden den Sterbenden auf seinem Lager liegen. Der alte Kastellan hatte sich ins Herz geschossen. (...)
Schon lange war ihm das Leben zur Qual, jetzt wurde es ihm völlig unerträglich. Ihm graute vor der Schande, er fürchtete sich vor der Göttin mit den verbundenen Augen und vor ihren Dienern, die das Tun und Lassen des Menschen nach den Normen des Strafrechts werten.
Als der kleine Franz wieder nach oben kam, war sein Großvater tot.«
3
WER IN DER CHRONIK unserer Familie vom Vater liest, möchte sicherlich auch einiges über die Mutter erfahren.
Vorab jedoch: Was Großvater Julius recht ist, sollte Deiner Großmutter Hedwig billig sein. Auch ihre Familie hat den Namen eines Ortes übernommen: Bad Schönfließ. Eigentlich solltest Du mal, wie Dein Cousin Georg, zu diesem Kurort fahren und Dich von der Umgebung begeistern lassen. Bad Schönfließ, damals im Landkreis Brandenburg, es wurde nach dem verlorenen Weltkrieg wieder polnisch: Trzcinsko-Zdrój. Es liegt etwa 80 Kilometer südlich von Stettin, läßt sich mit der Eisenbahn erreichen, Umsteigen in Küstrin. Das Dorfstädtchen mit seinen 2000 Seelen, mit dem schönen alten Rathaus, den angenehmen Kuranlagen, es liegt gleichfalls an einem See: dem Stadtsee. Auch hier: ein Seegürtel von Schilf, Büschen, Bäumen. Ja, und viele, viele Seerosen.
Aus diesem Ort die Familie Schoenflies – von alters her Gelehrte und Kaufleute, sprich: bürgerlich situiert, wohlhabend. Georg Schoenflies, Dein Großvater, war Mitglied des Berliner Stadtrats, war Mitglied des Repräsentanten-Kollegiums der jüdischen Reform-Gemeinde, an seiner Beerdigung nahmen Deputierte der Stadt in »Amtstracht mit der Kette« teil. Was seinen Rang und seine Bedeutung hinreichend sichtbar gemacht haben dürfte.
Eure Großmutter Hedwig war höchst unternehmungslustig. Noch im Alter von rund sechzig, wo sich andere längst aufs Altenteil zurückgezogen haben, brach sie zu immer neuen Reisen auf. Dies in Grüppchen, die vom Reisebureau Carl Stangen, Berlin, geleitet wurden. Das Unternehmen bot sogar eine Weltreise an, die allerdings ein Vermögen kostete – für die elftausend Goldmark hätte man eine halbe Villa bauen können. Hedwig konnte sich eine Umrundung der Welt nun doch nicht leisten, immerhin aber reichte es zu Reisen nach Italien, nach Griechenland, in den Vorderen Orient. Es war ein Verwandter, der Archäologe Gustav Hirschfeld (er hatte im Auftrag der Reichsregierung die Ausgrabungen in Olympia geleitet), der ihr Interesse an Archäologie geweckt hatte.
Diese Frau, hochbetagt, doch hochaktiv, konnte erzählen, was unsereins, in der Grundeinstellung wahrhaftig nicht provinziell, nur lesen kann. Wenn Du magst, so führe in der Familienchronik aus, wie Deine Großmutter in Brindisi das Schiff besteigt, wie sie von der Akropolis herab auf die staubige Stadt und die kahlen Bergzüge blickt und: auf das gleißende Meer. (Wenn Du Dein altes Vorhaben einmal durchführen kannst, nach Griechenland zu reisen, so könntest Du dort reichlich Anschauungsmaterial finden.)
Weiter wäre zu berichten: Großmutter Hedwig auf dem Mittelmeer, Kurs südwärts, Großmutter Hedwig in Alexandria, in Kairo, Großmutter Hedwig mit dem Grüppchen auf einem der Nildampfer, erneut Kurs südwärts. Wenn sie auf Deck des Schiffes saß, die Ufer an sich vorbeigleiten ließ mit all den Tempeln, Pyramiden, so muß das für sie ein Gefühl gewesen sein, als führe sie den Strom der Jahrhunderte, der Jahrtausende aufwärts, um endlich an eine Quelle des Zeitstroms zu gelangen. Ja, sie reiste in Zeiträume, die mit den zunehmenden Erkenntnissen der Forschung immer weiter zurückreichen, Jahrtausend um Jahrtausend um Jahrtausend.
So sehe ich Deine Großmutter schließlich in Karnak. Der dortige Tempel mit seinen kolossalen Dimensionen gilt nun mal als das staunenerregendste Bauwerk auf Erden. Ich sehe mit meinem geistigen Auge noch vor mir, was sie erzählt hat, in ihrer zuweilen lakonisch-wortkargen Art: Hedwig in der Mitte des halb eingestürzten Bauwerks, umgeben von Säulen mit einer Höhe und einem Umfang, daß, mit ihnen verglichen, die Säulen von Selinunt und Agrigent wie Zwergenwerk erscheinen müssen. Etliche der Säulen auch liegend, wie hingebreitete Felsmassen, und Großmutter Hedwig, von Herrn Stange oder dessen Stellvertreter wohl argwöhnisch beobachtet, auf Zurufe allerdings nicht weiter reagierend, kletterte auf einen der liegenden Riesen, sah all die Risse, Spalten, Klüfte im Fels, aus dem Gras, ja Buschwerk hervorwächst, schwankend im Windhauch der Wüste – so ungefähr könnte sie das zum Ausdruck gebracht haben. Sie hat sich den Luxus geleistet, der Kajüte zu entwischen, sich nachts in der Tempelruine aufzuhalten, in der Totenstille, in der sie gelegentlich Steinbrocken, Steinbröckchen hörte, die sich von den Riesensäulen lösten. Sie hatte fast das Gefühl, die Hieroglyphen ringsum würden sich aus den Kartuschen befreien und zu Klängen werden, die nur sie zu hören vermochte, in der Stille der Nacht. Doch das Mysterium teilte sich ihr nicht mit, sie kehrte zurück, wurde auf dem Schiff längst schon erwartet; es fuhr in jener Nacht noch weiter. Und dies – sie konnte es nicht hymnisch genug rühmen – unter einem Sternenhimmel, wie er sich in unseren Breiten nur erträumen läßt, selbst in klaren Winternächten: die Sterne nicht nur als Lichtpunkte, sondern wie Fackeln. Dazu noch das Kreuz des Südens, wenige Grade über dem Wüstenhorizont. Viele der Sterne verdoppelt auf dem Wasserspiegel – wenn sie den Blick senkte, hatte sie das Gefühl, sie sei nicht mehr auf dieser Erde, das Schiff gleite durch die Milchstraße dahin.
FREILICH, so weit ist deren Tochter Elise, Deine Mutter, nie gereist. Noch weniger wiederum deren Erstgeborene, unsere Gertrud. Einmal Frankreich, das ja, aber Gertrud in Karnak – so was kann ich mir nicht vorstellen und schon gar nicht: Gertrud vor der Sphinx, die noch älter sein soll als die Pyramiden gleich nebenan.
Immerhin aber: Eure Mutter ist nach Italien gereist. Womit schon das Stichwort Hochzeitsreise fällt. Elise Schoenflies war 21, als ich sie heiratete, mittlerweile 32 Jahre alt. Wie weithin Tradition, zumindest unter Begüterten, fuhren wir nach Rom. Begeistert schrieb sie meiner Schwester, was ich nur aus dem Gedächtnis andeuten kann – ich werde gelegentlich den Brief für Dich heraussuchen. Hier, gleichsam freihändig, einige Andeutungen: Das schöne Rom ... Die Kunst, die das Menschenauge entzückt ... Die großen Reize dort der Natur ... Die Erinnerungen an die alte Zeit ... Die Ausblicke über die gesamte Stadt ... Die südlichen Pflanzen und Gewächse ... Der Ausflug nach Tivoli im Sabinergebirge ... Der weite Blick von dort in die Campagna ...
Insgesamt möchte ich dieses Lebenskapitel knapp halten. Ich müßte mich sonst auseinandersetzen mit Elises gelegentlich erhobenen Vorwürfen, ich würde allzu strenge Maßstäbe anlegen, sie könnte sich an meiner Seite nicht recht entfalten. Sie hat sich freilich ebenso darüber beklagt, daß sie in jüngeren Jahren nur selten zum Tanzen gekommen sei, weil sie immer wieder für andere zum Tanz aufspielen mußte. Was uns als Ehepaar betraf – nun gut, wir gingen und gehen prinzipiell nie ins Kino, gingen und gehen nur selten ins Theater oder in die Oper. Dafür aber spielte Elise um so mehr auf ihrem Blüthner-Flügel. Ihr Geschwister werdet noch ihre Wiener Walzer, ihre Melodien aus der »Fledermaus« oder der »Csárdásfürstin« in den Ohren haben. So was konnte sich über Stunden hinziehen, und ihr habt ebenso ausdauernd zugehört.
Nun könntest Du, könnten Margot oder Georg fragen: Wenn Mama so begeistert war von diesen Operetten, warum seid ihr beiden nicht des öfteren in Aufführungen gegangen? Nun, für mein Teil muß ich gestehen, daß ich ein Mandat zur Verteidigung dieser Operetten nicht übernehmen könnte. Was uns dort an Geschichten aufgetischt wird, ist ja hanebüchen! Nicht eben amüsiert, aber auch nicht bekümmert, eher belustigt als erstaunt, frage ich mich, was für merkwürdige Figuren durch den Kopf eurer Mutter gingen, was für Geschichten und Geschichterln sie euch erzählt hat, in den Überleitungen der, wie man eingestehen muß, zuweilen recht zündenden Melodien. In welche Welten hat sie euch in euren jungen Jahren entführt, wie von Blüthner-Flügeln getragen! Ein Varieté in Budapest, Herren im Frack, mit Hut und elegantem Spazierstock, die weiße Kamelie im Knopfloch, und halbseidene Damen tanzen den Csárdás, da würden die Herren gern auch die Unterwäsche sehen, nicht nur sehen, denn »ganz ohne Weiber geht die Chose nicht«. Das habe ich noch im Ohr, denn zuweilen ergab es sich von selbst, daß ich, im Nebenzimmer beschäftigt, teilnahm an den Darbietungen, mit denen sie sich selbst zu beschwingen schien. Was für kuriose Namen fielen da allein schon: Gabriel von Eisenstein ... Prinzessin Stasi ... Chevalier Chagrin ... Sylva Varescu ... Ach ja, und der Sohn des Fürsten von und zu Lippert-Weylersheim. Ich hatte auch Mandanten aus Adelskreisen, aber jenes Operettenpersonal repräsentierte eher den unteren Adel: schmucke Uniformen ... ein bezechter Sowieso ... von Champagner angeheitert ... ein Stubenmädel ... ein Fledermauskostüm ... Ach, ich fürchte, ich werfe alles durcheinander, die Rache der Fledermaus und das Spiel von Schwalberich und Schwälbin, Lehár und Kálmán, Kálmán und Lehár. Was hat das alles mit unserer Welt zu tun, die genügend zwielichtige Figuren zu bieten hat, und weiß Gott, genügend Verwirrungen, die sich keineswegs immer glücklich auflösen, zu guter Letzt. Wie Ihr wißt, habe ich mit kritischen Anmerkungen nicht immer gespart, die Elise zuweilen ein wenig verstimmten, aber ausreden konnte und wollte ich ihr dieses Phantasieren auf dem Blüthner nun doch nicht und ihre Ausflüge in das Reich von Fledermäusen und Schwalben. Vielleicht kannst Du wenigstens nachträglich mehr als nur den Spielverderber in mir sehen, vielmehr erkennen, dies auch gebührend zum Ausdruck bringen, daß ich mich nicht ganz zu Unrecht zurückgezogen hatte, eher den Umgang pflegend mit Autoren des klassischen Roms, in der Überzeugung, ein Cicero oder Caesar habe ein anderes spezifisches Gewicht als eine Varescu oder ein Prinz Orlofsky.
Für heute indes breche ich ab. Zum Schluß nur: Es wird letztlich bei Dir liegen, Eure Mutter so darzustellen, wie sie sich selbst gern sah – als heiter, gesellig, liebevoll und musisch.
4
TOCHTER HILDE arbeitete in der Tat an der Chronik einer jüdischen Familie. Der Text sollte sich in drei Teile gliedern: Vaters Familie, Mutters Familie, Meine Schwester Gertrud.
Das geschah allerdings erst nach dem Krieg. In einem kleinformatigen Ringbuch mit (inzwischen brüchigem) rotem Plastikdeckblatt wurden Entwürfe variiert. So erhielt der erste Teil den Arbeitstitel Gertruds Ahnen. Als zweiter Teil: Die Familie. Als weitere Variante, sich selbst und Cousin Walter Benjamin probeweise einbeziehend: Gertruds meine und Walters Ahnen. Aber das strich sie wieder durch.
Wie auch immer aufgegliedert, es blieb beim Projekt der Familienchronik. Begonnen in den dreißiger Jahren setzte sie es in den sechziger Jahren fort – in einer Zeit, in der sie (weiterhin) schriftstellerischen Ehrgeiz entwickelte. Unter dem Pen-name Marisa Marconi verfaßte sie Kurzgeschichten und journalistische Beiträge: »Sie hieß Anastasia ... Das Katzenhaus ... Die verlorene Seele ... Spaziergänge rund um Intragnas Kirchturm ... Auf den Spuren der alten Zürcher ›Judenschuol‹ ... Yvonne und der Kibbuz ...«
Sie gestand (sich) allerdings Schwierigkeiten ein beim Verfassen der Chronik. »Bei meines Vaters Vorfahren gerate ich in Verlegenheit. Da gibt es keinen Stammbaum und keine Aufzeichnungen wie von Moritz Schoenflies und obwohl ich diese Großmutter ja noch sehr gut gekannt habe, ist die Zeit längst vorbei, da noch etwas von ihr zu erfahren gewesen wäre, und außerdem, sie sprach ja so selten von sich.«
Und doch ein Ansatz: Hilde über Julius und Johanna Chodziesner in der Provinz Posen. »Wahrscheinlich bald nach Vaters Geburt zogen die Großeltern nach Woldenberg und bewohnten dort ein sehr bescheidenes Häuschen. Im gleichen Haus betrieben sie einen Mercerieladen, und die Bonnen der Umgebung kamen an den Sonntagen, um einzukaufen. Die Großmutter war eigentlich Schneiderin von Beruf. Er war ein leidenschaftlicher Vogelliebhaber und hatte immer einige Singvögel in Käfigen. (...) Unser Vater hat immer erzählt, daß der Großvater sich nichts gönnte, nichts leistete, daß er Groschen um Groschen beiseite legte, um seinem ältesten Sohn eine gute Ausbildung und das Hochschulstudium zu ermöglichen.«
Und sie ergänzte: »›Nie sah ihn ein Wirtshaus in seinen Räumen‹. Diesen Satz haben wir immer wieder von unserem Vater, der stets mit ganzer Achtung und Liebe von seinen Eltern sprach, gehört.«
Die Familienchronistin über ihre Groβmutter: Ist ihr »nur als uralte Frau mit schwarzem Kopftuch über dem dünnen, wie gescheitelten Haar in Erinnerung. Wenn ihre Söhne sich beklagten, so pflegte sie zu sagen: ›Schau unter dich, mein Sohn, nicht über dich.‹ Viele Aussprüche der Großmutter haben mich durchs Leben begleitet, und immer ist sie mir ein hohes Ideal und Vorbild gewesen, in ihrer selbstlosen Güte unserer Mutter innerlich verwandt, allerdings ohne deren heiteres Temperament.«
Die Aufzeichnungen bleiben freilich sporadisch, erfolgten spontan, Zitate müssen in einen Kontext eingeordnet werden. Etwa hier: »An dieser Stelle möchte ich doch noch einmal hervorheben, was unser Vater für seine Geschwister getan hat. Oft hat er erzählt, daß er nichts zu essen gehabt hat, um seinen jüngeren Brüdern das Studium zu ermöglichen, er hat der einzigen Schwester die Aussteuer bezahlt und die Mitgift gegeben und sein Leitsatz war: ›Wohltun beginnt in der Familie.‹ (...) Nach einem harten Studium in Berlin, dem Wohnen in möblierten Zimmern, verbrachte er seine Referendarzeit in Frankfurt / O., wurde er Assessor bei dem damals schon bekannten Anwalt Max Wronker, der ihn dann zu seinem Sozius machte.«
AUCH IN DER FAMILIE SCHOENFLIES wurde eine Chronik geführt. Urgroßvater Moritz berichtet – unter anderem – von seiner Herkunft, vom Überwinden diverser Schwierigkeiten, speziell als Jude, berichtet von den sechs überlebenden seiner insgesamt 13 Kinder. Eins von ihnen: Georg, Vater von Elise Chodziesner, geb. Schoenflies.
»Nicht wie jetzt, wo Chausseen, Eisenbahnen, Telegraphen, Geldinstitute das Geschäft erleichtern und ausdehnungsfähiger machen, hatte ich damals unter ungünstigen Verkehrsverhältnissen auch mit einer mächtigen Konkurrenz zu kämpfen; auch Revolution und Kriege wirkten inzwischen nicht vorteilhaft, doch ist es mir gottlob gelungen, viele Schwierigkeiten zu überwinden und nach 31jährigem Bestehen mein Tabak- und Cigarren-Fabrikgeschäft 1868 meinem Sohne Georg zu übergeben.
Obgleich meine starke Familie außer meiner Frau auch mich in vielen Beziehungen in Anspruch nahm und meine Geschäftszeit mir wenig andere Zeit übrig ließ, blieb ich von Gemeindeämtern nicht verschont: bei der jüdischen Gemeinde einige Jahre Rendant seit 1847, 16 Jahre Repräsentant und 4 Jahre Vorsitzender des Vorstandes; außerdem seit 1851 bis heute noch ununterbrochen Stadtverordneter, Vorstandsmitglied mehrerer Vereine: was hier nur aus dem Grunde erwähnt sei, um den Umschwung in der politischen und bürgerlichen Gesetzgebung zu kennzeichnen, welcher seit meiner Lehrzeit bis zu meiner Niederlassung und weiterhin sich vollzogen hat.«
Und zum Schluß: »Wenn auch zugegeben werden kann, daß manches in den Familien-Skizzen für den Augenblick weniger beachtenswert erscheinen mag, so können doch Umstände eintreten, unter welchen die Nützlichkeit solcher Aufzeichnungen sich erweisen dürfte.« Was in der Tat geschehen wird ...
5
FAMILIENSITZ BERLIN. Von der Reichshauptstadt der Jahrhundertwende berichtet ausführlich ein Zeitgenosse: Jules Huret. Ein Journalist, der in Frankreich bekannt wurde durch seine Reiseberichte. Er durchquerte Nordamerika von Ost nach West, von Nord nach Süd, bereiste Argentinien und hielt sich schließlich längere Zeit in Deutschland auf. Seine Erfahrungen und Erkenntnisse teilte er Landsleuten fortlaufend mit in Reisebriefen, die 1906 im Figaro erschienen. Schließlich faßte er sie zusammen zu einem umfangreichen Werk in vier Teilen. Besonders ausführlich dabei sein Bericht über Berlin, das er zwei Monate lang durchfuhr, durchwanderte, sich für alles interessierend, was die Leserschaft interessieren konnte. Besonders eindringlich seine Berichte vom Gänse-Massenimport in die Stadt oder von einer Ausstellung der Bestattungsbranche.
Die deutsche Übersetzung erschien 1909 unter dem lapidaren Titel Berlin. Erscheinungsort war allerdings München. Der Zugriff auf dieses Buch ist nicht allzu schwierig, eine Neuausgabe erschien 1973, diesmal in Berlin. Der Name des Verfassers wird ein paarmal auftauchen, Huret als unser Cicerone durch die Stadt.
Hier auch gleich eine erste Annäherung. »Berlin ist auf einer weiten, einförmigen Sandebene inmitten der Provinz Brandenburg aufgebaut, von Norden, von Westen und von Osten allen Winden preisgegeben, die ihren kalten Odem ungehindert über diese karge Erde wehen lassen können. (...) Die Spree – so wie sie sich auf ihrer Wanderung durch Berlin zeigt, denn draußen weitet sie sich zu einem stattlichen Fluß – ist ein schmaler, schwärzlicher, träge fließender Wasserarm, dessen Ufer, nüchtern wie die eines Kanals, nichts an sich haben, woran das Auge sich laben könnte.«
Das klingt nicht eben einladend, doch gleich ein Bekenntnis: »Mir gefällt Berlin, ich finde es freundlich, lebhaft, gastlich mit seinem frischen, reinlichen Aussehen, den neuen Straßen, weißen Fassaden, vergoldeten Balkonen, blumengeschmückten Häusern.«
Und Huret preist die »Annehmlichkeit dieser reinen Straßen, wo die Luft so ungehindert zirkulieren kann«. Und weil der Berliner »nichts dazu kann, daß die Spree kein klares, freundliches Wasser ist, und daß er keine Hügel aus dem Boden zu stampfen vermag, von wo man schöne Fernsichten genießen könnte, muß man [ihm] zugestehen, daß er aus dem platten Terrain, wie es ihm nun einmal zur Verfügung stand, das Beste gemacht hat, was sich daraus machen ließ, sowohl was Augenweide als auch Wohnkunst oder Volkshygiene anbelangt«.
6
UND NUN ENDLICH GERTRUD! Sie wurde, als erstes der vier Kinder, am 10.Dezember 1894 hier in Berlin geboren, »vormittags vier ein viertel Uhr«.
Knapp einen Monat zuvor war Georg Schoenflies gestorben; der schmerzhafte Verlust des bewunderten und geliebten Vaters hatte lange Nachwirkung auf Elise. So schrieb sie Mitte Februar 1895 an die Schwägerin Rebecka:
»Es ist heut so sonnig hell draußen, und ich weiß nicht, mir ist so besonders schwer um’s Herz. Es ist ja nicht meine Art, zu jammern und zu klagen, aber ich kann mich noch garnicht an den Gedanken gewöhnen, daß ich keinen Vater, meinen lieben, guten Papa nicht mehr habe. Und je weiter die Zeit geht, desto größere Sehnsucht empfinde ich nach ihm, es scheint bei mir umgekehrt zu sein wie bei anderen Menschen. Ich bin zwar fröhlich und gelassen wie früher, ich störe keinen Menschen mit meiner Trauer, und doch kann ich den Gedanken nie los werden: Wenn Papa doch noch lebte. Doch, liebste Rebecka, sei mir nicht böse, daß Du heute einen solchen Brief von mir bekommst.«
Der Verlust des Vaters soll Elises Schwangerschaft um einige Wochen verkürzt haben: Gertrud kam früher als erwartet zur Welt.
Ende Januar 1895 wiederum Elise an Rebecka: »Wenn ich bis jetzt gezögert habe, Dir einige herzliche Zeilen zu senden, so mußt Du es mir nicht verargen – Trudchen hat Schuld. So ein kleines Wesen regiert das ganze Haus, und da das [Kinder]Mädchen ziemlich unbrauchbar ist, das ich für sie habe, so besorge ich beinahe alles allein. Es macht mir dies natürlich viel Vergnügen, aber es kostet auch demgemäß viel Zeit. (...) Nun noch einige Worte zu unserem kleinen Trudchen, und ich schließe für heute. Ich wünschte, Ihr könntet sie einmal sehen, unsere süße Maus. Sie sieht schon ganz vernünftig aus und lacht schon ganz vergnügt mit ihren hellen Äuglein.«
Geboren wurde Gertrud im Nicolaiviertel, in der Poststraße. Von dort aus hatte es der Vater nicht weit zur Kanzlei. Zwei Jahre später zog die Familie um in die Lessingstraße, in der Nähe von Schloß Bellevue. Im neuen Wohnsitz wird 1897 eine Schwester geboren, Margot. Nach drei Jahren im Spreebogen der nächste Umzug: zum Westend (von Charlottenburg). Hier, an der Ecke Ahornalle/Platanenallee, wird die Familie seßhaft für die nächsten zwei Jahrzehnte. Eine Villa mit »weitläufigem Entrée, Wohn- und Herrenzimmer und Salon«. In diesem Haus wird Georg geboren, 1900, hier kommt, wiederum ein halbes Jahrzehnt später, Hilde auf die Welt. Erinnerungen der Geschwister werden sich mit der Villa und dem weitläufigen Garten verbinden.
Für den Vater wiederum werden sich Erinnerungen an diesen Familiensitz verbinden mit Rückblicken auf seine Zeit der größten Reputation als Rechtsanwalt und Notar, als Verteidiger. Seine Erfolge zudem in einer Zeit wachsender Prosperität: Aktienkurse steigen, Realverzinsung wächst, Industrie boomt, die Stadt dehnt sich aus, auch nach Norden, nach Osten – viele Industriebetriebe dort, zahlreiche Mietskasernen. Der berufliche Erfolg, der (gelegentlich retardierte) wirtschaftliche Aufschwung, beides wirkt ein auf den Lebensstil der Chodziesners. Kindheit mit einem Status, der sich als großbürgerlich bezeichnen läßt: Köchin, Hausmädchen, Gärtner, Gärtnersfrau ...
IM W MUSS MAN ZUGELASSEN SEIN, will man zu der Berliner Gesellschaft gehören«, vermerkt Huret. Und zugleich: »Das W oder das Westend-Viertel Berlins ist nicht sehr ausgedehnt.« Ist aber auch gerade deshalb begehrt: Dort rauchten keine Schlote, die Luft wurde gepriesen, der Wald war nah. So wurde dort viel gebaut.
Huret berichtet über eine Erkundungsfahrt, die er in den damals äußersten Westen der Stadt unternahm. Er beobachtete und berichtete, was Gertruds Kindheitsregion Kontur und Kolorit verleiht.
»Berlin breitet sich täglich mehr aus. Viele Hunderte von Wegen werden augenblicklich in Charlottenburg, in Schöneberg, in Wilmersdorf namentlich, angelegt. Weite Strecken Land werden heute aufgerissen und morgen Straßen sein. In manchen Häusern wohnt man schon, wenn nebenan noch mit der Maurerkelle hantiert wird, so daß neben den Gerüsten die Balkone neuer fertiger Bauten von oben bis unten in üppigem Blumenflor prangen. (...)
Zur Zeit ist man eifrig dabei, die Bäume des Waldes zu fällen – bei aller Liebe der Leute für sie, Platz schaffen muß man doch wohl. Die Linien der Straßen [zeichnen] sich bereits deutlich ab. Diese Straßen von vierzig bis fünfzig Metern Breite haben auf beiden Seiten einen sieben bis acht Meter breiten Damm für Fußgänger, der mit Bäumen eingefaßt ist, je einen Fahr- und einen Reitweg, während die Mitte von einer stattlichen Chaussee eingenommen wird.
Ich unternahm diesen Ausflug, eigentlich sollte ich sagen, meine Forschungsreise, an einem glühendheißen Nachmittag. Meine Autodroschke war durch den Tiergarten, die endlose Charlottenburger Allee, die Bismarckstraße gefahren und auf einer ganz neuen Straße, dem Kaiserdamm, angelangt. Die nach rechts und nach links sich öffnenden Straßen begannen, sich mit neuen Häusern zu besetzen. Da und dort noch öde Strecken, unbebautes Land.
Bald hören die Häuser auf. Aber die Straße hat immer noch ihr Holzpflaster, die Rinnsteine sind gelegt, man stößt schon auf asphaltierte Stellen, auf Zierplätze mit frisch beschnittenem Rasen, blühenden Pflanzen, Geranien, Petunien, Hortensien.
Noch eine Spanne weiter, und wir sind im Grunewald. Auch hier neue Weganlagen, aber die Bäume sind stehen geblieben, die ganze Strecke entlang! Nach einiger Zeit hört die Pflasterung auf. Das Auto sinkt in den Wagengeleisen ein zwischen sandigen Böschungen, aufgestapelten Zement[säcken], Eisenrohren, Ziegelhaufen, zwischen Gräben, Baracken und Schubkarren. Kleine Lokomotiven ziehen Wagen mit Steinen und Baumaterialien auf ihren Schienen hinter sich her.
Plötzlich macht der Weg vor einer dichten Wand von Bäumen halt. Wir haben, in schnurgerader Richtung, vom Tiergarten an, zwölf Kilometer zurückgelegt. Ist das denkbar? Man meint, in Amerika zu sein, zu einer Zeit, da eben eine neue Stadt gegründet werden soll, und man muß den Wagemut, das Selbstvertrauen, die Umsicht, die solch ein Unternehmen erfordert, bewundern.«
ANMERKUNGEN zur Villenkolonie W., benannt nach dem Londoner Nobelviertel. Das Neubaugebiet der Jahrhundertwende war angelegt als Karree mit rechtwinkligem Straßenraster – die Namen nach den jeweils charakteristischen Alleebäumen: Akazie, Nußbaum, Ulme, Fichte, Eberesche, Platane, Ahorn ... Nördlich der Villenkolonie die Berliner Wasserwerke, südwestlich die Trabrennbahn, östlich der Bahnhof Westend, westwärts der Grunewald. Zentral im Rasterkarree der Branitzer Platz. Zahlreiche Grundstücke wurden erst im Lauf der Jahre bebaut – eins von ihnen, rasch verwildert, wurde zum Abenteuerspielplatz der Chodziesner-Kinder.
Viel Prominenz zog in das Viertel. Einige Namen: Robert Koch, der Mediziner, Emil Nolde, der Maler, die Komponisten Richard Strauss und Paul Hindemith, die Schriftsteller Joachim Ringelnatz und Robert Walser ...
DIE DICHTERIN wird später ihrer kleinen Nichte aus den Kindheitsjahren erzählen. »Wir spielten am liebsten im Freien. Da waren drei Nachbarskinder, Johann, Peter und Marion, die waren aus Hamburg hergezogen, und weil Hamburg ja eine Hafenstadt ist, wußten sie mehr vom Seewesen als wir und spielten immer ›Schiff‹ mit uns. Das Schiff war meistens unser Turngerüst mit seiner Leiter, den Stricken und Stangen; die Kinder kletterten als Matrosen da herum, und Deine Mami, die damals noch recht klein war, war die Stewardeß und hatte für das Essen der Mannschaft zu sorgen. Die Eltern der Kinder waren schon in Afrika gewesen, und aus Afrika stammte auch ihr grauer Papagei; er hatte einen roten Schwanz, hieß Gascon und konnte sprechen. Marion erklärte übrigens in jedem Frühling, daß die ganze Familie dies Jahr bestimmt nach Lissabon fahren würde; sie fuhren aber niemals. Die Jungen lehrten uns ein Hamburger Spiel ›Akree‹; das war eine Art Verstecken mit Greifen. Wir spielten es in dem langen Kellergang und den vielen dunklen Kellerräumen unter dem Hause. Ein schönerer Spielplatz aber als Haus und Garten war das ›Wäldchen‹. Das war ein ganz verwahrlostes und verwildertes Grundstück voller Bäume, Unkraut und Gestrüpp. Die Leute, denen es gehörte, betraten es nie, und als wir zum ersten Mal hineingingen, mußten wir überall Strauchwerk zerschneiden und zerbrechen, sonst wären wir nicht vorwärtsgekommen. Dazu lag auch noch überall alter, unbrauchbarer Hausrat herum, kaputte Teller, durchlöcherte Kochtöpfe, eine aufgeschlitzte Matratze, aus der die Füllung quoll. Und in der Mitte des Wäldchens, von der Straße her nicht zu sehn, stand ein kleines hölzernes Gebäude. Es war vielleicht in Wirklichkeit nur ein Stall gewesen, uns Kindern kam es aber sehr seltsam und wunderbar vor und wir nannten es ›das Hexenhaus‹. Das Schönste an dem Hexenhaus und dem Wäldchen war, daß es uns Kindern allein gehörte; die Großen kamen gar nicht hinein, weil sie sich von den Dornsträuchern nicht die Kleider zerreißen lassen wollten. Kennst Du das Spiel ›Böses Tier‹? Das spielten wir in unserem eigenen Garten im Winter, wenn es früh dunkel wurde und der Mond auf den weißen Schnee schien. Eins der Kinder war ›böses Tier‹ und hatte sich irgendwo in der Dunkelheit versteckt, die anderen gingen umher und sangen:
Wir wollen so schön spazieren gehn,
Wenn bloß das böse Tier nicht käm’.
Die Uhr schlägt eins, die Uhr schlägt zwei,
die Uhr schlägt drei, die Uhr schlägt vier,
Das Böse Tier ist noch nicht hier.
Die Uhr schlägt fünf, es kommt noch nicht,
Die Uhr schlägt sechs, es kommt noch nicht ...
Und die Uhr schlug immer weiter, ohne daß es kam, bis es plötzlich, meistens längst nach Mitternacht, irgendwo aus dem Hinterhalt mit furchtbarem Gebrüll hervorbrach und eins von den Kindern zu packen versuchte. Dieses Winterabendspiel war etwas ›gruselig‹; aber das war ja gerade das Schöne an der Sache.
Wir spielten auch gelegentlich Theater; aber davon erzähle ich Dir vielleicht ein andermal.«
RENOMMIERTE NACHBARN in der Ahornallee: ein Professor, eine Malerin, ein Bildhauer, ein Bakteriologe, ein Astronom.
In der Nähe freilich auch eine Kaserne. Hilde berichtet, daß sie als Kinder oft am »Hinterpförtchen« standen und zuschauten beim Exerzieren. Zuweilen scheint sich einer der Ausbilder einen Plausch am Gartenzaun gegönnt zu haben. Bald kannte man »sie alle bei Namen, die Offiziere, die Unteroffiziere, die Feldwebel«. Weiter berichtet Hilde, daß die Geschwister oft nebenher marschierten, wenn »unsere Soldaten« ausrückten mit »klingendem Spiel«.
Zu Weihnachten gab es denn, selbst für die Mädchen: Trommeln, Säbel, Uniformen – sogar »eine wunderschöne Husarenuniform mit Sporen«.
ERINNERUNGEN müssen nachgearbeitet, Angaben verifiziert werden. Lange Zeit hatte ich aus den Andeutungen geschlossen: Die Kinder konnten vom Gartenzaun aus zumindest einen Teil des Exerzierplatzes überblicken. Alte Stadtpläne (der Marke Pharus) studierend, sehe ich, daß derartiger Ausblick so direkt gar nicht möglich war.
Zwischen der Stadtbahntrasse nordwärts und dem Neubaugebiet der (damals ebenfalls neue) Kasernenbau des Königin-Elisabeth-Garde-Grenadier-Regiments Nr. 3. Eine alte Postkarte zeigt einen mehrstöckigen, weitgestreckten Bau, der Assoziationen weckt an jene mehrere hundert Meter lange Urlauberkaserne von Prora auf Rügen. Verglichen damit war der Kasernenbau allerdings vielgestaltiger gegliedert. (Die Bombenangriffe haben nur ein Rudiment übriggelassen, die Offiziersmesse.) Außerhalb des Kasernengeländes der Exerzierplatz früher Jahre: rechteckiges Areal auf Höhe des Lietzensees. Südlich angeschlossen, wenn auch jenseits einer Bahnlinie, der Schießplatz. Sehr ruhig kann es im Villenviertel demnach nicht immer gewesen sein.
In den zwei Jahrzehnten, in denen die Familie im Westend wohnte, veränderte sich die Gegend rasch. Ein Stadtplan der zwanziger Jahre zeigt, daß der Exerzierplatz mittlerweile bebaut worden war. Wo wurde statt dessen exerziert? Im Kasernengelände, damit in der Nähe des Familiensitzes? Aber auch dann: keine unmittelbare Sichtverbindung, und sicherlich keine Plaudereien über einen Gartenzaun hinweg. Denn zwischen Villa und Kaserne verliefen die Ahornallee und, parallel, die Soorstraße. Auch wenn hier noch wenig gebaut worden war – wollten die Kinder sehen, wie Rekruten gedrillt wurden, mußten sie ein Stückchen laufen.
Und der Vater mußte den Weg zur Anwaltskanzlei wie zum Amtsgericht (AG Charlottenburg? AG Mitte?) zu Fuß beginnen. Er wird dann am Westend-Bahnhof eingestiegen, später umgestiegen sein. Ab 1908 hatte er es freilich leichter, damals wurde eine neue U-Bahn-Linie eröffnet, als Stichbahn vom »Knie« (der heutige Ernst-Reuter-Platz), zum Reichskanzlerplatz (heute Theodor-Heuss-Platz). Nun war der Weg zur Bahn wirklich nur ein »Katzensprung« – die Ahornallee führt direkt zum Platz. Ein altes Foto zeigt eine weite Anlage mit Ansätzen zur Bepflanzung; noch ist hier südwärts, westwärts kein einziges Gebäude zu sehen, nur die U-Bahn-Eingänge hüben und drüben an der weiten, völlig leeren Straße. Auf riesiger Holztafel in großen Buchstaben: »Baustellen verkäuflich.« Die sehr breite Heerstraße führt (noch) als Piste durch Waldgebiet.
GERTRUD ERINNERT SICH an die frühen Jahre. »Bei uns waren Kindergesellschaften immer die Hauptsache. Die erste Schulkameradin, die mich zu sich einlud, hieß Tula Quittmann; sie war am 27.Januar geboren wie der Kaiser. Das war eine sehr angenehme Einrichtung: da zogen wir Kinder uns schon vormittags gut an, gingen für eine Stunde nur in die Schule zur Kaisergeburtstagsfeier und nachmittags brauchten wir keine Schularbeiten zu machen, gingen zu Tula und feierten deren Geburtstag. Und zu Mittag gab es Gemüsesuppe oder, wie wir sagten, ›Suppe mit allem drin‹, und hinterher Eierkuchen, und ich glaubte, weil ich noch so klein war, daß es dies Essen heute in allen Familien gäbe, auch beim Kaiser selbst, daß dieses eben das Kaisergeburtstagsessen sei. Ja, noch etwas ganz anderes glaubte ich. Zu der Schulfeier war auch ein Teil der Eltern gekommen, darunter der Oberst unseres Westender Regiments, Herr von Kuczkowski. Seine drei Töchter gingen in unsere Schule. Der Oberst also, in großer Uniform, in Blau und Rot und Gold, hatte inmitten der verschiedenen Väter und Mütter den Ehrenplatz bekommen. Als wir nun nach Schluß der Feier die Aula verließen und an den Eltern vorbeigingen, machte ich vor ihm einen ganz tiefen Knicks; ich glaubte nämlich, dieser hohe Offizier wäre der Kaiser (der hätte viel zu tun gehabt und sich in lauter kleine Stücke zerreißen müssen, wenn er bei allen Schulfeiern an seinem Geburtstag hätte dabei sein wollen!). Jedenfalls dachte ich das, weil ich nicht verstanden hätte, wie man einen Geburtstag feiern könnte, ohne daß das Geburtstagskind selbst anwesend sei. (...) Den größten Eindruck aber machte mir an jenem Tage Folgendes: ich ging abends um 8 Uhr allein nach Hause, und als ich an den Branitzplatz kam, stieg über einem unbebauten Grundstück eine hohe silberne Lichtsäule am schwarzen Nachthimmel auf. Heut weiß ich, daß zu Ehren des Tages auf dem leeren Grundstück ein Feuerwerk abgebrannt wurde; damals aber hatte ich so etwas noch nie gesehn und hielt die Lichtsäule für eine himmlische Erscheinung ...«
DER VATER, selbstbewußter Repräsentant des wilhelminischen Zeitalters, war dezidiert Herr im Hause. Diese Rolle war seit Jahrzehnten festgeschrieben, war kanonisiert: Der Hausherr bestimmte, was zu geschehen und was zu unterbleiben hatte; der Vater als kleiner Kaiser im Hause, durch seine Autorität die Autorität des Kaisers widerspiegelnd, der wiederum die Rolle des Herrn im Hause vorbildhaft legitimierte.
Die Rolle des Herrn im Hause mußte nicht durch autoritäres, womöglich aggressives Verhalten erobert, sie mußte nur ausgefüllt werden. So ist schwer zu unterscheiden, was Anlage war und was Vorgabe. »Vati« als Patriarch, als Padre padrone. Die Ehefrau schuldet ihm Gehorsam, die Kinder müssen kuschen. In Büchern über Kindheit in früheren Zeiten oder über die »Geschichte des privaten Lebens« wurde das hinreichend beschrieben und analysiert, es kann hier nur angetippt werden. In einer Person, einer Persönlichkeit wie Ludwig Chodziesner entstand ein Amalgam, eine Wechselwirkung von Rolle und Charakter.
Eins der überlieferten Fotos zeigt ihn um 1900 hoch zu Roß, mit glänzenden Reitstiefeln, weißer Jacke, weißem Hut. Massig der Schädel mit dem akzentuierenden Schnurrbart.
Was Hilde über Großvater Julius schrieb, dürfte auch für den Vater gelten: er »war eine leidenschaftliche Natur, aber im Alter milder«. Der herrische, auch heftige Mann prägte den häuslichen Lebensstil. Eine der Auswirkungen, charakteristisch: »Bei Tisch dürfen die Kinder nicht sprechen.« Schließlich leistet Vater konzentrierte Arbeit, muß sich mittags ein wenig erholen. Und abends erst recht.
Es war Elise, die – soweit möglich – für Ausgleich und Geselligkeit sorgte. Auch hier ein Amalgam von Charakter und Rolle: zur notwendigen Strenge des Vaters komplementär die ausgleichende Güte der Mutter.
BERLINER KINDHEIT UM NEUNZEHNHUNDERT: Titel eines der Werke von Walter Benjamin. Er war ein Cousin von Gertrud; sein vollständiger Name lautete: Walter Bendix Schoenflies-Benjamin. Zusammengehalten wurden die beiden Familienzweige vor allem durch Großmutter Hedwig. Auf einem Foto (es ist leider nicht allzu deutlich) thront sie in der Mitte, in schwarzem Kleid. Zu ihrer Rechten steht, an sie gelehnt, Walter in weißem Matrosenanzug, mit breitkrempigem Hut. Zu ihrer Linken, gleichfalls an sie gelehnt, Gertrud, in weißem Kleid und mit Strohhut.
Diese Oma, zum Zeitpunkt der Aufnahme noch keine sechzig, sah aus wie eine rechte Großmutter zu wilhelminischer Zeit: ehrfurchtgebietend. In ihrer Reiselust jedoch nahm sie Lebensformen heutiger Großmütter vorweg.
»Wenn man die alte Dame auf ihrem teppichbelegten und mit einer kleinen Balustrade verzierten Erker, welcher auf den Blumeshof herausging, besuchte, konnte man sich schwerlich denken, wie sie große Seefahrten oder gar Ausflüge in die Wüste unter der Leitung von ›Stangens Reisen‹ unternommen hatte, an die sie sich alle paar Jahre anschloß. Madonna di Campiglio und Brindisi, Westerland und Athen und von wo sonst sie auf ihren Reisen Ansichtskarten schickte – in ihnen allen stand die Luft von Blumeshof. Und die große, bequeme Handschrift, die den Fuß der Bilder umspielte oder sich in ihrem Himmel wölkte, zeigte sie so ganz und gar von meiner Großmutter bewohnt, daß sie zu Kolonien von Blumeshof wurden.«