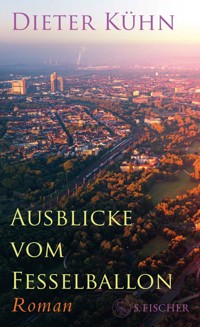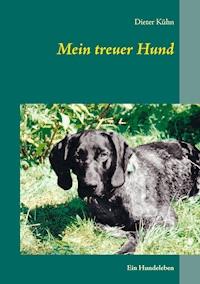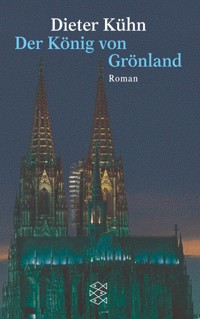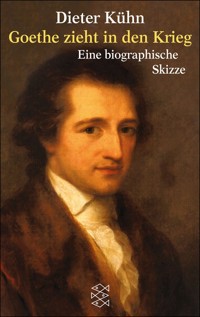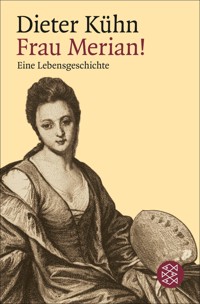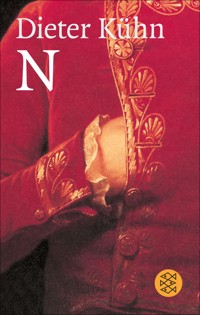9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Erzählte Geschichte Franz Xaver Mozart, Sohn des großen Mozart und wie dieser Komponist, lässt sich 1813 im galizischen Lemberg nieder – beruflich im Schatten des Vaters, privat gefangen in der Liebe zu einer verheirateten Frau. Vier Indianerhäuptlinge werden 1710 nach London zu einem Staatsbesuch gebracht, ihr Schicksal schon besiegelt. Und der Dichter E.T A. Hoffmann schreibt dem »sehr geehrten Herrn Geheimrat« und Kollegen Goethe Briefe ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 717
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Dieter Kühn
Ein Mozart in Galizien
Erzählte Geschichte
Erzählung/en
Über dieses Buch
Franz Xaver Mozart, Sohn des großen Mozart und ebenfalls Komponist, lässt sich 1808 in Galizien, der entlegensten Provinz des Habsburgerreiches, nieder – beruflich im tiefen Schatten des Vaters, privat im Bann einer verheirateten Frau –, und das Leben kommt langsam zum Stillstand.
Vier Irokesenhäuptlinge aus Amerika werden 1710 nach London zu einem Staatsbesuch gebracht, ihr Schicksal schon besiegelt.
Und gelingt es, den großen Goethe brieflich von den Qualitäten seines verschmähten Kollegen E.T A. Hoffmann zu überzeugen, der ganz im Verborgenen ein radikales und riskantes Leben führt?
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Covergestaltung: Hißmann & Heilmann, Hamburg
Coverabbildung: Karl Schweikart, »Franz Xaver Mozart« ©picture-alliance/maxppp
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2008
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-400126-5
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Festspiel für Rothäute
Hoffmannstropfen für Goethe
Erster Brief
Zweiter und dritter Brief
Vierter und fünfter Brief
Ein Mozart in Galizien
Anhang
Festspiel für Rothäute
Hoffmanns-Tropfen für Goethe
Ein Mozart in Galizien
Festspiel für Rothäute
IM FRÜHJAHR 1710 brachten englische Offiziere vier Irokesenhäuptlinge von Nordamerika nach London, zu einem Staatsbesuch.
HÄUPTLING JOHN an einem Tisch, der zwischen zwei kleinen Schiffsfenstern hochgeklappt werden kann; er blättert in einem Buch, beschaut Kupferstiche über damaligen Schiffsbau, kippt den Kopf mal etwas nach rechts, mal ein bisschen nach links, er scheint räumlich zu sehen, versucht das wenigstens.
Häuptling Etoh sitzt am Rand einer doppelstöckigen Bettkoje, in der nesselgraue Laken liegen, dunkle Decken; Etoh muss den Oberkörper vorbeugen, die Ellbogen auf die Oberschenkel stützen, das Kinn in die Handmulden legen, denn ziemlich tief, in Nackennähe, ist der vordere Tragebalken der oberen Koje. Etoh kaut ohne zu schlucken, höchstens Speichel, gelegentlich; kauend hat er den Blick auf einen Punkt gerichtet, der sehr weit außerhalb der etwa fünf Schritt langen, vier Schritt tiefen und knapp kopfhohen Kajüte zu liegen scheint.
Der dritte Irokesenhäuptling, Hendrick, raucht eine Pfeife, deren Kopf ziemlich klobig ist, beschnitzt und bemalt mit groben Maisblatt-Ornamenten. Auf den Fersen hockend, mit dem Rücken an der Schiffswand, schnitzt er einen zweiten, womöglich noch größeren Pfeifenkopf, hält ihn mehrfach in Augenhöhe, prüfend, legt das Werkstück auf den Oberschenkel, zieht mit dem Messer eine vorerst nur geplante Linie, zieht sie mehrfach nach, bis die Bewegung sicher und fast schon selbständig geworden ist, setzt dann erst das Messer an.
Häuptling Brant am Klapptisch, dessen Fläche lang genug ist für die beinah schulterhohe Muskete, die er reinigt: auf dem Tisch der Ladestock, um den vorn ein Läppchen gewickelt ist. Brant reinigt den Lauf, die Zündpfanne, den Abzughebel, das Ziermetall, am Kolben aufgeschraubt; der Vorderlader sieht freilich so sauber aus, als wäre er in den fünf oder sechs Wochen Atlantiksegelei schon mehrfach gereinigt worden.
In diesen Wochen ist die Bemalung der Indianer blass geworden, verwischt. Die Kleidung macht sie kaum noch als Indianer erkennbar; nur zwei von ihnen tragen Hirschlederjacken, aber ohne bunten Besatz; ein Dritter hat einen englischen Pullover an, der Vierte eine sichtlich ausrangierte Offiziersjacke. Keiner von ihnen trägt Federschmuck, Ohrschmuck.
Die Häuptlinge unterhalten sich nicht – nur Schiffsholzknarren, fern Wellenschlag, dann in der Nähe ein Ruf, weitergegeben. Die Indianer achten nicht darauf – viele Rufe, meist Befehle, sind auf einem Schiff zu hören. So kaut Etoh weiterhin, und John blättert, Hendrick raucht und schnitzt, Brant fettet die Abzugmechanik ein. Natürlich hat er nicht als Einziger eine Schusswaffe mitgenommen: Musketen mit Gabelstöcken neben dem Spind. Und einige indianische Waffen, wahrscheinlich zu Vorführzwecken: Kriegsbeile, Bogen, Köcher, Pfeile.
AN DECK DER H. M. S. »RESERVE«, einem Kriegsschiff der vierten Kategorie mit 54 Kanonen, stehen Sir Francis Nicholson, Peter Schuyler, Samuel Vetch: die Begleitoffiziere der Irokesenhäuptlinge. Und Dolmetscher Pidgeon. Die vier Offiziere betrachten eine erste Andeutung von Land, betrachten sie offenbar schon seit einiger Zeit, die freudige Erregung des ersten Anblicks hat sich bereits verflüchtigt. Sie überlegen, welcher Zipfel Englands sich dort ankündigen mag: ist es Lizard Point oder Lands End, oder liegt Lands End nicht zu weit nördlich, und es handelt sich vielleicht schon um Start Point? Das können sie nicht entscheiden, sie wollen einen der Schiffsoffiziere fragen oder gleich Kapitän Teate, aber im Moment werden sie ihre Frage nicht los, kein Offizier in Sichtweite, und bei einem Matrosen wollen sie sich denn doch nicht erkundigen.
Sie überlegen, ob sie die »Rothäute« heraufholen sollen, um ihnen diese Andeutung der englischen Küste zu zeigen, gleichgültig, ob sie nun Lizard Point, Lands End oder Start Point markiert. Aber sieht diese Küste, so fragt Vetch, nicht noch etwas sehr dünn aus? Soll man nicht ein bisschen länger warten, zum Beispiel bis kurz vor Portsmouth, und dann erst führt man sie nach oben? Schon der erste Eindruck, sagt einer der Offiziere, beispielsweise Nicholson, schon der erste Eindruck sei verdammt wichtig.
DER REGIERUNG IHRER MAJESTÄT, Königin Anna, war der Staatsbesuch der vier Indianerhäuptlinge bedeutsam genug, um einen Master of Ceremonies freizustellen, Sir Charles Cotterel. Was er als Erstes vorbereitet, ist der Empfang im Hafen von Portsmouth.
Sir Cotterel erläutert seine Konzeption an einem Bühnenbildmodell: ein Kai und eine Häuserreihe. Cotterel zeigt dem Bürgermeister der Hafenstadt die Stelle des Kais, an der das Kriegsschiff vertäut wird: auf diesen Punkt hin müsse alles ausgerichtet werden. Von der Verwaltung sei dafür zu sorgen, dass an sämtlichen Häusern des Hafenbereichs geflaggt werde. Dass sich in den Fenstern, auf der Straße viele Zuschauer drängeln, dies müsse wohl nicht organisiert werden, die Neugier auf die »Indianerkönige« sei groß genug. Zu organisieren wäre wiederum – in Zusammenarbeit mit einem Verbindungsoffizier – die erste militärische Präsentation des Gastgeberlandes: Gardekompanien sollen am Kai aufgestellt werden; der Master of Ceremonies deutet die voraussichtliche Position der fünf Soldatenkarrees an, auch die der Militärkapelle, auch die der Kanonen, die Salut schießen werden. Zuletzt die Stelle des Herrn Bürgermeisters, der die Begrüßungsworte sprechen wird, im Namen der Stadt, im Namen des Landes, im Namen der Königin.
AUCH DIE INDIANERHÄUPTLINGE bereiten sich auf den festlichen Empfang vor: paarweise stehen sie in der Kajüte, nur mit einem Hosenschurz, einem Kilt, bekleidet; sie bemalen sich. Etoh ist bereits bis zur Nasenspitze bemalt, farbige Ornamente auf der Brusthaut. Er bemalt Hendrick. Auch Brant ist auf der Brust bemalt, aber noch nicht im Gesicht, er bemalt John: eine Schlängellinie vom linken Ohrläppchen über die Oberlippe zum rechten Ohrläppchen; eine zweite, tiefblaue Schlängellinie parallel darunter; Kinn und Kiefer gleichmäßig eingefärbt; Punkte, weiß ausgemalt; drei Schmuckhalbkreise mit sehnenförmigen Verbindungen am Hals, großflächige Ornamente über den Schlüsselbeinen, weiß ausgesparte Kreuzmuster an den Schultern. Auf der Brust zwei Reihen Pfeilschäfte, senkrecht parallel. Dazwischen malt Brant einen etwa handgroßen Käfer in ornamenthafter Stilisierung: weitgeschwungene Fühler, nach oben gerichtet.
DER BÜRGERMEISTER von Portsmouth spricht – in festlicher Amtstracht, mit Siegelkette und Allongeperücke – von der Freude und vom Stolz, vom Vergnügen und von der Ehre, an diesem 7.April 1710 vier so angesehene Persönlichkeiten aus den Weiten des nordamerikanischen Kontinents begrüßen zu dürfen. Das übersetzt Major Pidgeon den Irokesen, die vor dem Schiff am Kai stehen. Ihre Haare sind glatt zurückgekämmt wie auf den Gemälden dieser Indianer aus dem Jahre 1710; Nackenknoten und Schmuckbänder halten die Haare zusammen. Vor den Ohren jeweils ein weißer Zierbömmel, der aussieht wie ein Puderkissen, wie ein dickes Wattebüschel für kosmetische Zwecke. Jeder der Häuptlinge trägt einen hemdartigen, knielangen, spitz und tief ausgeschnittenen Überwurf mit buntem Gürtel. Um die Schulter gelegt eine Decke, beispielsweise rot, mit Zierleisten. Die Beine nackt unter Überwurf und Decke; mehr als knöchelhoch die Mokassins mit großen Schleifen. Und die Begleitoffiziere tragen wie auf zeitgenössischen Bildern Schnallenschuhe, helle Strümpfe, Bundhosen, knielange Westen und Jacken; im angewinkelten rechten Arm jeweils der breitkrempige Hut; schulterlang die hellen Perücken.
Der Bürgermeister verliest die kompletten Namen der Indianer – das kann ihm hörbare Schwierigkeiten bereiten. Er begrüßt Yee Neen Ho Ga Prow oder Hendrick vom Wolfsclan. Begrüßt Sa Ga Yean Pra Ton oder John vom Wolfsclan. Begrüßt Etoh Oh Koam vom Schildkrötenclan. Begrüßt Oh Yee Yeath Ton No Prow oder Old Smoke Brant vom Bärenclan. Begrüßt in ihnen die Repräsentanten der fünf Indianernationen im Grenzgebiet von Neuengland und Neufrankreich.
Es fällt den Indianern schwer, der Übersetzung seiner Rede zu folgen: unruhig vor allem ihre Augen. Soldaten aufgereiht; Uniformtuch, Leder, Metall. Das Gesicht des Bürgermeisters. Dicht gedrängte Bevölkerung, auch in allen Fenstern. Fahnen. Militärmusiker mit polierten Instrumenten. Das festlich gekleidete Gefolge des Bürgermeisters. Die Salutkanonen. Die Fahnen. Die Zuschauer. Die aufgereihten Soldaten. Die polierten Instrumente. Die Fahnen. Die Salutkanonen.
Major Pidgeon tritt vor und verliest die »Rede der Indianer«. Hier ein (überlieferter) Ausschnitt: »Wir haben eine lange und nicht immer leichte Reise auf uns genommen, die keiner unserer Vorfahren zu unternehmen gewagt hätte. Was uns dazu antrieb, war das Verlangen, Ihrer Majestät, der Königin von England, über Fakten zu berichten, die von großer Bedeutung für Ihre Herrschaft sind – ebenso wie für uns, für Ihre Alliierten auf der anderen Seite des Großen Wassers. Gemeinsam mit Ihren Landsleuten führen wir einen langen und harten Kampf gegen die von Kanada her angreifenden Franzosen, einen Kampf, bei dem wir bereits etliche unserer besten Männer verloren haben. Um diesen Kampf gegen Franzosen und Jesuiten erfolgreich bestehen zu können, bedürfen wir der machtvollen Unterstützung durch England.«
AUS DEM GRENZKRIEG: Irokesen, ein Trupp von etwa zwanzig Mann, sie marschieren im »indian file« durch nass verschneites Gelände. Die Mokassins dick von Schlamm umpappt, die langen Lederhosen matschverkrustet, die Lederjacken durchnässt und eng anliegend; mehrere Indianer haben Decken umgehängt, die sind ebenfalls mit Nässe vollgesogen. Als Waffen tragen einige der Indianer Tomahawks, Bogen, Lanzen, die meisten sind mit Musketen bewaffnet. Die Irokesen gehen langsam, mühsam. Auch die drei oder vier englischen Soldaten, die sie begleiten, sind erschöpft und verdreckt: Stiefel schlammverpappt, Schmutzflecken auf hellen Hosen.
ENDE DES SIEBZEHNTEN JAHRHUNDERTS hatten sich fünf Indianerstämme, bis dahin durch Stammesfehden getrennt, im »Großen Frieden« zu einem Bund zusammengeschlossen: die Mohawk, die Oneida, die Onandaga, die Cayuga, die Seneca. Als Stifter des Friedensbundes wurde Prophet Deganawidah gefeiert: seine Vision von einem immergrünen Baum mit fünffacher Wurzel, dessen Krone bis ins »Reich des Meisters« hochragt.
Realer Grund zur Bildung des »Friedensbundes«: Schon in den dreißiger Jahren des siebzehnten Jahrhunderts waren Franzosen in den St.-Lorenz-Strom gesegelt, hatten hier erste Handelsniederlassungen gegründet, hatten sich mit den Indianerstämmen nördlich des Stromgebiets verbündet, vor allem mit den Algonkin, hatten gemeinsam mit ihnen den Pelzhandel ausgebaut, hatten immer weitere Gebiete erschlossen – so war es in den Grenzbereichen recht bald zu Auseinandersetzungen, zu Streitigkeiten, zu Scharmützeln, zu Gefechten, zu Kämpfen, zum Krieg gekommen. Hier waren von Anfang an die Irokesen beteiligt: die Nordgrenze ihres Bereichs war der St.-Lorenz-Strom, westlich reichte ihr Gebiet bis an den Ontariosee, den Eriesee, östlich bis New York.
Nach dem Zusammenschluss waren die fünf Stämme oder »Nationen« in einem gemeinsamen Rat vertreten, im Rat der Sachem: »Sachem« als Titel für einen Häuptling, der in diesem Rat Mitglied war. Normalerweise erlosch die »Amtszeit« eines Sachem erst mit seinem Tod. Da bei den Irokesen das Mutterrecht herrschte, wurde sein Nachfolger von der Matrone, vom weiblichen Oberhaupt seines Clans gewählt. Es gab acht Clans bei den Irokesen, jeweils gekennzeichnet durch ein Totemtier: der Wolf, die Schildkröte, der Bär, der Reiher, die Sumpfschnepfe, der Habicht, der Biber, der Hirsch.
Die Clanmatrone sprach sich meist mit den Frauen ihres Langhauses, ihrer Sippe, ab, schlug dann öffentlich und offiziell den Nachfolger des verstorbenen Sachem vor: fast immer wurde ihr Vorschlag von Sippe und Rat angenommen. Nach Beendigung der Trauerzeit trat der neue Sachem das Amt seines Vorgängers an, übernahm damit zugleich seinen Namen.
Auch nach der Amtsübernahme blieb das weibliche Oberhaupt eines Clans nicht ohne Einfluss; missbrauchte nach ihrer Meinung der Sachem sein Amt, so konnte sie eine Rüge, eine Verwarnung aussprechen. Nach drei Rügen forderte sie den Rat auf, diesen Sachem abzusetzen – das geschah denn auch in der Regel.
Der gesamte Rat der Sachem versammelte sich meist einmal im Jahr, im Sommer. Er fasste Beschlüsse vor allem über Krieg und Frieden, griff aber nicht ein in Vorgänge innerhalb der Bündnisstämme. Bei Konflikten oder Fehden zweier Stämme konnte der Rat freilich als Schiedsrichter fungieren.
Im Rat der Sachem waren die Stämme jeweils nach ihrer Größe vertreten: die Zahl variierte zwischen 14 und 9. Insgesamt bestand der Rat aus 50 Mitgliedern. Die Staatsbesucher waren also nur vier von fünfzig und hatten nicht mehr Rechte als die Kollegen im Rat. Nach welchen Kriterien hatte man sie ausgewählt?
DIE VIER HÄUPTLINGE werden in einer Kutsche nach London gefahren. Zwischen John und Hendrick eingequetscht Major Pidgeon; er hat die Arme verschränkt, macht ein Nickerchen. Denn was die Indianer durch die Kutschfenster beschauen, das erscheint ihm auch nach längerer Abwesenheit nicht sonderlich attraktiv.
Bei den schlechten Nachrichtenverbindungen jener Zeit war die Landbevölkerung zwischen Portsmouth und London über den Besuch der vier »Indianerkönige« wohl kaum informiert; also werden keine Zuschauer am Straßenrand warten, um zu gaffen, zu winken. Ein geschlossener Wagen wird auf dieser wichtigen Landstraße auch keine Seltenheit sein; also werden die Irokesen in den Dörfern und Weilern Vorgänge sehen, die vom vorbeifahrenden Gefährt kaum gestört oder unterbrochen werden. Etwa: ein Schmied beschlägt ein Pferd; ein Besoffener torkelt umher auf einem Marktplatz; eine Bauernfrau hackt einem Huhn den Kopf ab; ein Kind treibt eine völlig verdreckte Kuh vor sich her; ein Knecht schleppt auf einem Feld einen Steinbrocken zu einer entstehenden Heckenmauer; eine tote Kuh, an der ein Bauer steht, reglos; ein blatternarbiger Bettler, der ein Stück neben der Kutsche herläuft; ein Bauer peitscht einen Knecht aus dem Hof; Frauen, die an einem Bach Wäsche klopfen, rubbeln, walken; Kinder, die auf einem Feld hacken – weil eins von ihnen zu lang zur Kutsche starrt, kriegt es einen Schlag an den Hinterkopf.
SIR CHARLES COTTEREL bereitet den offiziellen Empfang der Staatsgäste in der Hauptstadt vor am Modell eines großen Saales mit festlichem Arrangement von Fahnen, von Repräsentantenfiguren auf dem Podest, von zahlreichen Zuschauerfiguren: Holz oder Zinn, bunt bemalt. Damit will Sir Cotterel dem Gesprächs- und Verhandlungspartner eine »ungefähre Vorstellung vom Gesamtbild vermitteln, das auf die Rothäute einwirken wird«.
Während des Einzugs der Indianerhäuptlinge soll ein Orchester spielen: festliche Ouvertüre. Danach wird der Bürgermeister die Indianer begrüßen, wird freundliche Grüße der Königin übermitteln, ihre Einladung zu einer Audienz, deren Termin noch bestimmt werden soll. In der Zwischenzeit, so wird der Bürgermeister hinzufügen, seien sie Gäste der Stadt London. Er wird die Hoffnung aussprechen, dass sie die Stadt und das Land bewundern und lieben lernen.
AUS DEM GRENZKRIEG: der Irokesentrupp arbeitet an einer Befestigungsanlage. Ein Graben wird ausgehoben mit Hacken und Schaufeln; der Boden nass und glitschig; die Arbeitslust der Indianer ist offenbar gering, sie werden von einem englischen Korporal angetrieben, der sich dabei auch mal einen Witz erlaubt: Schräg von hinten nähert er sich einem Indianer, der sich auf einen Schaufelstiel stützt; ein Tritt gegen das Holz, der Indianer kippt beinah in den Matsch; das findet der Korporal zum Totlachen. Auch ein zweiter Soldat, der zur Abwechslung ein bisschen mitschaufelt, kann sich kaum halten vor Lachen. Diese Art Humor geht den Irokesen offenbar ab, sie grinsen nicht mal, arbeiten weiter, zeigen dabei noch weniger Lust und Schwung.
Auch das Einrammen von Palisadenpfählen hinter dem Graben geschieht lustlos, schwunglos: von einem Holzgerüst aus treiben zwei Indianer mit abwechselnden Hammerschlägen einen zugespitzten, geglätteten Stamm in den Boden. Dabei scheint den Engländern ebenfalls Aufmunterung nötig: Ein Korporal schlägt mit dem Gewehrkolben gegen das Gerüst, wenn ihm die Hammerschläge zu lasch werden: Go on!
DIE VIER HÄUPTLINGE betreten ein Gasthofzimmer, geführt von einem Wirt, begleitet von Pidgeon, gefolgt von zwei Burschen mit den Reisebündeln. Musketen, Tomahawks, Bogen, Köcher tragen die Irokesen freilich selbst, stellen und legen sie, auf Anweisung von Pidgeon, in einer Raumecke ab. Der Wirt weist auf die Betten hin, zählt vor, dass es vier sind und dass sie zu viert sind, schlägt vorführend auf ein Kopfkissen, ein Federkissen. Die Indianer schauen ihm zu, ohne zu nicken, ohne über Pidgeon etwas zu erfragen. Sie werden von den Burschen begafft, die zwischen den abgelegten Reisebündeln stehen.
DIE OFFIZIERE Schuyler, Vetch, Nicholson (von den Irokesen Queder, Anadiafia und Anadagarjaux genannt) kamen in London mit diversen Organisationen und Institutionen zusammen, teils aus eigener Initiative, teils durch Einladungen.
Einer der ersten Kontakte ergab sich mit dem Vorstand der Society for the Propagation of the Gospel in Foreign Parts: eine Gründung der Society for Promoting Christian Knowledge; als einer ihrer aktivsten Männer galt Dr.Thomas Bray.
Er und seine Kollegen werden Informationen »aus erster Hand« wünschen über die derzeitige Lage in Nordamerika, besonders im Hinblick auf weitere Missionstätigkeit. So steht beispielsweise Peter Schuyler an einem Tisch, ein Blatt mit Notizen in der Hand, und neben ihm Nicholson, Vetch und rund um den Tisch würdig aussehende Herren vom Vorstand, dazu einige jüngere Männer, denen noch keine Amtswürde den Nacken steift. Und Schuyler betont, es handle sich bei den Auseinandersetzungen im Kern um ein religiöses Problem. Wie allen Anwesenden hier bekannt sei, dürften nach Neufrankreich nur Katholiken einwandern, darauf werde streng geachtet. Damit sei die Rolle der katholischen Kirche in der Nouvelle France schon angedeutet: als staatsbildende und staatserhaltende Macht. Und er berichtet weiterhin Folgendes?
Für das katholische Frankokanada sind die Siedler südlich des St.-Lorenz-Stroms nicht bloß Engländer, sondern primär Protestanten, seien sie nun Anglikaner, Puritaner oder Quäker. So versuchen die meist jesuitischen Missionare, den Machtanspruch, den Machtbereich der katholischen Kirche weiter nach Süden vorzuschieben, dies mit Hilfe der in ihrem Gebiet ansässigen Indianer, systematisch missioniert und gleichzeitig in europäischen Kampftechniken ausgebildet als so genannte Christliche Truppe.
Die Stoßrichtung des katholischen Kanada richtet sich freilich nicht nur südwärts, die Expansion erfolgt vor allem Richtung Westen. Mit dem Pelzhandel, vorangetrieben durch Waldläufer oder Trapper, wird zugleich die Missionierung gefördert. Wobei die Jesuiten zum Teil auch direkt am Pelzhandel beteiligt sind, ebenso am Handel mit Nahrungsmitteln; manche Missionsstelle zugleich als Umschlagplatz für Waren.
Diesen Bericht abschließend, betont der Offizier, dass sich die für England in mehrfacher Hinsicht gefährliche Entwicklung nicht allein durch verstärkte Missionstätigkeit aufhalten lasse. »Wenn Sie die Früchte Ihrer bisherigen Bemühungen sichern wollen, so müssen Sie mit uns auf eine erhöhte militärische Unterstützung vor allem der Neuengland-Kolonien hinarbeiten, bei Hof, bei der Regierung.«
HÄUPTLING HENDRICK VOM WOLFSCLAN steht mit Dolmetscher Pidgeon an einem Ladentisch, auf dem eine Reihe von Tabakspfeifen ausgelegt ist. Er interessiert sich vor allem für Pfeifen mit großem, durch Schnitzarbeit verziertem Kopf: den beklopft er mit dem Zeigefingerknöchel.
Mit seinen Kollegen und zwei Begleitoffizieren besichtigt Hendrick einen Reitstall. Geführt werden sie von einem reich gekleideten Mann. Hendrick geht langsam von Box zu Box, beschaut prüfend die Pferde; dabei legt er mal ein Pferdegebiss frei, schlägt auf Flanken, Nacken, Kruppen, prüft Geschlechtsorgane, macht dies alles wie beiläufig: die Sicherheit dessen, der sich bei Pferden auskennt.
Hendrick in einem Tanzsaal: er lässt sich von einer Frau Tanzschritte beibringen. Natürlich tanzen Paare in ihrer Nähe sehr langsam, wiegen sich fast auf der Stelle, bleiben stehen, denn das wollen sie sehen, genau: wie ein Indianer einen englischen Tanz erlernt, wie er sich dabei anstellt. Und Hendrick erweist sich als gelehrig, findet sich bald hinein in den Tanzschritt, seine Bewegungen freilich noch etwas zu sehr betont. Die Frau scheint mit ihm zufrieden, Verständigung über Mimik und Gestik; weil er so sehr aufpasst, wischt er schon mal Schweiß von der Stirn.
Vor einem künstlichen Baumstamm und einigen zu einem Gebüsch zusammengesteckten Ästen steht Hendrick reglos, in Festkleidung und Festbemalung, seine fast schulterhohe Muskete auf dem Kolben abgesetzt, Hand am Lauf: Er wird gemalt. Einmal greift er, nachdem er kurz dem Maler zugenickt hat, hinter sich: auf einem Holzsäulchen, wohl zu Dekorationen verwendet (etwa, um malerisch den Ellbogen draufzustützen), steht eine Flasche, aus der er einen kräftigen Schluck trinkt; gleich stellt er sie zurück, wird wieder vorbildlich reglos.
Die vier Häuptlinge in einem Bordell; die Offiziere lassen es sich nicht nehmen, ihre Gäste in diesem Fall vollzählig zu begleiten. Die Kunden stehen vor einigen Frauen, auf einem Wartesofa gereiht. Pidgeon redet auf Hendrick ein, schiebt mit raschem Griff einer jungen Frau den Rock hoch: eins der damaligen Strumpfbänder. Hendrick greift gleich zu, zieht dran, und zwar kräftig.
Hendrick auf dem Gasthofbett, im Schneidersitz, er reiht helle und dunkle Holzkügelchen auf eine Schnur, in wechselndem Abstand. Lautlose Lippenbewegungen. Er nimmt eine bereits fertige Knüpfschnur, die neben ihm auf dem Bett liegt, tastet die Entfernung zwischen einigen der Kügelchen ab, lautlose Lippenbewegungen, legt die fertige Schnur wieder aufs Bett, knüpft und reiht weiter.
AUS DEM GRENZKRIEG: der Irokesentrupp umgibt in lockerem Kreis einen Baum, schaut hinauf in die Baumkrone – ein Mann, ein Weißer, sicher ein Franzose, sitzt im Geäst, hebt kurz die Hände, hält sich gleich wieder an Ästen fest, hebt nochmal kurz die Hände, um sich sogleich wieder festzuhalten. Die Indianer finden das offenbar lustig, einige von ihnen lachen, andere rufen etwas zu ihm hinauf, ein Irokese legt mit übertrieben deutlichen Bewegungen seine Muskete auf den Gabelstock, die Lunte brennt, er zielt in die Baumkrone, schießt aber doch nicht. Eine Flasche wird herumgereicht. Einer der Indianer zieht einen Pfeil aus dem Köcher, legt ihn in die Sehne ein, lässt den Schuss los, der Pfeil schnellt dicht am Mann vorbei. Die Indianer lachen ausführlich, winken dem Mann zu, er soll runterkommen, das tut er nicht. Einer der Irokesen schlägt nun mit dem Kolben an den Baumstamm; zwei andere Indianer beginnen sodann mit Kampfbeilen eine Kerbe in den Baum zu schlagen, abwechselnd, in sicherem Arbeitsrhythmus.
Der gefällte Baum: aus der Krone kriecht der Siedler, mühsam, lässt ein Bein nachschleifen. Einige Irokesen gehen auf ihn zu, rufen etwas zu ihm hinab, der Mann kriecht weiter, ein Indianer holt kräftig aus, tritt ihm in den Leib; Indianer und Engländer lachen. Nun stößt ein Irokese dem Verwundeten ein stumpfes Lanzenende in den Rücken, ein Dritter rammt ihm den Kolben zwischen die Rippen. Der Mann bleibt liegen, ein Indianer tritt ihm in den Hintern, der Mann kriecht weiter, wird wieder getreten; nach einem besonders brutalen Kolbenschlag bleibt er liegen, offenbar bewusstlos.
DEN INDIANERHÄUPTLINGEN wird eine gotische Kirche gezeigt. Eine Zeit lang stehen die Irokesen, der erläuternde Pfarrer und Major Pidgeon vor einer liegenden Grabfigur auf Sockel: ein aus Stein gehauener Ritter mit Helm, Kettenpanzer, Schwert und einem Schild, auf dem Embleme eingemeißelt sind. Etoh beugt sich vor, beschaut den Steinkopf im Profil, prüft den Steinhelm. Währenddes Orgelmusik.
Die Häuptlinge sodann hinter und neben dem Organisten. Mit raschen Seitenblicken versucht er die bunt bemalten, exotisch gekleideten Besucher zu mustern, es irritiert ihn hörbar beim Spielen. Die Indianer schauen zu, wie Finger die Tasten berühren, wie durch Druck und Zug Register bedient werden.
Mehr als die Musik interessiert die Indianer das grundierende Arbeitsgeräusch hinter der Orgel. Sie gehen, ermuntert durch den Pfarrer, um die Orgel herum, schauen dem Jungen zu, der sie anstarrt und noch entschiedener die Bälge tritt. Der Pfarrer erläutert, der Bub soll aufhören zu treten, alle hören zu, wie der Orgelklang abstirbt, winselnd. Dann beginnt der Junge wieder zu treten – nach einigen Balgtritten wächst der Pfeifenklang erneut an, die Choralvariationen werden fortgesetzt.
Die Indianer staunen. Etoh will auch mal die Bälge treten, hält sich an der hüfthohen Holzstange fest, tritt im Wechseltakt. Der Bub begafft die Rothäute auf der Orgelempore. Davon wird er wohl noch als alter Mann erzählen: wie mich ein Indianerhäuptling beim Balgtreten ablöste! Etoh tritt immer schneller, sichtlich macht ihm das Spaß, er muss vom Priester gebeten, von Pidgeon aufgefordert werden, das Tempo etwas zurückzunehmen – er tritt langsamer, tritt ganz langsam, tritt gar nicht mehr, horcht mit offnem Mund, wie der Akkord winselnd abstirbt. Kurze Zeit Stille. Er beginnt wieder die Bälge zu treten, anschwellend wächst ein neuer Pfeifenton.
»AUCH IN DER DRITTEN NACHT erscheint der Geist, als Horatio mit auf der Wache ist. Horatio spricht ihn an, aber er antwortet nicht und verschwindet mit dem ersten Hahnenschrei.«
Die vier Irokesenhäuptlinge waren mehrfach im Theater, in der Oper – die Titel der Werke, die man ihnen vorführte, sind zum Teil überliefert. Shakespeares Hamlet beispielsweise gehörte dazu.
»Und alles lebt im Licht seiner Augen, die halbgeöffnet unheimlich blitzen.«
Entsprechen den Absichten der Gastgeber nicht am ehesten Texte aus Schauspielführern und Texte, die Imponiergebärden von Schauspielern beschreiben, und Texte, die selbst Imponiergebärden sind?
»Dieser schlanke Jüngling hat die Schmiegsamkeit einer Schlange und die Sprungkraft eines Panthers. Er steht und gleitet und fällt mit vollkommen prinzlicher Anmut.«
Und Pidgeon flüstert Hendrick etwas ins Ohr, und der nickt? Und Etoh schaut auf einen Punkt weit jenseits der Bühne, auf der sich Dramatisches ereignet? Und Brants Lippen bewegen sich, als würde er an einer Pfeife saugen?
»Und der weitere Verlauf der Rolle gibt dem Darsteller mit blitzartigen Leidenschaftsausbrüchen und aufschreiender Gewissensqual dann Gelegenheit genug, den unvergesslichen Eindruck zu befestigen.«
VOM ST.-LORENZ-STROM AUS errichteten die Frankokanadier westwärts eine Reihe von Forts: Frontenac, Niagara, Detroit, Ste. Marie. Ebenso reihten sie südwärts, mississippiabwärts, Befestigungsanlagen bis an den Golf von Mexiko: Fort Chartres, Fort Ste. Geneviève, Fort St. Louis, Fort Choctaw Bluff, Fort Biloxi.
Das hieß für die englischen Kolonisten: geplante Gebietserweiterungen nach Norden und Westen waren blockiert. Nicht nur das: Ziel der Franzosen war es, die Engländer in den Atlantik abzudrängen.
Die Begleiter der Indianer hatten – als verantwortliche Offiziere des neuenglischen Grenzbereichs – im Vorjahr von der Regierung die Genehmigung erhalten zu einem militärischen Vorstoß nach Kanada; es wurde ihnen Unterstützung durch Flotte und Landetruppen zugesagt. Gemeinsam mit den indianischen Verbündeten marschierten daraufhin Nicholson und Schuyler von der Grenzstadt Albany aus nach Norden; Vetch sollte von Boston aus in einer Flankenbewegung zu ihnen stoßen. So wollten sie auf breiter Front möglichst tief in Kanada eindringen, unterstützt von der Flotte, von Marinetruppen. Aber die Schiffe mit den Marinesoldaten blieben aus. Unter diesen Umständen waren Engländer und Irokesen den französischen Truppen unterlegen, sie mussten sich in ihre Ausgangsstellungen zurückziehen.
Man hatte den Irokesen die Vorstellung vermittelt von einem mächtigen England jenseits des Großen Wassers, einem England, das Frankreich weit überlegen sei – und nun war in entscheidender Situation die Unterstützung ausgeblieben. Das hatte deprimierende Rückwirkungen auf die Indianer, die den Hauptanteil der Angriffstruppe stellten: »Die Franzosen müssen uns jetzt für völlig unfähig halten, gegen sie Krieg zu führen.« Um wenigstens einigen der Häuptlinge zu demonstrieren, dass England nicht bloß ein fernes, schwaches Land ist, das seine Verbündeten im Stich lässt, hatten sich die Offiziere an Staatssekretär Earl of Sunderland gewendet, ihm den Staatsbesuch vorgeschlagen – von ihm war denn auch die offizielle Einladung ergangen.
DIE VIER HÄUPTLINGE vor Guckkasten-Panoramabildern: Soldatenfigürchen aus Blei, Zinn oder Holz, bunt bemalt. Major Pidgeon zeigt mit einem Stab Einzelheiten der figurenreichen Kampfdarstellungen.
Beispielsweise bei einer Kampfszene an einem Fluss, den blaue Gipswellen darstellen, und über dem Fluss eine Pontonbrücke, wie es sie damals schon gab, und auf der Brücke ein Ochsengespann vor einem Karren, vier Ochsen hintereinander, und neben den Ochsen Männer, die Peitschen schwingen, in Metall erstarrt. Hinter dieser noch geordnet wirkenden Gruppe drängt es sich freilich überdicht auf die Brücke, denn von einem in schönster Ordnung aufmarschierenden Truppenkarree in englischen Uniformfarben ist der Zugang zur Brücke fast schon blockiert: wildes Drängeln auf die Pontonbohlen, Soldaten auf Pferden, Soldaten zu Fuß, Soldaten Hals über Kopf, schon werden Flüchtende ins blaue Flusswasser abgedrängt.
Sehr interessieren sich die Indianer auch für eine Enterszene zwischen einem Piratenschiff und einem Handelssegler, der einen üppig vergoldeten Heckspiegel mit Fenstern und sogar einem kleinen Balkon zeigt; am Bug eine ebenfalls vergoldete Galionsfigur. Wieder weist Pidgeon mit einem Stab auf Details hin: das Handelsschiff lässt unter dem Mastkorb eine englische Fahne reglos flattern, das Piratenschiff hingegen mit zwei Fahnen: eine Piratenflagge, schwarz, mit Totenkopf, und eine französische Fahne, das Lilienbanner. Da nicken die Indianer. Vom Zeigestab wird weiter betont, wie sich zahlreiche Piraten an Seilen aus der Takelage hinüberschwingen auf das englische Schiff, doch da weiß man sich offenbar zu wehren, da sind Dolche und Schwerter gezogen, da werden sogar Beidhänder geschwungen, zum Piratenhalbieren, da werden Pistolen und Musketen gezündet, selbst kleine zusätzliche Schiffskanonen auf dem Steuerdeck; etliche Figuren stellen bereits zusammengesunkene Piraten dar, ebenso sind da Gefallene, Verwundete unter den Verteidigern, doch die Zahl der liegenden oder fallenden Piraten übersteigt deutlich die Zahl der fallenden und liegenden Verteidiger.
AUS DEM GRENZKRIEG: der Irokesentrupp geht in sumpfigem, verschilftem Gelände vor, erreicht einen schmalen Wasserarm, über dem ein Baumstamm liegt, der Länge nach halbiert. Die Irokesen gebückt im Schilf, sie halten Ausschau: kein Feind in Sicht. Ein erster Irokese huscht zum Stamm, ein zweiter folgt; am Steg bleiben sie sichernd stehen, auch jetzt nichts Verdächtiges, da erheben sich weitere Irokesen, der erste betritt den Steg. Sobald drei von ihnen auf dem Stamm balancieren, werden sie beschossen: Zwei fallen ins Wasser, einer kann noch ins Wasser springen. Die anderen Irokesen gehen sofort in Deckung, schießen in die Richtung, aus der offenbar geschossen wurde. Der Irokese, der ins Wasser gesprungen war, schwimmt im Kugelschutz des Baumstamms zurück. Der zweite Irokese versucht zu schwimmen, ist aber offenbar verwundet, mühsames Plantschen – ein Indianer lässt sich ins Wasser gleiten, hilft ihm. Dem dritten Irokesen ist sichtlich nicht mehr zu helfen.
DIE HERREN Nicholson, Schuyler, Vetch sitzen in einem Vorzimmer des St.-James-Palastes. Goldstuckatur, Bilder. Vor einer Flügeltür ein Gardesoldat, reglos in strammer Haltung, blanker Säbel an der Schulter: die Anwesenheit von drei Offizieren wird ihm stärker als sonst das Rückgrat steifen.
Von draußen Schritte, der Gardesoldat öffnet einen Türflügel, herein kommt ein ziviler Hofbeamter. »Ihre Majestät bedauern, Sie jetzt nicht empfangen zu können. Die Königin befindet sich zur Zeit in einem schlechten Gesundheitszustand, sie muss auf Anraten ihres Arztes das Bett hüten. Sie werden selbstverständlich anlässlich der Audienz für die Indianerkönige eingeladen.« Nicholson geht zwei Schritt auf den Beamten zu, redet halblaut – damit der Gardesoldat nichts mitkriegt? Er bedankt sich für die Einladung, die schon seit einiger Zeit bestehe. »Bitte betonen Sie, dass uns sehr daran liegt, bereits vor der Audienz empfangen zu werden. Es ist unerlässlich, dass wir Ihrer Majestät zuvor einige vertrauliche Informationen übermitteln. Tragen Sie das Ihrer Majestät noch einmal vor, vielleicht ist wenigstens eine ganz kurze Besprechung möglich.«
Der Hofbeamte, der solche Aufforderungen sicher schon oft gehört hat, zeigt ein regloses Gesicht: Es sei leider nicht möglich, dieser Bitte nachzukommen, das Befinden Ihrer Majestät lasse zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch ein kurzes Gespräch nicht zu. Die Herren könnten jedoch sicher sein, dass sie rechtzeitig über einen Termin in Kenntnis gesetzt würden.
ETOH BETRITT DIE KÜCHE des Gasthofs, in dem die Häuptlinge wohnen; der Koch und sein Gehilfe unterbrechen die Arbeit, starren ihn an. Etoh geht zum Herd, schaut in Töpfe und Pfannen, nimmt als Kostprobe einen Fleischbatzen, kaut erst prüfend, dann entschieden. Dem Gehilfen, der in seiner Nähe steht, ihn anglotzend, wirft Etoh ein Stück Fleisch zu, das muss er schnappen. Der Indianer lacht.
Etoh vor einer Laterna magica, deren Bildscheibe ein älterer Mann dreht: Lichtflickern im bemalten Indianergesicht. Etoh sieht eine Figur, die sich bewegt. Wiederholt will der Irokese den Bewegungsablauf dieser Figur sehen. Zwischendurch betrachtet er, sich aufrichtend, das Gerät, mustert es vor allem dort, wo die bewegte Figur zu sehen ist, schaut wieder in das Gerät hinein, kann sich offenbar nicht sattsehen an den Bewegungen der Figur.
In einem schmalen Gang des Gasthofs begegnet Etoh einem Zimmermädchen; es versucht, seitwärts auszuweichen, dieser Fluchtreflex fordert Etoh heraus, er springt auf das Mädchen zu, packt es, presst ihm eine Hand auf den Mund, drückt die nächste Tür auf, schiebt das Mädchen in den Raum.
In einer Schreinerwerkstatt arbeitet Etoh an einem Holzrahmen, gemeinsam mit einem Schreiner, dem er zwischendurch eine Schnapsflasche anbietet. Sobald der Rahmen fertig ist, beginnt Etoh Weinrebenstränge oder Seilstücke parallel aufzulegen, die Endstücke ragen jeweils über den Rahmen hinaus. Er verständigt sich mit dem Schreiner nur gestisch, aber das klappt offenbar; gemeinsam nageln sie Weinrebenstränge oder Seilstücke am Rahmen fest – ein grobes Netz entsteht, zum Fischen im Wildwasser.
Etoh probiert in einem Geschäft Hüte aus, beschaut sich jeweils ausführlich im Spiegel. Pidgeon bequem auf einem Stuhl, zuweilen vermittelnd. Der Ladenbesitzer legt neue Hüte vor, führt sie bei waagrechtem Oberarm und senkrecht hochgerecktem Unterarm auf der Faust vor, in Kopfhöhe. An einer Tür gaffen Lehrlinge. Offenbar gefallen Etoh am besten Hüte mit einer langen, schräg angesetzten Feder: die lässt er, vor dem Spiegel stehend, wippen, beschaut sich dabei von vorn, von der Seite.
Etoh auf einem Tisch, im Schneidersitz, in der linken Hand ein bunt verzierter Holzstab, in der rechten eine Klapper: ausgetrockneter Flaschenkürbis mit Steinen. Den Stab hält er mit steif gestrecktem Arm, die Klapper schüttelt er gleichmäßig. Ab und zu kippt er den Kopf in den Nacken, senkt den Kopf wieder, schüttelt die Klapper.
DIE IROKESEN in originalgetreu rekonstruierter englischer (Erzähl-) Umwelt des Jahres 1710? Beispielsweise als Besucher eines Hahnenkampfs? Und Engländer in der Kleidung jener Zeit, im Kreis die Kampffläche umgebend, den jeweils favorisierten Hahn mit Geschrei anspornend? Nach einem damaligen Bericht musste ein Fremder die Zuschauer eines Hahnenkampfs für glattweg verrückt halten – fast hysterische Parteinahme, gesteigert durch Wettleidenschaft.
Oder die Irokesen als Zuschauer bei einem Pferderennen? Das war im Besucherprogramm zumindest wahrscheinlich. Auch hier: würde originalgetreue Beschreibung nicht fiktiv wirken? Es war zu jener Zeit bei Pferderennen üblich, dass die Zuschauer, oft von weit her angeritten, nicht hinter Barrieren standen, sondern auf ihren Pferden dem Pulk von Rennreitern folgten, jeweils das Pferd anfeuernd, auf das sie gesetzt hatten. Also: vorn die Rennreiter, die gertenschwingend die Pferde antreiben; in dreißig oder fünfzig Yards Abstand die Kavalkade von berittenen Zuschauern, schreiend, sporentretend, winkend, gertenschlagend; und zwischen ihnen, sich nach vorn drängend, die Irokesenhäuptlinge, bunt bemalt, in flatterndem Festumhang, auch sie Gerten schwingend, auch sie schreiend?
»DIE BALLERINA erscheint, tanzt mit rhythmischen, offenen Bewegungen zur Rampe hin, dreht sich graziös und balanciert einen Augenblick lang, da sie auf das Thema wartet, um von neuem zu beginnen. Nun wird ihr Tanz lebendig.«
Den Irokesenhäuptlingen wurden Krankenhäuser, ein Irrenhaus, ein mathematisch-physikalisches Kabinett gezeigt, man führte ihnen Kriegsschiffe, Dockanlagen, eine Parade, Opern, Schauspiele, Konzerte vor und selbstverständlich Ballett.
»Die Tänzerinnen in Gazekostümen mit wundervoll leuchtenden Farben vor einem blauen Vorhang, der dem Raum mit seiner Durchsichtigkeit etwas sehr Weites und etwas sehr Ungewöhnliches gibt.«
Die Irokesenhäuptlinge begleitet diesmal kein Dolmetscher: Bühnenbild, Tanz, Musik sollen direkt auf sie einwirken.
»Die Tänzer machen tiefe Verbeugungen, drehen sich immerfort um die eigene Achse.«
AUS DEM GRENZKRIEG: der Irokesentrupp vor einem Baum, an dem zwei Indianer, gleichfalls Irokesen, hängen, Füße nach oben, Schnittund Schlagspuren an den Oberkörpern, in den Gesichtern.
Die Irokesen schneiden die Leichen ab, legen sie auf den Boden, Gesichter nach unten, kämmen die Toten, schlingen die Haarknoten neu, stecken eigene Federn hinein. Auf Anweisung eines englischen Korporals beginnen zwei der Indianer mit ihren Kriegsbeilen den trocknen Boden aufzuhacken, nicht eben energisch – das mag auch am heißen Wetter liegen. Jedenfalls wischen sich die hackenden Indianer wiederholt über die Stirn, lassen sich abwechseln; die anderen sitzen und liegen im Schatten des Baums. Mit einem Tomahawk, den er sich ausleiht, schlägt ein Engländer einen Ast vom Baum, zerhackt ihn in ein längeres und ein kürzeres Stück.
MAJOR PIDGEON als Gast einer Salonrunde, die Tee trinkt, Gebäck knabbert. Zwischen den Gästen einige Hunde: Pidgeon wirft ihnen Kekse zu, erzählt dabei von seiner Tätigkeit als Dolmetscher – sicher ist er danach gefragt worden. Ja, es wird ihm etwas viel in diesen Tagen und Wochen, vor allem, weil es schwierig ist, stets Entsprechungen zu finden in der Irokesensprache. Einer der Herren erkundigt sich, ob die Rothäute denn noch immer nicht ausreichend Englisch sprechen – sie hätten eigentlich Gelegenheit gehabt, drüben so einiges zu lernen. Pidgeon lockt einen der Hunde an mit vorgehaltenem Keks, krault: Die Indianer lernen drüben vorwiegend militärische Begriffe, außerdem das Fluchen auf Englisch. Das erheitert die Gesellschaft. Pidgeon lässt den Hund nach seinen Fingern schnappen.
Eine Frau will nun wissen, ob die Rothäute (und man sagt in diesem Kreis nur »Rothäute«) hier in London auch mal auf Irokesisch fluchen. Pidgeon grinst, lässt den Hund weiterhin nach seinen Fingern schnappen: Das komme gelegentlich vor. Einer der Herren fordert ihn auf, mal waschecht irokesisch zu fluchen. Aber da winkt Pidgeon ab: Die verehrten Herrschaften könnten ja doch nicht realisieren, was er in dem Fall brüllt, vielleicht wären das gar keine Flüche, sondern Bewunderungsrufe für die Damen. Diese Äußerung finden einige der Damen, zumindest der jüngeren, recht charmant. Das muntert Pidgeon auf: Bewunderung auf Irokesisch, was Frauen betreffe, sei etwas anderes als Bewunderung im englischen Sinne, aber dazu möchte er sich nicht weiter äußern.
Um die erwachte Neugier der Frauen ein wenig zu neutralisieren, stellt einer der Herren die Frage, ob die Rothäute hier in England nicht ihren Wortschatz erweitern könnten? Pidgeon krault einen anderen Hund: Die Rothäute strengen sich in diesem Punkt kaum noch an; die hören gar nicht mehr richtig hin; die warten ab, bis er übersetzt. Und das hat einige Vorteile, fügt er hinzu, weiterkraulend. Welche Vorteile?, will jemand wissen. Der Major lächelt »vielsagend«. Das sagt der Runde nicht genug, er muss ausführlicher werden: Man will den Gästen einen möglichst guten Eindruck von England vermitteln, dabei lässt sich zuweilen durch geeignete Übersetzung nachhelfen. Nun lächeln einige in der Runde, beginnen zu verstehen. Pidgeon, dadurch ermuntert, wird deutlicher: Man müsse den Rothäuten nicht alles unter die Nase reiben; es sei auch schon mal nötig, etwas überhaupt nicht zu übersetzen oder denen irgendwas anderes vorzusetzen. Die Runde zeigt sich amüsiert. Pidgeon resümiert: Er findet es am besten so, dass die Indianer sich auf seine Übersetzung verlassen. Oder wäre etwa wünschenswert, wenn die sich selbständig in London umhören?
HÄUPTLING JOHN wird in den Essraum eines Waisenhauses geführt, von einigen Männern in würdig-dunkler Kleidung; als Dolmetscher diesmal Vetch. Die Kinder in Waisenhauskitteln, gleichförmig auch die Frisuren. So stehen sie aufgereiht, nach Körpergröße abgestuft, von zwei Erziehern flankiert.
John vom Wolfsclan bleibt mit den Begleitern stehen. Er ist frisch bemalt, hält in einer Hand den Bogen, in der andren den Tomahawk. Einer der Erzieher spricht zu den Kindern, die furchtsam und fasziniert den echten Indianerhäuptling in ausgerechnet ihrem Waisenhaus anstarren; sie werden kaum auf allgemeine Ausführungen des Erziehers achten. Dagegen passen sie auf, sobald der Offizier Kleidung und Bemalung des Indianers erläutert, auf die Mokassins zeigend, auf die Gürtelschärpe, auf den Bogen, den der Sachem anhebt, auf den Tomahawk, den er mal schwingen lässt, lustlos. Eins der Kinder könnte dennoch Angst kriegen, zu flennen anfangen – da wird es von einem Erzieher streng zurechtgewiesen. John schaut dieses Kind an ohne begütigendes oder beruhigendes Lächeln.
Er wird nun aufgefordert, einen Indianertanz vorzuführen. Dazu will er Bogen und Tomahawk auf den Boden legen, aber ein Erzieher zieht rasch einen Stuhl heran – in einem ordentlichen Waisenhaus wird nichts auf den Boden gelegt, auch nicht von einem Indianer. Mechanisch führt John einen Tanz vor, bricht ziemlich bald ab, nimmt das Kriegsgerät an sich. Eins der Kinder muss den Stuhl vom Esstisch zurücktragen.
Sobald die Kinder wieder vollzählig in der Reihe stehen, müssen sie – verschreckt vom Indianertanz oder zumindest sehr beeindruckt – dem Gast ein Lied vortragen, müssen sich anschließend an den Tisch stellen, auf dem sich Teller und Näpfe reihen. John wird an die Stirnseite der Tafel geleitet; größere Stühle für die Erwachsenen.
Ein Erzieher spricht ein Gebet, bei dem John ein wenig die Augenlider senkt und brav die Hände faltet. Dann setzen sich die Erwachsenen, nach ihnen die Kinder. Vier Mädchen, die Tischdienst haben, springen sogleich wieder auf, laufen hinaus, kommen mit Kannen zurück und mit Holzplatten, auf denen Kuchen liegen, bereits in Stücke geschnitten – puritanischer Streuselkuchen? Dem Gast aus dem fernen Amerika wird der Trinknapf mit Milch gefüllt, ein zweites Kind legt ihm ein Stück Kuchen auf den Teller; danach wird der Offizier, werden die Erzieher bedient. Die Kinder am Tisch glotzen den bunten Indianer an, der Bogen und Tomahawk hinter sich an die Wand gelehnt hat.
DIE IROKESEN unterschieden sich von einer Vielzahl nordamerikanischer Indianerstämme vor allem dadurch, dass sie vorwiegend sesshaft waren und Ackerbau trieben. Die Felder wurden von Männern urbar gemacht, von Frauen bestellt.
Die Dörfer der Irokesen waren meist von Pfahlzäunen oder Pfahlwällen umgeben. Das Langhaus herrschte vor, mit Ulmenrinde gedeckt; mehrere Familien der gleichen Sippe rückten hier zusammen – da muss es im Winter gequalmt, gestunken, gewimmelt haben. Die Gesellschaftsform der Irokesen ist gelegentlich idealisierend gerühmt worden: keine Polizei, kein Gericht, kein Adel.
Nördlich des St.-Lorenz-Stroms die Algonkin-Indianer: die betrieben nicht Ackerbau, die bauten keine Wehrdörfer, die zogen in Trupps durch ihre Jagdgründe, bewohnten Wigwams: kuppelförmige Holzgestelle, mit Rinde gedeckt oder mit Binsen.
Zwischen diesen gegensätzlichen Stämmen wiederholt Kriege. Die Franzosen verbündeten sich mit den Algonkin, die vorwiegend Gebiete durchstreiften, an denen Frankreich interessiert war.
Die Irokesen wurden erst von Holländern, dann von Engländern aufgefordert, nach Norden zu ziehen und die Algonkin samt Franzosen zu vertreiben. So griffen schon Mitte des siebzehnten Jahrhunderts Irokesentrupps, zum Teil bereits mit Feuerwaffen ausgerüstet, Siedlungen der Neufranzosen an. Die Situation wurde für die Frankokanadier so bedrohlich, dass Truppenverbände eingeschifft werden mussten. Rund tausend französische Soldaten landeten 1665 bei Quebec; zwei Jahre später musste der Irokesenstamm der Mohawk um Frieden bitten. Freilich war damit keine Waffenruhe gesichert: fortgesetzt Übergriffe, Geplänkel, Gefechte.
DIE INDIANERHÄUPTLINGE sitzen mit Samuel Vetch in einem Chocolate House, trinken Kakao, essen Kuchen. Damen und Herren an benachbarten Tischen schauen ihnen fast unaufhörlich zu; gelegentlich gehen Gäste dicht an ihrem Tisch vorbei.
Ein neuer Gast betritt das Chocolate House, ohne die Indianer zu bemerken. Er trägt einen auffällig hohen Hut, den er nun abnimmt; John neigt sich zu Hendrick hinüber, weist flüsternd hin auf das Hutphänomen. Hendrick fängt an zu lachen. Der Mann geht zu einer Hutablage: Hendrick beobachtet das, lacht noch heftiger. John muss den beiden anderen Indianern rasch erklären, was es da zu lachen gibt, gleich lachen sie mit. Gäste merken auf. Der Mann stellt den hohen Hut auf das Ablagebrett, schaut jetzt erst zu den Indianern. Die lachen noch heftiger. Der Mann geht zu einem Tisch, der möglichst weit von den lachenden Indianern entfernt ist.
AUS DEM GRENZKRIEG: der Irokesentrupp läuft auf eine Siedlung zu von drei oder vier Blockhäusern; an einem Mast die Lilienflagge. Einige der Indianer halten ein, schießen: Siedler versuchen, sich in die Häuser zu retten, rennend oder kriechend. Die englischen Begleiter laufen weiter mit ihrem Trupp, aber nicht an der Spitze.
Die Irokesen dringen in die Häuser ein, treiben Frauen und Kinder heraus, einen älteren Mann; offenbar sind die arbeitsfähigen Männer draußen beim Roden oder auf Jagd. Die Bewohner des Weilers werden auf dem Platz zwischen den Häusern zusammengetrieben, dabei stoßen Irokesen mit Kolben zu. Schon legen zwei Indianer den Fahnenmast um, unterstützt von einem Korporal, die Fahne wird zerfetzt. Die Franzosen müssen sich auf den Boden setzen, die Hände heben; ein Irokese hält Wache.
Und es kommen die ersten Plünderer aus den Häusern, bepackt mit Kleidungsstücken, Pelzen, einer größeren Uhr, einem Teppich und eventuell sogar einem Schaukelstuhl.
DIE INTENSITÄT UND DAS AUSMASS der Kampfhandlungen im kanadischen Grenzbereich war weitgehend abhängig vom jeweiligen Verhältnis der europäischen Großmächte Frankreich und England. Krieg von 1689 bis 1697, abgeschlossen durch den Friedensvertrag von Ryswick, es folgten fünf Friedensjahre, dann bereits der nächste, noch größere Krieg: der Spanische Erbfolgekrieg von 1702 bis 1713. Kampf um die europäische Vormachtstellung.
PETER SCHUYLER in einer Kneipe. Es wird hart getrunken und stark geraucht. Der Offizier schwadroniert, beherrscht die Runde. Er bezeichnet die Indianer als Hosenscheißer, Waschlappen, Schlappschwänze; die ließen sich andauernd von den Weibern kujonieren; die hätten das Sagen bei denen; die Weiber würden sogar bestimmen, wer Häuptling wird!
Das kann er nicht begreifen, das will er nicht verstehen. Wer sich so was bieten lässt, ist in seinen Augen eine halbe Portion. Hätte eigentlich nur noch gefehlt, dass so eine Stammes-Oma mitgekommen wäre, so eine Clan-Tante!
Die Runde muss laut und ausführlich lachen. Sobald das Gelächter etwas nachlässt, schwadroniert Schuyler weiter: Die Rothäute taugen nicht mal zur Arbeit! »Wenn die für uns wenigstens auf den Feldern arbeiten würden und Bäume fällen und so, aber mit denen ist überhaupt nichts zu machen in der Beziehung, die können bloß rumlungern und auf Jagd gehn, zum Arbeiten kriegst du die Rothäute nicht ums Verrecken!« Man müsse sich die Arbeitskräfte bereits aus Afrika beschaffen, besonders für Plantagen in südlichen Kolonien, dort würden alle naslang Schiffe anlaufen mit Negersklaven, bloß, weil man die Indianer nicht ans Arbeiten kriege, dieses stinkfaule Gesocks! Wirklich, er kann sie nicht ausstehn, und riechen kann er sie schon gar nicht: »Was meint ihr, was die oft stinken, so in freier Wildbahn! Unsere vier Rothäute, die stecken wir alle paar Tage in den Badezuber, damit die uns nicht alle Chancen versauen mit ihrem Indianergestank. Man kommt sich richtig wie eine Gouvernante vor oder wie ein Kindermädchen. Dass wir denen nicht auch noch den Arsch abwischen müssen, das ist aber schon alles!« Wieder Gelächter, er nickt bestätigend, trinkt noch einen kräftigen Schluck, redet laut in das Gelächter und Gegröle hinein, will die gute Stimmung am Tisch nicht abflauen lassen, sie trägt ihn: Wenn er, wie jetzt, nur normale Gesichter um sich sieht, ohne das Farbgeschmier, das ist eine riesige Erholung für ihn. Aber morgen, da muss er wieder so verdammt höflich zu denen sein, obwohl er sie alle am liebsten stundenlang in den Arsch treten würde und in die roten Eier noch dazu! Erneutes Bier- und Schnapsgelächter. Und das Verrückteste sei: Die Freundschaft mit den Rothäuten kann nicht für alle Ewigkeit sein, es muss unausweichlich zum Krach mit denen kommen, weil Landsleute immer mehr Land brauchen, da müssen die Rothäute eben weichen, ab in die Wälder!
Nun, zum ersten Mal, kann einer der Männer am Tisch eine Frage loswerden: Würden die Rothäute in dem Fall nicht Rache üben, mit Skalpieren und Kastrieren? Schuyler winkt großspurig ab: keine Gefahr in dieser Hinsicht! Bis das aufkocht, haben alle Siedler entsprechende Schusswaffen. Da sollen es die Rothäute mal wagen, wieder aus den Wäldern hervorzukommen, da kriegen die es auf den Pelz gebrannt! Und er berichtet, weiterhin lauthals, dass er diesbezüglich seinen Beitrag leisten will, er hat schon vorgefühlt, voriger Tage, bei einer Firma dieser Branche; er wird sich später selbständig machen, dann zieht er in den Grenzbereichen von Haus zu Hof, verkauft Musketen und Pistolen. Zwar ist in fast jedem Hause bereits eine Schusswaffe, aber die werden ja älter oder gehen kaputt, da bietet er denn neue Waffen an, sind inzwischen auch besser. Außerdem, zwei Musketen pro Haushalt, das wäre schon angemessen, dazu entsprechend Schwarzpulver und Bleikugeln. Wenn er da als ehemaliger Offizier auftrete, so würde man schon kaufen im Hinblick auf die Rothäute.
»DIESE PRUNKVOLLE VERHERRLICHUNG Venedigs stammt von Veronese.«
Die Indianerhäuptlinge in einer Gemäldeausstellung – die private Sammlung eines der Adligen, von denen die Irokesen eingeladen wurden. Der Gastgeber oder sein Hauslehrer vermitteln den Indianern europäisches Kulturgut.
»Für Caravaggio ist das Licht sozusagen die Hauptdarstellerin seiner Malerei; es enthüllt mit scharfen Umrissen die Realität.«
COFFEE UND CHOCOLATE HOUSES als Treffpunkte: die »beau monde« des damaligen London traf sich vor allem in White’s Chocolate House, die konservativen Tories im Cacao Tree Chocolate House, die noch regierenden liberalen Whigs im St. James Coffee House. Bei Schriftstellern und Kritikern war Will’s am Covent Garden in Mode gekommen.
Könnte nicht jemand den Offizieren geraten haben, mit »ihren« Indianern mal in dieses Kaffeehaus zu gehen, dort würden sich eventuell Kontakte ergeben, die eine größere Öffentlichkeitswirkung des Staatsbesuchs ermöglichen?
So betreten die Irokesenhäuptlinge das Kaffeehaus, begleitet diesmal von Nicholson. Alle Tische von kaffeetrinkenden, pfeiferauchenden, kartenspielenden, redenden, lesenden Personen besetzt; nur in einer Ecke, an einem großen Tisch, ist noch ein halbes Dutzend Stühle frei. Die Männer hier nicken den Indianern zu, laden sie gestisch ein, Platz zu nehmen; die Indianer nicken zurück, setzen sich, zwischen ihnen Nicholson. Der stellt die Indianer mit ihren englischen Namen vor, die Häuptlinge selbst nennen ihre Namen in der Irokesensprache. Das könnte einen der Männer am Tisch herausfordern, die Namen nachzusprechen – dabei lächelt er nicht schon im Voraus über die Unmöglichkeit, diese Klangfolgen wiederzugeben, ohne über die Zunge zu stolpern, er probiert es ernsthaft: Yee Neen Ho Ga Prow, Sa Ga Yean Pra Ton. Und die Indianer? Sie hören wohl nicht in der lächelnden Gewissheit zu, dass dieses Bleichgesicht es nie schaffen wird, sie zeigen sich eher hilfsbereit; wenn Namensteile richtig ausgesprochen sind, nicken sie.
Es könnte die Literaten am Tisch (und Kollegen an benachbarten Tischen) als Erstes interessieren, wie sich England in den Augen und Köpfen der Irokesen darstellt. Dabei ist man auf Auskünfte angewiesen, wie sie der Offizier wiedergibt – etwa so: »Hendrick ist ziemlich erstaunt über die Entschiedenheit, mit der hier die Sonntagsruhe eingehalten wird.« Hier könnte zustimmendes Lächeln der Zuhörer einsetzen, vielleicht sogar Gelächter, und man zeigt den Indianern durch Kopfnicken an, dass dies zustimmendes Gelächter ist, bitte nichts falsch verstehen. Nicholson übersetzt weiter, was Hendrick hinzufügt an Einzelheiten: Dass man am englischen Sonntag eigentlich nur spazieren gehen darf, etwa im St. James Park, wo die Londoner denn überaus zahlreich anzutreffen sind, und kaum eine Kutsche fährt am Sonntag und kein Boot auf der Themse, und Spiele sind nicht erlaubt, kein Cricket, kein Fußball, nicht mal Musik darf man machen: John hatte vergangenen Sonntag im Gasthauszimmer ein bisschen getrommelt und gesungen, gleich kam jemand ins Zimmer – Musizieren am Sonntag bei Strafe verboten!
Nun ganz bestimmt Gelächter bei den Literaten, die am Tisch sitzen, an den Tisch herangerückt sind. Ja, die Sonntagsruhe ist vielfach reine Heuchelei; alle Welt weiß, dass Kaufleute den Sonntag für Rechnungslegung und Buchführung nutzen. Übersetzt das Nicholson? Immerhin ist die Kaufmannschaft eine repräsentative Bevölkerungsgruppe des England, von dem sie nur gute Eindrücke mitnehmen sollen. Redet sich Nicholson mit Übersetzungsschwierigkeiten heraus, er sei nicht der eigentliche Dolmetscher, der sei heute verhindert? Oder ist es tatsächlich nicht möglich, einen Begriff wie »Buchführung« in die Sprache der Irokesen zu übertragen, und sei es durch Umschreibung? Wahrscheinlich fasst Nicholson die kritische Bemerkung nur knapp zusammen: Einige Leute würden auch sonntags arbeiten, heimlich.
Um von den Indianern noch mehr zu hören, könnte eine weitere Frage gestellt werden: Was hat die Irokesen in London am meisten erstaunt oder befremdet? Da könnte Etoh von einem Mann am Pranger berichten; war festgekettet an die Mauer eines öffentlichen Gebäudes. Einer der Männer weiß, wen die Indianer gesehen haben: ein Name wird genannt, der den meisten bekannt scheint; eine öffentliche Äußerung wurde bestraft.
Nun können sich die Stellungnahmen im Kreise polarisieren. Einer mag betonen, unter Königin Anna sei endlich die Freiheit der Meinungsäußerung eingeführt, solche Fälle der Anprangerung wären Ausnahmen. Ein anderer Literat weist darauf hin, dass trotz der Pressefreiheit, von der er nur als »Pressefreiheit« spricht, mit hörbaren Anführungsstrichen: dass dennoch Meinungsäußerungen bestraft werden. Und er nennt Fälle, die nachgewiesen sind: Ein Schriftsteller, mehrfach am Pranger, hatte sich schließlich nach Frankreich abgesetzt. Einem Buchhändler, dem man vorwarf, er habe unsittliche Schriften verbreitet, wurden die Ohren abgeschnitten. Das könnte der Literat gestisch verdeutlichen, die Indianer sollen wissen, für welch ein England sie kämpfen: Mit rasch gegriffenem Löffelstiel führt er das Abschneiden von Ohren vor. Was gemeint ist, wird den Indianern sofort klar, nur muss ihnen noch der Grund für das Ohrabschneiden erläutert werden – wird das Nicholson tun? Wenn nicht, so wird er die Indianer schon gar nicht über den folgenden Fall informieren: Ein Schriftsteller, John Tutchin, zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt, wird zusätzlich einmal im Jahr durch jeden Marktflecken von Dorsetshire gepeitscht.
DER SPANISCHE ERBFOLGEKRIEG auch als Kampf um Absatzmärkte, vor allem der Textilindustrie – ungefähr zwei Fünftel des englischen Exports waren Textilprodukte.
Als größter und wichtigster Absatzmarkt: die englischen Kolonien in Nordamerika. Die Eroberung des kalten Kanada als Zusatzwunsch vieler Textilhersteller.
Die Produktion war damals noch nicht industriell zusammengefasst: Man koordinierte Heimwerkstätten, Manufakturen. Also mussten die Irokesen – wollte man sie in dieser Branche von der Bedeutung englischer Güterproduktion, von der Qualität englischer Fertigwaren überzeugen – verschiedene Häuser und Gebäude besichtigen.
Die Arbeit am Spinnrad wurde von Frauen und Kindern ausgeführt; oft setzte man hier schon Kinder ab vier oder fünf Jahren ein. Selbstverständlich mussten auch alte Frauen mitarbeiten, solange sie den Faden halten konnten. Eine Arbeit, die kaum Zeit ließ, aufzuschauen, sich zu strecken: Handbewegungen selbständig geworden, wie losgelöst von den gekrümmten Körpern.
Sobald freilich die Häuptlinge und Dolmetscher Pidgeon den engen und niedrigen Raum solch einer Heimarbeitsstätte betreten, stoppt die Arbeit: Die Kinder vor allem glotzen die fremdartigen Gäste an. Nur eine alte, wahrscheinlich schwerhörige oder vielleicht schon taube Frau hat, auf Rocken und Rad fixiert, nichts bemerkt, sie muss angestupst werden. Geführt werden die Indianer von einem Mann, der opulent gekleidet ist: Manufaktur-Unternehmer Henderson. Die Frau muss den Indianern, die sich zu ihr ans Spinnrad stellen, den Arbeitsvorgang zeigen. Die Vorführung dauert freilich nicht lang – wahrscheinlich kennen die Indianer solche Arbeit schon, haben sie bei englischen Siedlern gesehen. Henderson fordert die Kinder und die alte Frau auf, weiterzumachen. Die Kinder können sich freilich nicht recht auf die Arbeit konzentrieren, blicken mehr zu den Indianern als auf Rocken, Faden, Rad – so müssen sie den Arbeitsvorgang schon mal unterbrechen, den Faden wieder aufnehmen. Dafür werden sie von Henderson gerügt: Pidgeon übersetzt das nicht.
Das Weben wurde von Männern übernommen. Sicher gab es damals schon Räume, in denen zwei bis drei Webstühle standen. Die werden den Indianern gezeigt; dabei müssen die Weber weiterarbeiten: Henderson zeigt das Zusammenführen von Kette und Schuss.
Danach die Besichtigung eines Lagerraums, in dem sich Stoffballen reihen und stapeln. Die Häuptlinge dürfen verschiedene Stoffe befühlen; auch werden Stoffe vor das Licht gehalten. Henderson kommentiert die Webmuster. Um die positive Einstellung der Gäste zu fördern, könnte er ihnen heiße Schokolade bringen lassen.
DIE AMERIKA-OFFIZIERE werden um eine Besprechung mit Herren der Londoner Heeresleitung bitten. Hier sieht man dem Termin gar nicht gern entgegen: Was soll man den Kollegen sagen?
Ein höherer Repräsentant der Heeresleitung, beispielsweise O'Brian, und Adjutant Powell könnten über das bevorstehende Treffen sprechen. Dabei könnte der Adjutant die voraussichtlichen Forderungen der Amerika-Offiziere formulieren; Gelegenheit für seinen Vorgesetzten, sich passende Argumente bereitzulegen.
Die Offiziere werden nach Powells Erwartung das Gespräch mit der Erklärung einleiten, in den Kolonien seien schutzwürdige Interessen des Mutterlandes zu verteidigen. Gleich hier könnte O'Brian emotional reagieren: Den Ausdruck »schutzwürdige Interessen« will er in dem Zusammenhang nicht hören, denn wessen Interessen würden drüben letztlich vertreten? Das seien erstens Interessen von Handelsgesellschaften, die neue Märkte suchen. Das seien zweitens Interessen von heruntergewirtschafteten Politikern, die sich durch Kolonialbesitz wieder aufmöbeln wollen. Das seien drittens Interessen religiöser Chargen verschiedenster Schattierungen. Am deutlichsten aber scheinen ihm die Handelsinteressen. Womöglich ist ihm schon »zu Ohren gekommen«, dass die Amerika-Offiziere Kontakt haben mit der Neu-York-Neuengland-Kaufmannschaft, und da fange die Sache an, alarmierend zu werden! Darauf werde er auch zu sprechen kommen, er werde den Herren in aller Klarheit sagen: »Die englische Armee ist keine Schutztruppe des Außenhandels!«
Im Rollenspiel könnte der Adjutant folgende Antwort der Amerika-Offiziere entwerfen: Die Bevölkerung drüben bestehe nicht nur aus Händlern beziehungsweise aus Personen, die am Handel direkt oder indirekt beteiligt seien; die Armee sei da zum Schutz aller englischen Siedler.
Diese Äußerung könnte die Gegenfrage herauslocken: »Und was sind das für Herrschaften?« Bei einem großen Teil der Auswanderer sei man doch froh, dass man sie quitt ist: vorwiegend Schuldner, Verbrecher, Versager oder auch Leute, die zu Hause Unruhe stifteten, religiös oder politisch. »Hat die Armee vielleicht die Aufgabe, solche Leute zu protegieren?«
Zusätzlich könnte O'Brian darauf hinweisen, dass man sich in diesen Kolonien schon reichlich selbständig aufführt. »Bei jedem neuen Gesetz, bei jeder Regierungsanweisung zeigen die Herrschaften drüben, dass sie sich nicht gern vom Mutterland dreinreden lassen. Warum nun plötzlich diese betonte Abhängigkeit? Wenn schon selbständig, dann bitte auch in Fragen der Verteidigung!«
Wahrscheinlich werden die Offiziere, so entwirft nun Powell, in diesem Punkt darauf hinweisen, dass England Truppen in den nordamerikanischen Kolonien stationiert hat. Und wenn man schon mal militärisch engagiert ist, so muss das in einem Umfang geschehen, dass positive Ergebnisse gewährleistet sind.
Hierzu könnte O'Brian eine Antwort geben, die auf eine (fast schon übliche) Rivalität zwischen Heer und Marine hinweist. Nach seiner Auffassung wird an der jüngsten Niederlage im kanadischen Grenzbereich die Marine schuld sein, »die mal wieder nicht rechtzeitig ihre Schiffe ins Kampfgebiet brachte«. Bei dieser Gelegenheit wird er auch betonen, dass die Marine finanziell weitaus stärker gefördert wird als das Heer – da soll sie für die so förderungswilligen und einflussreichen Herren der Geldwelt und vor allem des Überseehandels bitte auch solche Aufgaben übernehmen!
Dazu Powell: Die Marine wird kaum bereit sein, auf dem Land zu kämpfen; die Hauptlast der Kampftätigkeit wird also letztlich bei den Indianern liegen. Dass die Offiziere die Häuptlinge hergebracht haben, zeigt nach seiner Meinung bereits an, dass ein stärkerer Einsatz der Irokesen vorbereitet wird.
Bezüglich der Staatsbesucher will O'Brian die Amerika-Offiziere unterstützen, schon werde eine Parade vorbereitet. Selbstverständlich werde man generell auch dafür sorgen, dass die Irokesen besser mit Kriegsmaterial ausgerüstet würden. »Aber darüber hinaus – Zurückhaltung, unsererseits.«
Bei der schlechten Ausrüstung und Ausbildung der Irokesen, bei ihren geringen Erfahrungen im Kampf mit regulären Truppenverbänden, so mag Powell nun einwenden, darf man freilich nicht allzu große Hoffnungen auf den Einsatz indianischer Truppen setzen.
Dazu könnte O'Brian (»wir sind ja unter uns«) seine Meinung ohne Verschnörkelung klarlegen: »Was da an Kampfkraft fehlt, muss eben durch die Masse ausgeglichen werden. Es gibt ja, weißgott, genug von diesen Indianern!«
OLD SMOKE BRANT VOM BÄRENCLAN mit Peter Schuyler in einer Kneipe, an der Theke. In drei Gläser, die er aufreiht, lässt er verschiedene Schnapssorten gießen, leert das erste Glas, lässt genussvoll zögernd die Hand zwischen zweitem und drittem Glas pendeln, greift zum dritten Glas, kippt es, trinkt auch gleich das mittlere Glas leer, winkt mit schwungvoller Gebärde den Wirt heran. Der will diesmal zwei Gläschen mit der gleichen Schnapssorte füllen, aber da winkt Brant entschieden ab. Schuyler, auch schon angetrunken, lacht. Wieder lässt Brant die Hand zwischen den gefüllten Gläsern pendeln.
Brant mit einem Mädchen in einer Kammer. Keine Schönheit: aufgeschwemmt, mit pusteliger Haut, schmuddeligem Haar. Brant steht vor ihr, beschaut sie, sein Gesicht reglos; das Mädchen lächelt nicht. Der Indianer hält noch zögernde Distanz, geht um sie herum, nimmt seine Zierdecke ab, wirft sie dem Mädchen um die Schultern, fasst jetzt erst hin, dafür umso entschiedener.
Ein Wettschießen mit einem englischen Korporal: Häuptling Brant zielt kurz auf die Scheibe, schießt, geht beiseite, schüttet Pulver in den Lauf, stopft es fest mit dem Ladestock, spuckt in die hohle Hand eine der Kugeln, die er im Mund aufbewahrt, schaut kurz auf, wenn der Korporal schießt, lässt die Kugel in den Lauf rollen, legt die schwere Waffe auf den Gabelstock, zieht den Abzughebel. Er hat offenbar eine gute Trefferquote, das zeigen Reaktionen der umstehenden Soldaten.
Brant wieder in einer Kneipe, am Tresen, kein Offizier neben ihm; diesmal hat er nur zwei Trinkgefäße vor sich, gleicher Schnaps für beide. Die Mittrinker beobachten den Indianerhäuptling von der Seite, das scheint er nicht zu bemerken. Links von ihm ein angetrunkener Mann, er hat eine Art Lederhelm mit Abplattung auf, mit einem Nackentuch. Der Lastenträger beschaut grinsend den Indianer. Sobald der Wirt die Becher oder Gläser vor dem Häuptling wieder aufgefüllt hat, erlaubt sich der Lastenträger einen Scherz, nimmt eins der Gläser, prostet Brant grinsend zu. Der schlägt ihm sofort das Glas aus der Hand.
Durch einen Wald oder Park schlendert Brant, frühmorgens, er beschaut Bäume, geht um Bäume herum, den Stamm musternd, wählt einen mittelstarken Baum, blickt sich um, sieht niemand, zieht ein Messer, schält einen ungefähr drei Spannen breiten Rindenstreifen ab, ritzt mit der Messerspitze den Umriss eines maskenhaften »falschen Gesichts« ins Holz, beginnt zu schneiden. Schließlich erkennt man große, schräg stehende Augen, eine scharfkantige, bogenförmig vorspringende Nase und fast negroid dicke Lippen.