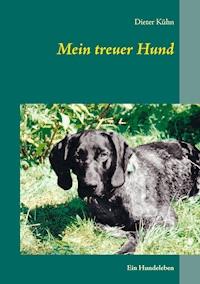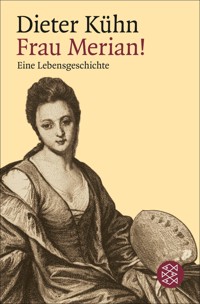6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sieben Erzählungen, die sich wie Variationen über ein Thema lesen: der Mensch und seine Rollen. Während es manchen Menschen gelingt, die Verkleidung fast spielerisch zu wechseln, erträumen sich andere sehnsüchtig ein freieres Leben. Zu letzteren gehört die österreichische Kaiserin: Elisabeth will nicht bleiben, was sie ist, fester Bestandteil des starren Protokolls am Wiener Hof. Charles Deon de Meaumont hingegen ist gezwungen, 49 Jahre seines Lebens als Mann und 34 Jahre als Geneviève zu verbringen. Und während der Maler Georg Friedrich Brandes überrascht feststellen muss, dass selbst seine besten Freunde ihn nicht mehr erkennen, macht Carabu aus Javasu keine Angaben über ihre Herkunft. Doktor Grotkau treibt der Drang nach sexueller Erfüllung, und König Ludwig von Bayern wünscht sich einen vertrauten Diener auf seinen Nachtwanderungen. Einprägsam und in weitem Sprachspektrum erzählt Dieter Kühn vom Wechselspiel der Masken und Rollen, von der Biographie als tragikomischem Spiel.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 286
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Dieter Kühn
Der wilde Gesang der Kaiserin Elisabeth
Erzählungen
Über dieses Buch
Sieben Erzählungen, die sich wie Variationen über ein Thema lesen: der Mensch und seine Rollen. Während es manchen Menschen gelingt, die Verkleidung fast spielerisch zu wechseln, erträumen sich andere sehnsüchtig ein freieres Leben. Zu letzteren gehört die österreichische Kaiserin: Elisabeth will nicht bleiben, was sie ist, fester Bestandteil des starren Protokolls am Wiener Hof. Charles Deon de Meaumont hingegen ist gezwungen, 49 Jahre seines Lebens als Mann und 34 Jahre als Geneviève zu verbringen. Und während der Maler Georg Friedrich Brandes überrascht feststellen muss, dass selbst seine besten Freunde ihn nicht mehr erkennen, macht Carabu aus Javasu keine Angaben über ihre Herkunft. Doktor Grotkau treibt der Drang nach sexueller Erfüllung, und König Ludwig von Bayern wünscht sich einen vertrauten Diener auf seinen Nachtwanderungen. Einprägsam und in weitem Sprachspektrum erzählt Dieter Kühn vom Wechselspiel der Masken und Rollen, von der Biographie als tragikomischem Spiel.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Dieter Kühn, 1935 geboren, lebt heute in Brühl bei Köln. Für seine Biographien, Romane, Erzählungen, Hörspiele und Übertragungen aus dem Mittelhochdeutschen (das ›Mittelalter-Quartett‹) erhielt er den Hermann-Hesse-Preis und den Großen Literaturpreis der Bayerischen Akademie der Schönen Künste. Zu seinen Werken gehören große Biographien (über Clara Schumann, Maria Sibylla Merian, Gertrud Kolmar sowie sein berühmtes Buch über Oswald von Wolkenstein), Romane (›Beethoven und der schwarze Geiger‹, ›Geheimagent Marlowe‹), historisch-biographische Studien (›Schillers Schreibtisch in Buchenwald‹, ›Portraitstudien schwarz auf weiß‹) und Erzählungsbände (›Und der Sultan von Oman‹, ›Ich war Hitlers Schutzengel‹). Zuletzt erschien seine Autobiographie »Das Magische Auge«.
Impressum
Coverabbildung: AKG, Berlin / Erich Lessing
Erschienen bei FISCHER E-Books
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2015
Die Originalausgabe erschien 1982 im S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403416-4
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Carabu aus Javasu
Ein Mann namens Lia
Plötzliche Entfremdung
Die Große Kombinatorische Kunst
Der Himalaya im Wintergarten
Der wilde Gesang der Kaiserin Elisabeth
I
II
III
Die Minute eines Segelfalters
Nachweise
Carabu aus Javasu
Wer bist du? Wie heißt du? Woher kommst du?« Keine Antwort darauf, sonst klappt so was immer, aber nicht bei ihr. Der Bauer wiederholt seine Fragen: »Who are you? What’s your name? Where are you coming from?« Sie nickt nicht, schüttelt nicht den Kopf, hebt nicht die Schultern, schaut den Bauern einfach an, weil er sie fragt, schaut dann zur Bäuerin, die seine Fragen wiederholt, vielleicht klappt es besser von Frau zu Frau: »Wer bist du? Woher kommst du? Wie heißt du?« Auch die Bauersfrau erhält auf ihre Fragen keine Antwort, obwohl das ja nun Fragen sind, auf die man eigentlich stets eine Antwort bekommt. Deshalb wiederholt sie ihre Fragen noch mal, ändert dabei die Reihenfolge, manchmal helfen ja Zufälle weiter: »Wie heißt du, wer bist du, woher kommst du?« Das Mädchen gibt noch immer keine Antwort, steht an der Tür, an die es geklopft hatte, ist nicht groß, aber hält sich grade, wirkt freundlich, wenn auch müde, ist fremdartig, aber sauber gekleidet: dunkles Kleid, Musselinkrause, ein Schal orientalisch um den Kopf, Turban mit Fransen. Die ganze Erscheinung schätzungsweise zwanzig. Sie lächelt anhaltend, versteht auch gemeinsam wiederholte Fragen nicht, kommt demnach von sehr weit her: wer ist sie?
Als nächster versucht es der Armenaufseher von Almondsbury: »Who are you, what’s you name?« Schon nach diesen beiden Fragen merkt er, daß hier mit Englisch in der Tat nichts auszurichten ist: freundlich schaut ihn die Fremde an, aber sie versteht halt nicht. Der Armenaufseher hat mal ein paar Brocken Französisch gelernt, die setzt er nun probeweise zusammen: »Comme vous appelez vous-même? Qu’est-ce que c’est votre nom?« Das bereitet ihm Mühe, klingt gar nicht gut, findet ebenfalls kein Echo bei ihr: was soll er sich da weiter anstrengen? Andere Sprachen kann er nicht, wozu auch?
Der Armenaufseher von Almondsbury informiert Samuel Worrall, Friedensrichter von Almondsbury; der ordnet gleich an, daß die Fremde in sein Haus geführt wird – ein Friedensrichter kriegt auch bei fremdländischen Personen was raus. Außerdem hat er einen griechischen Diener, der kann notfalls herangezogen werden: Griechenland, das ist doch schon halbwegs Orient, oder?
Der Armenaufseher begleitet die Fremde zum Haus des Friedensrichters. Der beguckt sie erst mal: tatsächlich dunkeläugig, tatsächlich dunkles Kleid, tatsächlich dunkler Schal, orientalisch drapiert. Die Einzelteile wirken eigentlich nicht orientalisch, der Gesamteindruck ist es auf geheimnisvolle Weise wiederum doch.
»Wie heißen Sie?« fragt endlich der Friedensrichter die Unbekannte aus dem Orient, läßt eine Pause entstehen, weil Schweigen beeindruckt, stellt die Zusatzfrage: »Wo kommen Sie her?« Er macht seine Aussprache deutlich, spricht langsam: da muß es doch klappen! Sie sagt aber gar nichts, lächelt fremd, geheimnisvoll, irgendwie orientalisch.
Worrall wiederholt seine Fragen, zeigt Geduld, überlegene Ruhe: »What is your name, where are you coming from?« Bei you deutet er auf die Fremde, ohne dabei auf ihre feste Brust zu schauen, an die er gern mal tippen würde. Sie versteht auch mit Fingerzeig nichts, lächelt nur freundlich, mit vollen Lippen, gesunden Zähnen, neigt ein wenig den Kopf; das alles kommt ihr wohl chinesisch vor.
Nun ruft der Friedensrichter den Griechen herein, der versucht es auf griechisch: sie lächelt und schweigt. Ein Versuch auf türkisch: sie schweigt und lächelt. Da muß sie ja aus dem sehr fernen Orient stammen! Wie kommt man von dort nach Almondsbury, Gloucestershire, England?
Die Fremde lächelt stumm, scheint müde: ist bei einem so langen Reiseweg verständlich. Sie müßte ins Bett, aber in welches? Beim Bauern nicht, mit Rücksicht auf seine Frau; beim Armenaufseher nicht, das wäre ein Präzedenzfall; beim Friedensrichter vorerst grundsätzlich nicht. Aber Mister Worrall hat Freunde, die nehmen die Fremde auf.
Auch der Pfarrer von Almondsbury kommt zur Besichtigung der Fremden. Gleich beim Eintritt erzählt man ihm, sie habe, als sie am Vorabend nach vielen gestischen Angeboten endlich doch das Bett der Tochter angenommen habe, vor dem Einschlafen gebetet, wenn auch auf fremdländische Weise; das ermutigt den Pfarrer. Er ist freundlich zur Heidin, die fromm ist, schickt verschiedenartige Sprachsignale aus, aber es kommt keine Antwort: selbst mit seinem Latein ist er rasch am Ende.
Nun schlägt der Pfarrer ein eigens zu diesem Zweck mitgebrachtes illustriertes Reisebuch auf, blättert kegelförmige Hüte und Berge vorbei, Reisfelder, Wasserbüffel, Tempelglocken, Zypressen, Dschunken – endlich reagiert sie auf eine Dschunke.
Aha, sagt der Pfarrer, zeigt ebenfalls auf die Dschunke, zeigt mit gleichem Finger auf die Fremde, macht einen welligen Verbindungsstrich: Mit so einem Boot von China nach England?
Sie reagiert nicht auf diese Frage, zeigt nur auf die Abbildung der Dschunke, nimmt ihre senkrecht gestellten Handflächen schätzungsweise zwölf Zentimeter auseinander, zeigt darauf eine Ausdehnung an von dreißig oder fünfzig Zentimetern, tippt mit dem Zeigefinger auf das Bild, zeigt noch mal runde zwölf Zentimeter an, läßt die Handflächen einen guten halben Meter auseinanderrücken, bis auch der Pfarrer kapiert: sie kam mit einem Boot dieser Bauart, nur in viel größerer Ausführung. Na, das versteht sich: das eine sind dann eben Fluß- oder Küstendschunken, und sie kam mit einer Überseedschunke.
Ob sie damit speziell aus China gekommen ist, scheint nicht ganz klar, eigentümlicherweise reagiert sie nicht auf das Wort China. Eventuell liegt das auch an der englischen Aussprache. Wenn sie nicht direkt aus China kommt, so doch zumindest aus dieser Gegend, soviel dürfte sicher sein.
Wenn man nur schon ihren Namen wüßte! Mit jemandem reden, ohne den Namen zu kennen, da rutscht alles ab. Mrs. Worrall, bei der die Fremde nun wohnt, sie will zeigen, daß eine Frau mit Geduld und List erfolgreicher ist. Sie legt der Fremden aus dem Orient ein Blatt Papier vor und einen Bleistift dazu und sagt: »Write your name, your name please, your name.«
Das löst aber nichts aus. Mrs. Worrall zeigt zur Erklärung auf sich selbst, sagt mit deutlicher Lippenstellung Worrall und noch mal Worrall und zur Sicherheit ein drittes Mal Worrall, schreibt Worrall auf das Papier, zeigt, während sie Buchstaben um Buchstaben nachzieht, mit der linken Hand auf sich selbst, Richtung Brustbein, zeigt danach auf das Geschriebene, sagt Worrall, liest ab Worrall, zeigt mit zurückschnellendem rechten Daumen auf sich, Nähe Brustbein, reicht der Orientalin den Bleistift, schiebt das Papier vor sie hin, deutet auf sie, auf das Papier, auf sie und das Papier, hier soll der Bleistift die Verbindung herstellen.
Aber die Fremde schreibt nicht. Wahrscheinlich, denkt Mrs. Worrall, weil die Leute in China und um China herum eine ganz andere Schrift haben.
Man darf aber annehmen, daß eine Fremde ihren Namen wenigstens aussprechen kann: Mrs. Worrall zeigt mit zurückzuckendem Daumen auf sich und sagt Worrall, das wiederholt sie ein paarmal. Dann zeigt sie auf die Fremde, hebt fragend die Schultern, wiegt fragend den Kopf, zieht fragend die Brauen hoch und hat tatsächlich Erfolg: die Fremde sagt etwas, es klingt wie Carabu. Dabei macht sie eine Handbewegung, die nicht auf ihr Brustbein zurückweist, sondern in den Raum hineinschlenkert, über den Raum hinaus: Carabu. Mrs. Worrall läßt sofort den Zeigefinger vorschnellen, pinnt das Wort Carabu an ihr fest: »Du heißt Carabu, du bist Carabu, du bleibst Carabu.«
Sobald Carabu diesen Namen trägt, kann man sie auch vorstellen. Friedensrichter Worrall und seine Frau nehmen Carabu mit nach Bristol, stellen sie dem Bürgermeister vor: »This is Carabu.« Der Bürgermeister will gleichfalls wissen, wo sie herkommt, aber bei seinen Fragen lächelt sie nur. Also bringt man sie ins Armenhaus; ewig kann man sich ja nun auch nicht mit ihr aufhalten!
Carabu soll es gut haben im Armenhaus, aber eigentümlicherweise wird sie dort nicht recht glücklich: ißt nicht, trinkt nicht, will auf dem Boden schlafen, lächelt überhaupt nicht mehr.
Die Worralls hören das und holen sie reumütig zurück; gleich schaut sie wieder freundlicher drein. Sie darf sich mit Hausarbeit beschäftigen, sonst wird ihr der Tag zu lang. Täglich werden Wortsignale ausgeschickt, aber Carabu antwortet nicht. Mehrfach zeigt man ihr feierabends Landkarten des fernen Orients, sie soll ihren Herkunftsort ankreuzen, so wie man für sie auf einer Englandkarte Almondsbury ankreuzt und das benachbarte Bristol. Aber sie kann offensichtlich nur was mit Bildern anfangen, vor der Karte lächelt sie bloß.
In solcher Lage kann nur ein Portugiese wie Manuel Eynesso weiterhelfen, der zu dieser Zeit in Almondsbury, Gloucestershire, auftaucht, frisch aus der malaiischen Inselwelt; ihn laden die Worralls ein, ihm stellt man Carabu vor. Und sieh mal an: die beiden verstehen sich sofort, fließend reden sie miteinander, keiner der Zuhörer versteht ein Wort. Bei der ersten Unterbrechung läßt man sich vom Portugiesen übersetzen, woher sie kommt: Aus Javasu.
Carabu aus Javasu, das spricht sich leicht aus, klingt recht orientalisch, läßt sich gut merken: Carabu aus Javasu. Endlich Fakten!
Der Portugiese muß weiterfragen.
Carabus Vater ist chinesischer Fürst, die Mutter Malaiin; drei Frauen hat der Fürst noch nebenbei, und auf Reisen wird er in einer Sänfte getragen. Mary Wilcox hat einen Flickschuster zum Vater und eine Schustersfrau als Mutter; der Vater macht keine Reisen, die Mutter schon gar nicht. Carabus Vater trägt an seinem Turban einen Knopf aus purem Gold, dazu rechts drei Pfauenfedern, links eine, das ist nämlich typisch. Weil Mary nicht zur Schule geht, da helfen keine Prügel, kann sie mit sechzehn zur Strafe auch nicht lesen; ihr Vater gibt sie als Magd in Dienst, aber spätestens nach zwei Jahren büchst sie aus und kehrt nach Hause zurück: dafür gibt es reichlich Schelte und Schläge. Carabus Mutter malt sich die Zähne an, insbesondere die Schneidezähne, und zwar schwarz; am rechten Nasenflügel trägt sie einen Edelstein, von dem führt ein goldenes Kettchen hoch zur Stirn, ist dort ebenfalls befestigt. Mary tippelt nach Bristol, soll endlich geregelt arbeiten, verliert unterwegs aber ziemlich die Lust, heult ein Stündchen am Straßenrand, hängt schon mal eine Seilschlinge an einen Ast und wartet auf einen reisenden Gentleman: so jemand durchschneidet bekanntlich den Strick, hinterläßt ein paar Shilling und gute Ratschläge fürs Leben dazu. Carabu trägt in Javasu werktags sieben Pfauenfedern in der Frisur, sonntags zehn, das ist prachtvoll anzusehn. Bristol iss nix, also latscht Mary weiter, Richtung London; dreißig Meilen vor der Hauptstadt wird sie fußkrank, legt sich an den Straßenrand, bis endlich der bekannte mitleidige Fuhrmann vorbeikommt, sie auf den Wagen wirft und in einem Londoner Krankenhaus abliefert. In Javasu lebt man glücklich und zufrieden, aber eines Tages bricht Krieg aus, Kannibalen gegen normale Malaien: auch Carabus Mutter wird im Gefolge der Kampfhandlungen aufgegessen. Drei Jahre lang, mehr oder weniger, arbeitet Mary, die sich seinerzeit im Krankenhaus rasch erholt hatte, in einem Londoner Haushalt: dann wird sie doch mal beim Stibitzen erwischt, fliegt raus, weint bitterlich. In fürstlichen Gärten mit Blumen und Springbrunnen und bunten Vögeln spaziert Carabu, die Halbwaise, begleitet von Dienerinnen; während sie nichtsahnend plaudert, wird sie von hinten gepackt, wird gefesselt, zusätzlich geknebelt und von Piraten fortgeschleppt, samt Dienerinnen. Mary will nicht mehr in London bleiben, möchte nach Hause, zu den zwar rauhen, aber herzlichen Eltern; weil sie schon rausgefunden hat, daß einem alleinreisenden Mädchen auf einer Landstraße bald die Beine gespreizt werden, zieht sie Stiefel, Hose, Jacke, Hut an, räubert ein bißchen als Mann mit zwei Männern herum, setzt sich aber rasch wieder ab: je länger man mit zwei Männern zusammenbleibt, desto eher entdecken sie, daß man Frau ist. Piraten schleppen ihre Opfer in der Regel zu einem nahe liegenden Strand, dort steht ein Boot bereit, unsanft werden die Opfer hineingeworfen, die Piraten rudern los, ein alarmierter Vater rennt meist hinterher, Carabus Vater schwimmt sogar hinterher, schießt auch noch schwimmend einen Pfeil ab, der versehentlich eine der Dienerinnen trifft. Marys Vater, der Flickschuster, und Marys Mutter, Hausfrau, öffnen weit die Münder und schlagen die Hände über den Köpfen zusammen, als Mary unerwartet wieder das Haus betritt: Wie war es in London? Vom Ruderboot hoch ins Piratenschiff; Dschunkensegel, schwarze Fahne, Kanonen; auf Deck löst man Carabu die Fesseln, sofort greift sie zu einem orientalischen Messer, Kris genannt, schwingt es aufblitzend in eine Piratenbrust, sticht dann in den zweiten Piraten, mehr lassen die umstehenden Piraten nicht zu, von einer Bastonade sehen sie aber vorläufig ab: je kleiner die Besatzung, desto größer der Beuteanteil. Wer einmal in London war, kommt in der Regel nach einiger Zeit wieder, auch Mary; sie arbeitet in einem Haushalt, muß putzen, kochen, spülen, auch mal ein Buch kaufen; in der Buchhandlung wird sie von einem Herrn angesprochen, der etwas fremdländisch aussieht, aber Inländer ist und Mary so hübsch findet, wie sie es eigentlich auch ist; er will sie öfter treffen, sie steht zur Verfügung. Piraten neigen dazu, Beute in Geld umzusetzen: nach etlicher Reisezeit wird Carabu an den Kapitän einer Brigg verkauft, einen gewissen Tappa Bu; der ist dunkelhäutig, hat einen langen Zopf und freut sich über Frischfleisch an Bord. Mary Wilcox hört gern zu, wenn Mister Baker – so heißt der Fremde, der sie in der Buchhandlung angesprochen hatte – von seinen Reisen erzählt, vorwiegend in den fernen Orient; die dortigen Sitten und Gebräuche unterscheiden sich nach seiner Darstellung auffällig von englischen Sitten und Gebräuchen: beispielsweise malen sich die Damen dort die Vorderzähne an, stecken sich Herren Pfauenfedern ins Haar, lassen sich in Sänften, in Palankins tragen. Eine Brigg segelt oft wochenlang, ehe sie einen Hafen anläuft, dann ist eine Versorgung mit frischem Wasser und Proviant aber auch dringend nötig: irgendwo an der afrikanischen Küste legt die dschunkenartige Brigg an, und es gehen vier neue Frauen an Bord. Mister Baker probiert Mary erst mal ein paar Monate aus: sie ist freundlich, reinlich, hat volle Lippen und eine stramme Brust, darüber will er länger verfügen, er heiratet sie; nach einiger Zeit findet er den fernen Orient doch wieder interessanter, und er läßt Mary zurück, ohne Geld. Der dunkelhäutige Mann mit dem langen Zopf geht aus purer Langeweile dazu über, die schöne Carabu zu quälen, und zwar auf ziemlich fiese Art. Mary hat von Mister Baker gelernt, daß es jenseits der Meere schöner ist als diesseits, deshalb möchte sie zunächst mal nach Amerika; auf dem Weg von London nach Bristol trifft sie einen Zigeunerclan, schließt sich vorerst an: die Zigeunerfrauen binden sich Schals auf interessante Weise um den Kopf und haben eine Sprache, die kein Engländer versteht – jedes, aber auch wirklich jedes Wort klingt anders. Verständlicherweise will Carabu von Bord, sobald Land in Sicht kommt, sie will sich von Tappa Bu nicht länger zwacken und pitschen lassen: kaum grünt England am Horizont, springt sie heimlich ins Meer und erreicht nach sehr ausdauerndem Schwimmen englischen Boden. Mary muß fünf englische Pfund zahlen, wenn sie auf Zwischendeck nach Amerika reisen will, sie hat keine fünf Pfund, möchte aber unbedingt nach Amerika: da faßt sie einen Plan. Natürlich sind das golddurchwirkte Kleid und der golddurchwirkte Schal klatschnaß, als Carabu endlich in England ist: gern tauscht sie beides gegen das zwar einfache und schwarze, dafür aber trockene Kleid einer Engländerin ein, ebenso den Schal. Mary tauscht in Bristol zur Ausführung ihres Plans ihre hübsche Haube gegen einen Schal ein und bindet ihn turbangleich um den Kopf; ihr Kleid ändert sie ein bißchen an der Halskrause, läuft dann zu Fuß nach Almondsbury, klopft an eine Bauernhaustür und versteht auf Befragen kein Wort.
Beschreib einen Orient, Carabu, der sich kartographisch nicht eingrenzen läßt. Beschreib einen Orient, in dem es warm ist, lässig zugeht: Asia, nicht Asien. Beschreib Gärten mit Gesträuch, das vorwiegend blüht, mit vielfarbigen Vögeln, mit zweiunddreißig Tulpenarten. Beschreib bunte Basare mit Pfauenfedern, Bananen, Teppichen, Krummschwertern, Turbanen, Korallenketten. Erzähl von einem jungen Mann, der am späten Vormittag, an dem in England längst alles busy ist, in einem mit fernöstlichen Motiven reich verzierten Sessel fläzt, einen kleinen, bunten Fächer in der rechten Hand, die schlaff über der Sesselkante herabhängt, ebenso locker die linke Hand, die Beine weit weggestreckt, und ein Fuß wird von einer der ihn umgebenden jungen Frauen in eine handbemalte Porzellanschüssel gehoben, während eine zweite sein Haupthaar bürstet, eine dritte eine Tasse mit Tee oder Kakao anbietet, eine vierte kniend einen Spiegel hält, eine fünfte, die noch kleiner und jünger sein mag, einen Fächer schwenkt, der aus Pfauenfedern besteht, die für den Fernen Osten typisch sind.
Beschreib deshalb möglichst oft Pfauenfedern: Pfauenfedern in den Frisuren junger Frauen; Pfauenfedern an, auf, in den Turbanen der Männer, da schwanken sie oft büschelweise; Pfauenfedern auch an Pferdeköpfen, zwischen den Ohren, die hochgestellt spielen; Pfauenfedern sogar an Elefanten, die im Fernen Osten erstaunlich leichtfüßig rennen können, mit einem Mann obendrauf, der die graue Masse mit kleinen Widerhaken an einem Stock lenkt: Glocken unter dem Elefantenbauch, kleinere Glocken aufgereiht an den Elefantenflanken, Glöckchen sogar um die baumstarken Fußgelenke: das alles betont hörbar eine Geschwindigkeit, wie man sie hier in England bei einem Elefanten wirklich nicht erwarten würde.
Beschreib weiter, zum Beispiel, wie in deinem Orient Mandarine aufgereiht sitzen, in knöchellangen seidenen Gewändern und auf den Köpfen spitze, runde Hüte, und sie haben kleine, schüttere Bärte am Kinn und an den Füßen ulkige Schuhe, mit denen man im feuchten England gar nicht zurechtkäme; auch trinken sie absonderlichen grünen Tee, der einem Engländer überhaupt nicht schmecken würde. Solcherart teetrinkend hören sie einem Obermandarin zu, während draußen – hinter Inseln und Landzungen des Meeres, das ein Fenster zeigt – Piraten in den bekannten Dschunken kreuzen, um einige der später heimfahrenden Mandarine abzufangen und abzusahnen. Da könnten sich denn allerlei Abenteuer anschließen, so ein Piratenschiff kann ja in einen fernöstlichen Sturm geraten, Taifun genannt, dem Schiff wird alles abgebrochen, was absteht, das abgewrackte Schiff wird umgekippt, überschwappt, die meisten an Bord versaufen, einer aber findet eine Planke, an der krallt er sich fest, wird irgendwo angeschwemmt, Fortsetzung folgt.
Beschreib nach solchen Abenteuern zur Belohnung wieder junge Frauen, von denen es im fernen Asia wimmelt. Und sie haben gefärbte Schneidezähne, tragen vielfach Pumphosen, an den Knöcheln zugebunden, dazu lackierte Schuhe, auf deren Größe sie sich die Zehen zurechtschneiden oder zurechtbiegen lassen – manche Frauen haben fast schon keine Füße mehr, weil die kleinsten Schuhe am beliebtesten sind; auch wenn englische Leser ihren Frauen den Arsch versohlen würden, wenn die an ihren Füßen mehr als nur die Zehennägel schnitten – beschreib es! Denn in anderer Beziehung wiederum werden Engländern die Frauen aus dem fernen Orient vorbildlich erscheinen: kochen jederzeit Lieblingsgerichte, warten im Schneidersitz auf den Mann, tanzen auf Wunsch äußerst gelenkig und begießen einen nach dem Liebesvollzug ohne Widerworte stundenlang mit heißem Wasser.
Mrs. Worrall hat nach vieljähriger Ehe allen Anlaß, sich zu fragen, ob Männer die Frauen jemals verstehen werden; zunehmend möchte sie das bestreiten im Verhältnis zwischen Ehemann und Ehefrau – wie soll ihr Friedensrichter dann erst einmal andere Frauen verstehen können, insbesondre eine so fremdartige Frau wie Carabu? Mrs. Worrall hat mal gelesen, daß Frauen sich untereinander oft besser verstehen und rascher verständigen, dabei hilft ihnen das besondere Einfühlungsvermögen. Was bekanntlich voraussetzt: Man muß einer anderen Person ähnlich werden, wenn man sie verstehen will. Mrs. Worrall traut sich durchaus zu, daß sie Carabu näherkommt, ihr damit ähnlicher wird. Und daß auf diese Weise, ganz nebenbei, England einen Hauch orientalischer wird. Denn: ist das Geheimnis des Orients nicht zugleich das Geheimnis der Frau und vice versa?
So verschließt sie zuweilen ihr Zimmer und wickelt sich aneinandergebundene Schals turbangleich um den Kopf: wie sieht man die Welt unter einem Turban, wie denkt und fühlt man nun? Alles rund, warm, umschlossen, gepolstert, gedämpft? Sie stellt auch fest, daß man mit einem Turban größer ist, und wer groß ist, schreitet aufrecht, schon werden die gewohnten Räume kleiner, das fällt ihr als erstes auf, auch stehen die Möbel zu eng, lassen nicht genug Platz zum Schreiten.
Deshalb setzt sich Mrs. Worrall mit ihrem homemade Turban auf den Boden, im Schneidersitz: nun fällt ihr auf, daß die Möbel nicht bloß eng stehen, sie sind auch zu hoch. Hat sie nicht mal gelesen oder gehört, daß man im fernen Orient nur niedrige Möbel kennt, spannenhoch zum Beispiel die Tischchen?
Mrs. Worrall will sich nicht lange mit Randerscheinungen aufhalten, will zum Wesentlichen vordringen und von hier aus alle Erscheinungen erschließen: sie nimmt Carabus Haltung beim Abendgebet ein, wiegend im Schneidersitz, die Hände fast wie gewohnt aneinandergelegt. Dabei macht sie folgende Erfahrung: wenn man beim Beten nicht hart kniet und auf die Handspitzen herabschaut, sondern bei weit gewinkelten Oberschenkeln auf dem Gesäß hockt, wiegend, so bleibt das nicht ohne Rückwirkung: recht unaufhaltsam wachsen dem gewohnten Gott Hüften an – gleich steht sie erschrocken auf.
Doch von nun an ist nichts mehr so, wie es vorher war: es genügt ein wolkenloser Tag, und schon bewegen sich Fichtenzweige wie Palmwedel, Schilf wiegt sich wie Bambus, Tauben gurren und Enten quaken fernöstlich. Die Blüten in diesem April 1817 duften insgesamt kräftiger und wachsen üppiger als in den englischen Jahren zuvor.
Setz dich in einer Morgenstunde, die schon weit vom Sonnenaufgang entfernt ist, auf die straßenumrahmte Grasfläche mitten auf einem Platz, der zu dieser Zeit am dichtesten frequentiert ist von Kaleschen und Karren, von Reitern und Fußgängern, sei umhüllt von orientalisch bunten Stoffen, nimm, falls es dir nicht zu unbequem wird, die Haltung des Lotossitzes ein, schau auf ein Fleckchen Gras, und was gelegentlich eine deiner Hände tut, sei höchstens dies: einen Grashalm zupfen, ihn fallen lassen, aber nicht aus angehobener Hand, nur so aus den sich öffnenden Fingern. Einverstanden, Carabu?
Und wenn du mal aufschaust, um wohlig zu spüren, wie sanft entspannt dein Nacken ist, da siehst du nicht unsereins, fahrend, reitend, gehend, tragend, schleppend, redend, du siehst nur Bewegung von rechts nach links durch dein Blickfeld und Bewegung zugleich von links nach rechts und Bewegung querdurch: das hebt sich auf, verwischt sich in deinen Augen, die ebenso lässig wie rund in den Höhlen ruhn.
Dein Tag als sanfte Mulde. Dein Oberkörper gelegentlich wiegend, du pendelst dich ein in deine Zeit: Zeit, nicht schneller als dein Atem, der langsam ist, langsamer wird; Zeit, nicht schneller als dein Herzschlag, der langsam ist, langsamer wird; Zeit, nicht schneller als die sehr runden Vokale, die du vor dich hin summst mit halb geöffneten Lippen: Zeit lassen, viel Zeit lassen für einen Vokal, der sich öffnet, weitet, der sich schließt.
Manchmal, besonders nachts, fragt sich Mrs. Worrall, ob sie nicht tatsächlich mal in den fernen Orient reisen soll. Diese Frage beschleunigt und verlangsamt ihren Herzschlag. Und sie entwickelt ein Motiv, das alles rechtfertigt: als Missionsgehilfin nach China segeln!
Schon sieht sich Mrs. Worrall in einem Missionshaus, das einen fernöstlichen Innenhof hat mit einem kleinen Teich, in dem Bambus, Riedgräser und Seerosen wachsen, auf dem orientalisch buntgefiederte Enten schwimmen, denen sie das Quaken abgewöhnen wird. Viel Personal wartet auf den Wink der erfahrenen englischen Hausfrau, die bald ihre Kleidung den lokalen Gegebenheiten anpaßt, ohne original englische Lebensart aufzugeben: Pumphosen sind wirklich praktisch, und wenn chinesische Schuster nur chinesische Schuhe reparieren können, warum nicht gleich chinesische Schuhe tragen?
Äußerlich rasch orientalisiert, jedoch mit unverwüstlich englischer Nüchternheit, inspiziert Mrs. Worrall Hütten des Dienstpersonals. Auch begleitet sie, da unentbehrlich, den ihr zugeteilten Missionar auf weiteren Reisen, sieht sich umgeben von Bambusstämmen, Reisfeldern, Wasserbüffeln, von kegelförmigen Hüten und Bergen, von langhalmigen Gräsern, blanken Schwertern, gefräßigen Krokodilen, schäumenden Amokläufern.
Der ferne Orient der Mrs. Worrall wird nachts von Stunde zu Stunde bunter: warum sich nicht zum Fest eines Mandarins einladen lassen, schon um die Landessitten besser kennenzulernen? Bei so einem Festessen sind die Gänge zahlreicher als die Finger an zwei Händen, der Tee ist grün, der Schnaps ist warm, die Musik schmeichelnd: gleich schwellen die Lippen der Mrs. Worrall, gleich werden ihre Brüste so groß und fest wie die von Carabu, und wenn sie nach dem Essen vor den Männern tanzt, sieht sie es in seidenen Pluderhosen hochwachsen. Schnell läßt sie das alles wieder runterklappen und gründet reumütig einen Kindergarten für fernöstliche Heidenkinder.
Dennoch: so eine Nacht färbt noch den folgenden Tag ein. An einem nieselnassen englischen Aprilmorgen versteht sie, weshalb Carabu manchmal so fernöstlich geheimnisvoll melancholisch dreinschaut – sind die Farben der Gebäude und Gewächse nicht von jahrhundertealtem Firnis überzogen, erzeugt durch unablässiges Grauwetter? Und wie sacktuchgrob erscheinen ihr die Kleider, die sie trägt: auf eine Haut, die nicht bloß mit biederer englischer Kernseife gewaschen, sondern mit duftenden orientalischen Essenzen gepflegt wird, hergestellt auf Eselsmilchbasis, auf solch eine Haut gehört Seide, die alle Härchen knistern läßt; dieses Prickeln überträgt sich auf das innere Gewebe, schließlich auf die inneren Organe. Nun kann sie verstehen, weshalb der Orient, wie sie mal gelesen hat, eine verjüngende Wirkung ausübt.
Täglich älter hingegen erscheint ihr der Friedensrichter: sie glaubt seine Gelenke knarren zu hören, wenn er morgens aus dem Bett steigt. Und öfter als sonst verläßt sie das Haus: der Hund, den sie an der Leine ausführt, zerrt manchmal als junger, gezähmter Leopard an der Kette.
Friedensrichter Worrall und Gemahlin haben sehr viele Verwandte und Bekannte, seit Prinzessin Carabu aus Javasu bei ihnen wohnt. Aus Bristol reisen die an und aus dem nahen Kurort Bath. Man will die Fremde sehn, ihre orientalische Kleidung, die sie sich inzwischen geschneidert hat, genau wie auf Bildern. Man will ihre Sprache hören, die so rätselhaft klingen soll, und statt eins sagt sie eze, in englischer Aussprache, statt zwei duce, trua statt drei, und das geht so weiter mit tan, zennee, sendee, tam, nunta, berteen, tashman, das heißt zehn.
Vor allem aber will man Carabu tanzen sehn: gibt es im Orient nicht unglaublich gelenkige Tänze zu einer Musik, die einem süß die Plomben aus den Zähnen saugt? Carabu wird gebeten zu tanzen, wenn sich wieder einmal nahe Verwandte, entfernte Verwandte, Bekannte, durch Bekannte vermittelte Unbekannte im Haus des Friedensrichters von Almondsbury, Gloucestershire, versammelt haben; Carabu ist anstellig, freundlich, sie tanzt. Die Musik dazu muß man sich denken: kleine Handtrommeln – als schlüge man mit flachen Händen auf nackte Pobacken – und Saiteninstrumente, deren Schwingungen schamlos laszive Resonanz finden. Carabu tanzt lautlos; unter dem Kleid im orientalischen Schnitt zwei orientalisch üppige Brüste, ihre Lippen halb geöffnet, sinnlich orientalisch, ihre geschwärzten Augenlider klappen orientalisch langsam auf und zu: Carabu tanzt, Carabu aus Javasu tanzt.
Ein Mann namens Lia
Ist er nicht ein entzückends Mädchen?« Ja, da seufzen die Frauen, wenn ihnen das hübsche Kind in hellem Kleid vorgeführt wird, und es macht einen so bezaubernden Knicks und gibt mit so brav gesenktem Blick reihum die Hand, das Händchen, das süße kleine Händchen, und auf Wunsch verteilt es auch Küßchen, mit weichen Lippen. Und die Haut flaumig, die Augen groß, die Haare lockig! Jeder will es mal streicheln, mal kraulen, mal küssen: »Was für ein entzückendes Mädchen, wie heißt es denn?« Heißt ein entzückendes Mädchen etwa Charles? Ein entzückendes Mädchen heißt zum Beispiel Geneviève. Geneviève als entzückender Name für ein entzückendes Mädchen. Da ist Grazie. Da ist vorläufig Keuschheit. Da ist jedenfalls Weiblichkeit. »Geneviève!« ruft es die Mutter. Der Vater ist vielbeschäftigt, er läßt die Frauen das Kind nennen, wie sie wollen: »Von mir aus Geneviève.« Ein Onkel, der nur Geneviève, Geneviève hört, sagt selten: Charles. Wenn die Mutter das Kind einmal anschreit, ihm einen Klaps hintendrauf gibt, da heißt es allerdings auch mal: Charles! Ist das Kind lieb, so ist es die liebe Geneviève.
Soll ein Mädchen mit Mädchen oder mit Jungen spielen? Im Garten in Tonnerre bei Dijon, Burgund, spielen öfter Mädchen als Jungen mit dem Mädchen. Mädchen werden für das Mädchen eingeladen. Je mehr Mädchen für ein Mädchen eingeladen werden, desto weniger Jungen kommen zu dem Mädchen. Höchstens Bekannte oder entfernt Verwandte bringen zum Besuch noch einen Jungen mit. Ist der Junge allein im Garten mit dem Mädchen, so spielen sie gemeinsam. Ist der Junge im Garten mit mehreren Mädchen, so hält der Junge ein bißchen Abstand: Mädchen bleiben gern unter sich, sagen Eltern den Jungen und natürlich den Mädchen, also wollen Mädchen lieber unter sich bleiben und Jungen ebenfalls. So kommt das Kind bald am besten mit Mädchen zurecht.
Etwa siebenjährig sind Mädchen besonders entzückende kleine Mädchen, wenn sie entsprechend angezogen werden. Mit zehn sind sie noch einen Hauch entzückender, und Mädchenkleidung steht ihnen ausnehmend gut; sie spüren das, suchen morgens selbst das Kleidchen aus, das sie anziehen wollen, und eine Mutter hat keinen guten Tag vor sich, wenn das ausgesuchte Kleidchen nicht angezogen werden darf; das weiß jede Mutter, die sich mehrere Kleider für ein Mädchen leisten kann.
Weil das entzückende Kind so entzückende Mädchenkleider trägt, muß es auf einen so entzückenden Mädchennamen wie Geneviève hören. Und weil es auf einen so entzückenden Mädchennamen wie Geneviève hört, muß es entsprechend entzückende Mädchenkleider tragen. Es würde ja einen merkwürdigen Eindruck machen, wenn die Mutter das Kind Besuchern vorführen will, sie ruft: »Charles!« und es kommt ein entzückendes Mädchen in entzückendem Kleid. Das gäbe Anlaß zu Gerede; deshalb muß er prompt auf den Mädchennamen reagieren, muß er Mädchenkleider tragen, die ihm entzückend zu Gesicht stehen, muß er Gäste mit einem entzückenden Knicks begrüßen und nicht mit einer Verbeugung. »Mach mal einen Knicks … Ja, das war schön, mach gleich noch einen Knicks … Wie macht unser Kind einen Knicks? … Das war kein guter Knicks, mach einen schöneren Knicks … Du mußt schöne Knickse machen, ein liebes Mädchen macht schöne Knickse … Bist du ein liebes Mädchen? Bist du unser liebes kleines Mädchen? Dann zeig mal, wie du nachher deinen schönen Knicks machst.« Geneviève sieht, daß Jungen eine kleine Verbeugung machen und die Hand ausstrecken, um die größere Hand etwas zu drücken. Das ist Jungenart. Hingegen Mädchenart ist es, einen Knicks zu machen und die Hand drücken zu lassen. Nach Mädchenart macht er einen Knicks, läßt sich die Hand drücken.
Mädchenhafte Mädchen lieben Mädchenspiele. Geneviève darf beispielsweise nicht Bockspringen: Anlauf, Beine spreizen und rüber! Erstens, wie sähe das aus? Zweitens wäre es auch technisch nicht möglich: das Kleid, der Rock bremsen beim Sprung. Also kein Bockspringen, das paßt nur zu Jungen. Mädchen spielen lieber mit Puppen. Dauernd kriegen sie Puppen geschenkt, dauernd spielen sie mit Puppen, und wenn sie mal nicht mit den Puppen spielen, sagen die Mütter, die Tanten, die Schwestern: »Nun spielt doch mal mit euren Puppen!« Also findet er es ganz selbstverständlich, daß man mit Puppen spielt, wenn man Geneviève heißt und Mädchenkleider trägt. Und wenn man schon so sichtbar Mädchen ist, muß man sich auch in jeder Hinsicht wie ein Mädchen aufführen. Beispielsweise keine zu weiten Schritte machen: kleinere und zartere Gehbewegungen unterscheiden ein Mädchen vom Jungen. Und nicht eine Hand in die Tasche stecken oder nachäffend in eine Rockfalte. In mädchenhafter Weise müssen sich Mädchen bewegen und verhalten: wie man das macht, lernen sie von den Müttern.
Damit Geneviève selbst dann Geneviève bleibt, wenn es mal sehr eilig wird, übt eine Mutter auch den Notfall ein: Nicht hinstellen, einen Schnibbel rausholen und lospladdern! Es wird dafür Sorge getragen, daß Geneviève solche Möglichkeiten gar nicht erst zu sehen bekommt, etwa bei Jungen auf Besuch im Garten: in diesem Fall sofort abwenden! Und falls es dich draußen mal überraschen sollte, unbedingt in die Hocke gehn: dann sind Rock oder Röcke ausgebreitet wie eine Glocke, und in der Mitte, etwas gedämpft, das Pieseln. So machen das die kleinen Mädchen. So macht das unsere Geneviève.
Was für ein entzückendes Mädchen er ist: hört auf den Namen Geneviève wie eine Geneviève, begrüßt Gäste mit einem Knicks wie eine Geneviève, trägt entzückende Mädchenkleider wie eine Geneviève, macht mit anderen Mädchen Mädchenspiele wie eine Geneviève, läßt mädchenhaft Wasser wie eine Geneviève – wenn schon Geneviève, dann auch richtig Geneviève!
Die Gräfin ist eine von etwa hundert Frauen, die sich im Alter rühmen, genau zu wissen, daß Geneviève Deon de Beaumont entgegen allen Gerüchten ein Mann war. Mit Entschiedenheit schließt sie freilich aus, daß hier mehr als zwei oder drei Frauen intime Kenntnisse erwerben und besitzen konnten. Sie selbst freilich – doch davon später.