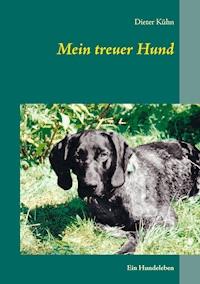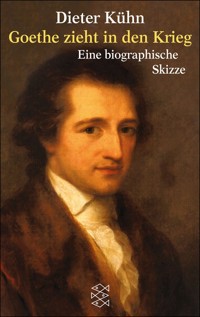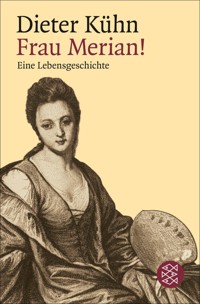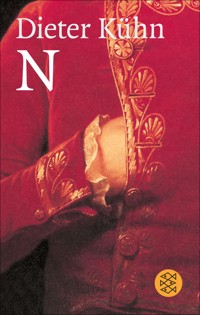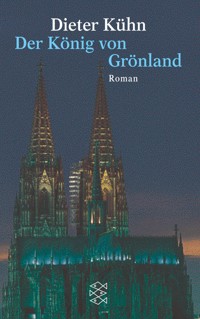
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wolfgang Herkenrath ist ein sympathischer Träumer und zugleich ein nüchterner Realist. Und er hat Großes vor – er will ein Nordlicht zur Kölner Bucht locken. Für sein weiträumiges Projekt »Sky Art« bringt der ehemalige Ausstellungstechniker eines völkerkundlichen Museums die nötigen Voraussetzungen mit: konstruktiven Sachverstand, Beziehung zum Schamanentum und Nachwirkungen eines Kriegsjahres auf einem Wetterschiff vor Grönland. Zudem ist er die Ruhe in Person: Mit seiner Gelassenheit irritiert er seine Frau, erotisiert er die junge Claudia, von der er sich am Kölner Rheinufer zum Walzer auffordern läßt. In Herkenraths innerer Ruhe entfaltet sich auch die künstlerische Vision, die er mit seinen beiden Freunden der »Tunu-Connection« realisieren möchte: das Polarlicht über Köln in der Stunde der Umstellung von Sommerzeit auf Winterzeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 426
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Dieter Kühn
Der König von Grönland
Roman
FISCHER E-Books
Inhalt
Der König von Grönland
Erste rituelle Passage
Die Blechtür wird mit einem Vierkantschlüssel zugesperrt, die Gondel ruckt an, gleitet hinauf zur ersten Zwischenstütze, rasselt, schaukelt, und schon der Rhein, rechts und links der Zoobrücke, die dem Panoramabild eine breite Mittelachse setzt. Dreibahnig gleitet es heran, westwärts, dreibahnig gleitet es unter der Gondel hervor, ostwärts.
Er läßt den Blick nach links hinausschwingen, zur Mülheimer Hängebrücke, zum Hochhaus der Firma Bayer in Leverkusen, zu den Ausläufern des Bergischen Landes. Die Gondel schwebt über die Zoobrücke hinweg, schon gleißt der Fluß auf: Flimmerpunkte so dicht beisammen, daß eine schwingende Lichtfläche entsteht, gegliedert von gestaffelten Bugwellen eines Güterschiffs, dessen Konturen abzuschmelzen scheinen. Je näher die Lichtbahn, Flimmerbahn an die Brücke heranreicht, desto stärker die Auflösung; an den Rändern nur noch einzelne Blitz- und Funkelpunkte, in Zufallsverteilung.
Herkenrath löst den Blick von den Lichtpunkten, schaut südwärts auf den Fluß zwischen dem unbefestigten, flachen Ufer des Rheinparks und dem befestigten Ufer rechts. Weiter hinaus der Dom und Groß St. Martin, die beiden Funkhochhäuser am Raderberggürtel, die Südbrücke. Rechts von ihr, im Stadtbild nicht betont, sein künftiger Tatort. Und vor der Südbrücke die Severinsbrücke und die Deutzer Brücke und die Hohenzollernbrücke: der künftige Aktionsraum. Ja, Aktionsraum Rheinschiene, im Streckenabschnitt Südbrücke/Zoobrücke, eventuell erweitert zur Rodenkirchener Brücke dort im Süden, zur Mülheimer Brücke hier im Norden der Stadt.
Die Gondel hat den Rhein bereits überquert, schwebt über der breiten Zone von Sand und Geröll, schwebt über Wiesenflächen, über Bäumen, Buschgruppen, Blumenbeeten, schon rasselt das Laufwerk der Gondel zwischen den Leitschienen der östlichen Zwischenstütze, er sieht das ausgebrannte Thermalbad mit leeren Becken in dachloser Halle, die umgeben ist von dachlosen Nebenräumen, schon wird das Tragseil nach unten geführt zur Station Rheinpark: die letzten der 935 Meter, schon das halbe Umrunden des mächtigen Antriebsrads, mit kleinem Ruck hält die Gondel an, leicht pendelnd, wird aufgesperrt. Nein, kein Spaziergang im Park, er behauptet, er müsse sofort zurück, habe versehentlich die Herdplatte angelassen, die Suppe könnte verkochen … Er reicht die Rückfahrkarte hinaus. Achselzucken, Türschließen, Schlüsseldrehen.
Die Gondel ruckt an, gleitet hinauf zum Mast; auch diesmal scharfes Rasseln, dann sanftes Pendeln; erneut die Wiesen, die Bäume, die Buschgruppen, die Blumenbeete; erneut die Lichtblitzpunkte und ihre Verdichtung zu scheinbar atmendem Flimmern – er schaut hinein, bis ihm schwarz vor Augen wird. Er schließt sie: in den Hirnraum verteilte Lichtblitzpunkte … wellenförmige Verdichtung im Flimmern … in sich schwingende Lichtfläche, die sich an den Rändern wiederum auflöst in Lichtblitzpunkte, wie abgesprengt von der Flimmerbahn. Was hier auf ein paar hundert Metern konzentriert ist, wird sich, mit ähnlicher Summe der Lichtstärke, in höchster Atmosphäre verteilen als sanftes Schimmern, ruhiges Flimmern: Lichtkaskade, fast reglos – höchstens ein leichtes Wehen im Sonnenwind. Sein weiträumiger Entwurf: Sky Art.
Und wieder: die Augen auf! Nun rechts zu sehen: die Mülheimer Hängebrücke, das Hochhaus in Leverkusen, die erste Hügelkette des Bergischen Landes. Und er blickt zur Hohenzollernbrücke, weiter hinaus zur Deutzer Brücke, noch weiter hinaus zur Severinsbrücke, Südbrücke. ›Seine‹ Südbrücke: Zentrum der geplanten Manifestation.
Schon ist Herkenrath über der Rheinuferstraße, über der schmalen Grünanlage, steil gleitet die Gondel hinunter zum Breitmaul der Station Zoo der Rhein-Seilbahn, wieder das halbe Umrunden des weiten Laufrads, das Abbremsen, das Schüsseldrehen. »Ging aber schnell diesmal …«
Ja, seine Frau kommt gleich zu Besuch, sie hat Kolleginnen der Volkshochschule eingeladen, »da muß ich ein bißchen was vorbereiten …« Und Herkenrath zeigt auf den Vierkantschlüssel in der Faust des Aufsehers: Schade, daß nicht alle Schlüssel so simpel ausgeführt sind …
»Seit wann interessieren Sie sich für Schlüssel?«
»Können Sie sich wohl denken: ich plane einen Einbruch.«
»Hätt ich eigentlich drauf kommen müssen …! Wie wär’s mit zehn Prozent Beteiligung – als Schweigegeld?«
»Mit Prozenten läßt sich in dem Fall nicht rechnen, es geht mehr um ein ideelles Objekt.«
»Aber in Edelmetall?«
»Nein, schwarzer Stein. Aber mit besonderer Wirkungskraft … Ich sage nur: Codewort Tulivkap.«
»Alles klar. Tschüs denn.«
Kleines Winkzeichen, und er verläßt das Stationsgebäude, überquert auf der Fußgängerbrücke die Riehler Straße, geht dicht am Terrarium vorbei neben dem Haupteingang Zoo: Nashornleguane, reglos hingestreckt. Wie auf jedem Hinweg zum Rhein, auf jedem Rückweg zum Leipziger Platz geht er an der Außenmauer der Flora entlang. Auch werbende Hinweise (»Betörende Düfte, verlockende Pflanzen«) können ihn nicht in den Botanischen Garten locken.
Er überquert die in diesem Abschnitt abgesenkte, eingefräste Amsterdamer Straße mit zwei Fahrtrassen, zwei Gleisen, erreicht die Florastraße: Wohnlage ohne Durchgangsverkehr. Zu seiner Rechten ein Kirchenbau der sechziger Jahre, mit kleinen quadratischen Fenstern hoch oben in beinah weißer Klinkermauer. Und der schmale Ausläufer des Nordparks. Und die Erziehungsberatungsstelle der Stadt Köln. Er überquert die Niehler Straße; Fortsetzung der Florastraße. Ein dicker Junge stellt sein Mountainbike quer zwischen einem der geparkten Autos und einer Hauswand.
»Hast du meinen Bruder gesehn, so einen kleinen Furzknoten?«
Den kennt er nicht. Und bitte, er will jetzt weitergehn, hat es eilig, muß Suppe kochen.
»Da mußt du erst ’ne Mark zahlen.«
»Hab ich nicht.«
»Du hast doch Geld. Du verdienst doch gut. Außerdem bist du Single.«
»Woher willst du das wissen?«
»Du kommst doch immer allein hier durch.«
»O.k., da hast du die Mark. Die reicht aber fürs ganze Jahr.«
Die Sperrung wird aufgehoben. Weiter, bis zur Kreuzung mit der Bülowstraße; dort schwenkt er nach rechts ein, geht zum Leipziger Platz.
Grünanlage in geometrischem Grundriß: hochgewachsene Bäume, ausgedünnte Buschgruppen; weite Sandfläche für Kinder; an der Bronzestatue des Generalfeldmarschalls Friedrich Graf Kleist von Nollendorf: Farbproben, aufgesprüht.
Ringsum geschlossene Bauweise: die Hauptfassade des Blücher-Gymnasiums und dreigeschossige Häuser aus der Zeit zwischen Jahrhundertwende und Erstem Weltkrieg: Stuckfassaden mit Backsteingliederung und Backsteinfassaden mit Stuckgliederung und Erker mit Balkonen und Fachwerkgiebel und Zierbalkone und Natursteinsockel – Altbau-Ensemble mit zwischengeschobenen Neubauten, meist aus den sechziger Jahren.
Herkenrath geht auf das Haus zu, in dem er wohnt. Stuckfassade, vier Geschosse. Sein Giebelgeschoß; vom Balkon der Blick herab auf die Grünanlage.
ER RÜHRT DIE FISCHSUPPE im Uhrzeigersinn, zügig gleichmäßig, rührt gegen den Uhrzeigersinn, gleichmäßig zügig. Stimmen aus dem Wohnzimmer. »Aber wenn die demnächst wieder den Etat kürzen … Interessengemeinschaft Kunst … Also, ich hab dem Dezernenten gesagt … Kreatives Freisetzen … Wir kriegen das nur durch, wenn wir in den Fachbereichen simultan …« Rühren im Uhrzeigersinn, zügig gleichmäßig.
Sigrid schaut in die Küche, über den Rand ihrer Lesebrille hinweg, Stirnfalten gebündelt. »Und, was macht die Suppe?«
»Sie braucht noch ein paar Minuten.«
»Du, wir haben Hun-ger!«
Sie zieht den Kopf zurück, wird wieder hörbar im Wohnzimmer. Volkshochschule Nippes: Arbeitstechnik und Rhetorik … »Activate your English« … Rechnungswesen und Existenzgründung … Wirbelsäulengymnastik … Tabellenkalkulation mit Excel … Aber: es soll eine neue Programmakzentuierung angedacht werden. Weil Sigrid für diese Planungsarbeit auch Atmosphärisches wichtig scheint, lud sie ein in die Wohnung am Leipziger Platz: Arbeitsessen. »Wenn du schon nicht Protokoll führen willst, koch uns wenigstens eine Suppe.« Bouillabaisse à la Herkenrath: Süßwasserfische; keine Grönland-Crevetten; Gemüse aus dem Vorgebirge, auf dem Markt gekauft. Rühren, das sich selbständig macht … Selbstvergessenes Rühren …
Sigrid kommt mit einem Aschenbecher, schwenkt den Mülleimer heraus, bückt sich, der schwarzgraue Zopf schwingt vorbei am Ohr, am Clip (Art deco), sie richtet sich auf, schlenkert den Zopf nach hinten; ihr straff zurückgekämmtes Haar. »Die Kolleginnen sitzen bald eine geschlagene Stunde da! Wenn die Suppe so lang braucht, hättest du früher anfangen sollen, statt da herumzugondeln …«
»Ich bin nicht herumgegondelt, ich bin mit der Gondel gefahren. Das gehört zu meinen Vorarbeiten. Dazu gehört übrigens auch das Suppenrühren; es gibt mir innere Ruhe zu kreativen Gedankengängen.«
»Na bravo! Aber wenn du noch ein bißchen schneller rühren würdest – drei Frauenmägen wären dir dankbar.« Und sie geht.
Protokoll der Gesprächsrunde vom 18. Mai 1992. Teilnehmerinnen: Dr. Sigrid Herkenrath, 56, Fachbereichsleiterin für Sonderprogramme Psychologie, Religionswissenschaft, Kulturelle Bildung, Heimat- und Länderkunde, Bildungsprogramm für Mitbürger/innen aus der Türkei; Barbara Thieme, 48, Fachbereichsleiterin für Grundstudienprogramme Mathematik, Naturwissenschaften, Technik, Künstlerisches Gestalten; Heidrun Schäffer, 42, Fachbereichsleiterin für Gesundheitsbildung, Hobby - Freizeit. Begrüßung durch Sigrid Herkenrath. Das Gespräch wurde mit der Frage eröffnet, wie weit eine Neuakzentuierung des künstlerischen Programmanteils innerhalb der –
Sigrid erscheint wieder, reißt eine Schublade auf, holt den Schöpflöffel heraus, erklärt: »Nun muß sie aber fertig sein!«, schreitet mit Kelle und Terrine zum Herd, doch er stellt sich quer: »Laß meine Suppe in Ruhe!«
Mit Entschiedenheit stellt sie die Terrine auf den Tisch, steckt den Schöpflöffel hinein, Porzellanglockenklang. Sie verläßt den Raum.
Und es folgen die köstlichen Minuten, in denen die Suppe in der Tat fertig ist, das beweisen Schlürfproben am Rührlöffel, dennoch rührt er weiter, wie eingefangen in die Bewegung: er ist sicher, daß dieses zusätzliche Rühren den Geschmack der Fischsuppe entscheidend verbessert. Beinah rituell schöpft er dann Bouillabaisse in die Terrine, so gleichmäßig, daß er die innere Ruhe der Suppe nicht stört.
AUFSICHTSDIENST IM »BLAUEN SALON« (hausinterne Bezeichnung). Die Fensterflächen von Holzplatten verschlossen; nicht mal ein schmaler Spalt Tageslicht; die Wände, auch die Decke blau gestrichen; Vitrinen in den Raum gestaffelt; Spotlights. Eckiger Kopf mit geschlossenen Augen und breitem, lächelndem Mund: Khmer-Periode, Mittlere Phase; Sandstein, 42 cm.
Herkenrath auf blauem Plastik-Klappstuhl in der Nähe der Glastür, er blickt hinaus zum Kiosk, in dem Eintrittskarten, Plakate, Kataloge verkauft werden. Aus der Pförtnerloge hört er fast unablässiges Sprechgeräusch. Schauspieler, Schauspielerinnen hinauf zu den Kammerspielen, und Schauspieler, Schauspielerinnen herab von den Kammerspielen in der Beletage. Zuweilen im Treppenhaus die hochgetriebenen Stimmen von Schulklassen; mindestens eine Oktave tiefer die Stimmen von Erwachsenengruppen.
Gegen Mittag keine Bewegung mehr im Treppenhaus; in der Pförtnerloge leckt oder löffelt man Eis; im Verkaufskiosk am Treppenaufgang scheint die alte Frau zu einem Exponat geworden zu sein, erstarrt in der Pose des Addierens.
Kopf mit ovalem Gesicht, breites Stirnband unter dichtem Haar, gerundete, an der Spitze durch flammenartige Strahlen gekrönte Usnisa: Thai-Periode; Bronze, 25 cm. Einer der Köpfe mit den milden Gesichtszügen Meditierender … Köpfe, die gern als »zeitlos« bezeichnet werden, in Vitrinen, die ausgegossen scheinen mit transparenter Zeitmasse. Und Zeit wird für Herkenrath zum Raumwürfel, blau ausgemalt, und er ist von diesem Würfel umschlossen.
»ICH MUSS EBEN WAS NACHSCHAUN«, sagte er zum philippinischen Kollegen, der sich am Blechspind umzieht. Kurzes Nicken; Juan José will warten, gemeinsam werden sie den Museumsbau verlassen.
Herkenrath geht, noch in der dunkelblauen Jacke mit Anstecker, in den Flur, steigt die düstere Treppe hoch in den Verwaltungstrakt, bleibt stehen vor einer Eisentür mit dem Schild: »Kl. Depot 2«. Er schließt auf – Sicherheitsschlüssel, kein zusätzlicher Kreuzschlüssel. Der Lichtschalter; Neonröhren flackern an. Drei Regalreihen; Aluträger mit dunklen Blechflächen, dicht bedeckt mit Objekten. Sofort geht er zum rechten Regal. Nordamerika dominiert in diesem Abschnitt; ein knapper Quadratmeter zusammengeschobener Mokassins, daneben Dutzende von Pfeilen.
Folienrollen am Ende des Gangs; ein Stuhl, ein Karteikasten, diverses Werkzeug. Ein Schildchen »Alaska, Grönland« ans Blech geklebt, doch alle Stücke sind weggeräumt. Das lang geplante Neuordnen und Katalogisieren beginnt also hier, ausgerechnet hier! Zuvor die systematische Reinigung, und es sollen neue Regalböden eingesetzt werden. Die grönländischen Objekte werden solange im Hauptmagazin gelagert sein. Und in ihrer Mitte, bestimmt in ihrer Mitte: der Rabe, Tulivkap; Statuette aus schwarzem Stein, mit langem, richtungweisendem Schnabel; magischer Impulsgeber. Und dieses Objekt ist nun seinem Zugriff entzogen …!
Er geht zur Tür, schaltet das Licht aus, schließt ab. Kl. Depot 2: diesen Raum kann er bei seinen Vorbereitungen aussparen.
DIE PINIE, DIE ZEDER, DIE LINDE in den Kronen dicht zusammengewachsen; vier weiße Bänke unter ihnen, das Holz bekleckert, verklebt von honigreichem Blütenniederschlag. Martin Niemeyer aber nimmt jeweils einen Stadtanzeiger oder eine Rundschau des Vortages mit, breitet Seiten auf der Sitzfläche aus, hängt Seiten aufgespreizt über die Lehne. Auch für Wolfgang ist die Sitzfläche, ist die Rücklehne bereits abgedeckt.
Begrüßung. Zurechtsetzen auf Raschelpapier … Lindenduft, süßlich, vermischt mit dem herberen Harzaroma der Pinie: das mediterrane Klima des Frühsommers 1992. Unter dem sonnendichten Schattendach schaut Herkenrath auf die Rosenrabatten: vibrierendes Rot. Mitten im Platzrechteck ein Schild: Winterdiensthinweise.
»Und, was macht die Kunst?«
Aufsichtsdienst, auch gestern, Spätschicht, während der Theatervorstellung. Nach dem Stillsitzen, Stillhalten wieder ausgleichend rasche Bewegung, er ging zum Bahnhof. Dabei machte er eine Stippvisite in einem Spielsalon – schauen, wie die Kugel läuft … Aber bei den neuen Flippergeräten kann er die wenigsten Anregungen holen: kein Quadratdezimeter, kein Quadratzoll, auf dem nicht irgendwas passiert oder explodiert, und sei es eine Farbe. Man muß sich schon sehr konzentrieren, um dem »pinball« zu folgen, über all die Gesichter, Figuren, Landschaften hinweg – ein Gewimmel, ein Gewusel, in dem sich Effekte wechselseitig neutralisieren, in seinen Augen. Genau dies hat ihn wieder von seiner Konzeption des Eskimo-Flippers überzeugt: weiße Fläche und nur wenige »bumpers«. Er hat sich vorgenommen, demnächst Freund Hennes zu konsultieren: technische und künstlerische Beratung …
Beine ausgestreckt, Arme verschränkt. Die Rosenflächen. Eine alte Frau geht Richtung Neusser Straße, mit Einkaufstasche. Gleißend das Licht, beinah afrikanisch die Temperatur, gelegentlich gemildert durch sanfte Windbewegung: stärker dann das Zedernholzaroma, herber der Piniengeruch, süßlicher der Lindenduft – das alles durchmischt sich. Schwingend, vibrierend die Fläche Rot.
Er richtet den Blick auf Martin: das dichte, weiße, zurückgekämmte Haar, von rotem Bändchen zu handlangem Haarstrang gerafft. Diesen »Pferdeschwanz« trägt Martin mit gleicher Selbstverständlichkeit wie (meist) den hellbraunen, auf Taille geschnittenen Ledermantel, den er sich mal geleistet hatte nach gut dotierten »Mucken«. An diesem warmen Tag freilich: Cordhemd, dunkelgrün; hellgrüne Hose aus leichtem Gewebe.
»Und bei dir – Neuigkeiten aus der Nordstraße?«
Ja, es droht sich eine neue Gewohnheit zu bilden: wenn Gertrud von der Pflegerin gewaschen oder gebadet ist und sie hat die Armgymnastik beendet, sitzt wieder im Rollstuhl, dann möchte sie ihm zuhören beim Üben. Er kann sich bei diesen Tuba-Exerzitien nicht bemogeln, denn Gertrud ist ganz Ohr – es sieht fast so aus, als halte sie den Kopf schief, um konzentrierter zu lauschen. Nach dem Spielen haucht sie ihm die Beurteilung zu, und die ist unbestechlich. In einer Stunde muß er wieder ran! Vorher sollten sie die Gelegenheit nutzen und ihre Mittwochspartie spielen. Frage nur: wo bleibt der dritte Mann? Hat den kürzesten Weg und braucht am längsten …
»Wahrscheinlich hat er verschlafen. Schmeißen wir ihn aus dem Bett!«
Sie falten die Zeitungen zusammen, die klebrigen Flächen nach innen, stecken sie in einen Jutebeutel, schreiten an den Rosenrabatten vorbei Richtung Neusser Straße, biegen ein in die Kamerunstraße. Schon von weitem leuchtet ihnen kobaltblau das Haus des Freundes entgegen – dieses Kobaltblau scheint im beinah afrikanischen Licht zusätzlich an Leuchtkraft gewonnen zu haben. In »wildem Entschluß« hat Johannes das (noch immer zweigeschossige) Haus in der dreistöckigen Reihenbebauung kobaltblau streichen lassen. Über dem flachen Dach (Teerpappe) ist, von der Straße aus, die Antenne an der Spitze des Gittermasts hinter dem Haus zu sehen: als wären dort oben vier elastisch dünne Beine schräg wegragend in die Luft gestützt, um der hohen Luftpeitsche zusätzlich Halt zu geben – Himmelsstippen, Himmelskitzler.
Sie überqueren die Straße vor dem Haus. Das Fassadenblau fast lackartig. Statt Topfpflanzen sind im Erdgeschoß sieben knallgelbe Plastik-Zitronenpressen aufgereiht, zwischen Fensterglas und Gardine – zweites Bekenntnis zur Farbe!
Die beiden Klingeln: Katharina Wolters, Johannes Wolters. Der untere Klingelknopf gedrückt, doch es öffnet Katharina. Über dem Kleid eine rotschwarze Schürze: »Celtic apron«. Das weiße Haar im Pagenschnitt. Kathrin grüßt und wird begrüßt.
»Wo steckt der Hennes? Wir sind zum Skat verabredet.«
Der Hennes mußte zu seinem Bruder fahren, ins Heim, ihn abholen; sie sind jetzt beim Vater in Solingen. Irgendwas soll da mal wieder schieflaufen – die Solinger Heimleitung hat bei den Riehler Heimstätten angerufen. Nun sehen die Brüder nach dem Rechten. Die sind aber garantiert wieder umsonst gefahren – blinder Alarm. Aber Lothar war der Meinung, die Fahrt wäre notwendig; er will keinen Ärger mit dem Alten.
»Kann ich ihm nachfühlen.« Martin hatte kürzlich erst wieder eine Auseinandersetzung mit seiner Schwiegermutter …
»Die ist doch auch schon weit über 90, oder?«
»Ja, 96. Vor einem halben Jahr hat es mal so ausgesehn, als könnte es kritisch werden, aber sie hat sich rasch wieder bekrabbelt. Sie will unbedingt die 100 erleben. Das schafft sie auch …«
»Ja, und nun setzen wir uns wieder in den Schatten und sammeln Energie …« Wolfgang hebt winkend die Hand.
»Wollt ihr nicht vorher einen Kaffee?«
»Danke, wir sind gut abgefüllt … Wir gehn zum Afrikanischen Platz, der Hennes kann ja nachkommen, falls er rechtzeitig zurück ist.«
Tschüs und tschöh.
»Und was war wieder mit der Schwiegermutter? Etwas Ernstes?«
Die üblichen Probleme … Sitzt in ihrem Beethovenstift – Noten, an die Wände gemalt, Noten als Intarsien, Türklinken in Notenform – , sitzt auf diesem Pfundnoten-Sonnenhügel des Vorgebirges und versucht weiterhin, Familiengeschichte zu lenken, redet vor allem auf ihre bald sechzigjährige Tochter ein: als bräuchte es nur ein bißchen guten Willen, und Trude kommt wieder auf die Beine … Sie selbst hat schließlich soundsoviele Anästhesien überstanden und ist, wie Enkelkind Tanja sagen würde, noch »fit wie ’n Turnschuh«. Und singt, umgeben von all den Noten, wiederholt das Loblied auf die Französin Clement, die schätzungsweise 115 ist und immer noch gern Schokolade nascht … Aber das Thema Schwiegermutter will er an diesem Vormittag lieber nicht intonieren, er schlägt vor, einen Umweg über die Nordstraße zu machen, und er holt das Steckschach ab.
IN DER U-BAHNSTATION EBERTPLATZ beobachtet Herkenrath ein Taubstummenpaar, das sich auf zwei Bahnsteigen gegenübersteht, getrennt von den Gleisen, den Säulen, den Werbeflächen, aber sie haben einen Abschnitt mit freiem Durchblick gewählt, verständigen sich in rascher, aber nicht hastiger Folge von Handbewegungen: Finger gestreckt, Finger geknickt, Hand geballt, Hand flach, Fingerkuppen hoch, Finger gestreckt, Hand geballt. Eine offenbar erheiternde Verständigung in einer Welt, in der sie keine Lautsprecherdurchsage erreicht, die einen Zugausfall (wegen Personalmangel) oder eine Verspätung ankündet (wegen Wasserrohrbruch in einem Streckenabschnitt): Herkenrath kann den Blick nicht lösen von der jungen Frau auf seinem Bahnsteig; körperbetonend das Sweatshirt, die Jeans. Eine Bahn fährt drüben ein, aber es ist nicht die Linie für den jungen Mann; sobald der Zug hinausfährt, setzten sie in ihrer lautlosen Doppelwelt den Austausch von Handzeichen fort. Viel zu früh fährt eine Bahn ein für die junge Frau. Sweatshirt und Jeans: der schöne Hintern der Taubstummen. Herkenrath blickt den Rückleuchten nach, schaut auf die Anzeigetafel über dem Bahnsteig; rote Punktschrift leuchtet auf: »Bitte Zugleitschild beachten«.
HALTESTELLE UBIERRING. Beim Aussteigen faßt er unauffällig in die Seitentasche seiner Leinenjacke: ja, links der Kompaß, rechts der Schraubenzieher, der Meißel.
Herkenrath geht nicht auf die klassizistische Fassade des Rautenstrauch-Joest-Museums und der Kammerspiele zu, er quert die kleine Allee in der Gleisschleife der Linie 15; der Gleiskörper als Umgrenzung der Grünanlage an diesem Ende des Rings. Und er geht in die Trajanstraße, schreitet hier unter Platanen, die in der Mitte der Straße eine Allee bilden, Fußgängern vorbehalten, betritt die Titusstraße, wird links vom Park begleitet, geht über den Spielplatz mit jungen Müttern und kleinen Kindern, ist schon im Park, läßt sich vom Bronzeadler auf hoher Säule den Weg weisen, am ehemaligen Fort entlang.
Auf einer der Bänke scheint ein Kaugummiwettfressen stattgefunden zu haben: schmale, alufarbene Folien, bunt bedruckte Papierhüllen. Schwenk um neunzig Grad, wiederum am Fort entlang, und erneut geschwenkt: schon kreuzt er die Gleise der Hafenbahn, in Steinwurfnähe zum westlichen Aufgang der Südbrücke. Der gesamte Weg: von Grün begleitet, von Grün gesäumt, von Grün geschützt – fast ein Meditationsweg, zwischen dem künftigen Tatort und dem Bereich der Manifestation.
Der Eingang ins Treppenhaus des Buntsandsteinturms. Natriumgelb betontes Halbrelief: technische Embleme der Jahrhundertwende und die Frontalansicht eines Rheindampfers auf gleichförmig gewelltem Wasser, mächtig ausladend die Radkästen, dick hochragend der Kamin, fast ein Schlot. Er wird einer der wenigen Brückengänger sein, die das kleine Halbrelief überhaupt beachten, also ist es ein Gruß der Erbauer an Wolfgang Herkenrath – schließlich wird er die Brücke zum Schwerkraftschwerpunkt des Außerordentlichen machen.
Er steigt die Treppe hinauf, erreicht die Brücken-Ebene, hält ein, berührt den Handlauf des Geländers: noch kein Schwingen, Vibrieren. Er schaut auf das breite Heranströmen, sieht die Rodenkirchener Autobahnbrücke, deren Trage- und Hängekonstruktion verdoppelt wird für den europäischen Binnenmarktverkehr.
Und weiter! Auf dem mittleren Abschnitt der Strombrücke bleibt er stehen, unter dem Scheitel des höchsten Bogens, schaut hinunter: das gleichmäßig braune, nun lichtgleißende Heranströmen; Lichtbahnen, Lichtflächen, die sich an den Rändern auflösen in umherzuckende Lichtpunkte. Ein Güterschiff stromaufwärts, ein Güterschiff stromabwärts, eins heißt Credo, das andere Ferntrans, es folgt ein Perseus.
Kleines Vibrieren nun im Brückenmetall, begleitet von obertonreichem Knirschen, und er stellt sich drauf ein, das Schwingen der Brücke zu spüren am Handlauf des Geländers, zu spüren auf der Stahl- und Asphaltfläche, und den Unterleib preßt er an Geländerstäbe. Langsam fährt die Lokomotive des Güterzugs heran, das Knirschen wird stärker, nun rollt die E-Lok an ihm vorbei, es folgt Güterwagen auf Güterwagen auf Güterwagen, zuletzt doppelstöckige Waggons mit fabrikneuen Autos der Firma Ford. Insgesamt ein halbes Hundert Waggons. Dann ein Nachschwingen, wieder von Metallknirschen betont, schließlich wird das Metall ruhig an seinen Händen, unter seinen Füßen, an den Hüftknochen.
Er geht zum nächsten Brückenbogen, schaut wieder auf Schiffe, die sich stromaufwärts schieben, auf Schiffe, die (mit deutlich höheren Rümpfen) leer nach Norden gleiten, VTG-GAS71, Natrona, Floralia. Überwölbter Durchgang zum Mittelturm; eine grün gestrichene Eisentür, Sex-Schmieragen, Telefonnummern. Kein Vibrieren der Brücke beim Gang zum östlichen Ufer. Die Turmstufen hinab, neben der Führungsschiene für Fahrräder; kühlfeuchter Gruftgeruch mit Urinaroma. Aufatmend hinaus auf den Gehweg, ein paar Schritte auf hellen Steinplatten und die Treppe hinauf zum nördlichen Geh- und Radweg. Gruftgeruch, Uringestank, Graffiti. Vom Gehweg aus sieht er den Dom, den Fernsehturm in Ehrenfeld, den Dachaufbau des Fernmeldeamts mit Antennen und Parabolschüsseln, den Bayenturm, die spitzgiebligen Lagerhäuser von Rhenania.
Der Zug, auf den er wartet, er kommt noch nicht. So schaut er wieder hinunter zum Strom, in das Gleiten nordwärts, nun ohne Lichtglitzern, Lichtflimmern, Lichtpunkte. Er schlendert bis zur Mitte der Brücke; ab und zu gleitet ein Radfahrer vorbei. Endlich wieder das vorlaufende Vibrieren, das obertonreiche Knirschen. Und Dröhnen, sobald die Lokomotive an ihm vorbeifährt. Und wieder das Schwingen, registriert von Händen und Füßen, von der Hüfte am Geländer.
Um Schwingzonen und Ruhepunkte der Brücke zu erkunden, geht er zum nächsten Brückenabschnitt: das Vibrieren verstärkt sich. Er kehrt zurück zum vorigen Abschnitt: die Schwingungsamplituden sind hier kürzer, schwächer. Auf dem Pfeiler nur noch schwaches Vibrieren. Und er weiß, er spürt sofort: Hier wird er in der Grönland-Nacht Posten beziehen. Steinpfeiler; die Buntsandstein-Brüstung als Kreissegment. Probeweise legt er die Unterarme auf: kein Nachschwingen, Nachvibrieren des Zugs, den er noch hört.
Er schaut nach rechts, nach links: kein Radfahrer, kein Fußgänger. Er zieht den Kompaß aus der Jackentasche, legt ihn auf die Brüstung, läßt die Nadel nach Norden einpendeln, zieht aus der rechten Tasche den Meißel, legt ihn in die Kompaßrichtung NW, ritzt mit der Schraubenzieherklinge am Meißel entlang eine Linie in den eingedunkelten Sandstein. Hier wird er die Raben-Statuette aufstellen; der Schnabel richtungweisend für die Tulivkap-Linie, deren Ansatz er nun kräftiger nachritzt.
»Sid Ihr he die Bröck am verschängeleere?!« Gleichzeitig mit der Stimme quietschendes Abbremsen – das scharfrandige Geräusch fährt Herkenrath wie ein Messer ins Hirn.
»Ich mach hier ein Hakenkreuz weg!« Und er ist von seiner Antwort selber überrascht.
Der Mann im hellen Grau, hellen Blau schaut mißtrauisch auf das Werkzeug. »Wofür dat dann?« Und schiebt sich an, radelt weg.
Wut, die in Herkenrath hochschießt wie der Strahl einer artesischen Quelle: schon zum zweiten Mal werden Vorbereitungen auf die große Manifestation jäh durchkreuzt! Und sofort die Entscheidung: er wird eine andere Stelle suchen hier auf der Brücke, er darf in der Grönland-Stunde nicht überrumpelt werden, damit würden alle technischen und mentalen Vorbereitungen annulliert.
WOLFGANG HERKENRATH SIEHT, am Rheinhafen auf einem Poller sitzend, einen Schubverband: Pax Mundo, Rotterdam, vor Pax Europa. Es schließen sich an, auf »Talfahrt« wie »Bergfahrt«: Patria, Venus, Korsika, Magnolia. Bei den meisten Schiffen sind, unterhalb des Ruderhauses, technische Angaben aufgemalt: im Schnitt 100 Meter Länge, 10 Meter Breite, durchweg über 1000 Tonnen. Dem Motorgüterschiff Heinz ist längsseits beigekoppelt das kleine Tankschiff Esso61; in dieser »Spargelformation« schiebt Heinz das Bunkerboot rheinaufwärts. Als nächstes: Romanticus mit offenem Laderaum, in dem hintereinander vier Industriekessel liegen, mächtig hochgewölbt. Es folgen Margarete, VAT26, Mezzoforte. Dann: Polaris.
UND SEIN SCHIFF hieß Sachsen. Knapp 43 Meter war es lang, 7,50 Meter breit; 284 Bruttoregistertonnen. Umgebauter, nachgerüsteter Fischdampfer. Rund zwei Dutzend Mann Besatzung; die meisten kamen aus der Hochseefischerei, einige vom Walfang, ein paar von der Handelsmarine, drei von der Kriegsmarine – unter ihnen der achtzehnjährige »Wollie« Herkenrath.
Noch etwa zweihundertfünfzig Seemeilen von Grönland entfernt, sah er Grönland, bevor Grönland zu sehen war. Er schob Wache, stand am Bug, hielt Ausschau nach amerikanischen Flugzeugen – da tauchte in Fahrtrichtung eine Steilküste auf, weitgestreckt, mit Schnee und Eis.
Zuerst wagte er nicht, die Küste auszurufen – mußte eine Täuschung sein … Aber diese Steilküste war so hoch und so weit, daß es nur die östliche Steilküste von Grönland sein konnte. War sie bisher hinter einer riesigen Nebelbank verborgen? Das Bild dieser Küste war noch etwas verwischt, etwas zittrig, als würde eine Bildprojektion scharfgestellt. Ja, und dann stand das Bild, und es war majestätisch: in der Steilküste senkrechte oder diagonale Einschnitte; die Oberkante gezackt wie eine Zinnenmauer – Eiszinnen, Schneezinnen. Und war hinter denen nicht auch, mächtig aufgewölbt, das Inlandeis zu sehen?
Nun schrie er doch, zeigte nach vorn: »Grönland in Sicht, Grönland in Sicht!« Auf der Kommandobrücke tauchte Kapitän Ritter auf, mit dem Ersten Offizier – sie traten hinter der Glasscheibe hervor, gingen auf der Brücke nach Steuerbord, und er schrie noch einmal: »Wir sind da, wir sind bald da, Grönland in Sicht!« Und die Antwort des Kapitäns, die kein Dementi mehr löschen kann: »Jaja, wir sehen.«
Wer nicht Dienst hatte, kam an Deck. Alle sahen – Zeuge neben Zeuge neben Zeuge – die grönländische Küste. Man hatte sich bei den letzten Positionsbestimmungen offenbar verrechnet. Eisbild horizontweiter Stille – auf Deck wurde es ruhig nach dem ersten Erregungsgeschrei, nach den wechselseitigen Bestätigungsrufen, nach den kameradschaftlichen Schlägen auf Schultern und Rücken. In diese Stille hinein sprach der Wissenschaftliche Leiter, von der Brücke herab, und der Kapitän stand neben ihm, als uniformtragende Bestätigung dessen, was Gottfried Weiß sagte: Luftspiegelung, in der Fachliteratur mehrfach bezeugt, die Blicklinie gebrochen wie in einem Prisma, man sieht, was noch unter dem Horizont liegt …
Die Küste sollte ihnen also ausgeredet werden. Aber sie war zu sehen, über dem Horizont, und sie wirkte keineswegs geisterhaft: Steilküste mit zinnenähnlichen Zacken. Er sah Grönland, wie auch immer, er sah Grönland! Ausgerechnet er, Wollie Herkenrath, hatte als erster das auftauchende Grönland gesehen: sein Grönland! Und das Bild dieses Grönland blieb, ließ sich weiterhin betrachten. Auch der Wissenschaftler schwieg, nachdem er seine ersten Stichworte losgeworden war, er schaute, wie der Kapitän, durchs Fernrohr. Damit wurde die Steilküste anerkannt: Männer in Uniform schauen nicht mit Ferngläsern der deutschen Kriegsmarine auf eine nördliche Variante einer Fata Morgana, auf ein Trugbild.
Das Schiff schien mehr Fahrt zu machen – oder war ein Sog von Erwartung entstanden? In der Tat, der Schiffsdiesel war lauter, die Bugwelle höher. Und doch schienen sie nicht voranzukommen: mit jeder Seemeile, die sie fuhren, volle Kraft voraus, schien die Steilküste eine Seemeile zurückzugleiten; es zeigte sich keine vorgelagerte Insel, es öffnete sich keiner der zahlreichen Fjorde. Erst mit der Dämmerung entschwand die Steilküste.
In der Messe hielt Weiß einen improvisierten Vortrag; weitere Stichworte waren ihm eingefallen, oder er hatte in einem der Fachbücher seiner Bordbibliothek nachgeschlagen. Weiß schien sich vor allem an Herkenrath zu wenden, der dieses Geister-Grönland, wie es nun hieß, entdeckt hatte. Nun wurden auf ein Blatt, um das sich alle am Tisch drängelten, Sichtlinien und Brechungen der Sichtlinien gezeichnet, und es wurden die notwendigen Voraussetzungen dieser Manifestation genannt: Ausgedehntes Hochdruckgebiet … Windstille … Luftschichten kalt, Luftschichten warm … Temperaturgradienten … sekundäres Abbild … Stauchung … atmosphärische Linse astigmatisch, Meerfläche leicht konkav …
Zum ersten Skizzenblatt kam bald ein zweites, das Phänomen schien komplex zu sein, viele Faktoren mußten zusammenwirken, damit am Horizont auftauchte, was noch unterhalb des Horizontes lag. Der Wissenschaftler versuchte zu relativieren: Von den Färöer-Inseln aus wurde mehrfach Island gesehen bei solch speziellen Hochdrucklagen, und von Island aus Grönland, von Grönland aus das nördliche Amerika. Und bei der jahrhundertelangen Suche nach der Nordwest-Passage sind wiederholt Inseln entdeckt, Bergzüge beschrieben worden, die spätere Expeditionen vergeblich suchten, und so mußte, was bereits benannt war, von Karten wieder entfernt werden, die Barnard Mountains wie das Crocker-Land, das Petermann-Land, König-Oskar-Land: aufgelöst, verflüchtigt. Nun also Grönland und doch nicht Grönland.
Immerhin besaß dieses Grönland so viel Realität, daß es eine Sonderration Grog gab, auf Anweisung des Kapitäns. Mit Grog im Leib stieg der junge Matrose noch einmal an Deck, doch im Westen war kein Grönland mehr zu sehen, im Mondlicht.
EINE GRÖNLANDKARTE im Maßstab 1:5000000 mit Reißzwecken an der Wand befestigt, auf der Rauhfasertapete; Herkenrath braucht sich am Schreibtisch nur nach links zu drehen, schon hat er die Karte im Blick. Und mit ihr die Balkontür, die Baumkronen über dem Leipziger Platz.
Auf der Karte ist mit rotem Textmarker an der Ostküste die Insel Kuhn hervorgehoben. In der Einleitung des geplanten Vortragszyklus der VHS Nippes wird Herkenrath erwähnen, daß der Osten Grönlands von den Inuit als »tunu«, als Rückseite bezeichnet wird. Hier liegt die Kuhn-Insel in einer besonders schwer zugänglichen Region.
Im Overheadprojektor wird Wolfgang Herkenrath, »Mitarbeiter des Rautenstrauch-Joest-Museums«, einen Kartenausschnitt des Gebietes zeigen: diese Insel (etwa zehn Kilometer breit und dreißig Kilometer lang) ist der Nordostküste nicht vorgelagert, sie liegt in weiter Bucht zwischen den Halbinseln Hochstetter Forland, nördlich, und Wollaston Forland, südlich. Die Nordspitze dieser Insel auf dem 75. Grad nördlicher Breite, die Ostküste auf dem 20. Grad westlicher Länge; die Zeitzone: GMT minus 2.
Und weiter, bereits vornotiert: etwa 200 Kilometer Luftlinie nördlich die Wetterstation Danmarks Havn, knapp 100 Kilometer südlich der Militärstützpunkt Daneborg: Basis der Hundeschlittenabteilung der legendären Sirius-Patrouille.
Tourismus, so wird er gleich im ersten Vortrag betonen, spielt an der (südlichen) Ostküste eine sehr geringe Rolle; im wesentlichen nur Flugexkursionen von Island aus; sie führen meist zum Flughafen Kulusuk, mehr als 1200 Kilometer Luftlinie von der Kuhn-Insel entfernt.
Weiter: diese Insel liegt in der Schutzzone des Nationalparks; dieses Gebiet darf nur mit besonderer Genehmigung grönländischer Behörden bereist werden; solche Genehmigungen werden ausschließlich wissenschaftlichen Expeditionen erteilt.
Das Gebiet im Bereich des 75. Grades nördlicher Breite, so wird er wiederholend betonen, ist vor allem durch Eis geschützt: im Westen das (rasch auf 2000, ja 2500 Meter Höhe ansteigende) Inlandeis, im Osten geht das Landeis in (meist) ganzjähriges Meereis über; jenseits der Inseln die Eisbarriere des Packeisgürtels; östlich davon das »Landwasser«, im Sommer schiffbar in einer Breite von einigen Seemeilen; östlich wiederum der Treibeisgürtel des Nordpolarstroms: ständig driften Eisschollen, Eisfelder, Eisberge südwärts. Wegen dieses bis zu vierzig Kilometern breiten Stroms von »Großeis« ist auch im Sommer für Schiffe eine Annäherung an die Insel äußerst schwierig; bereits ab August kann zudem die Eisbarriere vor der Küste undurchdringlich werden.
Und Herkenrath wird resümieren: Nach der Expedition der Engländer Clavering und Sabine im Jahre 1823 wurden im Nordosten Grönlands keine Bewohner mehr gesichtet; diese Region galt seither als unbewohnt; erst im Sommer 1955 wurde, nach der Entdeckung von Edelstein-Lagerstätten, auf der Kuhn-Insel eine Siedlung gegründet: 38 Inuit, unter ihnen eine Schamanin. Und das wird Herkenrath hervorheben: eine Frau in einer traditionellen Männerrolle. Takuka.
MIT EINEM KÖLSCH, EINEM KORN: Herkenrath. Er fühlt sich umstrudelt von Sätzen, von Satzfragmenten: »Einen Knall in der Schüssel … Der schaukelt doch nur noch seine Eier … Pi mal Arsch … Macht mir den Akkord kaputt … Haut sich den Punch voll … Das bläst den aus den Schuhen …«
Kleines Rumpeln an der Eingangstür, Herkenrath will sich durch das Gedrängel schieben, der Wirt aber winkt ab: »Dat mach ich, Könisch!« Und er verläßt die Zapfhähne, eilt zum Windfang, reißt die Tür auf, Martin schiebt den Rollstuhl herein; seine Frau zeigt, mit schiefgehaltenem Kopf, den Ansatz eines Lächelns. Herkenrath zieht einen Stuhl weg vom reservierten Tisch, der Rollstuhl wird herangeschoben. Die Frau legt langsam den rechten Arm auf die Tischfläche, der linke Arm bleibt auf dem Oberschenkel. Herkenrath reicht Martin die Speisekarte, der hält sie seiner Frau vor Augen. Sie bildet Lippenlaute, Hauchlaute – Martin setzt sie um in eine Bestellung: Riesling, wie immer, ein Achtel, und diesmal Krabbenomelette. Der Wirt bringt den Schoppen, stellt ihn vor ihr ab; Martin braucht keine Bestellung aufzugeben, erhält ebenfalls Kölsch und Korn. Besteck wird bereitgelegt, von einer Papierserviette umwickelt.
Gertrud mit hellrotem Sommerpulli und hellblauen Jeans. Ihr Körper: als wäre er von der linken Seite her zusammengestaucht worden; so sitzt sie schief im Rollstuhl, Kopf schräg aufgehalst. Ihre hellen, wachen Augen ruhen auf Herkenrath. Den Blick auf jemandem ruhen lassen: das wird fast zur körperlichen Erfahrung. Wieder zeichnet sich eine Spur Lächeln ab. Ihr Mund schließt sich nicht ganz, ist schräg herabgezogen, bleibt rechts unten geöffnet.
Die Wirtin serviert das Omelett, Martin entrollt das Besteckbündel, reicht ihr die Gabel, steckt die Serviette hinter dem Pullikragen fest. Die Wirtin fragt, wie es ihr geht. Martin lauscht, gibt die Antwort: »Es geht dir sehr unterschiedlich, gelt?«
Langsam, wie ferngelenkt, pikst sie mit der Gabel ins Omelett, hebt eine der Krabben hoch, steckt sie in den Mund, läßt Ei folgen. Auf der Serviette beginnt sich eine Sabberspur abzuzeichnen. Martin scheint das zu sehen, reagiert aber nicht, plaudert weiter. Er spricht entschieden leiser als sonst. Herkenrath senkt, wie im Reflex, ebenfalls die Stimme. Auch scheinen seine Körperbewegungen gedämpft. Und Martin horcht hinein in ihr Hauchen, er nickt, gibt leise Antwort. Kurze Phase völliger Reglosigkeit, dann ißt sie weiter; die Sabberspur verlängert sich, ihr Kinn glänzt. Martin wischt es nicht ab, drapiert die Serviette nicht neu. Keine Nachlässigkeit, das weiß Herkenrath, sein Freund will nicht dauernd an ihr herumwischen, das würde sie stören.
Während des Gesprächs schaut er sie fast unablässig von der Seite an. Als der Teller schließlich leer ist, haucht sie Martin etwas zu, gleich legt er eine Zigarette neben ihren Teller. Die hebt sie langsam an, steckt sie in den Mundwinkel, in dem die Lippen sich noch berühren, Martin reißt ein Streichholz an, sie saugt die Flamme an, aber nicht stark genug, das Streichholz muß ausgeschlenkert werden, Martin ratscht ein zweites Streichholz an, auch diesmal packt das Flämmchen nicht. Ohne Zeichen von Ungeduld reißt er ein drittes Streichholz an; beim vierten brennt die Zigarette. Die hält sie eine Spanne vor dem Mund in der Schwebe. Nun ist die Serviette weg – Martin hat sie mit beiläufigem Griff an sich genommen und so zusammengelegt, daß die Sabberspur nicht zu sehen ist. Die Wirtin nimmt den Teller weg, geht in die Küche.
Und Gertrud haucht ihrem Mann eine Frage zu, die er weitergibt: Woran Wolfgang zur Zeit arbeitet?
Herkenrath beugt sich nach vorn über die Tischkante, berichtet leise von Revisionen der Vortragsreihe für den VHS-Zyklus BEGEGNUNG MIT GRÖNLAND und von seiner gelegentlich fortgesetzten »Bastelarbeit« (wie Sigrid sagen würde) am Eskimo-Flipper, korrekter: am Inuit-Flipper. Hier soll ein modellhaftes Grönland-Environment bespielt werden, auf spezifische Weise. Das heißt: die Kontaktstellen der sogenannten Schlagtürme, der »bumpers«, sie werden weicher sein als üblich: ein gedämpftes Anprallen und damit Ansprechen der Kontakte; mit variierender Verzögerung werden hier Licht- und Toneffekte ausgelöst … Er muß alle Fähigkeiten und Fertigkeiten einbringen, die er als Ausstellungstechniker erworben und entwickelt hat, um das kleine Kunstwerk zu realisieren – aber dieses Hauptwort setzt er hörbar in Anführungsstriche.
Die Asche an der ruhig gehaltenen Zigarette wird länger, Martin rückt einen Aschenbecher, der sowieso in ihrer Reichweite steht, scheinbar zurecht, langsam senkt sie den gekrümmten Arm, streift Asche ab, hebt den Arm: als würde er in unsichtbarer Aufhängung nach oben gezogen.
Und sie haucht Martin wieder zu, was er hörbar macht: Wolfgang muß hier nicht ironisieren. Dieser Umbau des Geräts dürfte mehr erfordern als handwerkliche Arbeit. Auch ein Bühnenbildmodell kann Kunstwerk sein. Und es scheint so, als solle die Flipperkugel später durch ein bühnenbildähnliches Kunstwerk rollen, nach seiner Konzeption entwickelt. Er kann die ironisierenden Anführungszeichen also getrost weglassen.
Die Glühzone der Zigarette nähert sich ihren Fingerkuppen, Martin nickt ihr zu, sie verreibt das Aschenende. Und Gertrud ergänzt, hauchend: Wirklich, er solle sich nicht auf den Ausstellungstechniker rausreden, jeder Mensch sei Künstler, könne Künstler sein. Sie haucht einen Namen, der diesen Satz offenbar zu einem Zitat macht, aber nicht einmal Martin versteht ihn – zu hoch der Stimm- und Geräuschpegel der Kneipe. Und Gertrud zitiert weiter: Es sei gleichgültig, ob eine Produktion von einem Maler oder Bildhauer stamme oder von einem Physiker. Warum also nicht auch von einem Techniker?! Und sie läßt fragen, ob er sich das bitteschön zu Herzen nehmen wolle …?
»Ich laß es mir durch den Kopf gehn!«
Ein kleines Zucken im Körper der Frau, dieses Zucken wiederholt sich; Zucken auch im freien Mundwinkel.
»Sie lacht«, sagt Martin. In seinen Augenwinkeln ein feuchter Schimmer.
AUF DEM STRÖMUNGSGÜNSTIGEN BETONSOCKEL des westlichen Brückenpfeilers ein Graffito: zwei, drei Quadratmeter groß, in Arktis- und Pinguinfarben. Dieses informelle Bild rechts unten signiert mit schwarzem Kürzel; auf einer der weißen Flächen steht, schwarz gesprüht: »Who was this famous creator?« Diese auf Interaktion angelegte Frage fand ihre Antwort in Blau, mit schräg herabpurzelnden Buchstaben: Heinrich.
Und Herkenrath diagnostiziert: Künstler-Eitelkeit, sogar schmarotzende, usurpierende Künstler-Eitelkeit …! Aber die künstlerische Produktion im Lande bordet über! Allein die Graffiti innerhalb des Stadtbereichs, an sämtlichen Eisenbahnlinien entlang, auf verputzten wie unverputzten Mauern – eine malerische Selbstpräsentation neben der anderen, bis in die Schattenzonen von Unterführungen hinein. Und an wie vielen Waggons der Stadtbahn wie der Bundesbahn, dies oft von der ersten bis zur letzten Tür: Graffiti, kostenlos durchs Land gezogen von Elektro- und Diesellokomotiven. »Still on track« las er auf einem dieser Waggonbilder – des großen Erfolgs halber weiterhin auf Achse! Ja, alles scheint vor künstlerischer Energie zu vibrieren, auf jeder freien Fläche manifestiert sich Kreativität. »Everybody can be artist« stand in dekorativer Sprühschrift auf einer Brandmauer, freigestellt durch einen Abriß in der Worringer Straße, und dieses Schriftkunstwerk ergänzt von einem anderen Sprayer: »… said the Guru.« Und ein dritter fügte hinzu: »No risk no fame.«
Der nicht genannte Guru: hätte eine Bestätigung gesehen vor diesem Betonsockel mit dem groß angelegten Graffito, mit der besitzergreifenden Frage nach dem berühmten Künstler, mit der wiederum usurpierenden Antwort. Der Guru hätte sich zusätzlich bestätigt gesehen auf der anderen, der rheinnahen Seite des Sockels – Herkenrath geht um den Betonklotz herum. Er weiß, was ihn erwartet: auf grüner Fläche ein A und O und U schräg hintereinander gestaffelt, das O mit simplem Blütenmuster, die beiden anderen Großbuchstaben von Schnörkeln befallen; auch dieses Letterntrio mit einem Emblem signiert; vorangesetzt ein »by«.
Aber dieses Graffito ist bereits wieder übersprüht. Nein: es ist mit weißer Ölfarbe übermalt, konventionell aber gründlich. Ein Oval mit verwischten Konturen, etwa einen Meter lang, einen dreiviertel Meter hoch, und horizontal ein grauer Strich, pastos. Ein Newcomer der Open-air-Art, der Non-profit-Art. Aber wie lange, wie kurz wird es dauern, bis seine weiße Fläche zur Grundierung wird für ein neues Sprühwerk, beispielsweise für ein stilisierte Figur in Violett, Lila, Schwarz, die kauernd den Fluß zu betrachten scheint?
»DIE TRUDE macht noch ein bißchen Armgymnastik – komm solang zu mir rein.« Martin öffnet die Tür zum Studio, läßt ihn vorangehen.
Es sind keine Posters, keine Postkarten hinzugekommen an den Wänden: die längst vertrauten Abbildungen von Lokomotiven, die Dampf ausstoßen und Qualm hochpuffen. Dampfloks vor Tunnelöffnungen, konturenbetont … Lokomotiven zu zweit vor einem langen Zug, in einem Mittelgebirge … Dampfloks an Bahnsteigen, Dampfloks auf Drehscheiben, Dampfloks vor Lokomotivschuppen … Bestimmt ein halbes Hundert Lokomotiven, und allen wurde für die Aufnahmen eingeheizt – überschüssiger Dampf zischt seitwärts ab, Rauchballen puffen ungeduldig hoch. Um die angepinnten Postkarten nicht hochbiegen oder ablösen zu müssen, hat Martin kleine gelbe Zettel an die unteren Ränder geklebt: Hochdruck-Lokomotive … Höchstdruck-Lokomotive … Turbinenlokomotive … Kriegsdampflokomotive – Stichwort »Entfeinerung« …
Herkenrath löst den Blick von der Lokomotivenrevue. An die Seitenwand des Schranks gelehnt eine Tuba, auf dem »Kranz« stehend. Blick aus dem Fenster. Die zweigeschossige Villa gegenüber, aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg: Freitreppe, gegliederte Putzfassade, Walmdach. Mattes Weiß, lindes Grün, zages Braun der Fassade. Links anschließend: der schuppenähnliche Bau, der kopfsteingepflasterte Hof, die Garagentüren, das Wohnhaus; als Hintergrund der Flachbau, mit Dachpappe gedeckt. An die Straßenmauer gesprüht: »Schluß mit den Massakern in der Türkei + Kurdistan. Es lebe der Revolutionäre Kampf!« Wiederum links vom »Türkenhaus« die aufgegebene Tankstelle, nun ein Getränke-Shop.
Auf der Arbeitsplatte, auf deren Vorderkante Herkenrath sich abstützt: Stimmeisen, Stimmhörner, Windwaage. Und Borstenpinsel, Haarpinsel. Und Schrauben, Drähte, Stifte. Ein Staubtuch. Martin wird von der Orgelbaufirma in Mülheim zu Noteinsätzen gerufen, wenn der Meister nicht kann, die Mitarbeiter ausgelastet sind, der Kunde nicht enttäuscht werden soll. Und der Freund, mit einem Tablett hereintretend, berichtet: Meist klemmt oder hakt es in der Traktur – dann muß er das kleine Problem irgendwo zwischen Taste und Winkelhaken, zwischen Zugrute und Windlade lösen. Oder es wird ein »Durchstecher« gemeldet: Pfeifen sprechen an, die nicht angespielt werden. Besonders dringlich wird ein Termin, wenn sich ein »Heuler« einstellt. Manchmal genügt es, wenn er die Stellmutter über der Taste etwas lockert, und der enervierende Dauerton ist gestoppt.
Sieht ziemlich nach Arbeit aus, faßt Martin zusammen, und er gießt ein: Campari-Soda. Dies alles hier liegt aber oft tagelang brach, und länger. Zuweilen betritt er das Zimmer gar nicht erst, jeder Handgriff ist ihm zuviel, er läßt die Pfoten hängen, kriegt den Arsch nicht mehr hoch – als würde die fortschreitende Lähmung von Trude auf ihn übergreifen. Dann verfällt er melancholischem Rückblick: Sein Leben als Folge sehr verschiedener Sätze, musikalisch gesprochen. Und er sieht sich jeweils als eine andere Person. Ihm fällt zuweilen ein, was Wollie einmal über einen Indio-Stamm erzählt hat, im Zusammenhang mit einer Ausstellung: In diesem Stamm erhält ein Mann im Lauf seines Lebens mehrere Namen. War es nicht so? Also, das hätte er auch gern! Einen Namen für den noch hoffnungsvollen jungen Mann; einen Namen für den Tubisten der Kriegsjahre; einen Namen für den Mann der Nachkriegsjahre, mit allem Mißlingen; einen Namen für ihn jetzt, nachdem er aus dem Gröbsten heraus ist, schon mal neue Perspektiven entwirft, heimlich, nachts.
UND HERKENRATH BEOBACHTET einen älteren Mann, der mit weißem Blindenstock die Treppe herunterkommt, der heranschreitet auf dem Bahnsteig, den Stock vor sich herschwingend. Mehrfach läßt er ihn an die Wand klacken. So nähert er sich drei an der Wand befestigten Plastikschalensitzen; eine Frau auf dem ersten Sitz, sie zieht die Beine hoch. Der Blinde zögert kurz, geht an den Sitzen vorbei und weiter bis zum Abschnitt des Bahnsteigs, an dem Kurzzüge halten. Er bleibt stehen, läßt den weißen Stock vorschwingen bis zur Bahnsteigkante, scheint den Abstand auszumessen mit gestrecktem Arm, verharrt, schwingt nochmal kurz den Stock, überprüft erneut den Abstand zur Bahnsteigkante; dort findet sein Stock keinen Widerstand mehr, er zieht ihn wieder zu sich heran, steht reglos. Korrekte Rentnerkleidung, grau und beige. Keine Blindenbrille, aber ein Behindertenzeichen. Früher als sonst nimmt Herkenrath den kleinen Luftstau wahr: Tunnelröhrenpfropf, von der Bahn vorausgeschoben. Herkenrath markiert seinen Standort mit kleinem Räusperzeichen. Schon wendet sich ihm der Blinde zu, kommt mit wenigen Schritten heran. »Ich bin ein Whitestick … Fährt da Linie 12 ein?«
Das bestätigt Herkenrath, steigt ein – der Blinde lehnt dankend das Hilfsangebot ab, er komme gut zurecht. Der »Whitestick« setzt sich zwei Reihen weiter, steht nach dem Anfahren der Bahn wieder auf, kommt ohne Vorantasten zu Herkenrath, erkundigt sich, ob er der Herr sei, der eben so freundlich Auskunft erteilt hätte, und ob er sich zu ihm setzen dürfe, da könne man sich ein bißchen unterhalten.
Herkenrath fragt, wie er ihn hier so schnell lokalisiert hat, ohne Umweg.
Er hat den Schritt identifiziert, als sie auf die Bahntür zugingen, hat hier im Wagen gehört, in welche Richtung er ging. Er kann räumlich gut hören, hier hat er eine besondere Fertigkeit entwickelt, zum Ausgleich dafür, daß seine Netzhaut kaputt ist. Außerdem hat er es an der Prostata. Aber er sieht zehn Jahre jünger aus, trotz allem, das haben ihm schon viele bestätigt. Er hat sich aber auch immer tummeln müssen, das hält jung. Nach dem Krieg war er Vertreter, per Fahrrad, für Schusterzubehör, für Leder et cetera, danach führte er ein Lederfachgeschäft, insgesamt vierzig Jahre lang, dann war Schluß, seither ist er im Ruhestand, und vor sechs Jahren wurde er blind, er kann nicht mehr lesen, kann nicht mehr fernsehen, jedenfalls nicht so richtig, er muß sich alles nach dem Ton vorstellen, ausmalen. Ja, und tagsüber, zumindest werktags, fährt er mit der KVB, ihm wird zum Ersten jeweils eine Monatskarte zugeschickt, kostenfrei. Zuerst ist seine Frau mitgefahren, ebenfalls frei, aber sie hat zu tun, einkaufen und so weiter, dabei sieht sie ja auch Leute genug. Er fährt gern nach Sürth und manchmal mit der 16 auch weiter nach Bonn, fährt mit der 15 nach Thielenbruch oder mit der 19 nach Niehl, mit der 1 nach Junkersdorf. Jeden Tag sucht er sich ein anderes Ziel aus, zumindest wechselt er ab bei den Wiederholungen. Er hat das KVB-Netz im Kopf, die Reihenfolge der Stationen kann er streckenweise auswendig – bitteschön, bittesehr, wie wäre es mit der 13? Er glaubt nicht an Unglückszahlen, glaubt infolgedessen auch nicht an Glückszahlen, Zahl ist Zahl, er unterscheidet höchstens zwischen roten und schwarzen Zahlen. Kleines Auflachen. Also die Linie 13, und er setzt irgendwo ein? Zum Beispiel bei der Oskar-Jäger-Straße? Danach kommt die Weinsbergstraße, die Venloer Straße, die Subbelrather Straße, die Nußbaumerstraße, die Escher Straße, die Geldernstraße, die Neusser Straße –
Ja, und dann die Amsterdamer Straße, die Slabystraße, der Wiener Platz …
»Stimmt genau. Fahren Sie öfter mit der 13?«
»Meine Frau wohnt in Mülheim.«
SCHLENDERN AUF DER RHEINUFERPROMENADE, zwischen Deutzer Brücke und Hohenzollernbrücke, und gleichförmig, zu seiner Rechten, das Dahinströmen, betont durch Lichtreflexe, neonblaßblau und natriumdampfgelb; zuweilen auch das Grün oder Rot der Positionsleuchten von Güterschiffen, die noch nicht geankert haben. Vom Turm der Messehallen wird in regelmäßigem Zeitabstand ein roter Lichtstreifen auf das Wasser projiziert, dann ein grünblauer und wieder ein roter; er weiß, welche Zahlen und Buchstaben diesen Lichtreflexen entsprechen, da muß er nicht mehr hinüberschauen.
Weiter, flußabwärts: der wechselnde Wasserreflex der Leuchtschriften des Messeturms bald schon unterbrochen durch Bögen, durch Verstrebungen der Eisenbahnbrücke; Züge, in kurzen Zeitabständen heranfahrend, bringen sie zum Dröhnen. Ein Güterschiff mit längsseits beigekoppeltem Schubleichter überholt ihn; rasches Rotieren der Richtstrahlantenne der Radarortung. Der »Spargelformation« nachblickend, registriert er erst in der letzten Phase die rasche Bewegung von links heran: schon steht eine junge Frau vor ihm. Betonte Wangenknochen; das braune Haar ist locker zurückgekämmt und von einer Klammer zusammengefaßt. »Verzeihung – Sie haben früher bestimmt Walzer getanzt – können Sie mir den Walzerschritt zeigen?«
Sein Überraschungszögern kürzt er ab, er hört sich sagen, baritonal: »Aber natürlich.« Und faßt mit der linken Hand ihre rechte, legt seine rechte Hand an ihre Hüfte, souffliert: Eins-zwei-drei, Eins-zwei-drei, und sie beginnen, sich im Dreivierteltakt zu drehen.
Walzertanzen auf der Rheinuferpromenade, kurz vor Mitternacht. Gelächter von der Rücklehne einer der Bänke: zwei junge Männer, ein Mädchen zwischen ihnen. Er fragt, weitertanzend, weshalb die so lachen, sie tanze doch gut. Und sie: »Weil ich grade eine Wette gewonnen habe!«
In die Drehbewegung hinein fragt er, worum es in dieser Wette geht. Und hört: eine Tankfüllung, für ihren kleinen japanischen Wagen.
Er setzt die Drehbewegungen fort: Damit der Tank auch bis zum Verschluß gefüllt wird … Sie tanzen weiter bis zur Eisenbahnbrücke – schließlich, sagt er, komme ein kleines Auto mit einer Tankfüllung weit.
Wie im Reflex ein sanftes Verstärken des Drucks ihrer Hand. Sie könne noch lange so tanzen, er strahle so viel Ruhe aus …
»Vielleicht strahlt eher ein gewisses Amulett diese Ruhe aus …«
»Klingt schön geheimnisvoll«, meint sie. Doch er läßt das Stichwort verfallen.
Die drei auf der Bank schauen ihnen nach. »Sie wollen zurück, ich spür das. Aber schenken Sie mir noch ein Minütchen – wir haben uns gerade erst eingetanzt.«
Ihr Nicken. Nach zwei, drei weiteren Drehbewegungen berichtet sie, daß vor ihm einige Männer fast beleidigt reagierten, auch beleidigend – als würde sie ihnen etwas Grobes sagen oder wollte ihnen an den Geldbeutel, die Brieftasche – man ist ja gewarnt, man weiß ja Bescheid … Bei ihm aber nicht das geringste Zögern, er begann den Tanz mit ihr, als wäre das völlig selbstverständlich so. Und von Anfang an diese Grundschwingung der Ruhe – sie spürt so was ganz direkt …
Und sie drehen sich weiter, ein älterer Mann in Baumwollhose und Sommerpulli, eine junge Frau in Jeans und Sweatshirt. »Ich würde gern noch bis zur Bastei mit Ihnen tanzen oder bis zur Zoobrücke.«
Während er das sagt, spürt er, ganz kurz, Hüfte und Brüste. Passanten gehen beschleunigt oder verlangsamt an ihnen vorbei.
»Ich hätte nichts gegen eine kleine Fortsetzung. Aber wir wollen noch meine Freundin abholen. Sorry …«
»Wenn es Ihnen recht ist, tanz ich mit Ihnen noch ein Stück Richtung Bank.«
Drehbewegung im Dreivierteltakt rheinaufwärts. Kein Blick zur Wasserfläche mit ihren Lichtreflexen: ihre hellen Augen, ihre betonten Wangenknochen, ihre leicht aufgeworfenen Lippen, ihre gleichmäßig gereihten Zähne.
Und wie sieht sie ihn? Mann mit kurzgeschnittenem, grauweißem Haar, »Winterstoppeln«; graublau die Augen, in den Winkeln jeweils ein kleiner Fächer schmaler Linien; die Ohren betont von fleischigen Läppchen; braun die Haut in diesen sonnenreichen Monaten.
»Hätten Sie was dagegen, wenn ich gelegentlich mal anrufe?« fragt sie, noch in der Schattenzone der Brücke. Kein Zug über ihnen, der die Eisenkonstruktion zum Schwingen bringt.
»Ich steh im Telefonbuch.« Und er nennt seinen Namen silbengenau, auch die Anschrift – eine Telefonnummer werfe man leicht durcheinander, zum Aufschreiben habe er nichts dabei, eine Visitenkarte führe er nicht. Ja, er würde sehr gern mal mit ihr zur Bastei spazieren und weiter, zur Zoobrücke. Oder – drüben – Richtung Südbrücke.
»Aber was sollen wir erst lang telefonieren?« Auch sie möchte einen Spaziergang machen – ob er nächste Woche, am selben Wochentag, eventuell wieder hier sei?
Weil sie schon näher an die drei auf der Bank herangetanzt sind, sagt er rasch, er werde hier sein, am Punkt ihrer »Damenwahl«. Zu welcher Zeit?
Neunzehn Uhr, schlägt sie vor, kann allerdings nicht dafür bürgen, daß sie pünktlich sein wird – sie fährt ein Stück auf dem Ring, dort wird es bisweilen mühsam.
»Ich habe Zeit.«
In einer engeren Drehbewegung wieder ein sanfter Druck ihres Busens: aber das wird Zufall, kann kein Zeichen sein, schließlich ist er drei, vier Jahrzehnte älter.
Sie löst sich von ihm, geht hinüber zu den jungen Leuten, winkt ihm zu; er hebt gleichfalls die Hand. Als Körperecho: Drehbewegungen im Dreivierteltakt.
Er geht Richtung Bastei, als müsse er die Strecke zur Probe schon mal abschreiten. Jenseits der Eisenbahnbrücke, jenseits des Kiosks für Schiffskarten macht er einige weite, rasche Schritte – beschwingt, fast schwebeleicht.
Zweite rituelle Passage
Vor der Unterführung zwischen Breslauer Platz und Bahnhofsvorplatz sieht Herkenrath einen Streifenwagen der Bahnpolizei querstehen, und es sind Absperrgitter aufgestellt. Zwei Polizisten unterhalten sich mit einer Hosteß. In einem Lieferwagen mit seitlich geöffneter Jalousie spielt eine junge Frau Querflöte. Die Hüften betont vom hauteng anliegenden Abendkleid, das sich erst unterhalb der Knie locker entfaltet; die Füße knöcheltief in Bühnennebel.
Auf einem Tisch, dessen Beine unter weißer Tischdecke versteckt sind, reihen sich Sektgläser; drei Mann in Weiß und mit hohen Kochmützen schenken ein. Hostessen gehen mit kleinen Tabletts umher, bieten Sekt, Kölsch, Orangensaft, Mineralwasser an. Über den geladenen Gästen schwebt an einem Drahtseil (und Herkenrath sieht gleich, daß es zusätzlich gesichert ist durch ein zweites, dünneres Drahtseil) ein Mann, der eine Frau darstellt – viel Tüll und goldblond die Perücke. Von einem Spotlight betont, hält er unter dem rechten Arm einen Korb mit Sommerblumensträußchen; regelmäßig greift er in den Korb, wirft ein Sträußchen; zuweilen läßt er ein Papierflugzeug herabgleiten, und jedesmal strecken sich Arme aus nach dem gefalteten Hochglanzpapier, das wohl eine Losnummer trägt, für eine spätere Tombola. Die Flötistin spielt unablässig, wird von den Gästen aber nicht weiter beachtet.
ZWEI ABSCHNITTE DER STREIFENKARTE