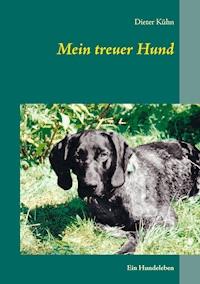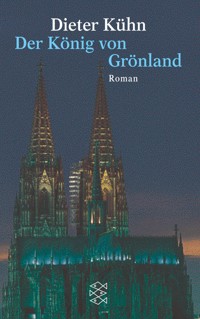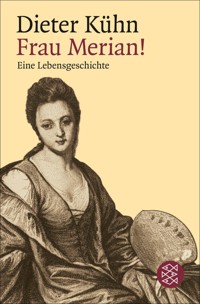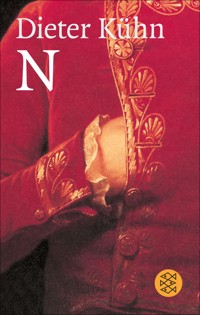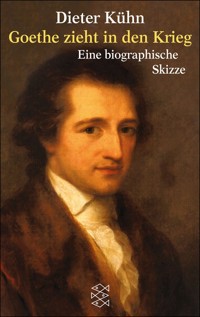
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1870 reist Wolfgang Maximilian von Goethe, der Enkel und Nachlassverwalter des Dichterfürsten, nach Weimar, um in dem leerstehenden Haus am Frauenplan nach dem Rechten zu sehen. In Weimar eingetroffen, entschließt er sich, ein Buch über seinen Großvater Johann Wolfgang von Goethe zu schreiben. Er kündigt dem Verleger Frommann, der der Familie Goethe schon lange verbunden ist, in einem Brief diese biographischen Pläne an; einem Brief, der wächst, wuchert und sich entfaltet, als wolle er schließlich selbst an die Stelle des angekündigten Buches treten. Zu komplex für einen Biographen allein, so muss der Enkel erkennen, ist das Werk des großen Goethe. Also sucht Wolfgang Maximilian Unterstützung bei seinem Bruder Walter, bei dem Archivar Schuchardt, bei Caroline Nees, einer Kennerin der Botanik und Mineralogie, und bei einem militärischen Gewährsmann, dem Major von Kalkreuth. Der Enkel plant, die Aufzeichnungen seines Großvaters über die »Campagne in Frankreich«, jenes unglückseligen Feldzuges, an dem Goethe 1792 teilnahm, zum literarischen Hauptgegenstand seiner Biographie zu machen. Das verschafft ihm – und damit auch Dieter Kühn – Gelegenheit, Goethes Verhältnis zur Französischen Revolution und zu den politischen Verhältnissen der Epoche schlechthin zu beleuchten; und da Goethe die Aufzeichnungen zur »Campagne in Frankreich« erst in hohem Alter endgültig bearbeitete, sehen wir auch den greisen Dichterfürsten – ein wenig mürrisch und mit mehreren Schreibern und Hilfskräften zugleich – an der Vollendung seines komplexen Lebenswerkes arbeiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Dieter Kühn
Goethe zieht in den Krieg
Eine biographische Skizze
FISCHER E-Books
Inhalt
– Goethe – Goethe – Goethe! Ich dachte: Du mußt doch zeigen, daß hinterm Berge auch noch Leute wohnen.
Immermann
Als Anfang der Geschichte: Johann Wolfgang Goethe, noch 42, vor dem kirchturmhohen Grabmonument in Igel bei Trier. Das etwa acht Stockwerke hohe Scheingrab als Eröffnungszeichen, als metaphorischer Meilenstein! Es beginnt hier für Goethe ein neuer Bereich der Erfahrung: er zieht in den Krieg.
Das »Pfeilerhochgrab«, auch als »Säule« bezeichnet, steht einen schwachen Steinwurf von der Straße entfernt, die schon zu Römerzeiten Heerstraße war: von Trier über Luxemburg nach Reims. Von Koblenz anrückend, ist das preußische Heer vor kurzem durch dieses Dorf gezogen; hinter dem Betrachter des Grabdenkmals aus römischer Zeit fahren schwer beladene, mehrspännige Wagen vorbei: Nachschub. Auf den Platz eingeschwenkt ein kleiner, leichter Wagen, Zweisitzer, mit dem Goethe kam, mit dem er weiterfahren wird zum Heerlager bei Longwy. Auf diesem »Wägelchen«, dieser »Halbchaise« Paul Götze, 23. Er macht sicherlich ein Nickerchen. Auch der Kutscher, der mich mit ortskundigem Begleiter die wenigen Kilometer von Trier nach Igel fuhr: kaum waren wir ausgestiegen, sank ihm der Kopf nach vorn …
Auf dem Vorplatz, zu Goethes wie zu meiner Zeit: Matsch, gleichsam zur Einstimmung. Auch der Himmel wie zur Einstimmung: grau. Ärmliche Häuser; ein Pflug, eine Egge; Hühner und Hunde. Gleich hinter dem Pfeilerhochgrab setzt ein Hügel an, mit kleiner Dorfkirche auf der Kuppe. Nur wenige Häuser zwischen Hügel und Mosel. So konnte auch ich das Monument schon kilometerweit vor dem Dorf sehen: kleiner Kirchturm auf dem Hügel, größerer Kirchturm (so sieht das Monument bei der Annäherung jedenfalls aus) am Fuß des Hügels.
Und hier verharrt der Mann im weiten Reisemantel. Vergangenes läßt er gegenwärtig werden: mehr als anderthalb Jahrtausende steht dieses Denkmal, mit dem sich zwei Brüder verewigen wollten, Tuchhändler der Region. Und in jener fernen Zeit eine noch weiter zurückliegende Zeit präsent in Zeichen: Figuren der griechischen Mythologie. Zeitperspektiven in Halbreliefs …
Freilich, der Betrachter auf dem verschmutzten Platz zwischen riedgedeckten Bauernhäusern wird abgelenkt: hinter ihm trotten, als Nachzügler, Infanteristen vorbei mit Tornistern und Gewehren. Dann, im Schritt, eine Abteilung Kavallerie: kürzere Karabiner, und an den Sattelknäufen hängen Holfter mit klobigen Pistolen. Auch der Betrachter des römischen Grabdenkmals fuhrt ein Pistolenholfter mit sich, aber es liegt im Reisewagen, vor dem die beiden Pferde Hafer fressen.
Ich denke mir, daß Goethe, sich zur Konzentration zwingend, mit der Besichtigung an der Westseite beginnt: seine Zukunftsseite, denn nach Westen wird die Fahrt weiterfuhren, in die Champagne. Die Westseite als Wetterseite (in den folgenden Wochen eher eine Sauwetterseite …): hier ist viel schon verwittert, auch abgeplatzt. Doch unten, an den Sockelstufen, erkennt man noch leicht den Triton mit der Keule vor dem Meerungeheuer und den Triton mit dem Steinbrocken vor dem zweiten Meerungeheuer, und es wird auf der nächsten Stufe ein Boot gezogen von zwei Treidlern, ein Bootsmann sitzt hinter zwei Ballen, und auf der dritten Stufe klettert ein fettes Knäblein auf einen Delphinrücken, reitet auf dem Delphin, sitzt wieder ab. Und darüber: eine Schlange … ein gezücktes Schwert … ein abgeschlagenes Haupt … Fragmente, von der Verwitterung verschont … Was einmal detailliert ausgeführt war, mit Feinputz und Farbe, das wurde wieder skizzenhaft …
Der Lehrer aus Trier, dem es eine Ehre war, den »Träger eines so berühmten Namens« ins Nachbardorf zu begleiten, er trug mir eine Deutung vor, die mit Goethes Auslegung möglicherweise nicht identisch war: Perseus und Andromeda, das Haupt der Medusa … Falls Goethe dies auch so sah: waren hier für ihn Symbole der nah bevorstehenden, der drohenden Zukunft? Lähmendes Schreckbild?
Dann wird er sich wohl lieber der Ostseite zuwenden: hier sind noch Szenen zu erkennen, hier lassen sich Figuren noch Namen zuordnen, aus Gesten wird eine Geschichte: Styx, die Wassergöttin, sitzt unter einem Baum, hält eine Amphore waagrecht, in öffnungsweitem Schwall ergießt sich Wasser, und Thetis, barbusig, hat das Söhnchen Achill am rechten Fußgelenk gepackt, hält ihn kopfunter in den Wasserschwall, der ihm Unverwundbarkeit verleihen soll. Wenn Goethe das so erkennt, wird er sich wohl ebenfalls Unverwundbarkeit wünschen, zumindest für einige Wochen, denn es soll ja alles ganz rasch gehn beim Vormarsch auf Paris …
Beruhigender Gedanke. Ruhe zu gelassener Betrachtung wird sich dennoch kaum einstellen. Positionswechsel; ja, und dort oben: Eßtisch … Schüssel … Trinkbecher … Schenkentisch … Wischtuch … Wams, gegürtet … Ärmel, aufgekrempelt … grüßend erhoben …
Was dem Blick wieder Halt verleiht, könnte der Reisewagen sein, der aus gewölbter Hauseinfahrt herauskommt. Zwei Maultiere ziehen den einachsigen Wagen, es läuft ein drittes Maultier mit; Gleichschritt, parademäßig exakt. Über die fast parallelen Zügel hinweg ist ein Meilenstein zu sehen, schemenhaft, mit Zahlenangabe. Zwei Männer auf dem Kutschbock; einer von ihnen hält die Zügel, der andere weist die Richtung. Mit ihm könnte Goethe sich identifizieren. Bild des Aufbruchs in einer Situation des Aufbruchs: ein Reisender, der mit einem leichten, einachsigen Wagen weiterfahren wird, sieht einen Reisenden auf einem leichten, einachsigen Wagen der Römerzeit. Ein Reisender, der dem Kutscher die Richtung weist, gesehen von einem Reisenden, der bald darauf in sein Gefährt steigt, und dem Kutscher, dem Diener, dem Schreiber Paul Götze sagt, daß es nun wirklich losgeht.
Und hier, spätestens hier, lieber Herr Frommann, lieber Friedrich, werde ich klarstellen müssen, wer dies erzählte, wer weiter erzählen wird.
Am besten würde ich mit einer Beschreibung meiner Situation beginnen: wie ich hier im Gartenhaus sitze, im Arbeitszimmer des ersten Stocks, mit Blick auf den Weg vor dem Haus, auf die Wiese jenseits des Wegs, auf die Büsche und Bäume jenseits der Wiese, auf den kleinen Ausschnitt des Flußlaufs jenseits der Büsche und Bäume, auf die Hangflanke jenseits der Ilm, auf die ersten Gebäude der Stadt dort drüben, dort oben, und daß ich, Goethe, viereinhalb Jahrzehnte nach Goethes Tod eine Geschichte aus seinem Leben erzählen werde: wie er am Feldzug gegen das Frankreich der Revolution teilnahm, als »Feldpoet«, wie Soldaten ihn nannten.
Bevor ich hier fortfahre, möchte ich kurz noch die kleine Namensirritation auskosten: ein Goethe in Goethes Arbeitszimmer des Gartenhauses, ein Goethe sogar mit dem Vornamen Wolfgang, freilich meist zu Wolf verkürzt; zusätzlich der Vorname Maximilian, den aber keiner benutzt, ich auch nicht. Also, ich werde im Buch, für das ich Dich als Verleger gewinnen möchte, die Verwirrung rasch beenden und mich vorstellen als Johann Wolfgang von Goethes Enkel Wolfgang Maximilian von Goethe, und ich füge gleich hinzu, daß ich aus Wien, meinem derzeitigen Wohnsitz, hierher nach Weimar gekommen bin, weil ich mich noch einmal um das Haus am Frauenplan kümmern muß, mittlerweile sind mal wieder Dachreparaturen notwendig, Feuchtigkeit in einer Wand der nicht mehr benutzten Aufwärmküche des ausgestorbenen Hauses mit seinen etwa dreißig geschlossenen Türen und fünfzig verschlossenen Fenstern. Ich teile mir derartige Lästigkeiten der Verwaltung eigentlich mit meinem Bruder, aber der wird erst später kommen. So bin ich erst einmal allein hier, sitze auf dem Stuhl, auf dem ER zuweilen bei der Arbeit gesessen hat, falls er nicht stehend schrieb oder auf und ab gehend diktierte – ER hatte ja auch hier im Gartenhaus reichlich Personal.
Goethe in Weimar … Das Fenster steht offen, ich höre die Ilm rauschen, ihr Wasserstand ist gestiegen nach den regenreichen Tagen, die sich offensichtlich fortsetzen – das Glasbarometer Goethes, neben der Haustür hängend, es zeigt in der Tülle an: weiterhin Tiefdruck. Ein Tief mit einer Permanenz, daß ich den birnenförmigen Glaskörper mit dem gefärbten Wasser am liebsten an einen der Bäume im Garten hängen und als Ziel einer Schießübung benutzen würde, Pistole gegen Wetterglas.
Ja, ich habe hier auf der kleinen Konsole eine (wenn auch nicht geladene) Pistole liegen, eine der beiden Waffen, die Goethe auf dem Feldzug mit sich führte, im Holfter, das auch er an den Sattelknauf hängte. Du liest richtig, lieber Frommann: unser aller Goethe mit Pistolenholfter. Eine der Waffen nun hier in Reichweite; ihre Mechanik müßte ich erst mal ölen, ehe ich Pulver in den Lauf stopfe und womöglich eine Kugel hineinschiebe, um dies vermaledeite Wetterglas zersplittern zu lassen, im Zorn über anhaltende Schlechtwetterbelästigung. Das kühle und nasse Wetter paßt freilich wiederum zur Geschichte, die ich erzählen will, Johann Wolfgang von Goethe skizzierend in einem, wie ich meine, durchaus ungewohnten, bisher nicht hinreichend beachteten Ambiente, unter Umständen, die sich als abenteuerlich bezeichnen ließen: Goethe zum zweiten aber nicht zum letzten Mal als Teilnehmer eines militärischen Unternehmens, Goethe 1792, also vor fünfundsiebzig Jahren.
Eine Geschichte aus Goethes Leben, geschrieben in Goethes Gartenhaus von einem Wolfgang, einem Wolf von Goethe: ja, das sollte früh schon so dargelegt, offengelegt werden. Und ich hoffe, geehrter Verleger, lieber Freund, es wird Deine Zustimmung finden, was ich in diesem Brief und in seinen Fortsetzungen skizziere, und Du ermutigst mich zur definitiven Ausführung. Schließlich habe ich bereits zwei Bücher bei Frommann veröffentlicht, damit die Tradition einer Beziehung lebendig erhaltend zwischen dem Hause Frommann und dem Hause Goethe, seit Dein Vater in Cottas Auftrag mehrere Bände von ihm druckte. Und nun würde, sollte, könnte im Hause Frommann ein Buch über Goethe gedruckt werden – falls den Herrn Verleger, Buchdrucker und Buchhändler überzeugt, was ich in dieser Brieffolge entwerfe.
Also, lieber Frommann, es muß von Anfang an klar sein: ich werde nicht Goethes Lebensgeschichte erzählen, das hielte ich gesundheitlich ja gar nicht durch, ich beschränke mich auf eine Episode aus Goethes Leben. Es wird sich wie von selbst ergeben, daß ich nicht nur berichte, was Goethe in Frankreich erlebte, ich werde auch rekonstruieren, wie er in Weimar den Feldzugsbericht diktierte und was sich diesen Diktaten jeweils anschloß: dafür sind vier Kapitel vorgesehen. Du siehst, ich habe schon ein »Schema« entwickelt, wie Goethe gesagt hätte – das Entwerfen, das Modifizieren von Schemata war ja typisch für seine Arbeitsweise.
Klar begrenzte Zeiträume: die etwa sechs Wochen, in denen er am militärischen Debakel teilnahm, und die Wochen, in denen er, rund dreißig Jahre später, die Geschichte seines Kriegsabenteuers schrieb respektive diktierte. Und ganz beiläufig ergeben sich Weiterungen: Goethe, der sich selbst in den durchweg verregneten Kriegswochen mit Fragen und Erscheinungen beschäftigte, die für sein Wirken und für sein Werk typisch sind: der Kriegsteilnehmer (oder: Schlachtenbummler), der die Erforschung von Mineralien und Pflanzen fortsetzt, der Literarisches reflektiert und projektiert, der die Farbenlehre nicht aus den Augen verliert. Auf diesen Mann wartet eine junge Frau, die ihm drei Jahre zuvor einen Sohn geschenkt hat, meinen Vater. Kleines Verharren im Gedenken an August von Goethe, mit vierzig Jahren in Rom gestorben.
Und wieder zum Haupt-Goethe! Um es gleich zu sagen: ich werde nicht vom hessischen Bübchen in der Frankfurter Hirschgasse erzählen, vom Puppentheater und von der Mutter Aja; ich werde nicht erzählen, wie er in Wetzlar studierte, Jura, und wie er dort Frau Charlotte kennenlernte; ich werde nicht erzählen, wie er den GÖTZ VON BERLICHINGEN schrieb und dieses Schauspiel über einen ruppigen Helden selbst zensierte und anonym veröffentlichte; ich werde nicht erzählen, wie er den sieben Jahre jüngeren Erbherzog von Sachsen-Weimar kennenlernte, wie die beiden sich anfreundeten (»mein Carl und ich«); ich werde nicht erzählen, wie Goethe mit achtundzwanzig dem Ruf des Herzogs nach Weimar folgte, das damals ein großes Dorf mit Repräsentationsbauten war, deren größter, das Schloß, eine ausgedehnte Brandruine war; ich werde nicht erzählen, wie Kuhherden durch das Weimar zogen, in dem sich Goethe und Herder und Wieland und später auch Schiller begegneten; ich werde nicht erzählen, wie aus dem Alleinunterhalter Goethe ein persönlicher Referent des Herzogs wurde, wie er sich in die Administration einarbeitete und sich verpflichtet fühlte, sich um jede, aber auch um jede Kleinigkeit höchstpersönlich zu kümmern; ich werde nicht erzählen, wie er sich mit der sieben Jahre älteren Frau von Stein in ein platonisches Liebesverhältnis von höchstem Niveau einließ, das lange, lange seinen Status des Junggesellen konservierte; ich werde nicht erzählen, wie er fluchtartig nach Italien aufbrach und sich dort fast zwei Jahre lang aufhielt; ich werde nicht erzählen, was er dort alles gesehen und gelernt und gemacht und geschrieben und gezeichnet hat; ich werde nicht von seinen Schwierigkeiten nach der vom Herzog befohlenen Rückkehr berichten, und wie er seinen Wirkungskreis nun enger zog, sich mehr um Schauspieler als um Rekruten kümmerte; ich werde nicht erzählen, was er in den viereinhalb Jahren nach Italien schrieb, diktierte, wirkte; ich werde nicht einmal erzählen, jedenfalls nicht chronologisch, wie ein dreiundzwanzigjähriges Mädchen, Arbeiterin in einer Manufaktur für Stoffblumen, mit einem Bittbrief ihres Bruders hier am Gartenhaus vorsprach und daß Goethe ein paar Stunden später mit Christiane schlief; ich werde auch nicht erzählen, wie mein Vater geboren wurde und wie ein potentieller Onkel und zwei potentielle Tanten schon nach wenigen Erdentagen dahinstarben. Ich werde nur erzählen, wie der junge Vater und glückliche Liebhaber einen Besuch bei seiner Mutter in Frankfurt machte und daß ihn dort ein Schreiben des Herzogs erreichte mit der Aufforderung, sich in das Heerlager bei Longwy zu begeben und sich dem Regiment Weimar im preußischen Heer anzuschließen, auf dem Vormarsch Richtung Paris.
Von diesem Vabanque-Unternehmen berichtend, werde ich es nicht vermeiden können, auch von mir selbst zu erzählen, wie ich auch nicht vorhabe, meinen Bruder und meinen Vater aus der Geschichte herauszuhalten und schon gar nicht Mutter Ottilie! Ich vermute, die Leser werden es sogar erwarten, daß wir zumindest in Umrissen erkennbar werden, der Exkomponist Walter, der Exdiplomat Wolfgang, die Eltern. Man wird uns sowieso noch oft genug ausklammern und aussperren aus Goethe-Büchern, da möchte ich mit Bruder und Mutter wenigstens hier zu Wort kommen.
Und so ergreife ich auch gleich das Wort in eigener Sache, lieber Herr Frommann, caro Frederico: ich habe das Gefühl (während des Schreibens kann ich das im einzelnen nicht erläutern), aber ich habe das begründete Gefühl, daß ich hier entschieden anders schreibe als in meinen Büchern zuvor. Wahrscheinlich wird Dir diese Änderung des Tonfalls auch schon aufgefallen sein. Und solltest Du fragen, wie es dazu kommt, so antworte ich: Mein Grundgefühl, mein Lebensgefühl hat sich verändert. Könnte sein, daß ich später einmal gestehe, was oder genauer: wer dahintersteckt.
Als erstes eine scheinbare Äußerlichkeit, die stimulierend wirkt beim Schreiben. Bisher hatte ich, dem Familienbrauch entsprechend, vieles diktiert. Das war bei Schriftsätzen im diplomatischen Dienst selbstverständlich, privat aber kannte ich es auch kaum anders: schreiben heißt diktieren. So eiferte ich einerseits dem großen Vorbild nach, andererseits kam das meiner Mentalität entgegen, die allzu große Anstrengung scheut. Allerdings entstand beim Diktieren so etwas wie Erwartungsdruck, auch vermittelt durch die Person, die jeweils mein Diktat aufnahm: es muß weitergehen auf hohem Formulierungsniveau …! Das bekam meinen Sätzen nicht, sie versteiften sich. Nun aber sitze ich allein hier, mutterseelenallein, und keiner wartet auf den jeweils nächsten Satz. Ich könnte zwischen diesem und dem folgenden Satz also aufstehen, ans Fenster treten und kopfschüttelnd registrieren, daß die Wolkendecke noch immer nicht aufgerissen ist. Ich könnte hinuntergehen, mich auf das Kieselstein-Mosaik stellen, und ich registriere wieder einmal, in einer Regenpause, das erstaunlich lange Nachtropfen von Bäumen. Schon bei kleinen Windbewegungen schüttelt jeder Baum Tausende von Tropfen ab, in sekundenkurzen Kronenschauern.
Trotz hoher, höchster, allerhöchster Luftfeuchtigkeit – ich stelle fest, wieder einmal erleichtert: ich kann relativ frei atmen respektive: die Abstände zwischen den Anfällen haben sich erheblich verkürzt. Offenbar sind mir die Hausgeister freundlich gesonnen. Wahrscheinlich könnte ich droben im großen, ausgestorbenen Haus so unbelastet nicht atmen, so unbefangen nicht schreiben. Ich fühle mich hier, fast, wie ausgewechselt.
Was so befreiend, so belebend wirkt, das mag ich noch nicht verraten, lieber Freund in Jena, auch wenn »Konfessionen« (und seien sie bruchstückhaft) der Familientradition entsprechen; ich fühle mich aber (noch) zur Diskretion verpflichtet. Freilich hindert mich nichts daran, mich selbst zu zitieren: »Es geht mit siebzehn Pferden mit mir durch, wenn ich glaube, geliebt zu werden.« Mit etwas weniger Faltenwurf hat es früher einmal Mutter Ottilie formuliert: »Ich brauche nur einen Verehrer, so bin ich wohl.« Ja, es geht mir besser. Keine Wunderheilung, dies nun doch nicht, aber größere Zeiträume, in denen ich durchatmen kann, in denen ich frei bin von Schmerzen. Auch das wirkt belebend. Es könnte also durchaus geschehen, daß ich dieses Vorhaben tatsächlich ausführe, und eines Tages liegt nicht nur die Skizze, sondern die Ausführung des Buchs auf dem Verlegertisch …! Den schönen Auftrieb nutzend, schreibe ich hochmotiviert weiter.
Daß der Herzog seinen Geheimen Rat zum Heeres-Sammelpunkt bei Longwy rief, dies war kein spontaner Einfall, keine Laune eines Duodezfürsten, war keine sadistische Zumutung für einen Dichter – die Einladung, die Aufforderung, die Anweisung war eine Selbstverständlichkeit.
Dies werde ich im Buch ausführlich begründen müssen. Ich greife hier schon mal das Stichwort »Geheimes Consilium« auf. Im Jahrzehnt zwischen der Ankunft in Weimar und dem Aufbruch nach Italien fanden 750 ordentliche Sitzungen statt; Goethe nahm an etwa einem halben Tausend Sitzungen teil; sein Fehlen bei den anderen Sitzungen hatte jeweils plausible, gravierende Gründe – meist waren sie dienstlicher Natur. Denn Goethe war gleichzeitig Vorsitzender verschiedener Ausschüsse: der Bergbaukommission … der Wegebaudirektion … der Kriegskommission …
Goethe als Leiter dieses »Militär-Departements«: das will dem Enkel (ehemals in diplomatischem Dienst …) überhaupt nicht gefallen. Zwar bekomme ich schon mal zu hören, mein Großvater hätte diesen Posten nur übernommen, um das kleine Weimarer Militär wiederum zu verkleinern, er hätte die 530 Mann Infanterie auf 250 reduziert respektive: hätte dazu beigetragen, sie zu reduzieren. Aber ich furchte, es war nicht so, als hätte Großvater sich gleichsam einschleusen lassen in diese Kommission, um von innen her zu erreichen, was von außen her nicht möglich war. Er hat das Miniaturheer verkleinert oder hat geholfen, es zu verkleinern, weil auf diese Weise Geld eingespart werden sollte in der desolaten Finanzlage des Herzogtums (vor allem nach den großen Belastungen im Siebenjährigen Krieg); im Militärbudget sah Goethe den einzigen Ansatzpunkt für Kürzungen. Das Militärwesen als solches war ihm nicht fremd; er nahm eine wichtige Position ein im Weimarer Militär, das Teil wurde der riesigen Maschinerie des preußischen Heeres.
So nahm Goethe teil an Rekrutenaushebungen, an Musterungen. Der Mann von dreißig Jahren, der seit drei Jahren in diesem ›meinem‹ Gartenhaus wohnte, der hier Rasenbänke plante, Blumenrabatten, Gemüsebeete, er fuhr oder ritt durchs Ländchen, nahm als Inspektor teil an Musterungen, und zwar im Auftrag Preußens; das forderte, zur Verstärkung der Armee in politisch brisanter Lage, auch von Weimar die Gestellung von Soldaten. Aktenvorgang »Anwerbung von Sächsisch-Weimarischen Landeskindern für die Preußische Armee«. Die Musterungen fanden in Rathäusern statt, und Goethe schaute hier nicht bloß zu oder schaute gelegentlich mal rein, er war direkt beteiligt. So berichtete er seinem Dienstherrn und Freund: »Indes die Burschen gemessen und besichtigt werden, will ich Ihnen ein paar Worte schreiben. Es kommt mir närrisch vor, da ich sonst in der Welt alles einzeln zu nehmen und zu besehen pflege, ich nun nach der Physiognomik des Rheinischen Strichmaßes alle jungen Burschen des Landes klassifiziere. Doch muß ich sagen, daß nichts vorteilhafter ist als in solchem Zeug zu kramen.«
Was auch immer zu tun, zu erledigen war – Goethe beteiligte sich. So schrieb er dem Herzog nicht beispielsweise dies: Ich bitte von Aushebungen und Musterungen befreit zu werden; ich bin Verfasser mehrerer Theaterstücke und bereits zahlreicher Gedichte; das Vermessen und Einstufen von Rekruten ist nicht meine Sache. Nein, er fuhr nach Buttstädt, hielt sich im Rathaus auf während der Dienstzeit, und wenn er in Buttstädt, beispielsweise in Buttstädt, nicht übernachtete, kehrte er zurück in dieses Gartenhaus, legte sich eventuell wieder auf das Dach des Anbaus für Waschküche und Personal, schaute aufwachend in den Sternenhimmel, hörte das Rauschen der Ilm, hörte Nachtvögel, hörte morgens die Glocken von Weimar – in dieser inspirierenden Umgebung begann er zahlreiche Vormittage mit dem Aktenstudium zur Vorbereitung irgendwelcher Sitzungen.
Ich habe den Kustos von Goethe-Haus und Goethe-Archiv, Johann Christian Schuchardt, gebeten, mir (zu den bereits vorgelegten und hier verwerteten Materialien) weitere Unterlagen herauszusuchen zum Thema: Goethe und das Militär. Viel hat unser Registratur bisher nicht gefunden, aber leider Gewichtiges. Aktenvorgang »Ansuchen der Republik der Vereinigten Niederlande um Überlassung von Soldtruppen«. Ein Fall unter etwa zwanzigtausend, die in den zehn Jahren vor der Italienreise vom »Geheimen Conseil« erörtert wurden. Da der Fall dringlich war, sich in »Höchstihro Abwesenheit« aber kein Beschluß fassen ließ, unterrichtete Goethe den Herzog über die Sachlage. Er hatte Vorverhandlungen geführt mit Johann August von Einsiedel. Dabei war festgelegt worden (vorbehaltlich der Entscheidung des Herzogs), ab wann der Soldtrupp gestellt werden mußte, wie lange nach Beendigung der Kampfhandlungen die niederländischen Zahlungen fortgesetzt werden sollten und so weiter. In Punkt 7 schließlich heißt es, und hier knirscht die Stahlfeder: »Was bei der Zurückgabe der Mannschaft fehlt, wird vergütet.« Das hieß, von Goethe so ausgehandelt: für einen gefallenen Infanteristen 100 Gulden, für einen Kavalleristen (Pferd inklusive) 300. So im »untertänigsten Pro Memoria«, am 30. November 1784 unterschrieben von »Ew. Hochfürstlichen Durchlaucht untertänigstem treugehorsamstem Johann Wolfgang Goethe«.
Ein Daniel Schubart hätte das Vermieten von jungen Männern, ihren Verkauf im Todesfall nicht nur beklagt, er hätte hier entschieden protestiert: Landeskinder zum Stückpreis …! Auch Schiller hat durch eine seiner Dramenfiguren scharfe Anklage gegen solche Praktiken erhoben. Und Goethe? Er handelte hier Konditionen aus, formulierte die Vorlage für den Herzog. »Was bei der Zurückgabe der Mannschaft fehlt, wird vergütet«: auch das hat Goethe geschrieben.
Ja, ja, ja: immer neue Regenwolken werden herangeschoben, lassen ihr Wasser ab, und was zuweilen antrocknet, wird gleich wieder naß, und was noch feucht ist, wird klatschnaß, quietschnaß. Als wären kumulushohe Wächter im Atlantikhimmel postiert, die jedes Hoch, das sich heranzubewegen traut, harsch zurückweisen, die nur noch Tiefs einwinken, und es regnet, regnet, regnet.
Zuweilen, wenn niemand in Sichtnähe ist, weiche ich bei meinen Spaziergängen hier im Tal von den längst nicht mehr festen Wegen ab, gehe durch Matsch, um das Saug- und Schmatzgeräusch zu hören, das Goethe nicht beschrieben hat, dieses satte »Pflatsch!«, mit dem sich der Schuh aus dem Dreck löst, der ihn sofort umschließt – zuweilen mußten Soldaten während der Campagne ihre Stiefel wie Futterrüben aus dem Boden reißen, mit beiden Händen.
Weiter im Text …! Goethe, der von Carl August bei insgesamt drei militärischen »Kriegsoperationen« (so der Herzog) mitgenommen wurde – es wäre sinnvoll (etwa an dieser Stelle), ein Kapitel über den Fürsten und Freund einzurücken. Nun habe ich ja meist in Wien, Rom, Dresden gelebt, ich bin kein Kenner der hiesigen Hofgeschichte, will mich, kann mich, möchte mich in diese Materie auch gar nicht einarbeiten, und doch sind hier Kenntnisse notwendig, sonst wird die Geschichte nicht richtig erzählt.
In dieser Notlage habe ich mich wieder einmal vertrauensvoll an Schuchardt gewendet, den früheren Registrator der Großherzoglichen Bibliothek, den Erarbeiter des zweibändigen Katalogs von Goethes Kunstsammlungen, des dritten Bandes über seine Natursammlungen – selbstverständlich im Hause Frommann gedruckt! Zur Zeit ist Schuchardt auch noch Direktor der hiesigen Zeichenschule. Ich erwähne das, um mir plausibel zu machen, weshalb Schuchardt einerseits der richtige Mann ist, weshalb er aber seinerseits einen Zulieferer suchte. Er fand ihn in der Bibliothek: ein Veteran der Befreiungskriege, damals verwundet. Ich hielte es für ein Gebot der Fairneß, seinen Namen zu nennen, doch er möchte bescheiden im Hintergrund bleiben. Eventuell werde ich in der definitiven Fassung dieses Buchs einen Weg finden, ihm meinen Dank für die ausführlichen Notizen zu erstatten, die ich dieser Skizze zugrundelege.
Ich muß hier freilich eine Auswahl treffen. Von Kindheit und Jugend des Herzogs berichte ich nicht weiter. Ich will höchstens erwähnen, daß seine Mutter für ihn (und seinen jüngeren Bruder) einen heute berühmten Mann als Erzieher aussuchte, Christoph Martin Wieland. Als weiterer Erzieher Graf Götz, der mit dem jungen Mann ein halbes Jahr in Paris lebte – pädagogische Erweiterung des Horizonts …
Zum Erstaunen seiner resoluten Mutter, die sich an die Regentschaft gewöhnt hatte, bestand Carl August darauf, pünktlich am 18. Geburtstag das hohe Amt zu übernehmen. Vier Wochen später fand die Hochzeit statt mit Luise von Hessen. Einen Monat darauf traf Goethe in Weimar ein.
Der junge Fürst der kleinen Residenz (etwa 6000 Einwohner) und des kleinen, territorial nicht einmal zusammenhängenden Landes (etwa 120000 Bewohner) war in seiner Mentalität nicht kleinstädtisch und kleinstaatlich, er arbeitete hin auf die Bildung größerer Konstellationen. Als erster unter den Fürsten kleinerer Länder trat Carl August dem Gründungs-Dreierbund von Preußen, Sachsen, Hannover bei. Er träumte davon, daß sich alle Fürsten der 49 deutschen Kleinstaaten und Staatsbildungen dem Bund anschließen würden; man sah in Carl August bald so etwas wie einen Kurier im Deutschen Fürstenbund. Er hoffte, daß der Zusammenschluß zu einer Reichsreform fuhren würde, zu einer neuen Verfassung, aber so weit kam es damals noch nicht – eine der großen Enttäuschungen im politischen Leben dieses Fürsten.
Auch als Soldat, als Offizier dachte er in größeren Dimensionen als die meisten seiner Amtskollegen, er projektierte ein gemeinsames »stehendes Heer« des Fürstenbundes, mit der Zentralgarnison Mainz. Er wurde hier aktiv: »Durch nützliche Gespräche die Lähmung meiner Existenz vermindern« …
Gleichsam als Vorübung schloß sich der Befehlshaber der Weimarer Infanterie, Kavallerie, Artillerie und des Scharfschützenbataillons dem damals größten militärischen Verband an, der preußischen Armee. Offenbar ergab sich bei Gesprächen ein guter Kontakt mit dem Nachfolger Friedrichs des Großen, mit Friedrich Wilhelm II. Der ernannte Carl August zum Generalmajor und übertrug ihm noch im selben Jahr 1787 die Führung des 6. Kürassier-Regiments.
Dies wurde von leitenden Beamten in Weimar nicht einhellig begrüßt, denn es war zu befürchten, ja zu erwarten, daß sich der begeisterte Soldat etwas zu oft in der Garnison, etwas zu wenig in der Residenz aufhalten würde. Die Weimarer Residenz, die Garnison zu Aschersleben (südlich von Magdeburg): zwei Brennpunkte einer Ellipse.
Eine weitere Befürchtung der Administration: Als Generalmajor einer preußischen Einheit werde der Fürst künftig teilnehmen müssen an militärischen Unternehmungen, die von König und Kabinett in Berlin beschlossen werden.
Schon im selben Jahr wurde denn auch eine geheime Reise nach Berlin notwendig: der Herzog und der Vorsitzende des Militärausschusses wollten rechtzeitig erfahren oder erkunden, ob – wie es hieß – ein Krieg geplant wurde, der Weimar in Zugzwang bringen konnte. Wenige Maitage mit gedrängtem Programm, es überwog Militärisches. In Potsdam Besichtigung des sogenannten Exerzierstalls – ein großes Gebäude, das in seiner simplen Ausführung einem Stall glich. Auch in übertragener Bedeutung war dies eine treffende Bezeichnung: Soldaten der glorreichen friederizianischen Armee wurden wie Vieh behandelt und mißhandelt – die bekannte Erbarmungslosigkeit der preußischen Militärmaschinerie. Gequälte, getretene, geschlagene, geschundene Soldaten – wie sollten sie motiviert sein? Ja, im Exerzierstall konnte man eigentlich schon sehen, was in Frankreich zur Niederlage beitragen wird.
Nach dem Exerzierstall das Militärwaisenhaus, ebenfalls in Potsdam: etwa fünftausend Zöglinge im riesigen Bau! Und Goethe nahm, mit dem Herzog, an einem Manöver teil, schaute zu bei einer Parade, ging ins Zeughaus, inspizierte Geschütze und Gewehre, ließ sich eine Gewehrfabrik zeigen … Goethe nach diesen Inspektionen an Frau von Stein: »Es ist ein schön Gefühl, an der Quelle des Krieges zu sitzen in dem Augenblick, da sie überzusprudeln droht.«
Der bayerische Erbfolgekrieg zwischen Preußen und Österreich fand jedoch nicht statt, dafür ein Ersatzkrieg weiter nördlich: der frisch ernannte Generalmajor wurde mit seiner Einheit in den Niederlanden eingesetzt. Carl August aber konnte sich keine Orden verdienen, der Feldzug wurde, wie man damals gern sagte, zu einer militärischen Promenade. Sie wurde beendet mit der kampflosen Kapitulation von Amsterdam – vielleicht eine Erfahrung, die beim Koalitionskrieg allzu leichtfertige Erwartungen auch beim Herzog wecken wird.
Der zog jedes Frühjahr, jeden Herbst zu den drei Garnisons-Städtchen seines Regiments: nach Aschersleben, Oschersleben, Kroppenstedt. Er inspizierte die Exerzierübungen seines »Völkchens«, legte aber auch großen Wert auf militärische Übungen.
April 1789 war er wieder in Aschersleben, seinem Hauptquartier. Sein Troß respektive »Train« war auch diesmal schon vor ihm zur Garnison gezogen. Der Lebens- und Selbstdarstellungsstil eines Barockfürsten wirkte nach; er reiste mit einem Kämmerer, einem Kammerdiener, mit fünf Hofbedienten, einem Schreiber, einem Garderobendiener, einem Mundkoch, einem Küchenburschen, einer Küchenmagd, einer Bettmagd, zwei Jagdkutschern, einem Reitknecht, zwei Leibhusaren – meist 16 Personen.
Der Herzog blieb meist sieben bis acht Wochen in der Garnison. Hinzu kamen jeweils einige Wochen in der zweiten Jahreshälfte: Herbstmanöver, Herbstparaden. Er fühlte sich wohl unter Soldaten, Offizieren. Goethe gebraucht hier den bekannten Vergleich vom Fisch im Wasser, Carl August formulierte das etwas origineller, schrieb von seinem »kentaurischen Leben« am Vormittag. Die Zäsur zwischen Pferd und Mensch dann mittags. Zum Essen lud er Offiziere seines Regiments ein; auch abends der »Offizierstisch«. Dem Herzog lag sehr an persönlichem Kontakt mit seinen Offizieren. Das war ihm so wichtig, daß er diesen Punkt ausformulierte in einem der Reformvorschläge, die er nach oben reichte – und die jeweils zu den Akten gelegt wurden.
Von Aschersleben oder Oschersleben ritt er gelegentlich zum Herzog von Braunschweig, in die Garnison Halberstadt. Oder er besuchte den Fürsten von Anhalt in Dessau.
Das alles schien, aus der Ferne gesehen, nicht uninteressant. So schrieb Goethe 1789 dem Herzog, er würde gern bei einer der Paraden (»Revuen«) zuschauen. »Das Programm, das Sie mir mitschicken macht mir Lust, auch so etwas einmal zu sehen. Es ist unerlaubt, daß ich noch keine Revue gesehen habe. Es ist doch eines der merkwürdigsten Dinge, welche die Welt hat und gehabt hat.« Bereits im Herbst dieses Jahres reiste Goethe nach Aschersleben, als Begleiter der Herzogin Luise und ihrer Hofdame. Eine gute Woche lang blieb man in der Garnisons-Kleinstadt, beschaute und bestaunte Paraden und Übungen.
Der zweiunddreißigjährige Herzog und sein vierzigjähriger Gefolgsmann, von einem Erfurter Buchhändler skizziert in einer Aufzeichnung dieses Jahres: »Jetzt trat er herein – in seiner Regimentsuniform, weiß und rot, mit großen, mächtigen Reitstiefeln. Der berühmte Geheime Rat Goethe war sein Begleiter. Goethe geht nicht mehr so geniemäßig einher wie ehmals – hat sich ganz nach Hofetiquette geformt. Er kam in einem zimtbraunen Bratenkleide, Chapeau bas, mit dem Degen an der Seite dahergeschritten – machte Komplimente wie der steifste Hofjunker. – Der Herzog trägt einen recht venerablen Bauch vor sich her – und sein Gesicht ist wie ausgestopft – er schreitet mit steifen, ernsten Heldenschritten – kaum, daß man ihn lächeln sieht.« So machte der Herzog sichtbar, daß er sich »zum Soldaten geboren« fühlte, wie Goethe es formuliert, daß er »in seinem militaristischen Wesen recht zu Hause« war.
Ein Auftritt im Jahre 1789. Im folgenden Jahr wurde es – beinah – ernst: der Feldzug nach Schlesien. Eine militärische Einschüchterungsgeste an der nördlichen Grenze des österreichischen Kaiserreichs, das damals noch Preußens und Rußlands Feind war – was sich beim Aufmarsch gegen Frankreich ändern wird. Ein Krieg mit Österreich schien wieder möglich, doch Goethe hoffte auf eine friedliche Lösung.
Das »Feldlager« in Schlesien: Goethe exerzierte hier vor (ich wähle bewußt diesen militärischen Ausdruck), daß er sich auch in soldatischem Ambiente auf naturwissenschaftliche Forschungen konzentrieren konnte. »In all dem Gewühle hab ich angefangen, meine Abhandlung über die Bildung der Tiere zu schreiben, und, damit ich nicht gar zu abstrakt werde, eine komische Oper zu dichten.«
Ein weiteres, von Schuchardt herausgesuchtes Zitat: »In Breslau, wo ein soldatischer Hof und zugleich der Adel einer der ersten Provinzen des Königreichs glänzte, wo man die schönsten Regimenter ununterbrochen marschieren und manövrieren sah, beschäftigte mich unaufhörlich, so wunderlich es klingen mag, die vergleichende Anatomie.«
Der Herzog sorgte dafür, daß auch Fleisch zu den Knochen kam: »Goethe isset und trinket sehr stark«, schrieb er seiner Mutter. Diverse Vergnügungen in schlesischen Städtchen und in Krakau. Heikler Punkt: Goethe soll eine junge Adlige kennengelernt haben, die ihm rasch sehr wichtig wurde, ja, er soll der einundzwanzigjährigen Henriette Freifrau von Lüttwitz einen Heiratsantrag gemacht haben, den ihr Vater im Standesdünkel freilich ablehnte. So hat das ihr Bruder bezeugt, in einem Buch, das drei Jahre nach Goethes Tod erschien. Sollte das stimmen und womöglich dokumentiert werden, so geriete unsere Großmutter (mit der uns eine Art Fernliebe verbindet) in ein schiefes Licht, und das würde ich ihr gern postum ersparen. Deshalb erwähne ich diesen Punkt selbstverständlich auch nur in diesem Entwurf, also ganz unter uns, caro amico …
Der Krieg zwischen Preußen und Österreich, er fand auch damals nicht statt (vor kurzem wurde er ja nachgeholt). Zwei Jahre nach dem Feldlager in Schlesien der Feldzug in Frankreich. Nun kannte sich Goethe im militärischen Bereich schon aus. Und: mit den meisten Offizieren im Gefolge des Herzogs hatte er in Aschersleben bereits am »Offizierstisch« gesessen und wieder in Schlesien: »Wir alten Kriegs- und Garnisonskameraden«. Ich bezweifle, ob diese Formulierung von Goethes Bewunderern oft hervorgehoben wird. Doch so ist es überliefert: Goethe fühlte sich wohl im Kreis »alter« Garnisons- und Kriegskameraden.
Und er folgte dem Regiment Weimar nach Frankreich, ohne vorgegebenen (oder vorgeschobenen) dienstlichen respektive militärischen Auftrag; wahrscheinlich wurde erwartet, daß er später eine Chronik des voraussichtlich triumphalen Feldzugs verfassen würde.
Freilich, Goethe war »weder am Tode der aristokratischen noch der demokratischen Sünder im mindesten etwas gelegen«. Er sah im Krieg zwar die »Erbkrankheit der Welt«, hoffte aber, auch in diesem Fall werde es glimpflich abgehen: »Das gute Schicksal lasse aus dem bevorstehenden Feldzug keinen Krieg werden.« Aber die hohen Herren spielten selber Schicksal, sie wollten den Krieg, partout, den Frankreich formell erklärt hatte.
Goethe stellte einmal fest, privat, »Kriegslust« plage den Herzog wie die »Krätze«. Es fiel der Kriegslust in diesem Falle leicht, sich zu rechtfertigen: Man wollte dem abgesetzten König Louis wieder zu Amt und Würden verhelfen, wollte der »Anarchie«, dem »Chaos« der Revolution ein Ende bereiten. Damit verfocht man eigene Interessen: was Preußen wie Österreicher am meisten fürchteten, war eine »Überpflanzung neufranzösischer Grundsätze« auf eigenen »Boden«. Ansätze dazu sah der Herzog bedrohlich nah: Studentenunruhen in Jena – wenn auch unentschlossen und ziellos. Dennoch: vom Heeressammelpunkt Koblenz aus wies er den damaligen Regierungsrat Voigt an, in Jena »kräftig zuzupacken«: »Die Unruhen in Jena erfordern zuverlässig eine sehr ernstliche Beendigung, und die Orden (Burschenschaften) müssen auf alle mögliche Weise ausgerottet werden.« Die Gefährdung der Landesordnung durch »demokratische Schwärmerei« sei keine Chimäre, »ich habe hier Beweise erhalten«. Also schien der Einmarsch notwendig: »Ein wahres Glück, daß die großen Mächte der Anarchie, welche gewiß der ganzen Menschheit drohte, den Kopf abbeißen.«
Abbeißen, ausrotten …: diese Aggressivität und Radikalität war sogar noch steigerungsfähig! Ich muß hier einen Satz zitieren, den mir Schuchardt nur ungern vorlegte. In einem Brief, ebenfalls an Voigt, schrieb Carl August in wackelnder Syntax: »Daß, ohne diese Stadt ihrer jetzigen Form und Wesen nach gänzlich zu zernichten, niemals dauerhafte Ordnung und Ruhe in Frankreich hergestellt werden kann.« Die völlige Vernichtung der materiellen wie der geistigen Substanz von Paris: das schien dem Fürsten von »Ilm-Athen« zumindest denkbar. Dabei wußte er, wovon er sprach und schrieb: als junger Mann hatte er Paris schließlich kennengelernt, gemeinsam mit dem jüngeren Bruder und dem Erzieher.
Ich frage mich, wie Goethe mit diesem Satz umgegangen ist – falls sein Herzog ihn in der gewohnten Runde ausgesprochen hat, bevor er zu Papier gebracht wurde. Hat Goethe, als Mann »an der friedlichen Seite der Welt«, den Herzog als Mann »am kriegerischen Ende« kritisiert, unter Freunden? Hat er diesen Satz überhört, scheinbar weltmännisch? Hat er, unter Kumpanen, diese typisch drastische Äußerung nachsichtig belächelt?
Wie auch immer er reagiert haben mag, wir müssen unsere eigene Antwort auf diese monströse Äußerung finden. Dabei wird Dein Votum großes Gewicht für mich haben, lieber Friedrich Johannes Frommann: Deine drei Jahrzehnte Vorsprung an Alter, damit an Erfahrung – auch im Umgang mit heiklen Sätzen, die im Druck erscheinen. Sobald meine Buchskizze komplett vorliegt, sag mir unumwunden, wie wir mit diesem Spreng-Satz umgehen sollen. Ich werde darüber auch mit Walter sprechen. Hier im Entwurf mag der Satz auf Widerruf stehenbleiben: »Daß, ohne diese Stadt ihrer jetzigen Form und Wesen nach gänzlich zu zernichten, niemals dauerhafte Ordnung und Ruhe in Frankreich hergestellt werden kann.«
Obwohl ich vor drei Jahren noch nicht ernsthaft plante, ein Buch über Goethe in Frankreich zu schreiben, war ich hinter ihm hergefahren. Um fruchtlose Familiendebatten zu vermeiden, hielt ich diesen (mich selbst überraschenden) Plan geheim. Noch auf den ersten Etappen erschien mir die Fahrt überaus gespenstisch: war sie Realität, war sie Tagtraum?
Erst in Trier schrieb ich Mutter Ottilie und meinem Bruder Walter. Durch Einspruch, Warnung, Widerspruch wollte ich nicht zurückgehalten, nicht einmal irritiert werden. Erneute, womöglich besonders heftige Gesichtsneuralgien, und du kannst nicht mehr aus den Augen gucken?! Schwere asthmatische Anfälle und du findest nicht rasch genug einen guten Arzt …?! Unberechtigt wären solche Warnungen nicht gewesen, denn die Reise fand statt im selben Jahr, in dem ich den öffentlichen Dienst aufgegeben hatte: mein Gesundheitszustand ließ diese Tätigkeit nicht mehr zu, vor allem, als ich einen neuen Vorgesetzten erhielt, mit dem die Zusammenarbeit schwierig wurde. Meine Motivation hatte sich ohnehin verflüchtigt. Also erst einmal Erleichterung, als ich mit 42 Jahren schon frei war, und zugleich: wieviel Lebenszeit lag noch vor mir, liegt immer noch vor mir? Ich mußte mir eine neue Aufgabe stellen, eine Zwischenaufgabe zumindest, also setzte ich mir in den Kopf, nach Frankreich zu reisen, im selben Alter, in dem Goethe nach Frankreich gezogen war. Nach etwas Bummelei kam es schließlich so aus, daß ich ebenfalls 43 war, als ich in Frankreich umherfuhr.
Selbstverständlich bin ich nach Trier mit der Bahn gereist. Dort habe ich einen Wagen gemietet, samt Pferd und Kutscher. Jean Arendt: von Arbeit, Wetter, Suff gestaltete Gesichtslandschaft. Daß er auch während der Reise trank, konnte er bis Longwy vor mir verbergen: das Flaschenversteck im Futterkasten. Zufällig aber, hinter einem Baum hervortretend, überraschte ich ihn mit angesetzter Flasche und rief ihm zu: »Davon könnten Sie mir eigentlich auch einen Schluck spendieren!« Damit war plötzlich Vertrauen geschaffen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er noch keine rechte Vorstellung vom Sinn der gemeinsamen Reise gewonnen. Will der Herr römische Bauwerke besichtigen? Will er Festungsbau studieren? Will er Landschaften entdecken? Nun war das alles nicht mehr wichtig, denn ich konnte ihm Schnaps eingießen, sorgte gelegentlich mit für »Nachschub«. Und den brauchte Jean! Denn er sah nur noch wenig Zukunft für sich als Leihwagenkutscher, überall wurden Eisenbahngleise verlegt, dies war womöglich die letzte Fahrt auf größere Distanz. Belastend auch: familiäre Wirren – drei Kinder, aber von zwei Frauen …
Solide Kutsche, langsame Pferde. Beinah feldmarschmäßig mein Gepäck: ein Zelt, wie es seinerzeit Offizieren zugestanden hätte; ein Feldbett, zusammenklappbar, zusammenschraubbar; ausreichend Decken; eine große und genaue Landkarte; ein Kompaß; Windlichter; Besteck und Geschirr. Jean freilich genügte sein Messer, damit schnitt er sich (oft gefährlich dicht vor den Lippen!) Stücke vom Fleisch los, das er im Biß hatte, schnitt Käsewürfel zurecht.
Dies zu meiner Goethe-Reise in Frankreich, einleitend. Ich werde den Bericht in Fortsetzungen weiterführen.
Rückfall, ganz unerwartet. Zwei Vorhöllentage, mit eingeübten Praktiken der Ablenkung von den Gesichtsschmerzen; zwei Höllennächte, weil ohne jede Ablenkung. Tage mit Ingrimm verbracht. Vergeblich Linderung gesucht mit geeistem Eau de Cologne, mit Chininsulfat, Morphinpulver … Versuche, mich auf Goethe zu konzentrieren, infolgedessen völlig gescheitert, hätte keine Zeile über ihn schreiben können. Auch Goethe-Lektüre wollte nicht gelingen. Ich hinfällige, schmerzgeplagte Kreatur will von diesem allumfassenden, alles umfassenden Vorbild nicht dauernd auf meine Grenzen hingewiesen werden, möchte nicht in pädagogische Provinzen entfuhrt und dort nachgebessert, womöglich geläutert werden, will nicht immer alles gut und richtig machen, auch nicht in diesem geplanten Buch, ich werde, voraussichtlich, solche Abschweifungen stehen lassen …
Also, ich habe gestern das Gartenhaus verlassen, spätnachmittags, bin zum Frauenplan getappt. Kurzes Gespräch mit dem alternden Schuchardt. Walter hat sich ihm gegenüber mal wieder beklagt, in einem Brief: »Staub, Moderhauch und böse Geister … die Überbliebenen von Tantals Haus … die große Last, die Haus und Sammlung uns aufbürden …« Seine Lieblingsformulierung: »Goethe-Gerümpel«. Sein Lieblingszitat: »Entzieht Euch dem verstorbnen Zeug, Lebend’ges läßt uns lieben.« Hat ein gewisser Friedrich Frommann als junger Mann geschrieben …! Ihr habt ja recht!
Trotzdem ging ich ins Arbeitszimmer-Archiv, blätterte herum. Theaterstücke, Theaterstückchen im Ersten Band der NEUEN SCHRIFTEN. GROSS-COPHTA … BÜRGERGENERAL … Seine Methode, sich mit der Französischen Revolution auseinanderzusetzen: Theaterfiguren gegen das historische Ereignis ins Feld geführt. Muß ich sie alle wieder lesen, diese dürftigen Stücke?! Schreiende, ja wahrhaftig schreiende (unterdrückt schreiende) Ungerechtigkeit, ich gebe es zu. Erneuter Schwur, nichts über seine Werke zu schreiben, da halte ich mich lieber an Balzac. Doch Goethes Taten … Ist mit der Koalitionsarmee in Frankreich eingerückt, die dem abgesetzten König Louis den Rückweg zum Thron freischießen sollte. Müßte mich eigentlich über die Entwicklung der Revolution bis zum August 1792