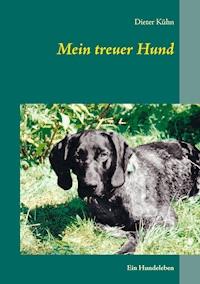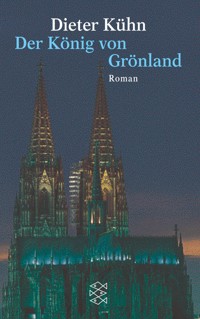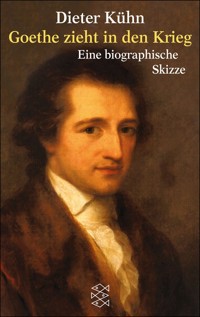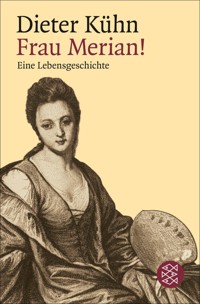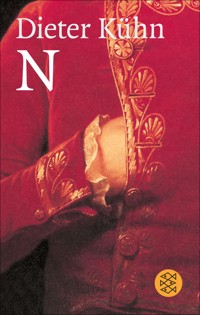9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Immer wieder hat Dieter Kühn zwischen seinen großen Biographien, Romanen und Übertragungen aus dem Mittelhochdeutschen auch für das Theater geschrieben. Schon von schwerer Krankheit gezeichnet, hat er die besten seiner Stücke, überwiegend Komödien, für dieses Buch ausgewählt. Sie werden hier erstmals oder in komplett überarbeiteten Fassungen gedruckt. Es ist das klassische Well-made-Play, zu dem sich Kühn mit diesen Stücken bekennt, getrieben von schlüssigem Plot, psychologisch profilierten Rollen, blitzenden Dialogen, überbordender Spielfreude. Vorhang auf! »Ich habe mir Spielräume eröffnet.« Dieter Kühn
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 358
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Dieter Kühn
Spätvorstellung
Mein Theaterbuch
FISCHER E-Books
Inhalt
Geschlossener Vorhang
Vorwort
Immerhin hatte ich erleben können, dass Stücke von mir zur Uraufführung gelangten, Anfang der siebziger Jahre, in Frankfurt, Wiesbaden, Oberhausen, Braunschweig, Düsseldorf. Gelegentliche Neuinszenierungen. Sogar Aufführungen in Paris und Djakarta. Aber dann riss der Faden, erst mal bei mir – ich gab mich auf als Theaterautor, konnte mich, auch ohne Stücke zu schreiben, entfalten. Blieb jedoch Zuschauer, auch bei später berühmten Inszenierungen.
Grübers Winterreise im Berliner Olympiastadion. Eiskalte Dezembernacht; in kleinem Segment des ansonsten leeren Stadions ein paar hundert Zuschauer; Decken waren verteilt. Auf dem Fußballfeld ein Zelt, eine Imbissbude, ein Nachbau des Portikus des Anhalter Bahnhofs. Fragmentarische Textvermittlung über die Anzeigetafel, über einen Dauerläufer, der Hölderlin rezitierte während seiner Runden.
Steins Projekt Shakespeare’s Memory in Hallen des CCC-Filmstudios. Dort konnte man in einer überdimensionierten Wunderkammer lustwandeln, in Gruppen, in Scharen. Installationen und Präsentationen; das Gesamtkonzept schien, zumindest in der Erinnerung, weithin vom Zufall bestimmt. Stets jedoch, in der Generalperspektive, Shakespeare: Vorspiele, Vorübungen; Begleiterscheinungen, kaleidoskopisch. Aufwendige, vielfältige Annäherungsversuche an ein übergroßes Phänomen … Waren eher der Bühnenbildner, der Ausstatter gefragt als der Regisseur?
Heymes Wallenstein in Köln: Grandios die Konzeption, »Das Lager«, »Die Piccolomini« und »Wallensteins Tod« nicht aufzureihen, sondern ineinander zu verschränken: das Lager, Wallensteins Basis der Selbstrealisierung als Feldherr, nun nicht als Vorspiel, sondern wiederholt in kurzen Szenen Präsenz gewinnend, wechselweise mit dem Geschehen auf Führungsebene …
Und wieder Grüber, eine Performance im Rudiment des bombengeschädigten Riesenhotels Esplanade. Nicht die geringste Erinnerung an ein Stück oder Text-Arrangement in den verbliebenen Räumlichkeiten, nachwirkende Präsenz aber jenes Ambientes: Wir Zuschauer flanierten. Ein Salon, noch mit Stuckaturen … ein kleinerer Raum, mit Stroh ausgelegt, das unsere Schritte raschelnd hörbar machte … ein Raum, ein Fenster mit Ausblick: auf die Mauer, neonhell beleuchtet, etwa hundert Meter entfernt. Stille. Oder hörte man gelegentlich das Bellen von Streifenhunden? Ein Hochhaus, weiter entfernt, mit riesigen Leuchtbuchstaben westwärts: DDR. Diese Konstellation vor allem hat sich eingeprägt: vom Zufall verschonte Räume eines fast völlig verschwundenen Grandhotels … leere Fläche zwischen Ruine und Mauer … Sichtverbindungen: Wilhelminische Ära – Kriegszeit Zwo – Teilung des Landes.
Das wirkte nach, also holte und hole ich nach, präzisierend: Erhalten blieben samt Innendekorationen Frühstückssaal und Kaisersaal … Nach dem Krieg eingeschränkter Restaurantbetrieb … Tanzveranstaltungen und Modeschauen … Das Hotelrudiment beinah zum Abriss freigegeben … Nach der Wende die legendäre »Translozierung«: Der Kaisersaal als isolierter Kubus hydraulisch um fast hundert Meter verschoben … Der Frühstückssaal in ein halbes Tausend Fragmente zerlegt und wieder zusammengepuzzelt. Die Saalbauten als Fundstücke eingefügt in das Sony-Center am Potsdamer Platz: Exponate in hochkant gestellter Vitrine … Da hätte man gleich Rekonstruktionen installieren können …
Und wieder Köln: ein radikaler, ganz und gar nicht werkgetreuer, dennoch schlagartig überzeugender Eingriff in Lessings Nathan der Weise (Nicolas Stemann)! Der Tempelherr mäht mit einer Maschinenpistole alle Figuren nieder, Nathan erscheint auf der Fläche mit Leichen; jetzt erst, neben seiner toten Pflegetochter, die berühmte Ringparabel: Wie eine Arie über einem »killing field« – mir blieb die Luft weg.
Ich begann, frühere Stücke nicht nur zu bearbeiten, sondern grundlegend umzuschreiben. Es kamen neue Projekte hinzu; in den Jahren 2013, 2014 habe ich weitergewerkelt im Bewusstsein, dass ich mit »well-made plays« keine Chance habe, aber die wollte ich nutzen, dem bewährten Spruch folgend. Obwohl ich in dieser Zeit mehrfach realisieren musste, dass Theaterstücke weithin als Trampoline dienen, auf denen Regisseure und Regisseurinnen möglichst sensationelle Sprung- und Flugfiguren präsentieren.
So arbeitete ich an Stücken weiter in einer Ära, in der entschiedene, mehr als nur irritierende Positionswechsel stattfanden: dominierend auf deutschsprachigen Bühnen längst nicht mehr der Autor, sondern der Regisseur. Das wurde 2014 offiziös: Thomas Oberender, Intendant der Berliner Festspiele, proklamierte im Deutschlandradio das Aus für Theaterautoren. Stichwort: Abschaffung des Stückemarkts.
Worum war es da gegangen? In öffentlichen Veranstaltungen hatten Schauspielerinnen und Schauspieler Texte neuer, noch nicht aufgeführter Stücke vorgestellt. Ich war mal mit von der Partie, im Berlin der siebziger Jahre: Szenische Lesung von Separatvorstellung. 1978 die Uraufführung in Wiesbaden. Jener Stückemarkt sollte also abgeschafft werden. Symptom von Veränderungen, die bereits seit Jahrzehnten laufen, sich immer radikaler entwickelnd. Auch ich fühle mich direkt und indirekt betroffen; dieser Bericht soll allerdings nicht unter dem Vorzeichen subjektiver Gefühle formuliert werden, ich zitiere aus einem publizierten Begleitdiskurs (nachtkritik, Ulf Schmidt) zur Entscheidung in Berlin. Leitfrage: Warum Autoren am Theater nicht mehr gebraucht werden.
Antwort: »Der Autor des Theaters sei nicht mehr der Schreiber, sondern der Regisseur – das führte der Leiter der Berliner Festspiele 2014 in einem Interview mit Deutschlandradio Kultur aus. Das Faktische scheint ihm dabei recht zu geben: Gefeierte Theaterstars sind heute nicht mehr Dramatiker (ein Wort, das man kaum mehr ernsthaft benutzen kann), sondern Regisseure bzw. ›Macher‹.«
Ja, es hat sich ein veritables »Feindbild« entwickelt, »sofern es sich um schreibende Autoren handelt. Denn mit der Autoritätskritik der sechziger Jahre wurde auch der Autorenbegriff problematisch.« Und so landet das Konzept Autorschaft »auf dem Müllplatz der Geschichte«. (Zumindest in deutschsprachiger Theaterwelt; der »German virus« erweist sich jedoch als grenzüberschreitend.)
Fazit: »Eine goldene Regiegeneration trat an.« Die zeichne aus ein »hochgradig pragmatischer Umgang, der sich von Text-Autoritäten abwendet. Man produziert eigene sprachliche Artefakte im Produktionsprozess. Die können von Experten des Alltags kommen, es sind Aktentexte oder andere selbst erarbeitete Texte. Dabei wird die klassische Autorschaft ausradiert.« Werk ist nur noch »so ein hübscher alter Begriff«. Denn es »langweilt einen Regisseur, der Fremdes aneignen will. Am Text entlang zu inszenieren, ist altmodisch, jedenfalls aber nicht ruhmesförderlich auf dem Regiemarkt.«
Auch Zuschauer »lassen sich heute nicht mehr mit dem Niveau der Tradition abspeisen«. Als Folge: Das »einsame Schaffen am Schreibtisch des Schreib-Autors ist vorbei«. Wieder der Leiter des Berliner Theatertreffens: Heute gelten Theater als »Orte, in denen Autoren arbeiten, und diese Autoren nennen sich Regisseure«.
Wenn dieses Buch im Druck erscheint, ist das alles vielleicht schon vergessen, samt Kommentar. Hier aber, im begleitenden Werkbericht, müssen solche Faktoren zumindest erwähnt werden. Keine Begleitmusik, das nun doch nicht, aber Begleiterscheinungen, die wahrgenommen wurden, mit Irritationen. Denn natürlich fragte ich mich zuweilen: Was machst, was treibst du da eigentlich? Arbeitest lustvoll Dialoge aus, baust Handlungsbögen auf, lässt Figuren agieren in Abläufen, die stringent sein, in Plots, die tragen sollen. Alles letztlich kontraproduktiv, oder?!
Regisseur-Autoren brauchen also keine Stücke mehr, sondern »Materialien«, die sie tradierten Schauspielen entnehmen und textfern umsetzen, falls nicht Romane oder Drehbücher berühmter Filme für Bühnen adaptiert werden, sei es von John Cassavetes oder Fritz Lang – wobei fast ständig Filmausschnitte projiziert werden! Zudem Anreicherungen, fast notorisch, durch Popsongs (etwa in Zeitabständen von Werbeblöcken im TV) sowie durch frei eingefügte Zitatsequenzen.
Solch ein regiegeneriertes »Artefakt im Produktionsprozess« sah, beispielsweise, im Hamburger Schauspielhaus vor vielen Jahren schon so aus: »Mephisto. Nach dem Roman von Klaus Mann von Andres Paulin. Mit Texten von Goethe, Mnouchkine, Nietzsche, Sloterdijk, von Wangenheim, Gründgens, Thomas Mann u.a.«
Oder man nimmt gleich das Telefonbuch als Material. Offenbar, offenkundig lässt sich sogar hier ein interpretatorischer Überbau kreieren. Was nun folgt, ist keine Realsatire, sondern ein theatereigener Begleittext der Hamburger Dramaturgie: »Nichts Geringeres schwebt uns vor, als das Telefonbuch als literarisches Dokument zu würdigen und für das Theater zu entdecken. Einem literarischen Mammut wird ein theatralisches Denkmal gesetzt. Welch ein Werk! Seine Entstehung entspringt einem Grundbedürfnis des Menschen nach Austausch. Nichts anderes war die Rolle der Rhapsoden bei den Alten, Homer ihr bekanntester Vertreter. In allen Epochen ging damit ein enzyklopädischer Anspruch einher. Eine ganze Welt, eine ganze Zeit sollte gefasst werden. Das war bei den antiken Epen nicht anders als in der Neuzeit bei Marcel Proust. Welch ein Werk! Es bewegt sich ganz auf der Höhe zeitgenössischen Erzählens.« Ich staune: Ein Telefonbuch, und sei es das der Hansestadt Hamburg, es ist von gleichem Rang wie homerische Epen, wie Prousts mehrbändiger Roman?! Obskures »upgrading«!
Statt weiterem Kommentar ein Zitat aus einem Interview mit der großen Regisseurin Andrea Breth. »Das heutige Theater ist wie ein Supernaschmarkt ohne irgendeine Zielsetzung. Ich bin der Meinung, dass der Regisseur ein Handwerker ist, kein Primärkünstler. Ich verstehe mich als Sekundärkünstlerin. Ohne den Text des Dichters wäre meine Arbeit nicht möglich. Auf der anderen Seite: Dieselben Leute, die so riesige Probleme haben, wie das Theater noch funktionieren soll, die sieht man Schlange stehen für einen fürchterlich melodramatischen Film. Viele Theaterleute erklären vehement, man könne heute keine Geschichten mehr erzählen. Und dann rennen sie ins Kino und sehen dort: Geschichten.«
Ja, dort gibt es sie weiterhin: Storys mit ausgefeilten Dialogen! Übermittelt von Schauspielern, Schauspielerinnen, sorgfältig ausgewählt – glaubwürdige Verkörperung von Figuren in glaubwürdiger Story.
Und erst mal die sogenannte E-Musik! Da wird nicht, frei nach Castorf, der Slogan ausgegeben, Partituren seien »nicht sexy«, da wird eine Komposition nicht zum Klangmaterial, über das frei disponiert werden kann, vielmehr bleibt es dabei: primär der Komponist, in zweiter Reihe der Interpret. Das wird im Reich der E-Musik weiterhin als selbstverständlich respektiert, besonders, wo »authentische Interpretation« erarbeitet wird.
Was für E-Musik, Literatur, Film gilt, das ist im Destruktionsareal heutiger Bühnen völlig out. Isoliertes Geschehen auf einer Insel, die immer weiter wegdriftet von den Kontinenten.
In jener weithin dominierenden Situation (mit rühmlichen Ausnahmen wie Breth oder Bondy!) war es fast erklärungsbedürftig, Theatertexte zu schreiben mit stringenter Story, profilierten Rollen. Und doch setzte ich immer wieder an zum Schreiben, zum Neuschreiben von Stücken, vor allem zum Komödiantischen hin. Die Lust am Entwickeln von Plots, die Lust am Entwerfen von Bildern, die Lust am Spiel mit adaptierten oder frei erfundenen Figuren. Ich schaffe mir Freiräume, eröffne Spielräume. Ich setze frei, fühle mich frei.
Zur Lust am Entwerfen von Bildern die Lust am Schreiben von Dialogen. Das ist zurzeit auf deutschsprachigen Bühnen auch kaum gefragt. So findet wenig Präsenz, was lange Zeit gefeiert wurde, zu Recht. Frei entfalten konnte ich mich hingegen in Hörspielen. Einige von ihnen sind, formal, ein durchlaufender Dialog, ohne Zäsuren, ohne Einschübe, und seien sie musikalisch – da heißt es, Spannungsbögen aufbauen.
1977 fand in Braunschweig die Uraufführung statt der Frühversion von Herbstmanöver. Das Schauspiel erschien auch im Druck: Spectaculum 27. So lässt sich leicht vergleichen, verifizieren, dass in der langen Zwischenzeit ein fast völlig neues Stück entstanden ist. Dies, auch dies verbunden mit Zuspruch und Einspruch: Helmar Harald Fischer hat die langfristige Arbeit an meinen Stücken mit produktiver Kritik begleitet.
Die Grundkonstellation des Stücks ist geblieben: Exilierter Kaiser und ausgemusterter U-Boot-Kapitän bei Holzarbeiten im Park von Huis Doorn. Das wurde in Braunschweig auf der Bühne nicht vorgetäuscht: aufgebockt ein veritabler Baumstamm. Und damit spezifische Erfahrungen: Bei der Arbeit mit der großen Baumsäge wurden für die Protagonisten im relativ kleinen Bühnenraum Sägespäne und Borkenstückchen frei: Durstgefühl, austrocknender Mund … Das hatten sich Autor, Dramaturgie, Regie nicht so vorgestellt. Besser also von vornherein Simulation. Was wiederum zur Gesamtkonstellation des Stückes passt: Wilhelm neigte zum Posieren, Simulieren.
Auch Separatvorstellung (Theater Heute12/1978) lässt oder ließe sich leicht vergleichen. Es wurde ein ganz anderes Stück, erhielt den neuen Titel Ach so, wir sollen sparen. Und Ihr?! – auch wenn König Ludwig und Richard Wagner die Protagonisten bleiben. Aber damals, in den siebziger Jahren, waren Sparprogramme noch kein Thema. Das lässt sich heute festmachen auch und gerade am Beispiel »Märchenkönig, Spartheater«, zu Lebzeiten Inbild grenzenloser Verschwendung (von der heute der Freistaat Bayern durchaus profitiert).
Krieg, Krieg, Krieg! wurde 2012 als »Szenisches Ritual« in der Mykenae Theaterkorrespondenz abgedruckt. Damals hatte das Stück noch die Form eines Rituals von Wiederholungen – was für das »Jahrhundert der Kriege« zutraf und permanent leider Fortsetzung findet im einundzwanzigsten Jahrhundert. Diese Litanei als Form und Aussage überzeugte mich nicht mehr, ich packte das Projekt in neuem Zugriff an: Wie kreieren wir auf Bühnen Bilder vom Kriege? Wie weit führt, beispielsweise, Reenactment? – Probierbewegungen, Probesequenzen, integriert in strenge Form. Schon ein kurzer Einblick in die beiden Druckfassungen kann zeigen, dass ich bei Änderungen entschieden vorgehe. Da ist erst mal, über längere Zeit hinweg, ein mulmiges Gefühl: Ein Stück hat noch nicht so recht seine Form gefunden. Und die ist ja nun eine Aussage. Irgendwann (hier in einem überschaubaren Zeitraum zwischen 2012 und 2014) der Zündpunkt für einen Neuansatz. Und es entwickelt sich ein letztlich neues Stück.
Ich habe mir wahren Luxus geleistet: zwischen der Arbeit an Büchern das Schreiben von Theaterstücken – aus purer Lust. Was sich bei der Lektüre (vielleicht, hoffentlich) überträgt. Fragen der Umsetzung, der Rezeption als Bühnenstücke blieben (und bleiben) weit jenseits des »Ereignishorizonts«.
Es gibt keine »Textsorte«, die in der Umsetzung so starken, so harten Belastungen ausgesetzt ist wie ein Theaterstück. Bis zu den (heute gesehen:) virtuellen Proben und Aufführungen kann ich aber nicht (mehr) warten, also macht mir der Verlag dieses Buch letztlich zum Geschenk. Gedruckte Theaterstücke hatten es immer schon schwer, die hier erst recht: Stücke, die in den vorliegenden Fassungen allesamt (noch) nicht aufgeführt wurden. Aber sie bilden eine Entwicklungslinie, wenn auch gestückelt, die sich ins Gesamtgewebe meiner Arbeiten, meiner Publikationen einfügt. Nun wird diese Linie erkennbar, ablesbar im Printmedium. Und ich atme auf: Sechs Stücke liegen vor. Ein Angebot!
Juni 2015
Roland dreht durch
Alleingang
ROLAND
Getränkemarkt. ROLAND schiebt einen Gitterwagen mit Leergutkästen, obendrauf ein praller Plastiksack. Am Leergutautomaten steckt er eine Flasche in die Eingabeöffnung, die Flasche kommt zurück.
ROLAND
Nanu? Wieso? Dasselbe noch mal – Flaschenboden vorschriftsmäßig vorn.
Flasche rein, Flasche zurück
Was soll das jetzt heißen?! Eine Original-Pfandflasche! Wird gefälligst angenommen!
Flasche rein, Flasche zurück
Hallo, ich will das Pfand zurück!
Flasche rein, Flasche zurück
Bring mich nicht auf die Palme!
Flasche rein, Flasche zurück
Wenn du die Flasche nicht sofort zurücknimmst –
Flasche rein, Flasche zurück
He, du Typ am Förderband: Vom Wind, den ich gleich mache, kannst du eine Erkältung kriegen!
Flasche rein, Flasche zurück
Meinst du mich damit?!
ROLAND marschiert eine Runde mit demonstrativ erhobener Flasche.
Guck mal aus deinen Löchern: Diese Flasche, Pfandflasche, ich betone: Pfandflasche, die stammt originalgetreu aus dem Laden hier! Pardon: aus eurem Shop. Also wird die eins zu eins, so wie ich die – Moment, was schwenkt denn da …?! Was blinkt denn da …? »Tankdiebstahl zwecklos – Videoüberwachung« …? Dokumentation von Sachschäden, angerichtet von wütenden Kunden …? Überwachung von Mitarbeitern …? Oder wieder mal zu unserer »eigenen Sicherheit«? Auf dass nicht eine Kundin zwischen den Kästen vergewaltigt wird …?! Auf dass mir keiner das Messer an den Hals setzt: Her mit dem Bon …?! Aber erst mal haben! Das zieh ich konsequent durch hier, und wenn es noch so lange dauert. Ich habe Zeit, jede Menge Zeit.
Damit wieder zum Flaschensortierer. Sie können das Folgende getrost verfolgen am Bildschirm im Büro – Ihr Mitarbeiter soll noch eine Chance kriegen.
Er hebt einen der Getränkekästen vom Gitterwagen.
Gegenprobe … Auf gehts!
Er schiebt den Kasten in die Öffnung. Annahme nicht verweigert.
Da schau her: anstandslos. Zur Besinnung gekommen, wie? Dann gleich da capo!
Nächster Kasten. Annahme nicht verweigert
Schon verdoppelt. Bon wird noch nicht in Druck gegeben, aller guten Dinge sind drei.
Nächster Kasten
Da haben wirs! »Kasten nicht akzeptiert«. He, ich füll hier keinen Mist ein!
Er dreht den Kasten um, schiebt ihn erneut in die Öffnung.
»Kasten nicht akzeptiert«. Akzeptier ich auch nicht! Kapiert? Bloß, zur Kasse laufen, Schadensmeldung stammeln, so was kann ich mir sparen. »Versuchen Sies einfach noch mal«, wird dann die Dicke sagen, »der Automat spinnt manchmal.« Also: da capo. Bon-Position 3!
Kasten wird reingeschoben
»Kasten nicht akzeptiert«. Falsch kalibriert, wie? Mustererkennung fehlerhaft, eh? Rücknahmefähigkeit eingeschränkt, was? Unter gleichen Voraussetzungen: angenommen, abgelehnt, angenommen, abgelehnt. Aber jetzt wird angenommen, capito?
Kasten wird reingeschoben, nicht akzeptiert
Damit Sie klarsehen, Herr Filialleiter oder Geschäftsführer: Ich werd nicht lockerlassen! Ich halt die Stellung, bis das geklärt ist, Flasche um Flasche. Einer wie ich, in meiner Lage, mit dem ist nicht zu spaßen. Mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Der ist quasi waidwund, und damit das Neuste vom Tage.
Er zieht ein Schreiben hervor, hält es hoch Richtung »Kamera«.
Zoomen Sie das mal ran, wenns geht … Und was sehen Sie? Ein Bewerbungsschreiben. So, und hier, bitte schön, der zugehörige Briefumschlag. Und was steht da drauf? »Zurück an Absender.« Ist meine Wenigkeit. Alles klar? Die ganze Misere fing an vor sechseinhalb Monaten. Mit einem Schock! Da steht man morgens, montagmorgens vor dem Tor zum Betrieb, und da ist eine Kette dran mit dickem Schloss. Ohne Vorwarnung, einfach zu! Mir nichts, dir nichts: zu! Dabei – dem Betrieb ging es gut, wir machten Gewinne, und plötzlich: Outsourcing …! In einer Nacht- und Nebelaktion …! Chef auf und davon. Kein Wort verloren, kein einziges, einfach weg, davongestohlen … Da gehst du heim wie auf Watte … Wie ein Schlafwandler … Reines Wunder, dass man noch punktgenau in der eignen Wohnung landet … Böses Erwachen, ganz böses Erwachen! Ein paar Tage später wie benommen, wie benebelt zur Betriebsversammlung: Wo ist mein Zeichentisch? Wo, verdammt nochmal, ist mein Zeichentisch gelandet?! Soll ich Ihnen verraten, wo? In Temeswar, Rumänien. Haben Sie eine Ahnung, wo das liegt, näher betrachtet? Wusste es vorher auch nicht.
Er schultert einen Getränkekasten, marschiert im Kreis.
Flexibilität, Mobilität … Auf die Socken machen, Gepäck aufgehuckt, nachschaun: Wo ist mein Arbeitsplatz verblieben? Von Entlassung war ja nicht die Rede, der Personalchef auf dem Schleudersitz hat anheimgestellt, mit Kind und Kegel, Sack und Pack der Firma zu folgen. Müsst euch allerdings den dortigen Lohn- und Lebensverhältnissen anpassen. Für 400 Euro, sage und schreibe: vierhundert Euro wärt ihr dabei. Ja, mit vierhundert Euro kommt man in Rumänien aus, zwar nicht spielend, aber leidlich. Kleine Wohnung, hat den Vorteil, man muss weniger putzen. Hinter dem Wohnblock ein winziges Gartenstück; wer in Rumänien mit 400 Euro im Monat auskommen soll, muss sein Gemüse schon selbst anbauen. Und morgens – wer unbedingt Milch im Kaffee haben will, sprich: im Getreidekaffee, was braucht ihr noch Bohnenkaffee, rumänischer Muckefuck ist gesünder für Herz und Kreislauf, also, wenn unbedingt noch Milch dazu muss, raus zur Kuh im Gärtlein, einen Jutsch aus der Zitze strull in die Tasse! So ein bisschen Landwirtschaft, Viehwirtschaft hat doch wohl jeder drauf! Speziell als Technischer Zeichner: für Ackerbau und Viehzucht gradezu prädestiniert!
Der Marsch im Kreis, beschleunigt
Garten, Kuh, Zitze … Zumindest Garten, Ziege, Zitze … Strull, strull, jutsch in die Tasse … Strull, strull, jutsch in den Getreidekaffee … Strull, strull und jutsch. Alles ist futsch.
Wenn ich nur schon daran denke: Schlägt aufs Gemüt, geht in die Beine. Kein Antrieb, kein Auftrieb – nichts, null, nada. Sie sollten sich mal in meiner näheren Umgebung umschaun – allein schon, was sich im Bau gegenüber abspielt beziehungsweise nicht mehr: spricht Bände!
Er legt sich bäuchlings auf einen Getränkekasten.
Auf einem der Balkons: Ein abgeknutschter, abgelutschter Teddybär, hängt so über der Geländerkurve, Ärmchen, Beinchen schlapp runter, Kopf noch im Trocknen, Teddyarsch jeder Form der Witterung preisgegeben, Nieselregen, Landregen, Schlagregen, Starkregen, Platzregen. Weicht infolgedessen auf, die Innereien verrotten, verfaulen, scheiden Faulgase aus. Schon mal einen entsorgten Teddybär gesehn, auf wilder Müllkippe? Da bohren Sie dem mal den Finger in den Arsch oder in den Nabel – was dann? Matsch, Matsch, Glitsch, Glitsch … Glibber, Glibber, Glitsch …
Er rappelt sich auf.
Im Klartext: Was ich so in meiner Nachbarschaft, ich meine, in der Umgebung meines nun statusgerechten Domizils, was ich da zu sehen kriege, tagein, tagaus, das zieht einen nur noch runter. Soll ich Ihnen mal verklickern, wie ich meinen Tag, einen gewöhnlichen Werktag – aber was heißt hier »Werktag«?! Tagesverlauf, Tageslauf … Nur läuft das nicht so recht im Tageslauf, Tagesverlauf, ich steh herum und denke: Ich steh nur noch so herum. Früher hätte ich mir gesagt: Was stehst du hier noch rum, die Arbeit wartet. Was wartet jetzt? Ob ich hier stehe oder hier, ob ich in die Richtung gehe oder ein paar Schritte dort hin – bringt mich keinen Schritt weiter. Also steh ich herum und denke, ich steh mal wieder dumm herum. Dürfte auf jemanden wie Sie befremdlich wirken. Sie können sich, voll im Berufsleben, wohl kaum eine Vorstellung davon machen, wie man einen normalen Vormittag verbringt in seiner »gebrochenen Erwerbsbiographie«.
Ich liege länger im Bett als nötig, raffe mich endlich auf, betreibe Körperpflege, ausgiebig, wasche Winkel, Zwickel, Nischen, die ich früher eiskalt ausgespart habe – Zeit war schließlich knapp zwischen Weckerläuten und Fahrt zur Arbeit.
Er improvisiert aus Getränkekästen einen Tisch, einen Hocker.
Nächste Phase: Frühstück. Ich koche das Fünfminuten-Ei, behalte es ständig im Blick, hör mir das Geblubber an. Mische Quark mit Schnittlauch, kleingehackt, gradezu mikroskopisch klein, Nano-Technik, hab ja Zeit, jede Menge Zeit. Nach dem »alsbaldigen Verzehr« sitz ich noch ein Weilchen am Tisch. Mütterchen im Harz würde sagen: Rolando, was hängst du noch so rum? Tja, Hand am Henkel des Kaffeepotts … Schieb den mal nach hier, mal nach da … Lass ihn ein Weilchen stehn … Dreh ihn mal rum … Heb ihn gemächlich an die Unterlippe … Lass ihn was stehn … Sollte davon mal ein Bewegungsdiagramm anfertigen – theoretisch, am Zeichentisch, der jedoch befindet sich in Dingsda. Sollen sich nur nicht zu früh freuen, die Billiglöhner in Dingsbums – eh die sichs versehn, wird auch dort ausgelagert, schwuppdiwupp steht der Zeichentisch in Minsk, Weißrussland. Mobilität, Flexibilität, also auf nach Belarus? Dort soll man sogar mit 300 Piepen im Monat auskommen, sofern man eine Kolchose, so eine Chose von Kolchose … Na, und falls es auch dort nicht fluppt, kommt der Zeichentisch, na, sagen wir: nach Aserbaidschan. Flexibilität, Mobilität …
Und hier, und hierorts, hienieden? Der Nachbar, gleichfalls arbeitslos, legt mir die ausgelesene Zeitung vor die Tür. Bei ansprechender Witterung stell ich auf dem Minibalkon den Wäscheständer auf, breite darauf die Zeitung aus – da muss ich die Arme nicht so recken, verstehn Sie, man muss mit seinen Kräften haushalten – eines Tages soll man die ja wieder feilbieten können.
Also, mit den Händen in den Taschen schau ich hinab auf das Weltgeschehn. Die Seiten wendet meist der Wind. Beim Sportteil halt ich die Seiten allerdings fest. Fußballfotos – einer springt höher als der andre, Kopfball, Kopfball, Fallrückzieher, spektakulärer Fallrückzieher, alles mit Zoom rangeholt, hautnah.
Richtig zu Herzen ging mir kürzlich ein Schnappschuss – ein Rechtsaußen, Nationalelf, seit zwölf Spielen torlos, liegt nach dem Abpfiff auf dem Spielfeld, Beine von sich gestreckt, Hände – so – vors Gesicht geschlagen. Vielleicht hat er gezuckt, infolge Schluchzen, sieht man dem Foto aber nicht an, liegt einfach so auf dem Rasen, dahingestreckt. Muss man sich mal auf der Zunge zergehn lassen: zwölf Spiele ohne Tor – nun liegt er da – aus, aus, alles aus – wobei der ja nun, wie sagt man: ausgesorgt hat – aber jetzt erst mal: liegt da – bis auf weitres.
Ja, und langsam, ganz, ganz langsam geht es auf elf zu. Ich erhebe mich, betrete den Balkon, das Balkönchen – zwo Quadratmeter – die Rede ist von der neuen Wohnung, nach der Devise: Brötchen kleiner, Gürtel enger. Schlafecke, Nasszelle, Küchenzeile. Und ein Plätzchen für den Laptop.
Neue Wohnung, alte Wohnung, gemeinsame Wohnung, damals gemeinsame Wohnung – solange ich berufstätig war, befand ich mich im Stand der Ehe. Mit einer Pathologin. Zoologisches Institut der hiesigen Universität. Tierkadaver präparieren.
Barbara ist eigentlich promovierte Medizinerin, aber mit der Anstellung am Krankenhaus wollte es nicht klappen. Beim Vorstellungsgespräch kriegte sie vom zuständigen Chefarzt zu hören: »Damit wir uns von Anfang an verstehen, Ihren Urlaub verbringen Sie bei uns im Hause. Und jeden Samstag, Sonntag nehmen Sie teil an der Visite.« Sie stellte in aller Bescheidenheit eine Zwischenfrage, darauf holte er den großen Hammer hervor: »Frauen stelle ich sowieso nicht ein, die werden ja schwanger.« Sie protestierte, höflich. Er darauf: »Bringen Sie mir Ihren Uterus in Spiritus, und wir können darüber reden.« So was kann man sich bei der allgemeinen Verrohung offenbar ungestraft leisten.
Statt Assistenz im OP-Saal: Präparieren. Ich hab mir ihr Etablissement mal angeschaut, wollte rauskriegen, woher der merkwürdige Geruch stammt, den sie nach Dienstschluss um sich zu verbreiten pflegte. Mit dem Ortstermin wurde mir klar: Es handelte sich um Formalin. Dazu der spezifische Geruch ausgekochter Knochen. Besagtes Institut befindet sich in einem Altbau, für technische Einrichtung ist seit alters her kaum Geld vorhanden, zurzeit erst recht nicht, infolgedessen: steinzeitliche Absaugvorrichtung.
Werktag für Werktag: meine Ex in diesem Binnenklima. Als ich bei ihr reinschaute, präparierte sie gerade eine exotische Katze – das Maul mit zwei Dutzend Stecknadeln fixiert. Auf dem Regal hinter ihr ein Hecht mit gleichfalls offnem Maul – nadelscharfe Reißzähnchen … Das alles im gewöhnungsbedürftigen Binnenklima! Trotz Formalin, trotz Zwischentüren: ihre Arbeit begleitet vom »Leichengeruch«. Ich bestand auf dem Wort »Leichengeruch« – fehlerfreundlich, wie ich es nun mal bin, von Zeit zu Zeit. War letztlich ja klar: Es konnte kein Leichengeruch sein, nur die Geruchsentwicklung tage- und nächtelang, ja wochenlang vor sich hin köchelnder Knochen – das allerletzte Fettmolekül muss raus aus den Poren, sonst müffelt ein Knochen noch Generationen später, beginnt in ferner Zukunft womöglich wieder zu stinken. Es kann also gar nicht intensiv und extensiv genug ausgekocht werden – was aber das Instituts-Klima belastet.
Jetzt darf man allerdings nicht denken, wir hätten uns ständig in so einer Geruchszone, Problemzone aufgehalten, und das hätte sich letztlich irgendwie negativ auf mich ausgewirkt. Wir haben immer wieder für gute Durchlüftung gesorgt – sogar in China, seinerzeit. Tempelbesichtigungen inklusive, soweit überhaupt noch vorhanden nach der Kulturrevolution. Einer der Tempel an einem Waldhang, Namen hab ich vergessen, ich sag jetzt einfach mal: Qigong-Yangsheng. Also, wir kommen in den Vorhof, eine Gruppe Milizionäre in Schlabberuniformen übt Karate, gleich weiter zum Haupthof, karge Blumenrabatten, kümmerlicher Springbrunnen, dafür aber seitwärts ein großer Pavillon, Dach mit den landesweit üblichen Verzierungen, und in diesem Pavillon wurde getanzt! Und was wurde da getanzt? Walzer, Wiener Walzer – ein Ghettoblaster in der Mitte der Fläche. Ich mit Barbara gleich die Stufen rauf und mitgetanzt!
Er präsentiert sich im Walzertakt.
Sehn Sie, so schwang ich meine nicht mehr nach Formalin riechende Frau im Walzertakt – – – Ganz nebenbei: So beschwingt kann ich immer noch sein, trotz alledem – – – Alle anderen Paare hörten auf zu tanzen, standen in weitem Kreis, schauten uns beflissen zu. – – – Aber dann begab sich einer zum Rekorder, wechselte mit einer chinesischen Geste des Bedauerns die Walzerkassette aus gegen eine mit irgendeiner Partymusik – Polonäse, Majonäse. Hat wohl gedacht, das wär moderner, würd uns besser gefallen, aber wir räumten, bye-bye, diskret das Feld.
Übrigens einer unserer letzten gemeinsamen Auftritte. Meine Entlassung, und die stimmte mich anhaltend reizbar. Immer öfter sagte ich: Leichengeruch, Leichengeruch, immer heftiger ihre Reaktionen – es ging ihr an die Berufsehre. Aber ich bin sicher: Ihr hing verstärkt besagtes Etwas in den Haaren, in den Klamotten. Ein gewisses Zerfallsferment war auch mein Vorwurf, sie würde jede Laus konservieren, die ihr über die Leber kroch.
Chef, ich mache es kurz: Barbara verfügte schließlich über beide Wohnungsschlüssel. Was aber eher symbolischen Charakter hatte, ich konnte mich sowieso nicht mehr an der Miete beteiligen, zu hoch, mittlerweile viel zu hoch, ich bezog mein kleines Domizil. Blieb dort aber nicht ganz allein – es kam, die da kommen musste.
»Lebensbeichten sprudeln!« Las ich kürzlich als Schlagzeile. Zwei Einbrecher waren festgenommen worden, Junkies, und nach einigen, vielleicht etwas scharf geratenen Verhören fingen die Lebensbeichten an zu sprudeln. Es würde Sie wohl eher peinlich berühren, wenn ich jetzt auch noch – Stichwort Geliebte –, wenn auch noch meine Lebensbeichte zu sprudeln begänne, begönne … Lebenssprudel, Beichtsprudel, Lebensbeichtsprudel – womöglich auf Flaschen gezogen … Keine Sorge, ich werde mich nicht entblöden, mich zu entblößen.
Ich kann nur sagen, generell: Der Zustand Arbeitslosigkeit wirkt ein bis ins Private. Ich habe da Sachen erlebt … Als mir der Zeichentisch entzogen wurde, und ich in vorerst engem Kontakt mit der Agentur für Arbeit, da kam so en passant heraus, dass ich den Führerschein für Lastwagen habe – der rasende Roland hatte in frühen Jahren davon geträumt, er fährt mit einem Zwanzigtonner nach Spanien, stundenlang gradeaus in der Hochebene, La Mancha, verlädt in der Südecke Mandarinen, Nektarinen – als man das spitzkriegte, wurde ich abgeschoben zur Transportbetonbranche. Dieser Tatbestand wiederum, verquickt mit meinem aufgefrischten Liebesleben – das lief gut, wirklich gut, aber nur, solang ich nicht diesen Zwischenjob hatte. Der springende Punkt war ganz einfach: Schätzchen wollte auch mal einen Arbeitslosen in der Riege haben.
Schätzchens Hauptvorwurf, während der kritischen Phase: Ich hätte mich aufgeplustert. Aufgeplustert …! Ich und aufgeplustert! Sie hätte nur mal einen Blick in das Vogelreich werfen sollen, da hätte sie gesehn, was Aufplustern heißt, wie sich dem Männchen-Vogel beim Balzen das Gefieder sträubt, als würde er bei heftigstem Gegenwind agieren, was ich nachfühlen, durchaus nachfühlen kann. Und nach dem Aufplustern – ich habe ja Zeit genug, so was zu beobachten, nicht nur im Kirschlorbeer, auch auf einem Baugerüst – Spatzen ziehen ein Baugerüst einem Baum vor, Stahlrohre schwanken nicht. Dabei kommt aber letztlich nie recht zustande, was man bei Vögeln eigentlich erwarten würde. Die Männchen landen mit viel Gezappel auf den Weibchen, rutschen aber gleich runter, flügelflatternd sofort noch mal drauf, schon rutschen sie wieder ab – also über das Vögeln von Vögeln hat man viel zu rosige Vorstellungen.
Wie komm ich jetzt auf dieses allgemein interessierende Thema?
Kurzes Armschwingen: »Flügelschlagen«
Richtig: Aufplustern, Stichwort Aufplustern. Man lässt nicht alles auf sich sitzen: Es war bald aus und vorbei. Vorrangig, weil ich den Brummi-Job angenommen hatte. Ich könnte übrigens für Ihren Shop Getränke fahren. Nur mal nebenbei bemerkt. Ich gelte als zuverlässiger Fahrer. Damals jedenfalls fuhr ich dieses Trumm von LKW-Betonfahrmischer.
Transportbetonfahrer: Das war für Schätzchen nicht mehr so prickelnd wie ein Arbeitsloser – da entfiel die Mitleidskomponente. Auch musste sie auf Teufel komm raus ihr Männerspektrum erweitern, geriet an einen Yuppie. Aus Rache sprech ich das nicht korrekt aus. Yuppie mit Cabrio. Doppeltes Auspuffrohr, tuningmäßig verdickt. Dachte wohl, ihm steht alles offen, wenn er da anröhrt. Jedenfalls, ich behielt die Entwicklung im Blick, und schließlich – hohoo!
Ich stellte den Betonfahrmischer, Achsdruck immerhin an die zwanzig Tonnen, ich stellte den LKW neben dem aufgemotzten Cabrio ab, schwenkte das Schüttrohr aus – Fließmittel war beigemischt – die Mündung des Schüttrohrs über dem Fahrersitz, Beton lief wie Magma rüber, rasch bedeckte die graue Pampe die Sitzflächen, stieg höher, erreichte das Lenkrad, stieg noch höher, ein Kubik, zwei Kubik, die Federung des Wagens gab unter der Überlast hörbar und sichtbar nach, doch ungerührt ließ ich den Restbeton ins Cabrio laufen, bald war die Oberkante des hochgefahrnen Fensters erreicht, Beton quoll über, Beton sickerte an den Türen herab, an der Windschutzscheibe, Beton schob sich breiig über die Motorhaube. Mit einem Seufzer der Erleichterung stellte ich die Mischtrommel ab, schwenkte das Schüttrohr bei, widmete dem Anblick des mit Betonbrei randvoll gefüllten Cabrios ein Schweigeminütchen und startete durch.
Damit wurde mein Job allerdings zum auslaufenden Modell. Ladung, zumindest den Rest einer Ladung veruntreut … Firma in Misskredit gebracht, vor zahlreich angelockten Passanten … Knick in der Erwerbsbiographie … Zwischenspiel vor dem Kadi, saftige Geldstrafe … War mir der Spaß aber wert.
Wär mir das auch hier – also ich würd am liebsten: Schüttrohr in die Öffnung für Kästen, Beton rein – knöchelhoch, kniehoch, hüfthoch – und so weiter. Dann gleich wieder Kadi zwo? Womöglich eingebuchtet, Bewährungsfrist vergeigt?
Dann doch lieber: zum Fenster, zurück zur Tür, rüber zum Fernseher, zurück zum Papierkorb. Zum Fenster, zurück zur Tür, rüber zum Fernseher, zurück zum Papierkorb. Zum Fenster, zurück zur Tür, rüber zum Fernseher, zurück zum Papierkorb. Denke hin, denke her. Ah, und endlich: Zigarettenpäuschen! Raus auf den Minibalkon.
Anzünden, inhalieren, Asche abstippen überm Kirschlorbeer. Gegenüber noch so eine Wohnung mit Minibalkon. Da tapst denn gegen zehn oder elf ein junger Mann raus, Basecap, bloßer Oberkörper, Kaffeepott im Griff, schlürft vor sich hin. Latscht wieder ins Zimmer, Tattoo-Feuervogel auf dem Rücken. Im Tätowierstudio »Pleasure and Pain« oder »Dirty-Ink« hatte er wohl noch an Aufschwung gedacht, womöglich an Höhenflug, nun lässt der Feuervogel die Flügel hängen, »pretty in ink«.
Zweiter Auftritt gegen elf, zwölf. Er steht auf dem Balkönchen, mit dem Rücken zu mir, tritt von einem Bein aufs andre, tritt wortwörtlich auf der Stelle. Standbein wird Spielbein, Spielbein wird Standbein, Standbein Spielbein, aber nur ein bisschen, kräftesparend, sehn Sie so, ungefähr so: Spielbein Standbein, Standbein Spielbein, Spielbein Standbein …
Er wiederholt das, stumm.
Ja, und manchmal legt er die Hände auf den Rücken, verschränkt die über dem Steiß wie ein ältrer Mann, alter Mann, übt schon mal. In den nächsten Jahren, Jahrzehnten wird sich für ihn nichts weiter ändern. Wieso fährt da keiner aus der Haut, tätowiert oder nicht?! Darüber denkt er wohl nicht weiter nach, der Feuervogelträger, er setzt sich hin, steht nach einem halben Minütchen wieder auf, geht ins Zimmer. Alles zur Hauptarbeitszeit!
Überhaupt, im Herbst, im Winter – ich seh morgens gegen sieben kaum ein Fenster mit Licht. Eigentlich die Zeit des hastigen Frühstücks, des Aufbruchs zur Arbeit, aber nichts rührt sich. Nicht mal schulpflichtige Kinder – alle erfolgreich verhütet?
Ende der Denkpause, zurück zum Laptop: Websites studieren von Firmen, die einen Technischen Zeichner brauchen könnten. Aber wer braucht die noch? Zeichentische werden nach und nach abgeschafft, demnächst läuft alles über Bildschirm. Aber vielleicht, vielleicht ergibt sich grade noch eine Lücke, für ein paar Jährchen. Also Numero 76 bis 78 an Firmen, die keine Arbeitskräfte suchen.
Also auch keine Antwort geben. Anfrage wiederholen, Anfrage wiederholen. Nach drei Wochen anrufen, um Verbindung bitten mit dem Entscheidungsträger, dem »Personaler«. Lande in irgendeinem Callcenter. Verhandlungssprache: gebrochenes Deutsch. Kommst nicht an die ran. Schweigen, die Arschlöcher schweigen. Errichten eine Mauer, eine chinesische Mauer des Schweigens. An der kannst du dir die Stirn blutig stoßen – der Schädel als Rammbock. Aber die chinesische Mauer hält stand – ich weiß, wovon ich rede.
Mittagsläuten … Jeden Tag Punkt zwölf: Mittagsläuten … Ich betrete erneut den Balkon. Im Wohnblock schräg gegenüber erscheint der arbeitslose Muslim auf dem genauso kleinen Balkon, beugt sich vor Richtung Osten, wird unsichtbar hinter gemauerter Brüstung. Ich Heidenkind zünde mein Zigarettchen an, inhaliere, stippe Asche ab über dem Kirschlorbeer. Der Muslim beendet sein Gebet, verschwindet hinter ständig zugezogner Gardine.
Und ich zurück an den Bildschirm. Business-Netzwerk: Millionen mittlerweile auf der Lauer, zielstrebig ohne Perspektive. Rüberschielen zur nächsten Zigarette – lugt bereits aus der Packung. Dreimal dürfen Sie raten, was ich gegen eins anstelle. Und das, bei Gott, nicht allein. Aus noch so einer Wohnung gegenüber tritt noch so ein Arbeitsloser auf noch so einen Balkon: Schlabberklamotten, stützt sich am Geländer auf, glotzt, langsam wie eine Schildkröte, mal nach rechts, mal nach links. Sieht aus, jedes Mal, als wär er grade aus dem Bett gekrochen. Schütteres Haupthaar verstrubbelt, Bauch abgeschlafft bis dort hinab – ich hab noch nie gesehn, wirklich noch nie, dass der mal die Wohnung verlässt. Hängt garantiert den ganzen Tag vor der Glotze, steht zwischendurch mal auf dem Balkönchen, stützt sich auf am Geländer, guckt mal nach halb rechts, mal nach halb links, mal nach halb rechts; den Kopf nur ein bisschen weitergedreht, schon würden die Nackenwirbel knirschen. Abgebaut, abgeschlafft. Dem könnte man den Finger in den Nabel: Glibber, Glibber, Glitsch …
Wieder der junge Mann mit dem Tattoo. Steht im Balkonwinkel, Kapuze hoch, Zigarette in der Hand. Die Nase fast am Sichtbeton, aber keine Aussicht mehr. Lässt sich am Rücken ablesen: Die verkorkste Welt hat dem nichts mehr zu bieten. Balkonwinkel, Kapuze hoch, Zigarette rauf, Zigarette gesenkt, vielleicht ein Joint – könnte man ihm kaum verübeln.
Es läuft allerlei schief im Kiez … Im Bau gegenüber: Fernsehgeflacker, Lichtgewitter bis in die frühen Morgenstunden. Und jeden zweiten, dritten Sonntag: mörderisches Gebrüll. Die Balkontür steht meist offen dabei: Er schreit sich die Lunge aus dem Leib, sie kreischt zurück. Psycho-Schlachtfest … Wirkt ansteckend.
Schrei
Funke springt über.
Anhaltender Schrei
Oder hätten Sie lieber eine Sequenz Stummfilm? Verstummt aus sich herausgehn? Verstummt die Wände hochgehn – neue Sportdisziplin …?
Also den Vormittag, den krieg ich mit Ach und Krach noch so einigermaßen über die Runden, aber der Nachmittag, der späte Nachmittag, der frühe Abend …! Hätte fast einen VHS-Kurs belegt! Musste mich allerdings durch Hunderte von Angeboten wühlen. »Sportklettern: ein Schnupperabend … Kochen und Genießen – fast zum Nulltarif … Wildkräuterspaziergang … Körperbalance und Sturzprävention … Latin-Tanz-Fitness … Qigong-Yangsheng …«
Da bau ich lieber Vogelhäuschen! Hab ein Händchen für so was, wenn auch kein goldnes. Das können Sie mir abnehmen: Wenn alles noch weiter den Bach runtergeht, fabrizier ich Vogelhäuschen, in Serie, gnadenlos! Als Erstes wird die bucklige Verwandtschaft mit Vogelhäuschen bedient, die soll mich mal so richtig kennenlernen! Sodann: Belieferung der schlaffen Nachbarschaft. Jedem Reihenhäuschen sein Vogelhäuschen. Dies zuletzt flächendeckend. Aber der da drin, der kriegt keins! Nicht ums Verrecken!
Ich frag mich schon die ganze Zeit: Spricht der überhaupt Deutsch? Kriegt er das hier wenigstens teilweise mit? Falls ja – da hätte er getrost mal ein Zeichen geben können, irgendwie. Mir was entgegenkommen, die Hand reichen … Ja, könnte die ruhig mal rausstrecken, aus der Flascheneingabe – wär doch angemessen, nach alledem, wie? Noch besser: Hand guckt raus, Zeigefinger krümmt sich: Komm her, Roland, vertrau mir die inkriminierte Flasche an, schieb den verweigerten Kasten noch mal rein, mach deinen Plastiksack leer. Aber nichts, nichts dergleichen. Wird mal wieder ein Arbeitsplatz eingespart? Die Pfandflaschen bereits so programmiert, über Code oder Chip, dass die sich selbst sortieren, selbst in die Kästen stellen?
Er schleicht den Automaten an, singt ablenkend:
O when the Saints go marching in … O when the Yanks go marching in …
Er schaut durch die Flaschenöffnung, die Kastenöffnung.
Da iss einer! Oben Schulter, unten Knie – ich könnte ihn, theoretisch, an die Schulter boxen, ans Knie treten.
Ja, ich weiß, ich weiß: Diskretion …! Zu Ihrer Beruhigung: Ich achte sonst streng darauf, speziell vor Geldautomaten. Stell mich nicht neben eine sichtlich hilflose Oma: Kommen Sie, ich helf Ihnen aus, diktieren Sie mal eben Ihre PIN-Nummer … Keep distance … Aber dies ist kein Geldautomat.
Er schaut noch mal durch die Eingabeöffnungen.
Angelehnt, bequem angelehnt … Fehlt bloß noch, dass er sich auf dem Förderband ausstreckt, Gerät und Augen auf null gestellt.
Auch jetzt, wo ich von ihm rede: keine Reaktion! Nichts, null, nada. Da gibt es nur zwei Erklärungen für einen logisch denkenden Menschen.
Erstens: Er spricht kein Wort Deutsch. Dazu kann ich nur sagen: Mit so was hab ich keine Probleme, aber er könnte sie kriegen. Kann nicht alles bloß der Flaschencodierung überlassen, wo sind wir denn hier!
Zweite Version: Besagte Person befindet sich im Zustand weitreichender Erschlaffung. Dabei, Sie wissen ja selbst, wie viel Energie im Menschen steckt, wenn er nur richtig gefordert wird! Auch und gerade in Krisenzeiten. Hat sich schon in meiner Familie erwiesen. Ich hätte da einen Vorfahren im Angebot – fragen Sie bitte nicht nach dem genauen Verwandtschaftsgrad, ich bin kein Ahnenforscher, aber ich kann Ihnen versichern, auf Treu und Glauben: er gehörte zur Familie, wenn auch vor ziemlich langer Zeit. Und das auch noch im Emsland, jottwedee im Emsland. Kleiner Hof, Landwirtschaft, keine Straße weit und breit, nicht mal eine Wasserstraße, ergo: Alles wird zu Fuß erledigt. Besagter Vorfahre marschierte, unter andrem, zweimal wöchentlich zum Markt in der Kreisstadt. Langer Marsch mit schwerer Last – meist Buchweizen, im Knicksack.
Ja, Sie haben richtig gehört: Knicksack. Jetzt fragen Sie sich: Ein Knicksack – was soll das sein? Antwort: ein in sich geknickter Sack. Sack mit Knick, in der Mitte, quasi nackengerecht. So was kennt man wahrscheinlich nur noch in Rumänien, auf so einer Chose von Kolchose.
Er schultert den Leergut-Plastiksack.
Mit einer Last ähnlichen Volumens trottete besagter Vorfahre stundenlang Richtung Marktstädtchen. Auch im Winter. Einmal zerbrach über einer Eiskante ein Holzschuh – man trug dort, seinerzeit, selbstgeschnitzte Holzschuhe, sprich: Klotschen. Einer von denen also zerkrachte, doch er lief weiter mit blutigem Fuß. Stark, wie?
Manchmal trug dieser Ausbund von Energie auch ein Kalb zum Metzger, und zwar, im Prinzip, wie einen Knicksack: über den Schultern, Beine fest im Griff. Im Winter wurde auch schon mal eine Schulter warm, lauwarm Wässerchen, fror im weiteren Verlauf der Wanderung jedoch an, gelbgetönt.
So gingen die Jahre dahin, der Vorfahre im Emsland wurde älter, schleppte sich immer noch ab: mal Knicksack, mal Kalb – Vorübungen zum Abschleppen des Vaters. Der wurde simultan noch älter, welkte dahin, und wie es so kommt, er starb zuletzt. Zur Beerdigung musste er in die Kreisstadt getragen werden. Nicht: Arme über der einen Schulter, Beine über der andren, vielmehr menschenwürdig aufrecht.
Er schwingt einen Stuhl auf den Rücken.
Wurde von den trauernden Hinterbliebenen auf einen Stuhl gesetzt, an der Lehne festgezurrt – ist ja beschämend, mit Blick auf unsre Zeit, wie viel Mühe man sich damals noch mit einer Leiche gegeben hat. Und wie wird heute mit uns umgesprungen – lebendigen Leibes?
Der Tote kam, samt Stuhl, auf den Rücken des Sohnes. Und der zog los. Wie zu erwarten: Unbilden der Witterung! Schneeflocken, Eispartikel, Schneeflocken, Eispartikel, alles stürmte los auf ihn, beinah waagrecht, doch er, mit Vater auf Stuhl auf Rücken, biss die Zähne zusammen, kämpfte an gegen den Schneesturm, zuletzt auf allen vieren kriechend – muss ungefähr so ausgesehn haben –, und er schrie um Hilfe im Eissturm, den toten Vater auf dem Stuhl auf dem Rücken, doch keiner hörte ihn. Im Schneesturm-Tohuwabohu ging der Vorfahre denn auch schlichtweg verloren: Erst tiefgefroren, dann zugeschneit. Wurde, mit einsetzendem Frühjahr, zur Moorleiche, samt Vater auf Stuhl auf Rücken – doch das Moor gibt ihn nicht frei. Nur ich, der Nachkomme, ich seh ihn weiterziehn mit dem toten Vater auf dem Stuhl auf dem Rücken.
Er befreit sich von der simulierten Last.
Jetzt bist du wieder dran. Hast dich mittlerweile hoffentlich zurechtsortiert. Gehst jetzt anständig mit einem Kunden um! So. Diese Flasche ist in diesem Shop erworben, die wird jetzt anstandslos zurückgenommen! – – –
Flasche rein, Flasche zurück
Was soll das jetzt wieder heißen?! Zoomen Sie mal ran! Hier: Pfandflasche – sogar eine der von Ihnen geführten Marken. Hier: Eingabeöffnung. Hier: Flasche, wie vorgeschrieben, Boden voran, und schon – sehn Sie, sehn Sie – schon guckt der Flaschenhals wieder raus. Man könnte – da könnte man glatt –
Er boxt die Flasche zurück. Sie kommt wieder zum Vorschein. Wieder ein Boxhieb. Wieder die Annahme verweigert
Jetzt will ich dir mal was flüstern, Zombie: Ich halte die Stellung, bis das geklärt ist. Dann wird der Sack hier geleert, Flasche um Flasche um Flasche. Da besteh ich auf meinem Recht, beinhart. Ich lass mich nicht abservieren. Von mir aus observieren, aber nicht abservieren! Ich steh das durch bis Ladenschluss. Kundschaft hab ich sowieso längst vergrault, ich überzieh notfalls auch noch die Öffnungszeit. Aber geklärt wird das hier, da bin ich unnachgiebig, unnachsichtig. Nimm-die-fla-sche-zu-rück! – – –
Tut sich nichts, rührt sich nichts.
Er schaut in die Kastenöffnung, in die Flascheneingabe.
Ja, wo isser denn?! Durchs Hintertürchen abgesetzt? Zeig mal deine Schulter, aber nicht die kalte, zeig dein Knie, aber nicht dein weiches – nichts dergleichen? Im toten Winkel bequem angelehnt? He, verstehst du kein Deutsch? Gib mal einen Laut von dir. Muss dich schließlich einordnen. Anatolien …? Aserbaidschan …? Noch weiter weg …? Tschuktsche …? Eskimo …? Außerirdisch …? Ich komm mit allem klar.
Er wendet sich wieder an die Kamera.
Das war jetzt nicht bloß so dahingesagt. Ich wohn ja mittlerweile in einem Kiez, in dem man – also ich kann Ihnen sagen!