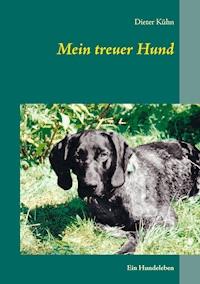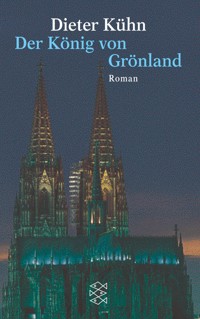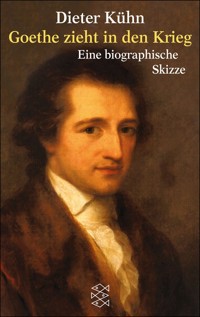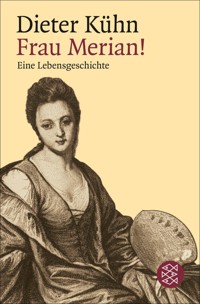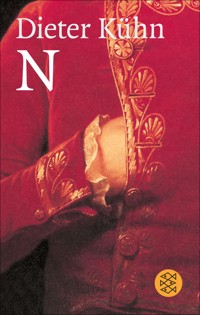9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieter Kühn versetzt uns in eines der irrwitzigsten Propaganda-Unternehmen aller Zeiten: Mitten im Zweiten Weltkrieg lässt Joseph Goebbels den Nazi-Durchhaltefilm »Kolberg« drehen. Für die monumentale Verfilmung eines historischen Stoffes im Sinne der Nazis muss dringend benötigtes Personal und Material von der Front abgezogen werden, koste es, was es wolle – es herrscht, wie der Regisseur Veit Harlan später gesagt hat, das »Gesetz des Irrsinns«. Aber ist dieses heute wirklich außer Kraft oder waltet es noch immer? Dieter Kühn erzählt die Geschichte der dramatischen Dreharbeiten nicht aus der Außensicht, sondern in Rollenprosa aus dem Innersten des Wahnsinns heraus. Es ist eine Geschichte vom totalen Untergang, eine fast parabelartige Geschichte vom Ende des Dritten Reichs, das so zerstörerisch war, dass es auch vor sich selbst nicht haltgemacht hat. Zusätzlich und erstmals im Taschenbuch: Dieter Kühns raffiniert »gefälschte« Geschichten »Den Musil spreng ich in die Luft« in erweiterter Fassung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 685
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Dieter Kühn
Das Gesetz des Irrsinns
Fischer e-books
Den Musil spreng ich in die Luft
Geschichten
Da gab mir Beethoven einen Kuss
Hiermit darf ich mich an die Deutsche Schillerstiftung wenden mit der ergebensten Bitte um Unterstützung durch eine Ihrer Ehrengaben.
Da meine Publikationen weit verstreut, meine Lebensdaten wenig bekannt sind, darf ich einige Punkte hervorheben, die für Ihren Entscheidungsprozess relevant sein könnten.
Ich, Johann Peter Lyser, 67, wohnhaft in Altona, Norderreihe Nr. 15, lebe, nein: vegetiere in einem Zustand unverdienter Armut, ja des Elends. Ich sehe mich gezwungen, dies gleich eingangs mit rückhaltloser Offenheit festzuhalten.
Meine gegenwärtige Bleibe befindet sich im Dachgeschoss eines desolaten Mietshauses. Was durchaus meiner Gesamtlage entspricht – meine Einkünfte nähern sich dem Nullpunkt. Dies frank und frei einzugestehen fällt schwer. Ich habe mich an dieses Eingeständnis gleichsam herangearbeitet mit mehreren Entwürfen meines voraussichtlich umfangreichen Schreibens. Was in den Entwürfen noch am Schluss steht, muss hier an den Anfang gesetzt werden, um Ihnen die Notwendigkeit meiner Eingabe ad oculos zu demonstrieren.
Ich bin Maler. Doch damit lässt sich nichts mehr verdienen. Porträtmaler sind seit Erfindung der Fotografie obsolet geworden. Gerne würde ich, wie seinerzeit in Wien, Wirtshaus- und Ladenschilder malen, jedoch: in Altona herrscht immer noch Zunftzwang. Mit dem Erteilen von Nachhilfeunterricht ist es hier ebenfalls schlecht bestellt – die wirtschaftliche Lage verschlimmert sich von Woche zu Woche.
Was ebenso für mich als Musiker zutrifft. Weder durch meine Kompositionen noch durch Besprechungen von Konzerten noch mit Konzertauftritten (Bassetthorn, speziell geeignet für Mozarts Klarinettenkonzert) kann ich das lebensnotwendige Minimum erwirtschaften, wobei sich allerdings spezielle Gegebenheiten abträglich auswirken – doch davon später. Denn hier muss erst einmal konstatiert und akzentuiert werden, worauf Sie gewiss schon warten: In der Hauptsache bin ich Schriftsteller, Autor, Dichter. Dies allein berechtigt dazu, mich an Sie, werte Herren der Schillerstiftung, zu wenden.
Ich schreibe, unter anderem, Gedichte und plattdeutsche Erzählungen. Gelegentlich kann ich ein Gedicht oder eine Erzählung an eine hiesige Zeitung verkaufen, dazu muss ich mir aber, mit Verlaub, die Hacken ablaufen. Das verschwindend geringe Honorar reicht zuweilen nicht mal aus, um Tinte zu kaufen, von Brot ganz zu schweigen. Die unzureichende Ernährung hat mich zum Fliegengewicht gemacht – mein Körperfleisch hat sich gleichsam verflüchtigt. Die erzwungene Beschränkung auf (das notorisch feuchte) Roggenbrot zwingt mich in erniedrigender Wiederholung, vom Dachjuchhe hinunterzulaufen, nein: hinunterzustolpern zum unbeschreiblichen Klosett im Anbau des Erdgeschosses. Nach der sogenannten Erleichterung bin ich, im Zustand ohnehin anhaltender Entkräftung, oft derart geschwächt, dass ich die Treppe streckenweise auf allen vieren überwinden muss.
So elend auch meine körperliche Verfassung sein mag, mein Kopf ist klar; er ragt über das alltäglich gewordene Elend empor. Ein Elend, das mich nicht nur dazu motiviert, sondern zwingt, mit angemessenem Nachdruck auf meine Situation hinzuweisen. Verzeihen Sie also die inhaltliche, wenn auch nicht wörtliche Wiederholung: Ich schreibe diesen Brief in äußerster Not. Was aber nicht sedierend, vielmehr stimulierend auf mich einwirkt, so dass ich, ungeachtet aller Malaisen und Molesten, diesen Schriftsatz con fuoco aufsetze. Das in der eher verzweifelten als verwegenen Hoffnung, meine Schreibperspektive möge zu Ihrer Sichtweise werden. Die Gewährung einer Ehrengabe der Schillerstiftung wäre nicht nur Rettung in höchster (oder aus tiefster) Not, sie wäre auch eine, mit Verlaub, längst überfällige Anerkennung meines literarischen, musikalischen sowie malerischen Schaffens.
Im Hintergrund (nun kurz in den Vordergrund gerückt) ein Nebengedanke: Dass ich hier nicht nur auf meine Hilfsbedürftigkeit hinweise, sondern zugleich Vorarbeit leiste für einen Biographen, der sich in Anbetracht meiner fraglosen Verdienste mit Sicherheit einstellen wird, spätestens nach meinem Ableben, das noch früher eintreten dürfte, als zu befürchten steht – schon sehe ich zwei Gemeindearbeiter meinen kleinen, hageren Leib in einem alten Segeltuch aus der Wohnung tragen und im Spital auf eine Pritsche abkippen.
Es ist nicht die fortschreitende Entkräftung allein: Ich leide an einer Krankheit, die man mir nicht ansieht – ich humple nicht, trage keinen Verband, unter dem es suppt, ich bewege mich frei … Das Unheil spielt sich ab im malträtierten Kopf, auf kleinstem Raum mit größter Wirkung: Geräusche erstickt, Wörter erstickt, Klänge erstickt, leider auch Musikklänge. Ja, als würden mir von fremden Händen Finger in die Ohren gesteckt! Zugleich stellen sich, höhnisch trügerisch, Phantomgeräusche ein, wie von einer Bootsmannspfeife. Die habe ich als Schiffsjunge gehört, wenn ein Besucher das Fallreep heraufstieg, ein Südseegouverneur, dadididaa, ein Eskimohäuptling, dadididaa. Aber nun kommt, im Kopf, unablässig jemand an Bord, unaufhörlich bläst der Bootsmann die Bronzepfeife. Der Pfeifklang dringt durch Mark und Bein, dringt durch Stirnbein, Schläfenbein, Jochbein, Brustbein, Schambein – dringt durch, schlägt durch! Ein wahrhaft infernalischer Bootsmann, der sich bei mir eingenistet hat: über Wochen, Monate, Jahre hinweg muss der kein einziges Mal Luft holen, ich werde ausgepfiffen, dass es in den Ohren gellt, aber von innen, von tief innen her. Dauerton, geblasen und gehalten, pausenlos gehalten, gnadenlos gehalten, gnadenlos pausenlos, ich glaube zuweilen, der Kopf zerspringt – wahrscheinlich haben sich bereits dünne Risse in der Schädelschale gebildet, der Pfeifton will irgendwo raus, doch er kommt und kommt nicht raus. Andererseits wirft sich jemand über jeden Klang, der sich am Dauerton vorbei in den Kopf stehlen will, wirft sich mit doppelter, dreifacher, vierfacher Decke über jeden Ton, jedes Tönchen, erdrückt, erstickt, erstickt, erdrückt, schließlich ist da nur noch eine Klangsteppe, Klangwüste, über die der Dauerton hinwegschwebt. Doch ich ließ mich nicht unterkriegen, schrieb weiter, komponierte weiter, zeichnete weiter.
[Anmerkung des Herausgebers: Offensichtlich setzt Lyser voraus, dass die Adressaten wissen, wer sich hier hilfesuchend an sie wendet. Um dem Verdacht entgegenzuwirken, er sei eine fiktive Figur, kurz einige Angaben zur Biographie des Antragstellers.
Geboren wurde er im Jahre 1803 in Flensburg, als Sohn des Schleswiger Hofschauspielers Friedrich Burmeister und der Louise Catharina Marie, geb. Jansen. Zwei Jahre nach seiner Geburt ließen sich die Eltern scheiden, seine Mutter heiratete erneut einen Mann aus der Theaterbranche, den Schauspieler und Intendanten Friedrich von Mertens. Nach einem Duell, das für den Gegner tödlich ausging, musste Mertens seine Stelle aufgeben, eine neue Existenz aufbauen; dies geschah unter dem Namen seines Stiefvaters Lyser. Unser Lyser nun kombinierte lange Zeit die Namen beider Väter: Burmeister-Lyser, beließ es zuletzt aber bei: Johann Peter Lyser. Wobei er in frühen Jahren zuweilen der wohlklingenden Namensform den Vorzug gab: Jean Pierre Lysèr.]
Es liegt mir ganz und gar nicht, schön brav der chronologischen Ordnung folgend mein Leben zu vergegenwärtigen, dazu besteht wahrhaftig kein Anlass, also belasse ich es an dieser Stelle bei einem dankbaren Hinweis auf meinen Doppelvater Friedrich.
Vater Friedrich hat nachhaltige Spuren hinterlassen in meinem Gedächtnis; er las dem Kind Berichte vor über Expeditionen in ferne, meist tropische Länder. Ich lernte auf diese Weise Wörter kennen, die anderen Kindern meines Alters vielleicht erst sehr viel später begegnen, falls überhaupt. Ich nenne das Wort »Lippenschmuck«. Ein gleichsam wegweisendes Wort für mich als Mann der Sprache! Es folgten weitere wohlklingende Wörter, schön wie das Federkleid tropischer Vögel: Purpurbindertäubchen … Rotschnabel-Hokko … Graurücken-Trompetervogel … Ja, und es wurde mir von Schlangen vorgelesen, die mit gespaltenen Zungen am liebsten nach Lebewesen schnappen, die durch Schönheit auffallen: Schmetterlinge, Kolibris, Singvögel … Diese Schlangen lassen, getarnt und reglos, ihre Opfer nah herankommen, schnellen dann zum tödlichen Biss auf sie los … Schlangen dieser Art als Gefahr auch für Menschen: sie umschlingen Körper, töten durch Strangulation. Die kann so stark sein, dass sich das Knacken von Rippen weithin vernehmen lässt, auch bei Personen mit einer gewissen Fettschicht auf dem Leibe.
Vorgelesen wurde mir zudem von chamäleonartigen Amphibien, die, gleichfalls gut getarnt, auf der Lauer liegen, meist auf Ästen in Kopfhöhe von Menschen, und mit einem kurzen, giftigen Anhauch machen sie jede Orientierung zunichte. Als Folge auch ungewöhnliche optische Eindrücke: Grüne Blätter schillern kurzzeitig in allen Farben des Regenbogens, während farbige Blüten aschfahl werden. Dies in kaleidoskopischer Verwirbelung.
Als weitere Gefahr im Urwald: meterlange Fäden, die von Bäumen hängen, hochgiftig wie Nesseln der Portugiesischen Galeere, der Staatsqualle. Das Nesselsekret brennt sich tief in die Haut ein; versucht man die Wirkung durch Wasser zu lindern, so wird der Schmerz nur gesteigert. Das Gift dieser Nesseln kann sogar lähmend wirken – dies so rasch, dass Gegenmaßnahmen sich als vergeblich erweisen.
Was meinen zweiten Vater Friedrich betrifft, so verbindet uns ein zuletzt leider gemeinsam erfahrenes Leid. Ihm schien zuweilen, er hätte eine Zikade im Kopf, ja eine Doppelzikade: eine im rechten, eine im linken Ohr, hinter den Trommelfellen vor jedem Zugriff gesichert; dort sägen, sägen sie alles in Stücke, die Gehörgänge füllen sich mit akustischen Sägespänen … Sodann berichtete er mir vom Gong im Kopf, einem riesigen, sprich: chinesischen Gong, doch der Ton, der tiefe, satte Ton verschwingt nicht, schwingt nicht aus, hört einfach nicht auf zu schwingen … Und wiederum, wie er mir zuflüsterte, als ich ein Flüstern noch wahrnehmen konnte: unablässig knatternde Furzmaschinchen … Und wieder Zischen, Zischeln, das sich anderen Lauten verschließt, ein permanenter Zischverschlusslaut … Gelegentlich auch noch das Dröhnen eines Hammerwerks, Stampfwerks, das pocht, pocht, pocht besonders laut, wenn es draußen laut wird, bei einem Feuerwerk etwa.
Ein offenbar chamäleonartiges Hörphantom, bei Vater Friedrich zwo leider auch noch verbunden mit stetigem Nachlassen des Hörvermögens. Ich vermute, hier hat sich etwas emphatisch übertragen: bereits in frühen Jahren begann auch meine akustische Wahrnehmung nachzulassen.
Als Bub bin ich umhergeschippert auf diversen Weltmeeren, als jüngster Schiffsjunge an Bord. Damals schon war ich ein Fliegengewicht, bin über einssechzig nie hinausgekommen. Wer derart klein und leicht ist, den hätten widrige Winde ohne weiteres von einer der Wanten und Rahen wegblasen können, weit hinaus aufs offene Meer.
Indes: zwar nahm ich nicht an Gewicht zu, doch gewann ich an Geschick. Als wetterfester Jungseemann umrundete ich das gefeierte Kap der Guten Hoffnung ebenso wie das gefürchtete Kap Hoorn. Mal setzte sich ein Eisvogel auf eine der Rahen, mal ein Kolibri; mal paddelten Eskimos auf das Schiff zu, mal Südsee-Insulaner; mal sprach ich mit einem dänischen Missionar über die Sprache der Eskimos, mal ließ ich mich von einem nackten, reich tätowierten Insulaner einweihen in die Sprache seines Stammes; mal liebte ich in einem Iglu ein Eskimomädchen auf erst hartgefrorenem, doch recht bald schon dampfendem Fell, mal brachte ich mit einem Südseemädchen eine Basthängematte zu heftigem Schaukeln zwischen kokosnussschleudernden Palmen.
Ich darf allerdings nicht verschweigen, dass ich für meine Abenteuer, für die Erweiterung meines Horizonts einen zuweilen hohen Preis zahlen musste. Eine Zwischenlandung bei Dakar, Ladung wurde gelöscht, neue Ladung an Bord genommen, doch nach ein, zwei Tagen erkrankten mehrere Mann an der Ruhr, davon blieb ich nicht verschont. Der Kapitän wollte uns erst wieder an Bord lassen, wenn wir »ausgeschissen« hätten, und so kampierten wir in einem improvisierten Zelt (aus Segelplanen der Rüstkammer an Bord). Und ich lag, trotz der Hitze, zugedeckt mit Säcken, war schlapp, total schlapp. Und keiner, der sich um uns kümmerte, uns gelegentlich einen Schluck Wasser einflößte bei all dem Flüssigkeitsentzug.
So stellten sich bald Halluzinationen ein, entwickelten sich urplötzlich mit einem einzigen Wort, zugleich einem Bild, das ich nicht vertreiben konnte, vertreiben wollte, half es mir doch, die Zeit zu verkürzen bis zur Genesung. Ich darf Ihnen, werte Herren, das Wort nennen, ohne mich zu dekuvrieren: es war »Glasaal«. Sie müssen sich das auf der Zunge zergehn, durch die Köpfe schweben lassen, nur so können Sie sich, ansatzweise, in meine Situation bei Dakar versetzen: Glas-Aal … mit diesem Wort das Bild eines schwebeleichten Körpers … Glas-Aal … nur noch angedeutet: Skelett und Kontur … Glas-Aal … bloß geahnter Körperumriss … Glas-Aal … schwebeleicht im Leerraum … Glas-Aal … Glas-Aal …
Am dritten Tag sah ich draußen einen Seemann vorbeigehn mit einem Spießchen aufgereihter saurer Gurken. Ich stieß einen Schrei aus, so laut ich noch konnte. Der Seemann trat tatsächlich an den Zelteingang, wollte zu uns Dünnscheißern aber nicht reinkommen. »Stinkt ja wie die Hölle!«
Es war ein Seemann von einem der anderen Schiffe, die auf Reede lagen; er hatte sich an Bord mit Gurken versorgt, Gurken im Fass. Ich bat ihn, mir die Gurken zu verkaufen, ich würde sonst eingehn vor Durst. Davon riet er ab: Gurken bei Ruhr, da ist man schnell über den Jordan. Ich antwortete mit hölzerner Zunge, das könne ihm doch egal sein. (Um wahrhaftig zu bleiben, muss ich hier korrigieren: Der Situation entsprechend sagte ich, das könne ihm doch scheißegal sein.) Zudem: auf seinem Schiff könne er sich ganz gewiss weitere Gurken besorgen, frisch vom Fass. Und ich kroch auf allen vieren zum Zelt hinaus, legte eine Silbermünze in den heißen Sand, er legte mir die sauren Gurken in die Mütze; ich schleifte sie aus der brüllheißen Sonne in das stickig heiße Zelt. Die anderen Ruhrkranken, vielleicht neidisch, redeten mir zu: Der hat ganz recht, bei Ruhr noch saure Gurken fressen, da gehst du hops. Aber das waren schon zu viele Wörter, für mich gab es nur noch zwei Wörter: Saure Gurken, saure Gurken!Einer der Mitleidenden, nachskatend, nachhakend: Lass die Finger davon; wenn du die frisst, hast du für immer ausgeschissen. Das war kein Satz, der die Wörter »saure Gurken« enthielt, also hörte ich nicht darauf, setzte mich vielmehr hin, fraß knirschend, schmatzend die saftigen, essigsauren Gurken, Stück um Stück. Durst gelöscht, Bauch gefüllt.
Nun war der Kopf wieder frei für Fragen: Machen die Gurken dich jetzt kaputt? Angstschweiß, vermischt mit Afrikaschweiß. Mein Bauch kühl, gurkenkühl, grabeskühl ausgehöhlt. (Von der Bühne abtreten …? Leben vollenden …? Geist aufgeben …? Entschlafen …?) Einer der Kranken schlug für mich ein Kreuz, mit vorletzter Kraft. (Von hinnen scheiden …? In die Grube fahren …? Abgerufen werden …? Erlöst werden …? In die ewigen Jagdgründe eingehen …?) Ein anderer fragte mit toten Lippen nach der Zahl der verputzten Gurken. Als ich die nannte, schrieb er mich vollends ab. (Abkratzen …? Abnibbeln …? Verrecken …? Krepieren …?)
Ich streckte mich aus, schon war ich weg. Schlief neun Stunden, wachte auf: lebte also noch! Kein Glas-Aal mehr – verschwunden im Lichtflirren draußen. Da wusste ich: du bist auf dem Wege der Besserung.
Das wollten die andren nicht glauben. Doch, ich lebte noch, es ging mir sogar besser. Das wollte man erst recht nicht glauben. Ja, eigentlich ging es mir viel besser, ich fühlte mich fast schon gesund. Das, so meinte einer, sei das bekannte Aufflackern kurz vor dem Abkratzen. Aber ich kratzte, nibbelte nicht ab, verreckte nicht, krepierte nicht, wurde gesund, durfte als Erster aus dem Quarantänezelt wieder an Bord.
Diese Gurken-Episode, werte Herren, halte ich hier zum ersten Mal schriftlich fest. Ausführungen gleichen Inhalts werden Sie in keiner der gedruckt vorliegenden Publikationen finden, nicht einmal in meinem Roman.
Bereits mit vierzehn wurde ich Stellvertretender Kapellmeister in Paderborn – vorwiegend für Operetten, für Begleitmusiken von Possen. Anschließend ein Engagement in Lübeck. Und dort die große Tragödie meines Lebens: Ohne Vor- oder Warnzeichen wurde ich, im Alter von siebzehn, Opfer einer schweren Erkältungskrankheit, die mir auf die Ohren schlug. Ich wurde taub. Doch ich gab nicht auf, das schon gar nicht!
Nun erst recht auf der Suche nach Einnahmequellen, verdingte ich mich, Mitte zwanzig, als Zeichner in der Anatomie des St.-Jakob-Hospitals zu Leipzig. Als Gehilfe des Prosektors zeichnete ich Anomalitäten, krankhafte Missbildungen von Patienten vor, während und nach Operationen. Auch dies führe ich an, um zu signalisieren, dass ich lebenslang knapp bei Kasse war, infolgedessen vor keiner Tätigkeit zurückscheute. Will sagen, dass ich nicht durch Versäumnisse in die bedrängte Lage geraten war, vielmehr, dass äußere Faktoren auf mein Leben negativ eingewirkt haben.
Nachdem ich hinreichend Verfall und Verformung menschlichen Fleisches in präzisen Zeichnungen festgehalten hatte, ging ich über zum Schreiben. Ich verfasste vor allem Novellen über große Musiker, angefangen bei J. S. Bach.
Die Arbeiten schickte ich der Reihe nach an Robert Schumann, der sie gleichsam unbesehen in seiner Zeitschrift für neue Musik veröffentlichte. Doch blieb dann meist das Honorar aus; in diesem Punkt war der gute Schumann mehr als saumselig.
Und ich sackte wiederholt ab in einen Zustand der Verzweiflung. Zum Beleg ein Zitat aus einem Brief, den ich 1836 an Robert geschrieben hatte: »Mich hat eine niederträchtige Hypochondrie erfasst, so dass mir Gesellschaft, Weiber, Wein usw., kurz alles jetzt Pomade ist; mein einziges Vergnügen ist nur noch, mich auf ein Pferd zu setzen und herumzujagen, bis mir alle Knochen wie zerprügelt sind, damit ich nur schlafen kann, es ist ein fürchterlicher Zustand! Sende mir Geld, dann will ich einmal eine Champagnerkur versuchen, vielleicht hilft sie mir.«
Nach einigen Zwischenzeilen mit Grüßen an »Felix le Grand«, sprich: Mendelssohn Bartholdy, musste ich meine damals bereits chronisch desolate Finanzlage durch inständiges Bitten zu erkennen geben: »Eh bien, drucke den Bach und sende mir Gold, Gold, Gold, Gold, Gold, Gold! Dein höchst übellauniger, Dich dennoch herzlich liebender J. P. Burmeister-Lyser.«
Mit gerade mal 27 veröffentlichte ich bei Hoffmann und Campe meinen Roman Benjamin, »Aus den Blättern eines tauben Malers«. Ein Werk, in dem ich Erlebtes und Erlittenes frei umsetzte – ich bezeichnete es zutreffend als »Versuch eines Versuches«. Der Verleger bat mich, dies im Klappentext zu begründen, was denn wie folgt geschah: »Ich griff hinein ›ins bunte Menschenleben‹ und in mein eigenes … Mein Buch enthält nur Wahres, und dennoch ist alles erdichtet – aber nichts erfunden.«
Zur Fortsetzung meines Werkberichts rufe ich nun freilich nicht der Reihe nach die Titel der Kunstnovellen auf, die ich zumeist im Publikationsorgan von Freund Robert veröffentlichen konnte – ich weise lediglich hin auf meine Erzählung über Friedemann, den ältesten der Bachsöhne.
Der erhielt Vorschusslorbeeren vom Vater, fand gebührende Anerkennung unter Kollegen, doch zuletzt, in Dresden: verarmt und vergessen. Der alte Musikant vegetierte dahin in einer Dachmansarde, dem Verhungern und Erfrieren nah – ein erst kränkelnder, dann kranker, schließlich schwerkranker Greis. Ich suchte ihn zuweilen auf, obwohl mir das Treppensteigen, erst recht über vier Stockwerke hinweg, bereits schwerfiel, im Jahr vor seinem Tode. Ich vollzog so etwas wie eine Krönung der ramponierten Erscheinung in desolater Dachwohnung, versuchte, das ein wenig feierlich zu gestalten, setzte ihm einen Kopfreif auf, wie er unter Indianern Südamerikas hohen Rang in der Stammesgemeinschaft signalisiert.
Ich darf den Zeremonialhut rasch skizzieren: Langgestrecktes Baumwollnetz, in das Büschel von gelben, roten, schwarzen Federn dicht gesteckt sind; an zwei gezwirnten Faserschnüren ein langer Nackenschmuck mit Büscheln von überwiegend grüngelben Körperfedern des Ara; seitlich, an einer gezwirnten Baumwollschnur, das Präparat eines Honigsaugers.
Ich bin in der Beschreibung penibel, um verständlich zu machen, weshalb sich Friedemann, sonst niedergedrückt, mit dem Kopfreif wie erhoben, ja beflügelt fühlte. Fast, so könnte ich sagen, fast hätte er abgehoben – bei all den Vogelfedern wäre das kein Wunder gewesen.
Ich vermute, Sie möchten eine Zwischenfrage loswerden: Wie kam Antragsteller Lyser an ein derart rares Objekt? Recht einfach: Einer aus meinem Kreis (er zählt nicht zu den Freunden, eher zu den guten Bekannten) ist Präparator, vor allem von exotischen Vögeln. Immer wieder werden von Offizieren oder Reisenden auf einem der in Hamburg oder Cuxhaven einlaufenden Schiffe aus Südamerika oder dem Fernen Osten auch Vogelpräparate mitgebracht, die unter den klimatischen Unbilden der langen Schiffsreisen sichtlich gelitten haben, demnach dringend aufbereitet werden müssen. Ich habe dem Präparator gelegentlich zugeschaut bei der Tüftelarbeit und dabei so manch schöne, ja poetisch klingende Bezeichnung zu hören bekommen: Kahnschnabelreiher … Schlangenhalsvogel … Rosa Löffler … Schillertangare …! Dem Balg- und Federexperten habe ich eine originalgetreue Skizze des Zeremonialdekors vorgelegt, und er hat, dem einen oder anderen Vogelpräparat eine Feder entzupfend, das Wunderwerk ausgeführt.
Da ich schon mal dabei bin, Authentisches zu vermitteln in vertrauensbildender Maßnahme, gleich ein weiteres Zitat aus einem meiner zahlreichen Briefe an Schumann – dies auch als Beleg dafür, dass mir selbst bedrückendste Lebensverhältnisse nicht den Humor rauben konnten. »Nun leb wohl, Du fettes Stück aus Epikurs Stall. – Beiläufig noch die Nachricht, dass ich Bräutigambinund im OktoberHochzeit mache. Beileidsbezeugungen werden verbeten.«
Nein, Beileid, Mitleid brauchte ich zu jenem Zeitpunkt noch nicht, alles sah erst mal gut aus. Ich wurde Vater, und das sukzessiv dreifach: zwei Mädchen, ein Junge.
Damit sei ein Schlusspunkt gesetzt hinter die privaten Mitteilungen, auch wenn es zur einschneidenden Erfahrung wurde, dass sich Caroline einen englischen Komponisten als Hausfreund, als Geliebten erkor, der schließlich zweiter Ehemann der Kindsmutter wurde. Den Namen nenne ich nicht, setze nur Initialen ein: HHP. Und schicke, Distanz suchend, meine Gedanken wieder auf Reisen.
Als Jungseemann war ich angeheuert auf einem Ostindiensegler nach Ceylon. Ein großes Handelsschiff, und doch herrschte Enge – alles vollgestellt, vollgepackt! Auf dem Deck, zwischen Haupt- und Fockmast: Beiboote, Bug- und Notanker; in den Stauräumen viele hundert Fässer, von denen allein sechzig bis siebzig mit Trinkwasser gefüllt waren, ebenso viele mit Sauerkraut, gepökeltem Rind- und Schweinefleisch, mit Mehl, Erbsen und Zwieback, auch mit Wein und Branntwein. Hinzu kam Steinkohle, teils als Ballast im Kielraum, teils für den Herd in der Kombüse.
Trotz aller Vorkehrungen stellte sich auf der monatelangen Schiffsreise Skorbut ein: Zahnfleisch begann zu faulen, Zähne lockerten sich, auf der Haut bildeten sich blaue Flecken, Beine schwollen an … Nicht so bei mir! Ich verschaffte mir heimlich Zugang zu einem Sauerkrautfass; dabei war es von Vorteil, dass ich mich klein und dünn machen konnte. Alles Weitere lässt sich denken.
Trotz aller Belastungen an Bord – Seemannsgarn wurde gesponnen. Ceylon als Insel der Affen, als Eiland der Elefanten …! Von den Affen, die allenthalben in der Hauptstadt herumturnen, hieß es, sie würden mit Einwohnern Karten spielen, selbstverständlich um Geld. Wenn sie gewinnen, so laden die Affen die Verlierer ins nächste Gasthaus ein, geben dort das gewonnene Geld gleich wieder aus, zeigen sich spendabel; sie trinken nicht nur Tee oder Kaffee, sie lassen sich auch mal ein Starkbier schmecken, am liebsten von niederländischer Brauart, zeigen auch keine Abneigung gegen Tabakwaren.
Noch mehr wurde von den dort zahlreichen Elefanten erzählt, dressiert zur Schwerarbeit … Gefangen werden Nachwuchs-Elefanten in Fallgruben, und dabei soll Folgendes geschehen sein: Ein Elefant entdeckte seinen Sohn in einer Grube, wollte ihn mit dem Rüssel herausziehen, ließ sich dabei von Eingeborenen nicht vertreiben, jagte sie vielmehr davon mit den Stoßzähnen, versuchte weiterhin, den Sohn aus der Fallgrube zu heben. Weil das nicht gelang, füllte er die Grube mit Erde, Steinen, Stämmen, wollte den Sohn lieber begraben als versklavt sehen …
Während der langen Reise freundete ich mich mit einem Passagier an, einem Sanitätsoffizier, auf den in Colombo eine Stelle im Spital wartete. Er ernannte mich vorab zu seinem Famulus, versprach Kost und Logis, alles Weitre werde sich zeigen.
Colombo! Ein Mauerring, eine Festungsanlage. Zum Meer hin ist die Stadt durch Felsen und Riffs zusätzlich geschützt, landeinwärts ein weiter Wassergraben voller Krokodile. Innerhalb des Festungsrings: eine Kirche, eine Pulver-Windmühle, ein Waffenarsenal, ein weitläufiges Magazin, Umschlagplatz für Waren. Häuser wohlhabender Bürger mit Gärten, üppige Vegetation – Rhododendron, Lotus, Veilchen, Vergissmeinnicht, Orchideen, natürlich Orchideen. Ein Fischmarkt, auch für Dörrfisch, ein Markt für Leinen- und Seidenwaren, ein Markt vor allem für Obst: Avocados und Bananen, Granatäpfel und Mangos, Papayas und Passionsfrüchte, Orangen und Zitronen.
Mein »Dienstherr« war im Spital nicht übermäßig belastet, dennoch verfiel er nicht, wie andere Männer, der Tropenlethargie oder dem Tropensuff, er begann, Pflanzen zu sammeln, zu bestimmen, zu beschreiben, zu zeichnen, für Herbarien zu präparieren. Überwiegend Pflanzen aus Gärten und landwirtschaftlich genutzten Gebieten in Colombo und Umgebung, kaum hingegen Pflanzen aus dem Innern der Insel, aus dem tropischen Regenwald, dem Urwald. Um den Sanitätsoffizier anzuspornen, fragte ich mehr als einmal, ob Präparate von Regenwaldpflanzen nicht weitaus interessanter wären – und lukrativer: in Europa ließen die sich mit Gewissheit leichter verkaufen. Je weniger der Herr Sanitätsoffizier darauf einging, desto mehr machte ich mir diesen Vorschlag zu eigen. Mich lockte das Abenteuer. Doch allein, so schien mir erst einmal, ganz allein konnte ich das Wagnis nicht unternehmen, ich brauchte landeskundige Begleitung, und die konnte er als Offizier leichter rekrutieren als ich, sein Famulus.
Doch mein sogenannter Dienstherr redete sich auf Gefahren hinaus: Scharfzähnige Schakale, die man nachts sogar in der Stadt hörte mit ihrem durchdringenden Geheul … Wildschweine, Wasserschweine, allesamt mit Hauern ausgestattet … Krokodile im Wasser, Warane im Wald … Heißhungrige Leoparden und Löwen … Besonders gefürchtet die Kobra, die Kettenviper, der Tigerpython … Der Gaur, groß wie ein Büffel, schwer wie ein Büffel, und wie rasch wird man von ihm attackiert … Der Tiger, der Panther, der Panther, der Tiger … Gereizte Elefanten …!
Zu allem Überfluss auch noch dies: Das Innere der Insel beherrscht vom singhalesischen König. Der galt als besonders grausam – Gerüchte über Säcke voll geschrumpelter Ohren, ausgelaufner Augäpfel, luftgetrockneter Genitalien. Er schien auf solchen Säcken zu thronen. Je weniger man über ihn und sein Königreich wusste, desto häufiger wurde Abschreckendes erzählt über Kanda-Uda-Pas-Rata, die Hauptstadt der fünf Hügel, die seit alters her Fremden verschlossen blieb.
Kanda-Uda-Pas-Rata: das prägte sich ein, wurde zum silbenreichen Lockruf! Ich wollte, musste das Geheimnis ergründen. Weil keiner mich begleiten wollte, musste ich spezielle Vorkehrungen treffen. Eine so kleine und leichtgewichtige Person wie ich wird rasch zum Opfer, also zimmerte ich einen Holzrahmen, der mich mehr als kopfhoch überragte und mir zugleich erhebliche Breite verlieh. Den stattete ich üppig aus mit Raubvogelfedern, vor allem der Harpyie, schnallte mir den Rahmen auf den Rücken, sah nun fast doppelt so hoch und doppelt so breit aus, marschierte dergestalt durch den Regenwald. Mehrfach zwischen Baumstämmen, Büschen, Lianen et cetera verkantet und verheddert, folgte ich dennoch konsequent der Richtung, die eine Karte vorzeichnete, ein Kompass vorgab.
Und ich blieb unbehelligt! Dahinziehende Jäger und Sammler wichen aus, Raubtiere überlegten sich mögliche Attacken dreimal und kamen zu klaren Ergebnissen. Ich erreichte die Position der Stadt Kanda-Uda-Pas-Rata und fand sie nicht vor! Keine Spur von einer Stadt auf weithin dominierender Kuppe. Demnach auch kein bösartiger Herrscher, keine Säcke mit getrockneten Augen und Genitalien. Leichtfüßig kehrte ich bergab zurück, leistete in Colombo meinen Beitrag zu dem (noch ungeschriebenen) Kapitel der Aufklärung auf Ceylon.
Es folgte eine Phase der Stagnation. Mentale Impulse zur Erkundung und Eroberung des Pflanzenraums wurden mehr als nur gedämpft. Dazu trug eine Person bei, die unerwartet in mein Leben trat: Mallika, vierzehnjähriges singhalesisches Mädchen, das seit zwei Jahren im Waisenhaus arbeitete, dort die Sprache der niederländischen Leitung erlernt hatte. Ich geriet in ihren Bann, wurde ihr Leibeigener der Lust. Damit gewann sie Einfluss auf mich, ja so etwas wie Macht. Sie legte sich wortwörtlich quer bei allen Versuchen, erneut den Weg in die tropischen Wälder zu wagen, spielte bei jedem Aufbruchsbegehren die Vormacht aus, die sie über meinen Körper erlangt hatte. Als sie schließlich erkennen musste, dass mich letztlich doch nichts vom Plan abbringen konnte, stellte sie sich um, machte sich zur Helferin, vermittelte einen Begleiter. Mit ihm zog ich los in den Regenwald.
Eine Enttäuschung! Der Urwald sah völlig anders aus, als ich mir das bei der Anreise vorgestellt, in vielen Farben ausgemalt hatte. Dreißig, ja vierzig Meter hoch die Bäume, und die Kronen so dicht geschlossen, dass unter ihnen nur wenig gedeihen konnte. Mittelhoher Bewuchs allein dort, wo sich das Kronendach öffnete, etwa nach dem Sturz eines Baumriesen. So war es mir relativ leicht gefallen, mit dem sperrigen Gestell auf dem Rücken voranzukommen.
Bei jener Exkursion zur fiktiven Stadt auf dem faktischen Bergrücken war mein Blick naturgemäß stets nach vorn gerichtet gewesen, sprich: mehr oder weniger horizontal. Nun aber die große Überraschung: Als ich das mitgeführte Teleskop zufällig in den Bereich der Baumkronen richtete, sah ich durch Blätterlücken hindurch Blüten neben Blüten, Blüten über Blüten – Orchideen, hoch droben auf Ästen gedeihend.
Aber wie dort hinaufkommen? Kaum Queräste an den hochragenden Stämmen … Mein Begleiter gehörte indes zu den Singhalesen, die in Palmenzonen des Küstengürtels Kokosnüsse ernten, dazu, mit einer Seilschlaufe gesichert, Palmstämme fast hinauflaufen. Ein so erfahrener Kletterer musste auch den Kronenbereich eines der Baumriesen erreichen!
Was denn auch gelang! Der Kokosnussernter warf erste Muster exotischer Vegetation herab. Ich wollte mehr, mehr, viel mehr von solchen Kreationen in Händen halten, doch der Singhalese kletterte eiligst wieder herunter – fast rutschte er den Stamm herab. Jäh war ihm der Gedanke gekommen, die Pflanzen hoch droben könnten für Götter bestimmt sein, die bei ihren Flügen auf die Kronen herabblicken, ja, auf unserem besonders großen Baum sei ein Zeichen für die Götter gesetzt, ein Pflanzenzeichen, wie es noch kein Menschenauge erblickt hätte, ein schmetterlingsbuntes Signal. Beschreiben wollte er das außergewöhnliche Phänomen aber nicht. Er wiederholte nur immer: Allein für Götter könnten die Gewächse, die Blüten dort oben bestimmt sein …!
Ich versprach hohe Belohnung für weitere Pflanzenwürfe, doch der Eingeborene ließ nicht mehr mit sich reden: Zur Strafe für fortgesetzten Frevel könnten ihn zum Jähzorn gereizte Elefanten, von Göttern mit überlangen Hakenstangen gelenkt, zwischen Wald und Stadt angreifen, die Ohren ausgeschwenkt, die Rüssel vorgestreckt, grell die Trompetenschreie.
Vor der großen Baumkronen-Expedition kleinere Exkursionen in den Regenwald. Die habe ich genutzt zu Beobachtungen, wobei ich mich eines Marine-Teleskops bediente, das ich leihweise mitführte zur rechtzeitigen Wahrnehmung feindlicher Annäherungen. Dieses Instrument nun verhalf mir zu einer Entdeckung, die mich in jener Zeit nachlassenden Gehörs zu hoher und höchster Aufmerksamkeit motivierte: Mir gerieten zwei Käfer in den Teleskop-Sichtkreis, die ausgiebig über ihre Fühler kommunizierten.
Keine beiläufige, womöglich bloß zufällige Beobachtung! Ich nutzte den Umstand, dass die meisten Tiere ihrem Revier treu bleiben. So kehrte ich wiederholt zum vorsorglich markierten Waldstück zurück, um meine Beobachtungen fortzusetzen, Beobachtungen, zu deren Publikation ich leider noch nicht gekommen bin: Das Malen von Bildern und Schildern, das Komponieren von Liedern, das Verfassen von Gedichten und plattdeutschen Märchen hat sich notgedrungen in den Vordergrund geschoben.
Die Fühler waren fast so lang wie die Käfer selber, die – dem Dschungelgewucher adäquat – etwa handtellergroß waren. Die Fühler gliederten sich in drei Abschnitte, dies mit fließenden Übergängen. Die Spitzen der Fühler waren dunkler als ihre Ansätze, stuften sich fortlaufend ab vom dunklen zum hellen Rotbraun. Die geringen Farbdifferenzen dürften ausgeglichen werden durch unterschiedliche Oberflächenbeschaffenheit; deren Charakteristika sind äußerlich allerdings kaum erkennbar.
Die beiden Panzerkäfer beklopften sich jeweils in den gleichen Fühlersegmenten: hart auf hart, mittelhart auf mittelhart, weich auf weich. Woraus sich schließen lässt, dass jeweils ein Segment für ein bestimmtes Spektrum von Mitteilungen bestimmt ist. Wie auch immer: Erstaunlich hoch war die Geschwindigkeit, mit der sich die Fühler wechselseitig beklopften, erstaunlich lang waren die Phasen von Mitteilungen in der von mir entdeckten Berührungssprache.
In mir arbeitete es weiter: Ich wollte – koste es, was es wolle – in das Reich der hohen Baumkronen eindringen, nur wie …?! In einer Tropennacht der Einfall, der mir als rettende Idee erschien: Eine der Harpunen besorgen, mit denen Wale und Haie gejagt werden … Mit solch einer Harpune das Fangseil hinaufschleudern in den Kronenbereich; die Harpune soll über einen belastbaren Ast hinweg wieder herunterfallen; am Seil wird sodann eine Strickleiter hinaufgezogen, zumindest ein Seil mit dicken Knoten, das Hochklettern erleichternd.
Ich besorgte mir eine Harpune: sie gehörte zur Ausstattung eines der Schiffe, die vor Colombo auf Reede lagen. Die ersten Würfe misslangen: die Harpune fiel schon vor dem angezielten Ast zurück, verfing sich beim nächsten Wurf in kleinerem Geäst, musste heruntergerissen werden. Doch ich gab nicht auf; mit der mir eigenen Geschicklichkeit gelang der dritte Harpunenwurf, das Seil hing herab von einem kräftigen Ast, die Strickleiter konnte hinaufgezogen werden, ich war kurz, ganz kurz vor dem Ziel – und jäh der Vipernbiss. Eine Kettenviper! Ich schlug sie blitzschnell tot, bepisste mein Bein, wie das für solch einen Fall geraten wurde, doch rasch dehnte sich Rötung aus. Hastig die Rückkehr. Mallika wusste, welche Pflanzen Schwellung und Schmerz dämpfen, doch mehr als Linderung verschafft Osterluzei auch nicht, Schwärzung setzte ein. Pflanzensud, Pflanzenkompressen, damit das Gift sich nicht noch weiter ausdehnte im Körper. Mallika munkelte, einer der Götter hätte die Schlange losgeschickt, zur Strafe.
Und ich machte eine neue Erfahrung mit mir selbst: ich ließ mich in die Krankheit fallen. Hatte es früher schon Ansätze dazu gegeben? Das fiebernde Kind hatte sich gern umsorgen lassen. Die Mutter hatte das gefördert, damals: Schon dich ein bisschen … Und hatte mir, oft über Stunden hinweg, vorgelesen aus Berichten von Expeditionen in ferne Länder, vom oft gefährlichen Erkunden exotischer Pflanzen- und Vogelwelten. Und Namen prägten sich ein! Schlangenhalsvogel … Goldstirnsittich … Grünschnabel-Tukan … Eisvogel Motmot und Maskenpitpit … Was Wunder, dass ich Mallika bat, mir am Krankenbett weiter vorzulesen.
Ich musste mich länger schonen als erwartet: Das Bein weiterhin geschwärzt, nur langsam ging die Schwellung zurück, die Muskulatur blieb angegriffen, obwohl Mallika Pflanzentinkturen mischte für Getränke und Kompressen, unter mehr oder weniger fachkundiger Beratung von Verwandten, auch von Bekannten. Ins Spital aber wollte ich auf keinen Fall: der Sanitätsoffizier sollte nicht rechthaberisch triumphieren …
In der Selbstverpflichtung zur Wahrheit muss ich eingestehen, dass ich in meinem Schmerz, in meiner Verzweiflung nicht allein auf Mallika vertraut, sie vielmehr gebeten hatte, einen Schamanen heranzuziehen. Und der wirkte wahre Wunder! Das sogar über den Heilungsprozess hinaus!
Unter diesem Aspekt sollte ich kurz die Zeremonialkleidung des Schamanen beschreiben, zumindest skizzieren.
Am auffälligsten war der Tanzhut – ja, mit Tänzen wurde mein Heilungsprozess fast synchron begleitet. Der Hut zeigte, und zwar in ganz bestimmter Reihenfolge, Bänder von Federn verschiedener Vögel, wobei jedes Federband einen Naturdämon verkörperte oder eher markierte. Es waren Schwanz- und Kragenfedern in Weiß von einem Hahn, in Schwarz von einem Hokko-Huhn, in Türkis von einem Tukan, in Rot und Grün von einem Ara, wiederum in Weiß von der Harpyie, einem besonders hässlichen, dennoch verehrten Großvogel. Vom Zeremonialhut herab ein langer Nackenbehang aus drei Federreihen, vor allem vom weißen Riesenstorch und dem Gelbbrust-Ara. Beim Tanz gerieten die Federn ins Schwingen wie Flügel eines abhebenden Vogels. Begleitet wurde der Tanz vom Rasseln einer Kalebasse, die verziert war mit kleinen Federbüscheln aus grünen Arafedern und braunhell gestreiften Harpyienfedern. Wichtig auch: jeweils am Oberarm des Schamanen ein Reif; der Baumwollstrang behängt mit Quasten, mit Anhängern aus bunten Glasperlen, mit halbierten Palmnuss-Schalen, besteckt mit buntem Papageiengefieder.
Das Wort »Tanzhut« deutete wohl schon an: mein Heilungsprozess wurde von Tänzen begleitet. Elaborierte Bewegungsfolgen: Da besagte ein Schleifschritt auf einem Viertel des Halbkreises sicherlich etwas anderes als ein Schleifschritt in der Hälfte eines Halbkreises. Mit Schleifschritt und Pendelschritt, Sprungschritt und Schlenkerschritt, Spindelschritt und Zwieselschritt ist das Spektrum der Bewegungen freilich nur angedeutet.
Sie können von diesen Ausführungen unschwer ablesen, dass ich sehr genau hingeschaut und mir alles eingeprägt habe. Was indirekte, aber weiter reichende Folgen hatte, nahm der Medizinmann doch trotz seiner Trance wahr, wie aufmerksam ich seinen Ritualen folgte; es entstand ein Vertrauensverhältnis, nicht wortreich, aber wirkungsstark – wobei Mallika dolmetschend vermittelte. Kurzum, ich durfte schließlich partizipieren an einigen der schamanentypischen Stimulationen: Kauen von speziellen Pflanzen, Trinken vom Sud jener Pflanzen (die ich weder benennen kann noch darf), und man hebt ab in einen Zustand, der laut Mallikas Übersetzung so bezeichnet wurde: Als Vogel ins Jenseits fliegen … Und wieder zurück. Es fand so etwas wie magische Übertragung statt: Als ich geheilt war, besaß ich – wenigstens für kurze, jedoch entscheidende Zeitphasen – die Fähigkeit, abzuheben. Dies im direkten Sinne des Wortes.
Damit Sie nicht annehmen, es handle sich dabei um ein rein exotisches Phänomen, darf ich hinweisen auf einen Vorgang, der im europäischen wie im nordamerikanischen Bereich als Levitation bezeichnet wird: die Fähigkeit, sich mit spiritualisierter Körperlichkeit in die Schwebe zu bringen. Ich erinnere an die hinreichend gefeierte Sensation von New Jersey, als ein Mann im Zustand der Levitation aus dem Fenster seiner Wohnung im vierten Stock hinausschwebte und, nach einer ruhigen Luftkurve, durch ein anderes, ebenfalls geöffnetes Fenster desselben Stockwerks wieder hineinschwebte und wohlbehalten auf dem Teppich landete. (Nebenbei bemerkt: Dieser Vorgang dürfte bei der dünneren Luft des Hochplateaus von Tibet noch leichter gelingen.)
Ich kehrte als gleichsam neuer Mensch zurück zu »meinem« Baum im Regenwald – jenem Baum, den der Singhalese fluchtartig verlassen, jenem Baum, an dem mich der Vipernbiss ereilt hatte. Ich bereitete mich systematisch auf die Levitation vor mit dem Kauen des mitgeführten, hochspezifischen Gemischs von Pflanzensubstanzen, mit einem Schluck Pflanzensud der besonderen Art – und schon hob ich ab. Was allerdings gefördert wurde durch den Gewichtsverlust nach dem Vipernbiss. Mit geschlossenen Augen schwebte ich hinauf zum ersten der mächtigen Queräste der weit ausladenden Baumkrone. Und nun zahlte es sich aus, dass ich als Schiffsjunge gelernt hatte, ebenso rasch wie gelenkig hoch droben am Hauptmast herumzuklettern, auf einer der Rahen ein Segel setzend oder bergend.
Ich wurde wundersam belohnt! In der Tat wuchsen dort oben Orchideen in größter Vielfalt der Formen und Farben! Zartes, doppelt gefiedertes Blattwerk … traubiger Blütenstand mit langgestielten Einzelblüten … tiefgelappte Blätter … leuchtend rote, mehrfach verzweigte Blütenstände … Fleckenzeichnung entlang der Hauptadern … karminrote Trichterblüten … blaue Schmetterlingsblüten mit hellem Zentrum … grünlichgelbe, braunviolett punktierte und gestreifte Kronzipfel … breite, lilarosa gefärbte, stark vanilleartig duftende Blüten … Statt vieler Namen, die ich aus dem Ärmel schütteln könnte, eine einzige Bezeichnung, Ihnen gleichsam als Hommage vorgelegt: Phalaenopsis Schilleriana.
Das wahre Wunder aber war der Schmetterlingsblütler, in dem der Singhalese ein Zeichen, ein Signal für anfliegende Götter gesehen hatte. Kein Wunder, denn: Die weithin überragende Baumkrone wurde wiederum überragt – dies um etwa anderthalb Meter – von einem schlanken Stängel, gekrönt von einer Blüte in Form und Farbe eines tropenbunten Schmetterlings.
Ich hätte diese Wunderpflanze bergen und für den Transport nach Europa konservieren müssen, wie aber hätte sich das technisch realisieren lassen? Ich hätte einen Behälter gebraucht, noch länger als das Futteral für mein Bassetthorn, ja, noch besser wäre ein etwa zwei Meter langes, oben für die Blüte ausgebauchtes Glasgefäß gewesen, aber wie hätte ich das von der Baumkrone herab und durch den Regenwald zum Küstenbereich schaffen können, um es schließlich auf dem Schiff vor den Einwirkungen der mit Sicherheit bevorstehenden Stürme zu schützen? Ich musste mich damit begnügen und die Fachwelt damit zufriedenstellen, dass ich dort oben eine präzise Zeichnung anfertigte mit exakten Angaben der Farbwerte – Hinweise, die ich erst später umsetzen konnte, mit Deckfarben.
Meine früh schon dokumentierten Fähigkeiten und Fertigkeiten als Maler kamen hier voll zur Geltung, nur leider nicht voll zur Wirkung: Unter Botanikern wurde, in einem Akt der Verschwörung, mein Fund stillschweigend ignoriert. Dabei hätte die von mir entdeckte und dokumentierte Pflanze durchaus meinen Namen verdient: Orchidea magnifica lepidopteriosa lys. Offenbar war man eifersüchtig auf meinen Fund – als stünde sowas nur Botanikern zu. In der Tat wäre diese Entdeckung und ihre wissenschaftlich relevante Publikation die Krönung eines Botanikerlebens gewesen – und nun machte dies ein Maler, Musiker, Schriftsteller geltend! Dagegen half nur ein Massenaufgebot an Vorurteilen! Kurzum, die Schmetterlingsblüte blieb auf dem Papier, das ich, auf Verlangen, gern nachreiche, damit Sie einen unmittelbaren Eindruck gewinnen können von der Bildkraft dieser wundersamen Erfindung der Natur.
Und die Belegstücke in den Herbarien, in den Bastkörben? Ich habe wahrlich nicht mit leeren Händen die Heimreise angetreten, doch die Umstände waren widrig. Will sagen: der Stauraum war äußerst knapp, auch in diesem Riesenschiff von 24 Metern Länge.
Sie müssen sich einen Ostindienfahrer etwa so vorstellen: auf dem Deck reihen sich steuerbord wie backbord Kanonen – Handelssegler sind besonders bedroht durch Piraten. Auch das Deck darunter: beherrscht von Kanonen. Über ihnen, zwischen ihnen Hängematten, in denen die Kanoniere schlafen – die Matten hängen so dicht, dass bei den Schaukelbewegungen des Schiffes Körper an Körper stößt.
Mir wurde ein Plätzlein zugewiesen im zweiten Unterdeck, dort, wo sich die Seemänner aufhalten und schlafen. Fragen Sie nicht, wie Luft, womöglich Frischluft in die Holzkammer dringt, die lediglich durch eine sehr steile Stiege zu erreichen ist. Ich kann nur sagen: Stickluft, zum Schneiden dick! Übrigens war unter dem Mannschaftsraum ein drittes Tiefgeschoss, mit der Segelkammer, der Pulverkammer und so weiter. Im Kielraum darunter vor allem Wasserfässer. Das Reich absoluter Finsternis!
Ich skizziere die drangvolle Enge auf vier Ebenen, um plausibel zu machen, weshalb ich schließlich mit leeren Händen zurückgekehrt bin. Einen Winkel, womöglich Spind, in dem ich meine botanischen Präparate, meine Fundstücke hätte verstauen können, gab es von vornherein nicht. Ich hatte nur eine Kiste zur Verfügung, und in der geschah Schlimmes, bevor das Schlimmste mit ihr geschah. Im feuchtheißen Klima zwischen Ceylon und dem Kap der Guten Hoffnung setzten die getrockneten und gepressten Pflanzen Schimmel an, und die Schmetterlinge, von gleicher Farbenpracht wie die Blüten, wurden von Schädlingen angefressen – winzige Käfer, die sich einfanden wie von einem bösen Geist gerufen.
Blieben die Vogelpräparate: in einer luftdichten Kiste hätte ich sie retten können, aber die Kiste ließ Luft herein und Gestank heraus, die Seemänner in der Kammer murrten erst, dann maulten sie und schließlich – mir zittert die Hand, während ich das schreibe –, schließlich warfen sie, während ich sinnend am Bug stand, am Heck die Kiste über Bord.
»Auf Nimmerwiedersehn!«, rufe ich ihnen nach: der Sonnenralle wie dem Schwarzen Geier, der Glanz- wie der Moschusente, dem Truthahngeier, Pfefferfresser, der Lanzettschwanzpipra und Pompadourkotinga, der Rotbug-Amazone und dem Langschwänzigen Tyrannen (Colonia colonus).
Gleich nach der Rückkehr aus Ceylon unternahm ich, von Cuxhaven aus, einen kräftezehrenden Fußmarsch nach Bamberg. Dort suchte ich den großen E. T. A. Hoffmann auf, half ihm beim Malen von Bühnenprospekten. Als »Famulus« habe ich Hoffmann einiges abgeguckt: Die rote Kappe … den chinesischen Schlafrock … die Pfeife mit einem Stiel, der fast drei Viertel seiner und meiner Gesamterscheinung maß – ich transportierte das zerbrechliche Utensil im Behältnis, in dem auch mein Bassetthorn steckte. (Anmerkung für die Nichtmusiker unter Ihnen: Es handelt sich um eine Alt-Klarinette mit aufgebogenem Schalltrichter.)
Damit gleich das Stichwort Musik: Ich habe dem Meister auch beim Komponieren assistiert, die eine oder andere Partie ausführend, zu der Hoffmann nicht die rechte Lust verspürte. Schrieb zudem Orchesterstimmen aus. Sang zuweilen auch eine Strophe eines von mir komponierten Liedes, ließ mich auf dem Bassetthorn vernehmen, improvisierend, fantasierend, geisterleicht umherschreitend.
Die Verständigung mit Hoffmann war allerdings schwierig. Denn: nach (oder eher: auf Grund) der Ceylon-Reise habe ich das Gehör verloren – Nachwirkung, Spätfolge des Viperngiftes.
Dennoch: wir haben nicht nur gemeinsam an Bühnenbildern, Theaterprospekten gearbeitet, wir haben auch ein veritables Gemälde vollendet: Gemeinschaftsarbeit von Gleichgesinnten.
Ich wollte allerdings nicht nur malen, musizieren, dichten, und so hatte ich mich vor etwa 45 Jahren erneut anheuern lassen auf einem Frachtsegler mit Kurs auf Kapstadt. Dabei, wie üblich auf dieser Route: Zwischenlandung St. Helena, zum Auffüllen von Trinkwasser, zur Versorgung mit Proviant, zur Reparatur von Takelage (nach einem der unvermeidlichen Stürme).
Ich habe die Ruhetage genutzt zu einem Besuch bei Napoleon. Wobei gleich angemerkt werden muss: Es war nicht leicht, zum streng bewachten Mann vorzudringen. Mein Vorwand und meine Begründung: Überreichen eines Geschenks. Es handelte sich um ein Fässchen Kölnisch Wasser, hergestellt hier in Altona, somit preiswerter als echtes Kölnisch Wasser: findigen Mitbürgern war es gelungen, das Rezept der Kölner zu analysieren, zu reproduzieren.
Auf einem Maultier ritt ich hinauf zum windüberstrichnen Bergsattel mit Haus Longwood. Dort wurde ich von Napoleon bereits erwartet – in seiner Statistik, nicht persönlich. Er pflegte die Böllerschüsse zu registrieren, mit denen jedes am Horizont auftauchende Schiff angekündigt wurde, hatte zudem, aus alter Gewohnheit, ein Nachrichtensystem ausgebaut, durch das er über Heimathafen (hier Cuxhaven), Namen (Godewind) und Ladung (Waffen für afrikanische Kriegsherren) informiert war – eine der ablenkenden Beschäftigungen auf der für ihn fast tödlich langweiligen Insel.
Selbstverständlich wurde ich von einer englischen Wache angehalten, sobald ich mich Haus Longwood näherte. Ich konnte den diensttuenden Sergeanten jedoch leicht davon überzeugen, dass mein Fässchen keinen Sprengstoff enthielt – ich ließ gluckern.
Warum ausgerechnet dieses Geschenk, werden Sie fragen. Nun, einer Pressenotiz hatte ich entnommen, dass die Engländer, allen voran Insel-Kommandant Sir Hudson Lowe, nicht bereit waren, Napoleon den Wunsch nach Kölnisch Wasser zu erfüllen, nachdem seine an Bord der Bellerophon mitgeführten Bestände zur Neige gegangen waren; man blieb britisch hochnäsig, versagte ihm den Import von Kölnisch Wasser, so dass der Exkaiser auf Lavendelwasser angewiesen war, was ihn aber nicht ganz so erfrischte wie Eau de Cologne, das zwar ebenfalls Lavendel enthält, dies jedoch zusätzlich mit dem ätherischen Öl der Zitrone, der Bergamotte, von Rosmarin und weiteren Pflanzen, die mir leider nicht bekannt sind. Dies aber weiß ich: Mein Geschenk war, strenggenommen, gepanschtes Kölnisch Wasser, aber das hat Napoleon nicht anders verdient, nachdem er so vielen Menschen das Leben verdorben oder gar gekostet hatte. Der Inhalt des Fässchens sollte ausreichen für die folgenden Jahre, in denen Napoleon erwartungsgemäß noch beleibter wurde, infolgedessen noch mehr transpirierte, womit sich wiederum der Konsum von Duftwasser erhöhen musste.
Voilà, es schien, als würde ihm Manna überreicht oder eher: Nektar! Auf der Stelle musste das Fässchen geöffnet werden von einem der Mitarbeiter, die als Zeitzeugen nach St. Helena zitiert worden waren, und schnuppernd überzeugte sich der Exkaiser von der Frische des Eau de Cologne aus Altona, das er für Kölnisch Wasser aus Köln hielt, bestrich mit feuchtem Zeigefinger den Achselbereich seiner Jacke, woran er gut tat, bestrich die Stirn, was sich günstig auswirkte – nach der erst mürrischen Phase wurde er leutselig, erkundigte sich, woher ich käme und was meine Profession sei. Bei den Stichworten Ceylon, Colombo, Regenwald horchte er auf, nahm Platz, forderte mich mit einem Wink auf zu berichten.
Und ich erzählte von meiner Tigerjagd auf Ceylon. Berichtete dem waffenkundigen Zuhörer, dass ich mir dazu eine Muskete beschaffte. Denn: zum Tiger passt eine Muskete, nicht eine Flinte, nicht ein Gewehr – kein Schießprügel also üblicher Art. Das Schießen musste ich nicht erst erlernen, ich schoss mich ein. Mit der Muskete zog ich denn los, geführt von einem Shikari.
Erst einmal: langer Anmarsch. Tümpel, Mücken, Mücken … Schilfdickichte, die wir umrunden mussten … Wasservögel, auffliegend, Reiher … Mangrovengehölze … Gestürzte Bäume … Faulendes, zuweilen phosphoreszierendes Holz … Gestrüpp, durch das wir den Pfad freihacken mussten … Mücken, Mücken, Mücken … Wildtauben und Dschungelhühner … Stachelschweine, die aus Verstecken flüchteten …
Pirschgang über Stunden hinweg. Ich wie besessen vom Wunsch, vom Verlangen, einen Tiger zu schießen. Endlich die ersten Spuren: Tatzenabdrücke im weichen Grund. Dann ein sichtlich von einem Tiger gerissener Zebuochse, aufgefetzt an der Halsschlagader und zum Waldrand gezerrt, wie die Schleifspur verriet. Also war damit zu rechnen, dass der Tiger zurückkehrte zu seinem Opfer, in der Dämmerung, in der Nacht.
Es waren bereits Schakale beim Tigerköder; sie konnten nicht durch einen Schuss vertrieben werden, das Geräusch hätte den Tiger warnen können. Also kletterten ich und der Shikari auf zwei nebeneinander stehende Bäume, hielten still, obwohl wir, ständig von Mücken umsirrt und gestochen, eigentlich nicht stillhalten konnten, das Warten wurde zur Qual. Doch das Jagdfieber war stärker als der Wunsch nach Schlaf. Wir warteten, warteten. Zwischendurch ein Schauer, wir wurden durchnässt, blieben weiterhin auf den Ästen sitzen. Leuchtinsekten … Nachtfalter … Ein Dschungelhahn … Das Heulen von Schakalen fern, das Schmatzen von Schakalen nah … Und, wie aus dem Boden gestampft, war er da, der Tiger! Ein Fauchen, ein rauer Atemstoß, die Schakale wurden vom Aas weggetrieben, und es begann das Reißen von Fleisch: flatschende, klatschende Geräusche, hörbares Zermalmen, Zermahlen.
Endlich mal wurde der Tiger deutlich sichtbar auf dem zerfleischten Zebuochsen, die Muskete wurde gezündet, ich traf! Doch der Tiger, angeschossen, entkam. Wir konnten ihm nicht folgen vor der Morgendämmerung, das wäre zu gefährlich gewesen, das waidwunde Tier hätte einen von uns anfallen können oder beide, also machte der Shikari ein Feuer. Kleine Stärkung. Sobald es heller wurde, folgten wir der Spur des angeschossnen Tigers – sein »Schweiß« blasig an Blättern und Gräsern. Stundenlang die Pirsch, wir arbeiteten uns vor durch Dorngestrüpp, die Hände blutig geschrammt, die Gesichter geschwollen von zahllosen Mückenstichen; Hunger, Durst und Erschöpfung, beherrschend aber der Gedanke: den waidwunden Tiger aufspüren!
Und wir fanden ihn, abgerutscht an einer Hügelflanke, in die er seine Krallenpranken geschlagen hatte; so lag er dahingestreckt, verendet, ein Königstiger von acht Fuß Länge. Triumphgefühl trotz aller Erschöpfung. Und das Gelöbnis: Dies soll nicht der letzte Tiger sein. Ja, ich hatte Tigerblut geleckt!
Napoleon, der sich bestens unterhalten fühlte, spendete Beifall und befahl eine Fortsetzung. Also ließ ich einen zweiten Tiger los. Und in den Kronen größerer Bäume der Hochfläche gaben englische Soldaten durch gelegentliches Aufblinken der Teleskopgläser im Sonnenlicht ihre Anwesenheit unfreiwillig zu erkennen. Der optische Telegraph, an geeigneter Stelle postiert, gab zum Dienstsitz des Sir Hudson Lowe durch: Der Fremde lässt eine Fortsetzung folgen. Zweimal strich, quasi zufällig, ein sicherlich sprachkundiger Offizier durchs Gelände, um sich davon zu überzeugen, dass von Konspiration nicht die Rede war. Auch er verharrte, sichtlich gebannt. Und Napoleon betupfte, in der Hör-Erregung stärker schwitzend, Achseln und Stirn mit Altonaer Eau de Cologne.
Zurück nach Altona! Da ich nicht davon ausgehen kann, werte Herren der Schillerstiftung, dass Ihnen mein bisheriges Gesamtwerk in vollem Umfang gegenwärtig ist, darf ich Ihnen (komprimierte) Wiedergaben aus einem meiner Opernlibretti vorlegen.
Da ich mich wohl hinreichend als Musiker ausgewiesen habe, ebenso als Komponist, werden Sie fragen, warum ich nicht einfach die Partitur vorlege. Nun, ich habe mein Libretto nicht selbst vertont. Ich bin eher Komponist von Liedern. Sie werden kaum eine Vorstellung davon haben, welch eine astronomische Zahl von Noten der Komponist einer Oper niederschreiben muss. So habe ich es Friedemann Bach angeboten – er hat abgewinkt. Habe es meinem Freund Franz Xaver Mozart vorgelegt – er erklärte daraufhin, sein Vater hätte sicherlich genügend Opern geschrieben, dem müsse er als Sohn nicht nacheifern.
Und Robert Schumann, mit dem ich in Freundschaft verbunden war? Für ihn war ich einer der Beiträger seiner Zeitschrift, darauf war sein Blick verengt. Und es trübte unsere Beziehung schon mal ein, dass er mir, wie bereits erwähnt, Honorare für Künstlernovellen schuldig blieb, und dies reichlich lang. Sich direkt an ihn zu wenden war aber auch nicht immer leicht. Zuweilen saß er in einem Gasthaus, den schaumlosen Bierkrug vor sich, den Blick über Stunden hinweg starr auf die Wand gerichtet.
So wandte ich mich wieder einmal an Clara, die ich bewundere, die mich schätzt, sonst hätte sie nicht eins meiner Gedichte vertont. Vielleicht ging ich etwas zu direkt vor in diesem Gespräch; in vertraulichem Tonfall gab ich zu erkennen, dass ich Roberts Projekt Das Paradies und die Peri für allzu abgehoben hielte, dass es sehr viel erfolgversprechender sein dürfte, mein fulminantes Libretto zu vertonen. Daraufhin Clara: Mein Lieber, ich werde schaun, was sich machen lässt, aber ich fürchte, ich werde hier bei Robert auf taube Ohren stoßen.
Wenn nicht Bach junior, wenn nicht Mozart junior (beide wohl allzu sehr belastet von den Namen ihrer Väter), wenn nicht der bockige Schumann, so wenigstens Joseph (Giuseppe) Rastrelli, Hofkirchen-Komponist zu Dresden; er hat sich fest vorgenommen, mein Libretto zu vertonen.
Ich darf es in gebotener Kürze skizzieren. Das Vorspiel bloß erwähnend, lenke ich Ihren Blick in einen repräsentativen Raum eines Palazzos in Florenz, in der glanzvollen Ära der Renaissance. Gäste haben sich eingefunden, illustre Gäste, entsprechend opulent kostümiert. Auftritt des Hausherrn Francesco Giocondo: schwerreicher Perlen- und Diamantenhändler, Ehemann der Mona Lisa, der Gioconda. Von einigen Gästen wird der Wunsch geäußert (kleine Chornummer), besonders wertvolle Diamanten und Perlen zu sehen, es folgt eine erste Arie:Perla, perla … bello splendore delle perle … splendore opaco delle perle … segreto della perla … miracolo della perla … il mare nella perla … la morte nella perla …
La morte – hier stellt sich gleich ein assoziativ passendes, jedoch in eine ganz andere Himmelsrichtung weisendes Stichwort ein!
Wenn auch nicht chronologisch, so doch thematisch folgerichtig: Ich habe später auf St. Helena auch den toten Napoleon gesehen. Dies bei einer Zwischenlandung, und zwar auf der Rückkehr von Deshima. Da Ihnen, werte Herren der Schillerstiftung, Deshima möglicherweise kein Begriff ist, rasch eine Anmerkung: Eine vor Nagasaki aufgeschüttete Insel, weil die Stadt von Fremden nicht betreten werden darf; kahle Insel mit kleinen Holzhäusern; die Angestellten der Handelscompagnien werden von Japanern ständig kontrolliert, ja eigentlich bewacht; nur Japaner dürfen Waren vom Umschlagplatz aufs Festland transportieren; Dienst auf Deshima lässt sich kaum von Inhaftierung unterscheiden. Und der Heimweg acht bis neun Monate lang; dabei verlieren viele, von Scharbock, von Skorbut befallen, nicht nur ihre Zähne, auch ihr Leben. Auch dies als Stichwort für eine bewegende Erfahrung.
Der Leichnam Napoleons auf dem eisernen Feldbett, das ihn auf fast all seinen Feldzügen begleitet hatte. Auf dem Gestell ausgebreitet sein Militärmantel; darauf der Tote in voller Uniform – grün mit roten Aufschlägen, Orden auf der Brust, Degen an der Seite, Sporen an den Reitstiefeln; der Dreispitz mit schwarzer Schleife und einer Kokarde in den Farben der Trikolore am Kopfende abgelegt.
Ich war, als einer der früheren Besucher, still geduldet, mit Graf Bertrand, einem Priester und einem Diener längere Zeit allein im Raum der Aufbahrung. Bertrand, ganz in Schwarz, verharrte reglos zu Häupten des Toten; der Priester murmelte Gebete; der Diener, am Feldbett kniend, scheuchte Fliegen von der Leiche. Die Stille im Raum betont vom Huschen der Ratten unter dem Holzboden, vom Summen der Fliegen, vom Blattgeraschel des Passatwinds, der fast ständig über Bergsattel und Landhaus hinwegstrich. Der Graf verließ zwischendurch den Raum. Der Priester wurde in seinem Gemurmel immer leiser. Der Diener bat mich, ihn kurz mal abzulösen – das habe ich dankbar übernommen. Ich rückte vor in unmittelbare Nähe des Verstorbenen, betrachtete die sehr weißen, ausgekühlten Hände, vor allem die rechte: Wie viele Fürsten und Könige hatten den Handrücken geküsst, wie oft hatte diese Hand Truppen in Marsch gesetzt, richtungsweisend, wie oft hatte sie Zeichen gegeben für taktische Manöver in Schlachten, die zum Siege führten … Ich berührte die Hand erst zögerlich mit den Fingerspitzen, legte zuletzt die Handfläche auf seinen Handrücken. Verharrte so.
Die Stille nun erst recht als Totenstille. Weil sich so etwas auf Dauer kaum ertragen lässt, begann ich dem Leichnam zu berichten, was mir unter diesen Umständen passend schien: Ein anderer Mächtiger, der König von Candi, genoss auf Ceylon hohe, ja höchste Verehrung, dies auch im westlichen Küstenbereich, weil er eine besonders kostbare Reliquie hütete: einen Zahn von Gautama Buddha. Vier Zähne, so berichtete ich erst halblaut, dann wispernd, vier Zähne wurden aus der Asche des feuerbestatteten Buddha geborgen; zwei von ihnen gingen im weiteren Verlauf der Weltgeschichte verloren, einer wurde von Raja Singha übernommen. Portugiesen allerdings raubten diesen Zahn, als er noch in der Küstenstadt Kotte verehrt wurde; sie überbrachten den Raub dem Erzbischof von Goa, der ließ die heidnische Reliquie zertrampeln und anschließend verbrennen. Doch was da vernichtet worden war, soll nur eine Fälschung gewesen sein; die wahre Reliquie fand sichere Bleibe im Tempel des heiligen Zahns, den ein Vorgänger des Herrschers hatte errichten lassen. Einmal im Jahr wird, unter dem Patronat des gegenwärtig regierenden Raja Singha, von einem über und über mit Gold geschmückten Elefanten die kostbare Reliquie durch die Bergstadt getragen.
Und ich verstummte in der Überlegung, ob ich dem Leichnam nicht rasch einen vielleicht schon gelockerten Zahn ziehen und den als Reliquie mitnehmen sollte. Da hätte man mich endlich beneidet und bewundert.
Zeitweilig sah man in mir Hoffmanns Doppelgänger. Ich gestehe, ich habe in der Hinsicht zuweilen nachgeholfen: Setzte mir eine rote Kappe à la Hoffmann auf, stopfte mir eine überlange Pfeife à la Hoffmann, zündete sie an, schmauchte, paffte, hustete originalgetreu.
In ähnlicher Aufmachung und Ausstattung hatte ich meinen Auftritt im Berliner Weinlokal Schultheiß, in dem Hoffmann zuweilen einen Kreis um sich bildete – dies mit raschem Zulauf, sobald sich im Viertel herumsprach: Hoffmann ist da!
Den Zeitpunkt des Auftritts hatte ich genau bedacht, sprich: kalkuliert. Es war die Zeit, in der sich Hoffmann, nach schwerer Erkrankung, zur Kur in Warmbrunn aufhielt – was allein seiner Frau bekannt war, die aber sprach nur Polnisch. In diesem abgesicherten Zeitraum betrat ich das Lokal. Freilich wollte ich – infolge meiner Taubheit – nur als Hoffmann gesehen, nicht jedoch als Hoffmann angesprochen werden, und so griff ich auf ein bewährtes Mittel zurück, um Aufmerksamkeit zu wecken, Teilnehmer anzulocken: Ich begann zu zeichnen, und zwar karikierend, wie es Hoffmanns Art war. Währenddes trank ich zuweilen vom Champagner, der mir spendiert wurde, setzte sodann zu einem Monolog an in Hoffmanns Manier. Wenn er erst mal zu sprechen begonnen hatte, gab es kein Halten mehr, das Monologisieren konnte sich über Stunden hinziehn, vor allem, wenn er alkoholisch »montiert« war. Ich erzählte der wachsenden Runde im Weinlokal von mir als Hoffmann in Bamberg, von seinen Erfahrungen im dortigen Theater, nicht zu trennen von meinen Erfahrungen aus der Zeit, da ich Hoffmann beim Malen von Bühnenbildern aushalf, et cetera.
Dieses Theater war offiziell eine Aktiengesellschaft, faktisch jedoch eine Klitsche, was allein schon dokumentiert wurde durch die Besetzung des leitenden Gremiums, allen voran ein Zuckerbäcker und ein Seifensieder – mit solchen Figuren also sollte man auskommen, zurechtkommen, denen sollte man Verständnis beibringen etwa für die Inszenierung der Montezuma-Oper von Graun, sprich: für die notwendigen Ergänzungen des gewohnten Instrumentariums durch indianische Perkussionsinstrumente – schließlich geht es nicht nur um die sichtbare, auch um die hörbare Konfrontation zweier Welten, rief ich aus. Und fuhr in gleitendem Übergang fort: Wenn der Darsteller des Montezuma, den Zeremonial- oder Tanzhut aufgestülpt, zu rituellen Bewegungen ansetzt, so darf er nicht von gewohnten Holz- und Streichinstrumenten begleitet, sprich: stimuliert, sprich: angefeuert werden, es müssen importierte Trommeln geschlagen, muss eine originale Spaltflöte angesetzt werden – und das in Bamberg! Wenn Graun nicht in der Lage war, das so umzusetzen, müssen wir das eben nachholen! Man stelle sich vor, rief ich in die atemlos lauschende Runde, aufstehend, einige Tanzbewegungen andeutend, man stelle sich vor: Montezuma setzt an zum Tanz vor den Conquistadores, auf dem Haupt besagter Zeremonialhut mit den Federbändern verschiedener Vögel, wobei jedes Federband einen bestimmten Naturdämon verkörpere, oder eher: markiere, sprich: Schwanz- und Kragenfedern in Weiß von einem Hahn, in Schwarz von einem Hokko-Huhn, in Türkis von einem Tukan, in Rot und Grün von einem Ara, wiederum in Weiß von der Harpyie, einem besonders hässlichen, dennoch verehrten Großvogel, und von diesem Tanzhut herab ein langer Nackenbehang aus drei Federreihen, vor allem vom weißen Riesenstorch und dem Gelbbrust-Ara, und beim Tanz geraten die Federn in Schwingung wie Flügel eines abhebenden Vogels – so ein Tanz, rief ich, mich wieder setzend, so ein Tanz kann doch nur begleitet werden vom Rasseln einer Kalebasse, verziert mit kleinen Federbüscheln aus grünen Arafedern und braunhell gestreiften Harpyienfedern!
Ja, so ließ ich mich mitreißen von meiner Darstellung, sprach immer rascher, so wie Hoffmann immer rascher gesprochen hat, zuweilen derart rasch, dass Mithören kaum möglich war, vor allem wenn Hoffmann – frontal zahnlos – vor sich hin nuschelte, was bei mir, obwohl Doppelgänger, nicht der Fall war, schließlich war ich jünger als Hoffmann zu jener Zeit, ein Hoffmann, mit dem ich mich, obwohl er sich nach der Rückkehr aus Warmbrunn in guter Verfassung befunden haben dürfte, nicht konfrontieren wollte, denn: eine Begegnung mit mir als Doppelgänger-Erscheinung hätte Hoffmann einen tiefen, einen womöglich tödlichen Schreck einjagen können, noch bevor die beruhigende Erklärung hätte erfolgen können: Ich bins! Ja, Schonung war angebracht, eine unvermutete Begegnung mit einem Doppelgänger kann letztlich nur heißen, dass einer von beiden überzählig ist hier auf Erden. Wem ein Doppelgänger entgegentritt, der sieht sich gleichsam abgelöst durch eine verteufelt ähnliche Erscheinung.
Da ich mich hiermit an die Schillerstiftung wende, muss ich mich vorrangig als Schriftsteller ausweisen. Meine Publikationen sind allerdings weit verstreut, und der Roman ist vergriffen, fast verschollen, also darf ich, zum gerechten Ausgleich, kurze Einblicke gewähren in mein Werk. Ich mache es mir nicht so leicht, dass ich einfach nur aus dem Roman zitiere, ich biete Ihnen als Textproben an: klangvolle Sequenzen aus meinem jüngsten Libretto. Hier greife ich den Faden wieder auf.
Es erscheint, angemessen verspätet, ein besonderer Besucher: Giovanni de Salviatis, einige Jahre zuvor Mona Lisas Liebhaber … Kaum sind sie allein, la Gioconda und Giovanni, kriegt ihre schwelende Liebe wieder den rechten Zug, flackert, züngelt, flammt auf … Duett, das sich steigert, sie schrauben sich singend in die Höhe: Amore … il nostro amore … amore appassionato … che domina la testa, il cuore, il corpo … Der Hausherr, der soeben die letzten Gäste hinausbegleitet hat, kehrt zurück, dem Nebenbuhler bleibt nur Flucht in den Schrank: luftdicht verschließbar zur Erhaltung des Perlenschimmers – splendore opaca delle perle … Der Hausherr schreitet zum Schrank, lächelnd, seinerseits geheimnisvoll lächelnd, dabei singend, und er verschließt den Schrank, zieht den Schlüssel ab, wirft ihn, trotz vehementer Proteste der in Panik geratenen Gattin, zum Fenster hinaus in den Kanal. Und Giocondo zwingt seine Frau zur Hingabe, direkt am Schrank, zu Füßen des Schranks. Fammi sentire: chi è il padrone … fammi sentire: chi ha il potere … Der Nebenbuhler erstickt peu à peu, die von Mona Lisas Zwischenschreien stoßweise akzentuierte Arie wird zum Duett mit der gleichzeitig erstickenden Stimme im Schrank. L’oscuro … il respiro … l’oscuro … il respiro nell’oscuro … buio e sinistro … respiro diminuendo … silencio nell’oscuro … Und Francesco Giocondo singt seinen Triumph hinaus, im Lust- und Siegesrausch.
Ende des ersten Akts. Fortsetzung des Operngeschehens wenige Briefseiten später. Vielleicht kann Sie auch dies zur weiteren Lektüre des notwendigerweise umfangreichen Schreibens bewegen.
Um das von Ihnen sicherlich erwünschte, ja erwartete Bild meiner Persönlichkeit mit einem zusätzlichen Akzent zu versehen, beziehungsweise: um das Selbstporträt durch einen weiteren Pinselstrich zu ergänzen, muss ich eingestehn, dass auch bei mir (ähnlich wie bei Hoffmann) das Eheleben nicht ohne Turbulenzen verlief. Falls nach Schuld gefragt wird, wo Natur die Spielregeln diktiert, muss ich sagen: Ja, die Ursachen lagen bei mir, doch vollzog ich einen gewissen Lernprozess. Der freilich indirekt von Caroline eingeleitet wurde.