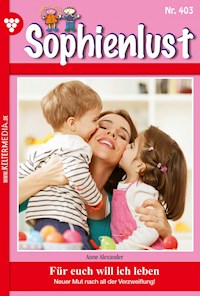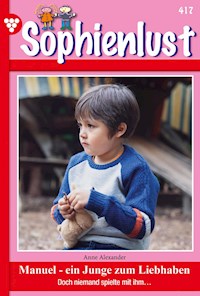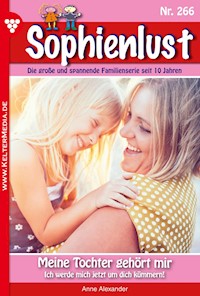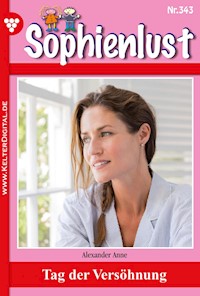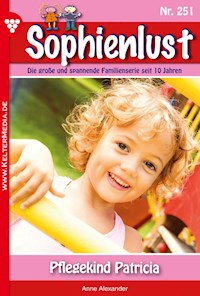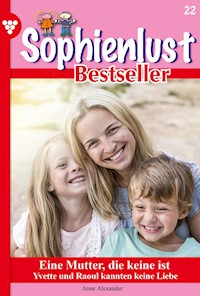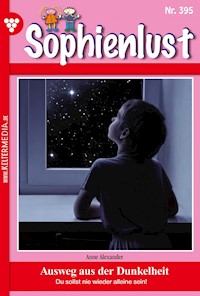Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sophienlust
- Sprache: Deutsch
Die Idee der sympathischen, lebensklugen Denise von Schoenecker sucht ihresgleichen. Sophienlust wurde gegründet, das Kinderheim der glücklichen Waisenkinder. Denise formt mit glücklicher Hand aus Sophienlust einen fast paradiesischen Ort der Idylle, aber immer wieder wird diese Heimat schenkende Einrichtung auf eine Zerreißprobe gestellt. Diese beliebte Romanserie der großartigen Schriftstellerin Patricia Vandenberg überzeugt durch ihr klares Konzept und seine beiden Identifikationsfiguren. »Also, ich begreife diese jungen Frauen von heute nicht«, sagte Gisela Neubrecht aufgebracht zu ihrer Nachbarin. »Sie setzen ein Kind nach dem anderen in die Welt und schieben es dann ins Kinderheim ab.« »Ganz so schlimm, wie Sie es sehen, liebe Frau Neubrecht, ist es doch nicht«, meinte Helga Schwaderer. »Erstens setzen die jungen Frauen von heute nicht ein Kind nach dem anderen in die Welt – eine Familie mit mehr als drei Kindern hat schon Seltenheitswert –, und zweitens blieb Frau Küster gar nichts anderes übrig, als Kerstin in ein Heim zu geben. Leicht hat sie sich das aber nicht gemacht, und soviel ich gehört habe, ist dieses Sophienlust ein ganz erstklassiges Kinderheim.« »Nein, nein, Frau Schwaderer!« wehrte Gisela Neubrecht entschieden ab. »Kein Kinderheim, mag es auch noch so gut sein, kann das Elternhaus oder die Mutter ersetzen.« Sie ergriff die Kaffeekanne, die vor den beiden auf dem Tisch stand. »Noch etwas Kaffee?« fragte sie freundlich. »Gern!« Helga Schwaderer hob ihre Kaffeetasse. Sie und Frau Neubrecht waren seit Jahren Nachbarinnen. Zweimal in der Woche trafen sie sich nachmittags zum Kaffeetrinken und Plaudern. Obwohl Gisela Neubrecht mit ihren über siebzig Jahren bedeutend älter war als sie selbst, unterhielt sie sich sehr gern mit ihr. »Danke«, sagte sie und setzte ihre Tasse auf den Tisch zurück.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 147
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sophienlust – 275 –Daniels unsichtbarer Freund
Ein kleiner Junge muss schon viel ertragen
Anne Alexander
»Also, ich begreife diese jungen Frauen von heute nicht«, sagte Gisela Neubrecht aufgebracht zu ihrer Nachbarin. »Sie setzen ein Kind nach dem anderen in die Welt und schieben es dann ins Kinderheim ab.«
»Ganz so schlimm, wie Sie es sehen, liebe Frau Neubrecht, ist es doch nicht«, meinte Helga Schwaderer. »Erstens setzen die jungen Frauen von heute nicht ein Kind nach dem anderen in die Welt – eine Familie mit mehr als drei Kindern hat schon Seltenheitswert –, und zweitens blieb Frau Küster gar nichts anderes übrig, als Kerstin in ein Heim zu geben. Leicht hat sie sich das aber nicht gemacht, und soviel ich gehört habe, ist dieses Sophienlust ein ganz erstklassiges Kinderheim.«
»Nein, nein, Frau Schwaderer!« wehrte Gisela Neubrecht entschieden ab. »Kein Kinderheim, mag es auch noch so gut sein, kann das Elternhaus oder die Mutter ersetzen.« Sie ergriff die Kaffeekanne, die vor den beiden auf dem Tisch stand. »Noch etwas Kaffee?« fragte sie freundlich.
»Gern!« Helga Schwaderer hob ihre Kaffeetasse. Sie und Frau Neubrecht waren seit Jahren Nachbarinnen. Zweimal in der Woche trafen sie sich nachmittags zum Kaffeetrinken und Plaudern. Obwohl Gisela Neubrecht mit ihren über siebzig Jahren bedeutend älter war als sie selbst, unterhielt sie sich sehr gern mit ihr. »Danke«, sagte sie und setzte ihre Tasse auf den Tisch zurück.
»Noch etwas Kuchen?« Gisela Neubrecht hielt ihrer Nachbarin den Teller mit dem selbstgebackenen Kuchen entgegen.
»Jedesmal, wenn ich bei Ihnen Kaffee trinke, bin ich am nächsten Tag ein Pfündchen schwerer.« Helga Schwaderer lachte und griff zu. »Aber um auf Frau Küster zurückzukommen. Es blieb ihr ja nichts anderes übrig, als ihre Tochter in ein Kinderheim zu geben. Ihr Mann ist vor zwei Jahren gestorben, Verwandte hat sie nicht. Wer hätte denn die kleine Kerstin betreuen sollen, während sie in Paris ist?«
»Sie hätte ihrem Chef klipp und klar sagen können, daß er eine andere nach Paris schicken soll«, meinte Frau Neubrecht. »Er wäre verpflichtet gewesen, auf ihr Kind Rücksicht zu nehmen. Und wenn er sich geweigert hätte, dann wäre es an ihr gewesen, sich eine andere Arbeit zu suchen.«
Helga Schwaderer unterdrückte ein Lächeln. Sie fand, Frau Neubrecht machte es sich etwas einfach. Als ob es so leicht wäre, schnell eine neue Stelle zu bekommen! Sie selbst konnte Frau Küster sehr gut verstehen. Und mit ihren sieben Jahren war Kerstin auch schon vernünftig genug, um einzusehen, daß sie einige Zeit ohne ihre Mutter auskommen mußte.
»Frau Küster hat mir Fotos von Sophienlust gezeigt«, erzählte Helga Schwaderer. »Das Heim liegt in der Nähe von Wildmoos, eingebettet in grüne Hügel und Wälder. Früher war es ein ehemaliger Herrensitz, dann wurde es nach dem Willen einer Frau von Wellentin in ein Kinderheim umgewandelt. Zum Heim gehört ein Park mit Baumschule, Spielplatz, Springbrunnen. Es ist alles vorhanden, was ein Kinderherz begehrt. Sogar reiten dürfen die Kinder.«
»Trotzdem!« Gisela Neubrecht schüttelte mißbilligend den Kopf. So schnell ließ sie sich nicht überzeugen. »Wie kann Frau Küster auch nur eine Minute ruhig sein, wenn ihre Tochter völlig allein in einem Kinderheim ist? Wenn ich mir vorstelle, daß meine Enkelkinder in einem Kinderheim leben müßten!« Unwillkürlich schaute sie zu dem gerahmten Foto hin, das ihr gegenüber auf dem Fenstersims stand. Ein weicher Zug erschien um ihren Mund. »Ich glaube, ich würde wahnsinnig werden vor Angst um sie.«
Helga Schwaderer folgte dem Blick der älteren Frau. Sie kannte Cornelia und Daniel Tanner seit ihrer Geburt. »Wie geht es Ihrer Tochter und den Kindern?« fragte sie.
»Ach, das habe ich Ihnen überhaupt noch nicht erzählt!« Über Gisela Neubrechts Gesicht ging ein Leuchten. »Stefanie hat mich heute morgen angerufen. Sie hat eine Woche früher Urlaub bekommen. Sie wird mit den Kindern bereits am Freitag hier sein.«
»Wie wunderbar!«
»Ja, es ist einfach herrlich!« Gisela Neubrecht glättete eine Falte des Tischtuchs. »Seit Stefanie mit den Zwillingen in Garmisch lebt, sehen wir uns leider nicht mehr so oft wie früher. Ich kann ja verstehen, daß sie nach Garmisch gezogen ist. Sie hat dort eine sehr gute Stelle als Hotelsekretärin. Und vor allem, im Wiesenhof steigen meist Familien mit Kindern ab. Deshalb hat ihr Chef auch nichts dagegen, daß die Zwillinge den ganzen Tag im Hotel herumspringen.«
»Leicht hat es Ihre Tochter bestimmt nicht, so allein mit den Kindern.« Helga Schwaderer mußte wieder an Margot Küster denken. Frau Küster war Witwe. Stefanie Tanner lebte dagegen von ihrem Mann getrennt.
»Nein, bestimmt nicht.« Gisela Neubrecht seufzte auf. »Aber ich hatte Stefanie damals gewarnt, diesen Rolf Tanner zu heiraten. Tagelang habe ich auf sie eingeredet, aber sie wollte nicht hören. Leider ist es dann genauso gekommen, wie ich es Stefanie prophezeit hatte.« Sie seufzte wieder. »Ich wünschte, ich hätte nicht recht behalten. Bei der erstbesten Gelegenheit ist Rolf auf und davon.«
»Warum läßt sich Ihre Tochter eigentlich nicht scheiden?« fragte Helga Schwaderer. »Wäre dann nicht alles viel einfacher für sie?«
»Stefanie hat nun einmal ihren eigenen Kopf. Sie nimmt ja nicht einmal Unterhalt von ihrem Mann an. Ich kann nicht behaupten, daß Rolf nicht für sie und die Kinder sorgen wollte, so gerecht muß ich schon sein. Während der ersten Monate hat er regelmäßig aus England Geld überwiesen, aber Stefanie hat es jedesmal prompt zurückgeschickt. Sie will ihm beweisen, daß sie auch allein zurechtkommen kann.«
»Aber warum?«
»Irgendwann muß Rolf ihr einmal vorgeworfen haben, daß sie nicht einmal in der Lage wäre, ohne meine Hilfe einen Schnürsenkel zuzubinden.« Offene Empörung sprach aus Gisela Neubrechts Worten. »Er war oft so beleidigend und hat nie einsehen wollen, daß ich Stefanie am Anfang ihrer Ehe beistehen mußte. Man kann doch so ein junges Ding nicht ohne jede Unterstützung in die Welt hinauslassen.«
Man kann auch zuviel des Guten tun, dachte Helga Schwaderer, aber sie sprach diesen Gedanken nicht aus. Sie mochte Frau Neubrecht, und sie wollte es sich nicht mit ihr verderben. Aber sie war überzeugt, daß Gisela Neubrecht nicht ganz unschuldig an der gescheiterten Ehe ihrer Tochter war.
*
»Kinderheim Sophienlust, von Schoenecker am Apparat!« meldete sich Denise von Schoenecker. Frau Rennert, die Heimleiterin, war vor einigen Minuten zur Küche gegangen, um etwas mit der Köchin zu besprechen. So hatte Denise den Hörer abgenommen.
Im Hörer erklang ein fernes Rauschen, dann ertönte ein kurzes Pfeifen, das von einem Knacken abgelöst wurde. Die Verbindung war unterbrochen.
»Es sollte nicht sein«, meinte Denise zu sich selbst und legte den Hörer auf. Sie widmete sich wieder den Karteikarten, die vor ihr auf dem Schreibtisch lagen. Am nächsten Tag wollte Frau Dr. Frey nach Sophienlust kommen, um einige Kinder zu impfen. Wieder klingelte das Telefon. Denise griff, ohne den Blick von den Karten zu heben, nach dem Hörer. »Kinderheim Sophienlust!«
»Küster!« meldete sich eine jugendlich klingende Stimme. »Ich hatte eben schon einmal angerufen, aber wir sind unterbrochen worden. Frau von Schoenecker?«
»Ja, am Apparat, Frau Küster! Guten Tag… Wie geht es Ihnen? Haben Sie sich schon etwas in Paris eingelebt?«
»Wie man’s nimmt, Frau von Schoenecker«, erwiderte Margot Küster.
»Mir fehlt vor allem Kerstin, aber das war ja zu erwarten. Wie macht sie sich? Fragt sie oft nach mir?«
»Kerstin ist ein ausgesprochen liebes Mädchen«, versicherte Denise. »Nach Ihnen gefragt hat sie zwar noch nicht«, sagte sie wahrheitsgemäß, »aber ich weiß von Pünktchen, daß sie jeden Abend betet: ›Und behüte auch meine liebe Mama in Paris‹!«
»Ich habe schreckliche Sehnsucht nach ihr«, meinte Margot Küster, den Tränen nahe. »Kann ich sie sprechen?«
»Einen Moment, bitte! Vorhin spielte sie mit den anderen vor dem Haus blinde Kuh.« Denise sprang auf und lief in die Halle. Wenig später stieg sie die Freitreppe hinab.
Die Kinder spielten noch immer vor dem Haus. Die kleine Heidi Holsten schlug lachend ihre Hände zusammen und rief ein ums andere Mal: »Kerstin ist die blinde Kuh! Kerstin ist die blinde Kuh!« Ihre blonden Rattenschwänzchen hüpften lustig auf und ab.
»Warte, dich krieg ich schon!« Kerstin versuchte mit verbundenen Augen nach Heidi zu greifen.
»Kerstin, deine Mama ist am Telefon!«
Mit einem Ruck riß das kleine Mädchen die Binde von den Augen. »Wo, Tante Isi?« rief sie aufgeregt.
»Im Empfangszimmer.«
Wie der Blitz war Kerstin an Denise vorbeigelaufen. Sie polterte die Freitreppe empor und stürzte in die Halle.
»Wir haben gerade so schön gespielt, Tante Isi«, beschwerte sich Heidi. »So schön!« Schmollend blickte sie zu Denise empor.
»Aber Kerstin mußte ganz schnell zum Telefon laufen«, erklärte Denise von Schoenecker. »Ihre Mutti ist in Paris. Es kostet sehr viel Geld, von dort anzurufen.«
»Wo ist Paris?« erkundigte sich Heidi neugierig.
»In Frankreich«, sagte Vicky Langenbach. »Paris ist eine große Stadt. Ein langer Fluß geht mittendurch. Er heißt…« Vicky nagte an ihrer Unterlippe. »Er heißt Seine! Und auf dem Fluß sind Inseln. Auf einer steht die Notre Dame, eine riesige Kirche.« Triumphierend blickte sie um sich. »Das habe ich alles gestern in Angelikas Erdkundebuch gelesen.«
»Und du hast es dir fein gemerkt«, lobte Denise. Sie plauderte noch ein Weilchen mit den Kindern, um Kerstin Gelegenheit zu geben, ungestört mit ihrer Mutter zu sprechen. Sie wußte, daß auch Kinder eine gewisse Privatsphäre brauchen.
*
»Sag, warum sollte ich heute abend zu dir kommen, Monika?« fragte Dagmar Dihlmann, eine hübsche junge Frau von fünfundzwanzig Jahren, ihre Freundin. Sie hatte halblange, goldblonde Haare, blaue Augen und ein reizendes Grübchen am Kinn. Als Stieftochter des reichen Fabrikanten Werner Springer stand ihr quasi die Welt offen, aber sie zog es vor, ein relativ bescheidenes Leben zu führen und für ihren Lebensunterhalt bei ihrem Stiefvater als Sekretärin zu arbeiten.
Monika Becker atmete tief ein. »Ich wußte nicht, wie ich es dir am Telefon sagen sollte«, begann sie unsicher.
»Um was handelt es sich denn, Moni?« fragte Dagmar. »Es ist etwas Unangenehmes. Das ist mir klar, sonst würdest du nicht so drumherumreden.«
»Du weißt ja, daß ich eine Freundin in Garmisch habe. Das heißt, Freundin ist etwas zuviel gesagt. Wir haben uns im letzten Jahr kennengelernt. Ihr Mann arbeitet in England. Sie ist in einem Garmischer Hotel als Sekretärin angestellt, hat zwei…«
»Monika!«
Monika starrte auf ihre Hände. »Dein Verlobter ist ja ein ziemlich bekannter Mann«, begann sie erneut. »Man braucht nur irgendeine Illustrierte aufzuschlagen, dann sieht man sein Konterfei. Stefanie Tanner rief mich heute morgen an, um mir zu sagen, daß sie am Freitag wieder mit den Kindern in München sein wird. Wir sprachen ein bißchen über den Hotelbetrieb im allgemeinen und dann über Garmisch. Ich fragte sie, ob zur Zeit berühmte Leute in der Stadt seien. Und da sagte sie mir, unter anderem wäre Karl Janke dort. Er ist im Monopol abgestiegen und soll seit einer Woche jeden Abend im Spielkasino sein.«
»Damit sagst du mir nichts Neues«, warf Dagmar ein. Sie drehte gedankenverloren an ihrem mit kleinen Diamanten besetzten Verlobungsring. »Karl ist letzten Sonntag nach Garmisch gefahren. Er wollte, daß ich ihn begleite, aber schließlich kann ich nicht fünf-, sechsmal im Jahr Urlaub machen. Wir haben uns deshalb ziemlich gestritten. Ich wünschte, er würde sich etwas mehr um seinen Betrieb kümmern, anstatt ständig unterwegs zu sein.«
»Dein Verlobter ist nicht allein im Monopol abgestiegen«, sagte Monika langsam. »Veronika Zerbst ist bei ihm.«
»Veronika Zerbst«, wiederholte Dagmar tonlos. Ihr Gesicht verschloß sich. »Und ich dachte, die Sache mit ihr wäre ausgestanden! Du weißt ja, daß sie vor unserer Verlobung zu seinen ständigen Freundinnen zählte.« Sie zuckte resignierend mit den Schultern. »Vor unserer Verlobung hat Karl mir hoch und heilig versprochen, daß es in Zukunft keine andere Frau mehr für ihn geben wird. Aber das war nicht sein einziges Versprechen. Die Sterne wollte er für mich vom Himmel holen! Viel ist von seinen guten Vorsätzen nicht übriggeblieben.« Nachdenklich strich sie über die Sessellehne.
»Hast du wirklich an seine guten Vorsätze geglaubt?« fragte Monika Becker zweifelnd.
»Was glaubt man nicht alles, wenn man es glauben will!« Dagmar Dihlmann lachte rauh auf. »Du weißt ja, die ersten Wochen nach unserer Verlobung hat Karl mich regelrecht auf Händen getragen. Und nicht nur das. Er erschien sogar fünfmal in der Woche jeden Morgen um neun Uhr in seinem Betrieb. Mein Stiefvater meinte noch, ihm hätte nur ein fester Halt gefehlt.«
»Soll ich eine Tasse Kaffee für uns aufbrühen?«
»Sei nicht böse, aber mir steht jetzt nicht der Sinn nach Kaffee.« Dagmar Dihlmann sah wieder ihren Verlobungsring an. Sechs Monate war sie jetzt mit Karl Janke verlobt. Sechs Monate, in denen fast jeder Tag eine neue Enttäuschung gebracht hatte.
Monika, die bereits aufgestanden war, setzte sich wieder. »Wir sind doch Freundinnen, Dagmar, aber ich weiß immer noch nicht, warum du dich mit Karl Janke verlobt hast. Sage jetzt nur nicht, daß er der Mann deines Lebens ist. Ich kenne dich gut genug, um zu wissen, daß er niemals deine große Liebe sein kann. Ehrlich, du hast mich damals mit deiner Verlobung regelrecht vor den Kopf gestoßen. Du und Karl Janke!« Sie schüttelte sich.
»Du hast nie ein Wort darüber verloren.« Dagmar hob ihren Blick.
»Es ist dein Leben, nicht meines«, entgegnete Monika. »Ich wollte mich nicht einmischen. Ich hätte dir das mit Veronika Zerbst auch nicht gesagt, wenn ich es nicht für meine Pflicht gehalten hätte.«
»Ich bin froh, daß du es mir gesagt hast, Moni«, erwiderte Dagmar. Sie stand auf und ging langsam durch das geschmackvoll eingerichtete Wohnzimmer ihrer Freundin.
»Vielleicht möchtest du einen Cognac?« fragte Monika besorgt. Sie machte sich Gedanken um die Freundin. Auch wenn offensichtlich war, daß Dagmar ihren Verlobten nicht liebte, schien sie doch tief getroffen zu sein.
»Nein, keinen Cognac!« Dagmar drehte sich wieder um, setzte sich auf eine Sessellehne. »Du hast mich gefragt, warum ich Karls Heiratsantrag angenommen habe«, fuhr sie fort, ohne ihre Freundin anzusehen. »Betrachte es als geschäftliche Transaktion.«
»Als geschäftliche Transaktion?« fragte Monika entsetzt. Sie starrte Dagmar ungläubig an. »Das glaube ich dir nicht, Dagmar. Von jeder anderen würde ich es glauben, aber nicht von dir.«
»Und doch war es nicht viel mehr«, sagte Dagmar ehrlich. Sie rutschte von der Sessellehne auf den Sitz und schlug ihre Beine übereinander. »Wie du weißt, kenne ich Karl seit etwa elf Jahren. Ich muß vierzehn gewesen sein und er siebzehn, als ich ihm durch meinen Stiefvater vorgestellt wurde. Er sah blendend aus, schien alles zu wissen. Kurz und gut, er imponierte mir, und ich fing an, für ihn zu schwärmen. Erst als ich etwa achtzehn, neunzehn war, erkannte ich, daß Karl das ist, was man landläufig einen Playboy nennt. Dann starb sein Vater, aber Karl änderte sich nicht. Er führte weiterhin das Leben eines Playboys und überließ die Leitung der Firma seinem Geschäftsführer und meinem Vater.«
»Deinem Vater?«
Dagmar nickte. »Gustav Janke, Karls Vater, hatte meinem Stiefvater vor Jahren aus einer ziemlichen Klemme geholfen. Aus Dankbarkeit versprach mein Stiefvater ihm, kurz bevor Gustav Janke starb, Karl beizustehen. Gustav Janke hatte sich immer Sorgen gemacht, weil sein Sohn sich nicht für die Firma interessiert hatte. Vielleicht hatte mein Stiefvater schon damals den Gedanken einer Fusion beider Firmen. Jedenfalls ist geplant, die Firmen nach unserer Hochzeit unter einem Namen zu vereinen.«
»Steckt eure Firma in Schwierigkeiten?« fragte Monika unverblümt. »Ich meine, weil dein Stiefvater an eine Fusion denkt.«
»Nein, keineswegs«, erwiderte Dagmar, »aber durch eine Fusion könnten beide Firmen nur gewinnen. Im Grunde sind sie ja eigentlich Konkurrenten. Beide arbeiten auf dem Bekleidungssektor.«
»Und du hast dich so einfach darauf eingelassen?« fragte Monika ungläubig.
»Ich sagte dir ja, daß ich während meiner Teenagerzeit für Karl geschwärmt habe«, antwortete Dagmar. »Und im Grunde habe ich noch immer etwas für ihn übrig. Trotz seiner Eskapaden finde ich ihn sympathisch. Natürlich überlegte ich es mir lange, bevor ich seinen Heiratsantrag annahm. Ich fand, daß Sympathie nicht ausreicht, um ein ganzes Leben miteinander zu verbringen, aber mein Stiefvater und meine Mutter standen voll hinter Karls Antrag. Meine Mutter gestand mir, daß es bei ihr und meinem richtigen Vater auch nicht Liebe auf den ersten Blick gewesen sei, daß sie aber dennoch eine gute Ehe geführt hätten. Ich weiß noch, wie verzweifelt sie war, als mein Vater starb. Sie hat ja auch erst fünf Jahre später wieder geheiratet. Und Karl versprach mir das Blaue vom Himmel herunter. Schließlich fiel es mir nicht schwer, ja zu sagen.«
»Und was wirst du jetzt tun?«
»Ich weiß es noch nicht«, erwiderte Dagmar und erhob sich. »Auf jeden Fall fahre ich noch heute abend nach Garmisch. Ich muß es mit eigenen Augen sehen.« Sie legte ihre Hand auf den Arm der Freundin. »Ich bin froh, daß du es mir gesagt hast, Moni!«
*
Erleichtert bedeckte Stefanie Tanner ihre Schreibmaschine mit der grauen Schutzhülle und räumte ihren Schreibtisch auf. Es war wieder einmal ein sehr langer, arbeitsreicher Tag gewesen.
Ein letztes Mal schaute Stefanie sich in ihrem kleinen Büro um. Vierzehn Tage würde sie jetzt Ruhe haben. Morgen vormittag kam ihre Vertretung, und gleich darauf wollte sie mit den Zwillingen in den Bus nach München einsteigen, der jeden Tag pünktlich um elf Uhr vor dem Hotel hielt.
Im Hinausgehen warf Stefanie einen Blick auf ihre Armbanduhr. Bereits halb acht! Höchste Zeit für die Kinder, daß sie ihr Abendessen bekamen. So spät wurde es selten. Hoffentlich spielten sie nicht noch draußen auf dem Hof.
Müde stieg Stefanie die Personaltreppe zum Dachgeschoß des Hotels empor. Sie bewohnte dort ein geräumiges Appartement mit einem großen und einem kleinen Zimmer.
»Ich geh jetzt die Mama holen!« schallte ihr im Gang vor dem Appartement die Stimme ihres fünfeinhalbjährigen Sohnes entgegen.
»Das darfst du nicht«, erwiderte seine Zwillingsschwester. »Die Mama wird ganz böse werden, wenn du das tust. Wir dürfen sie nicht stören.«
»Sie wird nicht böse!«
»Wird sie doch!«
Leise klinkte Stefanie die Tür auf. Cornelia und Daniel hockten auf dem weichen Teppich und spielten mit Legosteinen. Es war ein rührendes Bild, als sich die beiden über die Puppenstube beugten, die sie gebaut hatten.