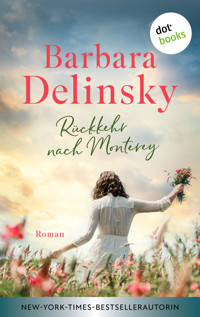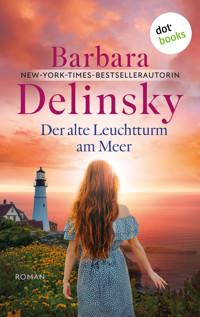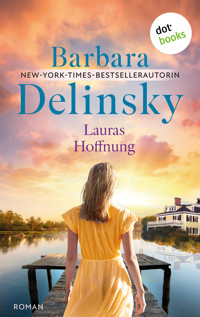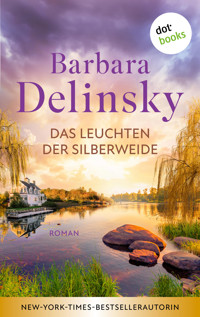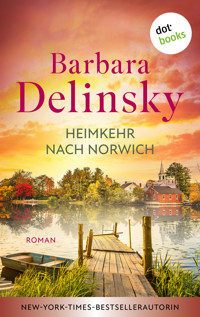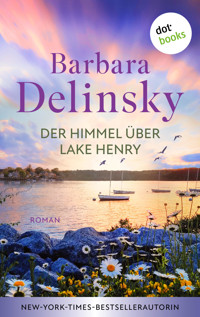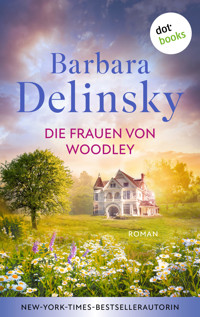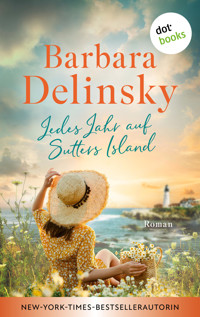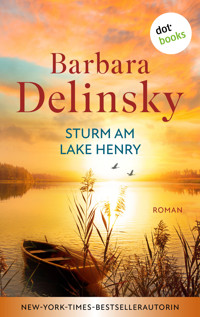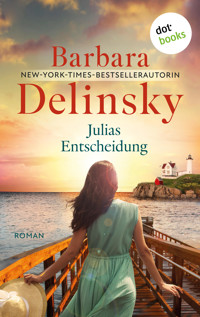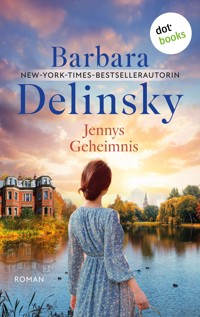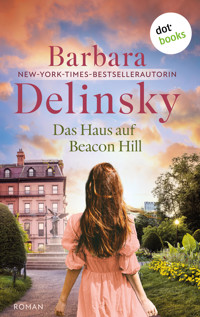
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei Freundinnen, die für Gerechtigkeit kämpfen: Der mitreißende Schicksalsroman »Das Haus auf Beacon Hill« von Barbara Delinsky als eBook bei dotbooks. Viele Jahre sind vergangen, seitdem Pamela St. George das letzte Mal die Familienvilla betreten hat: Das Zuhause, in dem sie unter ihrem kaltherzigen Vater und ihrem tyrannischen Bruder John fast zerbrochen wäre. Doch nun ist Pam fest entschlossen, endlich zu der Frau zu werden, die sie immer sein wollte. An der Spitze des Edelsteinunternehmens ihrer Familie und an der Seite ihrer alten Kindheitsfreundin Hillary will sie John voller Mut entgegentreten. Doch Pam ahnt nicht, wie tief die Intrigen sind, die ihr Bruder bereits vor Jahrzenten gewoben hat: Kann sie Hillary wirklich noch trauen? Und darf sie sich auf ein Bündnis mit Cutter Reid einlassen, dem Mann, der wegen seiner Liebe zu ihr einst alles verloren hat? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der fesselnde Familiengeheimnisroman »Das Haus auf Beacon Hill« von New-York-Times-Bestsellerautorin Barbara Delinsky wird alle Fans von Nora Roberts und Susan Wiggs begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 734
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über dieses Buch:
Viele Jahre sind vergangen, seitdem Pamela St. George das letzte Mal die Familienvilla betreten hat: Das Zuhause, in dem sie unter ihrem kaltherzigen Vater und ihrem tyrannischen Bruder John fast zerbrochen wäre. Doch nun ist Pam fest entschlossen, endlich zu der Frau zu werden, die sie immer sein wollte. An der Spitze des Edelsteinunternehmens ihrer Familie und an der Seite ihrer alten Kindheitsfreundin Hillary will sie John voller Mut entgegentreten. Doch Pam ahnt nicht, wie tief die Intrigen sind, die ihr Bruder bereits vor Jahrzenten gewoben hat: Kann sie Hillary wirklich noch trauen? Und darf sie sich auf ein Bündnis mit Cutter Reid einlassen, dem Mann, der wegen seiner Liebe zu ihr einst alles verloren hat?
Über die Autorin:
Barbara Delinsky wurde 1945 in Boston geboren und studierte dort Psychologie und Soziologie. Nach der Geburt ihres ersten Sohnes arbeitete sie als Fotografin für den Belmont Herald, erkannte aber bald, dass sie viel lieber die Texte zu ihren Fotos schrieb. Ihr Debütroman wurde auf Anhieb zu einem großen Erfolg. Inzwischen hat Barbara Delinsky über 70 Romane veröffentlicht, die in mehr als 20 Sprachen übersetzt wurden und regelmäßig die New-York-Times-Bestsellerliste stürmen. Sie engagiert sich außerdem sehr stark für Wohltätigkeitsvereine und Aufklärung rund um das Thema Brustkrebs. Barbara Delinsky lebt mit ihrem Mann in New England und hat drei erwachsene Söhne.
Die Website der Autorin: barbaradelinsky.com/
Bei dotbooks veröffentlichte Barbara Delinsky auch ihre Romane:
»Die Schwestern von Star’s End«
»Jennys Geheimnis«
»Das Weingut am Meer«
»Julias Entscheidung«
»Lauras Hoffnung«
»Die alte Mühle am Fluss«
»Der alte Leuchtturm am Meer«
»Sturm am Lake Henry«, Die Blake-Schwestern 1
»Der Himmel über Lake Henry«, Die Blake-Schwestern 2
»Heimkehr nach Norwich«
»Das Leuchten der Silberweide«
»Das Licht auf den Wellen«
»Die Frauen Woodley«
»Ein Neuanfang in Casco Bay«
»Im Schatten meiner Schwester«
»Rückkehr nach Monterey«
»Drei Wünsche hast du frei«
»Ein ganzes Leben zwischen uns«
»Jedes Jahr auf Sutters Island«
»Was wir nie vergessen können«
***
eBook-Neuausgabe August 2023
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1990 unter dem Originaltitel »Facets« bei Warner Books Inc., New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1995 unter dem Titel »Facetten der Liebe« bei Droemer Knaur.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1990 Barbara Delinsky.
Published by Arrangement with Barbara Delinsky
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1995 Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München.
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ys)
ISBN 978-3-98690-626-9
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Das Haus auf Beacon Hill« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Barbara Delinsky
Das Haus auf Beacon Hill
Roman
Aus dem Amerikanischen von Georgia Sommerfeld
dotbooks.
ERSTES KAPITEL
New York, März 1990
Von all den Dingen, die er ihr in der Vergangenheit angetan hatte, von all den Dingen, die er nicht getan hatte oder die er hätte tun können oder sollen, war dieser Verrat jetzt das grausamste. Hillary Cox starrte noch lange auf den Bildschirm, nachdem sie sein Gesicht durch Knopfdruck hatte verschwinden lassen. Ihr Kopf war fast ebenso leer, leergefegt von Unglauben, Schock und Schmerz.
Die langen, kastanienbraunen Haare nach hinten streichend, drehte sie den Kopf und schaute auf den Teppich hinunter, doch der hohe, karmesinrote Flor hatte keine Antworten für sie.
Verlobt? John war verlobt?
Sie schluckte trocken. Die Fernbedienung rutschte von ihren Schenkeln und fiel auf den Boden, und sie stand auf und lief geistesabwesend durch das Arbeitszimmer. Der Raum war nicht groß. Die ganze Wohnung war nicht groß, aber sie war das beste, was sie sich auf Manhattans Upper Eastside leisten konnte, wo sie leben, wo sie mit John zusammensein wollte. Sie hatte sie gleichermaßen gemietet, um ihren Stolz zu befriedigen und um Johns Ansprüchen Genüge zu tun: Er war ein Mann von Bedeutung, und eine schäbige Umgebung wäre unter seiner Würde gewesen. Wenn er ihr Geld gegeben hätte, hätte sie vielleicht eine größere Wohnung gehabt, aber dann hätte sie sich noch mehr wie eine Hure gefühlt.
Sie blieb stehen. Nein – sie hatte sich nicht verkauft. Ihre Gefühle für John waren stets tief gewesen, und ob sie ihn nun liebte oder hasste, respektierte oder verachtete – sie war ihm viele Jahre treu gewesen. Sie war keine Hure. Eine Närrin vielleicht – aber keine Hure.
Sie ging von einer Lehne eines chintzbezogenen Sessels zur nächsten und trat dann an den schlichten Kirschholztisch, der ihr als Schreibtisch diente. Ihre Finger glitten über die Papiere und Illustrierten, die scheinbar willkürlich darauf verstreut lagen. Sie wußte genau, wo was lag. John hatte das nie verstehen können. Seiner Meinung nach war Organisation ein Muß und Ordnung ihre Vorbedingung.
Am Bücherregal hielt sie inne, um den CD-Player zu berühren, den er ihr letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt hatte, dann die Steuben-Eule von ein paar Weihnachten davor, dann das gerahmte Foto, das sie wiederum einige Weihnachten davor von ihm gemacht hatte. Er war ein gutaussehender Teufel, dunkeläugig und dunkelhaarig, mit Zügen, die aristokratisch genug waren, um den gelegentlich primitiven Ausdruck nicht deutlich erkennen zu lassen. Sie hatte ihn im Laufe der Jahre erwachsen werden sehen, hatte gesehen, wie seine Schultern breiter wurden und sein Siebzehn-Uhr-Bartschatten dunkler, silberne Fäden seine Koteletten durchzogen. Siebenundzwanzig Jahre waren eine lange Zeit für die Beziehung zu einem Mann, aber bis heute hatte sie nicht nachgezählt – sie hatte als selbstverständlich angenommen, daß sie noch viele Jahre miteinander haben würden.
Eine kalte Hand drückte ihr Herz zusammen.
Er konnte nicht verlobt sein, sagte sie sich – John war nicht für die Ehe geschaffen. Er hatte die Fünfzig erreicht, ohne das Eheversprechen abzulegen, hatte ohne die Unterstützung einer Ehefrau außergewöhnlichen Erfolg gehabt – es gab keinen denkbaren Grund dafür, daß er sich jetzt eine nehmen sollte.
Und John tat niemals etwas ohne Grund.
Hatte er sich verliebt? Nein – nicht John.
Aber er hatte gesagt, er sei verlobt. In einer landesweit ausgestrahlten Sendung hatte er gesagt, er sei verlobt.
Ihr Magen zog sich nervös zusammen. Sie wandte sich von dem hoheitsvollen Gesicht auf der Fotografie ab und setzte ihre Wanderung durch ihre Wohnung fort. Sekunden später kam sie zur Schlafzimmertür, lehnte sich schwer an den Rahmen und starrte auf das Bett. Es war mit einer makellos glatten Satindecke bedeckt – im Gegensatz zum letzten Wochenende. Da hätte es keinen Sinn gehabt, das Bett zu machen: Sie und John hatten es nicht für lange verlassen.
Die Erinnerung beschleunigte ihren Atem. John war ein unbeschreiblicher Liebhaber, fordernd, aber auch belohnend, und wenn er manchmal etwas grob wurde, so mochte sie dies auch. Es gestattete einen Blick hinter die Maske der Wohlerzogenheit, die er in der Öffentlichkeit zur Schau trug. Sie war stolz darauf, diese Brutalität in ihm auszulösen. Es war ein Zeichen von Macht, der Beweis, daß sie Dinge für John tat, die keine andere Frau vermochte.
Am Sonntag war er nach Boston zurückgekehrt, der Basis von »Facets«. Sie hatte seitdem nichts von ihm gehört, aber das war eben seine Art. Sie hatte sich im Laufe der Jahre damit abgefunden, indem sie das Beste aus einer Situation machte, die sie nicht ändern konnte. John tat, was er wollte. Er nahm auf niemanden Rücksicht.
Verlobt? Es war nicht möglich.
Oder doch?
Die wachsende Erregung ließ sie schneller gehen. Sie hätte keinen Gedanken daran verschwendet, wenn sie im National Enquirer eine Meldung über seine Verlobung gelesen hätte: Das Revolverblatt hatte das auch schon früher verkündet. Aber das waren stets wilde Spekulationen gewesen, die ihn mit Frauen in Verbindung brachten, die er kaum kannte oder nicht ausstehen konnte.
Aber ein Interview bei 20/20 war etwas anderes. Die Sendung war seriös. Ebenso wie Janet Curry. Sie war eine reife, elegante Frau, eine Säule der Bostoner Gesellschaft, Mitte Vierzig, frisch verwitwet und finanziell gesichert. Hillary wußte, daß John mit ihr ausgegangen war – er hatte es ihr erzählt –, aber er hatte kein Wort über eine Verlobung verlauten lassen. Nicht, als sie ihn im vorangegangenen Monat gesehen hatte, als die Sendung aufgezeichnet wurde, und auch nicht letztes Wochenende.
Als sie begriff, was das bedeutete, wurde ihr Schmerz zur Qual. Wenn die Verlobung eine Tatsache war, hatte er mit ihr geschlafen, nachdem er Janet einen Antrag gemacht hatte, was ebenso das Wochenende wie auch Hillary billig machte. Außerdem – wenn er heiratete, gäbe es eine ständige Partnerin an seiner Seite und in seinem Bett, eine Ehe-Partnerin. Und es wäre nicht Hillary.
Gegen die aufsteigende Panik ankämpfend, ging sie zum Nachttisch hinüber, nahm den Telefonhörer ab und tippte mit Vehemenz hastig Pams Nummer ein. Pam würde die Wahrheit wissen. Sie war seine Schwester – ihr hätte er die Neuigkeit bestimmt anvertraut.
Vielleicht aber doch nicht. Hillary drückte auf die Gabel. Obwohl Pam ein Pfeiler des Familienunternehmens war, standen sie und John einander nicht nahe. Es war kein Wunder: John war ein Mistkerl.
Und wer könnte seine Pläne besser bestätigen als der Mistkerl selbst? Sie gab die Nummer von Johns Stadthaus am Beacon Hill ein, und mit jedem Klingeln wurde ihre Angst größer. Nach dem vierten wurde abgenommen.
»Bei St. George.« Lärm im Hintergrund.
»Christian – hier ist Hillary Cox.« Sie sprach mit fester Stimme und so viel Autorität, wie sie aufbringen konnte, denn sie mußte damit rechnen, daß sein Butler, sollte sie keinen Platz mehr in Johns Leben haben, dies wüßte. »Ist John da?«
Während der wenigen Sekunden, die sie auf seine Antwort warten mußte, identifizierte sie den Hintergrundlärm: Es waren Leute da, und die Stimmen vermischten sich zu einem mißtönenden Brummen. »Er ist da, Miss Cox – aber er ist im Moment beschäftigt.« Perlendes Gelächter. »Soll ich ihm ausrichten, daß Sie angerufen haben?«
Sie hatte den beunruhigenden Verdacht, daß eine Party im Gange war. »Ja – jetzt gleich. Sagen Sie ihm, daß ich am Telefon bin und mit ihm sprechen möchte.«
»Vielleicht wäre es besser ...«
»Bitte, Christian. Es ist dringend.«
Etwas von ihrer Verzweiflung mußte zu ihm durchgedrungen sein. Eine kurze Pause, dann eine knappe Anweisung, und Christian legte sie auf Warteleitung.
Die plötzliche Stille war wegen der vorher gehörten Stimmen eine noch größere Qual. Sie verfolgten sie, gaben ihr das Gefühl, ausgeschlossen zu sein, und obwohl sie dieses Gefühl in der Vergangenheit häufig gehabt hatte, war es in diesem Moment schlimmer. Es war eine Sache, ausgeschlossen zu sein, wenn alle anderen es ebenfalls waren, und eine andere, ausgeschlossen zu sein, wenn andere es ganz offenbar nicht waren.
»Hillary?« Seine Stimme war so leise und beherrscht wie immer. Keine Hintergrundgeräusche. Sie stellte ihn sich in der Bibliothek vor, umgeben von Regalen, in denen sich Bücher aneinanderreihten, die er nie gelesen hatte, die langen, schlanken Finger auf die glänzende Platte seines Mahagonischreibtischs gestützt. Er mußte die Tür zugemacht haben, um seine Privatsphäre zu sichern – ein Bedürfnis, dem plötzlich der Geruch von Schuldbewußtsein anhaftete.
»Was geht bei dir vor, John?«
Er schien die Anspannung in ihrem Ton nicht zu bemerken.
»Wie geht es dir?«
»John ...«
»Hast du die Sendung gesehen?« Er sprach langsam, bedächtig.
»Natürlich. Deshalb ...«
»Wie fandest du sie?«
»Ich weiß nicht. Deshalb ...«
»Es war nicht schlecht.« Sein Tonfall widersprach der Untertreibung geschickt. »Solche Sendungen können Gift sein. So charmant der Interviewer persönlich auch scheinen mag – wenn die Aufnahmen abgedreht sind, kann auch der klügste Mann nach der Bearbeitung des Materials wie ein Schwachkopf wirken.« Hillary verlor den letzten Rest ihrer Haltung. »John, was war ...«
»Ich kam gut rüber, glaube ich. Ich bin sehr angetan.«
»Aus dem Lärm zu schließen, den ich bei dir hörte, als Christian den Hörer abnahm, sind das auch eine Menge anderer Leute.« Sie sprach schnell, um etwas sagen zu können, bevor er sie wieder unterbrechen würde. »Was ist bei dir los?«
Kurze Stille. Dann: »Es sind ein paar Freunde zum Feiern vorbeigekommen.«
»Die müssen sich aber beeilt haben: Die Sendung war erst vor einer knappen Viertelstunde zu Ende.« Was nur eines bedeuten konnte. »Sie haben sie gemeinsam mit dir angeschaut, nicht wahr?«
»Einige von ihnen.«
»Einige. Drei? Acht? Zwanzig?« Sie machte keinen Versuch, ihre Verletztheit zu verbergen. »John – wenn ich gewußt hätte, daß du den Anlaß zu einer Party nutzen würdest, wäre ich auch gekommen. Aber ich war nicht eingeladen. Du wolltest mich also nicht dabeihaben. Das willst du ja nur selten. Und jetzt schon gar nicht mehr.« Sie atmete tief durch. »Stimmt es? Bist du mit Janet verlobt?«
Zögern. »Ich rufe dich nachher zurück, Hillary.«
»Nein – ich will es jetzt wissen. Bist du verlobt?« Er antwortete nicht. »Wirst du sie heiraten?« Noch immer nichts. »Sag es mir, John.«
»Wir reden später darüber.«
»Ich muß es jetzt wissen! Es war schlimm genug, es im Fernsehen zu hören. Wie konntest du mir das antun?« schrie sie. Nachdem der Schmerz einmal angefangen hatte, an ihr zu zerren, ließ er sie nicht mehr aus seinen Fängen. »Wie konntest du es auf diese Weise tun? Nach all den Jahren, all der Zeit, die wir miteinander verbracht haben – wie konntest du es mich da gemeinsam mit Millionen anderer Menschen erfahren lassen? Hast du dir nicht überlegt, daß es mich verletzen würde?«
»Nicht jetzt, Hillary.«
Er klang verärgert, doch sie scherte sich nicht darum. »Du liebst sie nicht. Ich kenne dich, John. Du liebst sie nicht. Du liebst nur dich und diese verdammten Läden. Warum heiratest du sie also? Du besitzt jetzt die Macht, die du immer wolltest. Mein Gott, nach heute abend werden dir Zeitungen und Illustrierte die Tür einrennen, um ein Interview zu bekommen. Du hast Geld. Du bist berühmt. Warum willst du sie also? Sie ist keine Schönheit – ich sehe besser aus. Und sie kann dir nicht geben, was du brauchst. Ich bin diejenige, die das tut. All die Jahre bin ich es gewesen ...«
Seine Stimme klang gepreßt. »Hillary – dies ist weder die Zeit noch der Ort ...«
»Und da du gerade Zeit und Ort erwähnst – was war mit dem letzten Wochenende? Du warst bei mir, John. Achtundvierzig Stunden lang warst du bei mir, und wir taten all die intimen, kleinen Dinge, die wir jahrelang getan hatten. Wenn du mit ihr verlobt bist – was, zur Hölle, tatest du dann bei mir?« Sie zitterte. »Sag mir das, John – was war mit dem letzten Wochenende?«
»Was soll damit gewesen sein?« Unverhüllter Zorn, weil sie ihn bedrängte. »Es war, wie es immer war.«
»Aber du hast vor, eine andere zu heiraten!«
»Und?«
Hillarys Unterkiefer fiel herab. »Und? Du betrügst sie also einfach!«
»Janet wird Nutzen aus dieser Heirat ziehen. Sie wird den Schutz erhalten, den sie verlor, als Turner starb. Sie wird wieder jemanden haben, der ihr Leben in die Hand nimmt, was sie vermißt hat. Ich habe ihr keine Treue geschworen, und sie hat nicht darum gebeten.«
»Du beabsichtigst, die Beziehung zu mir während deiner Ehe aufrechtzuerhalten?«
»Sie wird sich nicht daran stören.«
»Kann sein – aber ich!«
»Ich begreife nicht, weshalb.« Er klang vollkommen ernst. »Es hat dir doch früher nie etwas ausgemacht, wenn ich etwas mit anderen Frauen hatte.«
»Du warst mit keiner von ihnen verheiratet!«
»Bist du plötzlich rechtschaffen geworden? Vergiß es, Hillary. Welchen Unterschied macht es, ob ich verheiratet bin oder nicht?«
»Einen großen.«
»Unsinn. Es wird sich zwischen dir und mir nicht das Geringste ändern. Wir werden uns ebenso oft sehen wie bisher. Meine Verbindung mit Janet ist eine reine Vernunftsache. Sie bringt uns beiden Vorteile: Sie befreit uns von unerwünschten, hartnäckigen Verehrern, und sie bringt Skeptiker zum Schweigen. Ich suche keine Leidenschaft bei ihr – die bekomme ich von dir.«
»Aber du heiratest sie!«
»Und du weigerst dich, ein Verhältnis mit einem verheirateten Mann zu haben? Ich bitte dich!« Seine Stimme wurde hart. »Was willst du? Geld? Schmuck? Geschäftsanteile?«
Seine Worte trafen sie wie ein Schlag ins Gesicht. Er begriff nichts – selbst nach all den Jahren, die sie einander kannten, war er weit davon entfernt, sie zu verstehen. Solange sie die Geliebte eines Mannes gewesen war, der die Ehe scheute, hatte sie die anderen Frauen ertragen können, die in seinem Leben kamen und gingen – schließlich war sie diejenige gewesen, die blieb. John kehrte immer zu ihr zurück, und das tröstete sie über alles hinweg, was sie sich von ihm gewünscht hätte. Doch jetzt gab er einer anderen Frau seinen Namen, stellte eine andere Frau auf das Podest, das bisher leer gewesen war. Es ging ihr um ihre Selbstachtung. Hillary war zu stolz, um zuzulassen, daß ihre Beziehung zu ihm eine eindeutige Bezeichnung bekam, mit dem Etikett versehen wurde, das sie degradierte.
Plötzlich ertrug sie seine Gegenwart am anderen Ende der Leitung nicht mehr – in ihrem Schmerz ging dies über ihre Kraft. »Fahr zur Hölle!« stieß sie hervor und legte auf, um dann das Telefon anzustarren und zu beten, daß es läutete, daß er zurückriefe.
Aber sie wußte, daß er es nicht tun würde. Er würde ihr kein Zeichen seiner Zuneigung geben, und er würde sich ganz bestimmt nicht entschuldigen. Dazu war er zu arrogant. Nein – er würde das Licht in der Bibliothek ausmachen und zu seiner Party zurückkehren, wohl wissend, daß sie wußte, daß er das tat, während sie allein in New York saß. Er würde die Qual ihrer Phantasievorstellungen die Strafe dafür sein lassen, daß sie einfach aufgelegt hatte.
Und sie fühlte sich bestraft. Ihn im Geiste in einem Salon voller Menschen zu sehen, von denen eine sicherlich seine Verlobte war, allesamt voller Bewunderung dafür, daß er einen so sensationellen Publicity-Coup im Fernsehen gelandet hatte, war eine Qual. Sie schlang die Arme um sich und wiegte sich, auf der Bettkante sitzend, vor und zurück, doch die Bewegung linderte ihren Kummer nur ungenügend, ebenso wie die Wanderung durch ihre Wohnung. Sie fühlte sich auf eine seltsame Weise leer und doch erfüllt von Emotionen, die um ihre Aufmerksamkeit wetteiferten. Trauer, Schmerz, Zorn, Einsamkeit, Furcht – sie wußte nicht, welcher sie sich zuerst zuwenden sollte.
Sie warf sich einen langen Mantel über und suchte Zuflucht in der Märznacht. Die kühle Luft war angenehm. Ihren Mantel zuhaltend, ging sie mit schnellen Schritten den Bürgersteig entlang, vorbei an Häusern aus braunem Sandstein und Schaufenstern und vielen Menschen, die wie sie um Mitternacht unterwegs waren. In ihrer augenblicklichen Verfassung war sie froh, daß New York niemals schlief. Andere zu sehen, die allein waren, milderte ihr Gefühl der Einsamkeit ein wenig.
Bis heute war sie stolz darauf gewesen, über diesem typischen Großstadtgefühl der Isolation zu stehen. Wieviel Zeit sie auch allein verbrachte – und als Schriftstellerin war das eine ganze Menge –, es hatte doch immer die Gewißheit gegeben, daß es John gab. Auch wenn zwischen seinen Besuchen Monate lagen, wußte sie doch, daß er existierte. Sie telefonierten nicht. Sie schrieben einander nicht. Aber er war da, und sie wußte, sobald er dazu bereit wäre, würde er zu ihr kommen.
Jetzt nicht mehr.
Sie ging weiter und weiter. Schließlich, trotz der körperlichen Anstrengung kalt bis in die Knochen, kehrte sie in ihre Wohnung zurück. Der Anrufbeantworter zeigte einen einzigen Anruf an. Das mußte John sein! Ein unsägliches Glücksgefühl wallte in ihr auf, und sie schaltete den Apparat an.
»Hi, Hillary.« Das Glücksgefühl erlosch. »Hier ist Pam. Ich muß unbedingt mit dir reden. Aber ich bin nicht zu Hause, und deshalb kannst du mich nicht zurückrufen. Ich versuch’s morgen früh noch mal.«
Piep und aus. Wäre es John gewesen, hätte sie seine Nachricht gespeichert, um seine Stimme immer wieder hören zu können. Statt dessen blieb sie, die Enttäuschung wie ein schweres Gewicht auf ihren Schultern, stehen, wo sie war. Sie liebte Pam – aber es war Johns Stimme, nach der sie sich mit allen Fasern sehnte.
Sie wollte mit jemandem sprechen, wollte an einer mitfühlenden Schulter schreien und weinen, aber Pam war nicht zu Hause, und sie konnte zu dieser späten Stunde keine Freunde belästigen.
Um die Wahrheit zu sagen – mit Ausnahme von Pam hätte Hillary es ohnehin nicht gewagt, ihre Freunde anzurufen. John war ein Reizthema, eines, das sie schon vor langer Zeit vermeiden gelernt hatte. Nur wenige ihrer Freunde kannten John persönlich. Einige wußten nicht einmal, wer er war, sondern nur, daß sie seit langem einen Liebhaber hatte. Keiner von ihnen verstand, weshalb sie die Beziehung zu ihm aufrechterhielt. Sie hielten es für verrückt, daß sie die »Funkstille« zwischen seinen Besuchen akzeptierte, daß sie ihn kommen und gehen ließ, ohne daß er sich in irgendeiner Form zu ihr bekannte. Jede Frau habe das Recht, ihre Interessen zu wahren, sagten sie, und obwohl sie immer gekontert hatte, selbständig genug zu sein, um dieses Bedürfnis bezüglich John nicht zu haben, hatten sie vielleicht recht. Wenn sie jetzt bei ihnen anriefe und sich darüber beklagte, was John ihr angetan hatte, würde sie allenthalben nur ein »Ich hab’s dir gleich gesagt« ernten – und dem wäre sie nicht gewachsen.
Die Nacht erschien ihr endlos. Sie war zu aufgewühlt, um schlafen, ja sogar, um lange still sitzen zu können. Kein Ablenkungsmanöver wirkte. Sie spielte zärtliche Musik, trank lieblichen Wein, legte sich in die Badewanne, was ihre Anspannung eigentlich hätte lösen müssen. Aber sie dachte die ganze Zeit über an John, und der Schmerz in ihrem Innern hielt sich hartnäckig.
Bei Tagesanbruch war sie ein Nervenbündel. Sie beobachtete, wie die ersten Sonnenstrahlen in die Betonschlucht ihrer Straße vordrangen, beobachtete, wie der Lieferwagen die Zeitungen brachte. Sie ging hinunter, um ihre zu holen, nahm sie mit nach oben, schlug die Klatschseite auf und starb einen kleinen Tod. Der Artikel war nicht lang – John war noch keine königliche Größe –, aber die Meldung war da, berichtete in vier ganzen Absätzen von der bevorstehenden Verheiratung eines der begehrtesten Junggesellen der Ostküste. Vor Verzweiflung zitternd, versteckte sie die Zeitung unter der vom Vortag, die noch auf der Arbeitsfläche in der Küche lag.
Sie duschte heiß, zog sich an, schaute auf die Uhr: Es war fast halb acht. Pam wäre schon wach, aber sie wollte sie nicht anrufen – sie war zu aufgeregt zum Reden. Also setzte sie sich, entschlossen zu arbeiten, an ihren Schreibtisch. Es fiel ihr nichts ein.
Sie brauchte Luft. Sich den Mantel von dort greifend, wo sie ihn in der Nacht zuvor hingeworfen hatte, machte sie erneut einen Spaziergang. Sie atmete tief durch, stellte Blickkontakt zu den wenigen Samstagmorgenspaziergängern her, die ihr entgegenkamen, hielt sich sehr gerade. Doch unweigerlich wurde ihr Blick magisch von jedem Zeitungsstand angezogen. Schließlich konnte sie nicht mehr widerstehen und kaufte eine, die sie noch nicht hatte, klemmte sie unter den Arm und ging nach Hause.
Auch in dieser stand ein Artikel über Johns Verlobung.
Angewidert schob sie sie weg, packte ihren Aktenkoffer und verließ die Wohnung wieder. Diesmal hatte sie ein Ziel: die Bibliothek. Sie blieb den größten Teil des Tages dort – nicht, weil die Stunden so ergiebig waren, sondern weil sie es nicht ertragen hätte, in ihren vier Wänden mit ihren bittersüßen Erinnerungen und der Stille allein zu sein.
Als sie schließlich doch nach Hause ging, fand sich auf dem Anrufbeantworter eine weitere Nachricht von Pam. Diesmal mit präzisen Angaben. »Hi, Hillary – ich bin’s wieder. Hör zu, wir müssen uns treffen. Ich fliege am Mittwoch zu einer geschäftlichen Besprechung nach New York. Laß uns zusammen zu Mittag essen. Im ›Four Seasons‹. Wenn du es nicht einrichten kannst, ruf mich zurück. Ansonsten sehe ich dich dann.«
Typisch Pam: Gelassen und tüchtig wie stets, wußte sie, was zu tun war, und tat es. Hinter ihrer gelassenen Souveränität verbarg sich Hartnäckigkeit, doch sie beruhte nicht so sehr auf Überheblichkeit, als vielmehr auf einer leidenschaftlichen Überzeugung. Das war einer der Unterschiede zwischen Pam und ihrem Bruder. Sie fühlte. Sie sorgte sich. Sie blutete.
Wie Hillary.
John nicht.
Dieser Gedanke kehrte häufiger als jeder andere zurück und verfolgte sie durch die langen, einsamen Stunden des Wochenendes. Ihre Gefühle stürzten sie in schnellem Wechsel von Unglauben in Schmerz, von Verwirrung in Verzweiflung. Sie bemühte sich, der Zukunft, die vor ihr lag, ins Gesicht zu sehen, doch die unwirtliche Leere ließ sie den Blick abwenden. Es war nicht fair. So lange hatte sie ihre eigene Person hintangestellt, ihr Leben auf Johns ausgerichtet. In einem Augenblick verfluchte sie ihn, doch im nächsten mußte sie sich selbst verfluchen. Er hatte sie benutzt, und sie hatte es zugelassen.
Am Ende des Wochenendes war sie ebenso zornig wie verletzt, und der Zorn gebar eine Idee. Sie würde sich nie mehr von John mißbrauchen lassen. Das Leben ging weiter, und sie würde ihr Potential nutzen. Es störte sie nicht, daß ihr Zorn auf John als Katalysator wirkte. Es würde sie nicht stören, wenn John wütend über ihren Plan wäre. Sie hatte nichts mehr zu verlieren.
Es war an der Zeit, daß sie etwas aus ihrem Leben machte. John dafür zu benutzen, wäre dichterische Gerechtigkeit.
ZWEITES KAPITEL
Pamela St. George war eine Frau, die Klasse ausstrahlte, ohne es zu wissen. Sie dachte weder viel über Selbstvertrauen noch über Schönheit nach, aber sie besaß beides. Wenn es ihr beispielsweise einfiel, ihre langen, dunklen Haare zu einem dicken Zopf zu flechten und dazu ein Armani-Kostüm anzuziehen, kopierten die Damen der Gesellschaft diesen Look in der Woche darauf. Nicht, daß sie es bemerkt oder gar genossen hätte. Es gab Prioritäten in ihrem Leben, und Trends zu kreieren, gehörte nicht dazu.
Mit Schmuck allerdings war das anders: Schmuck war wichtig. Besonders Schmuck, der ihren Namen trug. Sie war eine lebende Reklame für »Pamela St. George Originals«, denn so beliebt ihre Entwürfe bereits waren, sie ließ niemals eine Gelegenheit verstreichen, diese Beliebtheit noch zu steigern. Sie war davon durchdrungen, daß aus Beharrlichkeit Macht erwuchs, und obwohl Hillary nicht genau wußte, warum Pam all diese Macht brauchte, hatte sie nichts daran auszusetzen. Pamela hatte ihr gerüttelt Maß an Schicksalsschlägen in ihrem Leben getragen, und sie tat es noch.
Als sie sie jetzt im Kielwasser des Oberkellners auf sich zukommen sah, erwachte in ihr die vertraute Mischung aus Eifersucht und Zuneigung für die Frau, die ihr näherstand als ihre eigene Schwester. Sie wollte sie hassen – wegen ihres Aussehens, ihrer Anmut, ihres Erfolges –, aber sie konnte es nicht. Pam war ein zu guter Mensch, zu warmherzig, zu aufrichtig, und sie war ihr immer eine loyale Freundin gewesen.
Wie üblich hatte sie sich eine bestimmte Aura verliehen. Mit den von einer Silberspange über einem Ohr zusammengehaltenen Haaren wirkte sie wie eine Künstlerin. Der Bohème-Effekt wurde durch ein Wildlederkostüm verstärkt, dessen ausgefranster Saum dazupassende Stiefel umspielte, doch je näher sie kam, um so mehr wurde Hillarys Aufmerksamkeit von der Kleidung abgelenkt und zum Hals hingezogen. Wie die Haarspange war auch die Kette aus Silber, mit einem Mosaik aus Steinen besetzt, deren Farbpalette von blassem Rosa bis zu Purpur reichte. Die Halbedelsteine waren Turmaline – Pamelas Markenzeichen.
Pamela schlang einen Arm um Hillarys Schultern, beugte sich zu ihr herunter und drückte sie in einer langen, vielsagenden Umarmung an sich. Dann ließ sie sich, dem Oberkellner ein kurzes Lächeln schenkend, auf dem Stuhl nieder und legte ihre Speisekarte auf das Porzellangedeck. Sie musterte Hillary forschend.
»Bist du okay?« fragte sie leise.
Sie hatten seit Johns Fernsehauftritt noch nicht miteinander gesprochen, und der lag bereits vier Tage zurück. Aber Hillary fühlte sich immer noch wie zerschlagen. »Ich werde überleben. Stolz hat die positive Eigenschaft, die Dinge im Lot zu halten.« Pam betrachtete sie eine weitere Minute, bevor sie – noch immer mit leiser Stimme, aber mit einem Anflug von stählerner Härte im Blick – sagte: »Ich bin entsetzt. Das weißt du, nicht wahr?«
»Du bist lieb.«
»Das hat nichts mit ›lieb‹ zu tun, sondern mit gesundem Menschenverstand. Und Mitgefühl. Und Liebe. Du hättest es sein sollen.« Als sie Hillarys plötzlich rebellische Miene sah, sprach sie hastig weiter. »Ich sage das, weil es meine Überzeugung ist und ich es mir von der Seele reden muß. Wenn er sich schon mit jemandem verloben mußte, dann hättest du es sein sollen.«
»Aber ich war es nicht.«
»Wofür du deinem Schicksal wahrscheinlich dankbar sein solltest, was du natürlich nicht sein wirst. Du hattest ja schon immer einen Narren an John gefressen. Gott allein weiß, warum. Er ist arrogant, selbstsüchtig, herrschsüchtig und durchtrieben – katastrophale Voraussetzungen für eine Ehe. Denk darüber nach, und du wirst erkennen, daß es wahr ist.« Sie tippte sich an die Stirn. »Zumindest hier oben.« Ihre Hand sank auf ihr Herz. »Hier ist es eine andere Geschichte. Wir haben nie das Wort Liebe ausgesprochen ...«
»Ich liebe ihn nicht.«
»Nein?«
»Nein.«
»Du hältst aber schon ewig lange an ihm fest.«
»Gewohnheit«, erwiderte Hillary mit einem kleinen, traurigen Lächeln.
Pam drückte Hillarys Hand. »Du hast etwas Besseres verdient. John ist zwar mein Bruder, aber ich wünsche mir einen weit besseren Mann für dich als ihn. Vielleicht ist das, was er getan hat, ein verkappter Segen: Vielleicht wird es deinen Blick für andere Männer öffnen.«
»Ich habe kein Interesse an anderen Männern.« Es hatte Zeiten gegeben, da hatte sie sich umgesehen – doch keiner konnte John das Wasser reichen. Aber sie hatte nicht vor, Pam das zu erzählen. Es würde bedeuten, Johns Anziehungskraft über die physische hinaus analysieren zu müssen, und dazu war sie nicht in der Lage. Es war etwas, das über Gewohnheit hinausging, etwas Irrationales, das sie immer und immer wieder zu ihm zurückzog.
»Ich brauche keinen Mann zum Überleben.«
»Ich weiß. Aber ...«
»Ich erhole mich schon wieder. Es war ein Schock, das ist alles.«
»Ja – aber ich kenne dich: In längstens einer Woche wirst du John verteidigen.«
»Kaum. Ich stimme dir zu, Pam – diesmal ist er zu weit gegangen.«
»Er hat dir nicht gesagt, was er vorhatte?«
Hillary schüttelte den Kopf.
»Mistkerl!« flüsterte Pam wütend. »Aber das ist ja nichts Neues. Neu ist seine Verlobung. Nach all dieser Zeit und angesichts der Dinge, die er erreicht hat, ist es nicht einzusehen.« Ihre Stimme hatte einen drängenden Unterton. »Worauf ist er aus? Ich habe versucht, dahinterzukommen, aber es ist mir nicht gelungen. John ist nicht für die Ehe geschaffen – er ist ein Einzelgänger. Umgeben von Menschen und doch allein – das ist John, auf den Punkt gebracht. Er konnte niemals jemanden lange in seiner Nähe ertragen. Was hat seine Einstellung geändert?«
Hillary hatte sich diese Frage während der 20/20-Ausstrahlung ein dutzendmal gestellt. »Vielleicht macht er jetzt die Midlife-Crisis durch, für die er vor zehn Jahren keine Zeit hatte.«
»Vielleicht. Vielleicht ist ihm auch plötzlich seine Sterblichkeit bewußt geworden, und er möchte, daß auf seinem Grabstein ›geliebter Ehemann‹ steht. Aber falls es so ist, dann hat er sich die falsche Frau ausgesucht. Ich kenne Janet Curry. Ihr Ruf ist über jeden Zweifel erhaben. Sie ist wie eines dieser alten Marmorgebäude, die die Commonwealth Avenue säumen – glatt, imponierend und kalt. Ich kann mir nichts ›Geliebtes‹ in der Beziehung dieser beiden vorstellen.« Sie seufzte. »John war niemals dafür bekannt, Unerwartetes zu tun – aber diesmal hat er es, weiß Gott, getan.«
»Hast du mit ihm gesprochen?« fragte Hillary, darauf bedacht, ihre Ungeduld zu verbergen. Im Laufe der Jahre hatte sie Pam oft als Quelle für Informationen über John benutzt. Pam hatte sich nie daran gestört – besonders, weil sie ebenfalls Informationen erhielt.
Sie nickte. »Samstag. Kurz. Er nahm meine Glückwünsche entgegen wie alles andere auch – als stehe es ihm zu. Natürlich glaubte er, meine Gratulation betreffe seinen Fernsehauftritt. Der Mann ist unglaublich.« Es war kein Kompliment – nichts, was Pam je über John sagte, war eines. So leicht es ihr fiel, anderen Komplimente zu machen – bei ihm fand sie kaum etwas, das sie eines Lobes wert erachtete. »Seine Reflexe scheinen nicht so zu funktionieren wie die anderer Menschen. Wir mögen denselben Vater haben, aber ich sage dir, er kommt von einem fremden Ort. Da hatte er gerade die Überraschungsmeldung des Jahrzehnts losgelassen, und alles, worüber er sprechen wollte, war die Sendung!«
»Ich kann verstehen, weshalb.«
Pam machte ein angewidertes Gesicht. »Das kann ich auch. Hast du jemals etwas derart Einseitiges gesehen? Er meisterte das Interview, wie er alle Dinge in seinem Leben gemeistert hat. Er ist ein Genius der Manipulation. Begibt sich nie in eine Situation, über die er nicht die Kontrolle besitzt. Mit Sicherheit hat er gewisse Grundregeln aufgestellt, bevor er sich bereit erklärte, 20/20 das Interview zu geben.«
»Sie müssen ungeheuer scharf darauf gewesen sein.«
»Davon bin ich überzeugt. Sie hatten einen guten Grund: Wir sind gebeten worden, der Präsidentenfamilie einige Stücke für die Moskau-Reise zu stellen.«
Das war Hillary neu. »Wie aufregend!« sagte sie und meinte es auch, aber gleichzeitig empfand sie glühenden Neid. Pams Stern war im Aufsteigen, immer im Aufsteigen, während Hillary nach wie vor darauf wartete, daß ihrer sich vom Boden löste.
»Es ist eine Live-Berichterstattung vorgesehen«, erklärte Pam, »was bedeutet, daß die Reporter die Pausen mit Nebensächlichkeiten wie Kleidern und Schmuck werden ausfüllen müssen.«
»Nebensächlichkeiten!« Selbst wenn Hillary kein Interesse an Schmuck gehabt hätte und obwohl sie von Verbitterung erfüllt war – sie hätte Pams Arbeiten niemals als »Nebensächlichkeiten« betrachten können. Dafür waren die Stücke zu schön und zu kostspielig. Sie hätte es sich nicht leisten können, eines davon zu kaufen. Daß sie ein Pamela-St.-George-Original trug – einen auffälligen Ring mit einem einzelnen, in Keramik gefaßten, grünen Turmalin –, war der Tatsache zu verdanken, daß Pam ihn ihr geschenkt hatte. Nicht John. Pam.
»Glaube mir – ich bin absolut glücklich mit diesem Etikett«, sagte Pam. »Kannst du dir vorstellen, welche Publicity das für uns bedeutet? Kostenlose Werbung. Also beschloß 20/20, die ›Facets‹-Story an sich zu reißen, ehe die Reporter sie bekämen. Offenbar waren die Produzenten bereit, Kompromisse zu schließen.«
»Und Johns Regeln zu befohlen.«
»Anders ist es nicht zu erklären. John hat Feinde – weiß Gott! Warum sollte 20/20 also nicht in der Lage sein, sie aufzutreiben?«
»Er muß ihnen eine Liste von Leuten gegeben haben, mit denen sie sprechen durften.«
»Mein Name stand bestimmt nicht drauf!« grollte Pam.
»Aber wenn – hättest du ihn fertiggemacht?«
»Darauf kannst du wetten!« rief sie in ihrer typischen Impulsivität, bremste sich jedoch beim nächsten Atemzug und lehnte sich dann, plötzlich bekümmert, in ihren Stuhl zurück.
Pams Ambivalenz überraschte Hillary nicht. Einerseits waren Pams Vorbehalte gegen John alles andere als gering. Sie hielt ihn für eine Ratte und hatte ihn viele Male als solche bezeichnet – vor allem in jenen Zeiten, als sie die Kunst der Diplomatie noch nicht so weit entwickelt hatte, daß ihr in ihren Momenten unkontrollierter Wut andere Worte eingefallen wären. Hillary war diejenige gewesen, die John immer verteidigt hatte, darauf hingewiesen, daß er den Nettowert des Geschäfts zunächst verdoppelt, dann verdreifacht und schließlich vervierfacht hatte, daß er jeden Cent der anfallenden Steuern bezahlte und daß er beträchtliche Summen für wohltätige Zwecke spendete. Selbst bei den durch nichts zu rechtfertigenden Untaten, von denen sich einige direkt gegen Pam richteten, hatte er in Hillary eine Fürsprecherin gefunden.
Andererseits war John noch immer der uneingeschränkte Herrscher über die St. George Company und somit über »Facets«. Pam konnte natürlich jederzeit ihre Entwürfe nehmen und woanders hingehen, aber Hillary bezweifelte, daß sie das tun würde. Wenn sie die Achtung für ihren verstorbenen Vater und die von ihm gegründete Firma nicht hielte, so die Furcht vor Johns Zorn.
»Du hast Angst vor ihm«, stellte sie eher mitfühlend als anklagend fest.
»Nicht mehr so sehr wie früher.«
»Aber du hättest niemals mit 20/20 geredet – du bist ein zu anständiger Mensch. Wenn du zugestimmt hättest, dich interviewen zu lassen, hättest du wählen müssen, entweder John ans Kreuz zu nageln oder mit zusammengebissenen Zähnen zu lügen. Du hättest keines von beidem über dich gebracht.« Sie lehnte sich in ihrem Stuhl zurück, flocht ihre Finger ineinander und holte tief Luft. »Ich kann es, Pam – und ich werde es: Ich werde ein Buch über ihn schreiben.«
Pam starrte sie entgeistert an. »Du machst Witze.«
»Keineswegs.«
Pam überlegte eine Weile. »Was für eine Art Buch?« fragte sie schließlich vorsichtig.
»Eine Biographie. Ich kenne ihn besser als die meisten – ich bin prädestiniert dafür.«
»Aber du bist persönlich beteiligt.«
»Nicht mehr.«
»Das sagst du so.« Wieder überlegte Pam. »Ich weiß nicht, Hillary«, meinte sie dann. Ihre Worte kamen langsam, zögernd. »Ich bin nicht sicher, daß das eine so gute Idee ist.«
Hillary studierte Pams Gesicht und erkannte an ihrer skeptischen Miene, in welche Richtung ihre Gedanken gingen. Ein Buch über John zu schreiben, bedeutete, ein Buch über die St. George Company zu schreiben. Es bedeutete auch – bis zu einem gewissen Grad – ein Buch über Pam zu schreiben, über Pams Mutter Patricia und über Cutter.
»Ich wünschte, du tätest es nicht«, sagte Pam leise.
»Ich muß. Es ist das einzige Positive, das aus diesem schrecklichen Erlebnis hervorgehen kann. Ich muß es tun, um zu mir zurückzufinden.«
Pam dachte darüber nach. Es war ihr anzusehen, daß sie sich unbehaglich fühlte. »John wird außer sich sein.«
»Ich weiß – aber ich habe nichts zu verlieren.«
»Ich schon. Ich habe einen Mann, eine Tochter und einen guten Ruf. Meine Mutter kann eine solche Publicity nicht brauchen – und Cutter auch nicht.«
»Keiner von euch muß etwas befürchten – keiner von euch hat etwas Unrechtes getan.«
»Aber ...«, begann Pam, brach jedoch ab, als ein Mann an ihrem Tisch erschien. Sie blickte überrascht auf, und dann lächelte sie strahlend, streckte ihm die Hand hin und reichte ihm die Wange zum Kuß.
»Ich sah dich hereinkommen und konnte der Versuchung nicht widerstehen, dir hallo zu sagen«, sagte der Mann. »Du siehst großartig aus, Pamela. Wie geht’s dir denn immer?«
»Gut, Malcolm. Es ist schön, dich zu sehen. Ich möchte dir meine Freundin, Hillary Cox, vorstellen. Hillary – Malcolm McCray. Ich habe Malcolms Frau einige meiner Lieblingsstücke verkauft«, erklärte sie Hillary und wandte sich dann wieder an Malcolm. »Wie geht es Lorraine?«
»Amüsiert sich in Vermont, nachdem die Scharen von Skifahrern abgereist sind. Ich werde mich Freitag auch auf den Weg dorthin machen. Es ist der einzige Ort, wo ich Ruhe finden kann.«
Hillary verstand das. Sie kannte das Gesicht des Mannes nicht, aber seinen Namen: Von San Francisco hierher übersiedelt, besaß Malcolm McCray einige der neuesten und luxuriösesten Hotels von New York. Wenn W zu glauben war, dann waren er und seine Frau auch an der Organisation von Wohltätigkeitsbällen beteiligt. Hillary war nicht überrascht, daß Pam das Paar kannte: ihr Bekanntenkreis war in den vergangenen Jahren ständig größer und exklusiver geworden. Kometen hatten die Eigenschaft, solche Schweife zu verursachen.
»Grüße sie von mir«, bat Pam.
»Natürlich.« Malcolm senkte die Stimme. »Was ist mit Brendan? Geht es ihm besser?«
Pam lächelte traurig. »Er hat seine Hochs und Tiefs.«
»Beim nächsten Hoch kommt uns besuchen. Das Landleben hat eine heilende Wirkung.«
Das traurige Lächeln blieb. »Danke. Es ist lieb, daß du dir Gedanken machst.«
Er drückte ihr zum Abschied die Hand, nickte Hillary zu und ging. Pam schlug die Speisekarte auf, doch Hillary sah ihr an, daß sie mit ihren Gedanken in Boston war.
»Wie geht es ihm?«
»Brendan?« Pam klappte die Speisekarte wieder zu. »Manchmal ist die Behandlung schlimmer als die Krankheit«, antwortete sie mit einer zaghaften Handbewegung. »Es ist schwer, nicht den Mut zu verlieren.«
»Haben die Ärzte den Mut verloren?«
»Wer weiß – wir bekommen nicht immer klare Auskünfte von ihnen.«
»Stellt ihr denn klare Fragen?«
»Natürlich nicht. Manche Dinge wollen wir gar nicht hören.«
»Aber du läßt dich nicht unterkriegen.«
»Das kann ich mir nicht erlauben – vor allem Brendans wegen. Und es ist nicht so schlimm. Ich habe viel zu tun. Das ist eine Ablenkung. Und Ariana ist eine weitere.« Ihre Miene erhellte sich bei der Erwähnung ihrer Tochter. »Sie ist ein Engel. Ich wüßte wirklich nicht, was ich ohne sie täte. Sie steht für so vieles – Hoffnung und Liebe und alle möglichen anderen Dinge. Sie war – ist – ein Gottesgeschenk.«
Nach einer kurzen Pause fragte Hillary: »Hast du Kontakt zu Cutter?«
Pam betrachtete das zarte Schnörkelmuster am Griff ihres Buttermessers. »Wir telefonieren hin und wieder. Ich habe ihn wegen Brendans Krankheit eine Weile nicht gesehen. Aber«, ihre Stimme wurde leise, »ich wüßte nicht, was ich täte, wenn die Verbindung zu ihm gänzlich abrisse.« Sie schüttelte unwillig den Kopf. »Diese Unterhaltung rutscht ins Rührselige ab. Laß uns bestellen.« Ein kurzer Blick, und schon stand ein Ober am Tisch.
Aber Hillary war nicht bereit, das Thema fallenzulassen. Als der Ober gegangen war, stellte sie ihr Weinglas ab. »Du hast noch viel mehr Grund zum Groll als ich, weißt du.«
»Gegen John?«
Hillary nickte. »Dein Leben sähe völlig anders aus, wenn es ihn nicht gäbe.«
Nach kurzem Nachdenken stütze Pam die Ellbogen auf die Lehnen ihres Stuhles und schaute Hillary in die Augen. »Stimmt. Er ist nicht viel besser als Abschaum, was wirklich ziemlich komisch ist, wenn man bedenkt, daß er sein Leben mit dem Bestreben zugebracht hat, sich als Angehöriger der Oberschicht zu erweisen.«
»Es ist an der Zeit, daß jemand darauf hinweist«, sagte Hillary, an ihr Buch denkend.
Aus ihrer ernsten Stimme zu schließen, dachte auch Pam daran. »Aber es gibt andere Möglichkeiten. Weniger spektakuläre, aber wirkungsvollere Möglichkeiten. Wir kriegen ihn, Hillary. Wir treffen ihn dort, wo es ihm weh tut.«
Hillary bemerkte Pams Entschlossenheit ausdrückende Kinnlinie. Sie hatte sie schon früher bemerkt, ihr jedoch nie Beachtung geschenkt, doch Johns Verrat hatte die Zeiten geändert.
»Ist das nicht reines Wunschdenken von dir?«
»Glaube mir – er kriegt sein Fett ab.«
»In der Firma?«
»Drinnen, draußen – wo immer. Sie kommt auf ihn zu, Hillary.«
»Wer?«
»Gerechtigkeit. Süße, süße Gerechtigkeit.«
Hillary, der diese Information zu vage war, schlug einen drängenden Ton an. »Was geht vor, Pam? Du hast schon früher Andeutungen gemacht. Ich habe diesen Ausdruck bei dir schon mehrfach gesehen – und jedesmal ist er ausgeprägter. Du hast etwas am Kochen, nicht wahr? Gemeinsam mit Cutter?«
»John gräbt sich sein Grab ganz allein.«
»Was für eine Platitüde!« Als Pam nicht protestierte, griff Hillary sie an. »Du warst nicht bereit, mit 20/20 zusammenzuarbeiten. Du warst nicht bereit, dich öffentlich gegen ihn zu stellen.«
»Das Fernsehen wäre das falsche Forum gewesen.«
»Und was ist das richtige?« Hillary hielt ihr Buch dafür, Pam war eindeutig nicht dieser Meinung.
»Es gibt eines. Vertrau mir. Er kriegt sein Fett ab.«
»Wann?« fragte Hillary, und nach einigen Sekunden: »Wie?«
Pam seufzte. »Ich kann dir im Augenblick nicht mehr sagen. Nur soviel: Wenn ein Mann wie John auf seinem Lebensweg ständig die Menschen verletzt, die ihm am nächsten stehen, ist es zu erwarten, daß sie irgendwann zurückschlagen. Du möchtest es jetzt tun – und viele von uns hatten in der Vergangenheit diesen Wunsch –, aber es gibt solche und solche Möglichkeiten. Und einige sind besser als andere. Es mag Zeit kosten, die richtige zu nutzen – aber es wird passieren. So wahr mir Gott helfe – es wird passieren.«
Hillary war nicht sonderlich beruhigt. Sie wollte ihr Buch schreiben. Sie wollte nicht tatenlos abwarten, während Pam und Cutter und wer noch mit von der Partie war, einen Racheplan gegen John schmiedeten. Sie hatte ihr eigenes Rachewerkzeug gefunden, und sie wollte es benutzen. Jetzt.
»Mach dir keine Sorgen«, sagte Pam, ihren Gesichtsausdruck mißdeutend. »Es wird nicht ›billig‹ sein. Es geht hier nicht um eine öffentliche Verunglimpfung.«
»Eine öffentliche Verunglimpfung wäre nicht das schlechteste«, erwiderte Hillary heftig. »Wenn ein Mann in die Öffentlichkeit geht, dann geht er in die Öffentlichkeit. Seit letzten Freitag abend ist John Freiwild. Er hat die Vorteile genutzt – jetzt muß er auch mit den Nachteilen rechnen.«
»Ich bezweifle, daß er es so sieht.«
»Wahrscheinlich nicht, der überhebliche Arsch.«
Pam lächelte trocken. »Jetzt weiß ich, daß er in Schwierigkeiten steckt: Wenn du anfängst, ihn mit Schimpfworten zu belegen, wird es ernst für ihn.«
»Darauf kannst du Gift nehmen!« bestätigte Hillary. »Was ich in den letzten Tagen empfunden habe, muß dem ähnlich sein, was du Jahre und Jahre empfunden hast.«
Pam nickte verstehend. »Zorn, ein Gefühl von Ungerechtigkeit, das Bedürfnis, zurückzuschlagen. Ich habe all das empfunden – aber das weißt du ja. Du hast erlebt, wie ich wegen der Dinge, die John getan hatte, um mich trat und schrie und mit dem Kopf gegen die Wand rannte.«
Die Vorstellung, wie die heutige, damenhafte Pam mit dem Kopf gegen die Wand rannte, ließ Hillary lächeln. »Das Treten und Schreien liegt schon eine ganze Weile zurück – aber ich erinnere mich noch daran, wie ich das erste Mal dabei war. Du kannst nicht älter als acht gewesen sein. Du warst während der Schulferien in Timiny Cove. John hatte eine Auseinandersetzung mit deinem Vater, und die kostete die Zeit, die eigentlich dir und Eugene vorbehalten war.«
Pam erinnerte sich zwar nicht an diesen speziellen Vorfall, aber an Dutzende ähnlicher Gelegenheiten. »Die beiden waren wie Öl und Wasser. Zehn Minuten im gleichen Raum, und es war die Hölle los. Wenn ich damals acht war, dann war John vierundzwanzig, was bedeutet, daß er bereits in der Firma mitarbeitete. Er glaubte zu wissen, wie das Geschäft geführt werden mußte, aber seine Ansichten standen in krassem Gegensatz zu denen meines Vaters. Sogar damals war er schon überheblich. Vierundzwanzig und wollte das Schiff steuern! Er wurde bereits arrogant geboren.«
»Wie du – dachte ich. Du wirktest wie ein verzogenes Balg, das einen Wutanfall hatte.«
»Frustration. Es war Frustration.«
»Du warst außer dir darüber, daß etwas oder jemand deine Pläne durchkreuzte.«
»Meine Beziehung zu Daddy war etwas Besonderes«, verteidigte sich Pam, in Erinnerung schwelgend. »Während der Schulzeit war ich in Boston. Er teilte seine Zeit zwischen uns und Maine auf, und so sah ich ihn nur selten. Aber die Ferien verbrachte ich immer in Timiny Cove. Mom blieb in Boston, und ich hatte Eugene ganz für mich. Er ließ sich bei den Minen von John vertreten, was John völlig wahnsinnig machte.«
Hillary konnte das verstehen. »Er mochte Timiny Cove ebensowenig wie deine Mutter.«
»So ist es. Er wollte in der Stadt sein. Da tut sich was, sagte er. In der Prärie tut sich nichts.«
Hillary erinnerte sich mit einem Kichern. »In der Prärie.«
»Du hast das Leben dort auch gehaßt. Ständig löchertest du mich mit allen möglichen Fragen über das Leben in der Stadt – weißt du noch?«
»Hm. Eine bizarre Situation. Ich war zehn Jahre älter als du, aber ich hungerte nach Informationen. Einige bekam ich von John, aber nie genug. Er hielt immer etwas zurück, um meine Neugier zu erhalten. Du erzähltest mir alles, was du wußtest.«
»Was nicht besonders viel war.«
»Für mich schon. Außerdem mochte ich dich.«
»Weil ich Johns Schwester war?«
»Nein. Na ja – vielleicht am Anfang. Aber ich mochte dich wirklich. Du hattest Ausstrahlung, es war lustig mit dir. Ich war glücklich.«
»Außer wenn ich Wutanfälle hatte«, sagte Pam und zog eine Grimasse. Dann wurde ihr Blick nachdenklich. »Ich habe die Zeit in Timiny Cove immer genossen. Das Haus war groß und luftig, und die Leute waren freundlich und interessant.«
»Interessant?«
»Sie waren farbenfroh.«
»Farbenfroh?«
»Ja, das waren sie, Hillary. Wie sonst würdest du Phoebe Hanks, Rufus Hacket oder Dwayne Wardell beschreiben? Mein Gott«, sie seufzte lächelnd, »sie waren phantastisch. Phoebe und ihre Häkelnadel, mit der sie eine unsägliche Unterhose nach der anderen fabrizierte, Rufus mit seinen Backenhörnchen-Wangen und dem zahnlosen Grinsen und den Witzen, deren Pointen er grundsätzlich verhunzte, Dwayne mit seiner strengen Miene unter der Igelfrisur – und alle hatten sie Herzen aus Gold. Daddy und ich pokerten immer mit Rufus und Dwayne. Ich erinnere mich so deutlich daran ...«
Und so begann es. Hillary hatte nicht darum gebeten, aber es war einfach, Pams Redefluß am Fließen zu halten. Eine Frage hier, ein ungläubiger Blick dort, ein Nachhaken brachten Pams einzigartige Eindrücke aus Timiny Cove ans Tageslicht. Sie akzeptierte Hillarys Neugier bezüglich dieser Eindrücke als selbstverständlich, und auch Hillarys Fragen zu Eugene St. George und – natürlich – John erschienen ihr völlig normal.
Während Hillary aufmerksam zuhörte und alle Informationen wie gewohnt speicherte, plante ein entfernter Winkel ihres Gehirns andere Mittagessen voraus, andere Morgen, Nachmittage oder Abende, die sie mit Pam, Patricia oder Cutter verbrachte. Sie würde ihnen sagen, was sie plante, weil ihr unendlich viel an ihnen lag, und wenn sie Bedenken hätten, würde sie das eine oder andere private Kapitel entschärfen. Bei ihnen würde sie Rücksicht üben.
Bei John würde sie gnadenlos sein.
DRITTES KAPITEL
Timiny Cove, 1964
Pam lernte zu bluffen, als sie acht Jahre alt war – beim Pokern im Hinterzimmer von Leroy Robichauds Kolonialwarenladen. Zu Anfang tat sie es nicht absichtlich. Sie war naiv und mit Begeisterung bei der Sache, und sie wagte es, ihre Pennies auf ein Blatt zu setzen, das keiner der anderen hätte haben wollen – weil sie nicht wußte, wie es war, wenn das Überleben von ein paar Pennies abhing.
Die Männer der Runde wußten das sehr wohl. Rufus Hackett und Dwayne Wardell mußten noch heute mit ihrem Geld haushalten, wenn auch nicht annähernd so streng wie vor den großen Halbedelsteinfunden, und Eugene – nun, Eugene erinnerte sich noch. Er erzählte Pam Geschichten aus den Tagen, als er von der Hand in den Mund lebte. Sie lauschte seinen Erzählungen mit großen Kinderaugen, doch sie wirkten wie Märchen auf sie. Nichts in ihrem Leben erinnerte auch nur im entferntesten an jene harten Zeiten in den zwanziger und dreißiger Jahren. In den vierziger Jahren hatte Eugene den Turmalinabbau bereits zu einem lukrativen Unternehmen gemacht, und in den Fünfzigern, als sie geboren wurde, gehörten ihm das Stadthaus an Bostons Beacon Hill, das stattliche Ziegelhaus in Timiny Cove und der Cadillac. Aber sie hörte sich seine Geschichten stundenlang an, weil es ihr Vater war, der sie erzählte, und weil sie ihn anbetete.
»Ich erhöhe, Missy«, verkündete Dwayne, nachdem er die Karten in seiner Hand mit ernster Miene betrachtet hatte, und warf zwei Pennies in den Pott.
Pam studierte die ihren. Es war kein besonders gutes Blatt – es war keine der Bildkarten dabei, die sie mochte –, aber sie hatte ein Paar Vieren, und ein Paar von irgendwas war besser als nichts.
»Ich will sehen«, beschloß sie, schob einen weiteren Penny in die Mitte des Tisches und grinste Dwayne an.
»Du solltest aber aussteigen wie dein Daddy und Rufus«, informierte er sie.
Als Eugene sich herüberbeugte, um einen Blick auf Pams Karten zu werfen, riß sie sie weg und drückte sie an die Brust. »Ich kann es, Daddy«, flüsterte sie.
»Du weißt, wie?« flüsterte er zurück.
»Ja.« Sie zog eine Kreuz Zwei und eine Karo Drei aus ihrem Blatt, legte sie vorsichtig auf den Tisch und nahm die beiden Karten, die Eugene ihr reichte: eine Herz Neun und eine Pik Drei. Sie verbesserten ihr Blatt um kein Jota, und dennoch weitete sie ihre Augen eine Spur in gespielter Erregung, bevor sie sich – angeblich – wieder faßte und Dwayne gelassen anschaute. Er hatte sie scharf beobachtet, und genau darauf hatte sie spekuliert. Sie kannte Dwayne. Er war von den dreien am leichtesten reinzulegen, aus dem einfachen Grund, weil er selbst keine Kinder hatte, die ihn an der Nase herumführten. Er wußte, daß Kinder Süßigkeiten mochten, und hatte immer einen Lutscher in der Brusttasche seines ausgebleichten Flanellhemdes, den er Pam gab, bevor sie nach Hause zurückkehrte.
Während er ernst sein Blatt studierte, beugte sich Rufus zu ihr herüber. »Ich habe einen guten für dich, Pammy – es ist ein Vertreterwitz.«
»Okay«, sagte Pam. Manchmal versuchte Rufus sie mit einem Witz abzulenken, doch da Dwayne im Moment derjenige war, der sich konzentrierte, wollte sie ihn hören. »Erzähl!«
»Also: Es war einmal ein Handelsvertreter, der hatte ein Pferd. Die beiden waren unten in Rumford, als das Pferd plötzlich tot umfiel.«
»Ruhe!« grollte Dwayne. »Ich kann nicht nachdenken.«
Rufus senkte seine Stimme. »Also – das alte Pferd stirbt in der Piscatawogue Street, und es sammelt sich eine Menschenmenge darum, und schon bald kommt ein Polizist, um einen Bericht aufzunehmen. Als erstes will er wissen, wie man Piscatawogue schreibt, und die Leute schauen einander hilflos an. Keiner weiß, wie man den Straßennamen buchstabiert.«
»Rufus!« beschwerte sich Dwayne.
»Und weil keiner weiß, wie man Piscatawogue schreibt, klappt der Polizist sein Buch zu und sagt zu den Leuten: Okay, Jungs – helft mir, das Pferd in die nächste Straße rüberzutragen.«
Pam schwieg, schaute hilfesuchend zuerst ihren Vater und dann Dwayne an.
Die Karten an seine Brust drückend, tadelte Dwayne: »Nein, nein, nein – du hast wieder mal die Pointe versaut. Es muß heißen: Okay Jungs – helft mir, das Pferd in die Main Street rüberzutragen.«
Jetzt lachte Pam, weil sogar sie »Main« buchstabieren konnte – und weil Eugene lachte, was immer eine Wonne für sie war, denn in Boston lachte er nicht oft.
Dann kam Bewegung in Dwayne. Er warf drei Karten verdeckt auf den Tisch und ließ sich von Eugene drei neue geben, woraufhin seine Miene sich noch mehr verfinsterte. Mit einem angewiderten Blick zu Rufus legte er aus, ließ ein Siebener-Paar, eine Herz-Königin, einen Kreuz-König und eine Karo Zwei auf den Tisch knallen.
Ihre Karten neben den seinen auffächernd, ließ Pam die anderen ihr Vierer-Paar betrachten, während sie mit ihren kleinen Händen die Pennies zu sich heranholte.
Jetzt lachte Eugene noch herzlicher. »Du bist ein Wunder, Pammy-Mädchen!« sagte er, sammelte die Karten ein und mischte sie, bevor er für eine neue Runde austeilte.
Pam strahlte. Sie vergötterte ihren Vater. Er war ein allseits beliebter Mann, ein Mann, dessen Stimme wie Donner durch das Haus hallte, wenn etwas nicht in Ordnung war – aber der Donner richtete sich nicht gegen sie. Manchmal brüllte er ihre Mutter an und sehr viel häufiger John, aber niemals sie. Sie sei sein ganz besonderes Juwel, sagte er zu ihr, und obwohl sie inzwischen zu groß war, um auf seinen Schultern zu reiten, wie sie es früher getan hatte, wenn er sie in die Edelsteingruben mitnahm, sagte er noch immer diese Worte. Ein eben zutage gefördertes Stück Turmalin in der Hand haltend, bewunderte er in einem Moment dessen Schönheit und sagte im nächsten: »Aber du bist mein ganz besonderes Juwel, Pammy-Mädchen.«
Mit den Augen ihrer Mutter sah sie ihn als Mann. »Dein Vater ist der bestaussehende von allen gutaussehenden Männern dieser Welt«, erklärte Patricia ihrer Tochter, als diese nicht älter als drei oder vier Jahre alt war. »Ich werde nie den Tag vergessen, als er in die Bank kam und ich ihn das erste Mal sah. So breitschultrig und selbstsicher. Er raubte mir den Atem ...«
»Deine Mutter war damals kaum neunzehn«, warf ihr Vater liebevoll spöttelnd ein. »Nahezu alles raubte ihr den Atem. Sie war eine Schönheit – was sie auch heute noch ist –, aber mit ihren vor Aufregung rosigen Wangen sah sie besonders hübsch aus.«
»Wie alt warst du, Daddy?«
»Ich war ein alter Mann.«
»Das war er nicht«, protestierte Patricia, die diese Äußerung als persönliche Beleidigung auffaßte. »Er war siebenundvierzig, und körperlich und gefühlsmäßig jünger als viele Fünfundzwanzigjährige. Als er seinerzeit in die Bank kam, wußte ich sofort, daß er der Mann war, auf den ich gewartet hatte, obwohl ich mir keinerlei Chancen ausrechnete, ihn bekommen zu können.«
»Sie liebte mein Haus«, sagte Eugene augenzwinkernd, und Patricia beeilte sich zu versichern, daß es nicht nur das gewesen sei. Allerdings wußte sogar Pam, wieviel Beacon Hill ihr bedeutete. Jedesmal, wenn sie nach Hause kam und, von neidischen Passanten beobachtet, die Steinstufen hinaufstieg, wurde Patricias Freude offenbar.
Es war ein Leben wie im Märchen, dachte Pam – besonders, wenn sie zusah, wie ihre Eltern sich für einen Ball feinmachten. Ihre Mutter war so schön, wie ihr Vater sagte, klein und biegsam, mit feinen Zügen und blonden, langen Haaren, die wie ein seidiger Schleier herabfielen, glatt wie die von Pam, aber Pams waren dunkel. Vielleicht lag es an diesem Farbunterschied, daß Pam nicht die zwischen Töchtern und Müttern üblichen Vergleiche anstellte. Sie sah anders aus, aber ebenso hübsch, wie sie annahm, weil ihr Vater das ständig zu ihr sagte, und sie glaubte, was ihr Vater sagte.
Ihr Vater war ihr Held. Er war größer als die meisten Männer, die sie bisher gesehen hatte, hatte dichtere Haare – dick und silbrig – und rotere Wangen. Ihre Mutter sagte immer, er habe eine gesunde Gesichtsfarbe und einen gesunden Körper, während er sich in der Spiegeltür des Kleiderschranks musterte. Und wenn seine Fliege korrekt gebunden war und seine Smokingjacke sich glatt über seinen Schultern spannte, dann sah Pam es selbst: Er sah fabelhaft aus – wie Wendys Vater in »Peter Pan«. Pam wußte, daß er ihrer Mutter am besten gefiel, wenn er sich feingemacht hatte und sie ausgingen. »Um zu sehen und gesehen zu werden«, sagte sie dann zu Pam. »Es ist sehr wichtig. Der Name deines Vaters wird gerade erst bekannt. Eines Tages wird er ein sehr wichtiger Mann in dieser Stadt sein.«
»Was meinst du damit?« fragte Pam ein wenig unsicher, weil der Ausdruck in den Augen ihrer Mutter besagte, daß sich einiges ändern könnte, und Pam dieser Gedanke nicht behagte. Ihr gefiel ihr Leben, wie es war – sie konnte sich nicht vorstellen, wie es noch besser werden sollte.
»Er wird zum Beispiel reich sein.«
»Ist er das denn noch nicht?«
»Im Moment sind wir wohlhabend.«
»Aber wir haben zwei Häuser. Melissa Gentile sagt, damit seien wir reich. Sie hat keine zwei Häuser.«
»Aber das eine, das sie hat, ist viel schöner als unsere.«
»Ich mag unsere.«
»Melissas ist größer. Es ist ein Gut mit viel Land dabei.«
»Unser Grundstück in Timiny Cove ist auch groß, und unser Haus ist das schönste in der ganzen Stadt.«
Patricia stieß einen Laut aus, der ihren Abscheu ausdrückte.
»Timiny Cove ist schmutzig. Es ist schäbig und arm.«
»Ich mag Timiny Cove«, beharrte Pam, obwohl sie schon früh lernte, daß sie ihre Mutter bezüglich Timiny Cove nicht umstimmen konnte. »Was wird Daddy noch machen?«
»Außer viel Geld verdienen, meinst du? Er wird ein Büro haben, das noch eleganter ist als sein jetziges. Vielleicht gehört ihm sogar das Gebäude, in dem es untergebracht ist, und wenn ihm das nicht gehört, werden ihm andere gehören. Immobilien sind eine gute Investition. Sie sind eine gute Möglichkeit, Geld zu verdienen.«
»Aber er hat doch schon eine Menge Geld – weshalb braucht er denn noch mehr?«
»Zur Sicherheit«, erklärte Patricia in einem Ton, der keinen Zweifel an der Richtigkeit zuließ. »Du bist ein sehr glückliches, kleines Mädchen, Pamela: Du weißt nicht, wie es ist, ohne Geld leben zu müssen. Ich erinnere mich noch an die Zeit, als ich drei Jahre lang dasselbe Paar Schuhe tragen mußte, obwohl meine Füße schon nach einem zu groß geworden waren. Ich erinnere mich noch daran, wie meine Mutter mich zum Metzger um ein kleines Stück Suppenfleisch schickte: Sie wußte, daß ich nicht genug Geld dabei hatte, aber sie hoffte, daß der Metzger aus Mitleid ein Auge zudrücken würde. Ich erinnere mich ...«
Die »Ich erinnere mich«-Geschichten ihres Vaters waren voller Wärme und Spaß. Trotz der Entbehrungen, die er beschrieb, verriet seine Stimme, daß er jene Tage geschätzt hatte, als er das Beste aus dem schlechten Blatt machte, das ihm ausgeteilt worden war. Wenn Patricia über die alten Zeiten sprach, war weder Wärme noch Spaß noch Wertschätzung ihrer Stimme zu entnehmen. Ihr Ton war hart. Alles an ihr war hart, wenn sie über die alten Zeiten sprach, und falls Pam an sie gelehnt dagesessen hatte, dann war nun der Augenblick gekommen, da sie aufstand und sich auf den Boden setzte oder im Zimmer herumwanderte. Ihre Mutter war nicht glücklich, wenn sie über die Vergangenheit sprach. Manchmal war sie auch nicht viel glücklicher, wenn sie über die Gegenwart sprach.