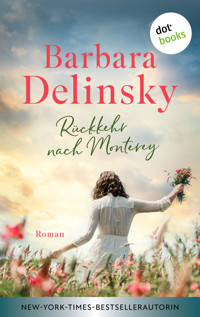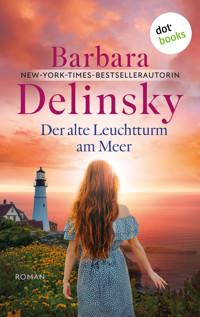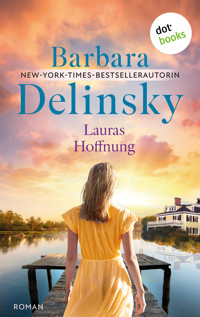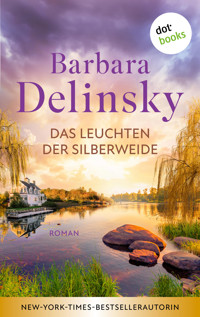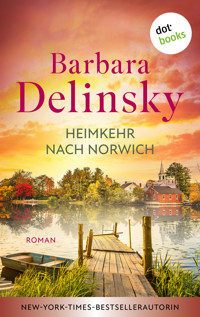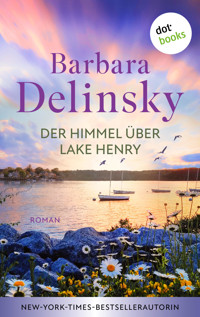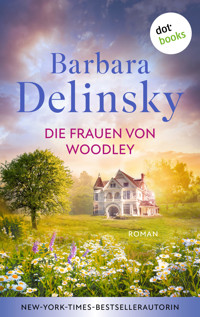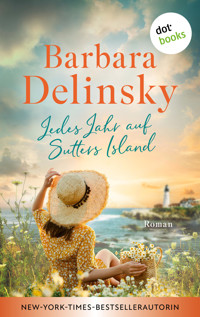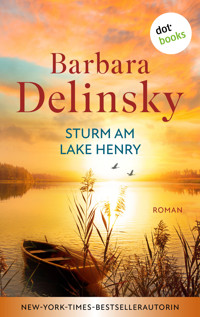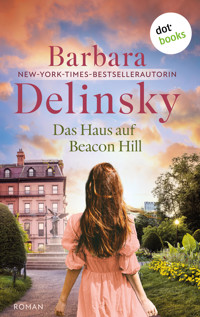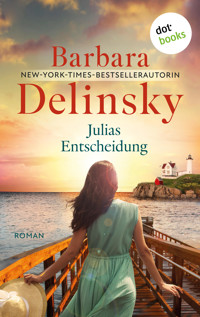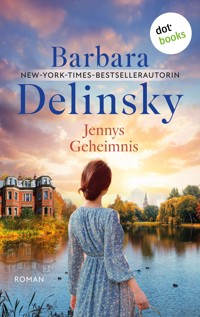5,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Um uns her die Dunkelheit, zwischen uns das Licht … Der Schicksalsroman »Im Schatten meiner Schwester« von Barbara Delinsky als eBook bei dotbooks. Schon immer hatte Molly das Gefühl, in ihrem eigenen Leben nur eine Randfigur zu sein, während ihre talentierte ältere Schwester Robin alle Aufmerksamkeit auf sich zog. Doch mit einem Schlag verändert sich alles: Nach einem Unfall fällt Robin ins Koma – und plötzlich ruht die Last auf Mollys Schultern, die alte Familiengärtnerei weiterzuführen und für ihre Familie stark zu sein. Aber dafür muss das Schweigen zwischen ihnen endlich aufhören: Warum konnte Mollys Mutter sie niemals so lieben wie ihre Schwester? Was geschieht mit ihrer Großmutter, die sie plötzlich nicht mehr erkennt? Fest entschlossen forscht Molly nach Antworten – denn dort, wo Schmerz ist, kann sich auch Hoffnung finden … In leisen Tönen und eindringlichen Bildern erzählt New-York-Times-Bestsellerautorin Barbara Delinsky davon, wie zerbrechlich eine Familie sein kann – und wie unvergleichlich stark. Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der bewegende Roman »Im Schatten meiner Schwester« von Barbara Delinsky – für alle Fans von Kristin Hannah und Jodi Picoult. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 456
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über dieses Buch:
Schon immer hatte Molly das Gefühl, in ihrem eigenen Leben nur eine Randfigur zu sein, während ihre talentierte ältere Schwester Robin alle Aufmerksamkeit auf sich zog. Doch mit einem Schlag verändert sich alles: Nach einem Unfall fällt Robin ins Koma – und plötzlich ruht die Last auf Mollys Schultern, die alte Familiengärtnerei weiterzuführen und für ihre Familie stark zu sein. Aber dafür muss das Schweigen zwischen ihnen endlich aufhören: Warum konnte Mollys Mutter sie niemals so lieben wie ihre Schwester? Was geschieht mit ihrer Großmutter, die sie plötzlich nicht mehr erkennt? Fest entschlossen forscht Molly nach Antworten – denn dort, wo Schmerz ist, kann sich auch Hoffnung finden …
In leisen Tönen und eindringlichen Bildern erzählt New-York-Times-Bestsellerautorin Barbara Delinsky davon, wie zerbrechlich eine Familie sein kann – und wie unvergleichlich stark.
Über die Autorin:
Barbara Delinsky wurde 1945 in Boston geboren und studierte dort Psychologie und Soziologie. Nach der Geburt ihres ersten Sohnes arbeitete sie als Fotografin für den Belmont Herald, erkannte aber bald, dass sie viel lieber die Texte zu ihren Fotos schrieb. Ihr Debütroman wurde auf Anhieb zu einem großen Erfolg. Inzwischen hat Barbara Delinsky über 70 Romane veröffentlicht, die in mehr als 20 Sprachen übersetzt wurden und regelmäßig die New-York-Times-Bestsellerliste stürmen. Sie engagiert sich außerdem sehr stark für Wohltätigkeitsvereine und Aufklärung rund um das Thema Brustkrebs. Barbara Delinsky lebt mit ihrem Mann in New England und hat drei erwachsene Söhne.
Die Website der Autorin: barbaradelinsky.com/
Bei dotbooks veröffentlichte Barbara Delinsky auch ihre Romane:
»Die Schwestern von Star’s End«
»Jennys Geheimnis«
»Das Weingut am Meer«
»Julias Entscheidung«
»Lauras Hoffnung«
»Die alte Mühle am Fluss«
»Der alte Leuchtturm am Meer«
»Sturm am Lake Henry«, Die Blake-Schwestern 1
»Der Himmel über Lake Henry«, Die Blake-Schwestern 2
»Heimkehr nach Norwich«
»Das Leuchten der Silberweide«
»Das Licht auf den Wellen«
»Die Frauen Woodley«
»Ein Neuanfang in Casco Bay«
»Rückkehr nach Monterey«
»Drei Wünsche hast du frei«
»Ein ganzes Leben zwischen uns«
»Jedes Jahr auf Sutters Island«
»Was wir nie vergessen können«
***
eBook-Neuausgabe November 2023
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 2009 unter dem Originaltitel »While my Sister Sleeps« bei Doubleday, New York.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 2009 by Barbara Delinksy.
Published by Arrangement with Barbara Delinsky
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2011 bei Knaur Taschenbuch. Ein Unternehmen der Droemerschen Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. GmbH & Co. KG, München.
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-98690-873-7
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: info@dotbooks.de. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Im Schatten meiner Schwester« an: lesetipp@dotbooks.de (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Barbara Delinsky
Im Schatten meiner Schwester
Roman
Aus dem Amerikanischen von Tina Thesenvitz
dotbooks.
Für Andrew und Julie
für immer
Kapitel 1
Es gab Tage, da liebte Molly Snow ihre Schwester, doch der heutige gehörte nicht dazu. Sie war in der Dämmerung aufgestanden, um Robins Wasserträgerin zu sein, nur um dann zu erfahren, dass Robin ihre Meinung geändert und beschlossen hatte, ihre Langstrecke am späten Nachmittag zu laufen, und dass sie selbstverständlich erwartete, dass Molly sich nach ihr richtete. Und warum auch nicht? Robin war eine Weltklasseläuferin – eine Marathonläuferin mit Dutzenden von Siegen an ihrem Gürtel, unglaublichen Statistiken und einer ernsthaften Chance, es zu den Olympischen Spielen zu schaffen. Sie war daran gewöhnt, dass die Menschen ihre Pläne änderten, um sie ihren anzupassen. Sie war der Star.
Molly hasste das zum millionsten Mal, und obwohl Robin ihr vom Schlafzimmer ins Bad und wieder zurück folgte, weigerte sie sich nachzugeben. Robin hätte locker heute Morgen laufen können; sie wollte einfach nur mit einer Freundin frühstücken. Als ob Molly das nicht selbst auch gerne täte! Doch das konnte sie nicht, da ihr Tag angefüllt war. Sie musste um sieben in Snow Hill sein, um das Gewächshaus zu versorgen, bevor die Kunden kamen, musste einkaufen, den Bestand und die Verkäufe überprüfen und für die Weihnachtszeit vorbestellen; und zusätzlich zu ihren eigenen Aufgaben musste sie auch noch für ihre Eltern einspringen, die auf Reisen waren. Das bedeutete, dass sie sich um alle Fragen kümmern musste, die auftauchten, und schlimmer noch, eine Geschäftsführungssitzung leiten musste – nicht gerade das, was Molly unter Spaß verstand.
Ihre Mutter wäre nicht darüber erfreut, dass sie Robin im Stich gelassen hatte, doch Molly fühlte sich zu überlastet, als dass es sie scherte.
Die gute Nachricht war, dass sie, wenn Robin am späten Nachmittag liefe, draußen wäre, wenn Molly nach Hause kam. Während die Sonne durch das offene Fenster schien und ihr Gesicht bräunte, schmolz Molly dahin, als sie von Snow Hill zurückfuhr. Sie holte die Post aus dem Kasten an der Straße, ohne sich zu fragen, warum ihre Schwester das niemals tat, und bog knirschend in die Auffahrt ein. Die Rosen waren von einem sanften Pfirsichrot, und ihr Duft war umso kostbarer, als ihnen nur eine kurze Lebenszeit beschieden war. Dahinter standen die Hortensien, die sie gepflanzt hatte und die durch einen Hauch von Aluminium, etwas darüber gestreuten Kaffeesatz und viel TLC wunderbar blau geworden waren.
Molly parkte unter der Pinie, die das Cottage beschattete, in dem sie und Robin seit zwei Jahren zur Miete wohnten, aber das sie bald verlieren würden, öffnete den Kofferraum des Jeeps und begann abzuladen. Sie war fast am Haus und jonglierte gerade mit einem herabhängenden doppelblättrigen Philodendron, einem Korb voller Kürbisse und einem Katzenkorb, als ihr Handy klingelte.
Sie konnte es schon hören. Es tut mir leid, dass ich heute Morgen geschrien habe, Molly, aber wo bist du jetzt? Mein Auto will nicht anspringen, und ich bin mitten im Nirgendwo und völlig kaputt.
Molly verteilte ihre Lasten, um einen Schlüssel zur Hand zu haben, als es erneut klingelte. Ein drittes Läuten ertönte, als sie sich hinkniete, um die Sachen gleich hinter der Tür abzuladen. In dem Moment setzte das Schuldgefühl ein. Sekunden bevor die Mailbox ansprang, zog sie das Handy aus ihrer Jeans und klappte es auf.
»Wo bist du?«, fragte sie, doch die Stimme am anderen Ende gehörte nicht Robin.
»Ist da Molly?«
»Ja.«
»Ich bin Oberschwester im Dickenson-May Memorial. Es hat einen Unfall gegeben. Ihre Schwester befindet sich in der Notaufnahme. Wir möchten gerne, dass Sie kommen.«
»Ein Autounfall?«, fragte Molly erschrocken.
»Ein Laufunfall.«
Molly ließ den Kopf hängen. Noch einer. O Robin, dachte sie und spähte in den Tragekorb, besorgter um die kleine bernsteinfarbene Katze, die dort drinnen kauerte, als um ihre Schwester. Robin war eine chronische Draufgängerin. Sie behauptete immer, die Belohnung sei es wert, aber was war mit dem Preis? Ein gebrochener Arm, eine ausgerenkte Schulter, verstauchte Knöchel, Fußsohlenschmerz, ein Neurom – es gab nichts, was sie noch nicht gehabt hatte. Dagegen war diese kleine Katze ein unschuldiges Opfer.
»Was ist passiert?«, fragte Molly zerstreut und gab leise Geräusche von sich, um die Katze herauszulocken.
»Das wird der Arzt Ihnen erklären. Wohnen Sie weit weg?«
Nein, nicht weit. Doch die Erfahrung hatte sie gelehrt, dass sie nur auf die Ergebnisse des Röntgens würde warten müssen, noch länger auf eine Magnetresonanztomographie. Sie griff in den Korb und zog die Katze sanft hervor. »Ich bin zehn Minuten weg. Wie ernst ist es?« »Das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber wir brauchen Sie hier.«
Die Katze bebte heftig. Sie war mit zehn anderen Katzen eingesperrt in einer Scheune aufgefunden worden. Der Tierarzt nahm an, dass sie knapp zwei Jahre alt war. »Meine Schwester hat ihr Telefon bei sich«, versuchte es Molly, die wusste, dass sie, wenn sie direkt mit Robin sprechen könnte, mehr erfahren würde. »Hat sie Handyempfang?«
»Nein. Tut mir leid. Die Nummer Ihrer Eltern steht zusammen mit Ihrer hier auf ihrem Schuhschild. Wollen Sie sie anrufen, oder soll ich?«
Wenn die Schwester den Schuh in der Hand hielt, dann steckte dieser nicht an Robins Fuß. Eine gerissene Achillessehne? Unwillkürlich besorgt, sagte Molly: »Sie sind nicht im Lande.« Sie probierte es mit Humor. »Ich bin ein großes Mädchen. Ich kann einiges vertragen. Können Sie mir einen Hinweis geben?«
Doch die Schwester war immun gegen Charme. »Der Arzt wird es Ihnen erklären. Kommen Sie?«
Hatte sie eine andere Wahl?
Resigniert nahm Molly die Katze auf den Arm und trug sie in ihr Schlafzimmer im Rückteil des Cottages. Nachdem sie sie in den Falten eines Kissens abgelegt hatte, stellte sie Katzenklo und Futter in die Nähe und setzte sich dann auf den Bettrand. Sie wusste, es war blöd, ein Tier hierherzubringen, mussten sie doch in einer Woche ausziehen, aber ihre Mutter weigerte sich, noch eine Katze in der Gärtnerei zu halten, und diese hier brauchte ein Heim. Der Tierarzt hatte sie einige Tage behalten, doch sie hatte sich mit den anderen Tieren nicht gut verstanden. Sie war nicht nur unterernährt, sie sah aus, als ob sie mehr als nur einen Kämpf verloren hätte. Ihr kleiner Körper war in Alarmbereitschaft, als würde sie einen neuen Schlag erwarten.
»Ich werde dir nicht weh tun«, flüsterte Molly beruhigend und kehrte in den Flur zurück, um der Katze Raum zu lassen. Sie ließ Wasser auf den Philodendron träufeln – zu viel zu schnell würde ihn nur ertränken –, trug ihn dann auf den Dachboden und stellte ihn direkt ins Licht. Auch der hier brauchte TLC. Aber später.
Zuerst eine Dusche. Es würde schnell gehen müssen, sie konnte das Krankenhaus nicht ewig aufschieben. Doch das Gewächshaus war heiß im September, und nach einer größeren Lieferung von Herbstpflanzen hatte sie fast den ganzen Nachmittag damit verbracht, Kisten zu zerbrechen, Töpfe umzustellen, Auslagen neu zu drapieren und zu schwitzen.
Die Dusche klärte ihre Gedanken. Als sie jedoch wieder in ihrem Zimmer war, um sich anzuziehen, konnte sie die Katze nicht finden. Sie rief leise nach ihr, sah unters Bett, in den offenen Schrank und hinter einen Stapel Kartons. Sie suchte in Robins Zimmer, dem kleinen Wohnzimmer, sogar in dem Kürbiskorb – den sie auch noch einpacken musste, doch er befriedigte nur ein ästhetisches Bedürfnis und konnte leicht eine kleine Katze verbergen.
Sie hätte noch weitergesucht, wenn ihr Gewissen sich nicht zu regen begonnen hätte. Robin war im Krankenhaus in guten Händen, doch da ihre Eltern sich irgendwo zwischen Atlanta und Manchester befanden und ihr Name als Erster auf dem Schild stand, musste Molly sich auf die Socken machen.
Sie ließ ihr langes Haar sich beim Trocknen locken und zog saubere Jeans und ein T-Shirt an. Dann fuhr sie mit dem Handy im Schoß los, da sie ernsthaft erwartete, dass Robin anrufen würde. Sie würde nachgiebig und kleinlaut sein – außer es wäre wirklich eine gerissene Achillessehne, was eine Operation und Wochen bedeuten würde, in denen sie nicht laufen könnte. Wenn das der Fall wäre, hätten sie alle ein Problem. Eine unglückliche Robin war ein Elend, und das Timing dieses Unfalls hätte nicht schlechter sein können. Die fünfzehn Meilen von heute waren eine Vorbereitung für den New- York-Marathon. Wenn sie dort unter den ersten zehn besten amerikanischen Frauen landete, wäre das ein Platz für sie bei den Olympischen Wettkämpfen im nächsten Frühjahr.
Das Telefon klingelte nicht. Molly war sich nicht sicher, ob das gut oder schlecht war, doch sie sah keinen Sinn darin, eine Nachricht für ihre Mutter zu hinterlassen, bis sie mehr wüsste. Kathryn und Robin waren an der Hüfte miteinander verbunden. Wenn Robin einen eingewachsenen Zehennagel hatte, spürte Kathryn den Schmerz.
Es war schön, so geliebt zu werden, meckerte Molly und empfand mit dem nächsten Atemzug bereits Reue. Robin hatte schwer gearbeitet, um dahin zu gelangen, wo sie jetzt war. Und he, Molly war am Renntag genauso stolz auf sie wie alle anderen.
Es kam ihr nur so vor, als ob Rennen das Leben von ihnen allen beherrschen würde.
Von Abneigung zu Reue und wieder zurück war so ein langweilig endloser Kreislauf, dass Molly froh war, als sie endlich vor dem Krankenhaus vorfuhr. Das Dickenson-May lag auf einer Klippe über dem Connecticut River im Norden der Stadt. Die Kulisse wäre zauberhaft gewesen, wenn es nicht die Gründe gegeben hätte, aus denen die Leute hier waren.
Molly eilte hinein, nannte am Empfang der Notaufnahme ihren Namen und fügte hinzu: »Meine Schwester ist hier.«
Eine Schwester näherte sich und machte ihr ein Zeichen zu einer Kabine am Ende des Flurs, wo sie erwartete, Robin zu sehen, die ihr von einer Trage aus zulächelte. Doch was sie sah, waren Ärzte und Apparate, und was sie hörte, war nicht das verlegene O Molly, ich habe es schon wieder geschafft ihrer Schwester, sondern das Flüstern düsterer Stimmen und das rhythmische Piepen von Apparaten. Molly sah nackte Füße – mit Hornhaut, eindeutig die von Robin –, doch sonst nichts von ihrer Schwester. Zum ersten Mal empfand sie Unruhe.
Einer der Ärzte kam zu ihr herüber. Es war ein hochgewachsener Mann mit einer großen schwarz gerahmten Brille. »Sind Sie ihre Schwester?«
»Ja.« Durch den Platz, den er frei gemacht hatte, erhaschte sie einen Blick auf Robins Kopf – kurzes dunkles Haar, das wie immer zerzaust war, doch ihre Augen waren geschlossen, und ein Schlauch klebte über ihrem Mund. Erschrocken flüsterte Molly: »Was ist los?« »Ihre Schwester hatte einen Herzinfarkt.«
Sie wich zurück. »Einen was?«
»Sie wurde bewusstlos von einem anderen Läufer auf der Straße aufgefunden. Er wusste genug, um mit Wiederbelebungsmaßnahmen zu beginnen.«
»Bewusstlos? Aber sie ist doch wieder zu sich gekommen, oder?« Sie musste nicht bewusstlos sein. Ihre Augen könnten auch aus purer Erschöpfung geschlossen sein. Wenn man fünfzehn Meilen lief, konnte das passieren.
»Nein, sie ist noch nicht wieder zu sich gekommen«, antwortete der Arzt. »Wir haben Krankenhausberichte über sie herangezogen, doch da wird kein Herzproblem erwähnt.«
»Weil es keines gibt«, erwiderte Molly, schlüpfte hinter ihn und ging ans Bett. »Robin?« Als ihre Schwester nicht reagierte, sah sie zum Schlauch. Er war nicht die einzige beunruhigende Sache.
»Der Schlauch verläuft zu einem Ventilator«, erklärte der Arzt. »Diese Drähte sind verbunden mit Elektroden, die ihren Herzschlag messen. Die Manschette misst ihren Blutdruck. Die Infusion ist für Flüssigkeit und Medikamente.«
»So viel so schnell?« Molly schüttelte vorsichtig Robins Schulter. »Robin? Kannst du mich hören?«
Robins Lider blieben zu. Ihre Haut war farblos.
Molly bekam es immer mehr mit der Angst zu tun. »Vielleicht wurde sie von einem Auto angefahren?«, fragte sie den Arzt, da dies mehr Sinn ergab, als dass Robin mit zweiunddreißig Jahren einen Herzinfarkt hatte.
»Es gibt keine andere Verletzung. Als wir die Brust geröntgt haben, um die Atemröhre zu untersuchen, konnten wir den Herzschaden sehen. Im Moment ist der Herzschlag normal.«
»Aber warum ist sie denn immer noch bewusstlos? Hat man ihr ein Beruhigungsmittel gegeben?«
»Nein. Sie hat immer noch nicht das Bewusstsein wiedererlangt.«
»Dann versuchen Sie es nicht genug«, beschloss Molly und rüttelte wie wild am Arm ihrer Schwester. »Robin? Wach auf!«
Eine große Hand legte sich beruhigend auf ihre. Leise sagte der Arzt: »Wir befürchten, es gibt einen Hirnschaden. Sie reagiert nicht. Ihre Pupillen reagieren nicht auf Licht. Sie reagiert nicht auf Stimmen. Kitzeln Sie sie am Zeh, piksen Sie sie am Bein, es gibt keine Reaktion.« »Sie kann doch keinen Hirnschaden haben«, beharrte Molly – vielleicht absurderweise, doch die ganze Szene war schließlich absurd. »Sie ist im Training.« Als der Arzt nichts entgegnete, wandte sie sich wieder an ihre Schwester. Die Apparate blinkten und piepten mit der Regelmäßigkeit von, ja, von Apparaten, doch sie waren unwirklich. »Herz oder Hirn – was nun?«
»Beides. Ihr Herz hat aufgehört zu pumpen. Wir wissen nicht, wie lange sie auf der Straße lag, bevor sie gefunden wurde. Eine gesunde Anfangdreißigerin könnte vielleicht zehn Minuten brauchen, bevor der Mangel an Sauerstoff einen Hirnschaden verursachen würde. Wissen Sie, wann sie angefangen hat zu laufen?«
»Sie plante, gegen fünf anzufangen, doch ich weiß nicht, ob sie es bis dahin geschafft hat.« Du hättest es wissen sollen, Molly. Du hättest es gewusst, wenn du sie selbst gefahren hättest. »Wo wurde sie gefunden?«
Der Arzt sah in seinen Papieren nach. »Gleich hinter Norwich. Das hieße etwas mehr als fünf Meilen von hier.«
Aber hin oder zurück? Es machte einen Unterschied, wenn sie versuchten abzuschätzen, wie lange sie bewusstlos gewesen war. Der Ort, wo ihr Auto stand, könnte etwas darüber aussagen, doch Molly wusste nicht, wo es war. »Wer hat sie gefunden?«
»Ich kann Ihnen seinen Namen nicht sagen, aber er ist wahrscheinlich der Grund, weshalb sie noch lebt.« Molly geriet in Panik und hielt sich die Stirn. »Sie könnte doch aufwachen, und alles wäre gut, oder?«
Der Arzt zögerte Sekunden zu lange. »Das könnte sie. Die nächsten ein, zwei Tage sind entscheidend. Haben Sie Ihre Eltern angerufen?«
Ihre Eltern. Ein Alptraum. Sie sah auf die Uhr. Sie waren noch nicht gelandet. »Meine Mom wird am Boden zerstört sein. Können Sie nicht etwas tun, bevor ich sie anrufe?«
»Wir wollen sie stabil haben, bevor wir sie verlegen.«
»Sie wohin verlegen?«, fragte Molly. Sie hatte ein blitzartiges Bild von der Leichenhalle vor sich. Zu viel CSI gesehen.
»Auf die Intensivstation. Dort wird man sie genau überwachen. «
Mollys Phantasie klebte an einem anderen Bild fest. »Sie wird doch wohl nicht sterben, oder?« Wenn Robin starb, dann wäre das ihre Schuld. Wenn sie da gewesen wäre, wäre das nicht passiert. Wenn sie nicht so eine miserable Schwester gewesen wäre, wäre Robin wieder im Cottage, würde Wasser in sich hineinkippen und ihre Zeiten aufzeichnen.
»Lassen Sie uns einen Schritt nach dem anderen machen«, riet der Arzt. »Erst einmal stabilisieren. Darüber hinaus ist alles wirklich nur eine Frage des Abwartens. Auf ihrem Schild ist kein Ehemann aufgelistet. Hat sie Kinder?« »Nein.«
»Nun, das ist immerhin etwas.«
»Nein, ist es nicht.« Molly war verzweifelt. »Sie verstehen nicht. Ich kann meiner Mutter nicht sagen, dass Robin hier so liegt.« Kathryn würde ihr die Schuld geben. Sofort. Noch bevor sie wüsste, dass es tatsächlich Mollys Schuld war. So war es schon immer gewesen. In den Augen ihrer Mutter war Molly fünf Jahre jünger und machte zehnmal mehr Ärger als Robin.
Molly hatte versucht, das zu ändern. Als sie erwachsen war, hatte sie Kathryn im Gewächshaus geholfen und in dem Maße, in dem Snow Hill wuchs, mehr Verantwortung auf sich genommen. Sie hatte dort im Sommer gearbeitet, während Robin trainierte, und hatte einen Abschluss in Gartenbau erworben, von dem Kathryn geschworen hatte, dass er ihr zustattenkommen würde. In Snow Hill zu arbeiten war keine große Mühe. Molly liebte Pflanzen. Aber sie liebte es auch, ihrer Mutter zu gefallen, was nicht immer so leicht war, da Molly sehr impulsiv war. Sie redete, ohne nachzudenken, sagte oft Dinge, die ihre Mutter nicht hören wollte. Und sie hasste es, Robins Ehrgeiz Vorschub zu leisten. Das war ihr allergrößtes Verbrechen.
Und nun wollte der Arzt, dass sie Kathryn anrief und ihr mitteilte, dass Robin vielleicht einen Hirnschaden hatte, weil sie, Molly, nicht für ihre Schwester da gewesen war?
Das war zu viel von ihr verlangt, fand Molly. Schließlich war sie nicht die Einzige in der Familie.
Während der Arzt sie erwartungsvoll anblickte, zog sie ihr Handy heraus. »Ich will meinen Bruder hier haben. Er muss helfen.«
Kapitel 2
Christopher Snow saß am Küchentisch und aß das Hüftsteak, das seine Frau gegrillt hatte. Erin saß zu seiner Rechten und zu seiner Linken ihre gemeinsame Tochter Chloe in ihrem Hochstuhl.
»Ist das Steak okay?«, fragte Erin, als er halb fertig damit war.
»Super«, antwortete er locker. Erin war eine gute Köchin. Er hatte niemals zu klagen.
Er bediente sich ein zweites Mal, pickte ein Körnchen Mais aus dem Salat und legte es auf das Tablett des Babys. »He«, sagte er sanft, »wie geht es meiner Hübschen?« Als das Kind lächelte, schmolz er dahin.
»Also«, setzte Erin an, »war dein Tag okay?«
Er nickte und schaufelte seinen Salat. Das Dressing war auch super. Selbst gemacht.
Das Baby kämpfte darum, das Körnchen aufzunehmen. Christopher war fasziniert von der Konzentration der Kleinen. Nach einer gewissen Zeit drehte er ihre Hand um und legte den glatten Kern in ihre Handfläche.
»Wie war dein Treffen mit den Samuel-Leuten?«, fragte Erin.
Er nickte und aß noch mehr Salat.
»Haben sie deinen Bedingungen zugestimmt?«, wollte sie wissen und klang ungeduldig. Als er nicht antwortete, fragte sie: »Ist es dir egal?«
»Natürlich ist es mir nicht egal. Aber sie brauchen noch eine Zeitlang, um die Zahlen durchzugehen, und deshalb liegt es jetzt nicht mehr in meinen Händen. Warum bist du so sauer?«
»Chris, das ist ein großes Projekt für Snow Hill. Du hast gestern die ganze Nacht damit verbracht, deine Präsentation vorzubereiten. Ich will wissen, wie es gelaufen ist.«
»Es ist gut gelaufen.«
»Das sagt mir nicht viel«, bemerkte sie. »Willst du es genauer erklären? Oder vielleicht willst du ja auch einfach nicht, dass ich es weiß.«
»Erin.« Er legte seine Gabel hin. »Wir haben darüber geredet. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Ich will mich jetzt davon lösen.«
»Ich auch«, stimmte Erin zu, »nur dass sich mein Tag um ein achtzehn Monate altes Kind dreht. Ich brauche das Gespräch mit Erwachsenen. Wenn du nicht über die Arbeit reden willst, worüber reden wir denn dann?« »Können wir nicht einfach das Schweigen genießen?«, fragte Chris. Er liebte seine Frau. Mit am besten an ihrer Beziehung war, dass sie nicht die ganze Zeit reden mussten. Zumindest hatte er das geglaubt.
Doch sie ließ ihn nicht vom Haken. »Ich brauche Anregung.«
»Liebst du Chloe denn nicht?«
»Natürlich liebe ich sie. Du weißt doch, dass ich sie liebe. Warum fragst du mich das dauernd?«
Er hob verwirrt die Hände. »Du hast gerade gesagt, dass sie nicht genug ist. Du warst diejenige, die sofort ein Baby wollte, Erin. Du warst diejenige, die mit dem Arbeiten aufhören wollte.«
»Ich war schwanger. Ich musste mit dem Arbeiten aufhören. «
Er wusste nicht, was er sagen sollte. Sie waren die Lieblingsneuverheirateten der ganzen Stadt gewesen, beide blond und grünäugig (Chris sagte immer, seine Augen seien haselnussfarben, doch der Unterschied war allen egal). Sie waren ein hinreißendes Paar gewesen.
Doch was nun mit ihnen passierte, war nicht so hinreißend. »Dann geh doch wieder arbeiten«, sagte er in dem Versuch, es ihr recht zu machen.
»Willst du, dass ich wieder arbeite?«
»Wenn du es willst.«
Sie starrte ihn mit diesen grünen Augen an, die jetzt Feuer sprühten. »Und was soll ich mit Chloe machen? Ich will sie nicht in eine Tagesbetreuung geben.«
»Okay.« Er hasste alle Streitereien, doch das hier war das Schlimmste. »Was willst du also?«
»Ich will, dass mein Mann beim Abendessen mit mir spricht. Ich will, dass er mit mir nach dem Abendessen spricht. Ich will, dass er mit mir über Dinge diskutiert. Ich will nicht, dass er nach Hause kommt und nur auf die Red Sox starrt. Ich will, dass er seinen Tag mit mir teilt.«
Ruhig erwiderte er: »Ich bin Buchhalter. Ich arbeite im Familienbetrieb. Es ist nichts Aufregendes an dem, was ich tue.«
»Ich würde ein neues Bauprojekt schon aufregend nennen. Aber wenn du es so hasst, dann geh doch.«
»Ich hasse es nicht. Ich liebe das, was ich tue. Ich sage nur, dass es kein tolles Gesprächsthema abgibt. Und ich bin heute Abend echt müde.« Und er wollte sich tatsächlich die Red Sox anschauen. Er liebte die Mannschaft.
»Meiner müde? Chloes müde? Ehemüde? Du hast früher immer mit mir geredet, Chris. Aber es ist, als ob nun, da wir verheiratet sind – nun, da wir ein Baby haben –, du dich nicht dazu aufraffen könntest. Wir sind neunundzwanzig Jahre alt, aber wir sitzen hier, als ob wir achtzig wären. Das haut bei mir nicht hin.«
Aus der Fassung gebracht, stand er auf und ging mit seinem Teller zum Spülbecken. Das haut bei mir nicht hin klang, als ob sie wegwollte. Das konnte er nicht verarbeiten.
Er wusste nicht mehr ein noch aus und hob das Baby hoch. Als die Kleine ihren Kopf an seine Brust legte, hielt er sie dort. »Ich versuche, dir ein gutes Leben zu bieten, Erin. Ich arbeite, damit du es nicht musst. Wenn ich abends müde bin, dann weil mein Geist den ganzen Tag beschäftigt war. Wenn ich ruhig bin, so bin ich vielleicht einfach so.«
Sie gab nicht nach. »So ein Mensch warst du aber vorher nicht. Was hat sich verändert?«
»Nichts«, antwortete er vorsichtig. »Aber das hier ist das Leben. Beziehungen entwickeln sich.«
»Das ist nicht einfach nur das Leben«, gab sie zurück. »Wir sind es. Und ich kann nicht ertragen, was aus uns wird.«
»Du bist erregt. Bitte beruhige dich.«
»Als ob das alles besser machen würde«, erwiderte sie
und wirkte wütender denn je. »Ich habe heute mit meiner Mutter geredet. Chloe und ich werden sie besuchen.«
Das Telefon klingelte. Er achtete nicht darauf, sondern fragte: »Für wie lange?«
»Ein paar Wochen. Ich muss mir über einiges klarwerden. Wir haben ein Problem, Chris. Du bist nicht ruhig, du bist passiv.« Das Telefon klingelte wieder. »Ich frage dich, was du davon hältst, Chloe in eine Spielgruppe zu geben, und du gibst die Frage an mich zurück. Ich frage dich, ob du die Bakers Samstagabend zum Essen einladen willst, und du sagst mir, ich solle tun, was ich will. Das sind keine Antworten«, sagte sie, als es erneut klingelte. »Es sind Ausflüchte. Fühlst du überhaupt etwas, Chris?«
Er war unfähig zu antworten und griff nach dem Telefon. »Ja.«
»Ich bin’s«, sagte seine Schwester mit hoher Stimme. »Wir haben ein ernstes Problem.«
Er drehte sich von seiner Frau weg und zog den Kopf ein. »Nicht jetzt, Molly.«
»Robin hatte einen Herzinfarkt.«
»Äh ... kann ich dich zurückrufen?«
»Chris, ich brauche dich jetzt hier! Mom und Dad wissen es noch nicht.«
»Wissen was nicht?«
»Dass Robin einen Herzinfarkt hatte«, rief Molly. »Sie ist mitten beim Laufen umgekippt und immer noch bewusstlos. Mom und Dad sind noch nicht gelandet. Ich kann das nicht allein machen.«
Erin stellte sich neben ihn. »Dein Dad?«, flüsterte sie, während sie ihm Chloe abnahm.
Er schüttelte den Kopf und ließ das Kind los. »Robin. O Junge, sie hat sich überfordert.« »Wirst du kommen?«, fragte Molly.
»Wo bist du?« Er hörte ihr eine Minute zu, dann legte er auf.
»Ein Herzinfarkt?«, fragte Erin. »Robin?«
»Das hat Molly jedenfalls gesagt. Vielleicht übertreibt sie ja auch. Sie steigert sich manchmal in etwas hinein.« »Weil sie Gefühle zeigt?«, schoss Erin zurück, wurde dann jedoch sanfter. »Wo sind deine Eltern?«
»Auf dem Nachhauseflug von Atlanta. Ich fahre besser hin.«
Er strich Chloe über den Kopf und berührte in einer versöhnenden Geste Erins. An sie dachte er, als er sich auf den Weg machte. Sie waren erst seit zwei Jahren verheiratet, eineinhalb Jahre davon mit einem Kind, und er versuchte zu verstehen, wie dramatisch sich ihr gemeinsames Leben verändert hatte. Aber was war mit ihm? Sie fragte, ob er etwas empfand. Er fühlte Verantwortung. Und gerade jetzt empfand er Angst. Ruhig zu sein gehörte zu seinem Wesen. Sein Dad war genauso, und bei ihm klappte es.
Molly dagegen neigte zu übertriebener Phantasie. Robin hatte vielleicht etwas erlitten, aber ein Herzinfarkt, das war doch wohl ein wenig weit hergeholt. Er hätte vielleicht beruhigend auf sie eingeredet, wenn er nicht aus dem Haus hätte fliehen wollen. Erin brauchte Zeit, um sich abzuregen.
Fühlte er etwas? Ganz sicher tat er das. Er wurde nur einfach nicht gleich hysterisch.
Er setzte den Blinker und bog beim Krankenhaus ab. Kaum hatte er vor der Notaufnahme geparkt, als Molly auf ihn zugerannt kam; ihr blondes Haar flog im Wind, und in ihren Augen stand Panik.
»Was ist passiert?«, fragte er, als er aus dem Auto ausstieg.
»Nichts. Nichts. Sie ist nicht aufgewacht!«
Er blieb abrupt stehen. »Wirklich?«
»Sie hatte einen Herzinfarkt, Chris. Sie glauben, ihr Hirn wurde geschädigt.«
Sie zog ihn ins Innere durch den Wartebereich in eine Kabine weiter hinten – und da lag Robin, so reglos, wie er sie noch nie gesehen hatte. Er stand lange Zeit an der Tür und blickte von ihrem Körper zu den Apparaten und zu dem Arzt neben ihr.
Schließlich kam er näher. »Ich bin ihr Bruder«, erklärte er und blieb stehen. Er wusste nicht, wo er anfangen sollte.
Der Arzt tat es für ihn, wiederholte einiges von dem, was Molly gesagt hatte, und noch mehr. Chris hörte zu und versuchte, es aufzunehmen. Auf Drängen des Arztes redete er mit Robin, doch sie reagierte nicht. Er folgte den Erklärungen des Arztes zu den verschiedenen Apparaten und blieb mit ihm am Röntgenschirm stehen. Ja, er konnte erkennen, auf was der Arzt zeigte, doch es war zu unwirklich.
Er hatte wohl zweifelnd ausgesehen, denn der Arzt sagte: »Sie ist Sportlerin. Hypertrophe Kardiomyopathie – eine Entzündung des Herzmuskels – ist die Hauptursache für plötzlichen Tod unter Sportlern. Es passiert nicht oft, und die Rate ist bei Frauen noch niedriger als bei Männern. Aber es kommt vor.«
»Ohne Vorwarnung?«
»Gewöhnlich ja. Bei Fällen, in denen es eine bekannte Familiengeschichte gibt, kann eine Echokardiographie es vielleicht diagnostizieren, aber viele Opfer zeigen keine Symptome. Sobald sie auf der Intensivstation ist, wird sich ein Internist ihres Falles annehmen. Er wird mit einem Kardiologen und einem Neurologen Zusammenarbeiten.«
Chris wusste, dass seine Eltern die Besten wollen würden, aber wie sollte er wissen, wer das war? Er kam sich ungeeignet vor und sah auf die Uhr. »Wann landen sie?«, fragte er Molly.
»Jede Minute.«
»Rufst du sie an?«
»Mach du das. Ich bin zu aufgeregt.«
Und er nicht? Musste er denn erst sichtbar zittern? Er sah den Arzt an und fragte: »Ist das ... Was ist sie – im Koma?«
»Ja, aber es gibt verschiedene Komastadien.« Er schob seine schwarze Brille mit dem Handrücken nach oben. »In den meisten Stadien machen die Patienten spontane Bewegungen. Die Tatsache, dass Ihre Schwester das nicht gemacht hat, deutet auf das höchste Komastadium hin.«
»Wie können Sie das messen?«, fragte Chris. Er wusste nicht, wonach er suchte, wusste nur, dass Molly neben
ihm stand und jedes Wort aufsog und dass seine Eltern dieselben Fragen stellen würden. Zahlen hatten Bedeutung. Sie waren etwas, mit dem man etwas anfangen konnte.
»Eine Computertomographie und eine Magnetresonanztomographie werden Aufschluss darüber geben, ob Gewebe abgestorben ist, doch diese Tests werden warten müssen, bis sie stabiler ist.«
Chris blickte zu Molly. »Versuch, Mom und Dad anzurufen.«
»Ich kann nicht«, flüsterte sie und sah verängstigt aus. »Ich hätte bei ihr sein sollen. Das war alles meine Schuld.«
»Und es wäre nicht passiert, wenn du fünf Meilen die Straße weiter gewartet hättest? Sei vernünftig, Molly. Ruf Mom und Dad an.«
»Sie werden mir nicht glauben. Du hast es auch nicht getan.«
Sie hatte recht. Doch er wollte sie nicht anrufen. »Du kannst besser mit Mom umgehen als ich. Du wirst wissen, was du sagen musst.«
»Du bist älter, Chris. Du bist der Mann.«
Er zog sein Handy aus der Tasche. »Männer sind absolute Pfeifen in solchen Dingen. Es wird schon reichen, wenn sie meine Anruferkennung sieht.« Mit einem scharfen Blick reichte er ihr das Handy.
Kathryn Snow schaltete ihren BlackBerry ein, sobald das Flugzeug gelandet war. Sie hasste es, nicht erreichbar zu sein. Ja, die Gärtnerei war ein Familiengeschäft, doch sie war ihr Baby. Wenn es Probleme gab, wollte sie es wissen.
Während das Flugzeug durch die Dunkelheit zum Terminal rollte, lud sie neue Nachrichten herunter und scrollte die Liste durch.
»Irgendwas Interessantes?«, fragte ihr Mann.
»Eine Nachricht von Chris – sein Meeting ist gut verlaufen. Eine Dankesnachricht von den Collins für ihre Hochzeitsfeier. Und eine Mahnung von der Zeitung, dass der Artikel über blühenden Kohl Ende der Woche fällig ist.«
»Ist alles schon geschrieben, kann rausgehen.«
Lobend lächelte sie. Charlie war ihr Marketingleiter, ein Mann, der hinter den Kulissen wirkte und der ein Geschick dafür hatte, Werbung, Presseerklärungen und Artikel zu schreiben. Wenn er Fernsehproduzenten zu verstehen gab, dass Kathryn diejenige sei, mit der man über Herbstkränze sprechen sollte, dann glaubten sie ihm das. Er hatte ihr im Alleingang einen festen Platz in den lokalen Nachrichten sowie eine Kolumne in einer Wohnzeitschrift verschafft.
Apropos. »Grow How ist Ende der Woche fällig«, überlegte sie laut. »Es ist für die Januarausgabe vorgesehen, was immer am schwierigsten ist. Molly kennt sich mit dem Treibhaus besser aus als ich. Ich werde sie es schreiben lassen.« Sie kehrte wieder zu ihrem BlackBerry zurück. »Robin hat nicht gemailt. Ich frage mich, wie ihr Rennen gelaufen ist. Sie war wegen ihres Knies besorgt.« Als Nächstes machte sie sich an ihre Mailbox, lächelte, runzelte die Stirn, lächelte wieder. Sie hörte auf zuzuhören, gerade als das Flugzeug die endgültige Position erreichte. Sie löste ihren Gurt, steckte den BlackBerry in ihre Tasche und folgte Charlie den Gang entlang. »Voice Mail von Robin. Sie musste selber fahren, weil Molly sich geweigert hat zu helfen. Was stimmt nur nicht mit dem Kind?«
»Hat sich einfach geweigert? Keine Entschuldigung?« »Wer weiß?«, murmelte Kathryn, lächelte jedoch. »Aber auch gute Nachrichten. Robin hat noch einen Anruf von den Zuständigen bekommen, die sichergehen wollten, dass sie für den Marathon in New York bereit ist. Sie zählen für die Ausscheidungen im nächsten Frühjahr auf sie. Die Olympischen Spiele, Charlie«, flüsterte sie, als hätte sie Angst, es zu verderben, indem sie es laut aussprach. »Kannst du dir das vorstellen?«
Er holte ihren Koffer aus der oberen Gepäckablage. Kathryn wollte gerade den Griff packen, als ihr BlackBerry ertönte. Christophers Nummer war auf dem Display zu sehen, doch Mollys Stimme erklang und sagte: »Ich bin’s, Mom. Wo seid ihr?«
»Wir sind gerade gelandet. Molly, warum konntest du Robin nicht helfen? Das war doch ein wichtiges Rennen. Und hast du schon wieder dein Handy verloren?« »Nein. Ich bin mit Chris im Dickenson-May. Robin hatte einen Unfall.«
Kathryns Lächeln erstarb. »Was für einen Unfall?«
»Ach, du weißt schon, beim Laufen. Da ihr nicht da wart, hat man uns angerufen, doch wahrscheinlich will sie euch hier haben. Könnt ihr auf dem Heimweg vorbeikommen?«
»Was für ein Unfall?«, wiederholte Kathryn. Sie konnte die erzwungene Lässigkeit raushören. Es gefiel ihr nicht, genauso wenig wie die Tatsache, dass Chris auch im Krankenhaus war. Chris überließ Krisen normalerweise den anderen.
»Sie ist hingefallen. Ich kann jetzt nicht länger sprechen, Mom. Kommt gleich her. Wir sind in der Notaufnahme.« »Was ist ihr passiert?«
»Kann jetzt nicht sprechen. Bis bald.«
Die Leitung wurde unterbrochen. Kathryn sah besorgt zu Charlie. »Robin hatte einen Unfall. Molly wollte nicht sagen, was es für einer war.« Verängstigt reichte sie ihm den BlackBerry. »Versuch du es bei ihr.« Er gab ihr das Telefon zurück. »Du wirst mehr aus ihr herausbekommen als ich.«
»Dann ruf Chris an«, bettelte sie und reichte ihm erneut den BlackBerry.
Doch die Reihe der Passagiere begann sich zu bewegen, und Charlie trieb sie voran. Sie wartete, bis sie nebeneinander am Flughafen standen, bevor sie sagte: »Warum war Chris da? Robin ruft ihn nie an, wenn es ein Problem gibt. Versuch es bei ihm, Charlie, bitte.« Charlie hob die Hand, um Zeit zu schinden, bis sie zum Auto kamen. Der BlackBerry klingelte nicht wieder, und Kathryn sagte sich, dass das ein gutes Zeichen sei, konnte sich aber trotzdem nicht entspannen. Auf der ganzen Fahrt fühlte sie sich unbehaglich und stellte sich schreckliche Dinge vor. In dem Augenblick, da sie beim Krankenhaus parkten, war sie schon aus dem Auto heraus. Molly wartete bereits vor der Notaufnahme.
»Das war ein grausamer Anruf«, schimpfte Kathryn. »Was ist passiert?«
»Sie ist auf der Straße zusammengebrochen«, sagte Molly und nahm ihre Hand.
»Zusammengebrochen? Von der Hitze? Dehydrierung?«
Molly antwortete nicht, eilte nur mit ihr den Gang entlang. Kathryns Angst wuchs mit jedem Schritt. Andere Läufer brachen zusammen, aber doch nicht Robin. Sie hatte körperliche Ausdauer in den Genen.
An der Tür zur Kabine stockte ihr der Atem. Chris war auch hier. Aber das konnte doch nicht Robin sein, die dort bewusstlos und schlaff lag, angeschlossen an Apparate – Apparate, die sie am Leben erhielten, wie der Arzt sagte, nachdem er erklärt hatte, was passiert war.
Kathryn stand neben sich. Die Erklärungen ergaben keinen Sinn. Lind die Röntgenaufnahmen auch nicht. Die Hand ihrer Tochter, die sie umklammert hielt, war so leblos, wie es nur die Hand eines schlafenden Menschen sein konnte.
Doch sie wachte nicht auf, als der Arzt ihren Namen rief oder sie ins Ohr zwickte, und selbst Kathryn konnte erkennen, dass ihre Pupillen sich als Reaktion auf Licht nicht erweiterten. Kathryn meinte, dass derjenige, der das tat, es nicht richtig machte, aber sie hatte nicht mehr Glück, als sie es selbst versuchte – nicht, als sie Robin anbettelte, die Augen zu öffnen, und auch nicht, als sie sie anflehte, ihre Hand zu drücken.
Der Arzt redete weiter. Kathryn nahm nicht mehr jedes Wort wahr, doch der Sinn drang mit niederschmetternder
Wirkung zu ihr durch. Sie merkte nicht, dass sie weinte, bis Charlie ihr ein Taschentuch reichte.
Als Robins Gesicht verschwamm, sah sie ihr eigenes – dasselbe dunkle Haar, dieselben braunen Augen, dieselbe Intensität. Sie waren wie zwei Erbsen in einer Schote, hatten weder den hellen Teint noch die lässige Herangehensweise ans Leben wie die anderen in der Familie.
Kathryn sah wieder scharf. Charlie wirkte untröstlich, Chris verblüfft, und Molly klebte an der Wand. Schweigen von allen dreien? War es das? Wenn sonst keiner den Status quo in Frage stellte, war es an ihr – aber war es nicht immer so gewesen, wenn es um Robin ging?
Herausfordernd blickte sie den Arzt an. »Hirnschaden ist nicht möglich. Sie kennen meine Tochter nicht. Sie ist unverwüstlich. Sie erholt sich von Verletzungen. Wenn das hier ein Koma ist, wird sie wieder erwachen. Sie ist seit ihrer Geburt eine Kämpferin gewesen – seit ihrer Empfängnis.« Sie hielt fest Robins Hand. Das hier standen sie zusammen durch. »Was kommt als Nächstes?«
»Sobald sie stabil ist, verlegen wir sie nach oben.« »Wie ist ihr Zustand jetzt? Würden Sie ihn nicht stabil nennen?«
»Ich würde ihn kritisch nennen.«
Kathryn konnte mit dem Wort nicht umgehen. »Was ist in ihrer Infusion?«
»Flüssigkeiten sowie Medikamente, um ihren Blutdruck zu stabilisieren und ihren Herzrhythmus zu regulieren. Als sie hier angekommen ist, war er sehr unregelmäßig.« »Vielleicht braucht sie einen Schrittmacher.«
»Im Moment wirken die Medikamente, und außerdem würde sie eine Operation nicht überstehen.«
»Wenn die Alternative zur Operation der Tod ist ...« »Das ist sie nicht. Keiner lässt sie sterben, Missis Snow. Wir können sie am Leben halten.«
»Aber warum sagen Sie, ihr Hirn ist geschädigt?«, wollte Kathryn wissen. »Nur weil sie nicht reagiert? Wenn sie von einem Herzinfarkt traumatisiert ist, würde das nicht die mangelnde Reaktion erklären? Wie testen Sie auf Hirnschaden?«
»Wir werden am Morgen eine Magnetresonanztomographie machen. Im Moment wollen wir sie nicht verlegen.«
»Wenn es eine Schädigung gibt, kann sie wieder geheilt werden?«
»Nein. Wir können nur weiteren Verlust verhindern.« Kathryn fühlte sich abgekanzelt und wandte sich ihrem Mann zu. »Ist das alles, was sie tun können? Wir können mit einem Herzfehler leben, aber nicht mit einem Hirnschaden. Ich will eine zweite Meinung. Und wo sind die Spezialisten? Das hier ist doch nur die Notaufnahme, um Gottes willen. Diese Ärzte mögen dazu ausgebildet sein, mit einem Trauma umzugehen, aber wenn Robin seit drei Stunden hier ist und sich noch kein Kardiologe um sie gekümmert hat, dann müssen wir sie verlegen lassen.« Sie sah, wie Molly Charlie einen besorgten Blick zuwarf, doch Charlie sagte nichts, und der Himmel wusste, dass Chris auch nichts sagen würde. Erschrocken und allein wandte sich Kathryn wieder an den Arzt. »Ich kann nicht rumsitzen und warten. Ich will handeln.«
»Manchmal ist das nicht möglich«, erwiderte er. »Im Augenblick ist es wichtig, dass sie auf die Intensivstation kommt. Der Arzt dort wird die Spezialisten hinzuziehen. Das ist das übliche Vorgehen und Standard.«
»Standard ist nicht gut genug«, beharrte Kathryn, die verzweifelt versuchte, Verständnis zu erlangen.
»An Robin ist nichts Standard. Wissen Sie, was sie macht?«
Die Augen hinter den Brillengläsern blinzelten nicht. »Ja, das tue ich. Es ist schwer, es nicht zu wissen, wenn man hier in der Umgebung lebt. Ihr Name ist so oft in den lokalen Zeitungen zu finden.«
»Nicht nur in den lokalen Zeitungen. Deshalb muss sie sich wieder erholen. Sie arbeitet überall im Land mit angehenden Laufstars. Wir reden über Teenager. Sie können das hier nicht sehen. Sie dürfen auch nicht im Ansatz glauben, dass der Lohn für hartes Training und hochgesteckte Ziele ... das hier ist. Okay, Sie hatten vielleicht noch nie so einen Fall, aber wenn das so ist, sagen Sie es einfach, und wir lassen sie woandershin verlegen.«
Sie suchte in den Gesichtern ihrer Familie nach Zustimmung, doch Charlie wirkte wie vom Blitz getroffen, Chris war erstarrt, und Molly sah einfach nur flehend von ihrem Vater zu ihrem Bruder und zurück.
Nutzlos. Alle drei.
Also sagte Kathryn zum Arzt: »Das ist keine persönliche Anschuldigung. Ich frage mich nur, ob Ärzte in Boston oder New York wohl mehr Erfahrung mit solchen Verletzungen haben.«
Da berührte sie Molly am Ellbogen. Kathryn sah ihre
Jüngste gerade lange genug an, um sie flüstern zu hören: »Sie muss auf die Intensivstation.«
»Genau. Ich weiß nur nicht, wo.«
»Hier. Lass sie hierbleiben. Sie lebt, Mom. Sie haben ihr Herz zum Schlagen gebracht, und es schlägt immer noch. Sie tun alles, was sie können.«
Kathryn zog eine Augenbraue hoch. »Weißt du das ganz bestimmt? Wo warst du, Molly? Wenn du bei ihr gewesen wärst, wäre das hier nicht passiert.«
Molly erblasste, doch sie wich nicht zurück. »Ich hätte einen Herzinfarkt nicht verhindern können.«
»Du hättest früher Hilfe für sie holen können. Du hast Probleme, Molly. Du hattest schon immer Probleme mit Robin.«
»Hör zu«, drängte Molly und blickte zu dem medizinischen Personal, das an der Tür stand. »Sie warten darauf, sie nach oben zu bringen, und wir verzögern das nur. Sobald sie dort ist, können wir über Spezialisten reden, sogar darüber, sie zu verlegen; aber sollten wir ihr jetzt im Augenblick nicht die bestmögliche Chance geben?«
Molly folgte den anderen auf die Intensivstation und sah zu, wie das Team Robin fertig machte. Einmal konnte sie fünf Ärzte und drei Schwestern im Zimmer zählen, was sowohl erschreckend als auch beruhigend war. Monitore wurden angeschlossen und Vitalfunktionen überprüft, während das Beatmungsgerät ein- und ausatmete. Alle ein, zwei Minuten sprach jemand laut mit Robin, doch sie reagierte nicht.
Kathryn verließ das Bett nur, wenn ein Arzt oder eine Schwester hinmusste. Die übrige Zeit hielt sie Robins Hand, streichelte ihr Gesicht, drängte sie zu blinzeln oder zu stöhnen.
Während Molly sie von der Wand aus beobachtete, wurde sie von dem Wissen verfolgt, dass ihre Mutter recht hatte. Wenn Robin früher zu atmen angefangen hätte, gäbe es keinen Hirnschaden. Wenn Molly bei ihr gewesen wäre, hätte Robin früher geatmet.
Doch sie war nicht die Einzige, die Robin im Stich gelassen hatte. Sie konnte ihrer Mutter keinen Vorwurf daraus machen, dass sie vorhin in der Notaufnahme wie verrückt gewesen war, aber wo war ihr Vater? Er sollte doch der Ruhige sein. Was hatte er sich nur dabei gedacht, Kathryn sich so aufführen 2u lassen? Selbst Chris hätte Einspruch erheben können.
Sie hatten nicht den Mumm dazu, beschloss Molly und korrigierte sich dann. Sie wussten es besser.
Du hast Probleme. Du hattest schon immer Probleme mit Robin. Sie wusste, ihre Mutter war erregt, doch Molly hatte genug Schuldgefühle, um von den Worten zutiefst getroffen zu sein.
Während die Minuten vergingen und die Apparate piepten, erinnerte sie sich daran, wie sie ab und zu eine telefonische Nachricht gelöscht, den falschen Energieriegel gekauft oder eine Lieblingslaufkappe verlegt hatte. Jedes Vergehen konnte mit etwas Gutem aufgewogen werden, das Molly getan hatte, doch das Gute ging in der Schuld verloren.
Chris verließ das Krankenhaus um Mitternacht, ihr Vater um ein Uhr. Charlie hatte versucht, Kathryn dazu zu bringen, mit ihm zu gehen, jedoch ohne Erfolg. Molly nahm an, dass ihre Mutter fürchtete, etwas Schreckliches könnte geschehen, wenn sie nicht da wäre, um Wache zu halten. Kathryn hatte Robin immer beschützen wollen.
Molly hoffte, dass ihre eigene Anwesenheit vielleicht ein kleiner Schritt auf dem Weg wäre, in Kathryns Augen wiedergutzumachen, was sie früher an dem Tag nicht getan hatte, und blieb länger. Um zwei Uhr jedoch schlief sie auf ihrem Stuhl ein. »Bist du sicher, dass ich dich nicht heimfahren soll?«, fragte sie ihre Mutter.
Kathryn blickte kaum auf. »Ich kann nicht gehen«, sagte sie und fügte hinzu: »Warum warst du nicht bei ihr, Molly?« Das tat sie mit einer Geschwindigkeit, die zeigte, dass sie nur darüber brütete.
»Ich war in Snow Hill«, versuchte Molly zu erklären. »Die Geschäftsführungssitzung, erinnerst du dich? Ich wusste nicht, wie lange es dauern würde. Wie konnte ich mich da Robin verpflichten?« Da war außerdem noch die Sache mit der Katze. Doch eine Katze vor ihre Schwester zu stellen war armselig.
Kathryn fragte nicht, wie lange die Sitzung gedauert hatte. Sie fragte nicht mal, wie es gelaufen war. Wenn sie über etwas brütete, dann über Mollys Nachlässigkeit gegenüber Robin, nicht über Snow Hill.
Und Molly war schuldig. Dieser Gedanke drückte sie nieder, bevor sie schließlich das Schweigen brach und fragte: »Kann ich dir etwas bringen, Mom? Vielleicht Kaffee?«
»Nein. Aber du kannst mich in der Arbeit ersetzen.«
Erschrocken stieß Molly den Atem aus. »Ich kann nicht zur Arbeit gehen, wenn Robin so ist.« »Du musst. Ich brauche dich dort.« »Kann ich hier nichts tun?«
»Hier gibt es nichts zu tun. Es gibt aber jede Menge in Snow Hill zu tun.«
»Was ist mit Dad? Und Chris?«
»Nein, du.«
Sie will mich nicht in der Nähe haben, erkannte Molly, und ihre Verzweiflung wuchs. Doch sie war zu müde, um um Gnade zu betteln, sogar zu ausgelöscht für Tränen. Nachdem sie Kathryn gebeten hatte, sie anzurufen, sollte sich irgendetwas ändern, schlüpfte sie zur Tür hinaus.
Kapitel 3
Mollys Cottage lag nach Süden, so dass der Speicher das ganze Jahr über Sonne hatte, während der Wald hinter dem Garten den Schlafzimmern Schatten spendete und die Luft mit Pinienduft erfüllte. Molly hatte davon durch Zufall erfahren, als der Besitzer, der New Hampshire verließ, um nach Florida zu ziehen, auf der Suche nach einem Heim für Dutzende von Pflanzen in die Gärtnerei gekommen war. Nun wollte der Besitzer renovieren und verkaufen, so dass Molly und Robin hinausgeworfen wurden.
Molly fand die hervorragende Küche einfach wunderbar. Sie liebte das verwitterte Gefühl des Fußbodens mit den breiten Bohlen und die Flügelfenster. Obwohl Robin sich beklagte, dass das Haus zugig sei und die Räume dunkel, war es ihr eigentlich egal, wo sie wohnte. Sie war die Hälfte der Zeit sowieso nicht da – in Denver, Atlanta, London, L.A. Wenn sie keinen Marathon, Halbmarathon oder zehn Kilometer lief, leitete sie ein Seminar oder tauchte bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung auf. Die meisten Kisten im Wohnzimmer gehörten Molly. Ihre Schwester hatte nicht viel zu packen.
Robin war froh auszuziehen, Molly nicht, doch sie würde mitmachen, nur damit Robin wieder so wäre wie früher.
Molly wartete auf den Anruf ihrer Mutter und schlief mit dem Telefon in der Hand und alles andere als tief. Ständig wurde sie aus dem Schlaf gerissen und hatte das hohle Gefühl zu wissen, dass etwas nicht stimmte, und sich nicht mehr zu erinnern, was es war. Zu schnell erinnerte sie sich dann doch wieder und lag voller Angst wach. Ohne dass Robin aufstand, um irgendeinen Körperteil mit Eis zu kühlen, war das Haus unheimlich still.
Um sechs Uhr brauchte Molly Gesellschaft und suchte nach der Katze. Sie hatte gefressen und das Katzenklo benutzt. Doch sie war nirgends zu finden, auch wenn Molly noch genauer suchte als am Vorabend. Da hatte sie Zeit verschwendet, wollte, dass Robin ausnahmsweise mal auf sie warten musste. Wie kleinlich das gewesen war. Ein Hirnschaden war Lichtjahre entfernt von einem verstauchten Knöchel oder Knie.
Natürlich konnte Robin inzwischen aufgewacht sein. Aber wen sollte sie anrufen? Molly konnte es nicht riskieren, ihre Mutter anzurufen, wollte ihren Vater nicht wecken, und Chris war keine Hilfe. Die Intensivstation würde nur einen offiziellen Zustandsbericht abgeben. Kritischer Zustand? Das wollte sie nicht hören.
Also goss und beschnitt sie den Philodendron auf dem Speicher, pflückte tote Blätter von einem kranken Ficus, besprühte einen sich erholenden Farn, während sie die ganze Zeit der Pflanze süße, sinnlose Dinge zuflüsterte, bis ihr schließlich nichts mehr einfiel und sie Jeans anzog und ins Krankenhaus fuhr. Sie ging direkt auf die Intensivstation und hoffte gegen alle Hoffnung, dass Robins Augen offen wären. Als sie das nicht waren, sank ihr das Herz. Das Beatmungsgerät rauschte, die Apparate blinkten. Wenig hatte sich geändert, seit sie gestern Nacht gegangen war.
Kathryn schlief auf einem Stuhl neben dem Bett, und ihr Kopf berührte Robins Hand. Sie bewegte sich, als Molly näherkam, und sah benommen auf die Uhr. Müde sagte sie: »Ich dachte, du wärst inzwischen in der Gärtnerei.« Mollys Blick war auf ihre Schwester gerichtet. »Wie geht es ihr?« »Unverändert.«
»Ist sie gar nicht aufgewacht?«
»Nein, aber ich habe mit ihr geredet«, antwortete Kathryn. »Ich weiß, sie hört mich. Sie bewegt sich nicht, weil sie noch traumatisiert ist. Aber wir arbeiten daran, nicht wahr, Robin?« Sie streichelte mit dem Handrücken Robins Gesicht. »Wir brauchen nur noch ein bisschen mehr Zeit.«
Molly erinnerte sich daran, was der Arzt über den Mangel an Reaktion gesagt hatte. Es war kein gutes Zeichen. »Haben sie die Magnetresonanztomographie gemacht?«
»Nein. Der Neurologe wird erst in einer Stunde hier sein.«
Dankbar, dass ihre Mutter nicht wegen des Wartens jammerte, packte Molly den Handlauf. Wach auf, Robin, drängte sie und suchte unter Robins Lidern nach einer Bewegung. Träumen wäre ein gutes Zeichen.
Doch ihre Augenlider blieben glatt. Entweder schief sie tief, oder sie lag tatsächlich im Koma. Komm schon, Robin, rief sie innerlich mit größerer Kraft.
»Ihr Rennen verlief wirklich gut, bis sie fiel«, bemerkte Kathryn und führte Robins Hand an ihr Kinn. »Du wirst es wieder dorthin schaffen, Süße.« Sie atmete schnell tief ein.
Da sie glaubte, sie habe etwas gesehen, blickte Molly genauer hin.
Doch Kathryns Stimme klang locker. »Oh, oh, Robin. Fast hätte ich’s vergessen. Du sollst dich doch heute Nachmittag mit den Concord-Mädels treffen. Das werden wir verschieben müssen.« Als sie aufsah, steckte sie sich das Haar hinters Ohr. »Molly, würdest du bitte da anrufen? Sie soll außerdem morgen in Hannover vor einer Gruppe Sechstklässler reden. Sag ihnen, sie sei krank.«
»Krank« war eine echte Untertreibung, wie Molly wusste. Und wie sollte man an so einem Ort nicht krank sein – an dem Lichter blinkten, Apparate piepten und das rhythmische Zischen des Beatmungsgeräts eine ständige Erinnerung daran war, dass der Patient nicht allein atmen konnte? Zwischen Telefonen und Alarmknöpfen war es noch schlimmer als draußen im Gang.
Molly hatte sich eine Pause davon gegönnt, Kathryn jedoch nicht. »Du siehst erschöpft aus, Mom. Du brauchst Schlaf.«
»Den bekomme ich schon.«
»Wann?«, fragte sie, doch Kathryn antwortete nicht. »Was ist mit Frühstück?«
»Eine der Schwestern hat mir einen Saft gebracht. Sie hat gesagt, das Wichtigste ist es jetzt zu reden.«
»Ich kann doch reden«, bot Molly an, die verzweifelt helfen wollte. »Warum nimmst du nicht mein Auto, fährst heim und ziehst dich um? Robin und ich haben eine Menge zu besprechen. Ich muss wissen, was ich mit den Kisten voller Turnschuhe in ihrem Schrank machen soll.«
Kathryn warf ihr einen Blick zu. »Rühr sie nicht an.« »Weißt du, wie alt manche davon sind?«
»Molly ...«
Molly beachtete die Warnung nicht. Im Streiten lag eine gewisse Normalität. »Wir müssen in einer Woche raus sein, Mom. Die Turnschuhe können nicht da bleiben, wo sie sind.«
»Dann pack sie ein und bring sie mit dem Rest eurer Sachen nach Hause. Wenn du ein neues Haus findest, bringen wir sie dorthin. Und dann ist da natürlich noch die Sache mit ihrem Auto, das irgendwo am Straßenrand zwischen hier und Norwich steht. Ich werde Chris schicken, es zu holen. Ich kann immer noch nicht glauben, dass du sie nicht hingefahren hast.«
Molly konnte es auch nicht, doch das war nur im Nachhinein so. Im Moment zeigte Robin absolut keine Anzeichen, dass sie das Gespräch mitbekam. Und plötzlich schaffte es Molly nicht mehr, so zu tun, als ob irgendetwas hier normal wäre. Über alte Turnschuhe zu sprechen, wenn die Läuferin an lebenserhaltende Apparate angeschlossen war?
Ihr klopfte das Herz bis zum Hals, als sie Robin ins Gesicht sah. Als Kind hatte Molly oft darauf gewartet, dass ihre Schwester aufwachte; ihre Augen hatten an ihrem Gesicht gehangen, und mit jedem Atemzug hatte sich die Hoffnung erhöht oder wieder gesenkt. Molly wäre im Moment für jede Bewegung dankbar gewesen.
»Wenn du Hilfe beim Packen brauchst«, sagte Kathryn, »frag Joaquin. Schau auf seinen Plan, wenn du nach Snow Hill kommst.«
»Ich will eigentlich hierbleiben«, beharrte Molly.
»Hier geht es nicht darum, was du willst, Molly. Es geht darum, was am meisten hilft. Jemand muss in Snow Hill sein.«
»Chris wird da sein.«
»Chris kann nicht mit den Leuten reden. Du schon.« Molly spürte, wie ihr die Tränen kamen. »Ich bin ein Pflanzenmensch, Mom. Ich kann mit Pflanzen reden. Und das hier ist meine Schwester, die da liegt. Wie kann ich da arbeiten?«
»Robin würde wollen, dass du arbeitest.«
Robin würde es wollen? Molly kämpfte gegen Hysterie an. Robin hatte noch nie in ihrem Leben achtundvierzig Stunden in der Woche gearbeitet. Sie lief, sie trainierte andere, sie winkte, und sie lächelte – alles dann, wann sie wollte. Sie hatte ein Büro in der Gärtnerei und war auf dem Papier verantwortlich für besondere Anlässe, doch ihre praktische Mitarbeit war minimal. Am Tag dieser Anlässe war sie öfter weg als anwesend. Sie war Sportlerin und keine Kranzbinderin oder eine Bonsai-Spezialistin, wie sie Molly mehr als einmal erklärt hatte.
Aber Kathryn das jetzt noch einmal zu sagen wäre genauso grausam, wie laut zu fragen, was geschehen würde, sollte Robin nie wieder aufwachen.
Snow Hill war seit seinem Beginn vor mehr als dreißig Jahren im Familienbesitz. Es breitete sich über hundertsechzig Hektar bestes Land aus und war berühmt für Bäume, Büsche und Gartenbedarf. Doch sein Kronjuwel – mit Solarzellen, die die Sommerhitze für den Winter bewahrten, einem Mechanismus, um Regenwasser zu recyceln, und einer computergesteuerten Feuchtigkeitskontrolle – war ein hochmodernes Gewächshaus. Das war Mollys Domäne.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: