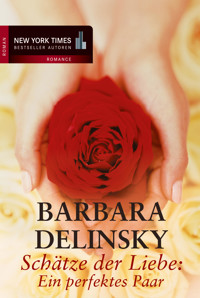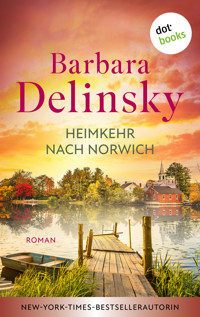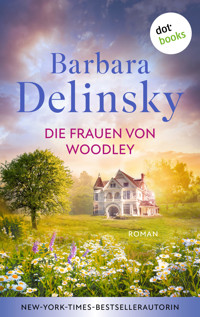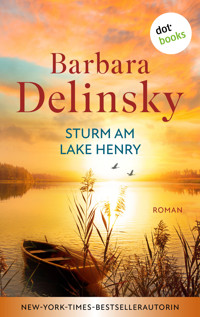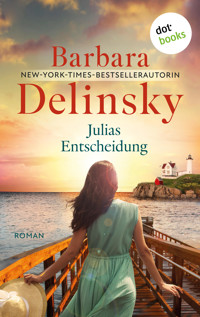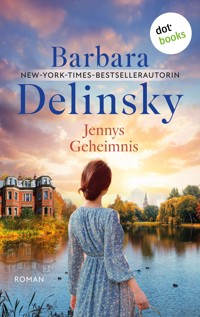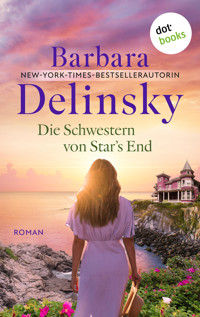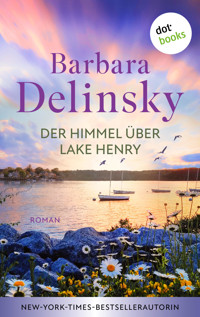
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Blake-Schwestern
- Sprache: Deutsch
Kann sie ausgerechnet hier ein neues Glück finden? Der berührende Roman »Der Himmel über Lake Henry« von Barbara Delinsky jetzt als eBook bei dotbooks. Als erfolgreiche Sängerin ist Lily Blake es gewohnt, Tag für Tag im Scheinwerferlicht zu stehen – doch als ein Klatschreporter ihr eine skandalöse Affäre andichtet, die ihren Ruf ruinieren könnte, sieht sie keine andere Möglichkeit, als vor den unbarmherzigen Medien in ihre Heimatstadt am Lake Henry zu flüchten. Dort schert sich niemand um Lilys glamouröse Karriere und sie kann einfach sie selbst sein … doch wer ist das eigentlich? Während Lily mühsam versucht, das Band zu ihrer Mutter und ihrer Schwester Poppy neu zu knüpfen, die ihr ganzes Leben am Lake Henry verbracht haben, verliebt sie sich gleichzeitig in den charmanten Fotografen John. Doch sie weiß nicht, dass John früher als Reporter gearbeitet hat … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der bewegende Kleinstadtroman »Der Himmel über Lake Henry« von New-York-Times-Bestsellerautorin Barbara Delinsky ist der zweite Roman ihrer mitreißenden »Blake Schwestern«-Reihe, deren Büchern unabhängig voneinander gelesen werden können. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 541
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über dieses Buch:
Als erfolgreiche Sängerin ist Lily Blake es gewohnt, Tag für Tag im Scheinwerferlicht zu stehen – doch als ein Klatschreporter ihr eine skandalöse Affäre andichtet, die ihren Ruf ruinieren könnte, sieht sie keine andere Möglichkeit, als vor den unbarmherzigen Medien in ihre Heimatstadt am Lake Henry zu flüchten. Dort schert sich niemand um Lilys glamouröse Karriere und sie kann einfach sie selbst sein … doch wer ist das eigentlich? Während Lily mühsam versucht, das Band zu ihrer Mutter und ihrer Schwester Poppy neu zu knüpfen, die ihr ganzes Leben am Lake Henry verbracht haben, verliebt sie sich gleichzeitig in den charmanten Fotografen John. Doch sie weiß nicht, dass John früher als Reporter gearbeitet hat …
Über die Autorin:
Barbara Delinsky wurde 1945 in Boston geboren und studierte dort Psychologie und Soziologie. Nach der Geburt ihres ersten Sohnes arbeitete sie als Fotografin für den Belmont Herald, erkannte aber bald, dass sie viel lieber die Texte zu ihren Fotos schrieb. Ihr Debütroman wurde auf Anhieb zu einem großen Erfolg. Inzwischen hat Barbara Delinsky über 70 Romane veröffentlicht, die in mehr als 20 Sprachen übersetzt wurden und regelmäßig die New–York–Times–Bestsellerliste stürmen. Sie engagiert sich außerdem sehr stark für Wohltätigkeitsvereine und Aufklärung rund um das Thema Brustkrebs. Barbara Delinsky lebt mit ihrem Mann in New England und hat drei erwachsene Söhne.
Die Website der Autorin: barbaradelinsky.com/
Bei dotbooks veröffentlichte Barbara Delinsky auch ihre Romane:
»Die Schwestern von Star’s End«
»Jennys Geheimnis«
»Das Weingut am Meer«
»Julias Entscheidung«
»Lauras Hoffnung«
»Die alte Mühle am Fluss«
»Der alte Leuchtturm am Meer«
»Sturm am Lake Henry«, Die Blake–Schwestern 1
»Heimkehr nach Norwich«
»Das Leuchten der Silberweide«
»Das Licht auf den Wellen«
»Ein Neuanfang in Casco Bay«
»Im Schatten meiner Schwester«
»Rückkehr nach Monterey«
»Drei Wünsche hast du frei«
»Ein ganzes Leben zwischen uns«
»Jedes Jahr auf Sutters Island«
»Was wir nie vergessen können«
***
eBook-Neuausgabe Dezember 2023
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1999 unter dem Originaltitel »Lake News« bei Simon & Schuster, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 2001 unter dem Titel »Die Affäre der Lily Blake« bei Droemer Knaur.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1999 by Barbara Delinsky
Published by Arrangement with Barbara Delinsky
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2001 bei Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98952-040-0
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Der Himmel über Lake Henry« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Barbara Delinksy
Der Himmel über Lake Henry
Roman
Aus dem Amerikanischen von Georgia Sommerfeld
dotbooks.
»Nichts auf der Erde ist so klar, so rein und so weit wie ein See. Himmelswasser! Es bedarf keiner Begrenzung. Völker kommen und gehen, ohne es beschädigen zu können. Es ist ein Spiegel, den kein Stein zum Bersten bringen kann, dessen Silberglanz sich niemals abnutzt, dessen Vergoldung sich fortwährend von selbst erneuert, dessen Oberfläche auf Dauer weder Sturm noch Staub trüben kann. Es ist ein Spiegel, in dem jedwede Unreinheit getilgt wird wie weggewischt von einem Besen aus der Sonne Strahlen – dem Staubtuch aus Licht –, ein Spiegel, der keinen Anhauch festhält, sondern seinen eigenen Atem ausströmt und als Wolken hoch über sich schweben und zugleich in seinem Schoß sich widerspiegeln lässt.«
Aus WALDEN vonHenry David Thoreau (1817–1862)
Kapitel 1
Lake Henry, New Hampshire
Das Schwarz der Nacht milderte sich, wurde zu einem tiefen Blau, das gemächlich in ein helles Blau überging, der Spitze eines Baumes, der Dachgaube eines Häuschens, der in den See hinausgestreckten, verwitterten Zunge eines hölzernen Bootsstegs allmählich Form verlieh. Das galt für einen klaren Tag. Heute nahmen die Konturen langsamer Gestalt an, reduzierte Nebel den See zu einer Milchglasscheibe, verschwammen die leuchtenden Herbstfarben am Ufer zu einem hellen Gold-Orange-Grün ineinander. Hier und da deutete ein pastellroter oder blassblauer Tupfen ein am See gelegenes Haus an, doch Einzelheiten verloren sich im zartgrauen Dunst. Ebenso wie die Trennlinie zwischen Wasser und Land. Kein Lüftchen regte sich, kein Laut störte die Stille. Es war, als sei alles in einen schützenden Kokon eingesponnen.
John Kipling genoss die Stimmung. Das Einzige, was ihm nicht gefiel, war die Kälte. Er war noch nicht auf das Ende des Sommers eingestellt, aber die Tage waren bereits merklich kürzer als vor zwei Monaten. Die Sonne ging früher unter und später auf, und die Kühle der Nacht wich nur zögernd. Er spürte es. Seine Seetaucher spürten es. Die kleine Familie, die er beobachtete, Vater, Mutter und zwei Junge, würde noch fünf Wochen auf dem See bleiben, war aber schon unruhig, schaute in einer Weise zum Himmel, die nicht Wachsamkeit signalisierte, sondern den Gedanken an den Flug in wärmere Gefilde.
Im Augenblick ließen die Vögel sich keine sechs Meter von seinem Paddelboot und keine drei Meter von der winzigen kiefernbestandenen Insel entfernt treiben, in deren geschützter Bucht sie den Sommer verbracht hatten. Die Insel war eine von vielen, die den Lake Henry sprenkelten. Neben der Klarheit des Wassers, der Stille des Sees und dem Überfluss an kleinen Fischen waren es diese Inseln, die die Seetaucher Jahr um Jahr hierher lockten, konnten sie doch an Land nur rutschen, da ihre Beine unter den großen, plumpen Körpern zu weit hinten saßen. Also bauten sie ihre Nester direkt am Ufer der Inseln, wo sie relativ einfach ins Wasser und wieder hinaus gelangten, aber es tat John in der Seele weh, zu sehen, wie sie sich selbst auf den wenigen Zentimetern zwischen Wasser und Nest abmühten.
In jeder anderen Hinsicht boten sie jedoch einen bemerkenswerten Anblick. Seit die Jungen im Juli ausgeschlüpft waren, hatte er verfolgt, wie sich ihr Federkleid vom schwarzen Babyflaum über Kleinkind-Braun zu einem Halbwüchsigen-Grau gewandelt hatte, das es nicht wert gewesen wäre, in einem Brief an die Lieben daheim erwähnt zu werden, aber sie hatten die spitzen Schnäbel und langen, dicken Hälse ihrer Eltern und ließen eine künftige Pracht erahnen – und die Eltern, ah, die Eltern, waren wirklich prächtig, sogar jetzt, im Herbst, da ihr Sommerkleid zu verblassen begann, sogar an diesem Morgen, durch den Schleier eines zartgrauen Dunstes gesehen. Sie waren wunderschön mit den weißen Tupfen auf den schwarzen Rücken, den weißen Kehlen, den kräftigen schwarzen Köpfen und den ausgeprägten, spitzen Schnäbeln. Als sei das noch nicht beeindruckend genug, besaßen sie Aufsehen erregende runde rote Augen. John hatte gehört, dass das Rot die Unterwassersehkraft verstärkt, und er hatte keine Zweifel an der Richtigkeit der Behauptung. Diesen Augen entging nicht viel.
Im Augenblick schwammen die Vögel gemächlich in der Bucht herum, wobei sie die Köpfe unter das Gefieder steckten, um sich zu putzen, oder ins Wasser, um nach Fischen zu tauchen. Als eines der Alttiere seinen Körper anspannte, die Beine grätschte und dank der Kraft seiner mit Schwimmhäuten versehenen Füße mit dem Kopf voraus unter die Wasseroberfläche ging, wusste John, dass der Vogel sich den Bauch mit bis zu fünfzehn Elritzen vollschlagen würde, bevor er in einiger Entfernung wieder auftauchte.
Er durchforschte den Nebel, bis er ihn entdeckte. Sein Gefährte ließ sich, noch immer in der Nähe der Insel, treiben, die Alttiere waren wachsam, spähten durch den Nebel mit erhobenen Schnäbeln. Später am Morgen würden sie ihre Jungen sich selbst überlassen, mühsam auf dem Wasser Anlauf nehmen und sich schwerfällig in die Luft erheben, eine oder zwei Runden drehen, bis sie ausreichend an Höhe gewonnen hatten, um die Bäume unter sich zu lassen, und dann zu einem benachbarten See fliegen, um dort ansässige Seetaucher zu besuchen. Nach der Einsamkeit, die die Monate der Aufzucht ihrer Jungen den beiden auferlegt hatte, war es an der Zeit, dass sie in Vorbereitung auf den Zug an die warme Atlantikküste ihre sozialen Fähigkeiten auffrischten.
Seit zehntausenden von Jahren wiederholten die Seetaucher dieses Ritual. Die gleiche Intelligenz, die ihr Überleben in all dieser Zeit gesichert hatte, sagte ihnen auch in diesem Jahr, dass der September in die zweite Hälfte ging, der Oktober kältere Tage und frostige Nächte und der November Eis mit sich bringen würde. Da sie für ihren Start eine beträchtliche Fläche offenen Wassers benötigten, müssten sie aufbrechen, ehe der See zufröre. Und das würden sie auch. In den Jahren, die er hier aufgewachsen war, und seit seiner Rückkehr vor drei Jahren hatte John nicht viele Seetaucher gesehen, denen das Eis ein Schnippchen geschlagen hatte. Sie verfügten über gute Instinkte, machten kaum jemals Fehler.
John machte Fehler und diese sehr oft. Wie heute Morgen, als er das Haus in T-Shirt und Shorts verlassen hatte, um den Sommer zu beschwören. Mit zwanzig hätte er die Kälte noch weggesteckt, doch jetzt, mit über vierzig, war er zwar noch immer einen Meter achtundachtzig groß und gesund, aber die leicht steifen Knie, die Fältchen um die Augen, die Geheimratsecken und die nicht mehr so gut durchbluteten Gliedmaßen zeigten deutlich, dass sein Körper nicht mehr der Jüngste war.
Aber er war nicht bereit, das Feld zu räumen. Noch nicht. Die Seetaucher lieferten vielleicht keinen Stoff für einen Bestseller, aber er hatte sich noch nicht an ihnen satt gesehen. Er saß regungslos in seinem Boot, hatte die Hände, um sich zu wärmen, unter die Achseln geklemmt, das lange Paddel vor sich aufgelegt. Die Seetaucher waren zwar an seine Gegenwart gewöhnt, aber er wollte nichts riskieren. Solange er Abstand hielt und ihr Revier respektierte, würden sie ihn damit belohnen, ihn an ihrem Leben teilhaben zu lassen – ihm erlauben, ihrem Gesang lauschen zu dürfen. Wenn die Welt unwirklich still war – nachts, bei Tagesanbruch, an Morgen wie diesem, wo der Nebel alle anderen möglichen von Leben am See kündenden Geräusche verschluckte –, erklang das zarte Lied des Seetauchers. So wie jetzt, atemberaubend, ein aus vibrierender Kehle aufsteigendes urzeitliches Tremolo, so schön, so geheimnisvoll, so wild, dass John eine Gänsehaut bekam.
Es enthielt auch eine Botschaft. Das Tremolo war ein Warnruf. In diesem Fall zwar nur ein leiser, aber John nahm ihn ernst. Kaum hörbar schabte Holz über Fiberglas, als er das Paddel hob, und dann schwappte leise Wasser an die Wände, während er sein Boot rückwärts bewegte. Als er den Abstand um weitere drei Meter vergrößert hatte, hielt er an und legte das Paddel so gut wie lautlos quer vor sich auf, stützte die Arme auf die Oberschenkel und schaute, lauschte und wartete.
Nach einer Weile streckte der ihm am nächsten auf dem Wasser treibende Seetaucher den Kopf vor und stieß einen langgezogenen, durchdringenden, ja klagenden Laut aus. Er ähnelte dem Heulen eines Kojoten, doch John hätte diesen Ruf niemals verwechselt. Der Schrei des Seetauchers war gleichzeitig urgewaltiger und zarter.
Dieser war der Beginn eines Dialogs. Ein Alttier rief das andere. In rascher Folge ertönten gespenstische Rufe, die den weiter draußen schwimmenden Vogel veranlassten, sich Johns Nachbarn zu nähern. Selbst als nur noch drei Meter zwischen den beiden lagen, führten sie ihre lautstarke Unterhaltung fort, wobei sie ihre Schnäbel kaum öffneten und ihre gereckten Hälse bei jedem Laut anschwollen.
John bekam wieder eine Gänsehaut. Deshalb war er an den See zurückgekehrt, hatte sich, nachdem er New Hampshire mit fünfzehn Jahren verlassen hatte, mit vierzig anders besonnen. Manche sagten, er sei aus beruflichen Gründen zurückgekommen, andere sagten wegen seines Vaters, aber in Wahrheit hatte seine Rückkehr letztendlich mit diesen Vögeln zu tun. Sie verkörperten Ursprünglichkeit und Wildheit, aber auch Einfachheit, Ehrlichkeit und Sicherheit für ihn.
Das Leben eines Seetauchers bestand aus Essen, Gefiederpflege und Fortpflanzung. Es war ein ehrliches Leben, ohne Vortäuschungen, Ehrgeiz und Grausamkeit, in dem nur die Verteidigung der eigenen Existenz zu einer Verletzung anderer führte. John fand das höchst erfrischend.
Und so blieb er noch, obwohl er wusste, dass er aufbrechen sollte. Es war Dienstag. Die »Lake News« müsste morgen Mittag in der Druckerei sein. Das Material seiner Korrespondenten – er hatte in jedem der umliegenden Orte einen Zuträger – war bereits im Haus. Vorausgesetzt, die entsprechenden Briefkästen enthielten die ihm von örtlichen Drahtziehern, also den Einflussreichen und Mächtigen – wobei einflussreich und mächtig relativ zu sehen war –, versprochenen Artikel, würde er in letzter Minute einen ganzen Stapel lesen, redigieren, tippen, zerschneiden und zusammenkleben müssen. Wenn die Artikel nicht in den Kästen wären, würde er Lake Henry und den vier Nachbargemeinden, die die Zeitung bediente, abtelefonieren und die auf diesem Weg ergatterten Informationen selbst zu Beiträgen formulieren – und wenn ihm am Ende noch Platz bliebe, würde er diesen ein weiteres Mal mit einem Text von Henry David Thoreau füllen.
Auch damit wäre kein Bestseller zu machen. Bestseller mussten originell sein. Er hatte Notizbücher voller Möglichkeiten, Aktenordner voller Anekdoten, die er seit seiner Rückkehr an den See gesammelt hatte, aber keine davon stachelte seinen Eifer an, ein Buch zu schreiben. Die »Lake News« stachelten seinen Eifer an – von Dienstagmittag bis Mittwochmittag. Er war ein Mann, der zur Höchstform auflief, wenn er die Faust im Nacken hatte. Er liebte es, wenn die Redaktion vor Hektik vibrierte, er liebte es, den Chefredakteur bis an den Rand seiner Nervenkraft hinzuhalten.
Jetzt war er natürlich selbst der Chefredakteur. Und der Herstellungsleiter. Und der Bildredakteur, der Klatschkolumnist und der Layouter. Die »Lake News« war nicht die »Boston Post«. Nicht im Entferntesten. Es gab Momente, da störte ihn das. Im Augenblick nicht.
Das Paddel blieb an seinem Platz, die Seetaucher setzten ihre Unterhaltung fort. Als sie eine Pause machten, wagte John, den Ruf nachzuahmen. Einer der Vögel antwortete ihm, und in diesem kurzen, berauschenden Moment fühlte er sich als Familienmitglied. Gleich darauf nahmen die Vögel ihr Gespräch wieder auf, und er war ausgeschlossen, wieder Angehöriger einer fremden Gattung.
Aber er fror nicht. Nicht mehr. Die Sonne löste den Nebel auf. Als sich schließlich blauer Himmel zeigte, schätzte John die Zeit auf kurz vor neun. Er streckte seine Beine aus, lehnte sich zurück und stützte die Ellbogen auf den Bootsrand, hob das Gesicht der Sonne entgegen, schloss die Augen, stieß zufrieden einen tiefen Seufzer aus und lauschte den Seetauchern.
Als die Sonne auf seinen Lidern zu brennen begann und das Gewicht seiner beruflichen Pflicht zu schwer wurde, um noch länger ignoriert werden zu können, richtete er sich auf. Ein paar Minuten beobachtete er die Vögel noch und sog in sich auf, was immer es auch war, das diese Tiere ihm gaben. Dann griff er nach dem Paddel und machte sich auf den Heimweg.
Das Schöne an einem Bart war, dass er einem die tägliche Rasur ersparte. John trug ihn kurz geschnitten, was gelegentliche Nachbesserungen notwendig machte, ihn aber der lästigen und nicht selten blutigen Prozedur enthob, zu der er früher gezwungen gewesen war. Auch eine Krawatte brauchte er hier nicht. Kein gebügeltes Hemd. Keinen Nadelstreifen, nur Jeans. Er musste nicht einmal darauf achten, zwei zusammenpassende Socken zu tragen, denn im Sommer steckten seine Füße nackt in Birkenstocksandalen und im Winter in Stiefeln, und da spielte es keine Rolle, was für Socken er anhatte, denn niemand sah sie.
Es war immer noch ungewohnt für ihn, bereits zehn Minuten nach dem Aufstehen geduscht, angezogen und unterwegs zu sein. Und auf was für einer Straße! Hier gab es keinen Verkehr. Keine anderen Autos. Keine Hupen. Keine Polizisten. Keine Geschwindigkeitsbeschränkung. Die Straße, die er jetzt entlangfuhr, war von Bäumen gesäumt, die kurz vor dem Höhepunkt ihrer herbstlichen Farbenpracht standen, und ihre Kurven entsprachen in groben Zügen den Krümmungen des Seeufers. Die Fahrbahn war nach den Frostperioden vieler Jahre rissig. Die meisten Straßen im Ort sahen ebenso aus. Sie erlegten einem zwangsläufig Geschwindigkeitsbeschränkungen auf, und den Leuten in Lake Henry gefiel es so. Sie waren nicht darauf aus, Touristen anzulocken, wie es viele andere Ortschaften am See taten. Es gab kein Gasthaus, keine schicken, kleinen Geschäfte. Obwohl in der Gemeindeversammlung alljährlich hitzige Diskussionen darüber geführt wurden, gab es keinen öffentlichen Zugang zum Wasser. Wer auf den See hinausfuhr, war entweder ein Anwohner oder ein Freund eines Anwohners oder ein Unbefugter.
Jetzt, da die Sommerurlauber abgereist und nur noch die Einheimischen da waren, belief sich die Einwohnerzahl auf eintausendsiebenhunderteinundzwanzig. Elf Geburten standen bevor, was sie steigern würde, zwölf der Einwohner waren sehr krank oder sehr alt, was sie senken würde. Achtundzwanzig Jugendliche waren zurzeit auf dem College. Ob sie zurückkehren würden oder nicht, konnte man nicht sagen. Als John in ihrem Alter gewesen war, hatten die jungen Leute dem Ort für immer den Rücken gekehrt, aber das begann sich zu ändern.
Er hatte eigentlich nur schnell etwas im General Store besorgen wollen, aber dann kam er mit Charlie Owens, dem Besitzer des Ladens, auf die Politik zu sprechen, und dann erzählte ihm Charlies Frau Anette, dass Hillary, die Tochter von Amanda und Stu Watson und Collegeabsolventin im vorletzten Jahr, zu einer Stippvisite nach Hause gekommen sei, nachdem sie sich in letzter Minute entschlossen hatte, das Studium in Europa fortzusetzen. Da Hillary im vorvergangenen Sommer ein Praktikum bei John gemacht hatte, hatte er ein persönliches Interesse an ihrem Werdegang, und so machte er den Umweg zu ihrem Haus, um sie zu interviewen, zu fotografieren und ihr Glück zu wünschen.
Wieder in der Ortsmitte angelangt, hielt er am Postamt und fuhr dann weiter zu dem schmalen, gelb getünchten viktorianischen Gebäude, das zwischen der Post und dem See stand. Als er aus seinem Geländewagen stieg – einem Chevy Tahoe, einer der angenehmen Begleiterscheinungen seines Jobs – griff er sich in der Bewegung seine Tasche vom Beifahrersitz, hängte sie sich über die Schulter und sammelte die vier eben erst erstandenen Zeitungen, eine Tüte Donuts und eine Thermoskanne ein. Als er die ungeteerte Zufahrt auf dem Weg zu der an der Seite des viktorianischen Hauses gelegenen Tür überquerte, klemmte er sich die Tüte zwischen die Zähne und durchforstete die Sammlung an seinem Schlüsselring.
Er suchte noch immer den richtigen, als er die Fliegentür öffnete. Die Tür dahinter führte zur Küche des Hauses, war aus Mahagoni, hochglanzpoliert und von einem einheimischen Künstler mit Schnitzereien verziert. In der unteren Hälfte befanden sich zwischen Schnörkeln ein Dutzend Briefschlitze mit kleinen Messingschildern darüber. Die erste Reihe war höflicherweise den Nachbarorten zugeeignet – Ashcroft, Heedgeron, Cotter, Cove und Center Syfield. Die Reihen darunter gehörten Lake Henry und waren durch Beschriftungen wie »Polizei und Feuerwehr«, »Kirche der freien Gemeinden«, »Textilfabrik« und »Gartenverein« spezifiziert. In Augenhöhe war ohne einen dazugehörigen Schlitz das größte Schild angebracht, und darauf stand »Lake News«.
Als John endlich den Schlüssel gefunden hatte und ins Schloss stecken wollte, gab die Tür nach, und als er sie mit dem Ellbogen weiter aufdrückte, begann das Telefon zu klingeln.
»Jenny?«, rief er. »Jenny?«
»Im Bad!«, kam die gedämpfte Antwort.
Das war nichts Neues, aber wenigstens war Jenny gekommen.
Er warf im Vorbeigehen die Schlüssel auf den Küchentisch und lief dann, immer zwei Stufen auf einmal nehmend, in das Dachgeschoss hinauf. Hier gab es keine Trennwände, was den Raum zum größten des Hauses machte. Die nachträglich eingebauten zusätzlichen Fenster und Oberlichter machten ihn darüber hinaus zum hellsten. Und was am wichtigsten war – er war der Einzige mit Aussicht auf den See. Der Blick aufs Wasser war zwar nicht annähernd so gut wie der von Johns Haus aus, aber besser als gar keiner wie unten, wo drei ineinander verästelte, stämmige Weiden die Sicht versperrten.
Der Dachboden war Johns Reich. Er bot genügend Platz für die Anzeigenabteilung, die Herstellung und die Redaktion, die jeweils mit einem auf den See ausgerichteten Schreibtisch ausgestattet waren. Die Aussicht half John, sich zu konzentrieren und die Nerven zu behalten.
Das Telefon klingelte immer noch. Er ließ die Zeitungen, die er sich unter den Arm geklemmt hatte, auf den Redaktionsschreibtisch gleiten und die Tüte aus Charlies Laden darauf fallen, stellte die Thermoskanne daneben und öffnete das Fenster. Die Luft war inzwischen ganz klar. Sonnenlicht ergoss sich über die Hänge der Hügel im Osten und steckte auf seinem Weg das Laub in Brand, ehe es auf dem Wasser aufkam. Vor einem Monat hätte es dort ein Dutzend Boote angetroffen, deren Sommer-Kapitäne die letzten kostbaren Augenblicke auskosteten, bevor sie ihre Schiffe für dieses Jahr einmotteten. Heute war das einzige Boot da draußen eines von Marlon Deweys sündteuren Criss-Crafts. Die Sonne tanzte über das Deck aus poliertem Eichenholz und ließ das Kielwasser glitzern.
John nahm den Hörer ab.
»Das hat ja gedauert«, klang die Stimme seines Verlegers barsch an sein Ohr. »Wo waren Sie denn?«
John folgte mit den Augen dem eleganten Criss-Craft. Marlon stand am Steuer, flankiert von zwei Enkeln, die bei ihm zu Besuch waren. »Oh, hier und da.«
»Oh, hier und da.« Armand Baynes’ Stimme war weicher geworden. »Das sagen Sie jedes Mal, und Sie wissen, dass ich es nicht widerlegen kann. Der See hat so viele Buchten, dass ich nicht sehen kann, was bei Ihnen vorgeht. Aber das Wichtigste ist mir die Zeitung, und die machen Sie gut. Solange das so bleibt, können Sie meinetwegen so lange schlafen, wie Sie wollen. Haben Sie meinen Beitrag bekommen? Liddie sollte ihn in den Kasten werfen.«
»Ja, er ist da«, antwortete John, ohne sich dessen zu vergewissern, denn Armand Baynes’ Frau war absolut zuverlässig – und ihrem Mann absolut ergeben. Was er ihr auftrug, wurde prompt erledigt. Und so warf sie Armands Kolumne jeden Dienstagmorgen um neun ein. »Was haben Sie sonst noch?«, fragte der Verleger.
John klemmte den Hörer zwischen Schulter und Ohr und zog eine Hand voll Papiere aus seiner Schultertasche. Das Layout für die aktuelle Ausgabe hatte er am Abend zuvor zu Hause gemacht, und er breitete die Seiten jetzt vor sich aus. »Der Aufmacher ist ein Bericht über den der Regierung in Concord vorgelegten Antrag auf die Schulreform. Ich habe dazu die Stimmen des örtlichen Abgeordneten und des Rektors der Cooper-Grundschule eingeholt.«
»Und was steht darüber in Ihrem Leitartikel?«
»Das wissen Sie doch.«
»Es wird den Einheimischen nicht gefallen.«
»Kann sein – aber wir pumpen entweder heute Geld in die Schulen oder morgen in die Wohlfahrt.« Das Problem war, dieses Geld aufzutreiben. Da er sich nicht wieder mit Baynes streiten wollte, der einer der vermögendsten Grundbesitzer der Gemeinde war und den es hart treffen würde, wenn die Grundsteuern verdoppelt würden, nahm er sich das nächste Layout vor. »Der Aufmacher der Seite drei ist ein Bericht über den Chris-Diehl-Prozess mit den Schlussplädoyers, dem Urteil der Geschworenen und der Heimkehr von Chris. Dann habe ich noch einen Artikel über die neu eingeführte Gewinnbeteiligung in der Textilfabrik und einen über den geplanten Personalabbau im Altersheim. In der Rubrik ›Kurzbiografie‹ ist diesmal Thomas Hook dran.«
»Ich kann den Kerl nicht ausstehen«, stieß Armand Baynes angewidert hervor.
John schraubte die Thermosflasche auf. »Er hat eben kein Händchen für Menschen. Dafür aber umso mehr für Computer. Seine Firma ist nicht umsonst schon zwanzig Millionen wert und weiter im Wachsen.«
»Er ist ein grüner Junge«, erboste sich Armand. »Was will der mit so viel Geld?«
John goss Kaffee in seinen Becher. »Er ist zweiunddreißig, und in den sechs Monaten, die er hier ist, hat er sein Haus um das Dreifache vergrößert, die Zufahrtstraße begradigt und gekiest, an Stelle des scheußlichen Baus, der da stand, ein Bürogebäude hingestellt und mit all diesen Aktionen Arbeit geschaffen – für einheimische Bauunternehmer, Zimmerleute, Maurer, Installateure und Elektriker ...«
»Ist ja gut, ist ja gut«, fiel Armand ihm grollend ins Wort. »Was haben Sie noch?«
John trank einen Schluck und zog sich die nächste Seite heran. »Einen Bericht zum bevorstehenden Schuljahresbeginn mit einer Botschaft des Leiters der Academy und dann noch das Neueste von der Polizei, der Feuerwehr und der Bücherei.« Er schlug das »Wall Street Journal« auf und überflog geistesabwesend die Überschriften. »Außerdem den Wochenrückblick von Zeitungen aus Boston, New York und Washington und eine ganze Menge Anzeigen.« Er wusste, dass Armand das gerne hören würde. »Einschließlich einer doppelseitigen! Der Herbst ist eine gute Zeit für Anzeigen.«
»Gott sei Dank«, sagte der Verleger. »Was noch?«
»Neuigkeiten von der Historischen Gesellschaft und dem Drei-Städte-Fußballturnier.«
»Sind Sie an einer Sensation interessiert?«
»Natürlich!« Sensationen gehörten zu den Dingen, die John hier in der Provinz schmerzlich vermisste. Er ließ sich auf seinen Stuhl sinken, schaltete den Computer ein und machte sich bereit, um zu tippen.
»Gestern wurde Noah Thackens Testament eröffnet, und die Familie kocht! Er hat das Haus Tochter Nummer zwei hinterlassen, und jetzt droht Tochter Nummer eins mit einer Klage und Tochter Nummer drei damit, Lake Henry zu verlassen, und sie sprechen nicht mehr miteinander. Arbeiten Sie sich da rein, John.«
Aber John hatte die Hände von der Tastatur genommen und sich zurückgelehnt. »Das ist Privatsache.«
»Privatsache? Heute Abend wird die ganze Gemeinde darüber Bescheid wissen.«
»Warum sollen wir es dann in der Zeitung breittreten? Außerdem drucken wir Tatsachen.«
»Das sind Tatsachen. Das Testament ist von öffentlichem Interesse.«
»Das Testament schon – aber die menschliche Tragödie dahinter ans Licht zu zerren, wäre indiskret. Ich mache doch kein Regenbogenblatt! Waren wir nicht übereingekommen ...«
»Ja, ja«, unterbrach Armand ihn erneut ungeduldig, »aber schließlich passiert nicht oft etwas Aufregendes bei uns.« Er legte auf.
Nein, dachte John, es passierte wirklich nicht viel Aufregendes hier. Der Antrag auf die Schulreform und der Bericht über den vor einem halben Jahr zugezogenen Computermogul lieferten keinen Stoff für einen Bestseller, und der Prozess, der Christopher Diehl wegen Bankbetrugs gemacht worden war, gab nicht im Entferntesten so viel her wie die Mordprozesse, über die er früher geschrieben hatte.
Johns Blick wanderte zu den gerahmten Fotografien, die am anderen Ende des Raumes an der Wand hingen. Eine zeigte ihn im Gespräch mit einem Informanten im City Hall Plaza in Boston, eine andere in einer Großraumredaktion, wo er als einer von vielen Journalisten an seinem Computer arbeitete und gleichzeitig, den Telefonhörer zwischen Ohr und Schulter geklemmt, telefonierte. Auf anderen Fotos war er Hände schüttelnd mit nationalen Politikern zu sehen und lachend mit Kollegen in Bostoner Bars, dann gab es noch eine Aufnahme von einer Weihnachtsfeier in der Redaktion, auf der er und Marley von Freunden umringt waren – und eine Vergrößerung des Bildes auf seinem Presseausweis der »Post«, von dem er sich blass, mit kurzen Haaren, ernster Miene und müden Augen entgegenblickte. Er sah aus, als sei ihm gerade die Story seines Lebens durch die Lappen gegangen oder als litte er unter schwerer Verstopfung.
Die Aufnahmen waren Zeugnisse seines früheren Lebens, ebenso wie das deaktivierte Gerät zum Abhören des Polizeifunks, das unter den Bildern auf einem Aktenschrank stand. Den Funkverkehr der Polizei oder Feuerwehr abzuhören, hatte damals zu seinem Alltag gehört. Jede Redaktion, die etwas auf sich hielt, besaß einen solchen Apparat, und so hatte er zu Beginn seiner Arbeit für die »Lake News« auch hier einen installiert, doch er war es bald müde geworden, den statischen, von keiner menschlichen Stimme durchbrochenen Geräuschen zu lauschen. Außerdem kannte er jeden persönlich, der in eine etwaige Sache verwickelt sein konnte. Wenn etwas passierte, riefen sie ihn an, und wenn sie ihn nicht erreichten, dann wusste Poppy Blake, wo er war. Sie nahm seine Anrufe an, leitete sie weiter oder beantwortete sie. Sie machte für die halbe Gemeinde Telefondienst. Wenn sie ihn an einem Ort nicht fand, suchte sie ihn an einem anderen. Er hatte in den drei Jahren noch nicht ein dramatisches Ereignis verpasst. Wie viele waren es gewesen – zwei, drei, vier?
Doch auch keines dieser Unglücke hätte Stoff für einen Bestseller geliefert.
Seufzend legte er den Hörer auf, zog einen Donut aus der Tüte, schenkte sich Kaffee nach und ließ seinen Stuhl nach hinten kippen. Er hatte kaum die Füße auf dem Schreibtisch überkreuzt, als Jenny Blodgett in der Tür erschien. Sie war neunzehn, blass und blond und so dünn, dass die Wölbung, die das Baby in ihrem Bauch verursachte, überdimensional wirkte. Da er vermutete, dass sie wieder nicht gefrühstückt hatte, nahm er die Füße vom Tisch, stand auf und reichte ihr die Tüte.
»Es ist zwar nicht übermäßig gesund, aber besser als nichts«, meinte er und dirigierte sie zur Treppe und die Stufen hinunter. Ihr Büro befand sich im Erdgeschoss, in dem ehemaligen Salon. Er folgte ihr dorthin, musterte die Stapel auf dem Schreibtisch und fragte: »Wie geht es voran?«
»Ich bin fertig.« Ihre Stimme war leise und kindlich. Sie zeigte nacheinander auf die Stapel: »Das sind die diesjährigen Leserbriefe, das die vom letzten Jahr und das die vom Jahr davor. Was soll ich jetzt machen?«
Er hatte es ihr bereits zweimal gesagt, aber sie arbeitete nur sporadisch, war seit letzter Woche nicht da gewesen und hatte seitdem wahrscheinlich einen Alptraum durchlebt. »Sie in alphabetischer Reihenfolge sortieren und ablegen. Hast du die Etiketten für die Ordner schon getippt?«
Ihre Augen weiteten sich. Sie waren gerötet, was bedeutete, dass sie die ganze Nacht kein Auge geschlossen oder heute Morgen geweint hatte. »Das habe ich vergessen«, flüsterte sie.
»Kein Problem – du kannst es ja jetzt machen. Treffen wir eine Abmachung: Bevor du heute gehst, müssen die Ordner beschriftet und die Leserbriefe sortiert darin abgelegt sein. Einverstanden?«
Sie nickte eifrig.
»Aber erst isst du«, schärfte er ihr im Hinausgehen ein und ging in Richtung Küche, um die Briefkästen zu leeren. Wieder oben in seinem Büro aß er an dem Fenster, von dem aus er auf den See schauen konnte, seinen Donut. Das Criss-Craft war verschwunden, seine Kielwelle ausgelaufen, doch der See war nicht mehr glatt. Wind war aufgekommen, kräuselte das Wasser und flüsterte in den Weiden unter seinem Fenster. Er schob das Fliegengitter nach oben, und beugte sich hinaus. Von »Charlie’s« wehte der Duft von Rindfleischeintopf über die Straße herüber. Zu seiner Linken angelten ein halbes Dutzend alter Männer am Ende des Stegs, der von einem schmalen Sandstrand in den See ging. Zu seiner Rechten breiteten gelb belaubte Birken ihre Äste über niedrigen Sträuchern aus, die zwischen den zu Tage tretenden Felsbrocken bis zum Ufer wuchsen. Ganz rechts standen Häuser von Einheimischen, die sehr viel stattlicher waren als die Ferienhäuser der Sommergäste. Sie lagen, seinem Blick entzogen, in schützenden Buchten oder hinter Biegungen. Er sah nur ein paar Bootsstege hervorlugen, sogar ein verwittertes Floß, das noch mitten im See vor Anker lag. Bald würde es zum Überwintern hereingeholt werden und der See kahl und leer sein.
Das Telefon klingelte. John ließ das Fliegengitter wieder herunter und wartete. Als Jenny nach dem dritten Klingeln noch immer nicht abgehoben hatte, tat er es selbst.
»Lake News.«
»John – hier ist Allison Quimby«, sagte eine resolute Stimme. »Mein Haus bricht zusammen. Ich brauche einen Handwerker. Alle, die ich davor hatte, arbeiten noch immer für Hook. Ist es schon zu spät für ein Inserat?«
»Nein – aber dazu müssen Sie mit der Anzeigenabteilung sprechen. Ich verbinde Sie.« Er schaltete sie auf die Warteleitung, durchquerte im Laufschritt den Raum und nahm den Hörer des Apparates auf dem Schreibtisch der Anzeigenabteilung ab. »Okay.« Er ließ sich auf dem Stuhl nieder und schaltete den Computer ein. »Haben Sie den Text schon formuliert?« Er vermutete es. Allison Quimby war die Besitzerin der hiesigen Immobilienfirma und ein echter Profi.
»Natürlich.«
Sie las, er tippte, machte ein paar Verbesserungsvorschläge, formulierte eine Überschrift, rechnete den Preis aus und ließ sich ihre Kreditkartennummer geben. Nachdem er den Hörer aufgelegt hatte, nahm er ihn wieder ab und wählte eine Nummer.
»Ja?«, meldete sich eine müde Stimme.
»Ich bin’s. Allison Quimby braucht einen Handwerker. Rufst du sie an?« Als er einen leisen Fluch hörte, sagte er: »Du bist nüchtern, Buck, und du brauchst die Arbeit.«
»Wer bist du – mein verdammter Schutzengel?«
John zwang sich zur Ruhe. »Ich bin dein verdammter, älterer Cousin, der, der sich Sorgen um das Mädchen macht, das du geschwängert hast, der, der denkt, dass du der Mühe vielleicht gar nicht wert bist, das Mädchen und das Baby es aber sind. Komm schon, Buck. Du bist ein geschickter Bursche, und Allison zahlt gut und wird dich weiterempfehlen, wenn du deine Sache ordentlich machst.« Er las ihm die Telefonnummer zur Sicherheit zweimal vor. »Ruf sie an«, beschwor er ihn und legte auf.
Sekunden später stand er wieder vor seinem Redakteursschreibtisch am Fenster, und wiederum Sekunden später hatte er seinen Unwillen im Griff. Alles, was er dazu brauchte, war ein langer Blick auf den See und die Erinnerung daran, dass Menschen wie Buck und Jenny den nicht hatten. Sie hatten den Ridge, den Rücken eines Berges, wo die Häuser zu klein, zu nah beieinander und zu schäbig waren, um die Stimmung zu heben, vor allem und erst recht, wenn Alkoholismus, Misshandlungen oder chronische Arbeitslosigkeit das Leben vergällten. John wusste das. Er hatte den Ridge im Blut. Er würde ihn bis zum Tag seines Todes hören, spüren und riechen. Eine Bewegung auf dem See erregte seine Aufmerksamkeit. Etwas Rotes blitzte auf einem Bootssteg in der Ferne. Er kniff die Augen zusammen, um besser sehen zu können, doch dann holte er mit einem kleinen Lächeln ein Fernglas aus der untersten Schreibtischschublade und richtete es auf den Farbfleck. Shelley Cole lag ausgestreckt in einem Liegestuhl in der Sonne. Ihre eingeölte Haut glänzte. Sie war eine attraktive Person, das musste er sagen. Aber die Cole-Frauen brachten die Männer von Lake Henry schon seit drei Generationen um den Verstand. Die meisten von ihnen waren liebe Geschöpfe, die irgendwann gute Ehefrauen und Mütter wurden. Shelley war anders. Sie würde in einer Woche nach Florida zurückkehren, wenn das Wetter hier zu herbstlich würde, um ihr den Erhalt ihrer Bräune zu ermöglichen. John würde sie nicht vermissen. Er mochte genauso empfänglich für ihre Reize sein wie jeder andere Mann hier, aber er würde sie nicht einmal mit einem Feuerhaken anfassen.
Ein kleiner Schwenk des Fernglases und er hatte Hunter’s Island vor sich. Die Insel war nach ihren ersten Besitzern benannt und eine der vielen winzigen, mit denen der See gesprenkelt war. Es stand zwar ein Haus darauf, aber es wurde nur als Feriendomizil genutzt. Die Hunters hatten mehr als ein Jahrhundert den Sommer dort verbracht, ehe sie es an die derzeitigen Besitzer, die Familie La Duc, verkauften, die nun auch schon die dritte Generation von dem schmalen Kiesstrand aus das Schwimmen lehrte.
Eine seltsame Familie, diese La Ducs. Ihre Generationen waren von fast ebenso vielen Skandalen durchsetzt wie die der Hunters. Während seiner Kinderzeit hatte John Gerüchte über beide Familien gehört. Als Erwachsener zurückgekehrt und von Berufs wegen neugierig, hatte er recherchiert, herumgefragt, sich Notizen gemacht. Schließlich hatte er das gesamte Material zu seinen privaten Unterlagen in seinen Aktenschrank gelegt, nachdem ihm nichts davon als Grundlage für ein Buch erschienen war. Aber vielleicht hatte er die Informationen nicht im richtigen Moment gelesen. Vielleicht sollte er sie sich noch einmal vornehmen. Sie sortieren. Chronologisch ordnen. Vielleicht würde ihm dann etwas ins Auge springen. Nach drei Jahren hätte er eigentlich etwas finden müssen, worüber sich zu schreiben lohnte.
Das Telefon klingelte. Diesmal nahm er den Hörer schon nach dem ersten Klingeln ab. »Lake News.«
»Hi, Kip. Hier ist Poppy.«
John grinste. Wie hätte er auch ernst bleiben sollen, wenn er Poppy Blake heraufbeschwor? Sie war ein Kobold, immer fröhlich und guter Dinge. »Hi, Süße. Wie geht’s?«
»Stressig«, antwortete sie, aber aus ihrem Mund klang das wie ein Vergnügen. »Ich habe einen Terry Sullivan für Sie in der Leitung. Soll ich ihn durchstellen?«
Johns Blick flog zu der Fotowand, zu einem der Schnappschüsse, die ihn mit anderen Reportern feiernd zeigten. Terry Sullivan war der hoch gewachsene, schlanke, dunkelhaarige Mann, dessen Schnurrbart ein gehässiges Grinsen verbarg, der, der sich immer in unmittelbarer Nähe einer Gesellschaft aufhielt, um allen anderen zuvorkommen zu können, falls sich eine Sensation ergäbe. Er war von Ehrgeiz zerfressen, selbstsüchtig bis zum Exzess und kannte Loyalität nur vom Hörensagen. Und er hatte John mehr als einmal übers Ohr gehauen.
John fragte sich, woher er die Dreistigkeit nahm, ihn anzurufen. Terry Sullivan war einer der Ersten gewesen, die ihn fallen ließen, als er sich entschieden hatte, Boston den Rücken zu kehren.
Voller Neugier bat er Poppy, die Verbindung herzustellen.
»Hier Kipling«, meldete er sich.
»Hey, Kip. Hier ist Terry Sullivan. Wie geht’s denn so, Bruder?«
Bruder? John ließ sich Zeit mit seiner Antwort. »Mir geht’s gut. Und dir?«
»Ach, es ist immer noch dieselbe Tretmühle, du weißt ja, wie es ist. Na ja – von früher wenigstens. Bei dir da oben muss es ja ziemlich ruhig sein. Manchmal bin ich fast so weit, dass ich hinschmeißen und auch in die Provinz gehen möchte, aber dann überlege ich es mir doch jedes Mal wieder anders. Es ist einfach nicht mein Ding, wenn du weißt, was ich meine.«
»Das weiß ich nur zu gut. Die Menschen hier sind ehrlich. Du würdest unter ihnen auffallen wie ein rosa Elefant.«
Es folgte eine Pause und dann ein Schnauben. »Das war unverblümt.«
»Die Menschen hier sind auch unverblümt. Also – was willst du, Terry? Ich habe nicht viel Zeit. Auch hier ist irgendwann Redaktionsschluss.«
»Okay. Lassen wir den Small Talk. Ich rufe dich als Kollege an. Es geht um eine gewisse Lily Blake. Sie lebt hier in Boston, stammt aber aus Laky Henry. Erzähl mir, was du über sie weißt.«
John setzte sich an seinen Schreibtisch. Lily war Poppys Schwester, ein wenig älter als sie, also um die vierunddreißig. Sie hatte Lake Henry verlassen, um aufs College zu gehen und war in New York City geblieben, um ihren akademischen Abschluss zu machen. In Musik, soviel er sich erinnerte. Er hatte gehört, dass sie Lehrerin geworden war. Und dass sie Klavier spielte. Und dass sie eine Aufsehen erregende Figur hatte.
Die Leute im Ort sprachen immer noch voller Bewunderung über ihre Stimme. Sie hatte mit fünf Jahren im Kirchenchor gesungen, aber John war kein Kirchgänger, und er hatte die Gemeinde lange bevor Lily alt genug gewesen wäre, um donnerstagabends im Tanzsaal von »Charlie’s« zu singen, verlassen.
Sie war seit seiner Rückkehr einige Male hier gewesen – einmal zur Beerdigung ihres Vaters und mehrmals zu Thanksgiving oder Weihnachten – jedoch nie länger als ein, zwei Tage geblieben. So viel er gehört hatte, verstand sie sich nicht mit ihrer Mutter. Er kannte Lily nicht, kannte aber Maida. Sie war ein harter Brocken, und er war geneigt, die Schuld für das schlechte Verhältnis der beiden Frauen nicht bei Lily zu suchen.
»Lily Blake?«, fragte er in einem Ton, als müsse er überlegen.
»Komm schon, Kip. Das Kaff ist winzig. Verkauf mich nicht für dumm.«
»Wenn sie nicht hier lebt, wie zum Teufel soll ich dann was über sie wissen?«
»Geschenkt. Erzähl mir was über ihre Familie. Wer lebt noch und wer nicht mehr? Was tun sie? Was sind das für Leute?«
»Warum willst du das wissen?«
»Ich habe sie kennen gelernt und denke daran, mich mit ihr zu verabreden. Aber davor will ich wissen, was mich erwartet.«
Er dachte daran, sich mit ihr zu verabreden? Das konnte nicht ganz stimmen. Lily Blake stotterte. Zwar nicht mehr so stark wie als Kind, soviel er wusste, aber Terry Sullivan verabredete sich nicht mit Frauen, die Probleme hatten. Eine solche Beziehung hätte ihm mehr abverlangt, als er zu geben bereit war.
»Hat das mit irgendeiner Story zu tun?«, fragte John, obwohl er sich nicht vorstellen konnte, welche Rolle Lily in einer Story spielen sollte, für die Terry Sullivan sich interessierte.
»Nein – es ist rein privat.«
»Und da rufst du mich an?« Sie mochten Kollegen gewesen sein, Freunde waren sie nie gewesen.
Terry verstand die Anspielung falsch. »Ja«, lachte er leise. »Ich finde das auch lustig. Ich meine, sie kommt aus einem Provinznest, und das ist ausgerechnet der Ort, in dem du dich verkrochen hast.«
»Ich habe mich nicht verkrochen – ich bin für jedermann sichtbar.«
»Das ist doch nur eine Redensart. Sind wir empfindlich?«
»Nein, Terry – wir stehen unter Zeitdruck. Sag mir den wahren Grund für deine Fragen nach Lily Blake, oder ich lege auf.«
»Okay. Es geht nicht um mich. Es geht um meinen Bruder. Er will sich mit ihr verabreden.«
Das reichte. John legte auf, ließ die Hand jedoch auf dem Hörer liegen, wartete bis die Verbindung unterbrochen war, nahm wieder ab und wählte Poppy an.
»Hey, Kip«, sagte sie Sekunden später wie immer munter und mit einem Lächeln in der Stimme. »Das ging ja schnell. Und was darf ich jetzt für Sie tun?«
»Zweierlei«, antwortete John. Er war aufgestanden, in der Rechten hielt er den Hörer, den linken Arm hatte er in die Seite gestemmt. »Erstens lassen Sie diesen Mann bitte mit niemandem im Ort reden. Wenn er wieder anruft, schmeißen Sie ihn aus der Leitung. Er ist ein ganz mieser Kerl. Und zweitens erzählen Sie mir bitte von Ihrer Schwester.«
»Von Rose?«
»Nein – von Lily. Was für ein Leben führt sie?«
Kapitel 2
Boston, Massachusetts
In den folgenden Wochen würde Lily Blake sich, wenn sie zu begreifen versuchte, warum ausgerechnet ihr ein Skandal angehängt worden war, daran erinnern, was für einen durchweichten Lappen sie an diesem regnerischen Dienstagnachmittag aus der »Boston Post« gemacht hatte, und sich fragen, ob vielleicht eine erzürnte Zeitungsgottheit sie zur Strafe für ihre Respektlosigkeit mit einem Fluch belegt habe. An dem fraglichen Tag ging es ihr einzig und allein darum, sich gegen die Nässe zu schützen.
Sie stand unter dem hohen, steinernen Rundbogen der kleinen Privatschule an Fuß des Beacon Hill, an der sie unterrichtete, weil sie dachte, der Regen würde in den nächsten Minuten aufhören, aber es goss unvermindert weiter, und die Zeit wurde knapp. Sie sollte um halb sieben im Club am Klavier sitzen und müsste vorher noch nach Hause, um sich umzuziehen.
»Bye, Miss Blake«, rief ein weiterer Schüler ihr zu, bevor er aus dem Schutz der Schule zu einem wartenden Auto rannte. Sie lächelte und hob grüßend die Hand, aber er sah es nicht mehr.
»Soviel zum Indian Summer«, schimpfte Peter Oliver, ein Geschichtslehrer, als er hinter ihr aus der Tür trat. Er blieb neben ihr stehen. Hoch gewachsen und blond war er der Schwarm fast jeden weiblichen Wesens an der Schule. Missmutig schaute er zum Himmel hinauf.
»Wir sind doch wirklich Idioten, Sie und ich. Besessene Idioten. Wenn wir uns auf die für die meisten anderen Lehrer übliche Arbeitszeit beschränken würden, wären wir schon vor zwei Stunden heimgegangen. Da schien noch die Sonne«, brummte er und sah Lily an. »Wo soll’s denn hingehen?«
»Nach Hause.«
»Haben Sie Lust, vorher noch was mit mir zu trinken?« Sie schüttelte lächelnd den Kopf. »Ich muss arbeiten.«
»Das müssen Sie immer. Wo bleibt da das Vergnügen?« Er spannte seinen Regenschirm auf. »Ciao.« Unbeeindruckt von den herabströmenden Wassermassen ging er die Stufen hinunter und in den Regen hinaus.
Lily beneidete ihn um seinen Schirm. Sie hätte seine Einladung annehmen sollen. Vielleicht hätte sich das Wetter in der Zeit, die sie für einen Drink gebraucht hätte, ja gebessert. Nein, ihre Entscheidung war schon richtig gewesen – erstens trank sie keinen Alkohol, und zweitens gehörte sie nicht zu Peters Fans. Peter liebte Peter, und es war schon schlimm genug, dass sie seine Selbstbeweihräucherungen im Lehrerzimmer erdulden musste. Seine Egozentrik war penetrant.
Außerdem hatte sie es wirklich eilig. Sie nahm die »Post« aus ihrer Aktentasche, schlug sie auf und lief, sich die Zeitung über den Kopf haltend, die Treppe hinunter und durch die schmalen, kopfsteingepflasterten Straßen am Fuß des Hügels, bog dann in die Beacon Street ein, wo es einen gepflasterten Bürgersteig gab. Die Aktentasche an die Brust gedrückt, machte sie sich unter der Zeitung so klein wie möglich. Da sie ohnehin klein war, hätte man denken sollen, dass das Papier ihr ausreichend Schutz geboten hätte, aber es hing schon sehr bald durchnässt an ihren Ohren herunter, und das Tanktop und der kurze Rock, die an diesem heißen Morgen die genau richtige Kleidung gewesen waren, boten dem kühlen Regen nun entschieden zu viel Angriffsfläche.
Lily hastete mit gesenktem Kopf weiter, bog links in die Arlington und dann rechts in die Commonwealth ein. Hier standen zwar vor der Nässe schützende Bäume, aber dafür hatte der von Westen kommende Wind freie Bahn und war viel kühler. Sie senkte den Kopf noch tiefer, stemmte sich gegen Wind und Wetter, einen Block, einen zweiten, dritten, vierten. Als sie das Ende des fünften Blocks erreichte, hätte sie die Zeitung eigentlich wegwerfen können, denn nun waren auch ihre Haare nass.
Als sie die Eingangshalle des Apartmenthauses betrat, streckte sie die Hand mit den nassen Papierlappen weit von sich, während sie in ihrer Aktentasche nach den Schlüsseln kramte. Die Luft im Foyer, die sie morgens als stickig empfunden hatte, erschien ihr plötzlich als herrlich warm. Sie strich sich die nassen Haare aus dem Gesicht, ging am Lift vorbei zu den Müllschluckern und warf die Zeitung weg. Sie hatte sie nicht gelesen, doch sie bezweifelte, dass ihr viel entgangen war. Abgesehen von Erzbischof Francis P. Rosettis Ernennung zum Kardinal, über die am letzten Wochenende ausführlich berichtet worden war, tat sich in der City nichts Aufsehen Erregendes.
Sie ging in den Raum, in dem die Briefkästen untergebracht waren und wünschte sich augenblicklich, sie hätte es nicht getan. Peter Oliver war nicht ihr Typ, Tony Cohn hingegen schon eher. Er wohnte in einer der Penthouse-Suiten, war Unternehmensberater und so dunkel, wie Peter blond. Im klassischen Sinn war Peter der besser aussehende von beiden, doch Tony hatte etwas reizvoll Fremdländisches und Verwegenes an sich. Lily war selbst unter günstigsten Bedingungen nicht besonders redselig, aber wenn Tony sie ansah, brachte sie kaum ein Wort heraus.
Natürlich hatte er sie noch nie eingeladen, nicht auf einen Drink und auch nicht zum Essen. Abgesehen von einer knappen Begrüßung, wenn sie zufällig gemeinsam mit dem Lift hinauf- oder hinunterfuhren, sprach er nicht einmal mit ihr und würdigte sie kaum eines Blickes.
Aber ausgerechnet jetzt schaute er sie an – und sie konnte sich lebhaft vorstellen, was für einen unvorteilhaften Anblick sie nach ihrem Fußmarsch durch den Regen bot. So unauffällig wie möglich zupfte sie an dem nassen Tanktop, das ihr an den Brüsten klebte. Sie waren ihr größter Pluspunkt, aber in diesem Moment brachten sie sie nur in Verlegenheit.
Tony allerdings schien nicht beeindruckt. »Sie hat’s erwischt, was?«, sagte er mit seiner tiefen Stimme, und die Belustigung, die darin mitschwang, half ihr über ihre Verlegenheit hinweg.
Lily nickte und konzentrierte sich darauf, ihren Briefkasten aufzuschließen. Sie fragte sich, wo Tony wohl in einer halben Stunde sein würde und warum sie ihm nicht dann über den Weg laufen konnte. Dann würde sie gut und toll aussehen.
Sie nahm ihre Post aus dem Briefkasten und zermarterte sich das Gehirn noch immer nach einer originellen Bemerkung – obwohl sie wusste, dass sie sie, selbst wenn ihr eine einfiele, auch nach jahrelanger Sprachtherapie wahrscheinlich nicht flüssig herausbrächte und dann noch verlegener wäre als ohnehin schon –, als er seinen Briefkasten zusperrte und hinausging. Gleich darauf hörte sie, wie sich die Aufzugtür öffnete und wieder schloss.
Er hätte auf sie warten können.
Gottlob hatte er es nicht getan.
Niedergeschlagen verließ sie den Raum und schaute ihre Post durch, während sie darauf wartete, dass der Lift wieder herunterkäme. Es waren zwei Rechnungen, zwei Gagen-Schecks, mit denen sie die Rechnungen gleich begleichen könnte, und vier Prospekte.
Als sie den Aufzug im vierten Stock verließ, wäre sie beinahe mit einer ihrer Nachbarinnen zusammengestoßen, die nach unten fahren wollte. Elizabeth Davis gehörte eine illustre PR-Agentur, und ihr Erscheinungsbild war entsprechend durchgestylt. Ihr Kostüm war rot und kurz, ihr Lippenstift hochglänzend, ihr Regenschirm schwarz und lang. Sie hatte sich offenbar der Spiegelverkleidung der Aufzugtür bedient, um große goldene Ohrringe anzulegen. Jetzt trat sie in die Kabine, um ihr Werk vor dem Spiegel dort zu vollenden, wobei sie den Fuß in die Tür stellte, damit sie offen bliebe.
»Lily. Sie kommen wie gerufen.« Mit schiefgelegtem Kopf, den Blick auf den Spiegel geheftet, mühte sie sich mit dem zweiten Ohrring ab. »Ich gebe eine Party für das Komitee, das die Kagan in ihrem Wahlkampf unterstützt, und brauche eine musikalische Untermalung. Ich habe Sie im Club gehört – Sie wären ideal dafür.« Der Ohrring saß an seinem Platz, und Elizabeths Blick glitt zu Lily. »Oje – Sie sind ja tropfnass – ich weiß ja, wie Sie normalerweise aussehen. Ihre schlichte Eleganz ist genau das, was uns vorschwebt. Die Spendenparty steigt morgen in zwei Wochen. Wir können Ihnen zwar keine Gage bezahlen – unser Budget ist jämmerlich niedrig –, aber ich kann Ihnen so gut wie garantieren, dass Ihr Auftritt Ihnen ein, zwei neue Engagements einbringen wird, denn es werden wichtige Leute da sein, und wichtige Leute geben Partys. Also wäre der Abend kein absolutes Verlustgeschäft für Sie. Außerdem wäre die Kagan auf dem Gouverneurssessel ein wahrer Glücksfall für die Frauen des Staates Massachusetts, und so wäre es auch in dieser Hinsicht in Ihrem Interesse, bei uns zu spielen. Wie ist es?«
Ihr Angebot schmeichelte Lily. Es verging kaum eine Woche, in der Elizabeths Name nicht in der »Post« stand. Sie veranstaltete nur Top-Partys. Lily war sich klar darüber, dass sie so knapp vor dem Fest nicht die erste Wahl war, doch das störte sie nicht. Sie spielte gerne auf politischen Veranstaltungen. Je mehr Leute da waren, umso leichter fiel es ihr, sich in ihrer Musik zu verlieren. Außerdem teilte sie Elizabeths Meinung über Lydia Kagan.
»Ich mache es«, sagte sie.
Elizabeth strahlte und nahm den Fuß aus der Tür. »Ich schicke Ihnen noch eine schriftliche Bestätigung, aber kreuzen Sie den Termin schon mal in Ihrem Kalender an. Es ist beschlossene Sache. Ich zähle auf Sie.« Die Aufzugtür schloss sich.
Lily war zu spät dran, um sich mehr als ein flüchtiges Gefühl der Befriedigung gestatten zu können. Sie hastete den Flur hinunter und schloss die Tür zu ihrer Wohnung auf. Sie hatte das Apartment direkt vom Eigentümer gemietet, der, wie sie, die Farbe Grün liebte und ein weiches Herz hatte, dem sie es verdankte, sich diese Adresse leisten zu können. Der Wohnraum war klein. Eine Wand wurde vom Klavier dominiert, eine andere von einem bis zum Bersten voll gestopften Bücherregal. Darüber hinaus war das Zimmer mit einem Sofa ausgestattet, das mit dem Rücken zu den auf das Einkaufszentrum hinausgehenden Fenstern stand, einem in Grün, Beige und Weiß geblümten Polstersessel und einem daneben und somit mehr in dem winzigen Vorraum als im Zimmer stehenden Glastisch, der Platz für das Telefon, eine Lampe und den CD-Player bot, aus dem jetzt auf einen Knopfdruck hin Chopin erklang. Die Küche erschöpfte sich in einer Zeile entlang der dritten Wohnzimmerwand, und das Schlafzimmer war gerade groß genug für ein Doppelbett, aber das ganze Apartment war vor ihrem Einzug renoviert worden, wodurch sie in den Genuss eines modernen Marmorbades mit einer verglasten Duschkabine kam.
Und die Letztere war jetzt ihr Ziel. Sie schälte sich aus den nassen Sachen, trat in die Dusche und drehte das heiße Wasser auf, ließ sich genießerisch von den prickelnden Strahlen wärmen. Dann seifte sie sich ein und wusch sich die Haare und musste der Behaglichkeit viel früher als gewollt ade sagen, denn die Uhr tickte. In Rekordzeit legte sie Make-up auf und föhnte ihre kinnlangen Haare, um ihnen Fülle zu verleihen, schlang in aller Eile ein Brot mit Erdnussbutter und Marmelade hinunter, schlüpfte in ein pflaumenblaues Kleid, das gut zu ihrer hellen Haut und ihren dunklen Haaren passte, stieg in schwarze Pumps und rundete das Ganze mit glitzernden, aus vielen kleinen Plättchen zusammengefügten, langen Ohrclips ab, die in der Bewegung wie geschmolzenes Silber wirkten. Dann griff sie sich ihre Handtasche und einen Schirm und machte sich auf den Weg.
Natürlich war Tony Cohn weit und breit nicht zu entdecken, als sie ins Foyer kam, aber wenigstens hatte es aufgehört zu regnen.
Der Essex Club florierte in einem großen Bau aus braunem Sandstein auf der anderen Seite der Commonwealth Avenue, nur drei Blocks von ihrer Wohnung entfernt, ein privater Dinnerclub mit erlesener Ausstattung und einer äußerst geschickten Geschäftsführung. Erleichtert, dass Sie sogar noch ein paar Minuten Zeit hatte, ging Lily nach ihrer Ankunft ins Büro, wo Daniel Curry, der Besitzer des Clubs, gerade eine Last-Minute-Reservierung annahm.
Der stämmige Fünfundvierzigjährige mit den roten Apfelbäckchen begrüßte sie mit dem Anheben seines Kinns und beendete das Telefongespräch. Bis dahin hatte sie ihre Sachen im Schrank verstaut.
Sie warf einen Blick auf das Reservierungsbuch. »Gut?«
»Für einen Dienstag sogar außerordentlich. Es sind zwar im Moment noch ein paar Tische frei, aber in einer Stunde sind wir rappelvoll. Es kommen lauter nette Leute. Viele alte Freunde.« Er nannte einige Namen von Paaren, die Lily in den drei Jahren, die sie jetzt hier spielte, kennen gelernt hatte.
»Irgendwelche speziellen Wünsche?«, fragte sie.
»Tom und Dotty Frische haben dreißigsten Hochzeitstag. Sie kommen um acht und werden an Tisch sechs sitzen. Er hat für ein Dutzend Rosen gesorgt und gefragt, ob Sie ›The Twelfth of Never‹ spielen würden, wenn der Champagner entkorkt wird.«
Diesen Aspekt ihrer Arbeit hier liebte Lily besonders.
»Natürlich. Sonst noch etwas?«
Als er verneinend den Kopf schüttelte, verließ sie das Büro und stieg die breite Wendeltreppe zu dem großen Speisesalon hinauf.
Er war, dem Charakter des Clubs entsprechend, dunkel getäfelt, mit schweren Möbeln und Ölgemälden aus dem neunzehnten Jahrhundert ausgestattet. Die Farben – Jägergrün und Burgunderrot – zogen sich durch die Tischwäsche, das Geschirr, den Teppichboden und die Vorhänge. Das luxuriöse Alte-Welt-Ambiente gab Lily das Gefühl, an einem geschichtsträchtigen Ort zu arbeiten.
Sie begrüßte den Oberkellner und schenkte auf ihrem Weg zu dem hochglanzpolierten schwarzen Steinway-Flügel den Stammgästen, auf die ihr Blick fiel, ein gewinnendes Lächeln. Manchmal erschien es ihr sündhaft, sich dafür bezahlen zu lassen, dass sie auf diesem Instrument spielen konnte, aber natürlich hütete sie sich, ihrem Arbeitgeber das zu verraten. Nach Abzug der Steuern reichte, was sie an der Winchester School mit Musikunterricht, der Leitung von Chorgruppen und ihren Klavierstunden verdiente, gerade mal für die Miete und den Lebensunterhalt. Ohne ihre Arbeit hier und ihre Auftritte auf Partys könnte sie sich darüber hinaus kaum etwas leisten. Außerdem hatte dieser Job sie veranlasst, nach Boston zu übersiedeln. Der Club war viel angenehmer als der von Albany, in dem sie vorher gespielt hatte.
Nachdem sie sich auf der Klavierbank zurechtgesetzt hatte, spielte sie sich mit ein paar leisen schnellen Akkorden ein. Die Tasten fühlten sich kühl und glatt an. Wie die erste Tasse Kaffee am Morgen waren diese ersten, zarten Berührungen stets die köstlichsten.
Sie hielt den Kopf gesenkt, und ihre Haare fielen ihr ins Gesicht wie ein Vorhang. Als sie den Kopf hob, warf sie sie in einer fließenden Bewegung nach hinten und begann ihre heutige Darbietung mit leicht meditativ verfremdeten Versionen bekannter Songs. Stammgäste mochten die Melodien wieder erkennen, aber selbst die häufigsten Besucher bekamen nicht zweimal genau die gleiche Variation zu hören, denn Lily ließ sich von ihrer Intuition leiten. Notentexte brauchte sie nur, um klassische Werke einzustudieren, dasselbe galt für Liedertexte, aber meistens benutzte sie CDs als Vorlagen.
Sie spielte nach Gehör, und wenn sie eine Melodie beherrschte, war sie in der Lage, eine dem Publikum entsprechende Variation anzubieten. Manche Partys, auf denen sie spielte, verlangten Soft Rock, andere nach Broadway-Hits und wieder andere nach Brahms. Ein und denselben Song auf den verschiedensten Zuhörerkreis zuzuschneiden, war eines der Dinge, die Lily am besten konnte. Sie genoss diese ständige Herausforderung, die sie davor bewahrte, im Einerlei zu versacken. Der Flügel stand in einer Ecke auf einem Podium, was ihr gestattete, beim Spielen den Raum zu überblicken. Vertrauten Gesichtern schenkte sie ein herzliches Lächeln, neuen ein eher unverbindlich-freundliches. Dan hatte Recht – es waren offenbar wirklich lauter nette Leute da. Es gab auch alte Krakeeler unter den Stammgästen, aber heute war keiner davon zu sehen.
Lily stimmte sich auf die Gäste ein und entschied sich für ein Medley gefühlvoller Oldies. Sie begann mit »Autumn Leaves«, ging fließend zu »Moon River« über und schloss »Blue Moon« und danach »September« an. Zweimal erfüllte sie Wünsche, die vom Oberkellner überbracht wurden. Um halb acht, als Dan Curry ihr ein Glas Wasser reichte, machte sie eine kurze Pause.
»Irgendwelche Fragen?«, erkundigte er sich, als sie einen Schluck trank.
»Davis hat gerade vier Gäste an Tisch zwölf gesetzt«, sagte sie leise, wobei sie sorgsam vermied, dorthin zu schauen. »Sie kommen mir bekannt vor, aber ... sind sie Mitglieder?«
»Nein. Es sind die Gouverneure von New Hampshire und Connecticut mit ihren Frauen. Die beiden Herren waren zu einer Konferenz hier, die heute geendet hat. Wahrscheinlich haben Sie ihre Fotos in der Zeitung gesehen.«
Das erklärte, warum ihr die Männer bekannt vorkamen. Sie deutete mit einem vorsichtigen Blick auf den Mann an Tisch neunzehn, der Schnurrbart war unverwechselbar und zierte das Gesicht eines Reporters von der »Post«.
»Ist Terry Sullivan wegen der Gouverneure hier, Dan?«
»Gesagt hat er es nicht«, erwiderte ihr Chef. »Sonst hätte ich ihn nicht hereingelassen.« Der Club schützte seine Mitglieder. Journalisten waren nur willkommen, wenn sie Mitglieder oder Gäste eines Mitglieds waren, was auf Terry Sullivan zutraf. Nur wenige Journalisten hatten Sponsoren, geschweige denn selbst das Geld, um einem solchen Club beitreten zu können. »Es gefällt ihm offensichtlich hier. Ist das nicht schon sein dritter Besuch in drei Wochen?«
»Ja.« Sie hatte ebenfalls mitgezählt.
»Er mag Sie.«
»Nein.« Aber sie konnte nicht leugnen, dass seine Anwesenheit unter anderem auch mit ihr zusammenhing.
»Sein Interesse an mir ist rein beruflich. Er schreibt eine Serie über Entertainer in Boston und will mich dafür gewinnen.«
»Das ist ja großartig.«
Lily fand das nicht. »Ich habe schon zweimal abgelehnt.«
»Das muss an seinem Schnurrbart liegen.« Dan grinste. Er warf einen Blick zur Tür, und seine Wangen röteten sich vor Aufregung. »Da ist er ja!«, strahlte er und eilte auf den Neuankömmling zu.
Lily lächelte, als sie Francis Rosetti sah. Erzbischof Francis Rosetti. Nun: Seine Eminenz Francis Kardinal Rosetti. Sich an die neue Anrede »Euer Eminenz« zu gewöhnen, würde eine Weile dauern. Lily und der Erzbischof kannten sich schon eine längere Zeit. Sie war ebenso stolz auf seine Ernennung wie Dan, der mit Rosettis Nichte verheiratet war.
Lily war nicht katholisch – sie war überhaupt nicht religiös –, aber dieser kirchliche Würdenträger beeindruckte sie immer wieder. Natürlich war er nicht im Ornat erschienen – Hut und Rock bekäme er erst in vier Wochen, wenn er zu seiner ersten Sitzung des Kardinalskollegiums nach Rom reiste –, aber der hoch gewachsene Mann mit dem vollen weißen Haar strahlte mit seinem schlichten schwarzen Anzug und dem Zinnkreuz auf der Brust eine unvergleichliche Souveränität aus.
Es war das erste Mal, dass Lily ihn nach seiner Ernennung sah. Häufig als Pianistin bei Veranstaltungen der Erzdiözese Boston engagiert, hatte sie zwei Abende zuvor auf einer Gartenparty auf seinem Amtssitz gespielt, aber heute war er zum ersten Mal im Club. Wie von selbst fanden ihre Finger die Tasten für »Chariots of Fire«.
Er horchte auf, schaute herüber und blinzelte ihr zu.
Erfreut spielte sie die Melodie zu Ende und ging dann zu anderen Weisen über. Francis Rosetti und sie hatten oft genug vierhändig gespielt, so dass sie wusste, was er mochte. Er war ein Mann, der das Leben in seiner ganzen Fülle schätzte, und das spiegelte sein Musikgeschmack wider, sowohl in Bezug auf geistliche als auch hinsichtlich profaner Musik.
Sie spielte »Memory«, leitete fließend zu »Argentina« über, ließ »Deep Purple« folgen, das Thema von »Dr. Schiwago« und »The Way We Were«.
Um Punkt acht wurde ein Paar an den Tisch mit den roten Rosen gesetzt, und als der Weinkellner den Champagner entkorkte, rückte Lily sich das Mikrofon zurecht und intonierte »The Twelfth of Never«; Ihre volltönende Altstimme passte optimal zu der Atmosphäre des Clubs.