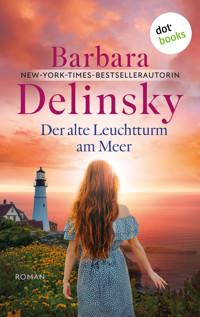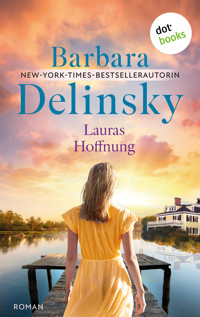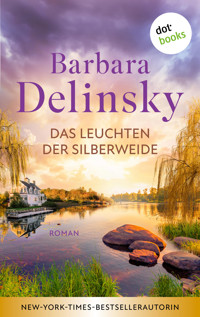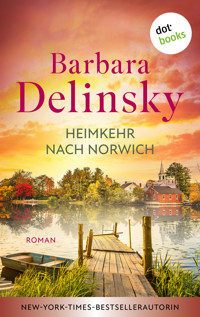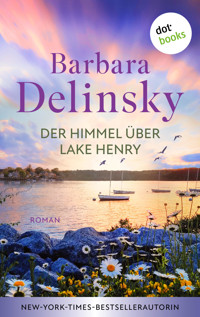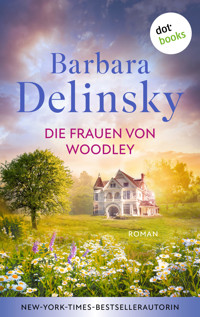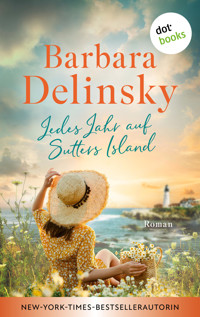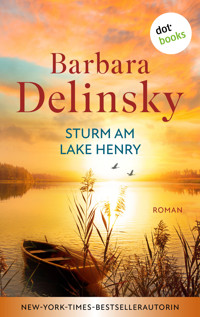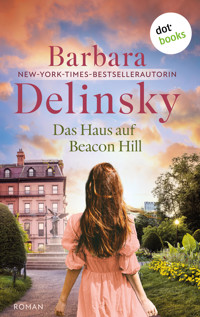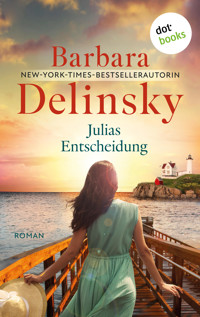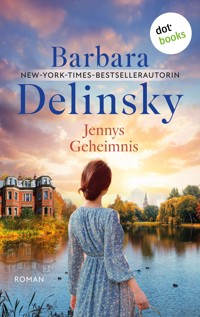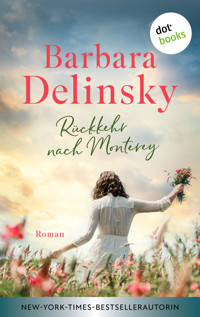
9,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Kraft von Hoffnung und die unvergleichliche Stärke einer Familie – ein Schicksalsroman für Fans von Kristin Hannah und Jodi Picoult! Früher stellte er seine Karriere über alles – doch der Tag, an dem seine Frau ihn mit ihren gemeinsamen Töchtern verließ, hat Jack für immer verändert. Jetzt, sechs Jahre später, erfährt er, dass Rachel nach einem Unfall im Koma liegt. Ohne zu zögern, kehrt nach Monterey zurück, in das alte Haus an der nordkalifornischen Küste. Seine Töchter brauchen ihn jetzt – doch aus den Kindern sind inzwischen rebellische Teenager geworden. Und während Jack in das fremde Leben seiner Familie eintaucht, muss er erkennen, dass er seine Frau nie wirklich gekannt hat. Weder die Bedeutung hinter ihren wunderschönen Ölgemälden noch das Geheimnis, das sie dazu brachte, ihn zu verlassen. Wird das Schicksal ihm noch einmal eine Chance geben?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 506
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch:
Früher stellte er seine Karriere über alles – doch der Tag, an dem seine Frau ihn mit ihren gemeinsamen Töchtern verließ, hat Jack für immer verändert. Jetzt, sechs Jahre später, erfährt er, dass Rachel nach einem Unfall im Koma liegt. Ohne zu zögern, kehrt nach Monterey zurück, in das alte Haus an der nordkalifornischen Küste. Seine Töchter brauchen ihn jetzt – doch aus den Kindern sind inzwischen rebellische Teenager geworden. Und während Jack in das fremde Leben seiner Familie eintaucht, muss er erkennen, dass er seine Frau nie wirklich gekannt hat. Weder die Bedeutung hinter ihren wunderschönen Ölgemälden noch das Geheimnis, das sie dazu brachte, ihn zu verlassen. Wird das Schicksal ihm noch einmal eine Chance geben?
Über die Autorin:
Barbara Delinsky wurde 1945 in Boston geboren und studierte dort Psychologie und Soziologie. Nach der Geburt ihres ersten Sohnes arbeitete sie als Fotografin für den Belmont Herald, erkannte aber bald, dass sie viel lieber die Texte zu ihren Fotos schrieb. Ihr Debütroman wurde auf Anhieb zu einem großen Erfolg. Inzwischen hat Barbara Delinsky über 70 Romane veröffentlicht, die in mehr als 20 Sprachen übersetzt wurden und regelmäßig die New-York-Times-Bestsellerliste stürmen. Sie engagiert sich außerdem sehr stark für Wohltätigkeitsvereine und Aufklärung rund um das Thema Brustkrebs. Barbara Delinsky lebt mit ihrem Mann in New England und hat drei erwachsene Söhne.
Die Website der Autorin: barbaradelinsky.com/
Bei dotbooks veröffentlichte Barbara Delinsky auch ihre Romane:
»Die Schwestern von Star’s End«
»Jennys Geheimnis«
»Das Weingut am Meer«
»Julias Entscheidung«
»Lauras Hoffnung«
»Die alte Mühle am Fluss«
»Der alte Leuchtturm am Meer«
»Das Haus auf Beacon Hill«
»Sturm am Lake Henry«, Die Blake-Schwestern 1
»Der Himmel über Lake Henry«, Die Blake-Schwestern 2
»Heimkehr nach Norwich«
»Das Licht auf den Wellen«
»Die Frauen Woodley«
»Ein Neuanfang in Casco Bay«
»Im Schatten meiner Schwester«
»Drei Wünsche hast du frei«
»Ein ganzes Leben zwischen uns«
»Jedes Jahr auf Sutters Island«
»Was wir nie vergessen können«
***
eBook-Neuausgabe Juni 2024
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1998 unter dem Originaltitel »Coast Road« bei Simon & Schuster, New York.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1998 by Barbara Delinsky
Published by Arrangement with Barbara Delinsky
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2001 Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98690-971-0
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Rückkehr nach Monterey« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Barbara Delinsky
Rückkehr nach Monterey
Roman
Aus dem Amerikanischen von Georgia Sommerfeld
dotbooks.
Prolog
Als das Telefon klingelte, war Rachel Keats in ihrem Atelier, und arbeitete an einem Meerotter-Bild. Sie malte in Öl und hatte endlich das richtige Schwarz für die Otteraugen gefunden. In diesem Moment kam eine Unterbrechung nicht in die Frage. Samantha war für diesen Fall vorgewarnt.
»Hallo! Sie sind mit dem Anschluß von Rachel, Samantha und Hope verbunden. Wir sind im Augenblick nicht zu erreichen. Bitte hinterlassen Sie Ihren Namen und Ihre Nummer, wir rufen zurück.«
Während der auf die Ansage folgenden Reihe von Pieptönen machte sie sich mit einem runden Pinsel an das erste Auge. Die tiefe, männliche Stimme, die schließlich erklang, war zu erwachsen, als daß der Anruf Samantha hätte gelten können, und außerdem kannte Rachel dieses Timbre, das irreführenderweise die Vorstellung von einem tollen Mann weckte. Der Bursche war Eintrittskarten-Vorverkäufer, ein Freund eines Freundes, ohne Ausstrahlung und Sinn für eine gepflegte Erscheinung. Aber tüchtig. »Ich habe drei Karten für das Garth-Brooks-Konzert in San Jose heute abend zu vergeben«, sagte er. »Spitzenplätze! Wenn ich in fünf Minuten nichts von Ihnen gehört habe, rufe ich den Nächsten auf meiner Liste an ...«
Rachel ließ Otterauge Otterauge sein und riß den Hörer von der Gabel. »Ich will sie!«
»Hallo, Rachel! Wie geht’s meiner Lieblingskünstlerin?«
»Gestreßt. Sie brauchen eine Kreditkartennummer, stimmt’s? Bleiben Sie dran – es dauert nur eine Minute!« Sie legte den Hörer neben den Apparat, hetzte durch das Haus in die Küche, wo ihre Brieftasche auf dem Tisch lag und gab, nach Luft ringend, von dort aus die Nummer durch. Als sie ins Atelier zurückkehrte, betrachtete sie schuldbewußt die Leinwand auf der Staffelei und die sechs auf dem Boden an der Wand lehnenden, ebenfalls noch unfertigen Bilder, dachte an all das, was sie in den kommenden drei Wochen außerdem noch zu tun hätte, und kam zu dem Schluß, daß sie verrückt war. Sie hatte keine Zeit, in ein Konzert zu gehen.
Aber die Mädchen würden ausflippen vor Begeisterung.
Sie stieß das Fenster auf und lehnte sich in die frische, nach Wald duftende Luft hinaus.
»Samantha! Hope!« Sie waren irgendwo da draußen. Rachel rief noch einmal.
Von weither antworteten zwei helle Stimmen.
»Beeilt euch!« drängte Rachel.
Gleich darauf stürzten ihre Töchter mit wehenden blonden Haaren und vom Rennen geröteten Wangen zwischen den Rotholzbäumen hervor, und Samantha sah in diesem Moment keinen Tag älter aus als Hope. Rachel verkündete ihnen die Neuigkeit noch bevor sie bei ihr ankamen, und der Ausdruck auf ihren Gesichtern machte die Aussicht auf ein, zwei strapaziöse Nächte ohne Schlaf mehr als wett.
»Ist das dein Ernst?« Hopes große Augen strahlten über blendendweißen Zähnen, die noch zu groß für ihr sommersprossiges Gesicht waren. Sie war dreizehn, aber noch völlig kindlich.
Rachel nickte lächelnd.
»Phantastisch!« hauchte Samantha. Sie war mit ihren fünfzehn Jahren einen Kopf größer als ihre Schwester und bereits sanft gerundet, sah alles in allem genau wie Rachel in diesem Alter aus.
»Heute abend?« vergewisserte Hope sich.
»Heute abend.«
»Gute Plätze?« fragte Samantha.
»Spitzenplätze.«
»Und gehen wir hin, wie wir es uns ausgemalt haben – mit allem Drum und Dran?«
Rachel hatte nicht die Zeit dazu und auch nicht das Geld, aber wenn ihre Bilder Anklang fänden, würde das Geld kommen, und was die Zeit betraf, so war das Leben zu kurz, um damit zu geizen. »Mit allem Drum und Dran«, bestätigte sie, denn es würde Samantha guttun, vom Telefon wegzukommen, und Hope, von ihrer Katze wegzukommen, und, ja, vielleicht sogar Rachel, von ihren Ölgemälden wegzukommen.
»O Gott, ich muß Lydia anrufen!« rief Samantha.
»Viel wichtiger ist, daß die für morgen fälligen Hausaufgaben erledigt werden«, erwiderte Rachel. »Das gilt für euch beide. Wir fahren in einer Stunde los.« Sie war wirklich verrückt. Nicht nur ihre Arbeit drängte, auch die Mädchen hatten reichlich zu tun, aber ... aber es ging um Garth.
Sie kehrte für die eine Stunde an ihre Staffelei zurück, brachte jedoch ebensowenig zustande, wie sie es von ihren Töchtern befürchtete. Und dann war es schließlich soweit. Sie stiegen in den Kombi und fuhren in Richtung Norden. Rachel hatte sich angesichts ihrer gemeinsamen Eines-Tages-klappt-es-bestimmt-Träumereien schlau gemacht und wußte, daß der einschlägige Laden an der Strecke nach San Jose lag. Nach dreißig Minuten inklusive einer himmelschreienden Geldausgabe verließen sie das Geschäft mit Cowboystiefeln unter den Jeans, Cowboyhüten auf den Köpfen und suppentassengroßen Strahleaugen.
Wiederum dreißig Minuten später starteten sie, umweht von Burger- und Pommesduft, McDonalds-gestärkt zu ihrer letzten Etappe.
Was sie vorfanden, übertraf ihre kühnsten Erwartungen. Unmengen von Fans, Light-Shows und wabernde Nebel bildeten den Rahmen für den Mann, der auf Bühnen, die aus dem Nichts aufstiegen, ohne Pause einen Hit nach dem anderen und von jedem eine nie zuvor gehörte längere Version sang. Wie hätte sich Rachel angesichts ihrer beiden sich verzückt neben ihr wiegenden Töchter und der Begeisterung um sie herum nicht anstecken lassen sollen? Nachdem sie sich bei den ersten beiden Songs noch zurückgehalten hatte, war ihre Schüchternheit beim dritten verflogen, und auch sie sprang von ihrem Sitz auf, klatschte mit hocherhobenen Händen und sang mit. Sie jubelte mit Samantha und Hope, wenn ein vertrauter Akkord ein besonders beliebtes Lied ankündigte, und applaudierte und schrie mit ihnen Beifall, wenn es endete. Die drei sangen sich bis zur letzten Zugabe die Seele aus dem Leib, und dann verließen sie das Stadion Arm in Arm – drei Freundinnen, die zufällig miteinander verwandt waren.
Es war ein ganz besonderer Abend, und Rachel bereute keine Sekunde – nicht einmal, als Samantha fragte: »Hast du das Mädchen vor uns gesehen? Das mit dem französischen Zopf? Hast du die Tätowierung auf ihrem Arm gesehen? Die Rose? Was würdest du sagen, wenn ich so was auch wollte?«
»Nein«, antwortete Rachel, während sie den Kombi durch die Dunkelheit nach Süden lenkte.
»Auch keine ganz winzige? Einen kleinen Stern am Knöchel?«
»Nein.«
»Aber es ist so cool!«
»Nein.«
»Warum nicht?«
»Weil sie älter war als du. Wenn du fünfundzwanzig bist ...«
»So alt war sie nicht.«
»Okay – wenn du zweiundzwanzig bist, können wir noch mal darüber reden. Jetzt nicht.«
»Das hat doch nichts mit dem Alter zu tun – es ist einfach Mode.«
Damit hatte sie Rachel ein Stichwort geliefert. »Du sagst es – eine Mode, die etwas vermittelt, was du mit zweiundzwanzig vielleicht gar nicht mehr vermitteln möchtest, wenn du dein Herz an jemanden oder etwas hängst, bei dem es sich als unpassend erweist.«
»Seit wann hast du denn diesen Hang zur Spießigkeit?«
»Seit meine fünfzehnjährige Tochter mit Riesenschritten auf die harte Realität zumarschiert.«
»Tattoos sind toll. Alle haben welche.«
»Lydia nicht. Shelley auch nicht. Und auch keines von den Mädchen, die ich aus dem Schulbus steigen sehe.«
Samantha verschränkte die Arme auf der Brust und senkte den Kopf. Rachel konnte sich gut vorstellen, wie sie unter der breiten Hutkrempe mit finsterem Gesicht vor sich hin starrte. Hope hatte sich auf dem Rücksitz zusammengerollt und schlief fest. Ihr Hut war heruntergefallen.
Rachel schob eine CD in den Player und fuhr, die Songs mitsummend, die sie an diesem Abend gehört hatten, durch die Nacht. Sie liebte ihren Hut, sie liebte ihre Stiefel, sie liebte ihre Töchter. Und es tat ihr nicht leid, daß sie mit ihrer Arbeit nun in Verzug geriet.
Am nächsten Morgen war sie nicht mehr so davon überzeugt, ihnen dreien etwas Gutes getan zu haben. Die Mädchen kamen kaum und dann äußerst mürrisch aus den Betten, griffen sich im Vorbeilaufen ihr Frühstück vom Küchentisch und hätten den Bus trotzdem um ein Haar verpaßt. Rachel war zutiefst erleichtert, als sie ihn doch noch gerade erreichten – und zutiefst beunruhigt, als sie gleich darauf in ihrem Atelier stand und den Arbeitsplan für die nächsten drei Wochen machte.
Sie malte fieberhaft, bis es Zeit war, die Mädchen nachmittags vom Bus abzuholen. Dann aß sie eine Kleinigkeit mit ihnen, denn sie hatte ihr Mittagessen ausfallen lassen. Samantha war noch immer auf dem Tattoo-Trip, weshalb sie ihr Streitgespräch – streckenweise wörtlich – wiederholten, bevor das Mädchen aufgebracht auf sein Zimmer stürmte. Hope blieb noch ein Weilchen mit ihrer Katze auf dem Schoß sitzen, doch schließlich verschwand auch sie.
Rachel kehrte ins Atelier zurück. Als sie nach einer Stunde überzeugt war, daß die Meerotter keines weiteren Pinselstriches mehr bedurften, ging sie in die Küche und schob das Abendessen in den Backofen. Wieder im Studio, nahm sie sich zunächst ein anderes Bild vor, doch ihr Blick wanderte erneut zu den Ottern, und sie genehmigte sich noch eine weitere Stunde dafür.
Nachdem diese Stunde verstrichen war, bewegte sich der Pinsel wie von selbst. So war es jedesmal.
Nur noch eine Minute, sagte sie sich zum x-ten Mal. Mit abwechselnden Blicken auf ihre Skizze und die Fotografie setzte sie den Rücken des Streichmessers ein, um dem Ölbild Leben einzuhauchen. Die Otter spielten im Tang. Die Herausforderung bestand darin, ihr nasses Fell naturgetreu darzustellen. Sie hatte mit ungebrannter Umbra und Kobaltblau begonnen, jedoch festgestellt, daß es damit zu dunkel wurde. Ungebrannte Umbra mit Ultramarinblau erwies sich als ideal.
»Die Backofenuhr ist abgelaufen, Mom«, rief Hope von der Tür her.
»Danke, Schatz«, murmelte Rachel und brachte noch ein paar Feinheiten auf die Leinwand. »Nimmst du bitte die Auflaufform aus dem Rohr und drehst das Gas ab?«
»Hab’ ich schon.« Hope war neben sie getreten und betrachtete das Bild. »Ich dachte, du wärst vorhin schon fertig gewesen.«
»Es hatte noch etwas gefehlt.« Rachel trat zurück, begutachtete ihr Werk und nickte schließlich. »Jetzt bin ich zufrieden.« Den Blick noch immer auf das Gemälde geheftet, legte sie die Palette aus der Hand, griff nach einem terpentingetränkten Lappen und wischte sich die Hände ab. »Ich räume nur noch schnell auf, dann komme ich.« Sie wandte sich Hope zu. »Hat Samantha den Tisch gedeckt?«
»Nein – ich.«
»Telefoniert sie wieder?«
»Noch immer«, erwiderte Hope so trocken, daß Rachel lachen mußte.
Sie hakte ihren Arm um den Nacken ihrer Kleinen und zog sie an sich. »Gib mir fünf Minuten.« Damit schickte sie sie hinaus.
Wie versprochen stand Rachel fünf Minuten später in der Küche und teilte Lasagne und Salat aus. Zwanzig Minuten später, als sie die Mahlzeit, begleitet von Samanthas Bericht über die neuesten Nachrichten aus ihrem Freundeskreis, verdaute, teilte sie die Aufräumungsarbeiten unter den Mädchen auf. Wiederum fünfzehn Minuten später zog sie, nachdem sie sich unter der Dusche aller Farbreste entledigt hatte und danach in frische Kleider geschlüpft war, ihre Bürste durch die Haare. Plötzlich hielt sie inne, und ihr Blick schoß hektisch durch den Raum. Wo war das Buch, das sie am letzten Wochenende gelesen hatte?
Die Durchsuchung ihres Schlafzimmers verlief ergebnislos. Vielleicht hatte sie es bereits zurechtgelegt. Sie ging in die Küche. »Ist mein Buch hier irgendwo?«
Samantha war beim Abwaschen, Hope trocknete weisungsgemäß ab.
»Ich würde mich ja danach umsehen, aber du hast gesagt, bevor ich etwas anderes täte, müßte erst das Geschirr fertig sein«, erwiderte Samantha patzig.
Rachel durchforstete einen Stapel Post, der hauptsächlich aus an eben diese Kindfrau adressierten Modekatalogen bestand. »Ich dachte, es läge vielleicht beim Telefon«, sagte sie und machte sich daran, bei den Kochbüchern nachzusehen. Dann bückte sie sich, um die an den Tisch geschobenen Stühle zu überprüfen.« Ich weiß genau, daß ich es in der Hand hatte«, murmelte sie, als auch das nichts erbrachte.
»Du bist eben nicht ordentlich«, griff Samantha sie an. Rachel predigte ihren Töchtern regelmäßig, daß Ordnung das halbe Leben sei.
»Oh, doch, das bin ich«, widersprach sie, aber nicht heftig, denn sie war in Gedanken bei dem Buch. Sie ging ins Wohnzimmer hinüber, um es dort zu suchen. »Ich habe momentan nur viel im Kopf.«
Das war milde ausgedrückt. Bis zu ihrer Ausstellung waren es nur noch drei Wochen, und die Daumenschrauben wurden zusehends fester angezogen. Okay, die Meerotter waren ihr optimal geglückt, aber es fehlte ihnen – und sechs anderen Bildern – noch der Hintergrund, und alles in allem müßten achtzehn gerahmt werden. Das Pensum wäre durchaus zu schaffen gewesen, wenn sie sich ausschließlich auf ihre Arbeit hätte konzentrieren können – aber Samantha brauchte ein Kleid für ihren ersten Schulball, das Picknick zum Jahresende von Hopes siebter Klasse mußte organisiert werden, beide Mädchen hatten Arzt- und Zahnarzttermine, für Ben Wolf, den Besitzer der Galerie und gelegentlichen abendlichen Begleiter stand eine Geburtstagsparty an und ein Tag der offenen Tür bei ihr für drei Fünftkläßler, die sie noch nicht kannte.
Sie hatte gestern abend über die Stränge geschlagen – eigentlich konnte sie es sich nicht erlauben, heute abend schon wieder nicht zu arbeiten.
Aber das gestrige Konzert war ein gemeinsames Erlebnis gewesen – der Lesezirkel war allein ihr Ding. Sie liebte die Frauen, liebte die Bücher. Auch wenn diese Zusammenkünfte eine zusätzliche Belastung für ihren ohnehin gedrängten Zeitplan bedeuteten – sie war nicht bereit, darauf zu verzichten.
Plötzlich stand Hope neben ihr. »Ich glaube, es liegt im Atelier.«
Rachel schloß die Augen und rief sich den Raum, der am anderen Ende des weitläufigen Hauses lag, wieder ins Bewußtsein.
An sich hatte sie ihn für heute verlassen gehabt, war dann jedoch außerplanmäßig noch einmal dorthin zurückgekehrt. Und davor? Ja, sie hatte das Buch in der Hand gehabt. Sie hatte es mitgenommen und dort irgendwo hingelegt.
»Danke, Schätzchen.« Sie umfaßte Hopes Kinn. »Bist du okay?«
Traurigkeit stand in den Augen des Kindes.
»Guinivere geht’s gut«, versuchte Rachel sie zu beruhigen. »Sie hat doch gefressen, oder?«
Hope nickte.
»Na, siehst du.« Sie küßte ihre kleine Tochter auf die Stirn. »Ich hole besser das Buch – es ist schon höchste Zeit für mich.«
»Soll ich es dir holen?« erbot sich Hope.
Eingedenk dessen, woran sie gearbeitet hatte, bevor die Meerotter wieder ihre Aufmerksamkeit beanspruchten, lehnte sie ab: Die Zeichnung mußte verschwinden. »Danke dir, Schatz – ich mach’ das schon.« Als Hope unschlüssig stehenblieb, bat sie: »Hilf Sam – sei so lieb«, und machte sich auf den Weg.
Das Buch lag auf einer Ecke des großen Arbeitstisches. Hope war hereingekommen, als Rachel an der Leinwand arbeitete.
Die Zeichnung – eine Kohleskizze – lag noch auf dem Schreibtisch am Fenster.
Rachel legte sie in eine dünne Mappe und schaute auf die zwischen zerwühlten Laken bäuchlings ausgestreckte Gestalt hinunter. Ihr war, als spüre sie die schmalen Hüften unter ihren Händen, die Wirbelsäule, den Rückenmuskel, den Trizeps, den Deltamuskel. Wären die Haare nicht gewesen, hätte man die Arbeit für den harmlosen Entwurf eines männlichen Körpers halten können, doch die dunklen, im Nacken ein wenig zu langen Haare identifizierten das Modell eindeutig. Dieser Körper hatte einen Namen, und es war besser, wenn die Mädchen ihn nicht sahen.
Sie versteckte die Mappe zwischen dem Schreibtisch und der Wand, nahm das Buch, lief in die Küche zurück, gab ihren beiden Mädchen einen schnellen Abschiedskuß, versprach, um elf wieder da zu sein und hastete zu ihrem Wagen hinaus.
Kapitel 1
Jack McGill war um Mitternacht zu Bett gegangen, doch die Sorgen, die ihn quälten, hatten ihn nicht einschlafen lassen, und als um zwei Uhr das Telefon klingelte, wirkte das Schrillen wie ein Stromschlag auf seine angegriffenen Nerven. In den Sekunden, die er brauchte, um den Hörer abzunehmen, schossen ihm ein Dutzend beunruhigende Gedanken durch den Kopf. »Ja?«
»Ist da Jack McGill?« fragte eine weibliche, angespannt klingende Stimme, die er nicht kannte.
»Ja.«
»Hier spricht Katherine Evans, eine Freundin von Rachel. Sie hatte einen Unfall. Sie liegt im Krankenhaus in Monterey. Ich denke, Sie sollten herkommen.«
Jack hatte sich aufgesetzt. »Was für einen Unfall?«
»Mit dem Auto.«
Sein Magen verkrampfte sich. »Auf welcher Straße? Waren die Mädchen dabei?«
»Auf dem Highway One – sie war allein unterwegs.« Erleichterung durchflutete ihn. Gott sei Dank war wenigstens seinen Töchtern nichts geschehen. »Es passierte in der Nähe von Rocky Point. Rachel war auf dem Weg nach Carmel. Ein Wagen hat sie von hinten gerammt. Der Aufprall war so stark, daß der Kombi quer über die Fahrbahn schleuderte und das steile Felsufer hinunterstürzte.«
Er schwang die Beine aus dem Bett. Sein Magen wurde zu Stein.
»Sie lebt«, berichtete die Freundin weiter. »Sie hat ein paar Knochenbrüche und Schürfwunden und, was aber den Ärzten Sorgen macht, eine Kopfverletzung mit Gehirnbeteiligung.«
»Mit Gehirnbeteiligung«, echote er. »Inwiefern?«
»Rachel ist noch immer bewußtlos. Sie hat ein Schädelhirntrauma mit Hirnödem.«
Er fuhr sich mit der Hand durch die Haare. Die Sorgen, die ihn zuvor wachgehalten hatten, waren vergessen. »Die Mädchen ...«
»... sind noch zu Hause. Rachel war zu unserem Lesezirkel unterwegs gewesen. Als sie um neun noch immer nicht aufgetaucht war, rief ich bei ihr zu Hause an. Samantha sagte mir, sie sei um sieben losgefahren, und ich rief sofort bei der Polizei an, wo ich erfuhr, daß sie einen Unfall gehabt hatte. Zu dem Zeitpunkt war es noch nicht gelungen, sie aus dem Wagen zu befreien, und darum konnte man mir keine Auskunft über ihren Zustand geben. Ich alarmierte ihren Nachbarn, Duncan Bligh, und er versprach, sich um die Mädchen zu kümmern. Ich habe sie gerade vorhin angerufen, aber nichts von der Kopfverletzung erwähnt, um sie nicht in Panik zu versetzen – und ich habe mich auch nicht getraut, Duncan zu bitten, sie hierherzubringen, denn diese Entscheidung steht mir nicht zu.«
Nein – das war Jacks Sache. Er war zwar nicht mehr Rachels Ehemann, aber immer noch der Vater der Mädchen. Das Telefon zwischen Schulter und Kinn geklemmt, griff er nach seinen Jeans. »Ich mache mich gleich auf den Weg. Die Mädchen rufe ich dann vom Auto aus an. Wo liegt Rachel?«
»In der Nothilfe.«
»Okay. Danke.« Als er auflegte, wurde ihm bewußt, daß er den Namen von Rachels Freundin vergessen hatte, aber das war angesichts des Drucks, unter dem er stand, kein Wunder. Sowohl im Büro als auch auf der Baustelle war die Hölle los, und er wurde am Morgen an beiden Orten dringend erwartet – und dann war da noch Jill. Heute abend fand das Wohltätigkeitsdinner statt, auf das sie so lange hingearbeitet hatte. Da er wußte, wieviel es ihr bedeutete, hatte er sich diesen Termin mit Mühe und Not freigehalten. Sein Smoking war frisch gebügelt, und sie erwartete ihn um fünf – aber er mußte nach Monterey fahren, und Gott allein wußte, für wie lange.
Du bist nicht mehr mit Rachel verheiratet, sagte sein Alter ego, doch er stopfte unbeirrt sein Hemd in die Jeans und schlüpfte in Sportschuhe. Du schuldest ihr nichts, Mann – schließlich hat sie sich von dir getrennt.
Aber sie war verletzt, und er war angerufen worden, und wenn es schlimm um sie stünde, würde er für seine Töchter eine Regelung finden müssen. Zunächst einmal müßten sie erfahren, was er gehört hatte. Sie waren zu alt, um mit Beruhigungsfloskeln zu Bett geschickt zu werden, und zu jung, um den möglichen Alptraum allein zu bewältigen. Rachel war ihre Mutter und ihre Vertraute – die drei waren ein Herz und eine Seele.
»Was den Ärzten Sorgen macht, ist eine Kopfverletzung mit Gehirnbeteiligung«, hatte Rachels Freundin gesagt. Vielleicht hatten sie ja inzwischen festgestellt, daß gar kein Grund zur Sorge bestand.
Jack schaufelte sich mit seinen Händen kaltes Wasser ins Gesicht und putzte sich die Zähne. Dann ging er in sein Atelier hinüber – und fragte sich in einem Anflug von Frustration, warum er es immer noch so nannte. Die wenigen Skizzen, die er angefertigt hatte, lagen unter Angeboten, Bauplänen, Verträgen und Korrespondenz begraben, den Zeugnissen einer schwindelerregenden Anzahl von Projekten in verschiedenen Entwicklungsstadien. Der Raum atmete Streß.
Jack packte seinen Laptop und so viele Unterlagen, wie sein Aktenkoffer zu fassen vermochte, zusammen, und verschiedene Versionen des Montana-Entwurfes in eine Mappe, klemmte sich beides unter jeweils einen Arm und ging durch den Flur in die Küche, schnappte sich seine Schlüssel von dem Granitklotz in der Mitte und einen Blazer von dem Garderobenständer neben der Tür, schaltete die Alarmanlage ein, lief in die Garage hinunter und fuhr gleich darauf in ein nebliges San Francisco hinaus. Die Sicht war so schlecht, daß das fahle Licht der Scheinwerfer seines Wagens nur meterweit reichte und er nicht erkennen konnte, ob es sich bei den dunklen Silhouetten, die sich vereinzelt gegen Hauswände abhoben, um Müllsäcke oder Obdachlose handelte.
Ohne den Blick von der Straße zu lösen, ertastete er sich auf dem Tableau seines Autotelefons die Nummer der Auskunft. Als er zur Klinik in Monterey durchkam, hatte er die Filbert und Russian Hill hinter sich gelassen und war auf der Van Ness in Richtung Süden unterwegs. »Hier spricht Jack McGill. Meine Frau, Rachel Keats, ist vor kurzem bei Ihnen eingeliefert worden. Ich bin zwar bereits auf dem Weg zu Ihnen, aber ich möchte doch schon vorab wissen, wie es ihr geht.«
»Einen Moment, bitte – ich verbinde Sie weiter.« Nach ein paar nervenaufreibenden Minuten meldete sich in der Nothilfe eine Schwester. »Mister McGill? Ihre Frau wird gerade operiert. Mehr kann ich Ihnen im Augenblick leider nicht sagen.«
Was den Ärzten Sorgen macht, ist eine Kopfverletzung mit Gehirnbeteiligung. »Was ist der Grund für die Operation?«
»Warten Sie einen Moment?«
Die plötzliche Stille in der Leitung zeigte, daß die Frage eine reine Formsache gewesen war – es wurde ihm keine Wahl gelassen. Auch Rachel hatte ihm keine Wahl gelassen, als sie damals vor sechs Jahren ausgezogen war. Sie hatte ihm mitgeteilt, sie verlasse ihn, und dann, während er beruflich unterwegs war, die Mädchen und ihre Sachen gepackt, und als er bei seiner Rückkehr ein leeres Haus vorfand, hatte er die gleiche Frustration und Hilflosigkeit empfunden wie jetzt. Dann hatte er sich mit Zorn gewappnet, das Haus verkauft und war in eines gezogen, das ihm seine Einsamkeit nicht so bewußt machte. Doch in diesem Fall gab es keine solche Fluchtmöglichkeit. Immer wieder sah er ihr Gesicht in den Nebelschwaden, in einem Augenblick realistisch schön und im nächsten fiktiv durch Verletzungen entstellt. Sein Herz schlug wie ein Hammer gegen seine Rippen.
»Mister McGill?« drang eine Männerstimme blechern, aber verständlich aus dem Lautsprecher. »Hier ist Doktor Couley. Ich habe mich Ihrer Frau angenommen, als sie eingeliefert wurde.«
»Warum wird sie operiert?« Jack umklammerte das Steuer.
»Um ihr linkes Bein in Ordnung zu bringen. Das Schienbein und der Oberschenkelknochen sind gebrochen. Sie werden genagelt ...«
»Ich habe gehört, sie hat eine Kopfverletzung«, unterbrach er den Arzt. An Beinbrüchen starb man schließlich nicht.
»Als Folge des Schädelhirntraumas hat sich ein Hirnödem gebildet. Wir wissen noch nicht, in welche Richtung es zunehmen wird.«
»Ich wünsche, daß ein Spezialist hinzugezogen wird. Der beste aus der City.«
»Unser Mann ist bereits auf dem Weg. Wann werden Sie hier sein?«
»Etwa in zwei Stunden – ich komme aus San Francisco. Ich gebe Ihnen meine Nummer.« Er ratterte sie herunter. »Rufen Sie mich bitte an, wenn es etwas Neues gibt.« Nachdem der Arzt ihm dies zugesagt hatte, tippte Jack eine zweite Zahlenreihe ein, doch diesmal zögerte er, bevor er auf die grüne Taste drückte.
Aber es half nichts – er konnte dieses Gespräch auf niemanden abwälzen.
Katherine. Plötzlich war ihm wieder eingefallen, wie Rachels Freundin hieß. Katherine.
Rachel hatte sie nie erwähnt, aber Rachel sprach mit ihm grundsätzlich nur über Belange der Mädchen. Und die hatten irgendwann einmal von Katherine erzählt, daran erinnerte er sich dunkel.
Von Duncan Bligh hatten sie ebenfalls erzählt, und das nicht nur einmal. Seine Ranch lag in dem tiefen, engen Küstental, in dem Rachel lebte, und seine Herde weidete auf den Hangwiesen über ihrem Rotholzwald. Sowohl die Hochwiesen als auch der Wald gehörten zur Santa Lucia Range, der zur Küste von Big Sur parallel laufenden Bergkette mit ihren schroff ins Meer abfallenden Landspitzen.
Duncan war Jack ein Dorn im Auge. Es paßte ihm nicht, mit welcher Zuneigung die Mädchen sein Häuschen, seinen Bart oder seine Schafe beschrieben, und es paßte ihm auch nicht, wie sie grinsten, als er fragte, ob Rachel mit dem Mann ausginge. Es war ihm natürlich klar, daß sie ihn eifersüchtig machen wollten, und es ärgerte ihn, daß es ihnen gelang. Er konnte sich durchaus vorstellen, daß ein Bursche wie dieser Rachel gefiel. Die Männer aus den Bergen besaßen eine Art rustikaler Attraktivität. Nicht, daß er selbst ein Weichei gewesen wäre. Er war hochgewachsen und durchtrainiert, und er konnte es beim Nägeleinschlagen mit den kräftigsten der Zimmerleute aufnehmen, die bauten, was er entwarf, aber er fällte die Bäume nicht, die die tragenden Balken lieferten, und er schor keine Schafe und erlegte kein Wild.
Es schmeckte ihm ganz und gar nicht, möglicherweise Duncan Bligh gleich am Apparat zu haben, aber andererseits mußte er den Mädchen zeigen, daß der Rancher nicht der einzige Mann war, der sich in dieser Situation um sie kümmerte.
Er drückte auf die grüne Taste.
»Hallo?« meldete sich eine atemlose Mädchenstimme, kaum daß das erste Klingelzeichen verklungen war.
»Hi, Sam. Ich bin’s. Seid ihr okay?«
»Weißt du schon, was Mom passiert ist?«
»Ja – ihre Freundin hat mich angerufen. Ich bin auf dem Weg in die Klinik. Als ich dort anrief, sagte mir ein Arzt, sie werde gerade operiert. Ihr Bein muß ziemlich übel zugerichtet sein.«
»Katherine erzählte, sie hätte auch Rippenbrüche.«
»Das hat der Doktor nicht erwähnt, also denke ich, daß es nicht so dramatisch ist«, wiegelte Jack ab. »Schläft deine Schwester?«
»Sie hat geschlafen – bis das Telefon klingelte. Wir wußten gleich, daß es mit Mom zu tun haben mußte – mich ruft schließlich mitten in der Nacht keiner an.« Das letzte kam mit einem Nachdruck, der Jack vermuten ließ, daß es in der Vergangenheit mehrfach vorgekommen war. »Wir möchten unbedingt ins Krankenhaus, Dad, aber Duncan will uns nicht hinbringen.«
»Gib ihn mir mal.«
«Er ist im Sessel eingeschlafen. Kannst du dir das vorstellen? Er schläft! Warte einen Moment – ich hole ihn. Sag ihm, daß er uns fahren soll.« Sie rief so laut, daß es sogar in Jacks Ohren dröhnte: »Duncan! Kommen Sie her! Mein Vater ist am Telefon!«
»Samantha!« rief Jack.
»Nein«, sagte sie leiser, »Mom ist nicht tot, aber die Katze wird es gleich sein, wenn du sie weiter so an dich drückst. Du tust ihr weh.« Dann wandte sie sich wieder an Jack: »Ich geb’ dir Hope, sie will mit dir reden.«
»Daddy?« kam ein zaghaftes Flüstern aus dem Lautsprecher.
Jacks Herz krampfte sich zusammen. »Hallo, Hope. Wie geht’s dir, Süße?«
»Ich hab’ Angst.«
»Das kann ich mir vorstellen, aber Mom wird bestimmt wieder gesund. Ich bin auf dem Weg in die Klinik. Wenn ich dort bin, erfahre ich mehr, und dann rufe ich gleich wieder an.«
»Komm her!« flehte die kleine Stimme.
»Das werde ich«, versprach er. »Aber das Krankenhaus liegt auf dem Weg, und darum schaue ich erst dort vorbei. Dann kann ich euch schon Genaueres berichten, wenn wir uns sehen.«
»Sag Mom ...« Sie brach ab.
»Was denn, Süße?«
»Sie weint wieder«, sagte Samantha. »Ich geb’ dir Duncan.«
»Duncan Bligh«, meldete sich eine schroffe Stimme. »Was gibt es?«
Jack hätte lieber wieder mit Hope gesprochen. »Ich habe noch nicht viel erfahren, aber ich bin auf dem Weg ins Krankenhaus. Bringen Sie die Mädchen bitte nicht hin.«
»Hatte ich gar nicht vor.«
Nach einem lautstarken Protest im Hintergrund kam wieder Samantha an den Apparat. »Daddy! Wir können doch unmöglich hier rumsitzen! Was ist, wenn sie nach uns fragt?«
»Sie ist im Operationssaal, Samantha. Selbst wenn ihr dort wärt, könntet ihr sie nicht sehen. Kümmere dich lieber um deine Schwester – sie braucht Trost.«
»Und ich brauche keinen?«
Jack hörte die Panik unter ihrem brüsken Ton, aber um sie machte er sich keine Sorgen. Im Alter waren die Mädchen zwar nur zwei Jahre auseinander, aber im Wesen Welten. Samantha war eine energische, fünfzehnjährige Erwachsene, die es gar nicht mochte, wie ein Kind behandelt zu werden. Hope war kindlich und sensibel. Samantha stellte die Fragen – Hope hörte die Nuancen der Antworten.
»Natürlich brauchst du auch Trost«, sagte er, »aber du bist älter als sie. Wenn du ihr Kraft gibst, gibt sie dir vielleicht auch Kraft, verstehst du?«
»Ich muß immer an den Highway One denken, Dad. Da gibt es Stellen, wo man hundert Meter in die Tiefe stürzt, wenn man von der Straße abkommt, und auf Felsen landet. War das bei Mom so?«
»Ich weiß nicht genau, was passiert ist.«
»Sie kann auch ins Meer gestürzt sein, aber das wäre nicht viel besser. Wenn sie in der Brandung im Auto festsaß ...«
Samantha hatte eine fast ebenso lebhafte Phantasie wie ihre Mutter, doch sie besaß noch nicht die Reife, sie zu bändigen. »Sam!« holte er seine Tochter in die Realität zurück. »Sie ist nicht ertrunken, deine Mutter hat ein gebrochenes Bein!«
»Aber du weißt nicht, was ihr sonst noch fehlt!« rief sie. »Ruf bei der Polizei an, die sagen dir, was genau passiert ist.«
»Das mache ich später. Das Krankenhaus hat meine Autotelefonnummer, und ich möchte jetzt für den Fall, daß man mich anruft, die Leitung freihalten. Und ihr beide geht bitte schlafen. Es tut euch nicht gut, wenn ihr euch ausmalt, was geschehen sein könnte. Macht euch nicht verrückt und bleibt nicht neben dem Telefon sitzen, denn ich rufe euch erst wieder an, wenn die Sonne aufgegangen ist.«
»Ich gehe morgen nicht in die Schule.«
»Das besprechen wir später. Jetzt beruhige deine Schwester und dann geht schlafen.
»Oh-keeh«, dehnte sie widerstrebend.
***
Mit der Stadt blieb auch der Nebel hinter Jack zurück. Um diese Zeit herrschte kaum Verkehr auf dem kurvigen Highway, und er gab Gas. In der Hoffnung, die Verkrampfung seines Magens dadurch zu lösen, legte er eine Hand auf seine Magengrube, doch es nützte nichts. Dieses unangenehme Symptom stellte sich jedesmal ein, wenn etwas seine Nerven belastete, und in letzter Zeit war dieser Krampf fast zu einem ständigen Begleiter geworden.
Er hoffte inständig, daß das Telefon klingeln und ihm mitgeteilt würde, daß Rachel nach der Operation aufgewacht und wohlauf sei, doch es blieb stumm. Er versuchte sich abzulenken, indem er seine Gedanken wieder auf die Probleme richtete, mit denen er sich vor dem Anruf herumgeschlagen hatte – Vertragsstreitigkeiten, Terminverzögerungen, Personalverluste –, aber er konnte keine Verbindung zu ihnen herstellen. Sie waren weit weg, in San Francisco, und samt der Stadt mit einem dichten, weißen Kokon umhüllt.
Am Morgen müßte er einige Telefongespräche führen, um die angesetzten Besprechungen zu verschieben. Wenn Rachel zu sich käme, könnte er allerdings schon mittags im Büro sein.
Eigentlich hielt er das für wahrscheinlich. Rachel war die willensstärkste und gesündeste Frau, die er kannte – die willensstärkste, gesündeste und unabhängigste. Sie brauchte ihn nicht, hatte ihn nie gebraucht. Als sie vor sechs Jahren an einer Gabelung ihres Lebensweges ankam, hatte sie sich für die Richtung entschieden, die von ihm wegführte. Ihre Entscheidung. Ihr Leben. Okay.
Warum war er dann jetzt auf dem Weg nach Süden? Warum stellte er auch nur eine Besprechung hintan, um an ihrem Krankenbett zu sitzen? Sie hatte ihn verlassen, hatte zehn Jahre Ehe zusammengeknüllt wie eine mißlungene Skizze auf einem Notizblock.
Warum also fuhr er nach Süden?
Er tat es, weil ihre Freundin ihn angerufen hatte. Weil es seine Vaterpflicht war, sich in dieser Situation um die Kinder zu kümmern. Und weil er panische Angst hatte, daß sie sterben könnte. Sein Leben war mit ihr schöner gewesen als davor oder danach. Er fuhr nach Süden, weil er das Gefühl hatte, ihr immer noch etwas dafür zu schulden.
***
Als Jack Rachel zum ersten Mal sah, entsprach sie überhaupt nicht seinem Geschmack. O ja. Er liebte blonde Haare, und sie besaß eine wellige Flut davon, aber er bevorzugte als Student den Model-Typ, und dem wurde Rachel Keats nicht gerecht. Sie sah viel zu natürlich aus. Keine getuschten Wimpern, kein Lipgloss, keine vordergründige Erotik – statt dessen ein sommersprossengesprenkeltes Gesicht und große Kinderaugen, die fasziniert an den Lippen des langweiligsten Professors hingen, den Jack je gehört hatte.
Das Thema der Vorlesung war »Rokoko und Klassizismus«. Der Professor, der auf seinem Gebiet einen hervorragenden Ruf genoß, hatte den Auftrag erhalten, ein Lehrbuch zu verfassen, Jack als Assistenten bewilligt bekommen und ihm so ermöglicht, während seines Architekturstudiums seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Jack korrigierte Examens- und Seminararbeiten und half seinem Professor bei den Recherchen und bei der Korrespondenz, die für das Lehrbuch anfielen.
Jacks Interesse an Rokoko und Klassizismus hielt sich in Grenzen, und er war auch nicht scharf darauf gewesen, von Manhattan nach Tucson umzuziehen, aber es waren ihm nirgendwo sonst ein Job und ein Stipendium angeboten worden, und da er mittellos war, hatte er wohl oder übel zugreifen müssen.
Der Job war nicht anstrengend. Da Jack das Manuskript der Vorlesungen jeweils vorab las, bestand der Sinn seiner Anwesenheit im Hörsaal weniger in seiner Weiterbildung als darin, seinem Professor bei Bedarf ein Glas Wasser oder ein vergessenes Buch oder Skript zu holen. Er saß in einiger Entfernung neben seinem Chef, eine ideale Position, um die etwa fünfzig Studenten zu überblicken, die von den eigentlich dreimal soviel für diesen Kurs eingeschriebenen erschienen waren.
Rachel ließ keine Vorlesung aus, lauschte wie gebannt, machte sich Notizen. Jack redete sich ein, daß sein Blick sie nur jedesmal suchte, weil ihr unverbrüchlicher Eifer ihn faszinierte, doch das erklärte nicht, daß er registrierte, daß sie mittags immer in dem kleinsten Café auf dem Campus aß, und das stets allein, oder daß sie einen alten, roten VW-Käfer fuhr und ein bemalter Sonnenschutz auf ihrem Armaturenbrett lag, der einen leuchtendbunten Käfer hinter dem Steuerrad eines Autos zeigte.
Ihr Hauptfach war Kunst, sie wohnte nicht weit von ihm entfernt in einem Apartmentkomplex, war allem Anschein nach eine Einzelgängerin und wirkte mit sich und der Welt zufrieden.
Sie war nicht nur nicht sein Typ, sondern er war dazu auch noch mit einem Mädchen zusammen, das seiner Vorstellung von Frau absolut entsprach. Celeste war groß und langbeinig, vollbusig und willig, stellte angenehm wenige Fragen und angenehm wenige Forderungen an ihn, engte ihn in keiner Weise ein. Sie kochte für ihn und putzte sein Badezimmer, aber er hatte sie nicht dazu bewegen können, seine Wäsche zu waschen, und darum war er an einem Dienstagabend wieder einmal im Waschsalon, als Rachel durch die Tür kam.
Sie hatte ihre blonde Wellenflut mit einem türkisfarbenen Band gebändigt, dessen Farbe einen gewagten Kontrast zu dem knalligen Rot ihres kurzen, ärmellosen Hemdchens darstellte. Shorts und Sandalen waren allerdings weiß, ebenso dezent wie die zarte Röte, die ihr sommersprossiges Gesicht bei seinem Anblick färbte. Sie blieb stehen, schien mit dem Gedanken zu spielen, wieder zu gehen, und um sie daran zu hindern, sagte er hastig: »Hallo! Wie geht’s?«
Sie lächelte. »Prima.« Einen vollgestopften Wäschesack an die Brust gedrückt, ging sie auf zwei nebeneinander offenstehende Waschmaschinen zu.
Jacks Herz klopfte bis zum Hals. Aber warum? Sie hatte ihn lediglich angelächelt, und es war ein völlig unerotisches Lächeln gewesen. Außerdem war sie überhaupt nicht sein Typ. Trotzdem sprang er von dem Trockner, auf dem er gesessen hatte, herunter, folgte ihr und lehnte sich an die Maschine, die mit dem Rücken zu den beiden stand und für die sie sich entschieden hatte.
»Sie besuchen die Vorlesungen über Rokoko und Klassizismus«, konstatierte er, um nicht den Eindruck zu erwecken, er wolle sie aus heiterem Himmel anmachen, denn es fiel ihm gar nicht ein, sie anzumachen. Sie war nicht sein Typ. Es war alles ganz harmlos.
Sie bestätigte seine Feststellung mit einem »Mm« und machte sich mit noch immer leicht gerötetem Gesicht daran, Wäsche aus dem Sack zu ziehen und in die erste Maschine zu stopfen.
Er schaute ihr eine Weile zu und sagte dann: »Meine ist im Trockner.«
Ein selten dämlicher Satz – aber er wollte irgend etwas sagen und sie darauf hinweisen, daß es ungut ausgehen konnte, wenn man, wie sie gerade, rote und weiße Wäsche zusammentat, stand ihm nicht zu – ebensowenig wie eine genauere Musterung der Wäschestücke. Beides hätte sie in Verlegenheit gebracht, und das wäre ein ungünstiger Ausgangspunkt gewesen. Ausgangspunkt? Wofür?
»Sie sind Obermeyers Assi«, sagte sie, als sie die zweite Maschine mit Dingen in regelrecht schreienden Farben zu füllen begann. Sie hob den Blick, und Jack sah, daß ihre Augen haselnußbraun mit goldenen Flecken waren – und sanfter als alle, die er je gesehen hatte. »Wollen Sie ins Lehrfach?«
»Nein. Ich studiere Architektur.«
Sie lächelte. »Ehrlich?«
Er erwiderte ihr Lächeln. »Ehrlich.« Sie war ein niedliches Ding.
Die Maschinen waren beladen. Sie richtete sich auf und schaute sich suchend um.
Jack holte seinen Waschpulverkarton und hielt ihn ihr hin. Sie belohnte ihn mit einem neuerlichen Erröten und einem gemurmelten Dankeschön. Als beide Maschinen angesprungen waren, fragte sie: »Was wollen Sie denn bauen?«
Diese Frage kannte er von seinen Eltern, und bei ihnen schwang Verachtung darin mit. Rachel Keats hingegen schien echt interessiert zu sein.
»Zunächst einmal Wohnhäuser«, antwortete er. »Ich komme aus einem Kaff mit Schachtelbauweise; mein Schulweg führte mich täglich an diesen Schachteln vorbei, und während des Unterrichts machte ich Entwürfe für Erweiterungen und Verschönerungen dieser einfallslosen Dinger. Wirkte sich nicht günstig auf meine Noten aus.«
»Das kann ich mir vorstellen.« Sie warf einen Blick zu dem Lehrbuch hinüber, das aufgeschlagen auf dem Trockner lag. »Geht es darin um den Bau von Wohnhäusern?«
»Noch nicht. Im Moment befassen wir uns mit Bögen. Es gibt die verschiedensten Arten davon: Flachbögen, Rundbögen, Giebelbögen, Spitzbögen, Korbbögen, Lanzettbögen, Kleeblattbögen, Fächerbögen ...«
Sie lachte. Ihr Lachen war genauso sanft wie ihr Blick. »Haben Sie Erbarmen«, bat sie scherzhaft und gestand dann fast schüchtern: »Ich habe auch immer gezeichnet.«
Ihre Schüchternheit gefiel ihm – sie machte sie ungefährlich für ihn. »Wo?«
»Zuerst in Chicago, dann in Atlanta und später in New York. Meine Kindheit war rastlos. Mein Dad kauft alte Firmen und bringt sie auf Vordermann – und wenn er sie dann verkauft, ziehen wir weiter. Und wo kommen Sie her?«
»Aus Oregon. Sie haben sicher nie etwas von dem Ort gehört – er ist auf keiner Landkarte zu finden. Was haben Sie gezeichnet?«
»Oh – Menschen, Vögel, Säugetiere, Fische. Was immer sich bewegt. Ich fange gerne den Augenblick ein – wie ein Fotoapparat.«
»Also tun Sie es noch immer«, schloß er daraus, da sie in der Gegenwartsform gesprochen hatte.
Ihr Blick drückte ein wenig Angst vor der eigenen Courage aus. »Ich hoffe, daß ich irgendwann mal von meiner Malerei leben kann.«
»Na, da haben Sie sich ja was vorgenommen.« Die meisten Künstler verdienten kaum die Margarine aufs Brot. Wenn Rachel nicht überdurchschnittlich begabt war, erwartete sie ein entsagungsreiches Leben.
Sie schlang die Arme um sich und sagte leise, beinahe traurig: »Ich habe Glück – die Firmen verkaufen sich gut. Meine Eltern haben kein Verständnis für meine künstlerischen Ambitionen. Sie würden mich lieber in der Geschäftswelt sehen, als Managerin oder so was. Haben Sie Geschwister?«
»Fünf Brüder und eine Schwester.«
Rachels zauberhafte Augen leuchteten auf. »Das ist ja toll! Ich habe keine.«
»Und genau darum finden Sie es toll. Wir sieben kamen innerhalb von zehn Jahren zur Welt, und wir wohnten mit unseren Eltern in einem Haus, in dem es nur drei Schlafzimmer gab. Aber ich hatte es gut erwischt – im Sommer durfte ich auf der Veranda schlafen.«
»Was machen denn die anderen jetzt? Sind sie über das ganze Land verstreut, oder leben ein paar von ihnen hier in der Gegend?«
»Sie sind alle noch zu Hause – ich bin der einzige, der den Absprung schaffte.«
»Und wie?«
»Ich mußte einfach weg – ich komme mit meiner Familie nicht klar.«
»Und warum nicht?« fragte sie so unschuldig, daß er es nicht als indiskret empfand.
»Sie sind destruktiv, kritisieren alles in Grund und Boden, weil sie es aus Mangel an Ehrgeiz selbst zu nichts bringen. Mein Vater hätte alles mögliche werden können – er ist ein kluger Kopf –, aber er fing irgendwann bei einem kartoffelverarbeitenden Betrieb an, und da blieb er dann. Meine Brüder haben zwar andere Jobs, aber auch sie werden daran klebenbleiben, nichts aus sich machen. Ich ging aufs College, und darum fühlen sie sich mir unterlegen – und das werden sie mir nie verzeihen.«
»Das tut mir leid.«
Er lächelte. »Da kann man nichts machen.«
»Demnach sind Sie nicht oft zu Hause.«
»Nein. Und Sie? Zieht es Sie nach New York?«
Sie rümpfte die Nase. »Ich bin kein Stadtmensch.«
»Haben Sie keine Freunde dort?«
»Doch, schon – aber nur wenige. Ich bin nicht übermäßig gesellig. Und wie ist es mit Ihnen? Haben Sie einen Mitbewohner?«
»Das fehlte mir noch! Davon habe ich wirklich zur Genüge genossen. Was gefällt Ihnen in Tucson am besten?«
»Die Wüste. Und Ihnen?«
»Die Santa Catalinas.«
Wieder leuchteten ihre Augen auf, mehr golden als braun. »Fahren Sie gerne Rad?« Als er nickte, sagte sie: »Ich auch. Wann haben Sie Zeit? Sind Sie für den ganzen Kurs eingespannt? Wie viele Stunden müssen Sie für Obermeyer arbeiten?«
Jack beantwortete ihre Fragen und stellte seinerseits weitere, und sie redeten und redeten, und als sie den Waschsalon schließlich mit ihrer getrockneten und ordentlich zusammengefalteten Wäsche verließen, wußte er dreimal soviel über sie wie über Celeste.
Das gab ihm zu denken, und so trennte er sich am nächsten Tag von Celeste, rief Rachel an und verabredete sich zu einer Pizza mit ihr, wobei sie ihr Gespräch nahtlos dort fortsetzten, wo sie es tags zuvor beendet hatten.
Jack war fasziniert. Er hatte nie das Herz auf der Zunge gehabt, seine Gedanken und Vorstellungen lieber für sich behalten, aber Rachel hatte etwas an sich ... Sie war ungefährlich. Sie war sanft. Sie war interessiert. Sie war intelligent. Ebenso ein Einzelgänger wie er, faßte auch sie zum ersten Mal spontan Vertrauen zu einem völlig fremden Menschen und öffnete sich ihm vorbehaltlos. Es war für sie beide eine gleichermaßen erstaunliche und wohltuende Erfahrung.
Sie wurden unzertrennlich. Sie aßen miteinander, lernten miteinander, sie gingen ins Kino, machten Radtouren, steckten vor den Vorlesungen die Köpfe zusammen und suchten gemeinsam ihre Lieblingsbänke auf dem Campus aus – aber es verging eine ganze Woche, bis sie miteinander schliefen.
An sich war eine Woche keine lange Zeit, aber angesichts der allgemein üblichen sexuellen Schnelllebigkeit war sie für zwei Menschen, die sich zueinander hingezogen fühlten, fast eine Ewigkeit. Und sie fühlten sich stark zueinander hingezogen. Bei sich erkannte Jack es an den Empfindungen, die in ihm erwachten, wenn er ihre feingliedrigen Künstlerhände oder ihren zarten Nacken betrachtete, wenn sein Blick auf ihren festen, runden Po in den knappen Shorts fiel oder auf ihre Brüste, die sich klein und hochstehend unter ihrem Hemdchen abzeichneten. Und bei ihr erkannte er es daran, wie sie sich an ihn lehnte, wenn sie miteinander ein Konzert auf dem Campus besuchten, wie ihr der Atem stockte, wenn er sich zu ihr herunterbeugte, um ihr etwas ins Ohr zu flüstern, und an dem Ausdruck, der in ihre Augen trat, wenn sie ihn ansah. O ja. Sie begehrte ihn. Er hätte sie schon zwei Tage nach ihrer Begegnung im Waschsalon nehmen können.
Er tat es nicht, weil er es nicht wagte. Er hatte noch nie eine so emotionale Beziehung zu einem Mädchen gehabt. Bei Rachel fühlte er sich geborgen, ihr konnte er sagen, was er fühlte und dachte. Und da er nicht wußte, ob die körperliche Intimität all das nicht zerstören würde, vermied er es tunlichst, sie mit zu sich zu nehmen oder mit zu ihr zu gehen. Er küßte sie nicht einmal.
Doch als sie ihn nach einer Woche zu sich zum Abendessen einlud, kam er zu dem Schluß, sich jetzt lange genug kasteit zu haben – und wie sich zeigte, hatte auch sie genug davon. Er hatte ihre Wohnung kaum betreten, als ihre Lippen sich zu einem brennenden Kuß fanden, der immer leidenschaftlicher wurde, während sie, einander umklammernd, an der Wand entlang zu ihrem Schlafzimmer glitten und aufs Bett fielen. Mit vor Ungeduld linkischen Fingern rissen sie sich die Kleider vom Leib, konnten gar nicht schnell genug zusammenkommen – und dann erlebte Jack eine in ihrer Intensität so atemberaubende Vereinigung, wie er sie niemals für möglich gehalten hätte.
Danach holte Rachel Block und Bleistift, setzte sich aufs Bett und zeichnete ihn – und was dabei herauskam, sagte mehr als tausend Worte. Er war ihr Gott, sie war sein Engel, und er war verliebt.
Kapitel 2
Der Operationssaal lag im ersten Stock am Ende eines langen Flures. Jack ließ sich in dem offenen Warteraum davor in einen Sessel fallen, verschränkte die Arme und fixierte die Tür. Seine Augen waren müde, doch die Angst hielt sie offen.
Es dauerte eine ganze Weile, bis er bemerkte, daß er nicht allein war. Eine Frau musterte ihn von einem in der Nähe stehenden Sofa aus. Sie hielt seinem prüfenden Blick gelassen stand.
»Sind Sie Katherine?« fragte er schließlich. Ein schiefes Lächeln huschte über ihr Gesicht.
»Warum überrascht Sie das?«
Er war zu erschöpft und zu angespannt, um sich in Diplomatie zu üben. »Weil Sie überhaupt nicht der Typ meiner Frau sind«, erwiderte er, sie noch immer anstarrend. Bei Rachel war alles Natur. Diese Frau hingegen war von ihren lackierten Fingernägeln über die getuschten Wimpern bis zu der modischen, in einem Dutzend verschiedener Beigetöne gefärbten, langen Lockenmähne durchgestylt.
»Sie ist ihre Exfrau«, korrigierte Katherine ihn, »und der Schein kann trügen. Sie sind also Jack.«
Er konnte gerade noch nicken, bevor die Tür aufging und ein Arzt erschien.
Jack sprang auf und ging mit großen Schritten auf ihn zu. »Ich bin Jack McGill.« Er streckte ihm die Hand hin. »Wie geht es ihr?«
Der Arzt hatte einen festen Händedruck. »Steve Bauer. Sie ist im Aufwachraum. Die Operation ist gut verlaufen. Die Vitalfunktionen sind in Ordnung, Ihre Frau atmet selbständig – aber sie hat noch immer nicht das Bewußtsein wiedererlangt.«
»Koma«, sagte Jack tonlos. Das Wort hatte ihn, in seinem Hinterkopf lauernd, von San Francisco hierherbegleitet, und er wünschte sich inständig, der Arzt würde ihm widersprechen.
Zu seiner Bestürzung nickte Dr. Bauer. »Sie reagiert nicht auf Stimuli wie Licht, Schmerz oder laute Geräusche. Die linke Gesichtshälfte weist eine schwere Prellung und eine starke Schwellung auf. Ihre tiefe Bewußtlosigkeit legt die Vermutung nahe, daß auch ein Hirnödem vorliegt. Wir überwachen den Hirndruck. Eine leichte Erhöhung des Liquordrucks kann medikamentös behandelt werden. Im Augenblick deutet nichts darauf hin, daß wir ihn chirurgisch normalisieren werden müssen.«
Jack fuhr sich mit der Hand durch die Haare. In seinen Ohren summte ein Bienenschwarm. Er versuchte, ihn zu vertreiben, indem er sich räusperte. »Sie liegt also im Koma. Okay. Wie schlimm ist das?«
»Nun – es wäre mir schon lieber, sie wäre wach.«
»Das versteht sich wohl von selbst«, erwiderte Jack ungeduldig. »Ich will wissen, ob sie sterben wird.«
»Ich hoffe nicht.«
»Wie können wir es verhindern?«
»Wir überhaupt nicht – das kann nur sie selbst. Wenn Gewebe verletzt wird, schwillt es, und je umfangreicher die Schwellung ist, um so mehr Sauerstoff wird für den Heilungsprozeß benötigt. Unglücklicherweise unterscheidet sich das Gehirn von anderen Organen dadurch, daß es vom Schädel umschlossen ist, in einer starken knöchernen Kapsel liegt. Wenn Hirngewebe schwillt, begrenzt der Knochen die entsprechende Raumforderung und der Hirndruck nimmt zu. Als Folge kommt es zu einer Abnahme der Hirndurchblutung, und da das Blut den lebenswichtigen Sauerstoff transportiert, bedeutet diese Mangeldurchblutung eine nicht ausreichende Sauerstoffzufuhr, wodurch der Heilungsprozeß verzögert wird. Inwieweit, entscheidet ihr Körper.«
»Wie sieht das schlimmste Szenario aus?« wollte Jack wissen.
»Der Hirndruck erhöht sich derart, daß es zum Stillstand des Blutstroms im Gehirn kommt, ihm somit kein Sauerstoff mehr zugeführt wird, die Hirnfunktionen ausfallen und der Patient stirbt. Darum überwachen wir Ihre Frau. Wenn wir eine Drucksteigerung sofort feststellen, haben wir die Chance, den Druck zu erniedrigen. Die nächsten achtundvierzig Stunden werden uns Aufschluß geben. Im Moment hat die Hirnschwellung einen minimalen Umfang.«
»Wenn sie nicht zunimmt – wann wird meine Frau dann wieder zu sich kommen?«
Der Arzt wischte sich mit dem Unterarm den Schweiß von der Stirn. »Das kann ich Ihnen leider nicht sagen – das ist bei jedem Fall anders.«
Jack wollte nichts unerwähnt lassen. »Wird sie einen bleibenden Schaden davontragen?«
»Auch das weiß ich nicht.«
»Wächst diese Gefahr proportional zur Dauer des Komas?«
»Nicht, wenn das Ödem nicht weiter an Umfang zunimmt.«
»Können Sie etwas tun, damit es zurückgeht?«
»Wir haben Ihre Frau an einen entsprechenden Tropf angeschlossen – aber eine Überdosierung brächte wiederum Probleme mit sich.«
»Dann lassen wir sie also einfach daliegen?«
»Nein«, antwortete der Arzt geduldig. »Wir lassen sie daliegen und gesund werden. Der Körper ist ein Wunderding, Mister McGill – er arbeitet selbsttätig.«
»Können wir denn gar nichts tun?« fragte Katherine, die zu ihnen getreten war.
»Nicht viel«, erwiderte Dr. Bauer bedauernd. »Krankenschwestern, die auf Komapatienten spezialisiert sind, raten dazu, mit ihnen zu reden, denn es kommt immer wieder vor, daß sie nach dem Erwachen Dinge wiedergeben, die an ihrem Krankenbett gesprochen wurden.«
»Aber das ist nicht die Regel«, entnahm Jack seinen Worten.
»Leider nein, aber es kann auf keinen Fall schaden, wenn Sie mit ihr sprechen.«
»Und was sollen wir sagen?«
»Das ist gleichgültig, solang der Tenor positiv ist. Vermitteln Sie ihr Zuversicht.«
»Wir haben zwei Töchter von dreizehn und fünfzehn Jahren. Sie möchten natürlich bei ihrer Mutter sein. Soll ich sie lieber noch ein wenig hinhalten? Vielleicht kommt meine Frau ja schon morgen zu sich.«
»Bringen Sie die beiden ruhig her. Ihre Stimmen könnten durchaus helfen, ihre Mutter aus der Bewußtlosigkeit zu holen.«
»Wie sieht sie denn aus?« erkundigte sich Jack. »Wird ihr Anblick die Mädchen erschrecken?«
»Die eine Gesichtshälfte ist stark geschwollen und abgeschürft. Sie verfärbt sich bereits. Und eine Hand hat eine Schnittwunde ...«
»Schlimm?« fiel Jack ihm alarmiert ins Wort und Katherine ergänzte: »Sie ist Malerin – und Linkshänderin.«
»Es ist zwar die linke Hand«, antwortete Dr. Bauer, »aber die Verletzung bedingt keine bleibenden Schäden. Ihr Bein ist gegipst; wir haben einen Streckverband angelegt und ihre Rippenfraktur durch einen Heftpflasterverband behandelt, damit nichts passiert, wenn sie sich unkontrolliert bewegt ...«
»Unkontrolliert?« unterbrach Jack ihn erneut. »Sie meinen krampfartig?« Wie viele Schreckensnachrichten hatte der Arzt wohl noch in petto?
»Manchmal kommt es dazu«, nickte Dr. Bauer. »Ich meine Bewegung allgemein. Wir Ärzte sprechen von ›Streckkrämpfen‹. Aber es ist auch möglich, daß sie bis zu ihrem Erwachen reglos daliegen wird. Ich denke, das wird Ihre Töchter weitaus mehr erschrecken als die sichtbaren Verletzungen.«
Nicht nur unsere Töchter, dachte Jack und schluckte: Das Bild, das der Doktor da gemalt hatte, entsprach in keiner Weise der aktiven Frau, die Rachel immer gewesen war. »Wann kann ich sie sehen?«
»Sobald wir sie stabilisiert haben, wird sie auf die Intensivstation verlegt ... Nein«, beruhigte er Jack, als dessen Augen sich weiteten, »das bedeutet nicht, daß sie in Lebensgefahr ist. Nur, daß wir sie genau beobachten wollen.« Er warf einen Blick auf die Uhr an der Wand. Es war vier Uhr zehn. »Ich schätze, in einer Stunde können Sie zu ihr.«
***
Jack und Katherine waren nicht die einzigen in der Cafeteria. Eine Handvoll Krankenhauspersonal saß, verteilt an mehreren Tischen, entweder bei einem frühen Frühstück oder einer Tasse Kaffee. Sie sprachen mit gedämpften Stimmen, gelegentlich klirrten Besteck und Porzellan.
Jack hatte einen Kaffee, einen Tee und einen Krapfen mit dickem Zuckerguß gekauft. Der Kaffee war für ihn, der Rest für Katherine. Ihre lackierten Fingernägel leuchteten im Neonlicht, als sie den warmen Krapfen auseinanderriß.
Jack beobachtete sie geistesabwesend und wandte sich dann seinem Kaffee zu. Er fühlte sich wie zerschlagen und brauchte das Koffein – aber jetzt etwas zu essen, war undenkbar für ihn. Daß Rachel sterben könnte, war eine unerträgliche Vorstellung, daß Rachel geistig behindert bleiben könnte, nicht minder.
Er trank einen großen Schluck, setzte die Tasse ab und schaute auf die Uhr, streckte sich, um seinen Magen zu entkrampfen und schaute wieder auf die Uhr, doch es war noch keine Zeit vergangen.
»Es will mir einfach nicht in den Kopf, daß sie hier ist«, sagte er und ließ gedankenverloren den Blick über die anderen Gäste wandern. »Sie haßt Krankenhäuser. Die Mädchen waren kaum auf der Welt, da war sie auch schon wieder zu Hause. Wenn sie eine Bauernmagd gewesen wäre, hätte sie die Kinder auf dem Feld bekommen.«
Katherine nickte. »Das kann ich mir gut vorstellen. Rachel ist einer der Freigeister unseres Zirkels.«
Ihre Zugehörigkeit zu diesem Zirkel verwunderte ihn. Während ihrer Ehe war sie eine erklärte Einzelgängerin gewesen, und das in einer Stadt, wo der geringste Anlaß genügte, um irgendeine Gruppe ins Leben zu rufen. Sie hatte das alles abgelehnt, hatte ihn abgelehnt, hatte ihre Sachen gepackt und war drei Autostunden weiter in den Süden nach Big Sur gezogen, um dort offenbar genau einige Dinge zu tun, die zu tun sie sich unter seinem Dach geweigert hatte.
Das gab ihm einen Stich, und er sagte anzüglich: »Das muß ja ein ganz besonderer Zirkel sein.«
Katherine hörte auf zu kauen und schluckte. »Wie meinen Sie das?«
»Na ja – es ist doch erstaunlich, daß Sie schon die ganze Nacht hier sind.«
Sie legte den Rest des klebrigen Krapfens auf den Teller zurück und wischte sich an einer Serviette die Hände ab. »Rachel ist meine Freundin – und ich wollte nicht, daß sie mutterseelenallein wäre, wenn sie aufwachte.«
»Wie es aussieht, wird sie vorläufig nicht aufwachen, und außerdem bin jetzt ich hier. Sie können nach Hause fahren.«
Katherine schaute ihn lange an. Dann schüttelte sie den Kopf, nahm ihre Tasse und ihren Teller, stand auf und sagte in einem Ton, der ein Erheben ihrer Stimme überflüssig machte: »Sie sind ein unsensibler Scheißkerl, Jack. Kein Wunder, daß sie sich von Ihnen hat scheiden lassen.«
Jack sah ihr nach, und als sie den Raum durchquert hatte, hatte er sich eingestanden, daß ihr Urteil noch milde ausgefallen war: Er war nicht nur unsensibel, sondern auch undankbar – und dazu noch ungehobelt. Er begann zu begreifen, warum diese beiden Frauen befreundet waren: Wenn er in einer solchen Art und Weise mit Rachel gesprochen hätte, wäre sie ebenfalls gegangen.
Er nahm seine Tasse und folgte ihr. »Sie haben recht«, gestand er leise. »Das war wirklich unsensibel von mir. Sie sind ihre Freundin und haben – weiß Gott – das Recht, hier zu sein. Ich fühle mich entsetzlich hilflos und habe Angst, und das habe ich an Ihnen ausgelassen.«
Sie sah ihn eine Weile an und senkte den Blick dann auf ihren Krapfen.
»Darf ich mich zu Ihnen setzen?« flehte er regelrecht. »Sie wissen doch – geteiltes Leid ist halbes Leid. Und wie wäre es mit ›ein Freund von Rachel ist auch mein Freund‹?«
Die Drohung einer Ablehnung hing eine halbe Ewigkeit lang über seinem Kopf wie ein Damoklesschwert, doch schließlich deutete Katherine auf den freien Stuhl an ihrem Tisch. Sie nippte an ihrem Tee, während er sich niederließ, und stellte ihre Tasse dann wieder hin. Den Blick darauf gerichtet, sagte sie ruhig: »Ich erwärme mich nicht schnell für Menschen – und in Ihrem Fall sind die Voraussetzungen denkbar ungünstig. Sie sind nämlich nicht der einzige hier, der sich hilflos fühlt und Angst hat.«
Plötzlich bemerkte er Spuren von Erschöpfung hinter ihrer makellosen Fassade. Es war nicht seine Absicht gewesen, ihr das Leben noch schwerer zu machen. Er freute sich für Rachel, daß sie eine so gute Freundin hatte.
Wieder schaute er auf seine Uhr. Es war erst halb fünf. Sie mußten Zeit totschlagen, und er war neugierig. »Rachel hat mir nie von dem Lese-Zirkel erzählt.«
»Vielleicht liegt das daran, daß Sie geschieden sind«, meinte Katherine sarkastisch, fuhr dann jedoch in freundlicherem Ton fort: »Sie hat die Gruppe mit aufgebaut. Wir haben uns vor fünf Jahren zusammengeschlossen.«
»Wie oft treffen Sie sich?«
»Einmal im Monat. Wir sind zu siebt.«
»Wer sind die anderen?«
»Frauen aus der Gegend. Eine Reisebürokauffrau, eine bildende Künstlerin, eine Bäckereiinhaberin, und zwei spielen Golf. Sie waren vorhin alle hier. Diesmal sprachen wir allerdings nicht über Bücher.«
Nein, dachte Jack – sie hatten natürlich über den Unfall gesprochen. In dem Bedürfnis, seiner Wut Luft zu machen, richtete er seine Aggression gegen einen Unbekannten. »Was war denn das für ein Irrer, der Rachel reingefahren ist? War der Kerl betrunken? Hat die Polizei ihn wenigstens erwischt?«
»Es war kein Mann. Es war eine Frau, und sie war nicht betrunken. Sie war senil, schon über achtzig, und man hätte ihr längst den Führerschein abnehmen müssen. Die Polizei hatte keine Schwierigkeiten mit ihr – sie liegt im Leichenschauhaus.«
Jack stockte der Atem. Im Leichenschauhaus. Daß sie tot war, machte die Situation plötzlich realer, ließ Rachels Zustand noch ernster erscheinen.
Er stieß ein langgezogenes Stöhnen aus. Mit der Luft entwich auch der Zorn aus ihm.
»Sie hinterläßt bestimmt Kinder und Enkel«, mutmaßte Katherine.
»Bestimmt.« Er lehnte sich zurück. »Großer Gott.«
»Sie sagen es.«
***
Katherine erklärte sich einverstanden damit, daß Jack als erster zu Rachel hineinginge, und er war ihr sehr dankbar dafür. Rachel, die immer vor Lebhaftigkeit gesprüht hatte, lag wie ein Schatten in dem mit einem Geländer versehenen Bett. Der Raum war nur gedämpft beleuchtet, die vierte Wand bildete eine Glasschiebetür, der Ungestörtheit gewährleistende Vorhang war zurückgezogen, damit das Klinikpersonal Rachel im Auge haben konnte.