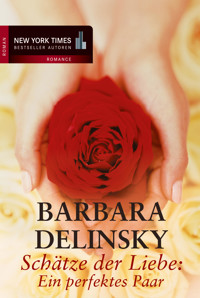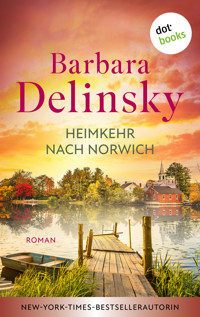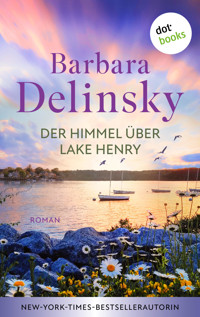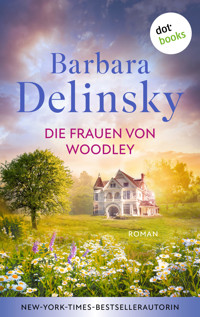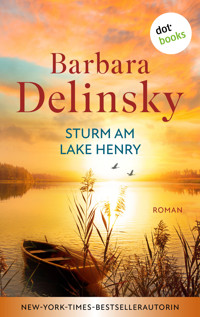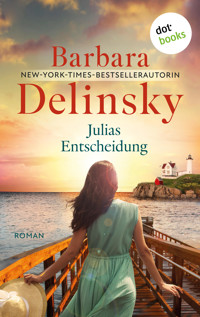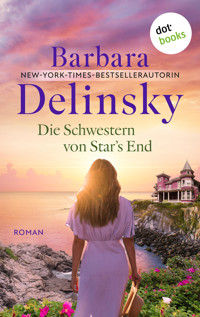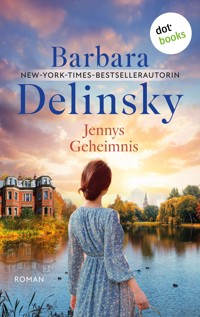
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Welche Geschichte verbirgt das alte Anwesen auf dem Hügel? Der mitreißende Roman »Jennys Geheimnis« von Barbara Delinsky als eBook bei dotbooks. Ein Erbe, das ihr Leben für immer verändern wird … Die Nachricht vom Tod ihres leiblichen Vaters wirbelt für die junge Psychologin Casey alles durcheinander: Cornelis Unger wollte sie nie als Tochter anerkennen, sondern als unerwünschte Folge eines Seitensprungs vergessen – warum also hat er ihr nun seine Villa auf Beacon Hill, der besten Gegend Bostons vererbt? Dort findet Casey noch dazu einen rätselhaften Umschlag, der an sie adressiert ist: Ein unvollendeter Roman – oder die wahre Geschichte einer jungen Frau namens Jenny, die vor vielen Jahren alles daran setzte, um ihr Glück zu finden? Casey beginnt, nachzuforschen … und ahnt nicht, wie weit die Geheimnisse der Vergangenheit ihre Schatten in die Gegenwart werfen können. »Bewegend und voller Gefühl. Man will diesen Roman nicht aus der Hand legen.« Library Journal Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der fesselnde Schicksalsroman »Jennys Geheimnis« von New-York-Times-Bestsellerautorin Barbara Delinsky wird alle Fans der Familiengeheimnisroman von Felicity Whitmore und Rachel Hore begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 619
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ein Erbe, das ihr Leben für immer verändern wird … Die Nachricht vom Tod ihres leiblichen Vaters wirbelt für die junge Psychologin Casey alles durcheinander: Cornelis Unger wollte sie nie als Tochter anerkennen, sondern als unerwünschte Folge eines Seitensprungs vergessen – warum also hat er ihr nun seine Villa auf Beacon Hill, der besten Gegend Bostons vererbt? Dort findet Casey noch dazu einen rätselhaften Umschlag, der an sie adressiert ist: Ein unvollendeter Roman – oder die wahre Geschichte einer jungen Frau namens Jenny, die vor vielen Jahren alles daran setzte, um ihr Glück zu finden? Casey beginnt, nachzuforschen … und ahnt nicht, wie weit die Geheimnisse der Vergangenheit ihre Schatten in die Gegenwart werfen können.
Über die Autorin:
Barbara Delinsky wurde 1945 in Boston geboren und studierte dort Psychologie und Soziologie. Nach der Geburt ihres ersten Sohnes arbeitete sie als Fotografin für den Belmont Herald, erkannte aber bald, dass sie viel lieber die Texte zu ihren Fotos schrieb. Ihr Debütroman wurde auf Anhieb zu einem großen Erfolg. Inzwischen hat Barbara Delinsky über 70 Romane veröffentlicht, die in mehr als 20 Sprachen übersetzt wurden und regelmäßig die New-York-Times-Bestsellerliste stürmen. Sie engagiert sich außerdem sehr stark für Wohltätigkeitsvereine und Aufklärung rund um das Thema Brustkrebs. Barbara Delinsky lebt mit ihrem Mann in New England und hat drei erwachsene Söhne.
Die Website der Autorin: barbaradelinsky.com/
Bei dotbooks veröffentlichte Barbara Delinsky auch ihre Romane:
»Die Schwestern von Star’s End«
»Das Weingut am Meer«
»Julias Entscheidung«
»Sturm am Lake Henry«
»Im Schatten meiner Schwester«
Weitere Romane sind in Planung.
***
eBook-Neuausgabe Juni 2023
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 2003 unter dem Originaltitel »Flirting with Pete« bei Scribner, New York.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 2003 by Barbara Delinsky
Published by Arrangement with Barbara Delinsky
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2004 bei Knaur
Taschenbuch. Ein Unternehmen der Droemerschen Verlagsanstalt
Th. Knaur Nachf. GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98690-679-5
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Jennys Geheimnis« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Barbara Delinsky
Jennys Geheimnis
Roman
Aus dem Amerikanischen von Georgia Sommerfeld
dotbooks.
TK gewidmet
Prolog
Little Falls
Der Anruf kam um drei Uhr morgens. Dan O’Keefe fuhr in seine Uniform und lief zu seinem Streifenwagen. Nicht, weil Darden Clyde verlangte, dass er käme, und auch nicht, weil es sein Job war – obwohl beides zutraf -, sondern aus Sorge um Jenny.
Er hätte inzwischen daran gewöhnt sein müssen, sich um Jenny zu sorgen, denn er tat es, seit er vor acht Jahren als Deputy seines Vaters angefangen hatte. Damals war sie eine sechzehnjährige Einzelgängerin gewesen, die einem nicht in die Augen schauen konnte. Er sorgte sich um sie, als sie achtzehn war, ihre Mutter starb und ihr Vater ins Gefängnis kam, und er hatte sich in den sechs Jahren seither um sie gesorgt, in denen sie zusehends zu einer Außenseiterin im Ort wurde. Er hatte keine großen Anstrengungen unternommen, um ihr zu helfen, und darum fühlte er sich schuldig.
Und jetzt hatte er noch mehr Grund dazu. Er hatte Dardens Entlassung ebenso wenig gewünscht wie Jenny, doch er hatte nicht versucht, sie zu verhindern. Also fühlte er sich doppelt schuldig und sorgte sich doppelt.
Und dann war da noch seine Schulter, die immer schmerzte, wenn Unheil drohte. Sein Vater führte die Attacken darauf zurück, dass er ein lausiger Footballspieler war, aber die alten Verletzungen waren längst verheilt. Wenn er angespannt war, spürte er die Narben, so einfach war das. Die Schulter hatte gebrannt, als Darden Clyde am Abend zuvor um sechs Uhr zwölf aus dem Bus gestiegen war und den Fuß auf Little-Falls-Boden gesetzt hatte. Jetzt schmerzte sie höllisch.
Er trat aufs Gas. Er fuhr durch Nieselregen von der Ortsmitte aus schnurgerade die West Main hinunter, an Häusern vorbei, die so dunkel waren, dass er nichts von ihrer Existenz gewusst hätte, wenn ihm nicht jeder Quadratzentimeter des Städtchens vertraut gewesen wäre. Nach einer Meile wurden die Abstände zwischen den Häusern größer. Schließlich bog er zu dem einzigen erleuchteten Haus ein und hielt das Steuer mit beiden Händen fest umklammert, während der Jeep durch die tiefen, wassergefüllten Schlaglöcher der Zufahrt holperte. Er parkte vor der Küchentür von Clydes Haus, die einen Spaltbreit offenstand, nahm mit einem Schritt die beiden schlammverdreckten Stufen und zog die Fliegengittertür auf.
Die Eintönigkeit der Kiefernholzeinrichtung der Küche wurde durch das Rosa der Resopalarbeitsflächen und das vom vielen Schrubben zu einem hellen Fleischton verblassten des Linoleumfußbodens aufgelockert, dem momentan menschlichsten Element im Raum. Darden saß am Ende einer Schlammspur auf dem Boden. Er lehnte unter dem Telefon an der Wand und erinnerte, so durchweicht und dreckig, wie er war, an eine nasse Ratte. Sein Gesicht war blutverschmiert. Er hielt sich den rechten Arm, schonte seine gesamte rechte Seite und hob lediglich den Blick, als ob seine Kraft nicht für mehr reichte. Doch selbst jetzt glitzerte Bösartigkeit in seinen Augen.
»Sie hat mich überfahren!«, knurrte er wütend. »Ich ging k.o. und lag eine Ewigkeit, bis ich hier reinkriechen konnte. Meine Hüfte bringt mich um.«
Dan interessierte sich herzlich wenig für Dardens Hüfte. Er ging zu der Tür, die in den Flur hinausführte, und horchte. Es war totenstill im Haus. »Wo ist sie?«
»Woher zum Teufel soll ich das wissen? Sie überfuhr mich mit meiner eigenen Karre und haute ab. Das macht zusammen Fahrerflucht, Diebstahl und Fahren ohne Führerschein – und darum habe ich Sie angerufen.«
Dan hatte schon gewusst, dass der Buick nicht da war, die Garage stand offen, und seine Scheinwerfer hatten ins Dunkel geleuchtet, als er von der Hauptstraße eingebogen war, war aber davon ausgegangen, dass Jenny den Wagen irgendwo abgestellt hatte und zurückgekommen war. Ja, sie hatte ihm gesagt, dass sie Little Falls verlassen wollte, und, ja, sie hatte einen Freund erwähnt, aber niemand hatte den Knaben bisher gesehen. Allein war Jenny scheu und unsicher, und Dan konnte sich nicht vorstellen, dass sie sich nach all der Zeit plötzlich auf den Weg in die große, weite Welt gemacht hatte. Sehr viel eher konnte er sich vorstellen, dass sie, auf den regenglitschigen Ziegeln mit ihrem Leben spielend, im Dunkeln auf dem Dach kauerte.
Dan drückte die Klinke.
»Heyl«, brüllte Darden ihm nach. »Wo wollen Sie hin?«
Ohne sich um den Alten zu kümmern, durchsuchte Dan in aller Eile das Haus, dabei innerlich auf der Hut, auf einen ähnlich grauenvollen Anblick zu stoßen wie vor sechs Jahren, doch er fand weder Jenny noch irgendwelche Anzeichen für eine Gewalttat. Abgesehen von einem nassen Kleid auf dem Fußboden im Schlafzimmer und einem wilden Durcheinander aus Kissen, Decken und Zeitungsausschnitten auf dem Speicher war alles ordentlich. Auf dem Dach war niemand und auf dem Gelände tief darunter gottlob ebenso wenig.
Er kehrte in die Küche zurück.
»Ich hab Ihnen doch gesagt, dass sie nicht da ist«, bellte Darden. »Haben Sie was mit den Ohren? Sie hat meinen Wagen genommen! Wenn Sie sie finden wollen, müssen Sie sie da draußen suchen.«
Das hatte Dan auch vor. Er wusste, dass Jenny keine gute Autofahrerin war. Mehr als einmal hatte er sie gestoppt und ihr ins Gewissen geredet. Was hätte er sonst tun sollen? Ihr einen Strafzettel wegen Zickzackfahrens aufbrummen? Ihr den Schlüssel wegnehmen? Sie wegen Fahrens ohne Führerschein festnehmen und sie ins Bezirksgefängnis stecken, wo sie mit Koksern und Nutten eingesperrt würde?
Was ihm Sorgen bereitete, war die Möglichkeit, dass sie einen Unfall gehabt hatte. Es gab um Little Falls herum viele Stellen, wo ein Wagen von der Straße abkommen konnte und tagelang nicht entdeckt würde. Er nahm sich vor, diese Stellen abzuklappern, aber zuerst wollte er noch mit Darden reden.
Er zog einen Stuhl unter dem Küchentisch heraus und setzte sich. Die Überreste des Abendessens – eingetrockneter Rindfleischeintopf, ein angebissenes Brötchen – und eine leere, umgefallene Bierflasche, der säuerlicher Alkoholgeruch entströmte, schufen eine Atmosphäre der Unappetitlichkeit. »Was ist passiert?«
»Wie oft soll ich Ihnen das noch sagen? Sie hat mich einfach über den Haufen gefahren und ist verschwunden.«
»Und warum?«
»Woher zum Teufel soll ich das wissen? Ich saß beim Abendessen. Sie sagte, sie geht jetzt. Als ich sie aufhalten wollte, fuhr sie mich um.« Seine Augen waren hart und kalt wie Stahl. »Finden Sie sie, O’Keefe. Das ist Ihr Job. Wenn Sie sie verhaften müssen, dann verhaften Sie sie. Nur bringen Sie sie zurück.«
»Warum? Sie ist vierundzwanzig und nie weiter gekommen als bis zum Gefängnis, wo sie Sie besucht hat. Vielleicht ist es Zeit.« »Von wegen! Sie hat hier zu sein!« Darden stach mit dem Zeigefinger auf den Linoleumboden ein. »Hier, verdammt noch mal! Sie hatte sechs Jahre Zeit...«
»Wofür?«, fiel Dan ihm ins Wort. »Um zu gehen? Wie hätte das aussehen sollen? Sie haben sie dazu verdonnert, das Haus in Ordnung zu halten, und ihr bei jedem ihrer Besuche vorgehalten, wie viel sie Ihnen verdanke, von Ihren Anrufen nicht zu reden. Ich will mir gar nicht vorstellen, was Sie ihr alles vorgehalten haben.« »Sie ist meine Tochter, und sie tat, was sie tat, weil sie mich liebt.«
Dan kam auf die Füße, denn er fürchtete, wenn er sie nicht anderweitig beschäftigte, würden sie anfangen, Darden mit Tritten zu traktieren. Er war kein Verfechter polizeilicher Brutalität, er verabscheute sie sogar – einer der Streitpunkte zwischen ihm und seinem Vater -, doch jetzt war er so wütend, dass er sich nur mühsam beherrschen konnte.
»Wollen Sie mich verarschen?«, fuhr Dan auf. »Sie hat getan, was sie getan hat, weil Sie sie zu Tode geängstigt haben. Sie hätte das Haus verkaufen sollen, nachdem das damals hier passiert war, aber Sie haben es ihr nicht erlaubt. Sie hätte es verkaufen oder niederbrennen oder einfach verlassen und verschwinden sollen. Ich redete ihr zu, und Sie redeten dagegen. Sie wollten sie auf ewig an die entsetzlichen Erinnerungen fesseln, Sie und Ihr perverses Hirn. Das arme Ding hat mehr an Jahren Leid hinter sich als Sie an Knasttagen, und Sie sind schuld daran.« Er beugte sich zu Darden hinunter, von einem so glühenden Hass erfüllt, dass er ihm am liebsten ins Gesicht gespuckt hätte. »Und darum sage ich Ihnen eines, und ich rate Ihnen, gut zuzuhören, damit Sie sich nachher nicht wundern: Wenn ich das Mädchen finde und Sie haben ihr etwas angetan, werden Sie sich wünschen, Sie wären im Gefängnis krepiert. Haben Sie das verstanden, Sie Arschloch?«
Darden stieß einen verachtungsvollen Laut aus. »Sie sind doch gar nicht Manns genug, um mich anzufassen. Ihr Daddy hätte den Mut vielleicht, aber Sie doch nicht.«
Dan richtete sich auf. »Ich habe ihm zweiunddreißig Jahre lang zugesehen. Seien Sie vorsichtig. Wenn sie verletzt ist, werden Sie sehen, was ich kann. Ich könnte gut auf Sie verzichten.«
Dardens Miene drückte deutlich aus, dass das auf Gegenseitigkeit beruhte. Wenn Blicke töten könnten, hätte Dan in diesem Moment seinen letzten Atemzug getan.
Der Deputy rieb sich die Schulter. »Haben Sie eine Ahnung, wohin sie wollte?«
»Sie erwähnte einen Pete.«
»Kennen Sie ihn?«
»Wie sollte ich? Ich bin noch keine zwölf Stunden hier!« »Hat sie ihn vielleicht im Gefängnis kennen gelernt?« Darden starrte ihn schweigend an, und Dan wünschte sich nicht zum ersten Mal, dass er bei Jenny wegen dieses Pete nachgehakt hätte. Er hatte es gut sein lassen, weil sie glücklich wirkte, und eine glückliche Jenny hatte Seltenheitswert. Angesichts der Entwicklung der Dinge wäre ihm jetzt allerdings sehr viel wohler gewesen, wenn er gewusst hätte, dass sie mit einem anständigen Kerl weggelaufen war. Und es hätte ihm großes Vergnügen bereitet, Darden Clyde das vor den Bug zu knallen.
»Hat sie ihn schon früher mal erwähnt?«, fragte Dan. »Oder einen anderen Mann?«
Darden grunzte ein Nein.
»Was haben Sie zu ihr gesagt, als sie Ihnen von ihm erzählte?« »Ich habe ihr gesagt, dass sie nirgendwohin zu gehen habe«, schnauzte Darden.
Der Deputy hätte darauf gewettet, dass er noch viel mehr gesagt hatte. »Und was antwortete sie darauf?«
»Dass sie gehen werde.«
»Also ging es hin und her. War das alles?«
»Was soll das heißen, war das alles«?«
»Haben Sie sie geschlagen?«
»Ich schlage sie nie. Ich liebe sie. Sie ist meine Tochter. Ich bin zurückgekommen, um mich um sie zu kümmern.«
O ja! Dan wusste, wie das aussah, und sagte es Darden mit einem Blick. »Haben Sie sie angefasst?«
»Ich bin nicht einmal in ihre Nähe gekommen! Suchen Sie sie, O’Keefe! In jeder Minute, die Sie hier rumstehen und mir blöde Fragen stellen, wird ihr Vorsprung größer.«
Genau das bezweckte Dan. Vorausgesetzt, Jenny war wohlauf und auf der Flucht vor Darden, wollte er ihr so viel Vorsprung geben wie möglich.
Falls sie jedoch einen Unfall gehabt hatte, müsste er sie schnellstens finden.
Er ging zum Telefon und forderte bei dem Krankenhaus zwei Orte weiter einen Rettungswagen für Darden an. Im Vertrauen darauf, dass der Mann nicht weit kommen würde, ließ er ihn allein auf dem Küchenboden sitzen, holte seine Stablampe aus dem Jeep und machte sich daran, die nähere Umgebung des Hauses und den Wald nach Jenny abzusuchen, wobei er auch nach Reifenspuren eines Motorrades Ausschau hielt, da Jenny erzählt hatte, ihr Pete fahre so ein Ding. Aber Dans Suche blieb in beiderlei Hinsicht ergebnislos. Also fuhr er los, um sie per Jeep zu suchen.
*
Als die Sonne aufging, hatte er jede Straße von Little Falls abgesucht, den Buick jedoch weder geparkt noch untergestellt oder zertrümmert gefunden. Er fuhr bei seinen Eltern vorbei, um seinen Vater zu informieren. Der jedoch war derart beschäftigt, sich über Funk mit Imus zu streiten, dass er seinem Sohn keine große Aufmerksamkeit schenkte und ihm die Suche nach Jenny gern überließ, was Dan sehr gelegen kam, denn er wusste, dass er gewissenhafter vorgehen würde, weil er mit dem Herzen dabei war. Sein Vater war seit fast vierzig Jahren der Polizeichef von Little Falls, er war gelangweilt, blasiert und hart geworden.
Dan war all das nicht. Von einem Gefühl wachsender Dringlichkeit getrieben, kehrte er in die Garage zurück, in der die Polizeidienststelle untergebracht war, und führte ein paar Telefongespräche. Nachdem er die benachbarten Polizeichefs auf den Buick aufmerksam gemacht hatte, stieg er wieder in seinen Jeep.
Seiner Meinung nach gab es außer ihm nur noch zwei Menschen, denen Jenny ihre Pläne, Little Falls zu verlassen, vielleicht anvertraut hatte: Miriam Goodman, die von ihrer kleinen Küche aus einen staatsweiten Partyservice unterhielt, und Reverend Putty von der Congregational Church. Dan sprach mit beiden, doch auch sie konnten ihm nicht sagen, wohin Jenny gewollt hatte.
Wieder suchte er die Landstraßen ab, diesmal bei Tageslicht, und wieder ergebnislos. Also fuhr er in den Ort zurück und auf einen Kaffee und Rühreier zum Imbiss. Wenn irgendjemand etwas wüsste, hätte er dort die größte Chance, es zu erfahren.
Das Einzige, was er erfuhr, war das Ausmaß der Antipathie, das die Einheimischen für Darden Clyde empfanden. Alle schienen zu bedauern, dass er nicht wenigstens eine gebrochene Hüfte davongetragen hatte statt der lächerlichen Abschürfungen und Blutergüsse, und es herrschte allgemeine Empörung darüber, dass der Mann, während er in der Notaufnahme medizinisch versorgt wurde, unentwegt über Dan O’Keefe gewettert hatte.
»Er sagte, Sie begünstigten eine Verbrecherin.«
»Er sagte, Sie hätten keine Ahnung von anständiger Polizeiarbeit.«
»Er sagte, wenn Sie ein Hirn im Schädel hätten, anstatt Sie wissen schon was, würden Sie das FBI einschalten.«
Das berichteten Dans Freunde, ohne ihn beleidigen zu wollen, und er fühlte sich auch nicht beleidigt. In Wahrheit hörte er nur mit halbem Ohr zu. In seinem Kopf summte es wie in einem Bienenstock, seine Schulter war total verkrampft, und in seinem Magen kribbelte es. Seine Sorge um Jenny wuchs.
Und wieder machte er sich auf den Weg, hielt bei jeder Schlucht und jeder Ausweichstelle an, weil er dachte, je höher die Sonne stiege, umso größer werde die Chance, dass ihr Licht auf etwas fiele, was ihm vorher nicht aufgefallen war. Am späten Vormittag hatte er noch immer nichts entdeckt.
Also fuhr er zum Steinbruch hinaus. Er war zwar heute schon zweimal dort gewesen, doch diesmal tat er es um seiner selbst willen. Er parkte am Rand und stieg aus. Im Ort war die Luft klar, hier herrschte Nebel, und das war einer der Gründe dafür, dass es ihn an diesen Platz gezogen hatte. Nebel befreite den Geist.
Er verwischte die Konturen der Wahrheit und gestattete Hoffnung. Der Steinbruch war bei jeder Witterung ein Platz zum Träumen, doch je dichter der Nebel, umso schöner der Traum. Was war sein Traum? Etwas Gutes zu tun. Etwas Gutes zu tun. Das mochte naiv klingen, aber es war eines seiner Motive gewesen, diesen Job anzunehmen. Ein zweites war, dass er sich damals als Künstler versucht, jedoch nicht Fuß gefasst hatte und Geld brauchte. Ein drittes Motiv? Dass seine Mutter ihn buchstäblich angefleht hatte, ihn anzunehmen, weil sein Vater niemand anderen finden konnte, der dazu bereit gewesen wäre. In Little Falls das Gesetz zu vertreten stellte keine Herausforderung dar. Es erschöpfte sich darin, Schwänzer zur Schule, Betrunkene ins Gefängnis und Junkies zum Behandlungszentrum drei Täler weiter zu schaffen, lächerliche Streitigkeiten zwischen Einheimischen zu schlichten und bei häuslichen Auseinandersetzungen den Schiedsrichter zu spielen. Und es bedeutete, endlos durch die Straßen von Little Falls zu patrouillieren, um den Leuten das Gefühl zu vermitteln, in Sicherheit zu sein.
Waren sie es? In dieser Umgebung erschien es Dan so. Die Szenerie hätte nicht friedlicher sein können. Kleine Wellen leckten leise am Granit, regenfeuchte Kiefernnadeln trockneten raschelnd in der weichen Brise, kleine Tiere huschten durchs Unterholz, und der Geruch von Erde hing in der Luft. An einem Tag wie diesem wirkte der Steinbruch wie eine Kirche, wie eine Zwischenstation auf dem Weg zum Himmel.
Das war eine der Phantasien, die sein Vater als Vergeudung hoher College-Studiengebühren bezeichnen würde, doch Dan fand sie zutreffend. Die Atmosphäre hatte etwas Sakrales. Er wurde zusehends ruhiger. Zuversichtlicher. Sogar seine Schulter fühlte sich besser an, was angesichts der Luftfeuchtigkeit seltsam war.
Er massierte seine Schulter. Sie war tatsächlich nicht mehr so verkrampft. Er füllte seine Lungen mit Nebel und horchte in sich hinein. Ja, er war tatsächlich zuversichtlich.
Wie erklärte sich das?
Der Steinbruch war eine riesige Schöpfkelle, deren Boden, ein Granitbecken, mit dem Wasser aus einer Quelle hoch oben auf dem Berg gefüllt war. Auf dem sechs Meter langen Stiel saß eine Erdmütze, in deren über das Wasser hinausragendem Schirm die Leute aus dem Ort ein Sprungbrett sahen. Dan ging um das Becken herum, wobei er vorsichtig Fuß vor Fuß setzte, um nicht auf dem von letzter Nacht noch regenglitschigen Granit auszurutschen, überquerte die Plankenbrücke über dem Ablauf des Beckens, der reißend stromabwärts gurgelte, und schaute, auf der anderen Seite angekommen, zu den Bäumen hinüber, die die wabernden Nebelschwaden abwechselnd freigaben und verhüllten.
Aus einem Impuls heraus wechselte er von dem Granit auf einen schmalen Pfad, der sich zwischen den Bäumen hindurchwand, und während er, den Blick nach unten gerichtet, um nicht über eine der vielen über dem Boden wachsenden Wurzeln zu stolpern, auf einem Teppich aus Kiefernnadeln und einem verfilzten, immergrünen Dickicht vorbei und unter überhängenden Ästen hindurchschlenderte, wurde seine Vermutung allmählich zur Überzeugung. Und so überraschte ihn nicht, was er schließlich fand.
Darden Clydes Buick stand, zwischen den Bäumen versteckt, an einer Stelle, die kaum jemand aus dem Ort kannte. Er hätte nicht im Traum gedacht, dass Jenny sie kannte.
Er wusste schon, bevor er hineinschaute, dass der Buick leer war, ebenso wie er plötzlich wusste, was sie getan hatte.
Er senkte den Kopf, doch ein aus seinem tiefsten Inneren aufsteigender Schmerz zwang ihn, ihn in den Nacken zu legen und zu stöhnen wie ein gequältes Tier. Nach einer Weile wurde der Schmerz von Schuldgefühlen verdrängt, und wieder nach einer Weile setzten die Schuldgefühle ihn in Bewegung.
Er ging den Weg zurück, den er gekommen war, und umrundete mit wachsamen Blick das wassergefüllte Becken, doch hier drückte nichts auf seine Seele, lag keine Tragödie in der Luft. Sie kam ihm sogar leicht und hell vor. Sogar seine Schulter fühlte sich hier gut an.
Natürlich ergab das keinen Sinn, aber so war es.
Verspielte Nebelkinder tollten über das Wasser, und Dans Blick folgte einem von ihnen, während es hierhin und dorthin sprang, höher und höher, bis es über den Schirm der Erdmütze davonhüpfte. Und in diesem Moment sah er die Kleider.
Wieder stieg Schmerz in ihm auf, doch diesmal lähmte er ihn nicht. Mit schnellen Schritten ging er zur anderen Seite des Steinbruchs und begann zu klettern, von einem Felsen zum nächsten, bis er den Vorsprung erreichte.
Er erkannte das Kleid sofort. Jenny hatte es bei Miss Jane’s gekauft und letzten Freitag zum Tanz getragen. Es lag ordentlich zusammengefaltet neben ihrer Unterwäsche und den abgetragenen Sneakers, die sie so oft ins Städtchen und wieder nach Hause gebracht hatten. Ihre Fußspuren waren klein und zart, Eigenschaften, die nur wenige im Ort mit ihr in Verbindung brachten, denn Zartheit assoziierte man mit Zerbrechlichkeit, die man mit Verletzlichkeit assoziierte, die man mit Unschuld assoziierte, die üblicherweise den Beschützerinstinkt weckte. Doch Little Falls hatte Jenny Clyde ebenso wenig beschützt, wie Dan es getan hatte. Dieses Wissen würde ihn für den Rest seines Lebens verfolgen.
Kleine, zarte, einsame Fußabdrücke waren die einzigen Spuren auf der nachts vom Regen glatt gewaschenen Erde. Wenn sie mit einem Mann zusammen gewesen war, so hatte er sie nicht hierher begleitet. Die Spur war deutlich, führte von der Stelle, an der Dan stand, zu der, an der Jenny ihre Kleider abgelegt hatte, und von dort bis zum Rand des Vorsprungs, wo sich ihre Fersen in den weichen Boden gegraben hatten, während ihre Zehen darüber hinausragten.
Das Gedankendurcheinander, das in seinem Kopf gesummt hatte, ordnete sich plötzlich. All die kleinen Dinge, die Jenny getan und die ihn in den letzten Monaten beunruhigt hatten – und in den letzten Tagen noch mehr machten auf einmal Sinn. Wäre er etwas intelligenter, hätte er vielleicht erkannt, worauf sie hinauslaufen würden.
Nein. Mit Intelligenz hatte das nichts zu tun. Er hatte die Puzzleteile nicht zusammengefügt, weil er das Bild nicht hatte sehen wollen. Sonst hätte er in Aktion treten müssen, und er stand allein in Little Falls, was Mitgefühl für Jenny Clyde betraf.
Er suchte mit den Augen das Wasser ab. Es lag ruhig da, geradezu provozierend in seinem Schweigen. Natürlich würde man versuchen, es zum Reden zu bringen, doch nach dem Unwetter konnten die Wassermassen die Leiche mit sich stromabwärts gerissen haben. Man würde die Ufer abgehen für den Fall, dass sie angespült wurde, doch das kam höchst selten vor. In den Annalen von Little Falls standen mehrere Freitode dieser Art, und bei keinem davon war die Leiche jemals aufgetaucht. Nach hiesiger Überlieferung gab der Steinbruch nicht wieder her, was er einmal verschlungen hatte.
Da er im Wasser nichts entdeckte, ließ Dan seinen Blick am Rand des Beckens entlang und dann zum Waldrand wandern. Der Nebel trieb sein Spiel mit ihm, gaukelte ihm die Umrisse einer lebendigen, menschlichen Gestalt vor, ehe er sich verzog und nichts hinterließ als Felsen, Bäume und Moos.
Selbstmord war eine Sünde. Dan konnte nicht gutheißen, was Jenny getan hatte, aber er wusste, wie erstickend eng ihre Welt gewesen war. Und in ihrer Not hatte sie das kleinere von zwei Übeln gewählt. Er brachte es nicht über sich, sie dafür zu verurteilen.
Außerdem hatte sie sich nicht nur schuldig gemacht, sie hatte auch Gerechtigkeit geübt. Indem sie sich umbrachte, nahm sie Darden Clyde, wonach ihn in seiner Pervertiertheit am meisten verlangte. Sie hatte ihn allein gelassen in seiner von ihm selbst geschaffenen Hölle.
Das gefiel Dan. Er wollte, dass Darden sich quälte, und er wollte Jenny frei wissen. Obwohl er um sie trauerte, empfand er Zufriedenheit. Wahrscheinlich schmerzte seine Schulter deshalb nicht mehr.
Er atmete tief ein. Beim Ausatmen hakte er die Finger in seinen Hosenbund. Es gab Arbeit für ihn. Er sollte seinen Bericht per Funk durchgeben und Hilfe für eine gründliche Suche anfordern. Nein. Noch nicht. Es widerstrebte ihm, die friedliche Atmosphäre zu zerstören, die so gar nicht dazu passte, dass letzte Nacht hier ein Leben beendet worden war. Dan stellte sich vor, dass es der Geist von Jenny Clyde war, der diese schöne Stimmung schuf – von Jenny Clyde, die endlich frei war und glücklich.
Dann driftete ein Nebelschleier zur Seite ab, und etwas Rotes stach Dan ins Auge. Es bewegte sich nur eine Winzigkeit, doch die genügte, um Dan in Marsch zu setzen.
Unerwarteterweise empfand er auf dem Weg nach unten einen Anflug von Enttäuschung. Er hatte Jenny gewünscht zu entkommen. Sie hätte kein Leben hier – nicht, nachdem Darden wieder da war.
Dieser Gedanke säte einen anderen, der im Zeitraffer Wurzeln schlug. Wenn es ihm darauf ankam, etwas Gutes zu tun, dann hätte er jetzt Gelegenheit dazu.
Er kletterte in Windeseile die Felsen hinunter, ohne darauf zu achten, dass er sich an den scharfen Kanten die Hände aufschürfte und die Knie und Schienbeine anschlug. Unten angekommen, lief er in den Wald zu der Stelle, wo er es rot hatte leuchten sehen. Als er näherkam, drosselte er sein Tempo, weil er fürchtete, sie sonst in die Flucht zu treiben, doch Jenny Clyde rührte sich nicht. Sie saß mit angezogenen Beinen, das Gesicht in den auf den Knien verschränkten Armen geborgen, nackt und zitternd auf dem nackten Boden. Ihre roten Haare hoben sich leuchtend gegen ihre weiße Haut ab.
Während er die letzten paar Schritte auf sie zu tat, zog er seine Jacke aus. Er ging neben Jenny auf die Knie, legte ihr die Jacke um, hob das Mädchen auf seine Arme und trug es ohne ein Wort
zum Jeep. Er setzte sie hinein, bedeutete ihr, sich zu ducken, damit sie von draußen nicht zu sehen wäre, glitt hinters Steuer und fuhr los.
Er nahm eine Nebenstraße, von der er wusste, dass er sie für sich allein hätte. Als Jenny aufhörte zu zittern, schaltete er die Heizung ein. Sie hob den Kopf nicht, und sie sagte nichts.
Als sie Little Falls ein gutes Stück hinter sich gelassen und ein Gebiet erreicht hatten, das ihm einen weitreichenden Empfang für sein Autotelefon bot, rief er die Auskunft an, bekam die gewünschte Nummer und sprach drei Minuten mit einem alten Freund vom College, der sofort bereit war, sich zwei Stunden freizunehmen und ihm auf halbem Weg entgegenzukommen.
Sein Vater wäre außer sich. »Behinderung der Justiz!«, würde er toben, denn er klebte förmlich an den Buchstaben des Gesetzes. »Du bist in großen Schwierigkeiten, Dan-O, und für deinen Freund gilt das Gleiche. Dazu habe ich dich nicht aufs College geschickt!«
Aber sein Vater würde es nie erfahren. Und auch sonst niemand im Ort. Der Steinbruch und das Bachbett würden abgesucht werden, dann käme man überein, dass die Leiche entweder in tieferes Wasser mitgerissen worden sei und sich unter einem Felsen verklemmt hätte oder ein Opfer der geheimnisvollen Macht wurde, die den Steinbruch regierte.
Die Ursache spielte keine Rolle, nur die Wirkung. Für Little Falls war Jenny Clyde tot.
Kapitel 1
Boston
Der Gedenkgottesdienst wurde in einer dunklen Steinkirche in Bostons Marlboro Street abgehalten, nicht weit von dort, wo Cornelius Unger gelebt und gearbeitet hatte. Er fand an einem sonnigen Mittwoch im Juni statt, drei Wochen nach dem Tod des Mannes, so wie er es verfügt hatte. Was immer sich davor ereignet hatte, war im kleinsten Kreis abgelaufen. Casey Ellis hatte man nicht dazu gebeten.
Sie saß in der vierthintersten Reihe und ließ den Blick über die Trauergemeinde wandern. Niemand schniefte, niemand flüsterte, niemand seufzte, stöhnte oder jammerte. Kummer war hier nicht gefragt. Die Damen und Herren, dezent gekleidet, denn es ging ihnen nicht darum aufzufallen, waren Wissenschaftler und Therapeuten, die sich eingefunden hatten, weil Cornelius Unger, Connie genannt, mehr als vierzig Jahre lang eine führende Persönlichkeit auf ihrem Gebiet gewesen war. Das voll besetzte Haus sprach sowohl für die Langlebigkeit des Mannes als auch für seine Brillanz.
Casey hätte darauf gewettet, dass von den mehreren hundert Versammelten sie die einzige emotional Beteiligte war – und dabei schloss sie die Witwe mit ein. Es war allgemein bekannt, dass der berühmte Dr. Unger seine Ehefrau in einem schönen Haus am North Shore »hielt«, wo sie ihr eigenes Süppchen kochte, während er allein in Boston lebte und sie gelegentlich am Wochenende besuchte. Connie Unger legte großen Wert auf ein ungestörtes Privatleben. Er verabscheute gesellschaftliche Zusammenkünfte. Er hatte Kollegen, keine Freunde, und wenn er Familie hatte – in Form von Schwestern, Brüdern, Nichten, Neffen oder Cousinen, so wusste niemand etwas davon. Seine Ehe war kinderlos geblieben.
Casey war das Ergebnis einer flüchtigen Begegnung mit einer Frau, zu der er nach ihrer einzigen, gemeinsamen Nacht nicht mehr als ein Dutzend Worte gesagt hatte. Da niemand hier über jene Nacht oder über Casey Bescheid wusste, war sie für die Leute nur ein weiteres Gesicht in der Menge.
Sie jedoch kannte eine ganze Reihe der Anwesenden, wenn auch nicht dank ihres Vaters. Er hatte sie nie offiziell anerkannt, ihr nie die Hand gereicht, ihr nie Hilfe angeboten, nie eine Tür für sie geöffnet. Er hatte nie Unterhalt für sie bezahlt. Ihre Mutter hatte nie darum gebeten, und als Casey schließlich den Namen ihres Vaters erfuhr, steckte sie mitten in der Teenager-Trotzphase und hätte sich nicht einmal an ihn gewandt, wenn ihr Leben davon abgehangen hätte.
Ein Stück Trotz war geblieben. Casey war zwar zu dem Gedenkgottesdienst erschienen, aber eigentlich nur, um ihren Erzeuger zu beschämen, denn verdient hatte er es weiß Gott nicht, und nachher würde sie die Kirche verlassen und das Thema abhaken.
Sich auf diese Gedanken zu konzentrieren war einfacher, als sich den Verlust einzugestehen. Sie hatte Cornelius Unger nie persönlich kennen gelernt, doch solange er lebte, lebte auch die Hoffnung in ihr, dass er eines Tages auf sie zukommen würde. Mit seinem Tod starb diese Hoffnung.
»Hast du je versucht, Kontakt mit ihm aufzunehmen?«, hatte ihre Freundin Brianna sie gefragt. »Hast du je versucht, ihn zur Rede zu stellen? Hast du ihm jemals einen Brief, eine E-Mail oder ein Geschenk geschickt?«
Die Antwort lautete in allen drei Fällen »Nein«. Stolz spielte eine Rolle dabei, ebenso Zorn und Loyalität ihrer Mutter gegenüber. Und dann war da noch die Heldenverehrung. Wie es für Hassliebe-Beziehungen typisch ist, war Cornelius Unger nicht nur ihr Feind, sondern auch ihr Vorbild gewesen, seit sie seinen Namen kannte. Mit sechzehn war sie neugierig, doch die Neugier wandelte sich schnell zu Zielstrebigkeit. Er lehrte in Harvard. Sie bewarb sich dort und wurde abgelehnt. Hätte sie sich an ihn wenden und ihm diese Niederlage gestehen sollen?
Danach machte sie ihre Abschlüsse an der Tufts University und am Boston College. In Boston machte sie ihren Master in Sozialarbeit, ein Master war kein PhD, kein Doktor, den Cornelius Unger hatte, aber sie therapierte wie er, und jetzt hatte man ihr sogar eine Dozentur angeboten. Sie wusste nicht, ob sie annehmen würde, aber das war ein anderes Thema. Sie liebte ihre Arbeit, und aus dem Engagement ihres Vaters ließ sich schließen, dass auch er mit Leib und Seele Therapeut gewesen war. Sie hatte im Lauf der Jahre seine sämtlichen Veröffentlichungen gelesen, viele seiner Vorlesungen besucht und jeden Artikel über ihn ausgeschnitten. Er sah die Therapie als eine Schnitzeljagd, bei der die Hinweise in den verschiedenen »Räumen« des Lebens eines Klienten versteckt waren, setzte auf Gesprächstherapie, um sie ans Licht zu holen, eine Ironie, wenn man bedachte, dass der Mann bekanntermaßen unfähig war, eine ganz normale Unterhaltung zu führen. Aber er wusste die richtigen Fragen zu stellen.
Darauf komme es an, erklärte er seinen Studenten, die richtigen Fragen zu stellen. Man muss zuhören und dann Fragen stellen, die den Klienten auf den Weg bringen, selbst die Antworten zu finden.
Nach dem Zulauf zu schließen, war sie recht gut darin. Die Leute, die sie heute hier kannte, waren Kollegen von ihr. Sie hatte mit ihnen studiert, Praxisräume geteilt, an Workshops teilgenommen und therapiert. Sie hatten eine so hohe Meinung von ihrem beruflichen Können, dass ein nicht unwesentlicher Prozentsatz ihrer Klienten aufgrund von Empfehlungen zu ihr kam.
Die Kollegen ahnten nichts von der Beziehung zwischen ihr und dem Verstorbenen.
In der Kirche war nichts von der Wärme des Junitages zu spüren. Die Sonne ließ zwar die Farben der hoch in den Steinmauern sitzenden, bemalten Fenster leuchten, doch es war angenehm kühl, und es roch nach Geschichte, wie es Relikte aus dem amerikanischen Freiheitskrieg taten. Casey liebte diesen Geruch und atmete ihn genießerisch ein, während ein Trauerredner nach dem anderen nach vorn ging. Keiner von ihnen sagte etwas, was ihr neu gewesen wäre. Beruflicherseits war Connie Unger geliebt worden. Seine Wortkargheit wurde abwechselnd als Scheu oder Nachdenklichkeit interpretiert, seine Weigerung, auf Fakultätspartys zu erscheinen, mit einer liebenswerten Schüchternheit erklärt. Irgendwann hatten die Leute begonnen, ihn zu beschützen, und Casey fragte sich oft, ob wohl sein Mangel an Privatleben dazu geführt haben mochte, dass sich, da er keine Freunde besaß, seine Kollegen für ihn verantwortlich fühlten.
Der Gottesdienst endete, und die Trauergemeinde strebte dem Ausgang zu wie Casey auf dem Rückweg an ihren Arbeitsplatz. Sie lächelte einem Freund zu, grüßte einen anderen mit einem Nicken, blieb vor dem Portal kurz auf der Treppe stehen, um ein paar Worte mit ihrem ehemaligen Studienberater zu wechseln, erwiderte die Umarmung einer vorbeikommenden Kollegin. Als sie das nächste Mal stehen blieb, geschah es wegen eines ihrer Partner.
Die Gemeinschaftspraxis umfasste fünf Partner, von denen John Borella der einzige Arzt, ein Psychiater, war. Zwei Kollegen waren Diplompsychologen, und Casey und eine Kollegin hatten ihre Master in Sozialarbeit gemacht.
»Wir müssen uns nachher zusammensetzen«, sagte der Psychiater.
Sein drängender Ton beunruhigte Casey nicht. John war ein Panikmacher. »Mein Tag ist voll«, erwiderte sie.
»Stuart ist weg.«
Das irritierte sie nun doch. Stuart war einer der Diplompsychologen, und, was noch wichtiger war, ihm oblag die Kontoführung der Praxis.
»Was meinst du mit >weg<?«, fragte sie vorsichtig.
»Weg«, wiederholte John, diesmal jedoch leiser. »Seine Frau hat vorhin bei mir angerufen. Sie sagte, als sie gestern Abend von der Arbeit gekommen war, habe sie feststellen müssen, dass er verschwunden sei. Schubladen, Schränke, Sparbuch – alles leer. Ich habe natürlich sofort in seinem Büro nachgesehen. Dort war es dasselbe.«
»Was ist mit seinen Akten?«, fragte Casey alarmiert.
»Weg.«
Ihr Erschrecken steigerte sich zu Entsetzen. »Unser Konto?« »Leer.«
»Oje.« Sie versuchte, sich zu beruhigen. »Okay. Wir reden später.«
»Er ist mit unserer Miete weg!«
»Ich weiß.«
»Für sieben Monate!«
»Ja.« Casey hatte Stuart an jedem Ersten der sieben Monate, die sie in dieser Praxisgemeinschaft arbeitete, einen Scheck in Höhe ihres Anteils gegeben. Letzte Woche hatten die Kollegen erfahren, dass Stuart die Miete für keinen dieser Monate überwiesen hatte. Als sie ihn darauf ansprachen, behauptete er, die Zahlungen seien in den Bergen von Papierkram, den er zu erledigen habe, untergegangen, und sie glaubten ihm, weil sie ihm das nachfühlen konnten. Er hatte versprochen, die ausstehende Summe dann auf einmal zu überweisen.
»Sie ist nächste Woche fällig«, erinnerte John Casey.
Sie würden das Geld auftreiben müssen. Die Alternative lautete »Räumungsbefehl«, und darüber wagte Casey, während Cornelius Unger zusah und -hörte, nicht einmal nachzudenken. »Du hast Recht, wir müssen uns zusammensetzen«, sagte sie zu John. »Heute Abend nach der Arbeit, okay?«
»Entschuldigen Sie?« Ein schlanker, grauhaariger Mann trat auf sie zu, als sie am Fuß der Treppe ankam. »Miss Ellis?«
John hob zum Abschied die Hand und entfernte sich.
»Ja bitte?«, sagte Casey.
»Mein Name ist Paul Winnig«, stellte der Fremde sich vor. »Ich war Dr. Ungers Anwalt, und ich bin sein Testamentsvollstrecker. Kann ich Sie kurz sprechen?«
Überrascht und auch ein wenig beunruhigt stammelte sie: »Äh ... ja, natürlich. Wann immer Sie möchten.«
»Jetzt gleich wäre gut.«
»Jetzt gleich?« Sie schaute auf ihre Uhr und verspürte einen Anflug von Verärgerung. Vielleicht hatte ihr Vater Klienten warten lassen, sie tat es nicht. »Ich habe in dreißig Minuten einen Termin.«
»Ich werde höchstens fünf beanspruchen.« Der Anwalt umfasste ihren Ellbogen und führte sie auf den schmalen mit Naturstein ausgelegten Weg, der an der Kirche entlanglief und dann in eine kleine Grünanlage mündete.
Dort angekommen, ließ er sie los und deutete auf eine schmiedeeiserne Bank. Caseys Herz hämmerte gegen ihre Rippen. Nachdem sie sich gesetzt hatten, sagte der Anwalt: »Dr. Unger hat verfügt, dass ich gleich nach dem Gedenkgottesdienst mit Ihnen sprechen sollte.«
»Ich verstehe nicht, weshalb«, erwiderte Casey äußerlich gelassen. »Er hatte keinerlei Interesse an mir.«
»Ich glaube, da irren Sie sich«, antwortete der Mann in sanft tadelndem Ton und zog eine gepolsterte Versandtasche aus seiner Jacketttasche. Es war ein brauner Briefumschlag, nicht viel größer als eine Visitenkarte, mit einem messingfarbenen Dorn verschlossen.
Casey starrte auf den Umschlag hinunter.
Der Anwalt drehte ihn um, sodass sie die Vorderseite sehen konnte. »Es steht Ihr Name darauf.«
So war es. Da stand Cassandra Ellis in der Krakelschrift, die sie von den Anmerkungen auf den Grafiken und Tabellen kannte, die Connie Unger in seinen Vorlesungen benutzte, die sie so oft aus der Ferne gesehen hatte.
Cassandra Ellis. Ihr Name, von ihrem Vater geschrieben. Das war eine Premiere.
Ihr schlug das Herz mittlerweile bis zum Hals. Sie hob den Blick und suchte den des Anwalts. Zögernd, weil sie nicht wusste, was sie in dem Umschlag zu finden hoffte, und gleichzeitig fürchtete, dass das, was immer es auch war, nicht drin wäre, streckte sie die Hand aus. Sie spürte etwas Hartes.
»Es ist ein Schlüssel, erklärte Paul Winnig. »Dr. Unger hat Ihnen sein Haus hinterlassen.«
Casey starrte ihn ungläubig an. Als er bekräftigend nickte, senkte sie den Blick wieder auf die kleine, braune Versandtasche. Mit zitternden Fingern entfernte sie den Dorn, öffnete den Umschlag, spähte hinein und stellte ihn auf den Kopf. Der Schlüssel fiel in ihre hohle Hand. Dann griff sie in das Tütchen, in dem noch ein x-mal gefaltetes Blatt Papier steckte, und zog es heraus. In den Sekunden, die sie brauchte, um es zu entfalten, einige Sekunden mehr, als sie gebraucht hätte, wenn ihre Hände ruhiger gewesen wären, schlug ihre Phantasie Purzelbäume. In diesen Sekunden malte sie sich eine Botschaft aus. Nichts Episches, einfach nur etwas in der Art wie »Du bist meine Tochter, Casey. Ich habe deine Entwicklung in all den Jahren verfolgt, und ich bin stolz auf dich«.
Der Zettel enthielt tatsächlich eine Botschaft, doch sie war von rein sachlicher Natur: die Adresse des Reihenhauses. Der Code für die Alarmanlage. Eine kurze Liste von Namen neben Stichwörtern wie »Klempner«, »Maler« und »Elektriker«. Die Namen des Gärtners und des Hausmädchens waren mit Sternchen versehen.
»Dr. Unger wäre es lieb, wenn Sie den Gärtner und die Hausangestellte behielten«, erklärte der Anwalt die Kennzeichnung. »Letztendlich liegt die Entscheidung natürlich bei Ihnen. Er schätzte die Arbeit der beiden und hatte das Gefühl, dass sie das Haus ebenso liebten wie er.«
Casey konnte es nicht fassen. Eine rein technische Notiz, kein einziges persönliches Wort für sie! »Er liebte das Haus?«, echote sie tief gekränkt und begegnete Winnigs Blick. »Ein Haus ist eine Sache. Hat er auch Menschen geliebt?«
Der Anwalt lächelte traurig. »Auf seine Weise.«
»Und wie war die?«
»Wortlos. Zurückhaltend.«
»Abwesend«, ergänzte Casey aufgebracht. Sie musste sich sehr beherrschen, um das Papier nicht zusammenzuknüllen und in hohem Bogen wegzuschleudern. Sie war wütend – enttäuscht, dass ihr Vater nichts zu ihrem beruflichen Werdegang gesagt, nichts geäußert hatte, was sie gern gehört hätte. »Was ist, wenn ich sein Haus nicht haben will?«
»Wenn Sie es nicht behalten wollen, dann verkaufen Sie es. Der Wert liegt bei drei Millionen. Das ist Ihr Erbe, Ms Ellis.«
Casey zweifelte nicht an der Wertangabe. Das Haus lag am begehrten Leeds Court auf dem Beacon Hill. Sie war viele Male daran vorbeigefahren, doch nicht einmal war sie dabei auf die Idee gekommen, dass dieses Anwesen eines Tages ihr gehören könnte.
»Sind Sie jemals drin gewesen?«, fragte der Anwalt.
»Nein.«
»Es ist ein ausgesprochen schönes Haus.«
»Ich habe Eigentum, eine Wohnung.«
»Sie könnten sie verkaufen.«
»Und mir eine noch höhere Hypothek aufhalsen?«
»Das Objekt ist nicht belastet.«
Und er hinterließ es ihr? Ein voll bezahltes Drei-Millionen-Dollar-Haus? Wo war der Haken? »Die Heizung und die Klimaanlage müssen ein Vermögen verschlingen, ganz zu schweigen von den Steuern. Allein die Vermögenssteuer ist wahrscheinlich doppelt so hoch wie meine jährlichen Hypothekenzahlungen.«
»Es besteht ein Treuhandfonds, aus dem die Steuern bezahlt werden. Das Gleiche gilt für das Personal. Das Haus hat eigene Parkplätze, zwei Stellplätze auf der Rückseite des Hauses, mit Zugang zum Garten, und zwei auf dem Court, ebenfalls voll bezahlt. Was die Heizung und den Rest betrifft, vertraute er darauf, dass Sie diese Ausgaben selbst tragen könnten.«
Das könnte sie oder hätte es gekonnt, wenn Stuart Bell sich nicht mit sieben Monatsmieten aus dem Staub gemacht hätte. »Warum?«
»Warum was?«
»Warum hat er das getan? Warum macht er mir nach all den Jahren absoluten Ignorierens ein so großzügiges Geschenk?« »Das kann ich Ihnen nicht sagen.«
»Weiß seine Frau davon?«
»Ja.«
»Und sie hat nichts dagegen?«
»Nein. Sie hat das Haus nie bewohnt, und sie braucht es auch nicht.«
»Wie lange weiß sie schon, dass es mich gibt?« »Eine Weile.«
»Und da konnte sie mich nicht anrufen und mir sagen, dass er gestorben war? Ich musste es aus der Zeitung erfahren! Das war kein schönes Gefühl.«
»Es tut mir Leid.«
»Hatte er ihr verboten, Kontakt mit mir aufzunehmen?«
Der Anwalt seufzte leicht genervt. »Das weiß ich nicht. Ihr Vater war ein komplizierter Mensch. Ich glaube, niemand von uns wusste, wie es in ihm aussah. Ruth, seine Frau, noch am ehesten, aber Sie wissen vielleicht, wie die beiden miteinander lebten.« Ja, das wusste Casey, und sie wusste nicht, wen sie mehr bedauerte – ihre Mutter, die Connie Unger verlor, bevor sie ihn gehabt hatte, oder Connies Frau, die ihn gehabt, aber verloren hatte. »Wie es scheint, war der Mann kein Glückstreffer«, meinte sie sarkastisch.
»Mag sein.« Der Anwalt stand auf. »Wie auch immer – das Haus gehört Ihnen. Es ist bereits alles auf Ihren Namen eingetragen. Ich werde Ihnen die Papiere morgen per Kurier zukommen lassen. Am besten legen Sie sie in Ihren Safe.« Casey war sitzen geblieben. »Ich habe keinen Safe.« »Ich schon. Soll ich sie vielleicht für Sie aufbewahren?« »Ja, bitte.«
Winnig zog eine Visitenkarte aus seiner Tasche. »Hier finden Sie mich.«
Casey nahm die Karte. »Was ist mit seinen ... Sachen? Sind die noch alle dort?«
»Die persönlichen, ja. Da Emmett Walsh dem Wunsch Ihres Vaters entsprechend die Praxis weiterführen wird, sind der Computer, die Patientenunterlagen und die Rotationskartei zu ihm gebracht worden.«
Eine kleine Seifenblase platzte. Von Zeit zu Zeit hatte sie einem Traum Quartier geboten. Der Traum ging so: Eines Tages würde Connie Unger Caseys berufliche Fähigkeiten so hoch achten, dass er ihr Klienten schickte; sie sogar zu seinem Protegé machte; ihr sogar anbot, sie in seine Praxis hineinzunehmen, sozusagen einen Familienbetrieb daraus zu machen.
Die Enttäuschung war von kurzer Dauer, schließlich hatte der Traum niemals auch nur ein Quäntchen Ermutigung erfahren. »Aha«, sagte sie tonlos und blieb wie festgeklebt auf der Bank sitzen.
»Sie sehen blass aus«, stellte der Anwalt fest. »Sind Sie okay?« Sie lächelte schief. »Ja, ja, nur etwas durcheinander.«
Er nickte verständnisvoll. »Sehen Sie sich das Haus an. Es hat Charme.«
An diesem Tag kam Casey nicht mehr dazu. Sie hatte bis acht Uhr Klienten, und danach traf sie sich mit ihren Kollegen im Konferenzraum. Cornelius Unger, der Inbegriff von Anstand und Ordnung, hätte in der folgenden Situation gelitten. Die Stimmung war von Anfang an feindselig. Es gab innerhalb der Gruppe oft Meinungsverschiedenheiten, doch die Krise verstärkte sie.
»Wo ist Stuart?«
»Woher zum Teufel soll ich das wissen? Ich habe ein Dutzend Leute angerufen!«
»Wir müssen die Polizei einschalten.«
»Ich bitte dich! Das ist eine Privatangelegenheit! Er ist ein Freund.«
»Dein Freund. Von früher.«
»Wie sind wir nur auf die Idee gekommen, ihn die Geldangelegenheiten managen zu lassen?«
»Er hat es gemacht, weil keiner von uns es machen wollte.«
»Er war immer sehr vernünftig, was mehr ist, als ich von einigen Therapeuten sagen kann«, bemerkte Renee, die »Sozialarbeiterin«.
»Das ist eine Beleidigung!«, fuhr John auf.
»Es war ein Witz!«
»Das glaube ich nicht. Du und Casey – ihr begreift nicht, dass ihr ohne uns gar keine Arbeitsberechtigung hättet.«
Dies wiederum fasste Casey als Beleidigung auf. »Natürlich hätten wir eine Arbeitsberechtigung!«
»Und ein angenehmeres Betriebsklima!«, setzte Renee giftig hinzu.
»Dann geht doch!«, forderte John sie heraus. »Umso weniger Praxisräume müssen wir mieten.«
»Wer wird uns denn jetzt noch was vermieten?«
»Hey, wir haben doch nichts verbrochen!«, warf Marlene Quinn, die Jugendpsychologin, ein, um wieder gutzumachen, dass sie dem Dieb am nächsten gestanden hatte. »Stuart hat den Mietvertrag unterschrieben. Als Einziger. Und darum ist auch er der Einzige, von dem der Vermieter das Geld erwartet.«
»Er hat unser Geld!«
»Und wie kriegen wir es zurück?«
»Ich will nicht umziehen.«
»Können wir das Geld irgendwie zusammenbekommen?«
»Hört, hört! Casey macht sich Sorgen wegen Geld!«, spöttelte John, »unser Softie, der Klienten sogar gratis behandelt!«
»Das hat nichts mit Softie zu tun!«, wehrte sie sich. »Ich will helfen – auch wenn die Versicherung nichts bezahlt! Bin ich je mit meinen Mietzahlungen in Verzug gewesen?«
»Nein«, antwortete Renee, »und ich auch nicht. Ein Umzug kommt nicht in Frage. Ich habe schließlich Patienten!«
»Nein«, korrigierte John. »Ich habe Patienten. Du hast Klienten.« »Keiner von uns wird jemanden behandeln können, wenn wir hier rausfliegen«, warf Casey ein. »Und der Hausbesitzer hat da keine Skrupel. Erinnert ihr euch an die Anwälte aus dem zweiten Stock?«
»Die sind auf die Füße gefallen«, sagte Marlene. »Sie haben in einem anderen Gebäude für weniger Geld schönere Räume bekommen.«
»Warum müssen wir denn am Copley Square sitzen? Wenn wir vier Blocks weiterzögen, würden wir bedeutend günstigere Konditionen kriegen.«
»Ich arbeite nicht in South End«, erklärte John.
»Wie konnte Stuart das Konto abräumen?«, fragte Casey ungläubig.
»Er hatte eine Vollmacht von uns. Die Bank hatte keinen Grund, misstrauisch zu werden.«
»Aber warum hat er es getan? Hat er Schulden? Spielt er? Ist seine Ehe kaputt?«
Renee nahm Caseys Faden wieder auf. »Und keiner von uns sah es kommen! Dabei ist Einfühlungsvermögen eine Grundvoraussetzung für unseren Beruf!«
»Deswegen sind wir noch lange keine Gedankenleser«, gab Marlene zu bedenken. »Wir können uns erst einfühlen, wenn wir bei einem Klienten die Mauer aus Verleugnung und Misstrauen eingerissen haben.«
»Stuart war kein Klient«, sagte Casey. »Er erfüllte in unserer Gemeinschaft eine bestimmte Aufgabe, wie wir das alle tun, und er verhielt sich in keiner Weise befremdend. Wie hätten wir darauf kommen sollen, dass etwas mit ihm nicht stimmte?«
»So kommen wir nicht weiter«, kam Renee auf das Wesentliche zurück. »Wir brauchen schleunigst Geld. Wo kriegen wir es her?«
Die Besprechung endete ohne Ergebnis. Casey verließ erschöpft die Praxis und den Copley Square. Mit ausgreifenden Schritten und tief aus dem Bauch heraus atmend, ging sie die Boylston Street hinunter zur Massachusetts Avenue. Links und dann rechts abbiegend, lief sie durch Seitenstraßen, bis sie zur Fenway mit ihren roten Backsteinhäusern kam, die auf einen Streifen von Wasser und Bäumen hinausschauten.
Die Yogaatemtechnik half nur zu einem Teil. Caseys Tränen waren schon längst versiegt, doch so oft sie auch hierher kam – dem Besuch gefasst entgegenzusehen, das schaffte sie nie. Wenn sie etwas in ihrem Leben ändern könnte, dann die Tatsache, ihre Mutter nicht mehr in diesem Zustand sehen zu müssen.
Sie stieg die fünf Steinstufen hinauf und öffnete die Tür, winkte der Dame am Empfang zu und bog zur Treppe ab. Im zweiten Stock begrüßte sie die Dienst habende Schwester. »Hi, Ann. Wie gehts ihr?«
Ann Holmes war eine mütterliche Frau, deren Gelassenheit darauf hindeutete, dass sie sich daran gewöhnt hatte, mit schwer Hirngeschädigten umzugehen. Caroline Ellis, Caseys Mutter, befand sich seit drei Jahren in ihrer Obhut.
Ann bedeutete mit der Hand ein So-und-So. »Heute war kein so guter Tag. Morgens hatte sie ein paar leichte Anfälle. Dr. Jinsji hat Sie doch angerufen, oder?«
»Ich war nicht da. In der Nachricht, die er mir hinterließ, hieß es, das Valium habe geholfen.« In der Nachricht hatte es auch noch geheißen, dass der Arzt besorgt sei wegen der zunehmenden Häufigkeit der Anfälle, aber Casey war eher ermutigt als besorgt. Sie beschloss zu glauben, dass die Anfälle nach so vielen Monaten des Dahinvegetierens ein Zeichen dafür seien, dass Caroline allmählich zu sich käme.
»Sie hat sie überwunden«, sagte die Schwester. »Jetzt schläft sie.«
»Dann werde ich ganz leise sein«, flüsterte Casey.
Sie eilte den Flur hinunter zum Zimmer ihrer Mutter und schlüpfte hinein. Der Raum war nur schwach von den Lichtern der Stadt beleuchtet, doch Casey hätte sich auch im Dunkeln zurechtgefunden. Abgesehen von den medizinischen Geräten für die künstliche Ernährung und Flüssigkeitszufuhr standen nur ein Bett, zwei Sessel und eine Kommode in dem Raum, und da Casey Sessel und Kommode selbst hergebracht und platziert hatte, wusste sie, wo sie sich befanden. Außerdem besuchte sie ihre Mutter seit dem Unfall vor drei Jahren mehrmals in der Woche, und nach so vielen Stunden, in denen sie hier auf und ab gegangen war, die Wände angestarrt und die Möbelstücke berührt hatte, kannte Casey jeden Quadratzentimeter.
Zielstrebig steuerte sie auf das Bett zu und küsste ihre Mutter auf die Stirn. Caroline duftete frisch. Das tat sie immer, was einer der Gründe dafür war, dass Casey sie hierließ. Abgesehen von den frischen Blumen jede Woche wurde auch auf Aspekte der Lebensqualität wie spezielle Körperpflege geachtet, obwohl diese – wie die Blumen – häufig eine größere Rolle für die Angehörigen zu spielen schien als für die Patienten selbst. Für Casey galt Letzteres ganz besonders. Die Caroline, die sie gekannt hatte, hatte die Ställe ihrer Tiere ausgemistet. Den einzigen Geruch jedoch, den Casey je mit ihr assoziiert hatte, war der leichte, würzige der Eukalyptuscreme, die Caroline benutzte. Casey sorgte stets für einen Vorrat davon, und die Schwestern wandten sie großzügig an. Es ließ sich nicht beweisen, dass der Duft Caroline in irgendeiner Weise half, aber zumindest wirkte er beruhigend auf Casey.
Sie setzte sich auf die Bettkante zu ihrer Mutter, nahm die steife Hand von der Decke, bog behutsam erst das Gelenk und dann die Finger gerade und drückte sie sanft an ihre Kehle. Carolines Augen waren verschlossen. Sie merkte es nicht, doch ihr Organismus hielt noch immer in etwa den üblichen Schlaf-wach-Zyklus ein.
»Hi, Mom. Ich weiß, es ist schon spät und du schläfst, aber ich musste einfach noch vorbeikommen.«
»Hattest du einen schlimmen Tag?«, fragte Caroline.
»Schlimm trifft es nicht so ganz. Seltsam stimmt eher. Connie hat mir sein Haus hinterlassen.«
»Er hat was?«
»Mir das Haus hinterlassen.«
»Das Haus auf dem Beacon Hill?«
Die Frage löste eine Erinnerung aus. Casey war plötzlich wieder sechzehn und gerade von einem Nachmittag in Boston zurück. »Beacon Hill?«, echote Caroline, nachdem Casey ihr die Worte in einer rebellischen Anwandlung hingeknallt hatte. Beacon Hill war ein Begriff, der zu so vielen Assoziationen einlud, doch im Hause Ellis führte er nur zu einer: Connie Unger. »Bist du dort gewesen, weil du ihn sehen wolltest?«, fragte Caroline. Casey leugnete es, doch ihre Mutter war natürlich gekränkt. »Er war nie für dich da, Casey. Er war für uns beide nie da, und wir sind gut ohne ihn zurechtgekommen.«
Damals war ihre Mutter zornig und verletzt gewesen. Die Reaktion, die Casey sich jetzt vorstellte, hatte eher mit Verwirrung zu tun.
» Was hat er sich wohl dabei gedacht?«
» Vielleicht wusste er nichts anderes damit anzufangen.« Caroline antwortete nicht sofort. Casey wusste, dass sie nach der bestmöglichen Art und Weise suchte, mit der Situation umzugehen. Schließlich fragte sie taktvoll: »Und wie stehst du dazu?« »Ich weiß noch nicht. Ich habe es erst heute Nachmittag erfahren.«
Casey ließ den Gedenkgottesdienst unerwähnt. Sie war nicht sicher, dass Caroline begreifen würde, warum sie hingegangen war, und sie wollte nicht, dass ihre Mutter glaubte, sie habe sich etwas von ihrem Erzeuger erhofft. Caroline war stets die perfekte Mutter gewesen, in jeder Hinsicht sicher und gefestigt – außer, was Connie Unger anging. Angesichts ihrer derzeitigen Situation und der Tatsache, dass ihre Ersparnisse durch Krankheitskosten dezimiert worden waren, würde sie ein so wertvolles Erbe von Connie als Bedrohung empfinden.
In dem Bestreben, das Thema zu wechseln, öffnete Casey den Mund, um Caroline von der Krise in der Praxis zu erzählen, doch dann überlegte sie es sich anders und machte den Mund wieder zu. Krisen kamen und gingen. Es war unnötig, Caroline mit dieser zu belasten. Ihre Mutter sollte ihre Energie lieber darauf verwenden, sich zu erholen.
Also saß sie eine Weile schweigend neben ihr, massierte einen Anschein von Beweglichkeit in die steifen Finger und wärmte sie an ihrem Hals. Nach einer Weile steckte sie die Hand unter die Decke und küsste ihre Mutter auf die Wange.
»Ein Haus bedeutet mir nichts. Du bist das Einzige, was für mich zählt. Du bist alles, was ich an Familie habe, Mom. Werd gesund. Wirst du das für mich tun?«
Sie betrachtete das schlafentspannte Gesicht. Nach einer Minute schlich sie auf Zehenspitzen hinaus.
Als sie die Fenway mit wehem Herzen hinter sich gelassen hatte, ging sie in Richtung Fluss zu der kleinen Wohnung in der Back Bay, die sie vor zwei Jahren gekauft hatte, ein Weg von kaum zehn Minuten. Nachdem sie die Post durchgesehen und sich ein »Leichte Kost«-Gericht warm gemacht hatte, waren ihre Kraftreserven erschöpft. Da am nächsten Morgen um acht der erste Klient auf der Matte stehen würde, legte sie sich schlafen.
Auch am Donnerstag fuhr sie nicht auf den Beacon Hill, denn wenn sie keine Klienten hatte, käute sie mit Renee, Marlene und John »den Fall Stuart« wieder. Stuarts Frau behauptete, es hätte zu keiner Zeit die Miete für sieben Monate auf dem Partnerkonto gelegen. Das ständige Hin und Her im Konferenzraum brachte die vier nicht weiter, sondern nur gegeneinander auf.
»Hast du dir die Kontoauszüge nie angesehen?«, fragte Marlene John.
»Ich? Warum hätte ich das tun sollen? Es war Stuarts Aufgabe.« »Aber du bist der Psychiater. Du bist der älteste von uns. Und du wolltest diese Räume.«
»Was? Ich wollte ins Government Center!«
»Wie sollen wir noch mal achtundzwanzigtausend aufbringen?«, fragte Casey.
»Es sind achtunddreißig! Der Vermieter hat Zinsen draufgeschlagen und will außerdem die nächsten zwei Monatsmieten im Voraus.«
»Wir könnten einen Kredit aufnehmen.«
»Ich kann mir keinen weiteren Kredit leisten.«
»Was schlägst du also vor?«
»Dass wir uns was Kleineres suchen.«
»Und wie soll das gehen? Wir brauchen auf jeden Fall vier Therapiezimmer, einen Konferenzraum und Platz für eine Buchhalterin.«
»Die könnte auch zu Hause arbeiten.«
»Dabei hätte ich kein gutes Gefühl. Ich meine, Stuart konnte uns sogar bestehlen, während wir ihn ständig um uns hatten. Wie viel leichter wäre es dann für jemanden außerhalb?«
Casey verließ die Praxis um sechs so verkrampft, dass sie zum Yogakurs ging. Sie brauchte Yoga sehr viel dringender als einen Besuch auf dem Beacon Hill, und danach war sie zu entspannt, um an Connie Unger zu denken. In dem Bedürfnis, sich etwas Gutes zu tun, lud sie zwei Freundinnen aus der Yogagruppe zum Abendessen ein, und als sie sich schließlich durch eine Flasche Merlot hindurchgelacht hatten, war es zu spät, um irgendwo anders hinzugehen als ins Bett und auch dorthin nur kurz. Freitag früh um sechs saß sie bereits am Steuer, unterwegs zu einem Workshop in Amherst.
Es war schon Abend, als sie sich auf den Heimweg machte. Im Auto hörte sie ihre Mailbox ab. Die eingegangenen Nachrichten bestanden ausschließlich aus dem Gejammer ihrer Partner, und plötzlich konnte sie es nicht mehr hören. Nach Rhode Island zu gehen, die Dozentur anzunehmen wäre eine gute Möglichkeit, sich diesem Durcheinander zu entziehen.
Sie rief nicht zurück, denn das Hickhack nervte sie, und das schon bevor sie darüber nachdachte, was Connie Unger wohl über so eine unharmonische Gruppe gesagt hätte. Sie habe versagt, würde er sagen. Er sei niemals von einem Partner bestohlen worden.
Kunststück. Er hatte schließlich allein praktiziert. Das könnte Casey auch. Die Dozentur erlaubte für ein paar Stunden pro Woche eine therapeutische Arbeit und das auf dem Universitätsgelände. Dass sie diese praktische Tätigkeit gänzlich aufgäbe, konnte sie sich nicht vorstellen, dazu liebte sie sie zu sehr.
Ein Umzug nach Providence warf aber ein anderes Problem auf: Die Entfernung zu ihrer Mutter – und das war geradezu eine haarsträubende Ironie des Schicksals. Casey war in Providence aufgewachsen, und Caroline hatte bis zu ihrem Unfall dort gelebt. Nach ihrem Wegzug hatte Casey größten Wert auf Abstand gelegt. Caroline war der Inbegriff von Heim und Herd, alles, was Casey nicht war, und je näher sie beieinander wohnten, umso bewusster wurde ihr das. Obwohl Casey in ihrem Beruf erfolgreich war, hatte sie immer das Gefühl, ihrer Mutter nicht das Wasser reichen zu können.
Als ob sie das beweisen wollte, machte Casey nicht den Kühlschrank sauber, als sie nach Hause kam, und sortierte auch nicht die Post aus, die auf der Arbeitsplatte in der Küche wie Schimmel wucherte, sondern sah sich Wiederholungsfolgen von »Buffy – im Bann von Dämonen« an, bis sie auf dem Sofa einschlief. Als sie um Mitternacht aufwachte, zog sie ins Bett um, schlief jedoch nur sporadisch. Wenn ihre Gedanken nicht um das Wort »Besorgnis« kreisten, das der Arzt an diesem Tag verwendet hatte, dachte sie über ihren möglichen neuen Job nach oder über die Situation in der Praxis, die sie ernsthaft anzuwidern begann, oder über die Tatsache, dass sie vierunddreißig war und noch immer ohne Wurzeln. Dann dachte sie an das Reihenhaus auf dem Beacon Hill, das sie so unerwartet geerbt hatte, und eine lästige Stimme in ihrem Kopf fing an, ihr Vorhaltungen zu machen.
Ja, sie mied das Haus, das war ihr durchaus bewusst. Sie demonstrierte ihrem toten Vater, dass sie es ihm übel nahm, erst nach seinem Tod von ihm anerkannt worden zu sein – und, dass sie sein Drei-Millionen-Dollar-Haus nicht brauchte. Jetzt ließ sie ihn warten. So einfach – und so kindisch – war es.
Als sie am Sonntagmorgen aufwachte, fühlte sie sich mutig. Sie hätte sich auch gern erwachsen gefühlt, doch das war ihr nicht vergönnt. Beacon Hill war ein Nobelviertel, und so wäre es – auch aus Respekt ihrem Vater gegenüber – angebracht gewesen, sich entsprechend zu stylen. Casey verzichtete auf jedwedes Make-up, zog knappe Joggingshorts und ein hautenges, ärmelloses Trikot an, setzte ihre schäbigste Baseballkappe auf, zog die Haare hinten durch, dann schlüpfte sie in ihre abgetragensten Laufschuhe, griff sich ihre dunkelste, trendyste Sonnenbrille und machte sich auf den Weg. Sie war schon zwei Blocks weit gekommen, als sie zu ihrem Ärger feststellte, dass sie den Hausschlüssel vergessen hatte. Nachdem sie ihn, ihr Handy und eine Wasserflasche in eine Leibtasche gepackt hatte, startete sie zum zweiten Anlauf.
Es war ein herrlicher Morgen, jetzt, um kurz vor neun, waren beinahe so viele Jogger wie Autos unterwegs. Sie lief in gemütlichem Tempo unter den alten Ahornbäumen und Eichen, die den großzügigen Mittelstreifen der Commonwealth Avenue bestanden. Nachdem sie in der Arlington Street an einer roten Ampel auf der Stelle gelaufen war, ging’s weiter in den Public Garden, und dort umrundete sie den Teich, auf dem die ersten Schwanenboote losmachten. Eltern fuhren ihre Babys spazieren, größere Kinder warfen Steine ins Wasser. Jedes dumpfe Plopp lockte eine Schar Enten an, die sich zerstreute, sobald die Tiere feststellten, dass die Steine nichts Essbares waren.