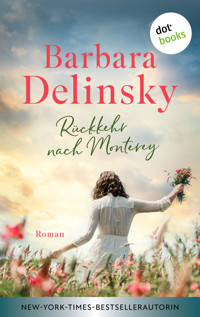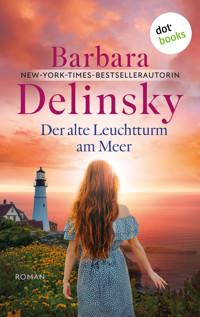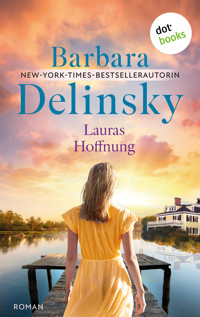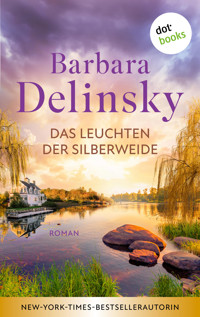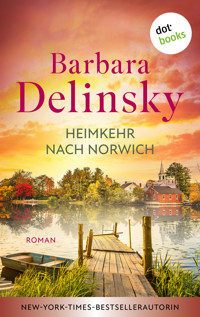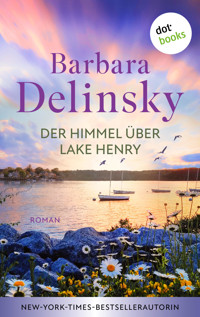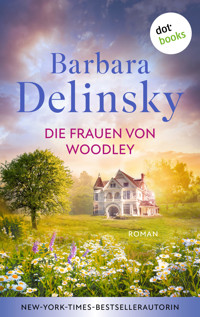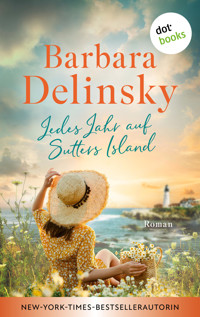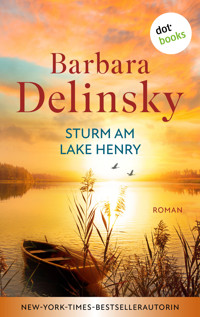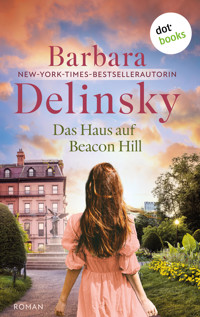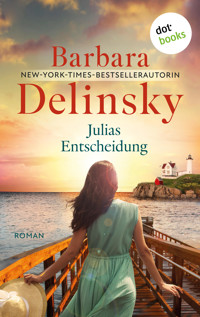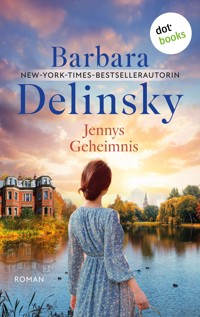5,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Welche Opfer würdest du für dein Kind bringen? Der aufwühlende Familienroman »Was wir nie vergessen können« von Barbara Delinsky als eBook bei dotbooks. Deborah und ihre 16-jährige Tochter Grace sind gerade auf dem Heimweg von einer Party, als sie im Scheinwerferlicht auf regennasser Straße eine Bewegung wahrnehmen, einen furchtbaren Schlag hören – und sich ihr Leben innerhalb einer Sekunde unwiderruflich verändert. Obwohl Grace am Steuer des Wagens saß, gibt Deborah zur Aussage, sie sei es gewesen. Der Tod eines Menschen soll nicht auf den Schultern ihrer jungen Tochter lasten, schließlich war es ein schrecklicher Unfall. Doch Deborahs Lüge hat ungeahnte Folgen, denn der Tote ist ein Schullehrer von Grace – und als Deborah zum ersten Mal seinem Bruder Tom begegnet, hat sie das Gefühl, dass ausgerechnet er ihr Fels in der Brandung sein könnte. Aber wird Deborahs Lüge für immer zwischen ihnen stehen? »Delinsky ist eine erstklassige Erzählerin: Sie erschafft glaubwürdige, sympathische Charaktere, die einem so vertraut vorkommen wie die eigenen Nachbarn.« Boston Globe Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der berührende Schicksalsroman »Was wir nie vergessen können« von New-York-Times-Bestsellerautorin Barbara Delinsky wird Fans von Jodi Picoult und Nicholas Sparks begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über dieses Buch:
Deborah und ihre 16-jährige Tochter Grace sind gerade auf dem Heimweg von einer Party, als sie im Scheinwerferlicht auf regennasser Straße eine Bewegung wahrnehmen, einen furchtbaren Schlag hören – und sich ihr Leben innerhalb einer Sekunde unwiderruflich verändert. Obwohl Grace am Steuer des Wagens saß, gibt Deborah zur Aussage, sie sei es gewesen. Der Tod eines Menschen soll nicht auf den Schultern ihrer jungen Tochter lasten, schließlich war es ein schrecklicher Unfall. Doch Deborahs Lüge hat ungeahnte Folgen, denn der Tote ist ein Schullehrer von Grace – und als Deborah zum ersten Mal seinem Bruder Tom begegnet, hat sie das Gefühl, dass ausgerechnet er ihr Fels in der Brandung sein könnte. Aber wird Deborahs Lüge für immer zwischen ihnen stehen?
»Delinsky ist eine erstklassige Erzählerin: Sie erschafft glaubwürdige, sympathische Charaktere, die einem so vertraut vorkommen wie die eigenen Nachbarn.« Boston Globe
Über die Autorin:
Barbara Delinsky wurde 1945 in Boston geboren und studierte dort Psychologie und Soziologie. Nach der Geburt ihres ersten Sohnes arbeitete sie als Fotografin für den Belmont Herald, erkannte aber bald, dass sie viel lieber die Texte zu ihren Fotos schrieb. Ihr Debütroman wurde auf Anhieb zu einem großen Erfolg. Inzwischen hat Barbara Delinsky über 70 Romane veröffentlicht, die in mehr als 20 Sprachen übersetzt wurden und regelmäßig die New-York-Times-Bestsellerliste stürmen. Sie engagiert sich außerdem sehr stark für Wohltätigkeitsvereine und Aufklärung rund um das Thema Brustkrebs. Barbara Delinsky lebt mit ihrem Mann in New England und hat drei erwachsene Söhne.
Die Website der Autorin: barbaradelinsky.com/
Bei dotbooks veröffentlichte Barbara Delinsky ihre Romane:
»Die Schwestern von Star’s End«
»Jennys Geheimnis«
»Das Weingut am Meer«
»Julias Entscheidung«
»Lauras Hoffnung«
»Die alte Mühle am Fluss«
»Der alte Leuchtturm am Meer«
»Sturm am Lake Henry«, Die Blake-Schwestern 1
»Der Himmel über Lake Henry«, Die Blake-Schwestern 2
»Heimkehr nach Norwich«
»Das Leuchten der Silberweide«
»Das Licht auf den Wellen«
»Die Frauen Woodley«
»Ein Neuanfang in Casco Bay«
»Im Schatten meiner Schwester«
»Rückkehr nach Monterey«
»Drei Wünsche hast du frei«
»Ein ganzes Leben zwischen uns«
»Jedes Jahr auf Sutters Island«
»Was wir nie vergessen können«
***
eBook-Neuausgabe November 2023
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 2008 unter dem Originaltitel »The Secret between us« bei Doubleday, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 2009 unter dem Titel »Wer mit der Lüge lebt« bei Knaur.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 2007 by Barbara Delinsky
Published by Arrangement with Barbara Delinsky
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2009 bei Knaur Taschenbuch. Ein Unternehmen der Droemerschen Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. GmbH & Co. KG, München.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-98690-629-0
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Was wir nie vergessen können« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Barbara Delinsky
Was wir nie vergessen können
Roman
Aus dem Amerikanischen von Georgia Sommerfeld
dotbooks.
Für Ruby in Liebe
Kapitel 1
Sie stritten sich Sekunden vor dem Zusammenstoß.
Später würde Deborah Monroe deshalb mit sich hadern, sich fragen, ob sie, wenn sie auf die Straße konzentriert gewesen wäre, vielleicht früher etwas gesehen hätte und in der Lage gewesen wäre zu verhindern, was geschah. Ihre Tochter und sie stritten sonst nie. Sie ähnelten sich im Aussehen und im Wesen und hatten die gleichen Interessen. Deborah musste Grace nur selten ermahnen ‒ ihren Sohn Dylan, ja, aber nicht ihre Tochter. Die wusste für gewöhnlich, was erwartet wurde und warum.
Doch an diesem Abend bot das Mädchen ihr die Stirn. »Du regst dich total grundlos auf, Mom. Es ist nichts passiert!«
»Du hattest gesagt, Megans Eltern wären zu Hause«, erinnerte Deborah sie.
»Ich hab dir nur weitergegeben, was Megan mir gesagt hat.«
»Ich hätte dich nicht hingehen lassen, wenn ich gewusst hätte, was da los war.«
»Wir haben gelernt.«
»Du, Megan und Stephie ‒ das war ausgemacht«, ja, Grace hatte Schulbücher dabeigehabt ‒ sie lagen auf dem Rücksitz, »aber von Becca und Michael und Ryan und Justin und Kyle war nicht die Rede. Drei Mädchen lernen ‒ vier Mädchen und vier Jungen feiern. Ich habe euch trotz des Regenrauschens vom Wagen aus vor Lachen kreischen hören.«
Deborah konnte nicht beurteilen, ob Grace schuldbewusst dreinschaute, denn die braunen Locken ließen von dem Gesicht mit den weit auseinanderstehenden Augen und den vollen Lippen im Profil nur die Spitze der geraden Nase sehen. Aber sie hörte ihre Tochter schmatzen ‒ der Geruch des Pfefferminzkaugummis überdeckte den der nassen Kleider. Allerdings nahm Deborah sich nur Zeit für einen kurzen Blick und schaute gleich wieder geradeaus. Obwohl die Scheibenwischer ihr Bestes taten, war die Sicht gleich null.
Sicher, April bedeutete Regen, aber dieser war ungewöhnlich kräftig. Deborah machte sich Vorwürfe, dass sie Grace ans Steuer gelassen hatte, aber ihre Tochter hatte gebettelt, und Deborahs Mann ‒ Ex-Mann ‒ warf ihr oft vor, überängstlich zu sein.
Außerdem fuhren sie langsam. Das würde Deborah sich in den darauffolgenden Tagen immer wieder vorsagen ‒ und die Spurensicherung würde es bestätigen. Aber es war stockfinster und der Regen, auch wenn sie die Strecke kannten, ein unberechenbarer Faktor. Natürlich wusste Deborah, dass ihre Tochter das Autofahren nur durch Übung lernen würde, aber sie fürchtete, dass Grace heute Abend überfordert sein könnte.
Deborah hasste Regen. Grace schien er nicht zu irritieren. »Wir waren fertig mit Lernen«, verteidigte sie sich und ihre Freunde. Sie hielt das Lenkrad vorschriftsmäßig umfasst. »Es war heiß im Haus, und wir machten die Fenster auf. Ist es ein Verbrechen zu lachen? Und überhaupt war es voll peinlich, dass meine Mutter mich abholen kam …«
»Entschuldige«, fiel Deborah ihr ins Wort, »was wäre denn die Alternative gewesen? Mit deiner eingeschränkten Fahrerlaubnis darfst du nicht allein fahren. Ryan und Kyle mögen den Führerschein haben, aber es ist ihnen nicht erlaubt, ohne die Begleitung eines Erwachsenen Freunde im Auto mitzunehmen ‒ und außerdem wohnen wir am anderen Ende der Stadt. Was ist denn so schrecklich daran, an einem Wochentag um zehn Uhr abends von deiner Mutter abgeholt zu werden? Du bist gerade mal sechzehn.«
»Genau«, sagte Grace mit Nachdruck. »Ich bin fast sechzehn, Mom. In vier Monaten habe ich den richtigen Führerschein. Dann werde ich ständig selbst irgendwohin fahren ‒ weil wir nicht nur am anderen Ende der Stadt wohnen, sondern auch noch mitten im Nirgendwo, weil Dad darauf bestand, eine Zillion Quadratmeter Wald zu kaufen, um mittendrin eine Villa zu bauen, und dann entschied, dass er sie doch nicht haben wollte, und die protzige Hütte und uns verließ, um mit seiner wiedergefundenen großen Liebe von vor fünfundzwanzig Jahren in Vermont zu leben …«
»Süße …« Deborah war im Moment nicht in der Verfassung, darauf einzugehen. Grace mochte sich von ihrem Vater im Stich gelassen fühlen, aber Deborah traf der Verlust noch härter. So war es nicht geplant gewesen.
»Okay, vergiss Dad«, fuhr Grace fort, »aber sobald ich meinen Führerschein habe, werde ich allein unterwegs sein, und du wirst nicht wissen, wer alles dort ist, wo ich hinfahre, ob die Eltern zu Hause sind, ob wir lernen oder Party machen. Du wirst mir einfach vertrauen müssen.«
»Dir vertraue ich ja«, ruderte Deborah zurück, »aber den anderen nicht. Hast du mir nicht erzählt, dass Kyle letztes Wochenende einen Sixpack zu der Poolparty bei Katherine mitgebracht hat?«
»Keiner von uns hat was davon getrunken. Katherines Eltern haben ihn rausgeworfen.«
»Katherines Eltern. Genau.«
Deborah hörte ihre Tochter knurren. »Mom! Wir haben gelernt!«
Deborah wollte eben anfangen aufzuzählen, was alles passieren konnte, wenn Teenager miteinander »lernten« ‒ Dinge, die sie als Partnerin des einzigen Hausarztes am Ort von der Behandlung Dutzender Teenager kannte ‒, als sie plötzlich ein Schemen im Scheinwerferlicht wahrnahm. Dann folgten unmittelbar hintereinander ein Aufprall, eine Vollbremsung und das Quietschen von Reifen. Der Sicherheitsgurt hielt sie fest, während der Wagen schlingernd über die regennasse Fahrbahn schlitterte, sich drehte und entgegen ihrer Fahrtrichtung zum Stehen kam. All das geschah in Sekunden.
Einen Moment lang dröhnten Deborah ihre Herzschläge so laut in den Ohren, dass sie das Rauschen des Regens nicht mehr hörte. Dann drang Graces entsetzter Schrei zu ihr durch: »Was war das?«
»Bist du okay?«
»Was war das?«, wiederholte das Mädchen mit zitternder Stimme.
Auch Deborah begann zu zittern, aber ihre Tochter saß offensichtlich unverletzt neben ihr. Mit bebenden Fingern löste Deborah ihren Gurt, setzte die Kapuze ihres Regenmantels auf, öffnete die Tür und rannte los, um zu suchen, was immer sie gerammt hatten.
Das Licht der Scheinwerfer reichte nur ein paar Meter weit, dahinter herrschte undurchdringliche Dunkelheit. Also lief Deborah zurück und kramte die Taschenlampe aus dem Handschuhfach. Dann suchte sie den Straßenrand ab, entdeckte jedoch nichts, was auch nur im Entferntesten einem überfahrenen Tier ähnelte.
»War es ein Reh?«, fragte Grace plötzlich neben ihr mit angstvoller Stimme.
»Ich weiß es nicht, Süße.« Deborahs Herz schlug noch immer wie ein Hammer. »Geh zurück ins Auto. Du hast ja nicht einmal eine Jacke an.« Es war eine warme Nacht ‒ Deborah wollte nur nicht, dass Grace sähe, was sie angefahren hatten.
»Es muss ein Reh gewesen sein«, sagte Grace, »und es kann nicht schwer verletzt sein, sonst würde es ja hier irgendwo liegen. Es ist in den Wald gelaufen.«
Deborah dachte, dass das, was sie in dem Sekundenbruchteil vor dem Zusammenstoß in der Dunkelheit gesehen hatte, bedeutend größer gewesen war als ein Reh. »Hallo!«, rief sie und leuchtete mit der Stablampe ins Unterholz. »Sind Sie verletzt? Hallo? Melden Sie sich, damit ich Sie finden kann!«
»Was machst du denn da?«, fragte Grace. »Es würde doch keinem Menschen einfallen, mitten in der Nacht und bei diesem Wetter hier draußen rumzulaufen. Es muss ein Fuchs oder ein Waschbär gewesen sein ‒ oder ein Reh. Bestimmt war es ein Reh.«
»Geh zurück ins Auto«, wiederholte Deborah. Sie hatte es kaum ausgesprochen, als sie etwas hörte. Es war nicht der Wind in den Bäumen und auch nicht der Regen.
Es war ein Stöhnen. Eindeutig. Sie folgte dem Geräusch, und nach ein paar Schritten sah sie etwa anderthalb Meter vom Straßenrand entfernt einen Fuß in einem Laufschuh aus dem Unterholz ragen. Das halb unter dem tiefhängenden Ast einer Hemlocktanne verborgene Bein steckte in einer dunklen Jogginghose mit einem blauen Streifen an der Seite. Bei näherem Hinsehen sah sie, dass das zweite Bein in einem unnatürlichen Winkel abgeknickt war. Zusammengesunken lehnte ein Mann am Stamm eines Baums.
Seine Augen waren geschlossen, dunkle Haarsträhnen klebten an der Stirn. Die einzige blutende Verletzung, die Deborah entdeckte, war ein hässlicher Kratzer am Kinn. »O Gott!«, jammerte Grace.
Deborah tastete am Hals des Mannes nach dem Puls. Erst als sie ihn fand, begann ihr eigener, wieder zu schlagen. Sie beugte sich vor. »Hören Sie mich? Machen Sie die Augen auf.« Keine Reaktion.
»O Gott!«, schrie Grace hysterisch. »Weißt du, wer das ist? Mr. McKenna! Mein Geschichtslehrer!«
Deborah versuchte, schnell zu denken. Sie zog ihre am ganzen Leib zitternde Tochter auf die Straße und zum Auto. So ruhig sie konnte, sagte sie: »Ich möchte, dass du nach Hause läufst, Süße. Es ist nur eine halbe Meile, und du bist sowieso nass bis auf die Haut. Dylan ist allein und wird sich fürchten, weil wir noch nicht da sind.« Sie sah im Geist ein kleines Gesicht am Fenster der Speisekammer, angstvolle Augen, unnatürlich groß hinter der Harry-Potter-Brille mit den dicken Gläsern.
»Und was machst du?«, fragte Grace mit hoher, dünner Stimme.
»Ich rufe die Rettung an und setze mich zu Mr. McKenna, bis Hilfe kommt.«
»Ich habe ihn nicht gesehen«, jammerte Grace. »Ich schwöre, ich habe ihn nicht gesehen. Kannst du nichts für ihn tun, Mom?«
»Nicht viel.« Deborah machte den Motor aus und schaltete die Warnblinkanlage ein. »Ich wage nicht, ihn zu bewegen.«
»Wird er sterben?«
Deborah klappte ihr Handy auf. »So langsam, wie wir gefahren sind, können wir ihn nicht schwer verletzt haben.«
»Aber er ist bis zu dem Baum geschleudert worden!«
»Er muss gerollt sein.«
»Er rührt sich nicht.«
»Er kann eine Gehirnerschütterung haben oder einen Schock.« Es gab auch noch reichlich schlimmere Möglichkeiten, von denen sie die meisten unglücklicherweise kannte.
»Soll ich nicht lieber mit dir hierbleiben?«
»Du kannst auch nichts tun. Geh, Süße.« Sie legte die Hand an die Wange ihrer Tochter, hektisch darauf bedacht, ihr wenigstens das vielleicht Kommende zu ersparen. »Ich bin auch bald zu Hause.«
Graces Haare hingen in langen Strähnen herunter, Regen tropfte von ihrem kindlich weichen Kinn. Mit wie im Fieber glänzenden Augen sprudelte sie hervor: »Hast du ihn gesehen, Mom? Wer kommt auf die Idee, mitten in der Nacht und bei solchem Wetter zu joggen? Warum hat er uns nicht bemerkt? Es muss doch die Scheinwerfer gesehen haben!«
Deborah tippte mit einer Hand 9-1-1 ein und legte die andere auf Graces Arm. »Geh, Grace. Du hilfst mir am meisten, wenn du dich um Dylan kümmerst. Na los.« Die Leitstelle meldete sich schon nach dem ersten Klingeln.
Deborah kannte die Stimme. Carla McKay war eine Patientin von ihr und keine Polizistin, tat aber mehrere Nächte in der Woche Dienst dort.
»Polizei Leyland. Dieser Anruf wird aufgezeichnet.«
»Carla, hier ist Dr. Monroe.« Deborah scheuchte ihre Tochter mit der Hand weg. »Es hat einen Unfall gegeben. Ich bin auf der Umgehungsstraße, etwa eine halbe Meile östlich von meinem Haus. Wir haben einen Mann angefahren, und wir brauchen einen Ambulanzwagen.«
»Wie schwer ist der Mann verletzt?«
»Er ist bewusstlos. Das eine Bein scheint gebrochen zu sein. Um mehr sagen zu können, müsste ich ihn bewegen.«
»Ist sonst noch jemand zu Schaden gekommen?«
»Nein. Wie schnell kann die Ambulanz hier sein?«
»Ich rufe sie sofort.«
Deborah klappte ihr Handy zu. Grace hatte sich nicht gerührt. Mit den aufgerissenen Augen in dem von nassen Locken eingerahmten Gesicht sah sie sehr kindlich aus und sehr ängstlich.
Selbst voller Angst, strich Deborah ihr die Haare nach hinten und sagte ruhig, aber nachdrücklich: »Bitte geh nach Hause zu Dylan.«
»Ich bin gefahren.«
»Tu mir den Gefallen und geh nach Hause zu Dylan, ja, Süße?«
»Es war meine Schuld.«
»Grace. Können wir später darüber reden? Hier, nimm meinen Regenmantel.« Sie wollte ihn gerade ausziehen, als das Mädchen sich umdrehte und losrannte. Nach ein paar Schritten hatte die Dunkelheit sie verschluckt. Deborah setzte die Kapuze wieder auf und eilte zurück zu dem Verletzten. Dort roch es nach nasser Erde und Tannennadeln, aber sie bildete sich ein, auch Blut zu riechen. Wieder suchte sie mit den Augen nach einer Verletzung, sah jedoch keine.
Calvin McKenna war noch immer bewusstlos, sein Pulsschlag aber kräftig und regelmäßig. Sie würde ihn überwachen und den Mann im Fall des Falles durch Herzdruckmassage reanimieren. Der Winkel des gebrochenen Beins deutete daraufhin, dass die Hüfte in Mitleidenschaft gezogen war, doch das wäre zu reparieren. Eine Wirbelsäulenverletzung wäre eine andere Sache, und aus diesem Grund hütete sie sich, ihn zu bewegen. Die Rettungsassistenten würden ihn auf eine Bahre legen und seinen Kopf fixieren.
Die Warterei zerrte an ihren Nerven. Endlose zehn Minuten verbrachte sie mit Selbstvorwürfen, weil sie Grace ans Steuer gelassen hatte, der Überprüfung von Calvin McKennas Puls, dem Versuch, etwaige weitere Verletzungen zu erkennen, der Überlegung, was den Mann wohl um diese Zeit und bei diesem Wetter auf die Straße getrieben hatte, der neuerlichen Überprüfung seines Pulses, der Verwünschung der Lage ihres Hauses und der Verantwortungslosigkeit ihres Ex-Mannes, bis sie endlich die Lichter eines Streifenwagens sah. Es war keine Sirene zu hören ‒ die erübrigte sich mangels Verkehr. Mit der Stablampe winkend, lief Deborah auf die Straße und erreichte den Streifenwagen gerade, als Brian Duffy ausstieg. Er war Mitte vierzig und einer der zwölf Officers der örtlichen Polizei. Außerdem der Coach der Little League. Deborahs Sohn, Dylan, spielte seit zwei Jahren in seinem Team.
»Sind Sie okay, Dr. Monroe?« Er setzte ein plastiküberzogenes Käppi auf seinen Bürstenschnitt und knöpfte seine Regenjacke zu.
»Mir geht es gut ‒ aber wir haben Calvin McKenna angefahren. Kommen Sie.« Deborah ging voraus. »Ich weiß nicht, wie schwer er verletzt ist«, sagte sie, als sie sich jenseits der Farne hinkniete und wieder den Puls fühlte. Unverändert kräftig und regelmäßig. Sie leuchtete in das Gesicht des Mannes. Der Officer kam mit seiner Taschenlampe dazu.
»Cal?«, rief sie. »Cal? Hören Sie mich?«
»Was machte er denn hier draußen?«, fragte Duffy. Deborah setzte sich auf ihre Fersen. »Ich habe keine Ahnung. Angezogen ist er wie zum Joggen.«
»Um diese Uhrzeit und in diesem Regen? Seltsam.«
»Und dann noch so weit draußen. Wissen Sie, wo er wohnt?« Ganz sicher nicht in der Nähe. Im Umkreis von einer Meile gab es nur vier Häuser, und Deborah kannte die Leute, die dort wohnten.
»Die McKennas haben ein Haus drüben beim Bahnhof«, berichtete Brian. »Ist Calvin ein Patient von Ihnen?«
»Nein. Grace hat ihn dieses Jahr in Geschichte. Er ist ein strenger Lehrer und ein sehr ernster Mensch. Das ist alles, was ich über ihn weiß.« Als sie gerade wieder nach dem Puls tastete, wurde die Straße lebendig. Ein zweiter Streifenwagen traf ein, blaue und weiße Lichtblitze zuckten durch die Dunkelheit. Dichtauf folgte ein Ambulanzwagen.
Die Rettungsassistenten kannte Deborah nicht ‒ sie waren jung, wahrscheinlich neu ‒, aber sie kannte den Mann, der aus dem zweiten Streifenwagen stieg. John Colby war der Polizeichef. Mit Ende fünfzig wäre er anderswo in Rente geschickt worden, aber er war in Leyland aufgewachsen, und so verstand es sich, dass er arbeiten würde, solange seine Gesundheit es erlaubte. Deborah schätzte, dass das noch eine ganze Weile der Fall wäre. Seine Frau plagten Allergien ‒ Nüsse, Pollen, Hausstaub ‒, die zu chronischem Asthma geführt hatten, aber Johns einziges Problem außer seinem Schmerbauch war seine Schlaflosigkeit. Er arbeitete Tag und Nacht, behauptete, körperlich aktiv zu sein, halte seinen Blutdruck unten, und da der gleichbleibend niedrig war, konnte Deborah nichts dagegen sagen.
Während John einen Halogenscheinwerfer hielt, fixierten die Rettungsassistenten den Verletzten. Deborah wartete, die Arme verschränkt, die Hände in die Ärmel geschoben, auf ein Lebenszeichen. Nichts.
Sie folgte den Männern zum Ambulanzwagen und schaute gerade zu, wie sie die Bahre hineinschoben, als Brian sie beim Arm nahm. »Setzen wir uns in mein Auto ‒ hier draußen ist es zu nass.«
Im Wagen streifte sie die Kapuze ab, öffnete den Regenmantel und wischte sich mit den Händen das Wasser vom Gesicht. Ihre kurzen Haare, jetzt feucht und lockig, fühlten sich noch immer fremd an, nachdem sie sie immer taillenlang und zum Nackenknoten aufgesteckt getragen hatte. Ihr ärmelloses Top und die Shorts unter der Jacke waren relativ trocken, die Füße in den Flipflops nass und schmutzig.
Sie hasste Regen. Er kam zu den unmöglichsten Zeiten, immer, wenn man nicht damit rechnete, und brachte das Leben durcheinander.
Brian setzte sich hinters Steuer und schüttelte sein Käppi draußen aus, bevor er die Tür zumachte. Dann nahm er Block und Kugelschreiber aus der Ablage zwischen den Sitzen. »Ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen. Reine Formsache, Doktor.« Er schaute auf seine Uhr. »Zweiundzwanzig Uhr dreiundvierzig. Ihr Vorname schreibt sich D-E-B-O-R-A-H?«
»Ja. Und der Nachname ist Monroe. M-O-N-R-O-E.« Sie wurde noch heute oft irrtümlich mit Barr angesprochen, ihrem Mädchennamen und dem Namen ihres Vaters, der so etwas wie eine Legende in der Stadt war. Dabei führte sie ihren Ehenamen bereits seit ihrem letzten Collegejahr.
»Was ist passiert?«, fragte der Officer.
»Wir fuhren …«
»Wir?«, hakte Duffy ein. »Ich dachte, Sie waren allein unterwegs.«
»Grace war dabei. Sie ist jetzt bei ihrem Bruder zu Hause. Ich hatte sie bei ihrer Freundin Megan abgeholt ‒ Megan Stearn ‒, und wir waren auf dem Heimweg. Wir fuhren langsam, höchsten fünfundzwanzig Stundenmeilen, weil es so stark regnete. Und plötzlich war er da.«
»Er lief am Straßenrand?«
»Ich sah ihn nicht laufen. Er war plötzlich da, wie aus dem Nichts, und dann war da dieser schreckliche, dumpfe Aufprall.«
»Fuhren Sie dicht am Fahrbahnrand?«
»Nein. Wir fuhren nahe der Mitte ‒ die Markierung war die einzige Orientierung bei diesen Sichtverhältnissen.«
»Haben Sie gebremst?«
Deborah hatte nicht gebremst ‒ Grace hatte gebremst. Jetzt war der Augenblick gekommen, das klarzustellen. Aber es schien irrelevant, ein rein technisches Detail.
»Zu spät«, antwortete sie. »Wir gerieten ins Schleudern und drehten uns. Sie sehen ja, wie der Wagen steht.«
»Aber wenn Sie Grace nach Hause gefahren haben …«
»Ich habe sie nicht gefahren ‒ ich habe sie zu Fuß laufen lassen. Es ist nur eine halbe Meile, und sie ist im Leichtathletikteam.« Deborah zerrte das Handy aus ihrer Tasche. »Sie wird wissen wollen, was hier geschieht. Ist das okay?« Als Brian nickte, drückte sie die Expresswahltaste.
Es hatte noch nicht zu Ende geklingelt, als Grace sich meldete. »Mom?«
»Bist du okay?«
»Ja. Wie geht’s Mr. McKenna?«
»Er ist auf dem Weg ins Krankenhaus.«
»Ist er zu sich gekommen?«
»Nein. Geht’s Dylan gut?«
»Er liegt auf dem Sofa und schläft wie ein Stein. Hat sich noch nicht gerührt, seit ich hier bin.«
So viel zu ängstlichem Warten am Fenster, dachte Deborah und hörte im Geist das gereizte Du machst dir immer zu viele Sorgen ihres Ex-Mannes. Aber wie sollte sie sich keine Sorgen um einen Zehnjährigen mit starker Weitsichtigkeit und einer besonderen Form der Hornhauttrübung machen, der das meiste wie durch einen Nebel sah? Auch das war nicht so von Deborah geplant worden.
»Ich bin trotzdem froh, dass er nicht mehr allein ist«, sagte sie. »Hör zu, Grace ‒ ich rede jetzt mit dem Officer, und dann schaue ich vielleicht noch im Krankenhaus vorbei. Geh lieber schon ins Bett ‒ du schreibst morgen doch diese Arbeit.«
»Morgen fehle ich.«
»Grace.«
»Auf jeden Fall. Ich habe im Moment keinen Kopf für Biologie. Es war ein absoluter Alptraum, Mom. Wenn das Autofahren bedeutet, dann lasse ich es. Ich frage mich immer wieder, wo er plötzlich herkam. Hast du ihn gesehen?«
»Nein. Schatz, der Officer wartet.«
»Meid dich.«
»Ja.« Deborah klappte das Handy zu.
Die Fondtür des Streifenwagens öffnete sich, und John Colby stieg ein. »Man kann sich nur wundern, wo all das Wasser herkommt«, sagte er. »Ich habe alles fotografiert, so gut es ging. Wenn es weiter so gießt, gibt es für die Staatspolizei nichts mehr zu sehen.«
»Die Staatspolizei?«, fragte Deborah erschrocken.
»Ich habe sie angefordert. Die haben ein Accident Reconstruction Team, das den Unfallhergang rekonstruiert. Die sehen mehr als wir«, erklärte John.
»Und wonach suchen die?«
»Nach Spuren. Aufprallspuren, Spuren am Wagen und auf der Straße, wo das Auto das Opfer erfasste, wo das Opfer landete. Schleuderspuren, Abrieb von den Reifen auf der Fahrbahn.«
Es war doch nur ein Unfall, wollte sie sagen. Ein Team der Staatspolizei auf den Plan zu rufen machte irgendwie mehr daraus.
Ihre Bestürzung war ihr offenbar anzusehen, denn Brian sagte: »Das ist reine Routine, wenn jemand verletzt wurde. Bei Tag und Sonnenschein hätten wir den Hergang vielleicht selbst rekonstruiert, aber bei diesem Wetter muss es zack, zack gehen, und die Jungs beherrschen das.« Er schaute auf seine Notizen. »Was sagten Sie, wie schnell Sie fuhren?«
Wieder eine Gelegenheit für Deborah zu sagen, Oh, ich bin nicht gefahren ‒ Grace saß am Steuer; und sie fuhr sehr langsam. Aber das fühlte sich an, als wolle sie sich herauswinden ‒ die Schuld abwälzen und außerdem war Grace ihre Erstgeborene, ihr Alter Ego, und litt schon genug unter der Scheidung. Sie brauchte wirklich nicht noch ein Problem. Außerdem würde es an Mr. McKennas Zustand nichts ändern, wenn sie den Sachverhalt jetzt richtigstellte. Und es lag keine Gesetzesübertretung vor.
»Hier sind fünfundvierzig Stundenmeilen erlaubt, aber wir fuhren bestimmt nicht schneller als dreißig.«
»Gab es in letzter Zeit irgendwelche technischen Probleme mit dem Auto?«
»Nein.«
»Die Bremsen funktionieren?«
»Einwandfrei.«
»War das Fernlicht eingeschaltet?«
Deborah runzelte die Stirn. Sie erinnerte sich, Grace daran erinnert zu haben, aber Fernlicht oder Abblendlicht ‒ bei solchem Regen reichten beide nicht weit.
»Der Hebel stand auf Fernlicht«, bestätigte John vom Rücksitz. »Alle Lichter funktionieren.« Er setzte seine Mütze auf. »Ich werde die Straße absperren. Das fehlte noch, dass einer vorbeifährt und die Spuren vernichtet.« Deborah wusste natürlich, dass er den Unfallort meinte, aber angesichts des erwarteten Teams der Staatspolizei machte ihr Kopf Tatort daraus. Das Thema Fahrer bereitete ihr Gewissensnöte, aber sie hatte keine Zeit, sich damit zu befassen, denn die Fragen gingen weiter. Wann war sie zu Hause losgefahren, um Grace abzuholen? Wann waren sie und Grace bei Megan weggefahren? Wie viel Zeit war zwischen dem Unfall und Deborahs Meldung vergangen? Was hatte sie während dieser Zeit getan? War Calvin McKenna irgendwann zu sich gekommen? Deborah war klar, dass all das zu den Ermittlungen gehörte, aber sie wäre lieber im Krankenhaus gewesen ‒ oder zu Hause bei ihren Kindern.
Sie schaute auf die Uhr. Es war schon nach elf. Wenn Dylan aufwachte, wäre er bestimmt erschrocken, weil sie noch nicht da war. Seit der Scheidung war er sehr anhänglich, und Grace wäre keine große Hilfe. Sie würde nach Deborah Ausschau halten ‒ nicht in der Speisekammer, die sah sie als Dylans Terrain an, sondern vom Fenstersitz im Wohnzimmer aus, das sie momentan kaum benutzten. Es wurde von Geistern bevölkert, gerahmten Familienfotos aus einer glücklichen Zeit, arrogante Zeugnisse von Perfektion. Grace würde sich grässlich fühlen dort.
Näher kommende Scheinwerfer kündigten das Team der Staatspolizei an. Als Brian ausstieg, klappte Deborah ihr Handy auf und tippte die Nummer der Notaufnahme ein. Sie hatte schon oft Patienten dorthin begleitet und kannte die Nachtschwestern. Unglücklicherweise konnte die Diensthabende ihr nicht mehr sagen, als dass die Ambulanz gerade angekommen war.
Deborah rief zu Hause an. Wieder meldete sich Grace sofort. »Wo bist du?«
»Immer noch hier. Ich sitze im Streifenwagen, während die Ermittler draußen den Unfall rekonstruieren«, sagte sie gewollt leichthin. »Das ist reine Routine. Was ist mit Dylan?«
»Der schläft. Wie geht’s Mr. McKenna?«
»Er ist gerade erst in der Notaufnahme angekommen. Jetzt werden sie ihn untersuchen. Hast du mit Megan oder einem der anderen gesprochen?« Vielleicht hatte jemand von ihnen gesehen, dass Grace auf der Fahrerseite eingestiegen war ‒ dann müsste sie, Deborah, das jetzt mit der Polizei klären.
»Stephie hat angerufen, aber ich bin nicht drangegangen.« Graces Stimme zitterte. »Was, wenn er stirbt, Mom?«
»Er wird nicht sterben. So schlimm war der Zusammenstoß nicht. Es ist spät, Grace. Du solltest ins Bett gehen.«
»Wann kommst du?«
»Kann ich nicht sagen, aber ich hoffe, bald.«
Deborah klappte das Handy zu, steckte es in die Tasche und ging wieder in den Regen hinaus, hielt mit einer tropfnassen Hand die Kapuze fest ums Gesicht.
Das gelbe Absperrband leuchtete grell im Scheinwerferlicht. Zwei Männer mit Latexhandschuhen suchten die Fahrbahn ab, hoben hin und wieder etwas auf und tüteten das Gefundene ein. Ein Fotograf machte Aufnahmen von Deborahs Auto, sowohl von seiner Position auf der Straße wie auch von der Delle vorn rechts. Sie war kaum nennenswert. Auffälliger war der zerbrochene Scheinwerfer.
»Oje«, sagte Deborah, als sie ihn bemerkte.
John trat zu ihr, bückte sich und inspizierte das verbliebene Glas. »Scheint der einzige Schaden zu sein.« Er richtete sich auf und wandte sich ihr zu. »Ich brauche den Fahrzeugschein.«
Sie stellte den Sitz auf ihre Größe ein, setzte sich hinters Steuer, holte die Papiere aus dem Handschuhfach und reichte sie dem Officer, der die Angaben sorgfältig übertrug. Nachdem sie den Schein wieder zurückgelegt hatte, stieg sie aus und zog ihre verrutschte Kapuze nach vorn.
»An den Schaden am Wagen dachte ich gar nicht«, sagte sie. »Ich wollte nur wissen, was wir angefahren hatten. Wir nahmen an, es wäre ein Tier gewesen.« Sie schaute regentropfenwegblinzelnd zu ihm auf. »Ich würde gern ins Krankenhaus fahren, John. Wie lange werden die Männer denn brauchen?«
»Sicher noch eine ganze Weile«, antwortete er, »auch wenn sie schnell machen müssen, weil der Regen sonst alles wegspült. Aber Ihren Wagen können Sie sowieso nicht nehmen ‒ den müssen wir abschleppen.«
»Abschleppen? Aber er fährt doch.«
»Unser Mechaniker muss ihn sich ansehen, um auszuschließen, dass ein technischer Defekt vorliegt. Bremse, Scheibenwischer, Reifenprofil ‒ all das könnte zu dem Unfall geführt haben, wenn da was nicht stimmt.« Er legte ihr die Hand auf die Schulter. »Keine Sorge ‒ wir bringen Sie nach Hause. Dort haben Sie ja noch ein Auto, stimmt’s?«
Ja, das hatte sie. Gregs BMW, mit dem er in die Firma gefahren war, den er auf dem »Chefparkplatz« abgestellt und regelmäßig hatte einwachsen lassen. Er hatte den Wagen geliebt, doch auch ihn zurückgelassen. Als er nach Vermont aufbrach, hatte er in dem alten VW-Käfer gesessen, der all die Jahre unter einer Plane in der Garage gestanden hatte.
Deborah mochte den BMW nicht. Greg hatte ihn sich auf dem Gipfel seines Erfolgs gekauft. Rückblickend war das der Anfang vom Ende gewesen.
Sie verschränkte die Arme und sah den Männern bei ihrer Arbeit zu. Sie suchten jeden Quadratzentimeter der Straße, der Bankette und der Umgebung der Stelle ab, wo Calvin McKenna gelandet war. Deborah fühlte sich nutzlos und fragte sich mehr als einmal, warum sie hier herumstand, anstatt sich im Krankenhaus nützlich zu machen.
Die Antwort war einfach: Sie war nur eine praktische Ärztin und keine Traumaspezialistin ‒ und es war ihr Wagen, der Mr. McKenna Schaden zugefügt hatte.
Dieses Bewusstsein wurde von Minute zu Minute erdrückender. Sie, Deborah, war verantwortlich ‒ für den Wagen, für Grace, für den Unfall, für Calvin McKenna. Wenn sie nichts für den Verletzten tun konnte, dann wollte sie wenigstens bei ihren Kindern sein.
Grace kauerte im Dunkeln. Jedes Mal, wenn das Telefon klingelte, schrak sie hoch und checkte das Display. Wenn ihre Mutter anrief, meldete sie sich, ansonsten konnte sie mit niemandem reden. Megan hatte es schon zweimal versucht, Stephie ebenfalls. Und jetzt simsten sie ihr.
Wo bist du? Melde dich!
Bist du da? Hallo?
Als Grace nicht reagierte, wurde das Thema gewechselt. Hat deine Mom das Bier gerochen?
Hast du Ärger bekommen? Es war doch nur eins.
Aber Grace hatte nicht nur ein Bier getrunken. Es waren zwei gewesen, wenn auch im Abstand von drei Stunden, und sie hatte nichts gemerkt und hätte es beim Blasen wahrscheinlich nicht einmal auf 0,1 Promille gebracht ‒ aber sie hätte nicht fahren dürfen.
Sie fragte sich, warum sie es getan hatte. Und sie fragte sich, warum ihre Freunde ‒ ihre angeblichen, nicht erwiesenen Freunde ‒ das Bier in einer SMS erwähnten. Wussten sie denn nicht, dass alles überprüft werden konnte?
Bist du okay?
Willst du nicht reden?
Nein, sie wollte nicht reden. Ihre Mutter war noch da draußen bei der Polizei, und Mr. McKenna war im Krankenhaus, und es war alles ihre Schuld, und nichts, was ihre Freunde sagen würden, könnte etwas daran ändern.
Kapitel 2
Es verging noch eine ganze Stunde, bis das Team der Staatspolizei die Scheinwerfer abbaute, und dann noch eine Weile, bis ein Abschleppwagen kam. Deborah kannte den Fahrer. Er arbeitete bei der Tankstelle in der Stadtmitte und war Stammkunde im Geschäft ihrer Schwester. Das bedeutete, dass Jill schon bald, nachdem sie ihren Laden um sechs geöffnet hätte, von dem Unfall erfahren würde.
Brian fuhr Deborah heim. Mit einem Arm ihre Arzttasche und Graces Schulbücher an die Brust drückend, lief sie zu der an das Natursteinhaus angebauten schindelgedeckten Garage und gab mit der freien Hand den Code für das Tor ein. Während es sich rumpelnd aufwärtsbewegte, rief Deborah im Krankenhaus an. »Joyce? Hier ist noch mal Dr. Monroe. Gibt’s was Neues von Calvin McKenna?«
»Einen Moment, Dr. Monroe ‒ ich frage nach.«
Deborah legte ihre Last ab und hängte ihren Regenmantel an einen Haken neben dem Platz, auf dem ihr Wagen normalerweise stand. Sie ließ die Flipflops an der Schwelle stehen und lief durch die Küche in die Waschküche.
»Dr. Monroe? Sein Zustand ist stabil. Sie machen im Moment noch Tests, aber der Neurologe sieht keine Anzeichen für eine Rückgratverletzung oder Lähmung. Die Hüfte ist gebrochen und wird nach dem letzten Scan gleich operiert.«
Deborah schnappte sich ein Handtuch. »Ist er bei Bewusstsein?« In der Küche trocknete sie sich, das Handy zwischen Schulter und Kinn geklemmt, die Arme ab.
»Ja ‒ aber er spricht nicht.«
»Er kann nicht sprechen?«
»Sie vermuten, dass er kann, aber nicht will.«
Deborah fuhr sich mit dem Handtuch übers Gesicht. Erst jetzt entdeckte sie Grace. »Vielleicht traumatisch bedingt. Danke, Joyce. Tun Sie mir den Gefallen und lassen es mich wissen, wenn sich etwas ändert?«
Grace kaute an ihrem Daumennagel. Deborah zog ihr die Hand vom Mund und nahm ihre Tochter in den Arm. »Wo warst du?«, fragte das Mädchen mit kleiner Stimme.
»Am Unfallort.«
»Die ganze Zeit?«
»Mm.«
»Warum hat die Polizei dich nach Hause gebracht?«
»Weil ich mit meinem Wagen erst wieder fahren darf, wenn er untersucht worden ist.«
»Was hast du denn da draußen gemacht?«
»Fragen beantwortet.«
»Was hast du ihnen gesagt?«
»Dass wir auf dem Heimweg waren und wegen des Regens langsam fuhren und dass Mr. McKenna plötzlich wie aus dem Nichts auftauchte. Morgen gebe ich meine Aussage auf dem Revier zu Protokoll, und dann hole ich den Wagen. Wo ist Dylan?«
»Irgendwann ins Bett gegangen. Hat mich gar nicht nach dir gefragt. Offenbar dachte er, du wärest hier. Was erzählen wir ihm, Mom? Er wird doch merken, dass etwas nicht stimmt, wenn er sieht, dass dein Auto nicht da ist.« Sie schüttelte den Kopf. »Dass ich ausgerechnet meinen Geschichtslehrer anfahren musste! Ich bin so schlecht in amerikanischer Geschichte, dass alle denken werden, es war Absicht! Was soll ich meinen Freunden sagen?«
»Du bist nicht schlecht in amerikanischer Geschichte.«
»Ich sollte nicht im Fortgeschrittenenkurs sein. Ich habe keine Chance, die Prüfung im Juni zu schaffen. Ich bin grottenschlecht.«
Das war Deborah neu. »Du sagst ihnen, dass wir langsam fuhren, aber Mr. McKenna bei dem Regen nicht sahen.«
»Du sagst ständig wir.«
Ja. Das war Deborah bewusst. »Ich war die Person mit einem regulären Führerschein. Ich trug die Verantwortung.«
»Aber ich fuhr.«
»Ich war für dich verantwortlich.«
»Wenn du gefahren wärest, wäre nichts passiert.«
»Das stimmt nicht, Grace. Ich habe Mr. McKenna auch nicht gesehen, und ich habe so aufmerksam auf die Straße geschaut, als ob ich am Steuer sitzen würde.«
»Du hast nicht am Steuer gesessen.«
Nach kurzem Zögern sagte Deborah: »Die Polizei nimmt das aber an.«
»Du hast gelogen?«
»Nein …« Deborah suchte nach den richtigen Worten. »Sie haben es als selbstverständlich vorausgesetzt. Ich habe es nur nicht korrigiert.«
»Mom.«
»Du bist minderjährig, Grace«, argumentierte Deborah, »du hast nur eine eingeschränkte Fahrerlaubnis, was bedeutet, dass ich als Führerscheinbesitzer verantwortlich für dich war. Ich fahre seit zweiundzwanzig Jahren unfallfrei ‒ allzu schlimm kann es nicht werden.« Als Grace protestieren wollte, legte Deborah ihr die Hand auf den Mund. »Es ist richtig so, Süße, glaub mir. Wir haben gegen kein Gesetz verstoßen, uns keiner Nachlässigkeit schuldig gemacht. Wir können nichts für das Wetter und auch nicht für das, was andere Menschen tun.«
»Und wenn er stirbt?«
»Wird er nicht.«
»Aber wenn doch ‒ dann ist es Mord!«
»Nein«, widersprach Deborah heftig, obwohl das Wort Mord sie frösteln ließ. »Dann wäre es ein ›Unfall mit Todesfolge‹. Aber da wir nichts falsch gemacht haben, wird es keine Anklage geben.«
»Hat Onkel Hai das gesagt?«
Hai Trutter war der Ehemann von Deborahs Freundin Karen und kein echter Onkel, aber die beiden kannten die Monroe-Kinder seit ihrer Geburt. Ihre Tochter, Danielle, war ein Jahr älter als Grace.
Deborah traf sich oft mit Karen. Neuerdings fühlte sie sich in Hals Gegenwart ein wenig unbehaglich, aber das war eine ganz andere Geschichte.
»Ich habe noch nicht mit ihm gesprochen«, antwortete Deborah, »aber ich weiß, dass er es bestätigen würde. Außerdem wird Mr. McKenna nicht sterben.«
»Und wenn er für immer verkrüppelt ist?«
»Hör auf, dich da hineinzusteigern, Grace«, warnte Deborah, obwohl sie die gleichen Befürchtungen hegte. Nur war sie die Mutter ‒ sie durfte nicht in Panik geraten.
»Ich habe sein Bein gesehen«, jammerte das Mädchen. »Es stand weg, als wäre er vom Dach eines Hochhauses gestürzt.«
»Er ist aber nicht vom Dach eines Hochhauses gestürzt.
Er lebt ‒ das hat mir die Schwester gesagt und gebrochene Knochen kann man reparieren.«
Grace verzog das Gesicht. »Es war grauenvoll. Ich werde dieses Geräusch nie vergessen.«
Das würde Deborah ebenfalls nicht. Sie hörte den dumpfen Aufprall noch jetzt, Stunden nach dem Unfall. Haltsuchend umfasste sie Graces Schulter. »Ich brauche eine heiße Dusche, Süße. Ich bin durchgefroren und schmutzig.« Sie legte den Arm um ihre Tochter und ging mit ihr die Treppe hinauf. Außer den drei Kinderzimmern ‒ das dritte war für das Kind gedacht gewesen, das Deborah und Greg vielleicht noch bekommen hätten ‒, gab es im ersten Stock noch ein Wohnzimmer mit eingebauten Schreibtischen, einer gemütlichen Sitzgruppe und einem Flachbildfernseher. Nachdem Greg gegangen war, hatte Deborah sich in dem dritten Kinderzimmer eingerichtet.
Als sie bei Graces Tür anlangten, kaute das Mädchen wieder am Daumennagel. Wieder zog Deborah die Hand ihrer Tochter weg und schaute Grace lange schweigend an. »Alles wird gut«, flüsterte sie schließlich und ließ sie los.
Das Simsen hatte aufgehört, bevor ihre Mutter nach Hause gekommen war, und Grace war dankbar dafür. Was sollte sie Megan sagen? Oder Stephie? Oder Becca? Meine Mom nimmt die Schuld für etwas auf sich, was ich getan habe? Mein Mom lügt, damit ich nicht verhaftet werde? Meine Mom muss vielleicht ins Gefängnis, wenn Mr. McKenna stirbt?
Grace hatte gedacht, die Scheidung wäre schlimm. Das hier war schlimmer.
Deborah hatte gehofft, dass die Dusche sie beruhigen würde, aber durchgewärmt, sauber und endlich trocken, konnte sie wieder klar denken, und ihr klarer Verstand ließ sie die Ungeheuerlichkeit des Geschehenen erkennen. Und der Regen machte es nicht besser. Er prasselte aufs Dach, wie er aufs Auto geprasselt hatte, und sie erinnerte sich an eine andere Nacht, an die, in der ihre Mutter gestorben war. Damals hatte es auch gegossen.
Sie schlich sich in Dylans Zimmer und ging vor dem Bett in die Hocke. Im Schein der Flurbeleuchtung sah sie die dunklen Wimpern wie Schmetterlingsflügel auf den noch kindlich glatten Wangen liegen. Er war ein liebes Kind mit mehr als den üblichen Problemen, und wenn sie auch wusste, dass seine Weitsichtigkeit korrigiert und die Hornhauttrübung behandelt werden konnten, tat ihr doch das Herz weh.
Sie wollte ihn nicht wecken, konnte aber nicht gehen, ohne ihn berührt zu haben, und so strich sie ihm zart über die rotblonden Haare. Dann ging sie in ihr Zimmer, schlüpfte ins Bett und zog die Decke bis ans Kinn. Sie hatte sich gerade erst zurechtgekuschelt, als die Tür aufging und Dylan hereinkam, an den Füßen die unvermeidlichen Socken, die er zum Schlafen trug. Es war das letzte Paar, das seine Großmutter, Ruth Barr, vor ihrem Tod gestrickt hatte, anfangs zu groß für ihn und inzwischen so fadenscheinig, dass jede weitere Wäsche das Aus bedeuten könnte. Er ließ nicht zu, dass Deborah die Socken wegwarf, sagte, dass sie seine Nana Ruth am Leben hielten. In dem Augenblick hätte Deborah ihre Mutter auch gebraucht.
»Ich wollte wach bleiben, bis du kommst«, murmelte er. Deborah wartete, bis er seine Brille auf den Nachttisch gelegt hatte, und nahm ihren Sohn dann zu sich unter die Decke. Im nächsten Moment war er eingeschlafen. Eine Minute später erschien Grace, kroch auf der anderen Seite ins Bett. Es war eng, aber besser, als allein wach zu liegen. Deborah griff nach der Hand ihrer Tochter.
»Ich werde die ganze Nacht nicht schlafen können«, flüsterte Grace.
Deborah drehte ihr im Dunkeln das Gesicht zu. »Wir können die Uhr nicht zurückdrehen. Was geschehen ist, ist geschehen. Wir wissen, dass Mr. McKenna in guten Händen ist und man uns anruft, wenn es etwas Neues gibt. Richtig?«
Grace stieß einen Laut aus, der Zweifel verriet, sagte jedoch nichts mehr. Nach einer Weile wurden ihre Atemzüge tiefer, doch sie schlief unruhig. Das wusste Deborah, denn sie lag wirklich wach, und es war nicht das Trommeln des Regens über ihrem Kopf, das sie am Einschlafen hinderte. Es war der plötzlich aus der Dunkelheit auftauchende Schatten, der durch ihren Kopf geisterte, und der Zusammenstoß, den sie wieder und wieder spürte.
Doch zwischen ihren Kindern eingekeilt, wusste sie, dass sie nicht in Panik verfallen durfte. Nach dem Scheitern ihrer Ehe hatte sie sich etwas geschworen: Keine weitere Beschädigung der Kinder. Keine … weitere … Beschädigung.
Als das Klingeln Deborah weckte, erschrak sie im ersten Moment, weil sie sich nicht bewegen konnte. Dann erinnerte sie sich, und ihr Magen zog sich zusammen.
Voller Angst, dass Mr. McKennas Zustand sich verschlechtert hatte, setzte sie sich auf und griff über Dylan hinweg nach dem Telefon. »Hallo?«
»Ich bin’s«, sagte ihre Schwester. »Ich dachte mir, dein Wecker müsste bald läuten. Mack Tully war gerade hier. Er sagte, du hättest letzte Nacht etwas angefahren.«
»Oh, Jill.« Deborah atmete auf. Sie und ihre Schwester standen einander sehr nahe, obwohl sie grundverschieden waren. Jill war vierunddreißig, vier Jahre jünger als Deborah, nicht brünett, sondern blond, mit eins fünfundfünfzig zehn Zentimeter kleiner und der Wildfang der Familie. Trotz zweier Langzeitbeziehungen hatte sie nicht geheiratet, und während Deborah dem Vater in die Medizin gefolgt war, verweigerte Jill jegliches Studium. Nach einem Jahr Bäckerlehre in New Jersey und einem zweiten in New York und vier Jahren als Süßspeisenköchin an der Westküste war sie nach Leyland zurückgekommen und hatte eine Bäckerei eröffnet. In den zehn Jahren seit ihrer Rückkehr waren drei Filialen dazugekommen ‒ zum Kummer ihres Vaters. Michael hoffte noch immer, dass sie irgendwann aufwachen, studieren und endlich etwas aus ihrem Leben machen würde.
Deborah hatte ihre kleine Schwester immer geliebt, und seit dem Tod der Mutter vor drei Jahren noch mehr. Jill war Ruth. Sie lebte einfach, aber bewusst und verströmte wie ihre Bäckerei eine wohlige Wärme. Allein ihre Stimme zu hören war tröstlich. Mit Ruth zu telefonieren hatte den Geruch ofenwarmen Brotes heraufbeschworen. Mit Jill zu telefonieren beschwor den Geruch zuckergussklebriger Krapfen mit Pekannussgarnitur herauf.
Das Bild milderte die Furcht. »Es war ein Alptraum, Jill«, sagte sie leise, um die Kinder nicht zu wecken. »Ich hatte Grace abgeholt, und es war stockfinster und goss in Strömen. Wir fuhren sehr langsam. Und plötzlich war er da ‒ aus dem Nichts.«
»War er betrunken?«
»Ich glaube nicht. Es war nichts zu riechen ‒ und fragen konnte ich ihn nicht.«
»Graces Geschichtslehrer, ja? Ist er schwer verletzt?«
»Er wurde letzte Nacht noch operiert. Wahrscheinlich haben sie seine Hüfte genagelt.«
»Marty Stevens sagt, der Typ wäre merkwürdig ‒ ein Einzelgänger, nicht wirklich freundlich.«
»Ernst ist das richtige Wort, denke ich. Er lächelt nie. Hat Marty sonst noch was gesagt?«
»Nein ‒ aber Shelley Wyeth. Sie wohnt in der Nähe der McKennas, und sie sagt, die Frau wäre auch merkwürdig. Sie haben keinen Kontakt mit den Nachbarn.« Nach einer kleinen Pause setzte sie hinzu: »Wow. Du hast tatsächlich jemanden überfahren. Ich hätte nicht gedacht, dass du dazu fähig wärest.«
Deborah verstand nicht gleich. »Entschuldige?«
»Hattest du schon mal einen Unfall?«
»Nein.«
»Dann wurde es Zeit.«
»Jill!«
»Es macht dich menschlich. Jetzt liebe ich dich noch mehr.«
»Jill!«, protestierte Deborah, aber Dylan war aufgewacht und griff nach seiner Brille. »Mein Sohn braucht eine Erklärung. Ich komme vor der Praxis zu dir, sobald ich die Kids abgesetzt habe.«
»Du fährst doch nicht mit dem BMW, oder?« Jill teilte Deborahs Abneigung gegen das Auto, wenn auch mehr wegen der Betriebskosten als wegen der Erinnerungen an eine gescheiterte Ehe.
»Es bleibt mir nichts anderes übrig.«
»Oh, doch. Ich bin um halb acht bei euch. Ich beneide dich nicht darum, dass du Dad von dem Unfall erzählen musst. Er wird nicht erfreut sein. Du weißt, er legt Wert auf einen makellosen Ruf.«
Daran brauchte Deborah niemand zu erinnern. Ihr graute vor dem Gespräch. »Ich finde einen makellosen Ruf auch schön, aber manchmal läuft es eben anders. Mein Wagen war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich muss hier weitermachen, Jill. Dann bis um halb acht. Danke.« Sie legte auf und schaute auf Dylan hinunter. Er war verschlossener als seine Schwester in seinem Alter ‒ und er war empfindsamer, weswegen ihn sowohl die Scheidung als auch seine Augenprobleme besonders belasteten.
»Du hast einen angefahren?«, fragte er mit aufgerissenen Augen.
»Ja, auf der Umgehungsstraße. Es war stockdunkel und goss in Strömen.«
Die Augen wurden noch größer. »War er über die ganze Fahrbahn verteilt?« Der Junge blinzelte heftig.
»Idiot«, murmelte Grace hinter Deborah.
»Er war nirgendwo verteilt«, antwortete Deborah in tadelndem Ton. »Wir fuhren ja ganz langsam.«
Dylan nahm die Brille ab und rieb sich die Augen. »Hast du schon mal einen angefahren?«
»Nein.«
»Und Dad?«
»Nicht, dass ich wüsste.«
»Ich ruf ihn an ‒ das muss ich ihm erzählen.«
»Bitte nicht jetzt«, bat Deborah, denn Greg würde darauf bestehen, mit ihr zu sprechen, und sie mit Fragen bombardieren. Sie schaute auf den Wecker. »Er schläft um diese Zeit noch, und du musst dich fertigmachen. Tante Jill holt uns ab.«
Dylan setzte die Brille wieder auf. »Warum?«
»Weil mein Wagen bei der Polizei ist.«
»Warum?«
»Sie wollen sich vergewissern, dass alles in Ordnung ist.«
»Sind Blutspuren dran?«
»Nein. Steh auf, Dylan.« Deborah gab ihm einen sanften Schubs.
Auf halbem Weg durchs Zimmer drehte er sich um. »Wen hast du angefahren?«
»Niemanden, den du kennst.« Deborah zeigte befehlend auf die Tür.
Er war kaum draußen, als Grace ihr von hinten ins Ohr flüsterte: »Aber ich kenne ihn ‒ und all meine Freunde kennen ihn. Und wenn Dylan es Dad erzählt, wird er denken, dass wir ohne ihn nicht zurechtkommen. Nicht, dass es ihn kümmern würde. Was ist, wenn Mr. McKenna bei der Operation gestorben ist?«
»Dann hätte das Krankenhaus angerufen.«
»Und wenn er heute irgendwann stirbt und sie dann anrufen? Ich muss zu Hause bleiben.«
Deborah drehte sich ihr zu. »Wenn du zu Hause bleibst, musst du die Arbeit nachschreiben ‒ und versäumst das Leichtathletiktraining, was angesichts des Wettkampfs am Samstag keine gute Idee ist.«
Grace schaute sie entsetzt an. »Ich kann doch unmöglich laufen, nachdem das passiert ist!«
Deborah wusste, wie ihre Tochter sich fühlte. Nachdem Greg damals gegangen war, hatte sie sich nur noch verkriechen und ihre Wunden lecken wollen. Im Moment verspürte sie den gleichen Wunsch, aber das würde alles noch schlimmer machen. »Ich muss arbeiten, Grace, und du musst laufen. Wir hatten einen Unfall, aber wir dürfen uns dadurch nicht lähmen lassen.«
»Und wenn Mr. McKenna dadurch gelähmt ist?«
»Nichts spricht dafür.«
»Kannst du echt arbeiten heute?«
»Ich muss. Die Patienten erwarten von mir, dass ich für sie da bin. Und von dir erwartet das Team, dass du einen Sieg holst.«
»Und was soll ich in der Schule sagen?«
Deborah schluckte. »Was ich Tante Jill gesagt habe: dass es stockdunkel war und in Strömen goss und das Auto zur falschen Zeit am falschen Ort war.«
»Wenn ich die Bio-Arbeit heute schreibe, vergeige ich sie. Das ist noch ein Fortgeschrittenenkurs, in dem ich nicht sein sollte.«
»Du vergeigst sie nicht. Du bist vorbereitet, und die bist ein Ass in Bio.«
»Aber ich habe so gut wie nicht geschlafen.«
»Du kennst den Stoff, und außerdem ‒ auf dem College wirst du ständig unausgeschlafen Arbeiten schreiben. Sieh es als Übung. Es stärkt den Charakter.«
»Apropos Charakter ‒ sollte ich dich nicht begleiten, wenn du wegen des Protokolls zur Polizei gehst?« Deborah verspürte einen Anflug von Stolz, gefolgt von einem Nadelstich ihres Gewissens. Beides wandelte sich in Angst, als sie an die Folgen dachte, die es haben könnte, wenn sie Grace die Verantwortung übernehmen ließe. Langsam schüttelte sie den Kopf und hielt den Blick ihrer Tochter einen Moment lang fest, bevor sie sie mit sich aus dem Bett zog.
Wie immer passierte es unter der Dusche, dass Deborah Bedenken wegen ihres Tuns kamen. Jede Woche bei Dutzenden Patienten Diagnosen zu stellen, ihrem Vater zu helfen, seinen Haushalt ohne seine Frau Ruth zu bewältigen, alleinerziehende Mutter zu sein und heikle Entscheidungen treffen zu müssen wie die gerade eben war zeitweise ungeheuer stressig, und während jetzt das heiße Wasser auf sie herabprasselte, fühlte sie sich so verlassen und überfordert, dass sie hätte heulen können.
In eines ihrer Arbeitsoutfits zu schlüpfen gab ihr das Gefühl von Professionalität zurück. Make-up überdeckte die Blässe ihres Gesichts und täuschte über den besorgten Ausdruck der weit auseinanderstehenden braunen Augen hinweg, die sie Grace vererbt hatte. Aber als sie ihre Haare mit einer Spange bändigen wollte, um zumindest äußerlich eine gewisse Ordnung herzustellen, widersetzten sich die knapp schulterlangen dunklen Wellen. Resigniert akzeptierend, dass eine Rückkehr in ihr normales Leben offenbar nicht möglich war, ließ sie sie sich locken, wie sie wollten, und kehrte dem Spiegel den Rücken.
Gnädigerweise hatte es aufgehört zu regnen, und die hier und da durch die Wolken brechende Sonne ließ die Tropfen an den knospenden Zweigen glitzern. Dankbar für den hellen Tag ging Deborah in die Küche hinunter, richtete die Frühstücksflocken für die Kinder her und rief im Krankenhaus an. Calvin McKenna lag noch im Aufwachraum und würde bald in ein Zimmer verlegt. Er hatte noch nicht gesprochen, aber sein Zustand war stabil.
Fürs Erste beruhigt, überflog sie die Post-its am Kühlschrank: Grundsteuer bezahlen ‒ Dylan Zahnarzt um vier ‒ Tenniscamp-Anzahlung. Dann checkte sie ihre E-Mails und rief beim Auftragsdienst an. Hätte es einen Notfall gegeben, wäre sie angerufen worden. Was sie da zu hören bekam ‒ die Verschlimmerung einer chronischen Mittelohrentzündung, eine hartnäckige Migräne, einen schweren Fall von Sodbrennen ‒, würde die Rezeptionistin, die um acht Uhr anfing, aufnehmen. Patienten, die früher einträfen, würde ihre Krankenschwester untersuchen.
Für gewöhnlich war Deborah um Viertel nach acht in der Praxis, nachdem sie die Kinder zur Schule gebracht, auf einen Kaffee bei Jill reingeschaut und nach ihrem Vater gesehen hatte. Sein erster Patient war für halb neun eingetragen, und heutzutage war es Deborahs Aufgabe, dafür zu sorgen, dass ihr »Doktorvater« rechtzeitig erschien. Ihre Schwester, obwohl ständig über Kreuz mit dem Mann, respektierte das. An diesem Morgen stand sie um Punkt halb acht vor der Tür. Da sie von der Arbeit kam, war sie in Jeans und T-Shirt. Das T-Shirt ‒ passend zu den Farben der Bäckerei stets rot, orange oder gelb ‒ war heute rot, das jungenkurze Haar zerzaust vom Schürzeherunterreißen. Sie hatte die warmen, haselnussbraunen Augen der Mutter und noch die Schatten der Sommersprossen aus ihrer Kinderzeit auf dem Gesicht, aber ihr fein modelliertes Kinn spiegelte Deborahs.
Als Grace und Dylan ins Auto gestiegen waren, reichte Jill den beiden je eine Tüte mit ihrem Lieblingsgebäck nach hinten. Auch für Deborah hatte sie eine Tüte und einen heißen Kaffee im Becherhalter.
Deborah umfasste den Becher mit beiden Händen und atmete den tröstlichen Duft ein. Nachdem sie getrunken hatte, sagte sie: »Danke, Jill. Es tut mir so leid, dass du meinetwegen von der Arbeit wegmusstest.«
»Sei nicht albern. Ich habe meine drei liebsten Menschen im Auto ‒ was will ich mehr. ‒ Geht’s euch gut da hinten?«, rief sie mit Blick in den Rückspiegel.
Dylan nickte. So hungrig, wie er seine Zimtstange mampfte, wäre man nicht auf die Idee gekommen, dass er gerade eine ganze Müslischüssel Frühstücksflocken verputzt hatte. Grace hatte ihre Flocken kaum angerührt und ihr Blaubeermuffin in kleine Stückchen zerzupft. Als sie am Unfallort vorbeikamen, stieß sie einen gequälten Laut aus.
»Ist es hier passiert?«, fragte Jill. »Man käme nicht darauf.«
Nein, erkannte Deborah. Man käme nicht darauf. Nur ein kleines Stück gelbes Absperrband an einem Zweig ‒ Hinweis für die Leute von der Spurensicherung, die heute noch einmal kommen würden ‒ deutete auf das Drama hin.
Sie versuchte, Graces Blick einzufangen, aber die weigerte sich strikt, sie anzusehen, und schließlich gab Deborah auf, lehnte sich zurück, nippte an ihrem Kaffee und ließ Jill plaudern, gestattete sich eine Verantwortungspause.