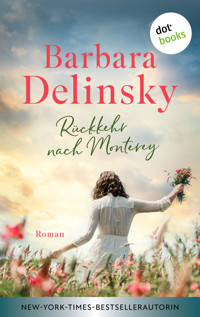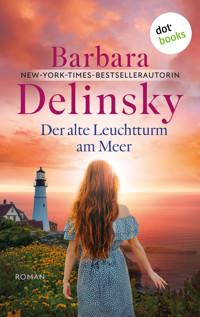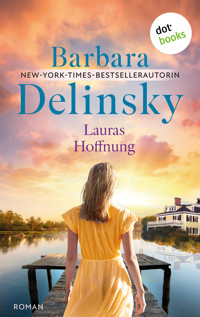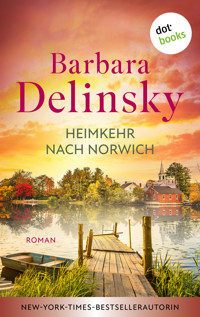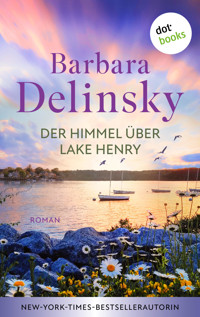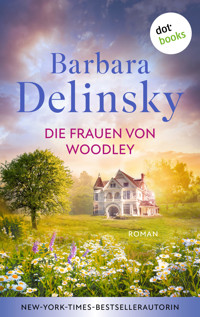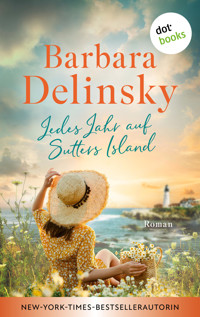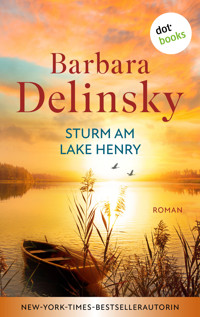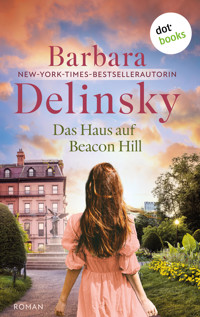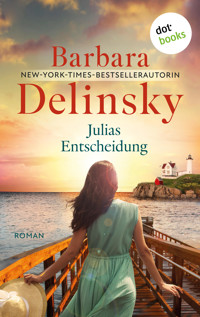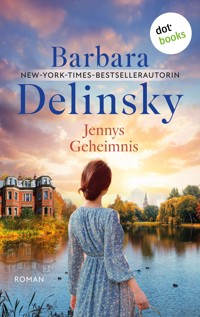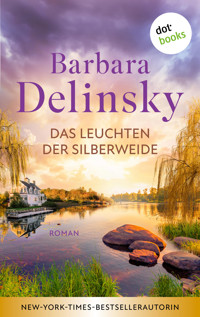
5,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwischen den Schatten der Vergangenheit und neuer Hoffnung: Der Roman »Das Leuchten der Silberweide« von Barbara Delinsky als eBook bei dotbooks. Gemeinsam haben Emily, Kay und Celeste in ihrer Heimat, der Kleinstadt Grannick, schon viele Herausforderungen gemeistert. Doch was lang vergangen schien, drängt nun wieder ans Licht … Seitdem Emilys Sohn vor vielen Jahren auf tragische Weise verschwand, sind sie und ihr Mann einander fremd geworden. Grau und eintönig ziehen die Tage vorüber. Doch als im Nachbarhaus, vor dem die alte Silberweide steht, der Polizist Brian einzieht, schöpft Emily plötzlich neue Hoffnung: Wird er dabei helfen können, doch noch ihren verlorenen Sohn wiederzufinden? Kay und Celeste stehen ihr dabei zur Seite, doch als Celestes Tochter ebenfalls auf rätselhafte Weise verschwindet, kann nichts die drei Freundinnen mehr davon abhalten, den Geheimnissen ihrer kleinen Stadt auf den Grund zu gehen … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der berührende Schicksalsroman »Das Leuchten der Silberweide« von New-York-Times-Bestsellerautorin Barbara Delinsky wird Fans von Jodi Picoult und Kristin Hannah mitreißen und begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 753
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch:
Gemeinsam haben Emily, Kay und Celeste in ihrer Heimat, der Kleinstadt Grannick, schon viele Herausforderungen gemeistert. Doch was lang vergangen schien, drängt nun wieder ans Licht … Seitdem Emilys Sohn vor vielen Jahren auf tragische Weise verschwand, sind sie und ihr Mann einander fremd geworden. Grau und eintönig ziehen die Tage vorüber. Doch als im Nachbarhaus, vor dem die alte Silberweide steht, der Polizist Brian einzieht, schöpft Emily plötzlich neue Hoffnung: Wird er dabei helfen können, doch noch ihren verlorenen Sohn wiederzufinden? Kay und Celeste stehen ihr dabei zur Seite, doch als Celestes Tochter ebenfalls auf rätselhafte Weise verschwindet, kann nichts die drei Freundinnen mehr davon abhalten, den Geheimnissen ihrer kleinen Stadt auf den Grund zu gehen …
Über die Autorin:
Barbara Delinsky wurde 1945 in Boston geboren und studierte dort Psychologie und Soziologie. Nach der Geburt ihres ersten Sohnes arbeitete sie als Fotografin für den Belmont Herald, erkannte aber bald, dass sie viel lieber die Texte zu ihren Fotos schrieb. Ihr Debütroman wurde auf Anhieb zu einem großen Erfolg. Inzwischen hat Barbara Delinsky über 70 Romane veröffentlicht, die in mehr als 20 Sprachen übersetzt wurden und regelmäßig die New-York-Times-Bestsellerliste stürmen. Sie engagiert sich außerdem sehr stark für Wohltätigkeitsvereine und Aufklärung rund um das Thema Brustkrebs. Barbara Delinsky lebt mit ihrem Mann in New England und hat drei erwachsene Söhne.
Die Website der Autorin: barbaradelinsky.com/
Bei dotbooks veröffentlichte Barbara Delinsky auch ihre Romane:
»Die Schwestern von Star’s End«
»Jennys Geheimnis«
»Das Weingut am Meer«
»Julias Entscheidung«
»Lauras Hoffnung«
»Die alte Mühle am Fluss«
»Der alte Leuchtturm am Meer«
»Das Haus auf Beacon Hill«
»Sturm am Lake Henry«, Die Blake-Schwestern 1
»Der Himmel über Lake Henry«, Die Blake-Schwestern 2
»Heimkehr nach Norwich«
»Das Licht auf den Wellen«
»Die Frauen Woodley«
»Ein Neuanfang in Casco Bay«
»Im Schatten meiner Schwester«
»Rückkehr nach Monterey«
»Drei Wünsche hast du frei«
»Ein ganzes Leben zwischen uns«
»Jedes Jahr auf Sutters Island«
»Was wir nie vergessen können«
***
eBook-Neuausgabe Februar 2024
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1996 unter dem Originaltitel »Together Alone« bei W. W. HarperCollins, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1997 unter dem Titel »Zusammen und doch allein« bei Droemer Knaur.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1996 by Barbara Delinsky
Published by Arrangement with Barbara Delinsky
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1997 Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Covergestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98690-963-5
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Das Leuchten der Silberweide« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Barbara Delinsky
Das Leuchten der Silberweide
Roman
Aus dem Amerikanischen von Georgia Sommerfeld
dotbooks.
DANK
Kein Schriftsteller ist allwissend,
und so geht mein tiefempfundener Dank
an Lt. Jack Hunt vom Needham Police Department,
Martha Shepardson von der Rivers School
und alle Mitarbeiter des National Center
for Missing and Exploited Children
für ihre Hilfe bei meinen Recherchen für dieses Buch.
Ich übernehme die volle Verantwortung für etwaige
Irrtümer, die sich vielleicht bei der Übertragung
von Tatsachen in die fiktive Handlung
eingeschlichen haben.
KAPITEL 1
Es würde ihm nicht gefallen. Er haßte das Ritual des gestellten Familienfotos, doch diesmal gab es schließlich einen Anlaß. In vier kurzen Tagen würde sein einziges Kind das Nest verlassen, aus dem Kokon schlüpfen und in eine aufregende, neue Welt hinausfliegen. Wenn je ein Ereignis es wert war, festgehalten zu werden, dann dieses.
Aufs College zu gehen, war eine einschneidende Veränderung, der Beginn eines neuen Lebens.
Und auch ein Ende – eines, dem Emily jahrelang voller Grauen entgegengesehen hatte. Bevor Jill in den Kindergarten kam, hatte sie ganz ihr gehört. Dann war sie drei Stunden täglich weg. Dann sechs. Dann sieben, dann acht.
College hieß vierundzwanzig Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Es war ein Sprungbrett fürs Erwachsenenleben und für völlige Unabhängigkeit.
»Wie sehe ich aus?« Jills Spiegelbild gesellte sich im Badezimmer zu dem ihrer Mutter.
Emily stockte der Atem. Das geschah jedesmal, wenn Jill unerwartet auftauchte. Daß diese attraktive junge Frau ihre Tochter war, erstaunte sie immer wieder von neuem. Sie hatte die dunklen Haare von Emily und die Größe von Doug, doch ihre Züge entstammten früheren Generationen, und innerlich war sie einzig und allein Jill. Sie war lieb, sensibel und gescheit. Sie war unschuldig und doch weltoffen – das Ergebnis einer Kindheit in einer kleinen Stadt, in einer immer kleiner werdenden Welt. Emily wollte nicht, daß ihr die Unschuld genommen würde. Sie wollte nicht, daß ihre Weltoffenheit ihr Enttäuschungen bescherte. Sie wollte nicht, daß Jill weh getan würde. Niemals.
»Mom«, sagte Jill leise in bittendem Ton.
Emily gab einen kleinen, Hilflosigkeit ausdrückenden Laut von sich und griff nach einem Papiertaschentuch. »Entschuldige – das wollte ich nicht.«
»Wenn du weinst, fang ich auch an, und dann sehen wir beide aus wie von der Geisterbahn. Dad hängt am Telefon.« Nach einer kleinen Pause fragte sie vorsichtig: »Wird er böse sein?«
Emily zwang ein strahlendes Lächeln auf ihr Gesicht. »Worüber sollte er böse sein? Er ist schon für die Grillparty angezogen, die Fotos sind in zehn Minuten gemacht, und dann fahren wir los.« Die ehemals melodische, jetzt, im Alter, jedoch schrill schnarrende Türklingel ertönte. »Der Fotograf ist da«, sagte sie und nahm Jills Gesicht in ihre Hände. »Du siehst wunderschön aus. Komm.«
Die Sonne sank dem Horizont entgegen, badete die ausladenden Ahornbäume auf dem Rasen vor dem Haus und den weißen Lattenzaun dahinter in goldenem Licht. Emily ließ Jill für einen Moment dort allein und ging zu Dougs kleinem Arbeitszimmer. Als er sie in der Tür stehen sah, hob er den Zeigefinger, um ihr zu bedeuten, sein Telefonat nicht zu unterbrechen.
Mit einem Flattern im Magen – wie immer, wenn sie seine Stimmung nicht einschätzen konnte – wartete sie und nutzte die Zeit dazu, ihn genau anzusehen. Mit vierundvierzig war sein Körper athletischer, als er es mit zweiundzwanzig gewesen war. Damals hatte körperliche Arbeit ihn in Form gehalten – jetzt tat es tägliches Training im Fitneßclub. Sein Bauch war flach, der Rücken zwischen den breiten Schultern gerade. Er brachte seine Kleidung optimal zur Geltung.
Er zog sich sehr gut an, kleidete sich auf seinen Reisen ein, und das war nicht zu übersehen. Die Hose mit der perfekten Bügelfalte, das Hemd mit offenem Kragen sahen eher nach Europa aus als nach einer Kleinstadt im Nordwesten von Massachusetts.
Emily wünschte fast, sie hätte sich für die Fotos etwas Neues gekauft, um besser zu Dougs weltmännischer Erscheinung zu passen, doch sie brachte es nie fertig, Geld für sich auszugeben, wenn dringende Ausgaben anstanden. Ein neuer Auspuff für den Kombi war wichtiger als ein seidener Fummel, den sie nur einmal tragen würde.
Doug legte den Hörer auf. »Wer hat geklingelt?«
Einschmeichelnd hakte sie ihn unter. »Larry Johnson. Er hat vor kurzem bei der ›Sun‹ angefangen. Ein Fotograf. Er ist gut und sehr preiswert. Ich habe ihn gebeten, ein paar Aufnahmen zu machen, bevor wir losfahren.«
»Emily!«
»Ich weiß. Du haßt es, fotografiert zu werden – aber Jill verläßt uns in vier Tagen, in vier Tagen, und dann wird unser Leben nie mehr so sein wie jetzt.«
»Vielleicht, wenn sie nach D.C. ginge wie Marilee. Aber Boston ist kaum drei Stunden entfernt.«
»Sie wird nicht mehr unser kleines Mädchen sein.«
»Das ist sie schon lange nicht mehr.«
»Du weißt genau, wie ich es meine«, sagte Emily mit einem flehenden Unterton. »Ihr Weggang ist wie ein Meilenstein. Außerdem braucht sie ein Bild von uns dreien für ihr Zimmer im Wohnheim. Wirst du ihr zuliebe lächeln? Ja?«
Wenn er nein sagte, würde sie Larry wegschicken – ein grimmig dreinschauender Doug wäre nicht im Sinn der Sache. Doch er seufzte und rang sich ein freudloses Lächeln ab. Erleichtert zog sie ihn aus dem Haus.
Jill saß auf der Schaukel, die am größten der Ahornbäume hing. Ein vom Blätterschatten gesprenkelter Rasen, ein Hintergrund aus Rhododendron und weißen Zaunlatten waren für die Kulisse ländlicher Idylle wie geschaffen.
Emily dachte an die vielen, vielen Stunden, die Jill auf dieser Schaukel zugebracht hatte, an das Abstoßen, Hoch-hinaus-Schwingen und Abspringen, als gedämpft das Klingeln des Telefons herüberklang – und ehe sie protestieren konnte, setzte Doug sich in Bewegung. Der Bestürzung, mit der sie ihm nachschaute, folgte schnell Resignation. Wenigstens war er zu Hause. Er hatte versprochen, die Woche daheim zu bleiben. Das war ein Zugeständnis, das nicht ohne einschränkende Klauseln gewährt wurde. Telefonate entgegennehmen war eine davon.
Nicht bereit, sich entmutigen zu lassen, wendete sie sich wieder Jill zu. »Ich möchte ein Bild von dir auf der Schaukel«, bat sie, und nachdem ein paar Fotos gemacht worden waren, begab Emily sich für ein paar gemeinsame zu ihr.
Sie legte ihre Hände auf Jills Hände, die die Ketten der Schaukel umfaßt hielten, und lehnte sich an sie. Als sich ihre Wangen berührten, lächelte sie, als sie Jills Lächeln spürte, lachte sie beim Klang ihres Lachens. Auf einmal schien die Zeit zurückgedreht zu sein, und das Lachen war wieder das aus Kindertagen. Emily liebte seinen Klang. Sie konnte es nicht ertragen, an den Tag zu denken, an dem sie es nicht mehr hören würde. Sie verließen die Schaukel, gingen nach hinten in den Garten und setzten sich auf einen aus dem Boden ragenden Felsen am Teich. Jill – ein wenig höher sitzend – ließ ihre Arme über Emilys Schultern fallen. Emily nahm ihre Hände. Sie lehnten sich aneinander, verloren das Gleichgewicht, lachten und machten einen zweiten Versuch, während der Fotograf unaufhörlich auf den Auslöser drückte.
»Doug!« rief Emily zum Fenster seines Arbeitszimmers hinüber, doch Jill hatte eine andere Idee. »Eins von meiner Mom allein«, bat sie.
Emily floh aus dem Sucher der Kamera. »Kommt nicht in Frage – heute ist dein Tag.«
»Aber ich will eins von dir allein.«
»Ich will welche von uns.« Sie schaute zum Haus.
»Doug?«
Sein Gesicht erschien am Fliegengitter – und wieder ging sein Zeigefinger in die Höhe.
Emily versuchte, ihre Enttäuschung mit einem kurzen Seufzer und dem Wissen, daß er irgendwann schon kommen würde, hinunterzuschlucken. Zwar widerwillig, aber er würde ihr den Gefallen tun. Sie bat ihn nicht oft um etwas, und dessen war er sich durchaus bewußt.
Sie kehrten vors Haus zurück und stellten sich auf die Treppenstufen, Emily oben, Jill unten, und dann überließen sie sich der Regie des Fotografen. Emily lächelte unbeschwert. Sie beherrschte es, auch dann unbekümmert zu lächeln, wenn ihr das Herz schwer war. Manche würden das als Unehrlichkeit bezeichnen – Emily bezeichnete es als Das-Beste-aus-der-Situation-Machen.
»Man möchte nicht glauben, daß Sie Mutter und Tochter sind«, meinte der Fotograf, worauf Emily mit einem Laut des Zweifels reagierte.
»Es ist wahr«, sagte Jill. »Alle werden denken, daß du meine Schwester bist.«
Emily zuckte bei dem Gedanken an Fremde in einem Wohnheim, das drei Stunden entfernt lag – und verspürte plötzlich eine innere Leere.
»Mom!« grollte Jill und drückte Emilys Finger, die mit den ihren verflochten waren.
»Ich bin okay«, schwor Emily.
»Ich bin doch nur in Boston. Wir werden immer telefonieren.«
»Ich weiß.«
»Du kannst rüberkommen und mich zum Mittagessen einladen.«
»Ich weiß.«
»Wir können einkaufen gehen.«
»Ich weiß.« Aber es war nicht dasselbe. Es würde nie mehr dasselbe sein.
Gegen den Kloß in ihrem Hals ankämpfend drückte Emily Jill an sich und hielt sie fest, bis sie ihre Fassung wiedergewonnen hatte. Dann wandte sie sich, ihr ganz nahe bleibend, wieder der Kamera zu.
Als sich hinter ihnen die Fliegentür öffnete, erschien ihr das wie eine Erlösung. Doug bedeutete eine Ablenkung von trüben Gedanken. Er war ihr Mann. Er war ihre Welt gewesen, bevor die Kinder kamen, und er würde es wieder sein, wenn Jill fort wäre. »Wo wollt ihr mich hinhaben?« brummte er in einem Ton, der ihren Magen wieder in Aufruhr versetzte.
»Probleme?« fragte sie. Er war Unternehmensberater, ein »Feuerwehrmann«, den kleine Firmen riefen, wenn es bei ihnen »brannte«. In einer Zeit der wirtschaftlichen Blutarmut war er wie Medizin. Er war gefragt wie nie.
Er warf ihr einen müden Blick zu. »Immer.«
»Wo?«
»Pittsburgh.«
O Gott! Concord oder Manchester, sogar Boston schaffte er oft an einem Tag. Pittsburgh dauerte immer länger. »Mußt du hin?«
»Ich muß nicht, aber wenn ich den Kunden behalten will, sollte ich.«
»O Doug.« Er hatte ihr diese Woche versprochen. Sie war traurig wegen Jill. Sie war traurig ihretwegen.
»Ich kann nicht ablehnen, zum Teufel«, er wurde schärfer. »Das Geld ist knapp – und ein College kostet ein Vermögen. Ich denke immer noch an den Scheck, den ich letzte Woche ausgestellt habe.«
»Es ist schon okay«, sagte Jill hastig. »Wir haben noch eine Menge zu erledigen, wobei Dad uns sowieso nicht helfen könnte. Wir haben alle Hände voll zu tun, Mom. Bist du zurück, bevor ich abfahre, Dad?«
Merklich sanfter strich er ihr über den Kopf. »Natürlich bin ich das – ich bin nur zwei Tage weg.«
Der Fotograf machte ein paar Fotos von Emily und Jill auf der Treppe und von Doug, der über das Geländer gebeugt stand. Dann setzte er Doug auf die Stufen und gruppierte Emily und Jill um ihn herum. Nach dieser Aufnahme sprang Jill auf.
»Ich möchte ein Bild nur von meinen Eltern«, sagte sie, und diesmal protestierte Emily nicht. Sie setzte sich auf die Stufe zwischen Dougs Beine und legte die Ellbogen auf seine Knie.
Es hätte die bequemste Pose der Welt sein müssen. Sie hatten Dutzende von Malen so gesessen, damals in der ersten Zeit ihres Kennenlernens, als das Leben noch einfacher gewesen war. Emilys Leben war noch immer einfach. Es drehte sich um Jill und Doug, um das kleine Haus, das Reparaturen brauchte, die sie sich nicht leisten konnten, den kleinen Kreis von Freunden, deren Loyalität nicht mit Geld zu bezahlen war, und die kleine Stadt, deren Reichtum in ihrer Wärme lag.
Es war Dougs Leben, das sich geändert hatte. Er war ständig auf Reisen, hetzte von einem Geschäftsessen zum anderen, vertiefte sich so sehr in innovative Management-Techniken, daß es Emily schwerfiel, ihn noch mit dem schlichten Öko-Farmer in Verbindung zu bringen, den sie geheiratet hatte. Vielleicht fühlte sie sich aus diesem Grund unbehaglich, als sie mit den Ellbogen auf seinen Knien zwischen seinen Beinen saß.
»Mutter!« rief Jill. »Lächeln!«
Emily lächelte. Für Jill tat sie alles.
Und so schwer war es gar nicht: Kummer zu verbergen war eines der Dinge, die das Muttersein sie im Laufe der Jahre gelehrt hatte.
Die leise wimmernde Julia auf dem Arm, stürmte Brian Stasek in den Supermarkt. Sie fühlte sich nicht wohl, aber ihm ging es auch nicht besser. Er war hungrig, müde und durchgeschwitzt. Sie war hungrig, müde und naß. Es war fünf Stunden her, daß er auf einem Rastplatz die letzte Pampers verbraucht hatte. Sie waren in Not. Er fand den Gang, fand die Größe, fand das Geschlecht. Mit einem Armvoll Kartons bahnte er sich einen Weg zur Kasse. Die Schachteln polterten auf das Laufband, und Julia fing an zu weinen.
Sie zappelte auf seinem Arm, während er nach seiner Brieftasche griff. »Nur noch ein paar Minuten. Nur noch ein paar Minuten. Nur noch ein paar Minuten.«
»Ein hübsches kleines Ding«, meinte die junge Kassiererin.
Brian grunzte. »Das dachte ich auch mal. Dann hatte ich sie plötzlich allein am Hals, und seitdem sehe ich die Dinge anders. Lassen Sie sich eines sagen: Kinder aufziehen ist nichts für schwache Nerven. Bedenken Sie das, falls Sie vorhaben, sich in nächster Zukunft ein Kind anzuschaffen.«
Das Mädchen trat einen Schritt zurück. Julia weinte lauter.
»Seit Chicago geht das so«, stieß er hervor.
»Vielleicht ist sie krank«, meinte das Mädchen besorgt.
Er seufzte. »Nein – nur müde.« Es steckte mehr dahinter, doch Brian hatte weder die Kraft noch die Absicht, das zu erläutern, und schon gar keinem fremden Teenager. Das Gebot der Stunde war eine trockene Windel, eine warme Mahlzeit und ein richtiges Bett – in dieser Reihenfolge. Und so steckte er das Wechselgeld ein, raffte die Schachteln zusammen und ging zum Jeep zurück. Das Wickeln war in Null Komma nichts erledigt. Nach drei Tagen hatte Brian genügend Erfahrungen gesammelt, um zu wissen, daß Perfektionsbestrebungen, wenn es um ein unglückliches Kind ging, absurd waren. Solange die Windel in etwa den Gefahrenbereich abdeckte, würde sie ihrer Bestimmung gerecht. Mehr oder weniger.
In diesem Fall weniger. Also fischte er einen trockenen Strampelanzug aus der fast leeren Tasche mit der sauberen Wäsche, stopfte den durchweichten in die fast überquellende Tasche mit der schmutzigen, und hob seine trockene Tochter hoch. »Hübsche Julia«, sagte er mit einem Grinsen und drückte sie an sich.
Sie begann zu jammern.
Das Grinsen erlosch. »Richtig: essen.« Er steckte ein leeres Fläschchen in den Bund seiner Jeans, stieg mit Julia im Arm rückwärts aus dem Jeep und richtete sich auf.
Sie begann sich zu winden.
Er verstärkte seinen Griff, so daß sie sich nicht mehr rühren konnte, und schaute ihr in die Augen. »Wenn ich dich laufen lasse, brauchen wir doppelt so lange für den Weg.«
Sie erwiderte seinen Blick mit blaßblauen Augen, ohne zu blinzeln. Die Pupillen waren silbern eingefaßt, irisierend, fast unirdisch – so wie die Leute seine oft beschrieben. Sie sagten, daß seine Augen seine wirksamste Waffe seien, daß ein langer, eindringlicher Blick selbst den bösartigsten Menschen einschüchtere. Zum erstenmal in seinem Leben begriff er, was sie meinten. Als Julia ihn jetzt mit diesen Augen auf diese Weise ansah, war es, als wisse sie etwas, das er nicht wußte, als wisse sie vieles, das er nicht wußte.
»Ja, ja«, sagte er in dem Versuch, ihr zu zeigen, daß er auch etwas wußte, »du hast drei Tage lang fast nur im Auto festgesessen und möchtest dich unbedingt mal wieder bewegen.«
Die Augen hielten seine fest.
Er seufzte. »Wenn du Hunger hast, dann geh schnurstracks in Richtung Essen.« Er setzte sie ab.
Sie ging schnurstracks in Richtung Straße.
Er fing ihre Hand mit einem »O nein, kommt nicht in Frage, Süße!« ein, doch es folgte eine Minute des Tauziehens und vehementen, wenn auch unverständlichen Protests seitens Julias, bevor sie bereit war, auf dem Bürgersteig zu gehen.
Brian dachte an Gayle. Sie war es, die Kinder gewollt hatte, obwohl er gesagt hatte, daß sie warten sollten. Sie seien beide Workaholics, hatte er gesagt. Sie könnten einem Kind nicht gerecht werden, hatte er gesagt.
Sie entgegnete, sie hätten lange genug gewartet, und wenn sie noch länger warteten, würden ihre Eileiter eintrocknen. Sie sagte, sie schaffe schon alles: Ehe, Kind und Job.
Dann starb sie, und er hatte die Bescherung.
Und was für eine süße, bemitleidenswerte, traurige Bescherung, dachte er, als er auf die hüpfenden, braunen Locken, den gepolsterten Po und die wackeligen Beinchen hinunterschaute. Daß Gayle tagsüber nicht da war, war Julia gewohnt, doch die Nächte waren problematisch und wurden, nach inzwischen vier Wochen, nicht unproblematischer, und dann war da noch das Stillen, das Gayle morgens und abends bis zuletzt praktiziert hatte.
Was das betraf, mußte er passen.
Vielleicht auch, was diesen Ort betraf, dachte er, als er die Straße hinunterschaute. Aber vielleicht auch nicht. Er atmete tief ein und langsam wieder aus, und als die gespannte Feder in seinem Innern nachgab, atmete er wieder ein.
Grannick war nicht häßlich, wenn man die Hauptstraße zum Maßstab nahm. Es war sauber, und es besaß den für eine Collegestadt typischen, aus der Kombination von Alt und Neu erwachsenden New-England-Charme. Spaziergänger schlenderten in der Abenddämmerung dahin. Sie wirkten intelligent und friedlich. Sie wirkten entspannt. Sie wirkten ländlich. Einige sahen aus wie er.
Er trug alte Jeans, ein schwarzes T-Shirt, das seinen schwärzesten Tag hinter sich hatte, abgetragene Turnschuhe, und in seinem Gesicht sproß ein Dreitagebart. Das war sein Undercover-Look. Zu Hause war dieses Erscheinungsbild mit gefährlicher Arbeit verbunden – hier mit Freizeit.
Julia wackelte, gelegentlich Unmutslaute von sich gebend, an seiner Hand dahin.
Neben dem Drugstore befand sich eine Videothek, deren Neonreklame Julia ein paar Sekunden lang ablenkte, danach folgte eine Buchhandlung und dahinter, gekennzeichnet durch edle goldene Lettern auf braunem Untergrund, die »Eatery«. Brian erlebte einen Energieschub. »Schau dir das an – genau das, was wir brauchen. Das ist ein gutes Omen, würde ich sagen.«
Das Lokal wäre schön gewesen, wenn er mit Gayle hier zum Essen gegangen wäre – aber Julia war hungrig und müde, nagte dazwischen immer wieder weinend an ihrer Faust, war mißgestimmt darüber, stillsitzen zu müssen, und die Speisekarte bot »Southwestern«-Gerichte mit viel Avocados, Sprossen und scharfer Sauce, nichts, was ihrer üblichen Nahrung entsprach. Er hatte auf Hausmannskost wie gebratenen Truthahn, Kartoffelpüree und Erbsen gehofft. Er wählte das, was diesem am nächsten kam, und bestellte einen Hamburger und Pommes.
Wenigstens gab es Milch, die die Bedienung in einem großen Glas vor ihn hinstellte. Es war ein Geduldsspiel, die Milch aus dem Glas in das Fläschchen zu gießen, denn Julia fuhr ungeduldig schreiend ständig mit ihren Ärmchen dazwischen, doch schließlich trat himmlische Stille ein.
Brian setzte sich in die Ecke der Nische und nahm Julia in seine Arme. Ihr Blick traf sich mit seinem und hielt ihn wieder mit diesem wissenden und dadurch einschüchternden Ausdruck fest. Er versuchte, ihr ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln, denn Sicherheit brauche sie jetzt unbedingt, hatte seine Mutter gesagt. Sie hatte auch gesagt, daß Julia bei ihr bleiben könne, daß es einfacher für ihn wäre, bis er eine Bleibe gefunden habe, daß die Reise mit einem Kleinkind zu einer Strapaze werde, aber er hatte nicht auf sie gehört. Er hatte sie einfach mitnehmen müssen, hatte dieses kleine Stück von Gayle und sich, das Beste ihres alten Lebens, die Saat seiner Zukunft gebraucht.
Außerdem – wenn er sie nicht mitgenommen hätte, hätte er vielleicht die Nerven verloren.
Was ein Witz war, wenn man bedachte, womit er seinen Lebensunterhalt verdiente. Er war dafür bekannt, selbst in kritischsten Situationen die Ruhe zu bewahren – aber die Polizeischule hatte ihn nicht aufs Vatersein vorbereitet. Wie für Detectives typisch, beherrschte er den Umgang mit Kriminellen, war reaktionsschnell, doch diese Eigenschaften beeindruckten Julia nicht im mindesten, und was sein Abzeichen betraf, so würde sie es eher in ihrer Cornflakes-Schale versenken, als in Ehrfurcht davor erstarren.
Brian war es gewohnt, tagsüber mit dem Schmutz der Welt umzugehen, anschließend nach Hause zu fahren, die Tür hinter sich zu schließen und ihn abzuduschen. Julia jedoch konnte er nicht abduschen – sie war für die absehbare Zukunft untrennbar mit ihm verbunden. Sie von ihrer Großmutter in Chicago wegzuholen, war das größte Wagnis, das er in seinem Leben bisher eingegangen war.
»Ein Burger und Pommes«, flötete die Bedienung und stellte einen großen Teller vor ihn hin. Er bedankte sich mit einem Lächeln, rührte sich jedoch nicht. Julia trank noch immer. Er wußte, daß sie durchaus in der Lage war, selbständig zu sitzen, den Kopf in den Nacken zu legen und die Flasche selbst zu halten, aber sie schien zufrieden zu sein.
Und auch er war das in diesem kurzen Moment.
Doch der Moment ging vorüber. Julia trank die Milch aus, ließ sich in das Kinderstühlchen neben ihn setzen und aß Häppchen von dem Hamburger, die er ihr reichte, doch sie war müde. Sie aß für gewöhnlich sehr ordentlich, doch jetzt wurde sie unachtsam und weinerlich, rieb ihre Augen mit ihren Ketchup-Händen, brabbelte Worte, die Gayle verstanden hätte, die Brian jedoch nichts sagten. Er versuchte, sie mit einer zweiten Portion Milch zu besänftigen, doch sie verweigerte sie ebenso wie die Cola, die er für sich bestellt hatte, und als sie »Mommmmy – Mommmmy ...« zu weinen begann, verging ihm der Appetit. Er hob sie mit Schwung aus dem Stuhl, bezahlte die Rechnung und machte sich auf den Weg zurück zum Jeep, ließ sie erst wieder runter, als sie sich erneut in seinen Armen zu winden begann.
Es war warm und windstill, die Luft mit dem intensiven Duft nach Bäumen und Gras geschwängert und so ganz anders als dort, wo er herkam, daß er sich fragte, ob das vielleicht auch ein Omen sei. Er hatte sich nie danach gesehnt, auf dem Land zu leben, doch in Anbetracht der Umstände erschien es ihm die beste Lösung. Er brauchte eine heile Welt, um Julia aufzuziehen. Er brauchte ein friedliches Umfeld, um von seinem Kummer zu genesen.
Julia begann wieder zu jammern.
Er nahm sie hoch. »Was ist los, Süße?«
»Mom-my.«
»Mommy ist nicht hier, aber Daddy ist da. Es wird alles gut. Siehst du, da ist der Jeep. Genau an der Stelle, wo wir ihn stehengelassen haben.« Und unbeschädigt und vollständig. Das war der typische Gedanke eines Städters, aber in Anbetracht der Tatsache, daß das Fahrzeug sein wertvollstes Hab und Gut enthielt, ganz zu schweigen vom Zubehör für Julia, von ihrer Lieblingssorte Cracker, vom Saft und dem Plüschhasen, ohne den sie sich zu schlafen weigerte, ein verständlicher.
Brians Gedanken verweilten bei Cracker und Saft und seinem eigenen Magen, der sich in ein paar Stunden zweifellos wieder melden würde. Julias Cracker und Saft würden ihn nicht zum Schweigen bringen, das hatte er in der letzten Nacht bereits versucht.
Also ging er zurück in den Drugstore und kaufte eine Partypackung Cheddar-Popcorn, drei Schokoladenriegel und eine Sechserpackung Aprikosen-Nektar. Julia unter dem einen Arm und seine Einkäufe unter dem anderen, wollte er den Laden gerade verlassen, als munteres Geschrei seine Aufmerksamkeit auf den hinteren Teil des Geschäfts lenkte.
Dort stand ein Fix-Foto-Automat. Der kurze Vorhang war zugezogen, und darunter war ein heilloses Durcheinander von Beinen zu sehen. Er erinnerte sich an seine diesbezüglichen Kindheitserlebnisse und grinste.
Quieken, Kichern, hohes Lachen, dann ein Blitz und hektisches Entwirren der Beine. Das Lachen erstarb, die Beine erstarrten, das Blitzlicht blitzte, und dann begann alles von vorne. Als die vier Aufnahmen gemacht waren, taumelten sechs Kinder, die das begehrte Teenageralter noch nicht erreicht hatten, aus der Kabine.
Es war Brian ein Rätsel, wie sie alle darin Platz gehabt hatten, doch sie hatten die bedrängende Enge sichtlich vergnügt und unbeschadet überstanden. Und plötzlich wurde die Vergangenheit für ihn so lebendig, erlebte er den Apparat als eine so erfreuliche Abwechslung gegenüber den riesigen Videotheken und Computer-Massakern, daß er nicht widerstehen konnte.
Er stellte seine Tüte in eine Ecke der Kabine, kramte Kleingeld aus der Tasche und setzte sich mit Julia auf dem Schoß auf den Hocker. »Grammie wird begeistert sein«, sagte er und versuchte, so etwas wie Ordnung in ihre Locken zu bringen. »Wenn wir in die Kamera lächeln, wird sie sehen, daß es uns gutgeht. Ist das nicht eine tolle Idee, Julia?«
Julia schaute sich in der Kabine um, als befinde sie sich in einem Gruselkabinett. Ihre unirdischen Augen wurden von Sekunde zu Sekunde größer. Tränen sammelten sich am unteren Lidrand. »O Süße, es ist alles in Ordnung«, versuchte er, sie zu beruhigen. »Es passiert dir nichts, dafür sorgt Daddy schon. Schau«, forderte er sie mit übertriebenem Eifer auf. »Ich füttere die Maschine mit ein paar Vierteldollarmünzen ... komm, hilf mir ... nimm die Münze ...«
Sie fiel auf den Boden.
Er bückte sich, um sie aufzuheben und drückte dabei zwangsläufig Julia zusammen, die einen Protestschrei ausstieß. Er wiegte sie in den Armen. Er küßte sie auf die Locken. »Schsch. Daddy hat das nicht absichtlich getan. Komm – versuchen wir’s noch mal.« Er steckte die Münzen vorsichtshalber selbst in den Schlitz, glaubte er doch, Julia beruhigt zu haben – was aber nicht von Dauer sein sollte. »So. Jetzt schauen wir dahin«, sagte er und deutete gerade in dem Moment auf den großen, schwarzen Kreis, als der erste Blitz aufleuchtete.
Julia erschrak, fing zu schreien an, und diesmal hörte sie nicht wieder auf, obwohl Brian alles versuchte, um sie zu trösten, beruhigend auf sie einredete, ihre Wange an seine drückte und sie anflehte zu lächeln. Als er dann vor der Kabine auf den Fotostreifen wartete, dachte er, daß ja wenigstens die erste Aufnahme brauchbar sein würde, denn da hatte Julia die Fassung noch nicht gänzlich verloren. Ein Mißtrauen ausdrückendes Gesicht war besser als ein von Entsetzen entstelltes.
Wie sich zeigte, war ihm nicht einmal das mißtrauische vergönnt. Er bekam drei Fotos von Julia, die sich die Seele aus dem Leib brüllte, während er ihre Wange an seine drückte. Bei der ersten Aufnahme hatte sie sich gerade vorgebeugt, und es war nichts von ihr zu sehen, nur ein Gewirr brauner Locken.
War auch das ein Omen? Er faltete den Fotostreifen in der Mitte zusammen und steckte ihn in die Tasche. Dann setzte er Julia auf seine Hüfte, schnappte sich die Papiertüte und verließ mit großen Schritten den Laden.
Myra Balch saß im ersten Stock ihres Holzhäuschens am Fenster und beobachtete, was sich draußen in der Welt tat. Es war keine große Welt. Sie wohnte am Ende einer Sackgasse, die von ähnlichen Holzhäusern gesäumt war, doch von ihrem Ende aus konnte sie nur das Haus der Familie Arkins sehen.
Das hieß jedoch nicht, daß sie nicht wußte, was sich im Rest der Straße tat, das wußte sie sehr genau. Sie wußte, wann die Wilsons ihre wöchentliche Orangen-Sendung von ihrer Tochter in Florida bekamen, weil der Wagen von UPS in Myras Einfahrt wendete. Sie wußte, wann Abel Hinkley eine Gehaltserhöhung bekam, weil der Lieferwagen des Möbelhauses ebenfalls bei ihr wendete. Und jener komische, kleine Lastwagen, der wie eine Ratte angemalt war. Der Kammerjäger. Bei den LeJeunes. Mal wieder.
Natürlich gab es auch Dinge, die ihre Einfahrt ihr nicht verriet – und deshalb ging sie jeden Vormittag um elf einmal die Straße hinauf und hinunter. Sie wollte wissen, was es Neues gab – und Bewegung wollte sie sich natürlich auch verschaffen. Frank legte großen Wert darauf, daß sie ihre Figur behielt. Falls sie jemals fett werden sollte, würde er sie ohne Frage verlassen. Der Store bewegte sich, aber nur ganz schwach. Sie sehnte sich nach mehr, sehnte eine Brise herbei, die ein wenig Kühle ins Haus brächte. Frank versprach ihr immer wieder einen Ventilator, aber irgendwie schaffte er es nie, ihn tatsächlich zu kaufen, und so blieb die Luft reglos und warm.
Sie beugte sich vor. Der Fotograf, der Bilder von den Arkins gemacht hatte, fuhr ab. Es war derselbe, der bei Ginny Haists fünfundsechzigstem Geburtstag fotografiert hatte, und die Aufnahmen waren wunderbar geworden. Myra hoffte, daß er bei den Arkins ebenso gute Arbeit geleistet hatte.
Sie hatte Jill fürs College eine Decke gehäkelt und beabsichtigte, sie ihr am Abend vor ihrer Abreise zu schenken. Emily würde gerührt sein.
Der Fotograf stieß rückwärts aus der Einfahrt und brauste davon. Jetzt stand Emilys Kombi wieder allein da. Er wirkte irgendwie verloren. Hatte bessere Tage gesehen, das arme Ding. Dougs Wagen war da schon etwas anderes. Im Augenblick sah sie davon allerdings nicht mehr als ein schimmerndes Schwarz und blitzendes Chrom, da er in der Garage stand. Würde er dort auch stehen, wenn sie die Zimmer darüber vermieteten? Würden sie von dem Mieter verlangen, auf der Straße zu parken? Von wem stammte überhaupt die Idee, einen Mieter ins Haus zu nehmen?
Wahrscheinlich von Doug – der war scharf auf Geld. Ihm würde es nichts ausmachen, wenn Fremde sich im Haus breitmachten. Er würde sie nicht kommen und gehen sehen. Seine Privatsphäre würde nicht gestört.
Emily hätte etwas Besseres verdient. Myra half, so gut sie konnte, und ihre Marmeladenplätzchen waren die besten der ganzen Stadt, aber Marmeladenplätzchen konnten auch keine Wunder bewirken.
Blumen halfen. Myra hatte immer die einen oder anderen für Emily. Und dann waren da noch Dinge wie gestrickte Handschuhe oder eine Wolldecke, die ein Lächeln garantierten.
Myra schnappte nach Luft. Da waren sie, Emily, Jill und Doug, und sie stiegen in Emilys rostigen Kombi, um zur Grillparty bei den Whittakers zu fahren. Morgen abend gab die Familie Davies eine, und am Abend darauf fand in der »Eatery« eine statt, wo Jill und ihre Freundinnen als Bedienungen gejobbt hatten.
Eine Party nach der anderen. Myra verstand nicht, warum Leute so scharf darauf waren, sich in der Öffentlichkeit zum Narren zu machen. Emily begriff das. Sie gab keine Party für Jill. Sie sah den Weggang ihrer Tochter nicht als Anlaß für ein Fest. Ihr Abschied würde eine ganz private Angelegenheit sein, und mit Sicherheit eine traurige.
»Aber ich sage nichts«, schwor Myra, als sie von ihrem Stuhl aufstand. »Habe ich nie getan, und werde ich nie tun. Ich backe meine Kekse, stricke meine Jacken und bin still. Und was tun sie? Sie planen eine Party für mich.« Sie ging die Treppe hinunter. »Ich will keine Party – sie wollen sie. Sie sind bei der ersten Gelegenheit verschwunden und danach nie mehr vorbeigekommen, nun haben sie ein schlechtes Gewissen. Also haben sie Essen für eine Party mitgebracht und mein Haus besetzt.«
Zu ihrer Rechten, am Fuß der Treppe, im Eßzimmer, war der Tisch gedeckt mit der gestickten Decke ihrer Mutter und den ersten der von ihren Schwiegertöchtern mitgebrachten Speisen. Zu ihrer Linken, im Wohnzimmer, verfolgten Söhne und Enkel gebannt die Fernsehübertragung eines Baseballspiels.
Myra ging nach hinten ins Haus, verließ es durch die in den Garten führende Küchentür, stieg die Stufen hinunter und wanderte über den Rasen, ohne daß sie jemand bemerkte. Sie blieb stehen, um die riesige, silberblättrige Trauerweide zu bewundern, die am Ufer des Teiches stand, ehe sie sich auf der verschnörkelten, schmiedeeisernen Bank unter dem Schleier ihrer Äste niederließ.
Sie sammelte die heruntergefallenen Blätter – »Weidenfusseln« nannte sie sie liebevoll – von der Bank, beugte sich dann vor und klaubte Blätter vom Boden, die das Gras unter der Weide verunzierten. Dann lehnte sie sich zurück und freute sich an der Pachysandra, die sie gepflanzt und die Jahre über gehegt und gepflegt hatte, wie das Springkraut und die Lilien dahinter. Sie schaute über das Wasser und seufzte.
Was für ein wunderschönes Fleckchen Erde! Und so gepflegt! Sie hatte ihr Bestes getan. Und das würde sie auch weiterhin tun, bis zum Tag ihres Todes.
Der Gedanke daran weckte gleichzeitig Unruhe, Ungeduld und Angst in ihr. Sie trug eine schreckliche Bürde. Wenn sie an den Tod dachte, verrutschte die Bürde und drohte herunterzufallen. Sie sammelte ihre Kräfte, rückte die Bürde wieder zurecht und schwor, noch nicht zu sterben.
Aber der Tod kam näher, das wurde ihr von Geburtstag zu Geburtstag klarer. Ihre Zeit lief ab.
»Myra?« Es war ihre Schwiegertochter Linda, die Karrierefrau, die die Meinung vertrat, daß alle Frauen Schwestern seien, ungeachtet ihres Alters, und daß »Mutter« eine zu förmliche Anrede für eine Schwiegermutter sei. »Warum sitzt du denn allein hier draußen?«
»Ich bin nicht allein«, sagte Myra freundlich. Sie mochte Linda. Wirklich. Sie hatte zwar ihre Marotten, doch sie war toleranter als die anderen. Die hätten sogar jetzt mit ihr geschimpft, aber Linda lächelte nur.
»Wir wollen Fotos machen. Kommst du ins Haus?«
»Die Fotos sollten hier draußen gemacht werden – dieser Platz ist der allerschönste.«
Linda verscheuchte einen Moskito. »Es ist viel Ungeziefer hier.«
»Das stört mich nicht – ich benutze das richtige Parfum. Wenn du etwas davon nehmen willst – es steht im Bad neben der Küche. Den Jungs wird es nicht zusagen, aber denen werden ein paar Stiche nicht schaden. Ja«, die Vorstellung verfestigte sich, »wenn wir Fotos machen, dann möchte ich, daß sie hier gemacht werden. Aber ihr müßt Frank rufen – wir können keine Bilder ohne ihn machen.«
Linda lächelte. »Ich gehe die anderen holen.«
Myra erwiderte das Lächeln, und es blieb auf ihrem Gesicht. Fotos unter der Trauerweide, das war perfekt. Schwiegertöchter hatten also doch etwas Gutes. Und Enkel sowieso. Und sogar Söhne, bei denen sich nach Jahren der Vernachlässigung das Gewissen regte. Sie würde sich hüten, ihnen zu verraten, daß sie ihren Auszug nicht bedauert hatte. Sie war ihre Streitereien untereinander und mit Frank müde gewesen, das Kochen und das Putzen. Sie war mehr als bereit für eine Ruhepause gewesen. Nicht, daß sie das Frank sagen würde. Um Himmels willen! Er wäre außer sich. Er hatte die Jungs nicht gerne gehen sehen, gar nicht gerne.
»Komm rein, Mom«, rief Carl, ihr Ältester. »Wir machen Fotos im Wohnzimmer.«
»Nein, hier draußen!« rief sie zurück.
»Das Licht wird da draußen schon schlecht.«
Tatsächlich dämmerte es bereits, doch sie war nicht so dumm, wie sie dachten. »Es ist immer noch heller als im Haus.«
»Hier drin können wir mit Blitz fotografieren.«
»Das könnt ihr hier draußen auch.« Sie lächelte. »Entweder hier oder überhaupt nicht, Carl. Es ist mein Geburtstag.« Das Lächeln erstarb. »Du wirst deinem Vater sagen müssen, daß wir hier draußen sind. Wo ist er überhaupt? Ich dachte, er würde beim Holzschuppen herumpusseln, aber ich sehe ihn dort nirgends. Suchst du ihn für mich, Carl?«
Carl verschwand im Haus, aber nur für eine Minute. Als er wieder auftauchte, war er nicht allein. Die Brüder waren bei ihm und die Schwiegertöchter und – pflichtschuldigst hinterhertrottend – die Enkel. Ehe Myra mehr tun konnte, als mit den Händen ihre Frisur zu überprüfen und sich zu vergewissern, daß ihr Kragen ordentlich lag, war sie von der Familie umgeben, die vor ihr kniete, neben ihr saß und hinter ihr stand. In dem Gewühl kam ihr der Gedanke, daß das Fotografieren hier draußen vielleicht doch keine so gute Idee gewesen war, weil das Gras unter der Weide durch die vielen Füße leiden würde, doch sie konnte jetzt schlecht einen Rückzieher machen. Wo war Frank? »Wo ist dein Vater, Carl?« Sie schaute sich fragend um, konnte Frank jedoch nirgends entdecken. »Ich möchte, daß er sich zu mir auf die Bank setzt.« Sie versuchte, die Enkel zu ihrer Linken zusammenzuschieben, doch sie saßen bereits dicht gedrängt. Carl hob die Kamera ans Auge. »Alle hersehen!«
»Wo ist Frank? Wir können nicht ohne ihn anfangen.«
Hinter Myra wurde Gemurmel laut, vor ihr Gekicher. Sie ignorierte beides, setzte sich noch aufrechter hin und die starre Miene auf, die Carl nicht auf einem Foto festhalten wollte. »Ich will Frank dabeihaben«, insistierte sie. »Schließlich gehört er zur Familie.«
»Mach endlich das Foto, Carl.«
»Es wird immer dunkler.«
»Mommy – es hat mich was gestochen!«
»Ich zähle bis drei«, kündigte Carl hinter der Kamera an. Myra beugte sich vor, um nachzuschauen, ob Frank vielleicht am Rand des Teiches durch das Wasser watete. Das tat er manchmal, wenn die Luft warm war.
»Eins ... zwei ... schau her, Mom!«
»Aber dein Vater ...«
Von hinten kam ein sanftes »Myra«, und Lindas Hand legte sich auf ihre Schulter. »Beruhige dich. Er wird schon noch kommen. Was hältst du von einem Lächeln – dann können wir Frank später mit dem Foto überraschen.«
Myra drehte sich um, sah sie unsicher an. »Meinst du?«
»Absolut.«
»Aber vielleicht wird er böse sein, weil wir nicht auf ihn gewartet haben.«
»Er wird nicht böse sein – er wird sich freuen.«
Das wünschte Myra sich mehr als alles andere auf der Welt. Frank Freude zu machen, war von größter Wichtigkeit. Es war der Schlüssel zu ihrem Überleben, das, was sie immer wieder veranlaßte, die schwere Last zurechtzurücken, die sie auf den Schultern trug, was sie immer wieder veranlaßte, sich vom Tod abzuwenden, selbst in Augenblicken, da sie des Kämpfens so müde war, daß sie am liebsten die Augen geschlossen und sich ihm ergeben hätte.
Sie lebte nur für Frank weiter.
»Schau zu Carl!« drängte Linda, und Myra war so durcheinander, daß sie gehorchte.
»Das war’s«, sagte die Stimme hinter der Kamera, und sie war Franks so ähnlich, daß Myra sich vorübergehend entspannte.
»Bei drei sagen alle ›Cheeeese‹. Eins, zwei, drei ...«
Ein kollektives »Cheeeese« erklang, dicht gefolgt von einem Blitz.
Myra lächelte weder, noch stimmte sie in den Chor ein. Es war nicht Frank hinter der Kamera, sondern Carl, und sie war nicht sicher, daß es Frank wirklich nichts ausmachte, übergangen worden zu sein. Wenn er böse wäre, würde er auf Carl losgehen. Aber so funktionierte es nicht. Sie war es, die mit ihm lebte – und sie würde es sein, die darunter zu leiden hätte.
Wieder wurde bis drei gezählt, wieder erklang ein kollektives »Cheeeese«, wieder blitzte es, und dann verzog der Menschenschwarm, der sie unvermittelt überfallen hatte, sich ebenso unvermittelt. Die Hintertür klappte einmal und noch einmal und ein letztes Mal, und dann trat endlich wieder Ruhe ein, und alles war still.
Myra schloß die Augen. Sie ließ den Abendwind den Raum um sie herum reinigen. Dann ließ sie sich, lautlos wie immer, auf die Knie nieder und fing an, das Gras aufzurichten, es mit den Fingern zu kämmen und den Boden zu liebkosen. Dieses Fleckchen Erde war das schönste, das sie kannte. Es war richtig gewesen, die Familienfotos hier zu machen – dieser Platz war der ideale Ort für Zusammenführungen.
KAPITEL 2
Was es unter anderem so schön machte, ein Kind zu haben, waren die Erinnerungen, die es weckte. Durch Jill erinnerte sie sich an Dinge, die andernfalls vergessen geblieben wären – Pyjamapartys mit kichernden Freundinnen, die Angst, keinen Stuhl zu ergattern, wenn die Musik bei der »Reise nach Jerusalem« abbrach, die feuchte Wärme des ersten Kusses. Indem Jill Dinge erlebte, erlebte Emily sie neu.
Und nun erlebte sie das Von-zu-Hause-Weggehen neu. Sie erlebte das hektische Einkaufen und Packen neu, die letzten, tränenreichen Treffen mit Freundinnen, die Furcht vor einer unbekannten Zimmergenossin, die Angst vor schulischem Versagen. Sie erlebte auch die Aufregung neu, denn rückblickend war die Entscheidung, aufs College zu gehen, der Schritt in ihrem Leben gewesen. Gleich in der ersten Woche hatte sie Doug kennengelernt, und sie hatten noch im selben Jahr geheiratet.
Für sie war das eine gute Lösung gewesen, doch für Jill wünschte sie sich mehr. Sie wünschte ihr vier Jahre Studium und Spaß, einen akademischen Grad, Reisen mit Freunden, eine Wohngemeinschaft, einen Job, eine Karriere – und dann die Rückkehr und ein Häuschen in ihrer Nähe.
Sich vorzustellen, daß Jill eines, Tages wiederkommen würde, war ein Mittel gegen die Traurigkeit über ihren Weggang. Ein anderes war Geschäftigkeit, und die praktizierte Emily bereitwillig als Putzfrau, Telefonistin und Köchin von Lieblingsgerichten. Dennoch gab es Augenblicke, da unterbrach Emily ihre jeweilige Tätigkeit, wenn Jill im Zuge ihrer letzten Vorbereitungen ihren Weg kreuzte, um sie zu betrachten, fragte sich, wo die Jahre geblieben waren, und wünschte sie sich zurück. Es war angenehm gewesen zu wissen, wie Jill ihre Zeit verbrachte und mit wem. Sie hatte es genossen, es zu bestimmen.
Jetzt entglitt sie ihr.
Es mußte sein, doch das minderte Emilys Angst nicht. Die Zeit war zu kurz, vier Tage waren wie im Flug vergangen. Früher als für möglich gehalten, saß Emily am Steuer, Jill mit starr geradeaus gerichtetem Blick neben ihr, und hinter ihnen war der Stauraum bis auf den letzten Kubikzentimeter ausgenutzt.
Emily ging im Geiste durch, was sie vergessen haben könnten. »Hast du den Scheck?« Er umfaßte Jills Verdienst dieses Sommers und war als Taschengeld gedacht.
»In der Brieftasche.«
»Und die Quittung über das Schulgeld?« Die müßte sie vorlegen, um den Schlüssel fürs Wohnheim zu bekommen.
»In meiner Tasche.«
»Den Plan vom Campus?«
»Hier.« Sie hielt ihn fest umklammert hoch.
»Vorsicht – zerknitter ihn nicht.«
Jill lockerte ihren Griff.
Als sie Springfield passierten, dachte Emily darüber nach, welche Ratschläge noch von Nutzen sein könnten. Die Zeit wurde schnell knapp. »Vorhänge und einen Teppich müßtest du ganz in der Nähe des Campus bekommen können.«
»Ich weiß – ich habe eine Liste von Geschäften.«
»Geh mit deiner Zimmerkameradin einkaufen.«
»Das werde ich.«
»Lauf nicht allein herum.«
»Ich werde gut zurechtkommen, Mom.«
Sie passierten Worchester. Die Straße war schnurgerade, doch Emilys Magen schlingerte.
»Wehr dich energisch.«
»Was?«
»Wenn ein Junge dich bedrängen sollte. Mach ihm deinen Standpunkt klar. Setz dein Knie ein.«
Jill seufzte vernehmlich.
Als sie die Mautstation von Weston passierten und Boston am Horizont erschien, stieg, überlagert von einem Gefühl der Leere und mit einem Schuß Grauen durchsetzt, innige Liebe in Emily auf. Jill ergriff ihre Hand.
Den Rest der Fahrt sprachen sie kaum noch, hielten sich an den Händen, bis sie nach der Mautstation von Cambridge abbogen – und dann schaltete das Leben auf Zeitraffer. Sie fanden das Wohnheim und entluden den Wagen. Sie lernten Jills Zimmergenossin kennen und die Mädchen auf der anderen Seite des Flurs, am Ende des Flurs und um die Ecke, bezogen das Bett, breiteten Myras Häkeldecke darüber. Sie stellten die Schreibtischlampe auf, den Anrufbeantworter und Jills Computer.
Diese Phase endete abrupt, das Zimmer war so aufgeräumt, wie es wahrscheinlich bis zum Ende des Studienjahres bleiben würde, und es gab nichts mehr zu tun für Emily.
Also setzten sie sich auf Jills Bett, eng nebeneinander, und schauten sich die Fotos an, die Jill mitgenommen hatte – unter anderem eines von Jill und fünf Freundinnen, wie sie lachend im Kreis auf der Party bei den Davies standen, eines von Jill und ihren beiden besten Freundinnen, Marilee und Dawn, eines von denselben drei Mädchen und deren Müttern.
»Das gefällt mir sehr«, bemerkte Emily. Die anderen Mütter, Kay und Celeste, waren ihre beiden besten Freundinnen. Sie hatte einen Abzug der Aufnahme an ihrer Pinnwand in der Küche. »Und das ganz besonders.« Es war eine Montage von fünf von Larrys Fotos, die Emily und Jill in verschiedenen gemeinsamen Posen zeigten.
»Meine Schwester«, scherzte Jill.
»Deine Mutter.«
»Darauf kommen die nie. Denk nur dran, wieviel Arbeit du dir sparst, wenn ich jetzt nicht mehr da bin.«
Emily warf ihr einen Blick zu. »Machst du Witze? Ich werde den nächsten Monat damit zubringen, dein Zimmer aufzuräumen.«
»Laß ja die Finger von meinem Zimmer! Ich will, daß alles noch so ist, wie es war, wenn ich nach Hause komme. Ich räume dann selbst auf. Es sind nur sieben Wochen bis zu den Herbstferien – wenn ich Heimweh kriege, komme ich schon eher. Vielleicht steige ich in den Bus und überrasche dich an einem Wochenende.«
Emilys Kehle wurde eng. Sie war dabei, ihre Tochter zu verlieren. O Gott. »Ich wünsche dir, daß du hier viel Spaß hast, Jill«, sagte ihre vernünftige Hälfte. »Es werden unglaubliche vier Jahre werden – davon bin ich überzeugt.«
»Was ist mit dir, Mom? Wirst du zurechtkommen?«
Emily wurde noch banger ums Herz. Sie legte den Arm um Jill.
»Natürlich.«
»Der Gedanke, daß du allein sein wirst, gefällt mir gar nicht.«
»Dein Vater kommt doch Ende der Woche heim.«
»Ja, für zwei Tage, und dann ist er wieder weg. Kannst du ihn nicht dazu bringen, mehr zu Hause zu sein? Es ist nicht fair, daß er ständig unterwegs ist.«
Emily schluckte ihre Zustimmung hinunter. Ihre Loyalität gegenüber Doug zwang sie zu sagen: »Er muß doch arbeiten. Er würde nicht so viel reisen, wenn es nicht nötig wäre.«
»Ich weiß – aber bis jetzt hattest du wenigstens mich.«
»Ich habe ja noch Kay und Celeste und John und all die anderen Menschen, die ich in der Stadt kenne. Ich habe Myra, die mich für ihr Leben gerne auf einen Schwatz besucht, und wenn ich dein Zimmer nicht aufräumen darf, werde ich mir den Rest des Hauses vornehmen, und wenn ich damit fertig bin, die Zimmer über der Garage.«
»Meine Spielzimmer?« fragte Jill bestürzt.
»Du hast seit Jahren nicht dort gespielt. Der Raum dort oben eignet sich hervorragend als kleine Wohnung.«
»Meine Freundinnen und ich haben ihn geliebt. Darf ich nächsten Sommer dort wohnen?«
»Nicht, wenn jemand anderer für dieses Privileg bezahlt.«
»Du willst ihn wirklich vermieten?«
»Warum denn nicht?«
»Weil er uns gehört.« Genau das hatte Emily zu Doug gesagt, als er den Vorschlag machte. Als habe sie ihren Gedanken gehört, sagte Jill: »Es war Daddys Idee, stimmt’s?«
Emily fragte sich, ob Jill Doug verübelte, daß er sie nicht hierherbegleitet hatte. Viele andere Väter waren mitgekommen.
»Warum glaubst du das?«
»Weil er zu selten da ist, um sich daran zu stören, wenn ein Fremder in unserem Haus lebt.«
»Es geht doch um den Raum über der Garage«, wandte Emily ein, wie Doug es getan hatte, »und die liegt gut zehn Meter vom Haus entfernt, und der Eingang befindet sich sogar auf der hausabgewandten Seite. Wir werden den Mieter gar nicht merken.«
»War es seine Idee?«
»Ich weiß nicht mehr, wessen Idee es war«, log Emily, weil es keine Rolle spielte, wessen Idee es gewesen war. »Jedenfalls ist sie vernünftig. Wir können das Geld gut gebrauchen. Vielleicht kann dein Vater dann mehr zu Hause bleiben.« Sie nahm das letzte Foto in die Hand, auch dieses war eine von Larrys Aufnahmen. Doug saß auf der Treppe vor dem Haus, Emily eine Stufe unter ihm, den Arm um seinen Schenkel, Jill eine Stufe höher, den Arm um seinen Hals gelegt.
Emily hatte den Eindruck, daß sie ihn einengten, mit Gewalt dort festhielten, was angesichts der Tatsache, daß er kurz vor diesem Foto ein weiteres Mal zum Telefon hatte rennen müssen, ganz und gar nicht abwegig war.
»Hübsches Bild«, meinte Emily, doch plötzlich dachte sie nicht mehr an Doug. Sie dachte daran, daß der Augenblick der Trennung bevorstand, daß die letzten Sandkörnchen durch das Stundenglas rannen. Unabänderlich. Sie hörte junge Stimmen auf dem Flur, wußte, daß Jill eigentlich dort draußen sein sollte, nicht mit ihr hier drin. O Gott. »Es wird Zeit«, flüsterte sie, und dann kamen die Tränen, Tränen der Hilflosigkeit und Liebe.
»Sei brav, ja.«
Jill schlang die Arme um ihren Hals und klammerte sich an sie. »Sei brav«, wiederholte Emily mit dem gleichen erstickten Flüstern, »und amüsier dich und lerne, und ruf mich an.«
Jill weinte ebenfalls. Emily spürte die Schluchzer, die ihren Körper erschütterten, und sie zerrissen ihr das Herz, doch gleichzeitig genoß sie die Zuneigung und die enge Verbundenheit, die aus ihnen sprach.
»Ruf mich an«, wiederholte Emily.
»Das werde ich. Du wirst mir fehlen. Ich werde mich um dich sorgen.«
Bestürzt schob Emily sie von sich weg. »Sorgen? Um mich?«
Jill nickte, ging jedoch nicht näher darauf ein, und Emily stand am Rande einer alles ertränkenden Sintflut. Sie wußte, je länger sie bliebe, um so schlimmer würde es werden, und so sprang sie auf, umarmte Jill ein letztes Mal und stürzte aus dem Zimmer. Sie war kaum aus der Tür, als sie wieder kehrtmachte. Das hätte sie nicht tun sollen, denn Jill hatte keine Zeit gehabt, sich zu bewegen. Sie saß allein auf dem Bett, mit verweintem Gesicht, und sah verloren aus.
»O Gott«, flüsterte Emily, und dann sagte sie: »Ich fahre auf direktem Weg nach Grannick zurück, aber ich geh vielleicht noch kurz einkaufen. Solltest du anrufen, ehe ich zu Hause bin, hinterlaß eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter, ich melde mich dann gleich bei dir. So müssen wir das vielleicht noch öfter machen, bis das Semester anfängt und sich die Dinge einspielen.
Ich bin heute abend daheim – aber morgen vormittag nicht: Ich frühstücke mit Kay und Celeste.« Ihre Stimme zitterte bedenklich. »O Gott«, flüsterte sie wieder. Sie lief zum Bett und umarmte Jill ein allerletztes Mal. »Begleitest du mich runter?«
»Geh, Mom.«
»Es war entsetzlich!« klagte Emily in der »Eatery«, selbst zwanzig Stunden danach immer noch aufgewühlt. »Ich habe keine Ahnung, wie ich zum Auto gekommen bin, und dann konnte ich vor lauter Heulen die Straße kaum sehen. Sie sah so allein aus, als sie da auf dem Bett saß.«
Celeste grinste. »Und zwei Minuten, nachdem du gegangen warst, schloß sie draußen auf dem Flur wahrscheinlich schon die ersten Freundschaften und amüsierte sich großartig. Hast du sie gestern abend noch gesprochen?«
Emily suchte in ihren Taschen nach einem Taschentuch. Sie schluchzte.
»Und?«
Sie trocknete sich die Tränen. »Okay, sie hat sich großartig amüsiert. Nette Mädchen, tolle Jungs. Zitat Ende. Wie steht’s bei dir? Hast du von Dawn gehört?«
»Kein Wort, aber das war vereinbart: Sie war unter der Bedingung damit einverstanden, in Grannick aufs College zu gehen, wenn ich so tue, als sei sie weit weg. Ich darf sie nicht anrufen – sie ruft mich an. Und das hat sie bisher nicht getan.«
»Dieses Problem hätte ich gerne«, meinte Kay, fing den Blick der Bedienung ein und deutete auf ihre Kaffeetasse. »Am ersten Tag kamen drei Anrufe, gestern zwei. In Büchern steht, daß das normal sei. Was nicht drinsteht, sind die Kosten. Vor Studiengebühren, Ausgaben für Kost und Logis und Schulbücher war ich gewarnt, doch nirgendwo waren die Telefonrechnungen erwähnt. Ich werde sie heimlich bezahlen müssen – wenn John sie sähe, ginge er durch die Decke. Er findet noch immer, sie hätte auf die Universität von Massachusetts gehen sollen.«
»Ach was«, sagte Emily. »John kann grummeln, soviel er will – ich kaufe es ihm nicht ab.« Sie war schon mit ihm befreundet gewesen, bevor Kay in ihr Leben trat, und seitdem mit beiden eng verbunden. »Er ist unheimlich stolz, daß sie in Washington ist. Wart’s ab – er wird sich auf die Anrufe freuen.«
»Dreimal täglich?« fragte Kay und hielt ungeduldig Ausschau nach der Bedienung. »Ich brauche Koffein! Ihr wißt, daß ich zu dieser nachtschlafenden Zeit niemals hier wäre, wenn ich euch Mädels nicht so lieben würde, oder?«
Emily wußte um diese Liebe. Die Montagstreffen mit Kay und Celeste, ohne Ehepartner und Kinder, hatten therapeutischen Wert. Den Sommer über hatten sie sich zum Frühstück getroffen und würden wieder auf Abendessen umsteigen, sobald Kay, die in der achten Klasse Englisch unterrichtete, wieder arbeiten müßte. »Wann fängt die Schule an?«
»Donnerstag. Ah, da kommt sie ja.« Sie hielt der Bedienung mit einem dankbaren Lächeln ihre Tasse hin und bestellte dann mit der Begründung, sich vor Schulbeginn noch einmal einen besonderen Luxus leisten zu wollen, ein ausgiebiges Frühstück. Emily und Celeste orderten bescheidener.
Celeste schaute der Kellnerin nach. »Es kommt mir vor, als wäre es erst gestern gewesen, daß unsere Kinder die Bestellungen entgegennahmen.«
Emily wußte, was sie meinte. »Viel länger ist es nicht her.«
»Es ist merkwürdig, in einem leeren Haus aufzuwachen. Ich schaue immer wieder in Dawns Zimmer, um mich zu vergewissern, daß sie tatsächlich weg ist.«
»Vermißt du sie?« Emily wollte hören, daß sie nicht die einzige war, die eine so schreckliche Leere in sich fühlte.
»Sie ist doch gerade erst abgereist.«
»Marilee auch«, sagte Kay, »aber trotzdem vermisse ich sie. Wir waren schon öfter getrennt, und auch schon für länger als zwei Tage, aber mit dem College ist es irgendwie anders. Bedeutungsvoll.«
Das erschien Emily einleuchtend.
»Aber es war allmählich Zeit«, bekannte Celeste ihre Einstellung offen. »Ich hatte seit ihrer Geburt allein die Verantwortung für sie, was angenehm ist, wenn man bedenkt, daß ich mich all diese Jahre nicht mit ihrem Vater auseinandersetzen mußte, aber nicht so angenehm, wenn man die ganze Arbeit bedenkt. Ich war diejenige, die sie mit Engelszungen, Penetranz und Bestechung dazu bringen mußte, zu lernen. Das ist die Schattenseite des Alleinerziehens.«
Kay sprach aus, was Emily in diesem Augenblick dachte: »Das ist die Schattenseite des Mutterseins.«
»Tja – vermisse ich sie?« überlegte Celeste laut. »Gefühlsmäßig, ja – praktisch gesehen, nein. Ich bin erleichtert, weil ich sie da hingebracht habe, wo sie jetzt ist, und jemand anderer sich die Verantwortung mit mir teilt.«
»Wer?« fragte Emily, begierig nach einer Ermutigung. Wenn sie daran dachte, daß Jill ganz allein in Boston war, wurde ihr ganz mulmig.
»Wer auch immer – das College, der Vertrauenslehrer, der Rektor. Sie selbst. Sie muß jetzt auch eine gewisse Verantwortung für ihr Leben übernehmen. Endlich.«
»Meinst du, sie wird zurechtkommen?« fragte Kay, und das aus gutem Grund. Von den drei Mädchen war Dawn sowohl die gescheiteste als auch die impulsivste. Mehr als einmal hatten Jill und Marilee sie davon abgehalten, etwas zu tun, das sie später bereut hätte.
Emily hoffte, sie würde neue Freunde finden, die sie in der gleichen Weise vor sich selbst beschützten. In dieser Hinsicht sorgte Emily sich sogar um Jill, die ungeheuer vernünftig war. Jill brauchte Freunde wie die Luft zum Atmen, und in ihrem Bestreben, sich auf dem College in eine Gruppe einzugliedern, machte sie vielleicht einen Fehler. Vielleicht hatten die Mädchen auf ihrem Stockwerk, die alle einen so netten Eindruck machten, nur darauf gewartet, daß ihre Eltern abfuhren, um ihre wahren Gesichter zu zeigen. Vielleicht würden sie sich jeden Abend betrinken, ihre Haare absengen und Koks schnupfen. Und man konnte davon ausgehen, daß die Jungen gepflegt, höflich und durch und durch lüstern waren. Außerdem war es hinlänglich bekannt, daß Cafeterias ein beliebter Tummelplatz für Serienmörder waren.
Celeste schien sich keinerlei Sorgen zu machen. »Natürlich wird sie zurechtkommen. Sie weiß, was ich von ihr erwarte – ich habe es ihr weiß Gott gründlich genug eingetrichtert. Wißt ihr was? Plötzlich meldet ihr Vater Protest an. Ist das nicht ein Hammer? Nach all den Jahren nimmt der Schatten Form an. Sie hat seine Intelligenz geerbt, und jetzt bekommt er die Rechnung. Als er damals, um mich möglichst schnell loszuwerden, einwilligte, das College zu bezahlen, war ihm nicht klar, wieviel das kosten würde.«
»Das war uns allen nicht klar«, sagte Emily. »Es ist nicht einfach.«
Celeste warf ihr einen befremdeten Blick zu. »Doug verdient doch gut.«
»Gut verdienen reicht kaum für die Studiengebühren.«
»Aber er ist sein eigener Chef. Er vermarktet seinen Verstand und seine Arbeitskraft von zu Hause aus. Er hat keine nennenswerten Betriebskosten.«
»Aber sehr hohe Reisekosten.«
Celeste blieb skeptisch. »Wenn man ihn so sieht, käme man nicht darauf, daß er rechnen muß – neulich sah er wieder aus wie aus dem Modejournal.«
»Er legt großen Wert darauf, schick angezogen zu sein«, gab Emily zu. »Und darauf, einen schönen Wagen zu fahren. Aber er spielt nicht, und er kommt nicht mit Lippenstift am Kragen nach Hause.«
»Er kommt überhaupt nicht nach Hause.«
»Sicher tut er das. Er ist fast jedes Wochenende da.«
»Wird er jetzt, da ihr allein seid, mehr zu Hause sein?« fragte Kay.
»Wie könnte er das angesichts von Jills Rechnungen? Er muß jetzt härter arbeiten als je zuvor.«
Celeste stieß einen ungeduldigen Laut aus. »Leidest du nicht darunter, daß du so wenig von ihm hast? Ich bekomme zumindest jeden Monat Unterhalt, einen Scheck, an dem ich mir die kalten Hände wärmen kann.«
Ja, Emily litt darunter. Vor Äonen waren sie und Doug unzertrennlich gewesen. Doch es brachte nichts, in Vergangenem zu schwelgen. »So schlimm ist es nicht«, antwortete sie. Sie gähnte, streckte sich, stützte dann die Ellbogen auf den Tisch und grinste. »Ich habe das Bad ganz für mich allein. Außerdem wird jetzt, da Jill weg ist, alles anders. Zum erstenmal seit Jahren werden Doug und ich ohne Kind sein – wir können die Wochenenden nutzen, wofür wir wollen, Spaß haben wie in den alten Zeiten, nur wir beide.« Die Aussicht darauf gab ihr Hoffnung.
Kay seufzte. »Ich bin neidisch: John hat keinen Sinn für Spaß.«
»John ist ein wunderbarer Mann«, protestierte Emily.
»Er ist Polizist – sein Leben ist eine einzige, lange Nachforschung.«
»Er ist anständig, aufrecht und ehrlich.«
»O ja«, nickte Kay. »Und er ist überbesorgt, wittert überall Unrat. Warum, glaubst du, vergrabe ich mich so in meiner Arbeit? Wenn ich nur die Hälfte dessen, was er sagt, beherzigen würde, wäre ich reif für die Klapsmühle. Und jetzt habe ich nicht einmal mehr Marilee zur Ablenkung. Ich würde eingehen ohne Job!« Sie fixierte Emily. »Du brauchst auch einen.«
»Doug will nicht, daß ich arbeite.«
»Wenn er eh nicht da ist, kann es ihm doch egal sein«, meinte Celeste. »Wenn er nicht da ist, kannst du tun, was du willst.«
»Aber ich respektiere seine Gefühle. Wir haben darüber gesprochen, ich habe es angeboten, aber er hat nein gesagt. Sein Stolz läßt es nicht zu.«
»Stolz? Ha! Er fühlt sich bedroht.«
Emily lachte. »Das tut er nicht.«
»Er befürchtet, du könntest ihn in den Schatten stellen. Immerhin hast du das schon einmal getan – mit dem Buch.«
»Nein, das stimmt nicht. Ich habe das Buch John zuliebe geschrieben – es sollte nie was Großes werden.«
»Du hast ein Buch geschrieben«, insistierte Celeste, »und es wurde veröffentlicht. Das ist eine ungeheure Leistung.«