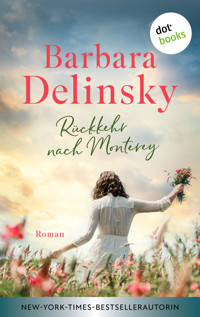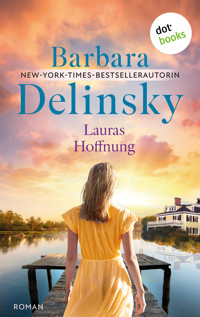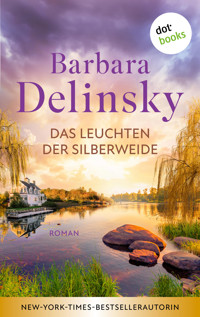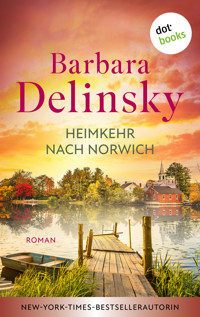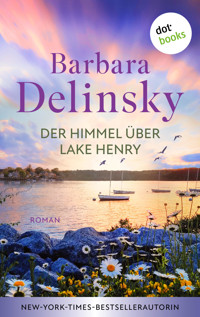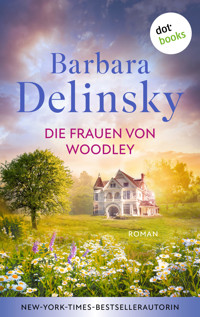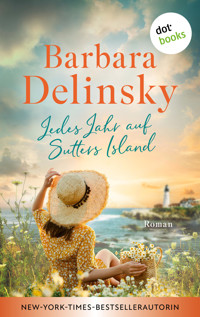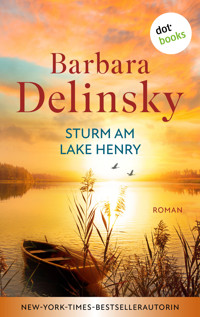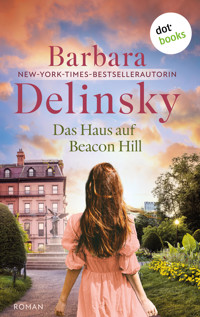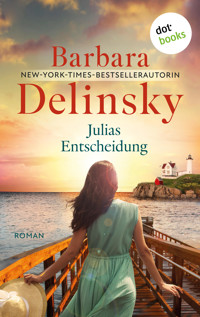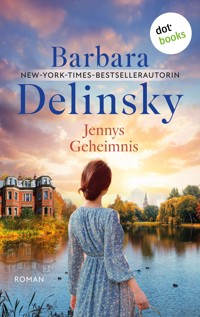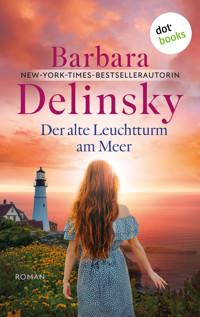
5,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Stets die perfekte Hausfrau und Mutter – und dennoch hat Claire es geschafft, sich im Schatten ihres Mannes mit Kreativität und Leidenschaft ein eigenes kleines Unternehmen aufzubauen. Aber dann zerbricht ein einziges Wort Claires ganze Welt: Scheidung. Sie soll das Sorgerechte für die beiden Kinder abgeben und Alimente zahlen – gegen die Schmutzkampagne von Dennis’ Anwalt scheint sie keine Chance zu haben. Nur Claires alter Jugendfreund Brody steht ihr bei. Er ist der Einzige, der sie nicht für verrückt hält, als sie in einen alten Leuchtturm an der Küste von New Hampshire zieht und beschließt, noch einmal ganz von vorn anzufangen – und wie eine Löwin um ihre Kinder zu kämpfen … »Wenn es um Gefühle geht, ist Barbara Delinsky unübertroffen.« Romantic Times Magazine
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 540
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch:
Stets die perfekte Hausfrau und Mutter – und dennoch hat Claire es geschafft, sich im Schatten ihres Mannes mit Kreativität und Leidenschaft ein eigenes kleines Unternehmen aufzubauen. Aber dann zerbricht ein einziges Wort Claires ganze Welt: Scheidung. Sie soll das Sorgerechte für die beiden Kinder abgeben und Alimente zahlen – gegen die Schmutzkampagne von Dennis’ Anwalt scheint sie keine Chance zu haben. Nur Claires alter Jugendfreund Brody steht ihr bei. Er ist der Einzige, der sie nicht für verrückt hält, als sie in einen alten Leuchtturm an der Küste von New Hampshire zieht und beschließt, noch einmal ganz von vorn anzufangen – und wie eine Löwin um ihre Kinder zu kämpfen …
Über die Autorin:
Barbara Delinsky wurde 1945 in Boston geboren und studierte dort Psychologie und Soziologie. Nach der Geburt ihres ersten Sohnes arbeitete sie als Fotografin für den Belmont Herald, erkannte aber bald, dass sie viel lieber die Texte zu ihren Fotos schrieb. Ihr Debütroman wurde auf Anhieb zu einem großen Erfolg. Inzwischen hat Barbara Delinsky über 70 Romane veröffentlicht, die in mehr als 20 Sprachen übersetzt wurden und regelmäßig die New–York–Times–Bestsellerliste stürmen. Sie engagiert sich außerdem sehr stark für Wohltätigkeitsvereine und Aufklärung rund um das Thema Brustkrebs. Barbara Delinsky lebt mit ihrem Mann in New England und hat drei erwachsene Söhne.
Die Website der Autorin: barbaradelinsky.com/
Bei dotbooks veröffentlichte Barbara Delinsky auch ihre Romane:
»Die Schwestern von Star’s End«
»Jennys Geheimnis«
»Das Weingut am Meer«
»Julias Entscheidung«
»Lauras Hoffnung«
»Die alte Mühle am Fluss«
»Sturm am Lake Henry«, Die Blake–Schwestern 1
»Der Himmel über Lake Henry«, Die Blake–Schwestern 2
»Heimkehr nach Norwich«
»Das Leuchten der Silberweide«
»Das Licht auf den Wellen«
»Die Frauen Woodley«
»Ein Neuanfang in Casco Bay«
»Im Schatten meiner Schwester«
»Rückkehr nach Monterey«
»Drei Wünsche hast du frei«
»Ein ganzes Leben zwischen uns«
»Jedes Jahr auf Sutters Island«
»Was wir nie vergessen können«
***
eBook–Neuausgabe Mai 2024
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1997 unter dem Originaltitel »A Woman’s Place« bei Headline Book Publishing, London. Die deutsche Erstausgabe erschien 1999 unter dem Titel »Der Platz einer Frau« bei Droemer Knaur.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1997 by Barbara Delinsky
Published by Arrangement with Barbara Delinsky.
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1999 der deutschsprachigen Ausgabe bei Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München.
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook–Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98690-627-6
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Der alte Leuchtturm am Meer« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Barbara Delinsky
Der alte Leuchtturm am Meer
Roman
Aus dem Amerikanischen von Georgia Sommerfeld
dotbooks.
KAPITEL 1
Wäre ich ein abergläubischer Mensch gewesen, hätte ich den Gestank als böses Omen gewertet. Ich hatte mir gewünscht, daß unsere Abreise glatt über die Bühne ginge, und jetzt wurde es allmählich ernst. Das letzte, was ich brauchen könnte, wäre ein verärgerter Dennis.
Aber ich war eine vertrauensvolle Seele. Als ich an jenem Freitagmorgen im Oktober die Küche betrat, beschlich mich keinerlei böse Vorahnung – ich merkte lediglich, daß irgend etwas schlecht geworden war. Ein ekelhafter Geruch überlagerte den frischen Herbstduft, der aus dem Garten hereinwehte, und nahm den weinroten Kerzen auf der gläsernen Tischplatte und dem Korb frischgepflückter Äpfel dazwischen den Charme.
Roch vielleicht das Einwickelpapier des Kabeljaus, den es gestern abend gegeben hatte, unter dem Spülbecken? Nein, der Deckel des Mülleimers war fest geschlossen, und die Luft in dem Schrank einwandfrei. Desgleichen im Backofen. Auch als ich den Kühlschrank öffnete, schlug mir kein Gestank entgegen, doch ich überprüfte sicherheitshalber trotzdem die Milch, die meine Tochter oft zu lange draußen stehen ließ, das Hühnchen, das ich für Dennis vorgebraten hatte, und die Käsedose, in der sich unter Plastikfolie vielleicht etwas Pelziges, Blaues verbarg.
Doch der Gestank war nach wie vor da, widerlich und intensiv, eine weiterer Stolperstein in einer mit Stolpersteinen gespickten Woche. Als berufstätige Ehefrau und Mutter zweier Kinder auch nur zwei Tage zu verreisen, erforderte jedesmal generalstabsmäßige Vorbereitungen, doch diesmal würde ich elf Tage weg sein, und das teilweise in einer Mission, vor der mir graute. Meine Mutter lag im Sterben, und mein inneres Gleichgewicht war auch ohne unerklärliche Geruchsbelästigungen angeschlagen genug.
Nachdem ich die naheliegenden Quellen ausgeschlossen hatte, begann ich mich gerade zu fragen, ob vielleicht unter den zweihundert Jahre alten Dielenbrettern des Hauses etwas vor sich hin zu faulen begonnen hatte, als mein Sohn auf Strümpfen hereingetappt kam. Er sah ernster aus, als ein Neunjähriger mit zerzausten Haaren in einem echten Red-Sox-Baseball-Shirt und kampferprobten Jeans es sollte, doch er war von Natur aus ein ernstes Kind – und hellwach. Ich hatte mich zwar nach Kräften bemüht, den Grund für unsere Reise zu bagatellisieren, doch ich vermutete, daß er Bescheid wußte. »Ich kann meine Turnschuhe nicht finden, Mom. In meinem Zimmer sind sie nicht, und wenn ich sie nicht finde, dann weiß ich nicht, was für welche ich zu Grandma anziehen soll – sie waren meine besten.«
»Sehr richtig, sie waren es.« Ich legte meine Arme auf seine Schultern. Er reichte mir bis zur Brust. »Ich mußte gestern abend Schlamm von den Sohlen abkratzen. Was hast du dir nur dabei gedacht, Johnny? Wir waren uns doch einig, daß du zum Football keine guten Schuhe anziehen würdest.«
»Wir haben Basketball gespielt. Jordans Vater hat einen Korb aufgehängt, aber es ist noch nichts gepflastert.« Er schnitt eine Grimasse. »Puhhh! Was stinkt denn hier so?«
Ich ließ einen verzweifelten Blick durch die Küche wandern. »Gute Frage! Hast du eine Idee?«
»Frag nicht mich, frag Kikit. Die läßt doch immer alles rumliegen. Bist du sicher, daß ich zum Training am Dienstag zurück bin?«
»Die Maschine landet um eins. Training ist erst um fünf.«
»Wenn ich es versäume, muß ich auf die Ersatzbank.«
Ich nahm sein Gesicht in die Hände. Seine Wangen waren noch weich, hatten ihre kindliche Rundlichkeit jedoch bereits verloren. »Du könntest das Training höchstens versäumen, wenn der Flug aus irgendeinem Grund verschoben würde, und in dem Fall würden Daddy oder ich mit dem Mann reden ...«
»Es ist eine feste Regel«, fiel Johnny mir ins Wort und trat einen Schritt zurück. »Ohne Training darf man nicht mitspielen. Wo sind meine Schuhe?«
»Auf dem Treppenabsatz in der Garage.« Er trabte los. »Willst du was essen?« rief ich ihm nach. »Brody kommt in einer Dreiviertelstunde. Im Flugzeug bekommen wir zwar etwas, aber ich kann nicht garantieren, daß es dir schmecken wird.« Keine Antwort. Er war schon durch den Vorraum und in der Garage. Ich rief die Treppe hinauf nach meiner Jüngsten.
»Kikit?«
»Sie hat es sich wieder anders überlegt und verfrachtet ihre Menagerie aus ihrem ins Arbeitszimmer«, verkündete mein Mann und warf die Morgenausgabe des GLOBE, abgesehen vom Wirtschaftsteil, auf den Tisch. »Ich habe noch nie so viele ausgestopfte Viecher auf einem Haufen gesehen. Braucht sie die wirklich alle?« Er zog prüfend die Luft durch die Nase ein und verzog das Gesicht. »Was ist das denn?«
Aus Dennis’ Mund war diese Frage besonders unangenehm für mich, denn im Rahmen der Pflichtenaufteilung in unserer Ehe war ich für alles verantwortlich, was das Haus betraf.
Aber ich hatte jetzt einfach nicht die Zeit, noch weiter zu suchen. »Vielleicht ist es eine Ratte. Der Kammerjäger mußte ein paar der Fallen im Keller mit neuen Ködern versehen, was bedeutet, daß etwas von dem Gift gefressen worden ist, was wiederum bedeuten kann, daß es eines der Tiere nicht mehr nach draußen geschafft hat.«
Johnny stürmte mit einem inbrünstigen »Eklig!« durch die Küche.
Seine Schuhe hinterließen eine Spur getrockneter Schlammbröckchen, aber ich hatte auch keine Zeit mehr, sie aufzufegen.
»Eier, Dennis?«
»Vielleicht. Ich weiß nicht. Erst mal Kaffee.« Er setzte sich mit dem Wirtschaftsteil an den Tisch.
Ich schaltete die Kaffeemaschine ein und sagte, die Stimme in mir ignorierend, die mich hektisch zur Eile antrieb, in sanftem Ton: »Willst du nun Eier oder nicht? Ich habe nur noch vierzig Minuten, um mich fertigzumachen und zu packen.«
»Was ist mit dem Gestank – den kann ich unmöglich elf Tage ertragen!«
»Vielleicht geht er ja von selbst weg«, meinte ich hoffnungsvoll. »Falls nicht, mußt du den Kammerjäger anrufen. Die Nummer hängt an der Pinnwand.«
»Aber ich bin doch nicht da, wer soll ihn denn reinlassen? Ich fahre gleich nach euch los, um mich in den Berkshires mit der Ferguson-Gruppe zu treffen. Darum kann ich euch ja nicht zum Flughafen bringen.« Er warf mir einen tadelnden Blick zu. »Ich kann es nicht fassen, daß du nicht in der Lage warst, den Zubringerdienst zu organisieren.«
»Ich bin nicht schuld, daß es nicht geklappt hat. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Ich habe die Fahrt zum Flughafen schon vor zwei Wochen gebucht und eine Bestätigungsnummer bekommen, die es beweist. Sie behaupten, ich hätte den Auftrag letzte Woche telefonisch storniert, aber das habe ich natürlich nicht getan. Wenn ich nicht noch mal dort angerufen hätte, um sicherheitshalber nachzufragen, ob es klargehe, hätten wir dagesessen. Ein Glück, daß Brody uns hinbringen kann. Und was den Geruch angeht«, ich versuchte, ruhig zu bleiben, »ruf den Kammerjäger doch einfach an, wenn du wieder da bist. Eine andere Lösung fällt mir nicht ein, Dennis. Es ist ein durch den Feiertag verlängertes Wochenende, und alle Flüge sind ausgebucht. Wir bekämen keine Plätze in einer späteren Maschine.« Ich hätte gerne noch hinzugefügt, daß er in Anbetracht meiner wegen des Zustandes meiner Mutter reichlich angeschlagenen Psyche ruhig ein wenig Rücksicht auf mich nehmen könnte, aber er hatte sich immerhin bereit erklärt, die Kinder zu versorgen, damit ich nach Cleveland noch eine Arbeitswoche dranhängen könnte, und so verkniff ich es mir. Ich war nicht undankbar – meine Nerven waren nur ein wenig ausgefranst. Und es wurde immer später.
Ich nahm gerade den Eierbehälter aus dem Kühlschrank, als hinter mir Hüpfgeräusche laut wurden und Clara Kate mit ihrer siebenjährigen Stimme sagte: »Ich nehme Travis, Michael und Joy mit, okay, Mommy?« Ich drehte mich zu ihr um, und sie schaute, ihre Wange an meine Taille schmiegend, mit ihrem Engelsgesicht, das von einer durch Haarspangen nur mangelhaft gebändigten Masse kastanienbrauner Locken eingerahmt wurde, zu mir auf. Meine Haare hatten die gleiche Farbe, doch die Locken waren schon vor langer Zeit Schere und Fön zum Opfer gefallen.
Ich legte den Arm um ihren Hals und drückte sie an mich, während ich Eier verrührte. »Ich dachte, wir hätten uns geeinigt, daß du nur zwei mitnehmen würdest.«
Ihre Wange streifte meinen Arm. »Das wollte ich ja auch, aber wen soll ich hierlassen? Ich bin die einzige, die weiß, von welchem Essen Travis übel wird, und Michael hat Alpträume, wenn er nicht bei mir ist, und Joy würde die ganze Zeit weinen, weil sie immer zusammen sind, die drei. Außerdem möchte ich, daß sie Tantchen Rona kennenlernen, und Grandma freut sich bestimmt, wenn sie sie sieht. Wie ist es denn in ihrem Krankenhaus?«
»Ich weiß nicht – ich war noch nicht dort.«
Sie drehte ihre kleine Hand mit gespreizten Fingern hin und her. »Ist es blankgeputzt und laut wie bei mir damals?«
»Nur auf der Station, wo kleine Mädchen behandelt werden, die allergisch auf bestimmte Lebensmittel reagieren. Grandmas Station wird blankgeputzt und ruhig sein.«
»Schläft sie?«
»Nicht die ganze Zeit.«
»Nur manchmal?«
»Ziemlich viel, aber bestimmt nicht, wenn ihr da seid. Da wird sie keine Minute versäumen wollen.«
»Kann sie reden?«
»Natürlich kann sie das.«
»Nicht, wenn sie Schläuche im Hals hat. Hat sie Schläuche im Hals?«
»Nein, Schätzchen.« Ich riß einen Beutel mit geriebenem Cheddar auf und hielt ihn ihr hin.
Sie nahm sich eine Handvoll. »Hat sie Schläuche in der Nase?«
»Nein. Das habe ich dir doch gestern abend schon gesagt.«
»Nun, manchmal ändern sich Dinge ja«, meinte sie altklug, führte die Faust zum Mund und duckte sich kauend unter meinem Arm hervor. »Warum kommst du nicht mit, Daddy?«
»Das weißt du doch«, antwortete er hinter seiner Zeitung.
»Ich muß arbeiten.«
»Wenn du arbeiten mußt«, sie kletterte auf einen Stuhl und von dort auf den Tisch, setzte sich auf die Kante und ließ die Beine baumeln, »warum hast du dann deine Golfschläger in den Kofferraum getan?«
Ich mischte Cheddar unter die Eier – aber sehr leise.
»Weil ich«, sagte Dennis, »nach der Arbeit Golf spiele.« Das »nach« betonte er.
»Wir schwänzen Schule, um Grandma zu besuchen. Ich finde, du solltest auch schwänzen und mitkommen.«
»Ich war doch im August dabei.«
Ihre Beine schabten an der Zeitung entlang. »Wann darf sie denn wieder aus dem Krankenhaus?«
»Ich weiß nicht.«
»Überhaupt noch mal?«
»Großer Gott, Kikit!« Er lachte gepreßt und legte mit lautem Geraschel die Zeitung beiseite. »Ich kann nicht lesen, wenn du dauernd gegen die Zeitung stößt. Du verstreust überall Käse. Geh vom Tisch runter!«
»Holst du uns am Dienstag vom Flugplatz ab?«
»Ja.«
»Aber der ist so riesig, wie willst du da wissen, wohin du mußt?«
»Ich werde es schon herausfinden. Runter vom Tisch!« kommandierte er und schlug augenblicklich wieder die Zeitung auf, als sie gehorchte.
»Er wird euch abholen«, rief ich ihr beruhigend nach, als sie aus der Küche hüpfte. Ich goß die Eier-Käse-Mischung in eine fettbrutzelnde Pfanne, drückte die Toasttaste nach unten und griff mir einen Teller. »Die Angaben zu dem Flug hängen an der Pinnwand«, erklärte ich Dennis, »und es ist auch die Nummer dabei, unter der du erfahren kannst, ob die Maschine pünktlich landet. Außerdem habe ich dir die Cleveland-Nummern hingehängt und den Plan, wann die Kinder nach ihrer Rückkehr wo sein müssen, samt den Telefonnummern der Fahrgemeinschaften.«
Die Zeitung wurde wieder weggelegt, die Stuhlbeine schabten über den Boden. Dennis stand auf, ging zu der Pinnwand hinüber, die neben dem Telefon hing, studierte die Notizen und stieß einen Grunzlaut aus.
»Was ist?« fragte ich.
»Was soll sein? Immer dasselbe, immer dasselbe. Wir brauchen ein Kindermädchen.«
»Wir hatten ein Kindermädchen. Die Gute belegte das Telefon mit Beschlag, fuhr wie ein Irre und schmierte Kikit, obwohl ich ihr tausendmal sagte, daß die Folgen katastrophal seien, stur Erdnußbutter aufs Brot.«
»Sie war Französin. Französische Kindermädchen sind leichtfertig. Wir brauchen ein schwedisches Kindermädchen. Ich weiß, ich weiß – du sagst, wir seien ohne besser dran, aber« – er bedachte die Pinnwand mit einer ungeduldigen Handbewegung – »diese Fahrgemeinschaften sind ein schlechter Witz, und die vielen Termine der Kinder sind sogar ein Problem, wenn du da bist. Erinnerst du dich noch an letzte Woche?«
Wie könnte ich das vergessen? Ich hatte Kikit und ihre Freundinnen nach dem Ballettunterricht eine geschlagene Stunde warten lassen, als im Laden in Essex, wo ich zu dieser Zeit gerade arbeitete, der Strom ausfiel und die Uhren stehenblieben. Ich hatte ein schauerlich schlechtes Gewissen gehabt.
»Warum hast du nicht auf deine Armbanduhr geschaut?« fragte er zum x-ten Mal.
»Weil ich vollauf mit dem Versuch beschäftigt war, die Computer wieder auf die Reihe zu kriegen.«
»Du bist überfordert«, meinte der eingefleischte Pessimist.
»Bin ich nicht«, widersprach die eingefleischte Optimistin.
»Solange du mir hilfst, komme ich bestens zurecht.«
»Es wäre bedeutend einfacher, jemanden zu engagieren, der die Kinder herumkutschiert.«
»Das würden sie nicht wollen.« Ich verrührte die Eier. »Sie wollen, daß wir das tun. Ich will, daß wir es tun. Außerdem haben wir für Notfälle einen Sitter: Mrs. Gimble.«
»Die hat doch gar keinen Führerschein.« Dennis war zu seiner Zeitung zurückgekehrt.
»Sie wohnt zwei Häuser weiter und liebt die Kinder. Dennis?« Ich wartete, bis er mich ansah. »Du gehst doch am Samstag zu Johnnys Spiel, oder?«
»Wenn ich kann.«
Natürlich konnte er – die Frage war, ob er wollte. »Es würde ihm das Herz brechen, wenn du nicht kämst.«
»Wenn mir etwas dazwischenkommt, dann geht es eben nicht. Ich habe eine Firma zu leiten, Claire.«
Auch das hätte ich nicht vergessen können – dazu erinnerte er mich zu oft daran. Und ich könnte auch nicht ins Feld führen, daß seine Firma nur noch ein Schatten ihrer selbst war und ihm genügend Zeit für Vaterpflichten bliebe, wenn er sich entschlösse, sie wahrzunehmen, denn damit würde ich ihn in die Defensive drängen. Das wußte ich aus Erfahrung, und ich würde mich hüten, ein zweites Mal in dieser Richtung zu argumentieren. Ich mußte einfach nur wissen, daß Dennis den Kindern in meiner Abwesenheit seine volle Aufmerksamkeit widmen würde.
»Wie groß ist die Ferguson-Gruppe?«
»Das ist unterschiedlich.«
Die Eier waren fast fertig. »Und was machen die genau?«
»Plastik-Kram.«
Ich gab den Eiern den letzten Schliff. »Für den Haushalt?« Der Grunzlaut, mit dem er mir antwortete, konnte ebenso ja wie nein heißen.
Der Toast sprang hoch. Ich bestrich beide Scheiben mit Butter, schnitt sie diagonal durch, arrangierte die Hälften am Tellerrand, häufte die Eier in der Mitte auf und schob den Teller in den Spalt zwischen Zeitung und Dennis. Dann machte ich mich ans Abspülen der Pfanne.
»Das Spiel findet am Samstagvormittag um zehn statt. Bitte leg deine geschäftlichen Termine entsprechend – einer von uns muß Johnny spielen sehen, und es tut ihm besonders gut, wenn du das bist. Er war todunglücklich, als du seinen Touchdown letzte Woche nicht miterlebtest. Er ist überzeugt, daß er nie wieder einen schaffen wird. Aber selbst wenn es so ist – er muß das Gefühl haben, daß du ihn spielen sehen willst.«
»Ich habe gesagt, ich werde es versuchen«, erwiderte Dennis in warnendem Ton, »aber wenn mir Arbeit dazwischenkommt, versäume ich vielleicht die erste Halbzeit. Was stinkt hier bloß so?« Er schob die Zeitung mit lautem Geraschel zu einem Haufen zusammen und mit einem Ruck seinen Stuhl zurück, sprang auf und begann, Schranktüren aufzureißen und zuzuknallen. »Du warst in letzter Zeit mit deinen Gedanken überall, nur nicht hier. Du mußt irgendwas an den falschen Platz gelegt haben.«
Das war zwar möglich, aber ich glaubte nicht, daß er in den Schränken etwas finden würde – sie waren erst vor ein paar Tagen gründlich saubergemacht worden.
»Hier«, sagte er angewidert. »Schmeiß das weg.«
Eine stinkende Tüte landete im Spülbecken. Sie enthielt eine halbe, verfaulte Zwiebel. Ich hatte keine Ahnung, wie sie in dem Schrank mit den ordentlich zusammengefalteten Einkaufstüten gelandet war, aber als ich Dennis fragend ansah, wich er vor dem üblen Geruch zurück und ließ sich wieder am Tisch nieder, um weiter zu frühstücken.
Ich versenkte die Zwiebel im Mülleimer, griff mir das Luftspray und drückte auf den Sprühknopf. »Alle Achtung«, lobte ich in heiterem Ton, »du bist ein sehr viel besserer Detektiv als ich.«
Er warf mir einen ärgerlichen Blick zu und befaßte sich dann wieder mit dem Börsenbericht.
Eine halbe Stunde später kam Brody. Er nahm sich eine Tasse Kaffee und fachsimpelte mit Dennis, während ich unsere Taschen fertigpackte, die Betten machte und in eine Kombination aus weichfallenden, grauen Hosen, elfenbeinfarbener Weste und aprikotfarbenem Blazer schlüpfte, die ideal für die an Cleveland anschließende Arbeitswoche wäre. Und meine Mutter würde begeistert davon sein. Sie liebte schöne Kleider, spürte sie gerne auf der Haut und sah ihre Töchter gerne darin, und das war nur zu verständlich: Sie hatte harte Zeiten durchgemacht und war froh, daß sie der Vergangenheit angehörten.
Das Gepäck wurde eingeladen, Dennis geküßt und umarmt, und dann winkte er uns von der Veranda unseres georgianischen Hauses am Cape Cod hinterher, das überhaupt nicht am Cape stand, sondern in einem kleinen Ort nördlich von Goucester. Wir fädelten uns in den Pendlerverkehr Richtung Boston ein.
Ich lehnte mich auf dem Beifahrersitz von Brodys Range Rover zurück und atmete hörbar aus.
»Geschafft?« fragte er leise.
Ich lächelte und schüttelte den Kopf, minderte das Kopfschütteln jedoch mit einer Geste wieder ab. Ja, ich war geschafft. Und voller Sorge. Und in diesem Moment erleichtert, Dennis »hinter mir zu haben«. Er haßte meine Reisen, betrachtete sie, trotz all meiner Bemühungen, die dadurch entstehenden Unbequemlichkeiten zu minimieren, als Belastung für unser aller Leben. Wobei er diesmal erstaunlich handzahm gewesen war, eher verdrießlich als aggressiv. Vielleicht wurde er allmählich nachgiebiger. Oder der Zustand meiner Mutter ging ihm nahe. Wie auch immer – es hatte keine größeren Explosionen gegeben.
Jetzt, mit Brody am Steuer, konnte ich für die Stunde, die wir zum Flughafen brauchen würden, eine Verantwortungspause einlegen. »Es ist so lieb von dir, daß du uns fährst«, sagte ich. Mit seinen hellbraunen Haaren, den etwas dunkleren, noch leicht verschlafenen Augen hinter der randlosen Brille und seiner lockeren, entspannten Art war er ebenso erholsam fürs Auge wie für die Seele.
»Es ist mir ein Vergnügen«, erwiderte er. »Ich glaube übrigens, daß bei dieser Ferguson-Geschichte einiges für Dennis drin ist. Die Firma hat ein paar böse Einbrüche erlebt, aber das Management ist solide, und es arbeiten Spitzenköpfe dort. Sie brauchen nur etwas Kapital. Wenn Dennis das beschaffen kann, landet er vielleicht einen Supercoup.«
Ich hoffte es. In letzter Zeit war ihm das allzu selten vergönnt gewesen, was ihm meinen Erfolg mit WickerWise noch schwerer im Magen liegen ließ. Allerdings arbeitete er auch nicht so hart. Das wollte er gar nicht. Aber ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn er auf eine Goldmine gestoßen wäre. Mein Ego brauchte weit weniger Bestätigung.
»Die Verträge für die Filiale in St. Louis müßten heute zurückkommen«, fuhr Brody in seiner ruhig-kompetenten Art fort. »Sobald ich die unterschrieben vorliegen habe, kann ich der Baufirma grünes Licht für die Renovierung geben. Ich faxe dir den Stand der Dinge ins Hotel – dann hast du ihn am Mittwoch bei deiner Ankunft dort vorliegen. Die Firma kümmert sich auch um die notwendigen Handwerker. Hast du die Baupläne dabei?«
Ich klopfte auf den Aktenkoffer neben meinem Bein. »Kaum zu glauben, daß das schon Nummer achtundzwanzig wird.«
Zwölf Jahre war es her, daß WickerWise seine Pforten geöffnet hatte. Das Mutterhaus befand sich noch immer in einem ehemaligen Spritzenhaus in Essex, fünfzehn Autominuten von zu Hause entfernt. Es war der Prototyp einer Ladenkette, die sich inzwischen von Nantucket bis Seattle erstreckte. Wir hielten enge Verbindung zu unseren Filialen, Brody und ich. Alle waren in freistehenden Gebäuden untergebracht – alten Schulhäusern, ehemaligen Bars, Tankstellen, Gemischtwarenläden, sogar in zwei früheren Kirchen. Diese Kulissen verliehen ihnen einen ganz besonderen Charme, der durch die charakteristische Innenraumgestaltung und die Art der Präsentation der Korbmöbel, die wir verkauften, seine Vollendung erfuhr. Auch darauf hatten Brody und ich ein wachsames Auge. Alle Bestellungen liefen über uns. Jede neue Filiale wurde grundsätzlich von einem von uns eröffnet und dann zweimal jährlich besucht.
Achtundzwanzig Filialen, ein Dutzend Boutiquen in Nobelkaufhäusern, eine Fabrik in Pennsylvania, Räume in zahlreichen Ausstellungshäusern von Wohltätigkeitsorganisationen – es wurde mir ganz schwindlig, wenn ich darüber nachdachte. So viel erreicht in so kurzer Zeit – fast wie im Märchen. Ich hatte ein winziges Pflänzchen eingesetzt, und es wuchs wie verrückt.
»Weißt du, wo wir hinfliegen?« Kikit war aufgestanden, hatte sich zwischen den Sitzen vorgebeugt und sich mit ihrem kleinen Pulloverarm in seinen großen Lederjackenarm eingehakt. Eigentlich hätte sie angegurtet hinten sitzen sollen wie Johnny, doch ich brachte es nicht übers Herz, darauf zu bestehen, denn im Flugzeug müßte sie sich bald genug anschnallen. Außerdem war Brody ein guter Fahrer, und er liebte meine Kinder. In einer brenzligen Situation würde er Kikit augenblicklich an seine Rückenlehne drücken.
»Nach Cleveland, glaube ich«, antwortete er mit Engelsgeduld, obwohl wir beide wußten, was kommen würde.
»Warst du da schon mal?«
»Das weißt du doch, Clara Kate.«
»Erzähl’s mir trotzdem.«
»Ich war in Cleveland auf dem College«, berichtete Brody pflichtschuldigst. »Und dort habe ich deinen Dad kennengelernt.«
»Und meine Mom.«
»Und deine Mom. Aber zuerst deinen Dad. Wir waren in der selben Verbindung.« Er hielt inne – das gehörte zum Spiel.
»Und ihr habt allen möglichen Mist gemacht«, gab Kikit ihm sein Stichwort.
»Wir haben allen möglichen Unsinn gemacht, wollte ich es formulieren«, korrigierte er streng genug, um eines von Kikits glucksenden, kleinen Lachern zu ernten. »Nach dem Abschluß studierten wir an verschiedenen Orten Betriebswirtschaft und sahen uns eine Weile nicht.«
»Sechs Jahre.«
»Du kennst die Geschichte besser als ich.«
Ich schloß die Augen, lehnte mich an die Kopfstütze und lächelte. Brody erzählte sie ihr noch immer, während Dennis es schon lange müde geworden war.
»Du und Daddy redeten eine Zeitlang darüber und machtet dann gemeinsam eine Firma auf. Hast du meine Grandma in Cleveland kennengelernt?«
»Nein – erst als ich hierhergezogen war.«
»Wird sie sterben?«
Meine Lider flogen auf. Ich drehte mich zu Kikit um und wollte sie gerade für diese Frage schelten, als mein Blick auf Johnnys gespanntes Gesicht fiel und mir klar wurde, daß sie nur ausgesprochen hatte, was sie beide dachten. Das tat sie häufig, und ich liebte sie dafür – auch wenn es mir Antworten abverlangte, die ich eigentlich nicht zu geben bereit war.
»Nicht heute oder morgen«, antwortete Brody für mich.
»Aber bald?« insistierte Kikit.
»Vielleicht. Sie ist schon ziemlich lange krank, und ihr Körper wird allmählich ziemlich müde.«
»Ich werde auch manchmal müde.«
»Das ist etwas anderes«, sagte Brody. »Etwas ganz anderes.«
»Bist du sicher?«
»Absolut. Definitiv. Du wirst müde, wie wir alle müde werden. Bei deiner Grandma liegt es an ihrem Alter und der Krankheit, die sie hat.«
»Krebs.«
»Krebs.«
Kikit holte tief Luft, und ich wappnete mich für einen geharnischten Angriff, doch was kam, war ein quengeliges »Gehen wir dieses Jahr in den Zirkus, Brody? Du hattest es versprochen, aber dann hast du nie wieder was davon gesagt. Meine Freundin Lily geht hin. Und Alexander Bly. Ich will auch hin.«
»Ich habe schon die Eintrittskarten.«
Ihr Gesicht leuchtete auf. »Ehrlich? Sitzen wir in der Mitte wie letztes Jahr? Da sind die Elefanten auf die Umrandung von der Manege gestiegen, weißt du noch, Brody? Es. War. So. Cool. Joy« – Brodys Tochter, nicht zu verwechseln mit Kikits Puppe – »kommt doch auch mit, oder? Es wäre nämlich nicht fair, wenn wir ohne sie gingen. Ich möchte noch so einen Alligator wie Hector, krieg ich einen, Mommy? Einen purpurroten diesmal? Es ist mir egal, was Daddy sagt – Alligatoren müssen mit anderen Alligatoren zusammensein. Kriege ich einen, bitte?«
Connie Grant war immer klein und zierlich gewesen, aber in den wenigen Wochen seit meinem letzten Besuch schien sie noch kleiner und zierlicher geworden zu sein. Und nicht nur das – sie hatte auch deutlich weniger Farbe und Energie. Sie stand unter schweren Medikamenten, und ihre Augen konnten ein Ziel nur Sekunden festhalten. Das vordringliche Problem, hatte mir der Arzt bei einem meiner Anrufe erklärt, sei im Moment nicht der Krebs, sondern ihr Herz – für einen chirurgischen Eingriff sei sie aber zu schwach.
Sie mußte ihre letzten Kraftreserven mobilisiert haben, um für die Kinder präsent zu sein, denn sobald Johnny und Kikit mit meiner Schwester verschwunden waren, damit wir ein Weilchen für uns hätten, schloß sie die Augen und lag schweigend da.
Bedrückt setzte ich mich zu ihr. Nach ein paar Minuten begann ich eine Melodie zu summen, und das schwache Lächeln, das ich erntete, beflügelte mich, der Melodie den Text hinzuzufügen. Connie liebte die Streisand. Mit »Evergreen« beginnend, sang ich leise ein Medley, bis sie ausgeruht genug war, um die Augen wieder zu öffnen. Ich sang die letzten Zeilen von »The Way We Were« und lächelte.
Das Lächeln, mit dem sie mich belohnte, war nur kurz, doch der Blick, der ihm folgte, war ein Von-Frau-zu-Frau-Blick und erschreckend scharfsichtig. Ich sah die Wahrheit darin, vor der ich mich fürchtete, und sagte hastig: »Das darfst du nicht einmal denken!«
»Wie stellst du dir das vor?« fragte sie mit kraftloser Stimme. »Ich kann nicht viel anderes tun als hier zu liegen und zu denken. Was für eine Ironie. So viel Freizeit.« Sie schloß die Augen und seufzte. »Ich war immer beschäftigt. So beschäftigt – mit so wenigen Resultaten.« Ihre Lider hoben sich, und ihr Blick erbat mein Verständnis. »Ich habe so vieles in meinem Leben tun wollen und es nicht getan. Es ist frustrierend.«
»Du hast genug getan«, widersprach ich.
»Von damals an, als Daddy starb. Du hast uns durchgebracht – mit zwei Jobs gleichzeitig –, Tag und Nacht gearbeitet.«
»Ich bin meinem Schwanz nachgejagt wie eine Katze, das war alles. Ich kam nicht weiter. Wie jetzt. Immer wieder glaube ich, die Schmerzen im Griff zu haben, und dann schlagen sie erneut mit voller Wucht zu. Ich bin müde, Claire.«
Ihre Verzweiflung zu hören, ängstigte mich und machte mich gleichzeitig zornig, denn Connie Grant verdiente es nicht, mit Dreiundsechzig zu sterben. Sie hatte lange und hart für ein besseres Leben gekämpft, sich nie entmutigen lassen.
»O Mom, es gab doch auch Positives. Eine Menge.«
»Dich, ja.« Sie seufzte wieder. »Aber Rona?«
»Auch Rona.«
»Sie ist achtunddreißig, aber so unreif wie eine Zwölfjährige.«
»Wenn du so willst. Aber für eine Zwölfjährige ist sie unheimlich auf Zack. Und sie war für dich da, Mom. Viel mehr als ich. Ich wünschte, ich wohnte näher bei dir.«
»Selbst wenn du das tätest – du hast eine Familie. Du hast eine Firma. Rona hat nichts.«
»Sie hat Freundinnen.«
»Die sind genauso orientierungslos wie sie. Keine von ihnen hat ein Ziel – außer das Kosmetikstudio. Was soll aus Rona werden, wenn ich nicht mehr die Hand über sie halte? Sie hat zwei gescheiterte Ehen hinter sich, keine Kinder, keinen Beruf. Ich sorge mich um sie.«
»Sie muß sich nur finden, und das wird sie, keine Angst.«
»Wirst du ein Auge auf sie haben, Claire?« flehte Connie.
Sie war noch blasser geworden. »Wenn ich nicht mehr da bin, hat Rona nur noch dich.«
»Ich werde tun, was ich kann.«
»Biete ihr die Leitung einer Filiale an.«
»Das habe ich schon, aber sie will sie nicht.«
»Biete sie ihr noch mal an. Sie wird Harolds Geld in null Komma nichts durchgebracht haben. Armes Ding. Sie ist fast genauso unselbständig wie ich es war, als euer Vater starb. Es ist tragisch, wie die Geschichte sich wiederholt. Da versucht man, die Kinder davor zu bewahren, die gleichen Fehler zu machen ...« Die Heftigkeit, mit der sie sich für dieses Thema engagierte, forderte ihren Tribut, und Connie sank noch tiefer in die Kissen zurück. »Wenigstens bist du mir gelungen. Sprich mit mir. Wo ist diese neue Filiale?«
Froh über die Ablenkung, erzählte ich ihr von dem Laden in St. Louis und von der International-Home-Furnishing-Ausstellung in North Carolina. Sie lächelte und nickte, doch ich spürte, daß ihre Konzentration nachließ. Aber WickerWise gefiel ihr. Und so berichtete ich ihr, während sie mir zugewandt in ihrem Klinikbett lag, von den Hochwasserschäden, die in der New-Orleans-Filiale behoben werden mußten, der möglichen Vergrößerung unserer Filiale in Denver, der Frau, die sich als neue Zweigstellenleiterin beworben hatte und eventuell in Frage kommenden Geschäftsräumen, die wir uns in Atlanta würden ansehen müssen.
»Gut«, sagte sie an einer Stelle, und an einer anderen: »Je mehr Städte, um so besser – Präsenz ist wichtig«, und schließlich – und erwartungsgemäß: »Und New York?«
Wir hatten eine hervorragend florierende Niederlassung in East Hampton, aber East Hampton war nicht Manhattan, und Mutter wünschte sich, daß WickerWise Einzug in die Fifth Avenue hielte.
»Noch nicht«, sagte ich. »Vielleicht in ein paar Jahren.«
»Aber das wäre der wahre Erfolg! Meinst du nicht auch?«
»Ich weiß nicht, Mom. Manhattan ist ein hartes Pflaster. Allein die Miete für einen Laden dort wäre schwindelerregend. Vielleicht wäre eine Boutique in einem Kaufhaus machbar ...«
»Ein eigenständiges Geschäft auf der Fifth Avenue – etwas anderes kommt nicht in Frage! Und jetzt erzähl mir alles, was die Kinder mir nicht erzählt haben.«
Ich erzählte ihr, daß Johnny im Kirchenchor sang, von dem Blumenverkauf von Kikits Pfadfindergruppe, von den Lehrern und Freunden der beiden. Ich redete, bis sie wieder ermattete. Diesmal schien sie regelrecht zornig, weil sie meinen Besuch nicht voll auskosten konnte. Ich versprach ihr, zur Abendessenszeit wiederzukommen und ging, damit sie sich ausruhen könnte.
Rona war knapp zwei Jahre jünger als ich. Als Kinder und Teenager hatten wir ein Zimmer, unsere Kleider und sogar unsere Freundinnen geteilt, und man hätte annehmen sollen, daß wir einander nahestanden. Daß das nicht so war, resultierte aus der Tatsache, daß wir auch Connie teilten. Für mich war es nicht schwer, sie zu teilen – Connie und ich waren uns derart ähnlich, daß ich immer gut abschnitt, wenn Vergleiche angestellt wurden. Rona war anders, sie sang nicht in unserem Chor, sie sehnte sich nach Moms Anerkennung und bemühte sich so verzweifelt darum, daß jeder Versuch fehlschlug. Trotzdem gab sie nie auf, war grimmig entschlossen, irgendwann einmal Erfolg zu haben.
In dem Bestreben, uns alle aus der Armut zu erretten, heiratete sie mit Zwanzig überstürzt den reichsten und begehrtesten Junggesellen, den sie finden konnte. Drei Jahre und zwei Geliebte später wurde Jerry ihr Ex. Nicht zu entmutigen – um so mehr, als ich an der Schwelle zur Ehe stand –, fand sie Mann Nummer zwei. Harold war der älteste begehrte Junggeselle, den sie finden konnte, und er betrog sie nicht. Er starb.
Meine Kinder liebten Rona, und sie liebte sie. Während ich an Moms Bett saß, ging sie mit ihnen ins Kino, in Spielwarenläden, ins Naturwissenschaftliche Museum, in Restaurants, wohin alle mit ihren Kindern gingen, die im Großraum Cleveland etwas darstellten. Ihr Bedürfnis nach Bewegung, das von Erwachsenen als Ruhelosigkeit empfunden wurde, wurde von Kindern als Durchhaltevermögen bewundert. Und warum auch nicht?
Sie war selbst ein Kind, wenn sie mit ihnen zusammen war, wenn auch das mit der offenen Brieftasche. Es lag Trotz in dem, was sie mit Kikit und Johnny unternahm, als käme es ihr nicht sosehr darauf an, das eine oder andere zu tun, sondern einfach darauf, etwas zu tun, was ich nicht tun würde. Rona mochte für das Ziel leben, von Connie akzeptiert zu werden, doch sie liebte es, mich zu provozieren. Ich war die Geizige, die Strenge und zu guter Letzt der Grund für ihre tiefsitzende Lebensangst.
Und ich war außerdem dafür da, die Fragen zu beantworten, mit denen ich bestürmt wurde. Rona war mißtrauisch, verlangte zu wissen, was die Ärzte mir gesagt hätten, weil sie überzeugt war, daß sie ihr nicht halb soviel sagten. Johnny behandelte das Thema ausweichend, erkundigte sich, was aus der Katze seiner Großmutter werden würde, weil er es nicht über sich brachte, zu fragen, was aus seiner Großmutter werden würde, aber Kikit hatte keine solchen Hemmungen. Wenn sie nicht fragte: »Was war in der Spritze?« oder: »Hast du gesehen, daß ihre Hand zitterte?« oder: »Warum piepst die Maschine so?«, dann berichtete sie: »Ich hörte sie weinen, als sie sie auf die Seite drehten. Warum hat sie da geweint, Mommy?«
Die Kinder begleiteten mich zweimal am Tag ins Krankenhaus, zu kurzen Besuchen, die zu Connies Aufheiterung gedacht waren, doch die Hinfälligkeit ihrer Großmutter bedrückte sie. Und so zog Rona nur zu bereitwillig mit ihnen ab. Meine Ankunft bot ihr eine Fluchtmöglichkeit, und sie gab sich nicht die Mühe, ihre Erleichterung darüber zu verbergen. Manchmal sagte sie spöttisch: »Viel Vergnügen«, oder neckend: »Wir werden an dich denken.« Und dann wieder bedachte sie mich nur mit einem befriedigten Blick, der besagte, daß die Zeit des Heimzahlens gekommen war. Und ich verstand sie. Nicht nur war sie all die Tage in der Klinik, wenn ich nicht da war, sondern sie erlebte Connie von einer anderen, kritischeren Seite – und sie mußte Connies Frustration aushalten.
Nein, ich konnte es ihr nicht verübeln, eine Atempause zu begrüßen. Hätte ich die Wahl gehabt, wäre ich auch lieber woanders gewesen, denn es war qualvoll, meine Mutter sterben zu sehen. Gleichgültig, wie oft ich ins Krankenhaus ging – jedesmal, wenn ich das Zimmer betrat und sie leiden sah, traf es mich wie beim ersten Mal. Gleichgültig, wie lange ich an ihrem Bett saß und ihr blasses Gesicht betrachtete – beim nächsten Besuch erschreckte es mich, sie so blaß vorzufinden. Gleichgültig, wie geschickt ich mich ablenkte, wenn ich nicht bei ihr war oder wie müde ich ins Bett kroch – ich lag wach und grämte mich.
Die Kinder blieben bis Dienstag. Der Abschied von ihrer Großmutter war nur die erste Nervenprobe. Als wir auf dem Flugplatz eintrafen, erfuhren wir, daß die erwarteten Maschinen wegen an der Ostküste tobender Unwetter verspätet eintreffen würden. Ihre Ankunft verzögerte sich weiter und weiter. Ich versuchte Dennis im Büro und zu Hause zu erreichen, einmal, zweimal, dreimal, und hinterließ jeweils Nachrichten für ihn.
Johnny begann sich wegen seines Trainings zu sorgen.
Der Abflug wurde neuerlich verschoben. Ich hinterließ neuerliche Nachrichten für Dennis.
Johnny weinte, daß er wirklich keine Lust hätte, auf die Ersatzbank verbannt zu werden, weil das Team, gegen das sie am Samstag spielen würden, nichts taugte, und seines darum die Chance hätte, zu gewinnen.
Kikit weinte, weil Michael, Travis und Joy sich in ihrem Koffer zu Tode fürchteten, und was passierte während Flugverzögerungen mit dem Gepäck?
Ich war auch nicht besserer Dinge als die Kinder. Es paßte mir ohnehin nicht, sie allein fliegen zu lassen, doch als ich vorschlug, sie sollten bis zum nächsten Morgen und auf besseres Wetter warten, geriet Johnny wegen seines Trainings in eine solche Panik, daß ich nachgab. Schließlich änderte die Fluggesellschaft die Route dahingehend ab, daß die Maschine über Baltimore fliegen würde, was Johnny noch nervöser machte, was sich darin äußerte, daß er Kikit kniff, die daraufhin weinend zu mir kam. Und alles, was ich tun konnte, war, Dennis eine letzte Nachricht zu hinterlassen, die Kinder nach ausgedehnten Umarmungen ins Flugzeug zu setzen und der Flugbegleiterin den Schwur abzunehmen, sie Dennis in Logan persönlich zu übergeben.
Ich kehrte ins Krankenhaus zurück und versuchte weiterhin, Dennis zu erreichen. Meistens hörte ich beim Abfragen des Anrufbeantworters mich selbst. Erst kurz vor der ursprünglichen Landezeit hatte ich endlich Glück.
»Wirst du pünktlich dort sein?« fragte ich, nachdem ich ihn ins Bild gesetzt hatte.
»Natürlich werde ich pünktlich dort sein«, antwortete er. Aber das war er nicht. Die Kinder landeten um sechs in Logan. Dennis kam erst um sechs Uhr vierzig. Er behauptete, ich hätte ihm diese Zeit genannt.
Das stimmte nicht, aber sich darüber zu streiten, wäre sinnlos gewesen. Ich wollte nichts, als die Kinder aus der Ferne nach Kräften beruhigen und dann ins Bett fallen. Ich hatte die ganze Woche schlecht geschlafen – das war auf Reisen immer so. Ich war geschafft.
Ich verschob St. Louis auf Donnerstag, um noch einen Tag länger bei meiner Mutter bleiben zu können. Ein Anruf bei Brody, und alles wurde entsprechend arrangiert. Am Freitag trafen wir uns bei der International-Home-Furnishing-Ausstellung, und von da an legten wir, einschließlich Montag, Zwölf-Stunden-Tage ein, an denen wir von Ausstellung zu Ausstellung pilgerten und von Firmenrepräsentant zu Firmenrepräsentant. Ich wußte, welche Modelle in unseren Läden laufen würden, und Brody wußte, welche preiswert waren.
Mit Rücksicht auf meine Sorge um Connie übernahm Brody Denver und New Orleans für mich. Ich absolvierte Atlanta und war am Dienstag spät abends wieder in Cleveland. Rona war begeistert über den zusätzlichen freien Tag, doch ich war nicht um Ronas willen zurückgekommen. Nicht einmal so sehr um Moms als um meiner selbst willen. Connie Grant war die einzige Mutter, die ich jemals haben würde. Ich hatte zu lange zu weit von ihr entfernt gelebt. Nur zu bald würde das keine Rolle mehr spielen.
Die Kinder waren enttäuscht, aber verständnisvoll. Das war allgemein ihre Einstellung zu meinen Reisen, denn nachdem ich sie in ihren ersten Jahren immer mit in den Laden genommen hatte, fühlten sie sich persönlich in meine Karriere eingebunden. Sie kannten das Warenangebot, die Fachausdrücke und wußten erstaunlich viel über jede neue Filiale. Und sie wußten auch, daß sie mich anrufen konnten, wo immer ich auch sein mochte.
In diesem Fall wußten sie, nachdem sie ihre Großmutter gerade gesehen hatten, wie krank sie war. Wenn es Grandma guttue, daß ich bei ihr bliebe, dann solle ich bleiben, beschwor Kikit mich tapfer, auch wenn sie mich wie verrückt vermisse.
Ich wünschte, ihr Vater wäre nur halb so entgegenkommend gewesen. Er nahm mir das Versprechen ab, am Donnerstag mit der Nachmittagsmaschine nach Hause zu kommen.
An jenem letzten Mittwoch wirkte meine Mutter kräftiger. Sie sprach tatsächlich davon, zu Thanksgiving in den Osten zu kommen, und während die Ärzte dies für unwahrscheinlich hielten, klammerte ich mich an den Gedanken. Grandma vom Flughafen abzuholen – es gehörte einfach zu diesem Feiertag. Die Kids zählten auf ihren Besuch. Und ich auch.
Sie bestand darauf, daß ich anriefe, damit sie mit ihnen sprechen könnte, und war enttäuscht, als sich der Anrufbeantworter einschaltete. Ich sah es positiv. »Dennis muß sich irgend etwas für sie ausgedacht haben und mit ihnen unterwegs sein.«
Mutters Züge wurden weich. »Es ist so einfach mit den beiden. Es sind wundervolle Kinder, so redegewandt und reif, unterschiedlich, aber jedes für sich etwas Besonderes. Du bist eine bessere Mutter, als ich es war.«
»Das stimmt nicht. Ich hatte nur Glück.«
»Mit Glück hat das wenig zu tun. Wie heißt es in dem Sprichwort? Jeder ist seines Glückes Schmied.«
»Das gilt nur zum Teil. Wir hatten wirklich Glück, Dennis, die Kids und ich. Abgesehen von Kikits Allergien, sind wir gesund, die Kinder haben nette Freunde, machen sich gut in der Schule. Johnny bereitet mir allerdings ein wenig Sorgen – er will immer alles besonders gut machen. Gott sei Dank, gelingt es ihm auch.«
»Da kommt er nach seiner Mutter«, sagte meine Mutter.
»Meine Freundinnen sind völlig hingerissen von deinen Läden. Ich werde immer wieder gefragt, ob die Firma Aktien ausgibt.« Ihre Brauen hoben sich fragend.
»Nein, nein, wir wollen keine Fremdbeteiligungen.«
»Warum nicht?«
»Es ist nicht nötig, wir expandieren nicht so schnell. Ich lege Wert darauf, die Kontrolle über meine Filialen zu haben, mich selbst darum zu kümmern. Und darum muß ich sie auf eine gewisse Anzahl beschränken, sonst ist das nicht mehr machbar.«
»Aber denke an das Geld!«
Ich hatte bereits eine Menge Geld – das letzte Jahr hatte uns einen Umsatz von mehr als zwanzig Millionen beschert –, und Connie kannte meine Einstellung, da wir dieses Gespräch nicht zum erstenmal führten. Früher hätte sie trotzdem weiterdiskutiert, doch jetzt fehlte ihr die Energie dazu. »Nun ja, ich bin jedenfalls stolz auf dich.«
Das wußte ich. Von meiner Kindheit bis heute hatte sie niemals an meinen Fähigkeiten gezweifelt. Sie vertraute mir. Sie glaubte an mich.
Ich straffte meine Schultern. »Ich bin auch stolz auf mich.«
»Und wie steht es mit Dennis?«
Meine Schultern sackten eine Spur ab. »Schwer zu sagen, er spricht nicht darüber.«
»Und wie geht es ihm beruflich?«
»Ich wünschte, ich wüßte es, aber auch darüber spricht er kaum.« Ich zögerte. Es erschien mir unloyal, mich zu beschweren, aber sie war immer meine Klagemauer gewesen, und sie war noch nicht tot, verdammt noch mal. »Manchmal begreife ich es nicht. Man sollte doch denken, daß es ihm ein Bedürfnis wäre, seine Ideen mit mir zu erörtern. Ich bin zwar kein Akademiker wie er, aber ich habe durchaus ein Gefühl dafür, was Erfolg verspricht und was nicht. Doch er behält alles für sich. Es kommt mir vor wie ein Machtkampf – als wolle er nicht riskieren, daß ich ihn niedermache. Als ob ich das täte! Ich halte seit Jahren den Mund, wenn mir eine seiner Unternehmungen zweifelhaft erscheint.«
»Du hättest ihn mal aufmachen sollen.«
»Es wäre mir schrecklich gewesen, wenn ich recht gehabt hätte, und ebenso schrecklich, wenn ich mich geirrt hätte. Es wäre nichts Positives für mich dabei herausgekommen, und für ihn wäre es nur eine Verletzung seines Stolzes.« Ich lächelte. »Aber Brody hat einen guten Eindruck von der Gruppe, mit der er sich letzte Woche traf. Mit etwas Glück wird Dennis sie überzeugen können, daß er der Mann ist, der ihnen die Geldgeber besorgen kann, um die Firma zu halten.« Diesmal ließ Connie meinen Bezug auf das »Glück« unkommentiert, und sie wies mich auch nicht darauf hin, daß ich bereits so erfolgreich war, daß ich keinen Penny von dem brauchte, was Dennis verdiente. Diese Tatsache war für uns beide eine Beruhigung, wie sie nur Menschen, die früher einmal ohne Schwimmweste über Bord gefallen waren, empfinden konnten.
»Ich will es noch erleben, daß Dennis den Durchbruch schafft.«
»Ich auch.«
»Ich bin nicht bereit, zu sterben.«
»Und ich bin nicht bereit, dich gehen zu lassen.«
Sie schenkte mir einen weiteren Von-Frau-zu-Frau-Blick, und ich, die ich mich mit ihr verbunden fühlte wie mit keinem anderen Menschen auf der Welt, wurde von einer Welle der Liebe und des Kummers erfaßt, die mir Tränen in die Augen trieb und die Kehle zuschnürte. Über die Liebe und den Kummer hinaus empfand ich auch Bewunderung. Connie Grant hatte die Mentalität eines Mulis. So schwer ihr Leben auch gewesen war – sie war unbeirrt ihren Weg gegangen. Jetzt war sie oft so schwach, daß sie kaum den Arm heben konnte, von einer solchen Übelkeit geplagt, daß sie kaum einen Bissen hinunterbrachte, von solchen Schmerzen gequält, daß sie kaum denken konnte – und trotzdem weigerte sie sich zu sterben.
»Du bist eine starrsinnige Frau«, sagte ich, als ich wieder sprechen konnte.
»Was habe ich für eine Wahl?« konterte sie. »Die Alternative wäre – was? Defätismus? Der würde es noch schlimmer machen. Man kann kein Essen auf den Tisch bringen, wenn man nicht bereit ist, zu kochen. Deine Schwester hat das nie begriffen. Sie hätte etwas aus sich machen können, wenn sie nicht immer die schnellste Lösung gesucht hätte. Du willst braun werden? Geh ins Sonnenstudio. Du willst Geld? Heirate einen reichen Mann. Ich dachte, sie würde daraus lernen, mich arbeiten zu sehen. Falsch gedacht. Rona will immer das Beste und das sofort. Aber manchmal ist das nicht möglich. Manchmal ist das Beste, was man tun kann, das Beste, das man tun kann.«
Sie ließ sich erschöpft zurücksinken und schloß die Augen. Ihr Atem ging flach. Während ich sie, anfangs voller Angst, und dann zunehmend ruhiger, beobachtete, regenerierte sie sich langsam. Als sie die Augen schließlich wieder öffnete, war ihr Blick weich. »Du bist wie meine Mutter Kate, Claire. Sie war einfallsreich und zielbewußt.« Ihr Blick wurde entrückt, und ein liebevoll-spöttisches Lächeln umspielte ihre Lippen. »Es gab da eine Geschichte. Ich hatte sie fast vergessen: Die süße Kate und ihre Perlen.«
Ich hatte nie etwas über irgendwelche Perlen gehört. »Großmutter Kate war bettelarm.«
»Arm an Besitz, nicht an Phantasie. Ihre Perlen waren Augenblicke – ein schöner nach dem anderen, aufgezogen auf eine feste Schnur. Sandkörner wischte sie einfach weg und vergaß sie. Manche Menschen, sagte sie, könnten die Perlen durch den Sand nicht sehen oder hätten nur die Charakterstärke, einige wenige davon zu befreien und am Ende ein Würgehalsband. Die Kette deiner Großmutter Kate war lang, und deine wird es auch werden. Ronas – nun, Rona befaßt sich nicht lange genug mit einer Sache, um überhaupt eine Perle wachsen zu lassen. Was mich betrifft« – sie seufzte –, »ich arbeite immer noch daran. Die Kinder zu sehen, dich zu sehen – das sind schöne Momente, Claire. Sie helfen mir mehr als Morphium, weißt du das? Du kommst mich doch bald wieder besuchen, ja, Baby?«
Die Geschichte von Großmutter Kates Perlen war eine der philosophischeren, die meine Mutter mir erzählt hatte. Sie beschäftigte mich am Donnerstag während des Heimflugs. Ich dachte an meine eigenen Perlen, wundervolle Momente mit der Familie, mehr als ich zählen konnte, Momente der Freude und des Stolzes bei meiner Arbeit – und plötzlich wurde das Heimweh, das mich durch die ganze Woche begleitet hatte, fast unerträglich. Ich konnte es nicht erwarten, nach Hause zu kommen.
Mein Flugzeug landete pünktlich, der Chauffeur, den ich zum Flughafen bestellt hatte, war pünktlich, doch meine Ungeduld wurde immer größer. Ich war eine Ewigkeit weggewesen, und ich sehnte mich danach, heimzukommen, sehnte mich danach, meine Kinder zu umarmen und mit Dennis zu sprechen. Ich freute mich sogar auf die mir an sich verhaßten Pflichten wie Abwaschen, Wäsche zusammenlegen, Teppiche saugen, Betten machen. Mein Zuhause war mein Hafen, ich sehnte mich danach, vor Anker zu gehen. Ich kam um halb sechs an – genau zu der Zeit, die ich den Kindern genannt hatte –, und es wunderte mich, daß sie mich nicht draußen erwarteten, denn ich hatte fest damit gerechnet, meine Kette um zwei schöne Perlen verlängern zu können, indem ich Johnny auf dem Verandageländer lümmeln sähe und Kikit beim Kästchenhüpfen auf dem sanft geschwungenen Bürgersteig. Es war warm draußen und noch hell. Dennis hätte schon vor einer halben Stunde mit ihnen zu Hause sein müssen.
Sein Wagen stand vor der an unser Haus gebauten Garage. Ich schleppte mein Gepäck zur Vordertür und mußte sie aufschließen, was mich ebenfalls wunderte. Wer immer als erster heimkam, sperrte beide Türen für die Kinder auf, die dann bis zum Einbruch der Dunkelheit zwischen Drinnen und Draußen pendelten.
»Hallo?« rief ich und erwartete die Freudenschreie, die mir bei meiner Ankunft für gewöhnlich aus der vor mir liegenden Küche oder aus dem ersten Stock entgegenschallten, doch es kamen keine, und die Stille war nur ein Punkt, der mich beunruhigte. Abgesehen von meinen Reisetaschen, die ich am Fuß der Treppe zum ersten Stock abgestellt hatte, war sie leer, nichts von den Schuhen, Schulpacks, Pullovern und diversen anderen Dingen zu sehen, die sich in meiner Abwesenheit üblicherweise dort ansammelten.
»Hey, Leute, ich bin wieder da-ah!«
»Das höre ich.« Dennis war wie aus dem Nichts in der Tür des Arbeitszimmers zu meinen Rechten erschienen. Er hielt ein Glas in der Hand. Bourbon on the rocks. Es schien sein erster zu sein – sein Blick war noch völlig klar.
Ob aus mütterlichem oder ehefraulichem Instinkt – jedenfalls erfaßte mich jäh ein ungutes Gefühl. »Was ist los?« fragte ich in die Stille hinein. Es war mir klar, daß etwas passiert sein mußte, und Angst stieg in mir auf. War Kikit krank? Johnny verletzt? Connie gestorben? »Was ist los?« wiederholte ich, diesmal im Flüsterton.
Dennis lehnte sich mit der Schulter an den Türrahmen und betrachtete scheinbar fasziniert den Inhalt seines Glases. Als er den Blick wieder hob, lag ein seltsamer Ausdruck darin.
»Ist etwas mit meiner Mutter?«
Er schüttelte den Kopf.
»Mit den Kindern?«
»Es geht ihnen gut.«
»Wo sind sie?«
»Bei meinen Eltern.«
Meine Schwiegereltern wohnten gleich hinter der Grenze nach New Hampshire, nur dreißig Fahrminuten entfernt. Ich konnte verstehen, daß sie Dennis die Kinder zeitweise abnahmen, wenn ich verreist war – aber doch nicht, wenn ich wieder heimkam! Johnny und Kikit freuten sich doch genauso auf mich wie ich mich auf sie. »Soll ich sie abholen?«
»Nein.« Sein Tonfall war ebenso seltsam wie sein Ausdruck, kälter als sonst, energischer als sonst. Die Erinnerung an eine Auseinandersetzung vor ein paar Monaten schoß mir durch den Kopf. Sie hatte mit Gift und Galle begonnen, war dann jedoch in ein unüblich kälteres, energischeres Stadium übergegangen, in dem Dennis mir die Trennung vorschlug.
»Warum nicht?« fragte ich in vorsichtigem Ton.
Er trank einen Schluck.
»Dennis?« Die Gefühle und Gedanken, die mich beschlichen, gefielen mir ganz und gar nicht. Ich hatte schon seinerzeit, wie schon einige Male zuvor, gegen eine Trennung gestimmt, doch diesmal wirkte er beängstigend selbstsicher und entschlossen.
Es klingelte.
Mein Blick flog zur Haustür und zu Dennis zurück. »Wer ist das?« fragte ich, als ich sah, daß er nicht überrascht war.
Er bedeutete mir mit dem Glas, zu öffnen, was ich eiligst tat. Ein freundlicher, leger gekleideter Mann in mittleren Jahren stand auf der Schwelle.
»Claire Raphael?«
»Ja.«
Er streckte mir ein neutrales Kuvert hin. Sobald ich es entgegengenommen hatte, machte er auf dem Absatz kehrt und ging den Weg hinunter.
Der Umschlag war an mich adressiert. Als Absender war das Office of the Constable of Essex County angegeben.
Ich schloß die Tür, warf Dennis einen unbehaglichen Blick zu und riß das Kuvert auf.
KAPITEL 2
Die Überschrift wies das Papier als eine Vorläufige Verfügung des Probate and Family Court Department of the Commonwealth of Massachusetts, Essex Division aus. Dennis war mit Schreibmaschine als Kläger aufgeführt, ich als Beklagte.
Verwirrt schaute ich zu ihm auf. Er erwiderte meinen Blick völlig gelassen. Ich las weiter.
Bis zu einer Anhörung zur Feststellung des Sachverhalts oder einer weiteren Verfügung des Gerichts wird angeordnet:
Der Kläger/Vater erhält das vorläufige Sorgerecht für John und Clara Kate Raphael, die minderjährigen Kinder der Parteien.
Die Ehefrau hat die eheliche Wohnung bis zum kommenden Montag, dem 28. Oktober, zwölf Uhr mittags zu räumen, zu welchem Zeitpunkt alle Parteien zu erscheinen haben, um triftige Gründe dafür vorzubringen, warum das vorläufige Sorgerecht und die Wohnungsräumung dauerhafte Gültigkeit erlangen sollten oder nicht.
Zu besagtem Termin wird eine Anhörung zu dem Zweck stattfinden, vor einer endgültigen Scheidungsvereinbarung über das vorläufige Sorgerecht und eine Unterhaltszahlung zu entscheiden.
Das Formblatt trug das Datum dieses Tages: Donnerstag, 24. Oktober, und die Unterschrift von E. Warren Selwey, Justice of the Probate and Family Court.
Ich starrte fassungslos auf das Schreiben hinunter. Dennis spielt mir einen üblen Streich, um mir deutlich zu machen, daß ihm meine Reisen nicht passen, war die einzige Erklärung, die mir dafür einfiel. Aber das Formular sah mit seinem geprägten Briefkopf und den mit einer altersschwachen Schreibmaschine ausgefüllten Leerräumen, deren Typen, wie ich feststellte, bis auf die Rückseite durchgeschlagen hatten, erschreckend echt aus – und Dennis lachte nicht.
»Was ist das?« fragte ich.
»Das sollte eigentlich klar sein.«
»Es sieht aus wie eine gerichtliche Verfügung.«
»Kluges Kind.«
»Eine gerichtliche Verfügung?«
»Du sagst es.«
»Dennis!« Anklagend hielt ich ihm das Formular hin. »Was ist das?«
Dennis war ein Blender. Was ihm am Geschäftssinn mangelte, glich er mit gutem Aussehen, Charme und der Art selbstbewußten Lächelns aus, das Menschen unwiderstehlich anzog. Als seine Frau wußte ich, daß sich eine gewisse Unsicherheit hinter der Fassade verbarg.
Zumindest war das bisher so gewesen. Heute wirkte sein Selbstvertrauen so echt, daß es mir Angst machte.
»Ich habe die Scheidung eingereicht«, erklärte er. »Das Gericht hat mir das vorläufige Sorgerecht für die Kinder zuerkannt, und angeordnet, daß du das Haus räumen mußt.«
Das konnte nur ein übler Streich sein. »Du machst Witze.«
»Nein. Dieses Schreiben ist eine offizielle Verfügung.«
Ich schüttelte den Kopf. Was sollte das? »Warum sind die Kinder bei deinen Eltern? Heute war doch Schule.«
»Meine Eltern wohnen ja ganz in der Nähe. Bei ihnen zu Abend zu essen ist etwas Neues für die Kids, und es gibt dir Zeit, deinen Kram zu packen und zu verschwinden. Ich möchte nicht, daß die Kinder sich aufregen.«
»Wenn du nicht möchtest, daß sie sich aufregen« – ich schluckte trocken und hob das Formblatt hoch –, »was soll das dann?«
Er stieß sich gereizt vom Türrahmen ab. »Um Himmels willen, Claire, du hast es direkt vor der Nase! Ich verlange die Scheidung. Ich wiederhole: Ich verlange die Scheidung. Warum geht das nicht in deinen Kopf?«
»Weil das nicht die Art und Weise ist«, erwiderte ich mit aufsteigender Angst laut und heftig, »in der zwei vernünftige Menschen nach fünfzehn guten Ehejahren miteinander umgehen. Solche Menschen reden miteinander.«
»Das habe ich versucht, aber du hast dich taub gestellt. Ich habe dreimal von Scheidung gesprochen. Wenn du willst, kann ich dir sogar die genauen Daten nennen. Das letzte Mal war im August. Da sagte ich, wir sollten uns trennen, wenn die Schule wieder anfinge.«
Ich erinnerte mich daran. Er war aufgebracht gewesen, weil eine Finanzierung, um die er sich bemüht hatte, geplatzt war. Zur gleichen Zeit waren die Umsatzaufstellungen des zweiten Quartals von WickerWise gekommen – besser denn je, was ihn noch zusätzlich demoralisierte. Und so hatte er gedroht, auszuziehen. Das tat er immer, wenn er aufgebracht oder frustriert war oder sich gedemütigt fühlte – das kannte ich zur Genüge.
»Ich kam nicht auf die Idee, daß du es ernst meintest.«
»Das tat ich aber. Sehr.«
»Dennis!«
»Claire!« äffte er meinen Tonfall nach und lehnte sich, wieder ganz gelassen, an den Türrahmen. Ich glaube, es war diese Gelassenheit, die mich fertigmachte, denn sie vermittelte, daß Dennis in diesem Fall wirklich die Oberhand hatte, und sie schuf Distanz zwischen uns, verlieh seiner Stimme Kälte. »Ich will die Scheidung. Da du nicht bereit warst, mir zuzuhören, blieb mir nichts anderes übrig, als zu diesem Mittel zu greifen.«
In meinem Kopf herrschte ein heilloses Durcheinander – Fragen, Ängste, langfristige Folgen schossen in alle Richtungen, kollidierten miteinander. Ich versuchte, sie voneinander zu trennen, Satz für Satz zu denken, Schritt für Schritt. Trotzdem war ich atemlos. »Okay. Wenn es dir ernst ist mit der Trennung, dann können wir uns einigen – aber was soll das mit dem Sorgerecht für Johnny und Kikit und dieser Verfügung, daß ich das Haus zu räumen habe?«
»Ich will das Haus. Ich will Unterhalt. Ich will das alleinige Sorgerecht für die Kinder.«
»Wie bitte?«
»Du bist keine verantwortungsbewußte Mutter.«
»Wie bitte?«
»Großer Gott, Claire, soll ich es dir buchstabieren?«
»Ja – du sollst es mir buchstabieren.« Ich wurde allmählich zornig. Es reichte mir. »Ich bin durchaus eine verantwortungsbewußte Mutter. Was in aller Welt könntest du dem Richter erzählen, um ihn vom Gegenteil zu überzeugen?«
»Du wirst zwischen deiner Mutter und deiner Arbeit zerrieben. Die Kinder leiden.«
»Inwiefern?«
»Du bist kaum hier – und wenn, dann hast du den Kopf so mit Arbeit voll, daß du die Kinder vergißt.«
»Kommst du jetzt wieder mit Kikits Ballettunterricht? Das haben wir doch schon ein dutzendmal durchgekaut. Im Laden war der Strom ausgefallen und die Uhren waren stehengeblieben.«
»Was war mit dem versäumten Gesprächstermin bei der Lehrerin?«
Ich brauchte einen Moment, bis ich begriff, was er meinte. »Dem bei Mrs. Stanetti? Den habe ich nicht versäumt. Wir mußten ihn zweimal verschieben, und dann konnten wir einander nicht mehr erreichen.«
Er hob die Hand. »Sie hat auf dich gewartet, und du bist nicht erschienen. Und dann war da noch der Unfall, den du letzten Monat hattest. Der Wagen war total hinüber. Es war ein Wunder, daß den Kindern nichts passierte.«
»Ich konnte nichts für den Unfall, Dennis. Ich wurde von einem Mann gerammt, der einen Herzinfarkt hatte. Das hat die Polizei so gesehen und die Versicherung ebenfalls.«
»Der Richter sieht es aber anders: Er ist meiner Meinung: daß du hättest ausweichen können, wenn du bei der Sache gewesen wärst, und nicht das Leben unserer Kinder hättest aufs Spiel setzen müssen. Apropos Kinder: Kikit hatte einen kapitalen Allergie-Anfall, während du weg warst.«
Mein Magen krampfte sich zusammen. »Wann? Und woraufhin?«
»Dienstag abend – auf den tiefgefrorenen Eintopf hin, den du für uns vorbereitet hattest. Was hast du da bloß reingetan, Claire? Du müßtest doch am besten wissen, was Kikit essen darf und was nicht. Aber was noch schlimmer ist – es war kein Epi-pen da. Du mußt ihn in Cleveland gelassen haben.«
»Das habe ich nicht. Ich habe ihn eingepackt. In ihre Reisetasche.«
»Da war er aber nicht. Ich habe nachgesehen. Er war weder dort noch hier. Ich mußte mit ihr ins Krankenhaus rasen. Sie schwoll immer mehr an und rang immer mühsamer nach Luft. Als wir ankamen, war sie schon fast blau.«
Ich preßte die Hand auf die Brust. Diese Neuigkeit raubte mir den Atem, mehr als alles andere. Mit Medizin oder ohne – jeder Anfall von Kikit war gefährlich. »Es waren Antihistamine da und ein Reserve-Epi-pen. Ich habe immer einen Vorrat da.«
Er schüttelte den Kopf. »Wir haben überall gesucht.«
»Die Sachen sind in dem Kühlschrank im Keller. Das hatte ich dir gesagt! Ist sie wieder okay?«
»Sie haben sie stabilisiert, aber es dauerte eine Weile. Sie weinte nach dir, aber du warst ja nicht da.«
Wut kochte in mir hoch. »Ich war nur eine Telefonnummer weit weg. Warum hast du mich nicht angerufen?«
»Ich habe es versucht, aber du hattest dein Handy ausgeschaltet, und bei deiner Schwester war besetzt.«