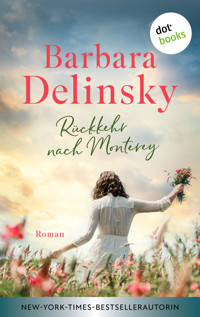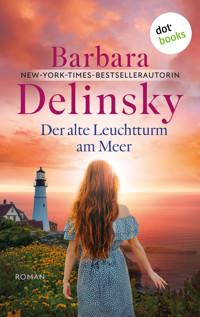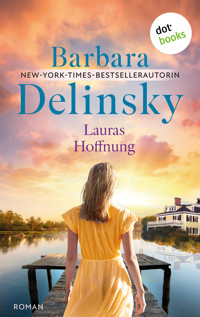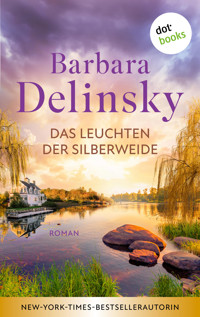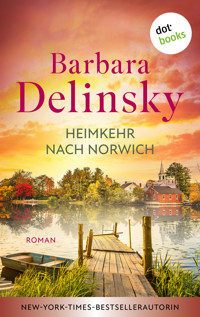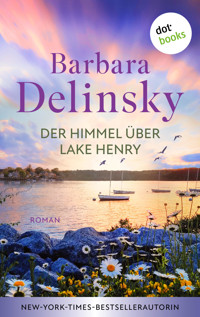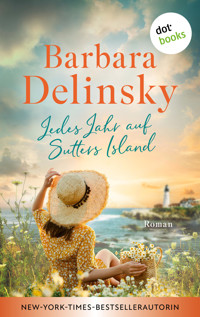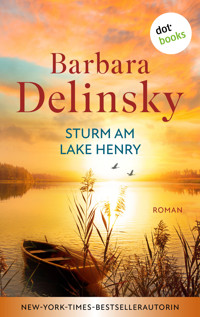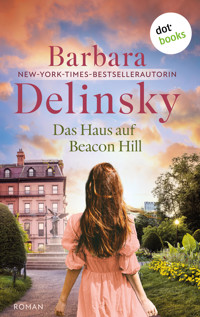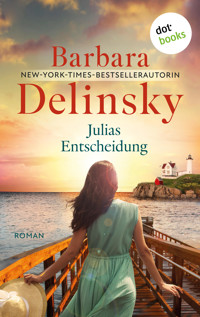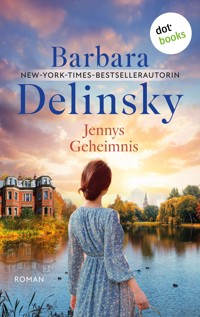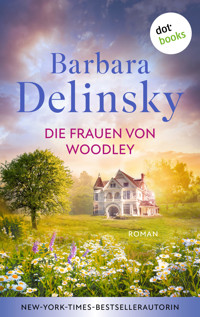
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Herz einer kleinen Stadt: Der berührende Freundinnenroman »Die Frauen von Woodley« von Barbara Delinsky als eBook bei dotbooks. Im beschaulichen Woodley brodelt die Gerüchteküche! Eine junge Witwe ist schwanger, ein Jahr nach dem Tod ihres Mannes – hatte sie eine Affäre mit einem Nachbarn? Drei Freundinnen halten nichts vom Klatsch und Tratsch … und fühlen sich trotzdem schmerzlich an ihre eigene Situation erinnert: Da ist Amanda, die seit Jahren verzweifelt versucht, ein Kind zu bekommen, Georgia, die gerade vor der unmöglichen Wahl steht, sich zwischen Karriere und Familie entscheiden zu müssen, und schließlich Karen, die doch immer noch versucht zu vergessen, dass ihr Mann sie betrogen hat. Bisher haben die drei Freundinnen alle Stürme des Lebens gemeistert. Aber müssen sie nun vielleicht lernen, Altes loszulassen, um jede für sich einen Neuanfang zu finden? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der bewegende Kleinstadt-Roman »Die Frauen von Woodley« von New-York-Times-Bestsellerautorin Barbara Delinsky wird Fans von »Virgin River« begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 470
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über dieses Buch:
Im beschaulichen Woodley brodelt die Gerüchteküche! Eine junge Witwe ist schwanger, ein Jahr nach dem Tod ihres Mannes – hatte sie eine Affäre mit einem Nachbarn? Drei Freundinnen halten nichts vom Klatsch und Tratsch … und fühlen sich trotzdem schmerzlich an ihre eigene Situation erinnert: Da ist Amanda, die seit Jahren verzweifelt versucht, ein Kind zu bekommen, Georgia, die gerade vor der unmöglichen Wahl steht, sich zwischen Karriere und Familie entscheiden zu müssen, und schließlich Karen, die doch immer noch versucht zu vergessen, dass ihr Mann sie betrogen hat. Bisher haben die drei Freundinnen alle Stürme des Lebens gemeistert. Aber müssen sie nun vielleicht lernen, Altes loszulassen, um jede für sich einen Neuanfang zu finden?
Über die Autorin:
Barbara Delinsky wurde 1945 in Boston geboren und studierte dort Psychologie und Soziologie. Nach der Geburt ihres ersten Sohnes arbeitete sie als Fotografin für den Belmont Herald, erkannte aber bald, dass sie viel lieber die Texte zu ihren Fotos schrieb. Ihr Debütroman wurde auf Anhieb zu einem großen Erfolg. Inzwischen hat Barbara Delinsky über 70 Romane veröffentlicht, die in mehr als 20 Sprachen übersetzt wurden und regelmäßig die New–York–Times–Bestsellerliste stürmen. Sie engagiert sich außerdem sehr stark für Wohltätigkeitsvereine und Aufklärung rund um das Thema Brustkrebs. Barbara Delinsky lebt mit ihrem Mann in New England und hat drei erwachsene Söhne.
Die Website der Autorin: barbaradelinsky.com/
Bei dotbooks veröffentlichte Barbara Delinsky auch ihre Romane:
»Die Schwestern von Star’s End«
»Jennys Geheimnis«
»Das Weingut am Meer«
»Julias Entscheidung«
»Lauras Hoffnung«
»Die alte Mühle am Fluss«
»Der alte Leuchtturm am Meer«
»Sturm am Lake Henry«, Die Blake–Schwestern 1
»Der Himmel über Lake Henry«, Die Blake–Schwestern 2
»Heimkehr nach Norwich«
»Das Leuchten der Silberweide«
»Das Licht auf den Wellen«
»Ein Neuanfang in Casco Bay«
»Im Schatten meiner Schwester«
»Rückkehr nach Monterey«
»Drei Wünsche hast du frei«
»Ein ganzes Leben zwischen uns«
»Jedes Jahr auf Sutters Island«
»Was wir nie vergessen können«
***
eBook–Neuausgabe November 2023
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 2001 unter dem Originaltitel »The Woman Next Door« bei Simon & Schuster, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 2003 unter dem Titel »Die schöne Nachbarin« bei Knaur.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 2000 by Barbara Delinksy.
Published by Arrangement with Barbara Delinsky
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2003 bei Knaur Taschenbuch. Ein Unternehmen der Droemerschen Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. GmbH & Co. KG, München.
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook–Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978–3–98690–757–0
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks–Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung–per–Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Frauen von Woodley« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Barbara Delinsky
Die Frauen von Woodley
Roman
Aus dem Amerikanischen von Georgia Sommerfeld
dotbooks.
Prolog
Wäre es nach ihnen gegangen, hätten Amanda und Graham einander irgendwo in aller Stille das Jawort gegeben, denn sie betrachteten in ihrem Alter – immerhin waren sie bereits dreißig beziehungsweise sechsunddreißig – ein rauschendes Fest als unangemessen, doch Amandas Vater bestand darauf, seinem einzigen Kind eine große Hochzeit auszurichten. Amandas Mutter genoss es, sein Geld auszugeben, und Grahams Familie feierte für ihr Leben gern.
Also fand die Trauung im Juni auf Cape Cod in dem Country Club statt, in dem Amandas Vater Mitglied war, im Freien, mit Blick auf ein Salzsumpfgelände, auf Entenschnepfen und Seeschwalben und im Beisein von dreihundert geladenen Zeugen. Anschließend zogen die dreihundert, angeführt von den Arm in Arm dahinschreitenden Frischvermählten, in den Garten hinter dem Clubhaus, wo sie ein Bufett der Extraklasse erwartete. Die in voller Blüte stehenden Flieder- und Rosenbüsche wurden von den Gästen der Braut, deren Interesse dem Rahmen der Feier galt, weit mehr gewürdigt als von den Gästen des Bräutigams, für die der Schwerpunkt auf dem Feiern lag.
Als die Zeit für die Trinksprüche kam, machte Will O’Leary den Anfang, der nächstältere Bruder von Graham, dem jüngsten von acht Geschwistern. Das Champagnerglas in der Hand, schenkte er seiner Frau und seinen vier Kindern das für die Sippe charakteristische Lächeln und wandte sich dann dem Bräutigam zu. »Obwohl ich ein Jahr älter bin als du, warst du mir immer voraus, Graham O’Leary. Du warst der bessere Schüler, du warst der bessere Sportler, du wurdest jedes Jahr wieder zum Klassensprecher gewählt, und ich kann dir sagen, es gab Zeiten, da ging mir das ganz entschieden gegen den Strich.« Hier und da wurde gelacht. »Heute allerdings habe ich dir etwas voraus: Eheerfahrung. Ich wünsche dir, dass du mit deiner Frau ebenso glücklich wirst, wie ich es seit fünfzehn Jahren mit meiner bin.« Er hob sein Glas. »Auf euch beide. Möge es in eurem gemeinsamen Leben viel zu lachen geben – und großartigen Sex.«
Hochrufe erschollen, und dann tranken alle auf das Wohl des jungen Glücks.
Als der Tumult sich gelegt hatte, trat Beth Fisher ans Mikrofon, eine der drei Brautjungfern, gekleidet in elegantes Königsblau, und sagte mit leiser, wohltönender Stimme: »Amanda hat lange auf den Richtigen gewartet, und auch bei mir ließ er auf sich warten. Ich fand ihn schließlich, und Amanda fing an zu arbeiten und stellte die Partnerfrage hintan. Sie war nicht auf der Suche, als sie Graham kennen lernte, und wahrscheinlich hat sie ihn genau aus diesem Grund gefunden.« Sie hob ihr Glas. »Auf Amanda und Graham – und darauf, dass ihr einander in Ewigkeit liebt.«
***
Amanda hatte die Partnerfrage nicht hintangestellt – sie hatte die Hoffnung aufgegeben, einen Mann zu finden, der vertrauenswürdig und damit es wert war, geliebt zu werden. Und dann, an einem Augustnachmittag, als sie, der Hitze der Stadt entfliehend, ihre ehemalige Tutorin in Greenwich besuchte, hatte sie Graham gesehen. Er grub, Oberkörper nackt und vor Schweiß glänzend, gemeinsam mit fünf anderen Männern auf dem Hanggrundstück ihrer Gastgeberin Pflanzlöcher für verschiedene Büsche. Er war größer als die anderen Männer und muskulöser, und seine dunklen Haare und der kurz geschnittene Bart verliehen ihm etwas Verwegenes. Es war nicht nur sein erotisches Äußeres, was sie gefangen nahm – auch die Art, wie er ihren Blick festhielt, fesselte sie. Entweder war er ungehobelt oder extrem selbstsicher. Weder das eine noch das andere hatte sie bislang bei Männern erlebt, und das eine war ebenso reizvoll wie das andere. Amanda war gerade einmal fünfzehn Minuten im Haus, als der junge Mann mit dem Pflanzplan in der Hand an der Tür erschien, um sich von der Hausherrin weitere Instruktionen geben zu lassen. Wie er später zugab, war das nur ein Vorwand gewesen, um Amanda vorgestellt zu werden. Was dann auch geschah.
***
Die älteste Schwester des Bräutigams, MaryAnne O’Leary–Walker, trat jetzt ans Mikrofon. Sie trug einen grünen Hosenanzug, der ihr vor der Geburt der letzten drei ihrer fünf Kinder gepasst hatte, und richtete mit fröhlicher Miene selbstbewusst das Wort an Graham, der, umringt von Freunden, den Arm um die Taille seiner blonden, in weiße Spitze gewandeten und perlengeschmückten Braut gelegt, erwartungsvoll zu ihr aufschaute. »Ich war zwölf, als du geboren wurdest«, sagte sie, »und ich habe dir ungezählte Male die Windeln gewechselt. Bald wird es deine Sache sein.« Sie hob ihr Glas. »Ich wünsche euch viele Babys – und viel Geduld.« »Hört, hört!«, erscholl es im Chor, und Ruhe kehrte erst wieder ein, als eine weitere Brautjungfer in Königsblau ans Mikrofon trat. »Amanda und ich studierten zusammen«, sagte Gail Wald und lächelte die Braut voller Zuneigung an. »Und dann arbeiteten wir in benachbarten New Yorker Schulen als Psychologinnen, bis Graham sie uns wegnahm, und ich weiß nicht, ob ich ihm das jemals werde verzeihen können. Aber er hat ein Lächeln in ihre Augen gezaubert, und das ist hoch zu bewerten, denn Lächeln ist in unserer heutigen Welt Mangelware. In unserem Beruf weiß man, wie kostbar ein Lächeln sein kann, und man weiß auch ein echtes zu erkennen, und das Lächeln, das ich da bei meiner Freundin sehe, ist unzweifelhaft ein solches.« Sie hob ihr Glas und strahlte das glückliche Paar an. »Auf Amanda und Graham. Es ist sehr schnell gegangen mit euch beiden, doch so läuft das wohl, wenn zwei Menschen füreinander bestimmt sind. Ich wünsche euch, dass euch das Lächeln nie vergehen möge, und ein Leben in Gesundheit und Wohlstand.«
***
Für gewöhnlich begegnete Amanda Männern zunächst mit Vorbehalt, denn sie hatte schon als junges Mädchen in ihrer Verwandtschaft Ehen scheitern sehen, und das, was Schüler ihr im Rahmen ihrer Beratertätigkeit von daheim berichteten, bestärkte sie in ihrem Misstrauen. Liebe auf den ersten Blick gehörte für sie in die Kategorie Kitschroman. Lust konnte spontan entstehen, ja, aber nicht die Liebe. Als Therapeutin wusste sie, dass zur Liebe Vernunft und weitreichende Übereinstimmungen gehörten.
Graham O’Leary belehrte sie eines anderen. Am Abend nach ihrer ersten Begegnung in Greenwich machte er sie zum Sushi–Fan, und als sie am darauffolgenden Abend zum Tanzen gingen, war sie verloren. Graham war ein unglaublicher Tänzer. Er führte mit Routine und Anmut, und Amanda, die bis dahin stets auf Selbstständigkeit bedachte Seele, überließ sich willenlos seiner Führung. Ein Tanz reihte sich an den anderen, und als er ihre Hand auf seine Brust legte, dorthin, wo sein Herz pochte, da flog ihm ihres entgegen.
Für Graham war die Begegnung mit Amanda ein Schlüsselerlebnis. Er brauchte keine Frau, die der Vorstellung seiner Mutter oder seiner Brüder entsprach. Nicht noch einmal. Er brauchte eine Frau, die zu ihm passte, und die Art, wie sie sich beim Tanzen seinen Bewegungen anglich, deutete darauf hin, dass er sie in Amanda gefunden hatte. Er war fünfunddreißig und hatte Erfahrung mit körperlicher Anziehung, aber Amanda zog ihn nicht nur körperlich an. Sie war eine Frau mit Niveau und entsprechend zurückhaltend, doch als er sie an sich zog, erkannte er daran, wie sie ihm entgegenkam, dass auch sie Mühe hatte, ihre Gefühle zu beherrschen. Die Überraschung, die er in ihren Augen las, verriet ihm, dass er der Erste war, dem sie so schnell ihr Vertrauen schenkte.
Er würde sich bis zu seinem letzten Atemzug an diesen Moment erinnern. Er hatte sich einzigartig gefühlt. Er hatte sich ersehnt gefühlt.
***
Dorothy O’Leary, die Mutter des Bräutigams, brachte keinen Trinkspruch aus. Mit eingefrorenem Lächeln und leerem Blick stand sie etwas abseits bei ihrem Bruder und dessen Familie und schien den fröhlichen Trubel gar nicht wahrzunehmen. Erst als ihr drittältester Sohn, Peter, ans Mikrofon trat, kam Leben in ihre Augen, und ihre Züge wurden weich.
Peter O’Leary war Jesuitenpater. Mit seiner Ausstrahlung, die sein Kollar noch unterstrich, war es ihm ein Leichtes, die Aufmerksamkeit der ausgelassenen Hochzeitsgesellschaft auf sich zu ziehen. »Wenn ich mit euch beiden in den letzten Monaten nicht so viel Zeit verbracht hätte«, richtete er das Wort an Amanda und Graham, »wären mir vielleicht Bedenken hinsichtlich der Ernsthaftigkeit eurer Gefühle füreinander gekommen, als ich hörte, dass ihr in einem Country Club heiraten wolltet anstatt in einer Kirche. Aber wie die Dinge liegen, habe ich keinerlei Zweifel daran, dass euch eine tief empfundene Liebe verbindet.« Er trat auf die Frischvermählten zu, legte Graham die Hand auf die Schulter und hob sein Glas. »Sie strahlt aus euren Augen und lässt eure Gesichter leuchten. Möge es immer so sein. Mögt ihr lange leben, mögt ihr mehr geben als nehmen und mögt ihr unserem Herrn Ehre machen.« Mit einem verschmitzten Blinzeln setzt er seinen Wünschen eine typische O’Leary–Krone auf: »Und möget ihr euch zahlreich vermehren.«
***
Amanda hatte, bevor sie Graham kennen lernte, nur zwei Beziehungen gehabt, hatte sich beide Male Monate Zeit gelassen, bis sie – und auch das nach sorgfältiger Planung, was den Ort des Geschehens und die Verhütungsmethode betraf – ihre Kleider ablegte.
Bei Graham war alles anders. Er hatte einen Wanderausflug vorgeschlagen, was in Amandas Ohren allein schon herrlich aufregend klang. Sie hatte mit einer Tagestour gerechnet, aber Graham erschien mit Schlafsäcken, Verpflegung und dem Schlüssel für die Hütte eines Freundes vier Meilen bergaufwärts im Wald.
Es kam ihr nicht in den Sinn, nein zu sagen. Sie hatte noch nie eine Wanderung gemacht – und nie einen Schlafsack besessen, der warm genug gewesen wäre, um gegen die nächtliche Kälte in den Bergen zu schützen –, aber sie war überzeugt, sich Graham anvertrauen zu können. Er war vernünftig und klug. Wenn er ihr etwas erklärte, tat er es einleuchtend und mit Spaß an der Sache. Ging es um ein Gebiet, auf dem sie mehr wusste als er, scheute er sich nicht, ihr Fragen zu stellen. Und dann war da noch sein Lächeln. Noch nie hatte sie jemanden so bezaubernd lächeln sehen. Alles in allem war er der aufregendste Mann, den sie je kennen gelernt hatte.
Der Berg, den sie hinaufwanderten, war üppig begrünt, und glasklare Bäche, zwitschernde Vögel und die Aussicht, die umso atemberaubender wurde, je höher sie stiegen, machten den Ausflug zu einem denkwürdigen Erlebnis, Irgendwann endete der angelegte Weg, doch Graham kannte die Route genau, und Amanda überließ sich seiner kundigen Führung vorbehaltlos, so wie auf dem Tanzboden,
Sie kamen nicht bis zur Hütte. Nach dem Mittagessen in einer von Bäumen umstandenen kleinen Senke nahm Graham Amanda in die Arme, Sie waren verschwitzt und staubig und – wie sie geglaubt hatte – erschöpft, doch Letzteres erwies sich als Irrtum. Nachdem sie ihrer Leidenschaft nachgegeben hatten, konnten sie nicht mehr voneinander lassen. Amanda begehrte ihn so sehr, dass sie auf Verhütung verzichtet hätte, wenn Graham nicht so umsichtig gewesen wäre, dafür zu sorgen. Ihn in sich zu spüren, gab ihr die Gewissheit, ihre andere Hälfte gefunden zu haben.
***
»Meine Familie ist unverbesserlich«, sagte Kathryn O’Leary–Wood lachend, die nach ihrem Bruder Peter ans Mikrofon trat.
Ihr Blick streifte Megan Donovan, Grahams Sandkastenliebe, erste Frau und noch immer Freundin der Familie, und richtete sich dann auf Graham und Amanda. »Dieser Toast kommt von Megan und mir«, sagte sie. »Amanda – mein Bruder ist ein Hauptgewinn.
Abgesehen von seiner sensationellen Erscheinung ist er auch noch hochintelligent und sensibel, etwas ganz Besonderes. Wie mir scheint, trifft das alles auch auf dich zu.« Mit einem O’Leary–Lächeln fuhr sie fort: »Also können wir mit wunderschönen, hochintelligenten, sensiblen und ganz besonderen Babys rechnen. Ich wünsche dir und Gray alles Glück der Welt.« Sie kniff die Augen zusammen und fixierte den drei Jahre jüngeren Bruder: »Und was dich angeht, Graham O’Leary, so war das mein letzter Trinkspruch in Sachen Hochzeit. «
Der frenetische Applaus verebbte erst, als die dritte Brautjungfer das Wort ergriff. Hoch gewachsen und schlank, schaute sie schüchtern auf die ihr freundlich entgegenblickenden Gesichter hinunter und sagte leise: »Zuerst einmal möchte ich auf das Wohl von Amandas Eltern trinken, die uns allen mit diesem Fest einen so herrlichen Tag bereiten.« Sie hob ihr Glas und prostete Deborah und William Carr zu.« Als der zustimmende Beifall verstummte, wandte sie sich an die Gäste. »Ich bin Amandas älteste Freundin. Wir kennen uns seit dem Kindergarten und haben uns seitdem immer nahe gestanden. Amanda war all die Jahre stets für mich da, wenn ich sie brauchte. Sie ist eine großartige Zuhörerin, besitzt einen scharfen Verstand und ist eine absolut verschwiegene Vertrauensperson. Es überrascht mich nicht, dass sie bei den Teenagern so beliebt ist.«
***
Graham hatte schon einmal am Altar gestanden und, den Blick auf den blumenbestreuten Mittelgang gerichtet, das Erscheinen seiner Braut erwartet. Doch damals war die ganze Umgebung nicht zur Schemenhaftigkeit verblasst, und es hatte ihm auch kein Ziehen in der Brust die Tränen in die Augen getrieben.
Er empfand es als Privileg, Amanda heiraten zu dürfen. Sie war intelligent und kultiviert und schön. All diese Eigenschaften hatte er seit jeher bewundert, aber angesichts seiner Herkunft niemals für sich zu reklamieren gewagt. Trotz ihrer Unterschiedlichkeit war es bisher noch nie zu Reibungen zwischen ihnen gekommen: Sie liebten denselben Einrichtungsstil und dieselbe Musik, hatten dieselben Vorstellungen von ihrem zukünftigen Heim und denselben Wunsch nach einer großen Familie. Seit ihrer ersten Begegnung in Greenwich war er davon durchdrungen, dass er sich in Wirklichkeit nur von Megan hatte scheiden lassen, weil Amanda auf ihn wartete. Und an dem Tag der Tage sah er nur sie, wie sie über den Rasen auf ihn zuschritt, und sein Herz sagte ihm, dass es diesmal für immer war. Für immer und ewig.
***
Die Brautjungfer fing Grahams Blick ein. »Meine Freundin ist kostbar – bitte geh sorgsam mit ihr um.« Sie hob ihr Glas. »Auf euch beide. Möge die Wartezeit jede Minute wert gewesen sein.« Zustimmendes Gemurmel und Seufzer der Rührung folgten ihrer kleinen Ansprache. Und dann übernahm Malcolm O’Leary das Mikrofon, der älteste O’Leary–Spross, gemeinsam mit James, dem zweitältesten, Inhaber der Eisenwarenhandlung des verstorbenen Familienoberhauptes und fünffacher Vater. »Apropos Wartezeit«, knüpfte er an die Worte seiner Vorrednerin an. »Da habe ich einen Rat für meinen gut aussehenden Bruder und seine schöne Braut. Geht es an, Amanda und Gray! Ihr seid spät dran!«
An ihrem ersten Hochzeitstag besichtigten Amanda und Graham ein Haus. Es war nicht das erste, das sie sich ansahen, aber das erste so große, so hübsche und in einer so vornehmen Gegend gelegene. Der Preis war dementsprechend hoch angesetzt. Woodley, West Connecticut, eine wohlhabende und weitläufige Gemeinde. Sie lag etwa neunzig Autominuten von New York entfernt in einer Hügellandschaft. Unter den vierzehntausend Einwohnern gab es ein halbes Dutzend Geschäftsführer von Spitzenfirmen, ungezählte Anwälte und Ärzte und eine wachsende Zahl von Internet–Millionären. Die Bevölkerung wurde zusehends jünger. In dem Maße, wie auf bewaldeten Grundstücken neue Häuser entstanden und alte frei wurden, weil ihre Bewohner in den Ruhestand gingen und in den Süden zogen, rollten Möbelwagen durch die Stadt.
»Ihr« Haus war kaum zehn Jahre alt und eins von vieren, die, im viktorianischen Stil erbaut, eine von Bäumen gesäumte Sackgasse umstanden. Gelb getüncht und mit weißen Fensterumrandungen, war es mit der umlaufenden Veranda, dem niedrigen Lattenzaun und der Gaslaterne vorn am Plattenweg, der in den Garten hinter dem Haus führte, ebenso malerisch wie seine Nachbarn, und die Schönheit endete nicht an der Haustür. Die Eingangshalle war hell und geräumig, das Speise– und Wohnzimmer, die ihr zur Linken und Rechten lagen, schmückten Stuckdecken, Mahagoni–Einbauten und hohe Fenster. Im rückwärtigen Teil des Hauses befand sich die Küche mit Arbeitsplatten aus Granit, Holzboden und einem verglasten Frühstückserker. Eine geschwungene Treppe mit Fensterbänken auf den beiden Absätzen führte in den ersten Stock hinauf, wo vier Schlafzimmer lagen. Und als sei das nicht schon des Guten genug, zeigte ihnen die Immobilienmaklerin zu guter Letzt noch zwei Räume über der Garage.
»Büros!«, flüsterte Amanda aufgeregt, als die Frau einen Schritt zur Seite machte, um einen Anruf auf ihrem Handy entgegenzunehmen.
»Könntest du denn hier Klienten beraten?«, fragte Graham ebenfalls flüsternd.
»Ja, bestens. Könntest du hier deine Zeichnungen machen?« – »Es wäre optimal. Hast du den Wald gesehen? Hast du den Flieder gerochen? Und was sagst du zu den Schlafzimmern?«
»Sie sind riesig!«
»Bis auf das eine neben dem größten. Das könnte ein Babyzimmer werden.«
»Nein, nein.« Amanda hatte andere Pläne. »Ich würde das Bettchen in unser Zimmer stellen und aus dem Raum ein Arbeitszimmer machen. Es wäre geradezu perfekt zum Gutenachtgeschichtenvorlesen.« – »Dann geben wir Emma und Zoe das Zimmer gegenüber und quartieren Hal und Tyler ganz hinten ein.«
»Nicht Hal, bitte«, flehte Amanda. Diese Debatte hatte bereits Tradition. »Graham junior. Wenn sie nämlich nach dir und deinen Brüdern geraten, haben sie nur Unfug im Sinn, und da wäre es vernünftig, sie zwecks Kontrolle in unserer Nähe zu behalten.«
»Hal«, beharrte Graham auf seiner Idee, »und ich will sie weiter weg haben. Jungen machen Krach. Du wirst mich bald verstehen.«
Er schlang einen Arm um ihre Taille und zog sie zu sich heran. Seine Lider wurden schwer. »Hast du das Diaphragma beseitigt?«, flüsterte er heiser.
Amanda war so erregt, dass sie kaum atmen konnte. »Hab ich.«
»Wir machen ein Baby?«
»Heute Nacht.« Sie hatten sich ein Jahr damit Zeit gelassen, um einander ungestört zu genießen, denn wenn ein Baby erst einmal da war, war nichts mehr, wie es war.
»Wenn dieses Haus uns gehörte«, sein Flüstern klang noch heiserer, »wo würdest du ...?«
»In dem Erker in der Küche«, flüsterte sie, und ihre Stimme vibrierte, »dann könnten wir uns in ein paar Jahren über die Köpfe der Kinder hinweg ansehen und unser kleines Geheimnis genießen. Und wo würdest du ...?«
»Im Garten. Ganz hinten unter den Bäumen, weit weg von den Nachbarn. Das wäre dann wie unser allererstes Mal.«
Das allererste Mal war lange her, und inzwischen drängten ihre Träume nach Verwirklichung. »Dieses Haus ist ideal, Gray. Dieses Viertel ist ideal. Hast du die Baumhäuser und Schaukeln gesehen? Hier wohnen nette Leute mit Kindern. Können wir es uns leisten, hierher zu ziehen?«
»Nein. Aber wir werden es tun.«
***
An ihrem zweiten Hochzeitstag gingen sie gemeinsam zum Frauenarzt. Sie hatten seit einem Jahr ungeschützt miteinander geschlafen, ohne dass eine Empfängnis eingetreten war. Nach Monaten der Verleugnung. Monaten, in denen sie einander immer wieder versichert hatten, dass es nur eine Frage der Zeit sei, mussten sie sich nun doch mit der Möglichkeit, der Unmöglichkeit befassen. Nach einer ausführlichen Untersuchung erklärte der Gynäkologe Amanda für körperlich gesund und teilte seinen Befund anschließend auch Graham mit, nachdem man ihn ins Sprechzimmer gebeten hatte. Erst als Graham sie lächelnd an sich zog, wagte Amanda aufzuatmen. »Ich hatte solche Angst«, gestand sie dem Arzt verlegen. »Die Leute erzählen die schlimmsten Schauergeschichten.«
»Hören Sie nicht hin.«
»Das ist leichter gesagt als getan.« Die dramatischsten Storys lieferten ihre Schwägerinnen, wobei sie aber nicht etwa aus ihrem eigenen Erfahrungsschatz schöpften. Nein, die Katastrophenberichte hatten sie von Freundinnen oder Freundinnen von Freundinnen. Die O’Learys hatten keinerlei Probleme mit der Fortpflanzung. Amanda und Graham fielen da völlig aus dem Rahmen.
Der Arzt lehnte sich zurück und faltete in einer väterlichen Geste die Hände über seinem beeindruckenden Bauch. »Ich bin jetzt seit über dreißig Jahren Arzt und weiß, wie Probleme aussehen. Das Einzige, was ich hier sehe, ist Ungeduld.« – »Können Sie uns die verübeln?«, fragte Graham. »Amanda ist zweiunddreißig, und ich bin schon achtunddreißig!« – »Aber Sie bemühen sich erst seit einem Jahr um Nachwuchs. Das ist nicht gerade lange.« Er schaute über den Rand seiner Brille auf die Notizen, die er sich zuvor gemacht hatte. »Ich würde ja auf Stress tippen, aber Sie sind offenbar beide glücklich in ihrem Beruf.«
»O ja!«, bestätigten sie wie aus einem Munde. Es war ein höchst erfolgreiches Jahr gewesen.
»Und Sie wohnen gerne in Woodley?«
»Sehr gerne«, Graham nickte, »das Haus ist ein Traum.«
»Das gilt auch für die Nachbarschaft«, ergänzte Amanda. »Es sind sechs Kinder da mit großartigen Eltern. Und dann gibt es noch ein älteres Paar ...« Sie brach ab und warf Graham einen kummervollen Blick zu.
»June ist vor kurzem gestorben«, erklärte er dem Gynäkologen.
»Sechs Wochen zuvor war Krebs diagnostiziert worden. Sie wurde nur sechzig Jahre alt.«
Amandas Stimme zitterte, als sie weitersprach. »Ich liebte diese Frau. Jeder liebte sie. Sie war wie eine Mutter – nein, besser als eine Mutter. Man konnte mit allem zu ihr kommen. Sie hörte zu und hatte oft eine ganz einfache Lösung für ein Problem parat. Ihr Mann ist verloren ohne sie.«
»Was hat sie denn zu ihrem Fertilitätsproblem gesagt?«, erkundigte sich der Arzt.
»Dass wir uns gedulden sollten – dann würde es schon klappen.«
Der Gynäkologe nickte. »So sehe ich das auch. Körperlich sind Sie in Ordnung. Alles ist da, wo es hingehört. Ihre Menstruation ist regelmäßig, wir wissen also, dass ein Eisprung stattfindet.«
»Aber es ist jetzt schon ein Jahr! In den Büchern steht ...«
»Vergessen Sie die Bücher«, befahl er, jedoch in gutmütigem Ton. »Fahren Sie mit Ihrem Mann nach Hause und genießen Sie einander.«
An ihrem dritten Hochzeitstag fuhren Amanda und Graham zu einem Spezialisten nach New York. Er war schon ihr dritter Arzt. Den ersten hatten sie aufgegeben, nachdem er stur darauf beharrt hatte, dass alles in bester Ordnung sei. Amanda und Graham waren nicht etwa überzeugt, dass etwas nicht stimmte, aber sie fanden doch, dass ein paar Untersuchungen nicht schaden könnten. Also suchten sie vor Ort als zweiten einen Fachmann für Fruchtbarkeitsstörungen auf. Er führte ihr Fertilitätsproblem auf ihr Alter zurück.
»Na, großartig«, machte Graham seiner und Amandas Enttäuschung Luft. »Und was ist nun zu tun?«
Der Mann zuckte mit den Schultern. »Sie können die Uhr nicht zurückdrehen.«
Amanda entschloss sich, die Frage neu zu formulieren. »Wie behandeln Sie ... ältere Paare, die sich ein Kind wünschen?«
»Ältere Paare?«, echote Graham empört. »Wir sind im Schnitt sechsunddreißig. Das ist nicht alt!«
Sie hob die Hand, um ihn zum Schweigen zu bringen und dem Arzt die Gelegenheit zur Beantwortung ihrer Frage zu geben.
»Nun, da gibt es die AI: die IUI und ICSI. Und wenn das nicht klappt, gibt’s noch die IVE«
»Übersetzen Sie uns das bitte, wir wissen nämlich nicht, was Sie meinen«, bat Graham.
»Ja, bitte, so ist es«, schloss Amanda sich ihm an.
»Das ist Ihnen alles fremd?«, wunderte sich der Arzt. »Normalerweise informieren sich Paare in Ihrer Situation.«
»Der Arzt, bei dem wir zuletzt waren, erklärte uns, es sei alles in bester Ordnung und es bestehe kein Anlass, sich mit speziellen Verfahren zu befassen«, verteidigte Amanda ihren Mann und sich.
»Wollen Sie ein Kind, oder nicht?« Der Ton des Arztes war nicht unfreundlich, aber Graham fühlte sich dennoch angegriffen. »Dieses Gespräch führt zu nichts«, meinte er und stand auf. Amanda nickte. Sie suchten Verständnis, nicht Kritik. Der Arzt zuckte mit den Schultern. »Auch wenn Sie noch zehn Ärzte aufsuchen, werden Sie keine andere Auskunft erhalten. Es bleibt Ihnen die Möglichkeit der artifiziellen beziehungsweise künstlichen Insemination: der intrauterinen Insemination, bei der aufbereitete Samenzellen per Katheter in die Scheide oder Gebärmutterhöhle eingebracht werden, der intrazytoplasmatischen Spermainjektion, bei der eine einzige Samenzelle direkt in das Zytoplasma der Eizelle injiziert wird, und der In–vitro–Fertilisation, bei der dem Eierstock eine oder mehrere Eizellen entnommen, diese im Labor mit aufbereiteten Samen befruchtet und zwei oder drei Tage nach der Befruchtung in die Gebärmutter eingesetzt werden. Ich muss Ihnen aber fairerweise sagen, dass Sie, wenn Sie alle Methoden durchprobiert haben, nicht nur um ein Vermögen ärmer sein werden, sondern außerdem um einiges älter und entsprechend weniger befruchtungsbereit.«
Als Amanda Grahams Kopfbewegung in Richtung Tür auffing, war sie wie der Blitz an seiner Seite und Sekunden später mit ihm aus der Tür. Und so verbrachten sie ihren dritten Hochzeitstag in einer New Yorker Arztpraxis. Der Arzt wirkte mitfühlend und tüchtig und führte gleich zu Beginn zur Abklärung der Unfruchtbarkeit eine ganze Reihe von Untersuchungen durch, von denen einige erstmalig Graham einbezogen. Als die ersten Resultate keine Erklärung für die Nichterfüllung des Kinderwunsches lieferten, drückte er ihnen einen ganzen Stapel einschlägiger Literatur und einen Ordner mit Anweisungen und Karten in die Hand und schickte sie mit dem Rat nach Hause, sich von den noch ausstehenden Untersuchungsergebnissen keine Überraschungen zu erwarten. Amanda solle ihre fruchtbaren Tage ergründen, indem sie täglich ihre Aufwachtemperatur messe und die Basaltemperatur in eine Karte eintrage, und Graham sei zu empfehlen, Quantität und Qualität seiner Spermien zu maximieren, indem er es zu einer Ejakulation nur alle zwei bis drei Tage kommen lasse. Auf der Rückfahrt nach Woodley witzelten sie darüber, doch ihr Lachen war nicht echt. Zwangsläufig verlor ihre Zweisamkeit die Unbeschwertheit und Spontaneität. Das Ziel, ein Kind zu zeugen, drängte das Vergnügen in den Hintergrund, und mit jedem Monat, in dem sich das Ziel als nicht erreicht erwies, wuchs ihr Unbehagen.
***
Ihren vierten Hochzeitstag verbrachten sie in aller Stille zu Hause. Amanda hatte sich noch nicht gänzlich von dem kleinen Eingriff erholt, den die Leiterin einer Klinik für Infertilitätsbehandlung, eine halbe Autostunde südlich von Woodley entfernt, an ihr vorgenommen hatte. Die Frau war in den Vierzigern, Mutter von drei kleinen Kindern unter sechs und voller Verachtung für Kollegen, die Unfruchtbarkeit, wenn sie keinen medizinischen Grund dafür finden konnten, auf eine emotionale Störung des Rat suchenden Paares schoben, wie es Graham und Amanda zuletzt in Manhattan erlebt hatten. Sie stellte nicht nur andere Fragen als ihre Vorgänger, sie führte auch andere Untersuchungen durch. Sie entdeckte bei Amanda die Verklebung eines Eileiters. Obwohl deren Geringfügigkeit bezweifeln ließ, dass sie die Ursache der ungewollten Kinderlosigkeit darstellte, riet Emily – sie hatte darauf bestanden, mit dem Vornamen angesprochen zu werden – sicherheitshalber zur Beseitigung des Störfaktors.
Amanda und Graham überlegten nicht lange. Sie hatten gehofft, inzwischen drei Kinder zu haben – Hal, Emma und Tyler –, und das Haus, das sie im Hinblick darauf gekauft hatten, erschien ihnen allmählich quälend groß und still.
An ihrem vierten Hochzeitstag schliefen sie nicht miteinander. Zum einen war Amanda noch nicht wieder ganz auf der Höhe, und zum anderen hätten Grahams Spermien an diesem Tag nichts ausrichten können. Er brachte ihr das Frühstück ans Bett und schenkte ihr ein Paar Ohrringe in Herzform. Sie umarmte ihn zärtlich und schenkte ihm ein Buch über exotische Büsche. Dann fuhr er zur Arbeit.
Was ihre Jobs betraf, so konnten sie an diesem Tag eine durchaus erfreuliche Bilanz ziehen. O’Leary Landscape Design florierte. Graham hatte im Zentrum von Woodley Büroräume gemietet, in denen zwei Vollzeitkräfte und ein Geschäftsführer saßen. Er war ein bevorzugter Kunde der drei größten Baumschulen im Westen von Connecticut und kaufte regelmäßig bei Baumfarmen in Washington und Oregon und bei Buschfarmen in North und South Carolina ein. Zwei von Wills Mannschaften waren ständig für ihn im Einsatz.
Amanda war zur psychologischen Koordinatorin von Woodleys Schulen ernannt worden, was ihr die Möglichkeit gab, ein leicht antiquiertes System zu modernisieren. Es bedeutete, dass sie Schülern auf Ebenen begegnete, die die jungen Leute nicht als bedrohlich empfanden – auf Führungsseminaren, beim Mittagessen oder im Rahmen der Programme für gemeinnützige Jugendarbeit. Es bedeutete auch Fünf-Minuten-Gespräche und nicht nur die an sich üblichen Fünfundvierzig-Minuten-Sitzungen sowie E-Mail-Kommunikation, wenn Schüler sich einem Psychologen nur auf diesem Wege öffnen konnten. Es bedeutete, in schwierigen Fällen mit beratenden Psychologen und in rechtlichen Angelegenheiten mit Anwälten zusammenzuarbeiten. Es bedeutete die Bildung und Unterweisung eines Kriseninterventionsteams.
Graham und Amanda hatten ihr Haus, ihre Jobs, ihre Nachbarn und ihre Liebe. Das Einzige, was ihnen zu ihrem Glück noch fehlte, war ein Kind.
***
Zwei Monate vor ihrem fünften Hochzeitstag trafen Amanda und Graham sich zum Mittagessen in der Stadt. Sie sprachen über ihre Arbeit, sie sprachen über das Wetter, und sie beschäftigten sich ausführlich mit der Speisekarte. Kein Wort fiel über das, was Amanda an diesem Vormittag erlebt hatte – eine Ultraschalluntersuchung zur Messung ihrer Follikel –, oder das, was sie beide an diesem Nachmittag erwartete: Von Graham wurde Ejakulat zur Spermiengewinnung erwartet, und Amanda sollte anschließend mit den aufbereiteten Samenzellen befruchtet werden. Eine erfolglose Insemination lag bereits hinter ihnen. Dies wäre nun die zweite von drei möglichen. Kurze Zeit später lag Amanda allein in einem schmucklosen Behandlungsraum des Krankenhauses. Graham hatte seine Aufgabe erfüllt und war wieder zur Arbeit gefahren. Emily hatte auf dem Weg zu einer Untersuchung nur schnell hallo gesagt und war wieder verschwunden. Nach einer Amanda endlos erscheinenden Wartezeit kam eine Frau herein, die sich als medizinische Technikerin vorstellte. Amanda schätzte sie auf maximal einundzwanzig. Als ihr Versuch, eine Unterhaltung in Gang zu bringen, auf taube Ohren stieß, starrte sie gottergeben an die Decke, während die abweisende junge Frau ihr Grahams Sperma einspritzte. Danach wurde sie wieder allein gelassen. Amanda kannte den Ablauf ja bereits. Sie würde zwanzig Minuten auf dem Rücken auf dem nach hinten gekippten gynäkologischen Stuhl liegen, um den Samenzellen den Weg zum Ovar zu erleichtern, sich anschließend anziehen, nach Hause fahren und die nächsten zehn Tage in quälender Ungewissheit verbringen.
Während die Minuten in dem stillen Zimmer dahinschlichen, bemühte sich Amanda, ihrer inneren Unruhe Herr zu werden, was ihr aber nicht gelang. Und dann verspürte sie plötzlich ein Ziehen im Unterleib. Sie hätte gerne geglaubt, dass das ein Hinweis auf den Beginn eines Lebens in ihr war, doch sie wusste es besser. Dieses Ziehen war ein Ausdruck von Angst.
Kapitel 1
Graham O’Leary arbeitete wie besessen. Wieder und wieder trieb er den Spaten in den Boden und schleuderte Erdladung um Erdladung über den Rand der Pflanzgrube, die für einen Baum ausgehoben werden musste. Seine Muskeln schmerzten, die Anstrengung tat ihm aber trotzdem gut, denn sie half ihm einigermaßen über seine Nervosität hinweg. Heute war Dienstag – der Tag der Entscheidung. Amanda würde entweder ihre Periode bekommen oder ihre Bemühungen würden endlich Wirkung zeigen. Er hoffte inständig, dass es diesmal geklappt hatte, aber nicht nur, weil er ein Kind haben wollte, sondern auch um ihrer Ehe willen. Die allmonatliche Enttäuschung stellte eine wachsende Belastung für sie beide dar. Es war, als wüchse eine Mauer zwischen ihnen in die Höhe, die sie zu trennen begann. Er spürte, dass seine Frau sich innerlich von ihm entfernte.
Graham hatte das schon einmal erlebt.
Vor Anstrengung keuchend, hievte er eine weitere Erdladung über den Rand. Als er den Spaten erneut ansetzte, traf er auf Stein. Fluchend richtete Graham sich auf, wischte sich mit dem Unterarm den Schweiß vom Gesicht und setzte den Spaten wieder an. Er schob ihn unter den Felsbrocken, hebelte ihn heraus, hob den schweren Steinklotz hoch und wuchtete ihn auf den Rand der inzwischen bereits beachtlichen Grube. Danach arbeitete er weiter, schaufelte und schaufelte unermüdlich mit der Präzision eines Metronoms.
»Hey.«
O ja, er wusste, wie es war, wenn eine Frau sich von ihm entfernte. Megan hatte es auch irgendwann getan. Langsam, aber unaufhaltsam war sie ihm immer mehr entglitten, bis er nicht mehr wusste, wie er sie noch erreichen sollte. Bei ihr hatte er es sich nicht erklären können. Bei Amanda kannte er den Grund, aber das machte es nicht erträglicher für ihn. Früher waren sie sich immer einig gewesen. In jeder Hinsicht. Das war vorbei. Während er schwer atmend und schweißüberströmt tiefer und tiefer grub, rekapitulierte er die Auseinandersetzung, die sie in der vergangenen Woche gehabt hatten, nachdem er mit der Überlegung gekommen war, dass sie vielleicht entspannter und somit empfängnisbereiter sein würde, wenn sie arbeitsmäßig kürzer träte. Schließlich müsse sie nicht ein Dutzend Programme leiten, meinte er, in seiner Ansicht nach freundlichem Ton, es könnten auch die anderen etwas tun. Damit bekäme sie Gelegenheit, an ein, zwei Tagen in der Woche schon mittags heimzufahren. Dann hätte sie Zeit zum Lesen oder Kochen oder zum Fernsehen.
Sie war ihm regelrecht ins Gesicht gesprungen, und er hatte sich geschworen, dieses Thema nicht noch einmal anzuschneiden.
»Gray.«
Zähneknirschend hebelte er einen weiteren Felsbrocken aus dem Boden. Ja, es stimmte, auch er arbeitete jeden Tag lange – aber immerhin war es nicht sein Körper, in dem sich ein Kind einnisten sollte. Natürlich würde er sich hüten, ihr dieses Argument zu bringen. Sie war auch so schon schlecht genug auf ihn zu sprechen.
»Hey, du!«
Es wurde wirklich zusehends schwieriger, mit ihr auszukommen. Sie hatte ihm doch tatsächlich verübelt, dass er nicht bei ihr geblieben war, als sie das zweite Mal künstlich befruchtet wurde. Dabei hatte sie gesagt, er solle gehen! Jetzt behauptete sie, sie habe lediglich gesagt, er könne ruhig gehen, wenn viel Arbeit auf ihn wartete.
»Graham!«
Er schreckte aus seinen Gedanken auf und schaute nach oben. Sein Bruder Will ging am Rand der Grube in die Hocke.
»Hey. Ich dachte, ihr wärt abgezogen.« Die Mannschaft arbeitete von sieben bis drei, und es war schon kurz vor fünf.
»Ich bin eben noch mal zurückgekommen. Was machst du?«
Graham rammte den Spaten in den Boden und strich sich die nassen Haare aus der Stirn.
»Ich schaffe die Voraussetzungen dafür, dass der Baum hier Wurzeln schlagen kann«, antwortete er mit einem Blick zu dem Giganten, von dem er sprach. Es war eine stattliche, neun Meter hohe Papierbirke, die das Herzstück des Innenhofes sein würde, den er entworfen hatte. Es hatte ihn viel Zeit gekostet, genau das Exemplar zu finden, das ihm vorschwebte. »Die Abmessungen der Grube sind von entscheidender Bedeutung.«
»Das weiß ich«, nickte Will. »Aber von Hand kannst du die Grube nicht ausheben. Ich habe für morgen einen Bagger bestellt.«
»Ist schon klar. Mir war einfach nur nach körperlicher Betätigung.«
Damit griff er wieder zum Spaten.
»Hat sich Amanda schon gemeldet?«
»Nein.«
»Du hast doch gesagt, sie würde anrufen, sobald sie Bescheid wüsste.«
»Daraus kann man entnehmen, dass sie noch nicht Bescheid weiß«, gab Graham gereizt zurück. Doch er bedauerte es sofort. »Tut mir Leid«, entschuldigte er sich.
»Schon okay«, winkte Will gutmütig ab. »Vielleicht solltest du sie mal anrufen.«
»Nein«, lehnte Graham ab. »Dann beschwert sie sich bloß, dass ich sie unter Druck setze.«
»Ist ein bisschen schwierig, dein kleines Frauchen, was?«
Graham stieß ein freudloses Lachen aus und schaufelte eine Ladung Erde aus dem Loch. »Angeblich ist das eine Nebenwirkung des Medikaments, das sie nimmt. Clomifen heißt das Zeug. Na ja – ich stehe auch unter Strom, und das ganz ohne Pillen. Für mich ist das Ganze auch kein Zuckerschlecken. Allmählich fühle ich mich wie ein Neutrum.«
»Dazu hast du keine Veranlassung«. Will grinste. »Du bist durchaus noch interessant für die Damenwelt. Hast du deine Zuschauerin nicht bemerkt?«
Graham wischte sich zum x-ten Mal den Schweiß vom Gesicht und warf seinem Bruder einen Blick zu, der besagte, dass er ihn für einen Spinner hielt. »Doch.« Er fing wieder an zu graben.
»Ein hübsches Ding.«
»Ihr Mann ist eine Internet–Größe. Die beiden sind gerade mal dreißig und haben Geld wie Heu. Offenbar weiß die Gute nicht, was sie mit sich anfangen soll und schaut mir deshalb zu.«
»Ich denke, du gefällst ihr. So, mein Junge, ich muss los – Mikey und Jake haben Training, und ich bin heute der Coach.« Er richtete sich auf. »Mach nicht mehr zu lange, hörst du. Lass dem Bagger was übrig.«
Aber Graham grub noch eine Weile weiter. Die Vorstellung, dass Will mit seinen Söhnen Baseball spielte, nagte an ihm. Doch irgendwann verließen ihn seine Kräfte, und er gab auf. Bei seinem dunkelgrünen Pick-up angekommen, auf dessen Seiten in weißen Lettern das Firmenlogo prangte, nahm er als Erstes einen großen Schluck aus der Wasserflasche, die er in einer Kühlbox bei sich hatte. Dann schüttete er etwas auf ein Handtuch, reinigte sich, so gut es ging, zog das bunte Baumwollhemd wieder an, in dem er gekommen war, und machte sich auf den Heimweg.
***
»Sie sind am Zug«, sagte Jordie Cotter von der Kante des Clubsessels in Amandas Büro aus. Er war fünfzehn und so strohblond wie seine drei jüngeren Geschwister. Die Cotters wohnten ebenfalls in der Sackgasse, zwei Häuser weiter, und so hatte sie ihm keine Fragen stellen müssen, um seinen familiären Hintergrund zu erkunden. Der Junge hatte nicht um eine Beratung gebeten – offiziell war er gekommen, um seine Aufgabe im Rahmen des gemeinnützigen Programms mit ihr zu besprechen, das sie betreute –, aber er saß nun schon zum dritten Mal hier, und das ließ tief blicken.
Dankbar für die Ablenkung von der bangen Baby–oder–nicht–Baby–Frage, begutachtete Amanda kritisch die Situation auf dem Spielbrett. Fünf schwarze Damen standen drei weißen ungekrönten Häuptern gegenüber. Die weißen Steine gehörten ihr, was bedeutete, dass ihre Niederlage nur eine Frage der Zeit war.
»Es bleiben mir nicht mehr viele Möglichkeiten«, seufzte sie.
»Ziehen Sie.«
Amanda entschied sich für ein Manöver, das sie, wie sie meinte, nur einen Spielstein kosten würde. Als Jordie zwei Steine übersprang, sog sie hörbar die Luft ein. »Das habe ich nicht kommen sehen.« Er lächelte nicht, riss nicht triumphierend die Faust hoch, konstatierte lediglich: »Sie sind dran.«
Sie zögerte. Als sie aufsah, schaute sie in ein ernstes Gesicht. »Sie sind dran«, wiederholte Jordie. Sie verschob ihren letzten Stein, der Junge übersprang ihn und lehnte sich zurück. Er hatte gewonnen, aber von Siegerstolz war nichts zu merken. »Haben Sie mich gewinnen lassen?«, fragte er.
»Warum hätte ich das tun sollen?«
Er zuckte mit den Schultern und ließ den Blick zum Fenster wandern.
Seine Glieder waren noch schlaksig, seine Gesichtszüge noch unfertig, aber es war schon jetzt zu erkennen, dass ein gut aussehender Mann aus ihm werden würde. Sein T–Shirt und die Jeans waren sauber, die Haare gepflegt und modisch geschnitten, und er hatte eine reine Haut. Die hatten allerdings die meisten Schüler hier. In wohlhabenden Gemeinden wie Woodley waren Dermatologen ebenso gefragt wie Kieferorthopäden.
»Es ist Ihnen wichtig, dass man sie mag«, antwortete er, ohne sie anzusehen. »Wenn Sie verlieren, machen Sie sich beliebt.« – »Da hast du nicht Unrecht«, gab sie zu. »Als ich noch zur Schule ging, habe ich manchmal absichtlich eine Schulaufgabe verhauen, um nicht als Streberin dazustehen.«
»Das würde ich nie tun«, sagte Jordie.
Vielleicht nicht aus demselben Grund, dachte Amanda, aber Tatsache war, dass seine Noten sich im zweiten Halbjahr dramatisch verschlechtert hatten. Irgendetwas stimmte nicht mit dem Jungen. Dafür sprach auch seine ständig ernste Miene.
»Hat meine Mom was zu Ihnen gesagt?«, fragte er.
»Wegen deiner Noten? Nein. Und sie weiß nicht, dass wir uns unterhalten haben.«
»Wir haben uns eigentlich nicht unterhalten – nicht wirklich.«
Er schaute auf das Spielbrett hinunter. »Das hat doch nichts mit einer Unterhaltung zu tun. Es macht nur mehr Spaß als Hausaufgaben.«
Amanda fasste sich melodramatisch ans Herz. »Oh, das schmerzt.«
»Sie haben die Sachen doch hier, damit sie benutzt werden, oder?«
»Ich nenne sie Eisbrecher.«
»Ist Harry Potter auch so einer?«, fragte er mit einem Blick zu dem Buch auf ihrem Schreibtisch.
»Ja. Ich finde Harry Potter cool.«
»Die Zwillinge sind ganz wild auf ihn.« Seine Zwillingsbrüder waren acht. »Aber ganz geheuer ist er ihnen nicht. Ich habe ihnen erzählt, dass Harry auf seinem Besenstiel durch unseren Wald fliegt. Seitdem habe ich dort meine Ruhe vor ihnen. Unser Wald ist cool. Er ist real. Harry ist das nicht.« Er beugte sich vor und begann, die Spielsteine wieder in Reih und Glied aufzustellen.
»Eigentlich bin ich ja wegen Ihres Programms hier. Ich würde gerne als Schülerberater arbeiten, aber das geht nicht.«
»Warum denn nicht?«
»Ich bin nicht gut im Reden.«
»Du redest doch bestimmt mit deinen Freunden?«
»Sie reden – ich höre zu.«
»Ja, das ist ja ideal«, ermutigte Amanda ihn. »Als Schülerbrater muss man zuhören können.«
»Manchmal möchte ich aber auch was sagen.«
»Zum Beispiel?«
Er hob den Blick und sah sie unglücklich an. »Zum Beispiel, dass mich die Schule ankotzt, dass mich mein Zuhause ankotzt, dass mich Baseball ankotzt.«
»Baseball? Ich dachte, du magst Baseball.« Er war direkt vom Training zu ihr gekommen.
»Ich würde Baseball mögen, wenn ich spielen dürfte – aber ich sitze bloß auf der Bank. Können Sie sich vorstellen, wie peinlich das ist, wenn mich die Kids da sehen und meine Eltern? Wieso müssen sie überhaupt zu den Spielen kommen? Meine Mom ist ständig wegen irgendwas in der Schule. Julie gefällt das, aber die ist schließlich erst sechs.«
»Deine Mutter tut viel für die Schule.«
»Können sie sich vorstellen, wie peinlich das ist?« »Offen gestanden, nein«, spielte Amanda auf Risiko. »Ich hätte mich gefreut, wenn meine Eltern sich in der Schule engagiert oder für mich interessiert hätten, aber sie verwendeten ihre ganze Zeit und Energie auf ihre Streitereien.«
Jordie zog die Schultern hoch. »Meine streiten auch – aber nur, wenn sie glauben, wir bekämen es nicht mit.« Amanda schwieg.
»Wir müssen es gar nicht hören – wir sehen, dass da was im Busch ist«, fuhr der Junge fort, »Mom lächelt kaum noch, und sie veranstaltet auch keine Pyjamapartys mehr.« Er grinste schief. »Ich bin für so was natürlich schon zu alt, aber Julie und die Zwillinge hätten noch Spaß daran. Früher waren oft zwanzig Kinder auf einmal da, und es gab Popcorn und Pizza und Videos, und es störte mich nicht mal, wenn die Kleinen mich und meine Freunde nervten, weil das einfach dazugehörte, verstehen Sie?« Seine Begeisterung wich Verdrossenheit. »Jetzt streckt sie nur noch den Kopf zu meiner Zimmertür herein und löchert mich mit Fragen.«
»Arschloch!« Amanda bedachte den neongrünen Papagei, der in einer Ecke des Zimmers in einem großen Käfig saß, mit einem strafenden Blick.
»Das sagt man nicht, Maddie.«
Jordie schaute den Vogel an. »Sie sagt das immer. Wie kommt es, dass Sie sie behalten dürfen?«
»Wenn Mr Edlin oder einer der Lehrer hier ist, benimmt sie sich untadelig. Die wissen gar nichts von ihrem skandalösen Wortschatz.« Auch Maddie war ein Eisbrecher. Manche Schüler brachten dem Vogel einen Monat lang täglich Leckerbissen, bis sie sich heimisch genug fühlten, um sich Amanda anzuvertrauen.
»Du bist ein braves Mädchen«, gurrte Amanda in Richtung Käfig.
»Ich liebe dich«, antwortete Maddie.
»So schnell kann sie umschalten?«, staunte Jordie. »Was ist sie – lieb oder ungezogen?«
»Lieb. Eindeutig lieb. Auch ein liebes Geschöpf kann schlimme Dinge sagen, wenn man es provoziert. Maddie lernte die Schimpfworte von jemandem, der sie mit einem Besen zu jagen pflegte. Sie weiß, wie Zorn klingt – und sie hat ihn gehört, als du über Baseball sprachst.«
»Ich habe nicht über Baseball gesprochen, als sie fluchte«, sagte Jordie.
Nein – er hatte über seine Mutter gesprochen, und das wusste er natürlich genau. Unvermittelt kam er auf die Füße und hängte sich sein Schulpack über die Schulter. Es fiel ihm schwer, über seine Eltern zu sprechen, und noch schwerer, seine Gefühle in Worte zu fassen.
Eigentlich hätte er einen fremden Therapeuten gebraucht, einen, der die Familie nicht kannte, doch weder er noch seine Eltern hatten sie bisher darauf angesprochen. Amanda hätte ihn gerne zum Bleiben bewegt, doch bevor sie etwas sagen konnte, war er aus der Tür, und sie hörte ihn in den Flur hinuntertrotten.
Warte, hatte sie sagen wollen. Lass uns reden. Über deine Eltern, die sich streiten und darüber, wie dir dabei zumute ist, darüber, was du tust, wenn du eigentlich lernen solltest, was du denkst, wenn du traurig bist. Ich habe Zeit. Wir können reden, so lange du willst.
Aber er war zu schnell gewesen. Wieder allein, schaute sie, wie schon oft an diesem Tag, Grahams bärtiges Gesicht an, das ihr aus einem rechteckigen Schieferrahmen entgegenlächelte, der auf dem Schreibtisch stand. Es war ein Gesicht, das die meisten ihrer weiblichen Besucher gefangen nahm. Auch Graham O’Leary war ein Eisbrecher.
Sicher wartete er bereits ungeduldig auf ihren Anruf, aber sie hätte ihm noch nichts sagen können, und es könnten noch Stunden vergehen, bis sie Bescheid wüsste. Seit ihr Kinderwunsch sich zu einer Manie ausgewachsen hatte, stand Amanda unter einem ständigen, quälenden Druck. Graham hatte seinen Teil zum Gelingen beigetragen, sogar mehrfach – ihr Körper war das Problem. Ihr Mann sprach das zwar nicht aus, doch seine zunehmende Gereiztheit war beredt genug.
Aber was sollte sie noch tun? Sie hielt sich strikt an Emilys Anweisungen, ernährte sich gesund, strapazierte sich nicht und sorgte für ausreichende Bewegung – außer heute. Um nur ja nicht ihre Periode zu forcieren, hielt sie sich so ruhig wie möglich. Natürlich war das unsinnig, denn normale Bewegungen würden niemals zum Abbruch einer normalen Schwangerschaft führen, doch Amanda war an einem Punkt angelangt, wo ihr jeder Schritt riskant erschien. Deshalb hatte sie ihr Büro nicht verlassen, war weder zum Mittagessen gegangen noch auf die Toilette. Letzteres würde allerdings in naher Zukunft unvermeidlich werden.
Amanda warf einen Blick auf ihre Armbanduhr. Es war halb sechs. Sie hatte Quinn Davis mitgeteilt, er würde sie bis sechs antreffen. Seine E–Mails beunruhigten sie. Die erste Mail vom frühen Morgen hatte gelautet: »Ich muss mit Ihnen reden, aber privat. Ist das okay?« »Absolut«, hatte sie geantwortet. »Was du mir erzählst, bleibt unter uns, das garantiert dir meine Schweigepflicht. Ich habe in der dritten Stunde Zeit. Geht das?« Er war in der dritten Stunde nicht gekommen, aber dafür in der vierten eine zweite E–Mail: »Müssen meine Eltern erfahren, dass ich bei Ihnen war?«
»Nein«, erwiderte Amanda. »Sie erfahren es nur, wenn du mir eine Einverständniserklärung unterschreibst. Ich habe nach dem Unterricht eine halbe Stunde für dich Zeit, aber wenn du zum Baseballtraining musst, können wir uns auch später sehen. Ich bin bis sechs Uhr hier. Ist das okay?«
Er hatte nicht geantwortet, und sie hatte auch, während Jordie hier war, keine Schritte auf dem Flur gehört, die darauf hingedeutet hätten, dass Quinn gekommen und wieder gegangen war, als er merkte, dass sie jemanden bei sich hatte.
Quinn Davis war ein Star, Oberstufensprecher, Schülerberater, Star des Basketballteams im letzten Winter und jetzt das Wunderkind der Baseballmannschaft. Zwei ältere Brüder hatten die Woodley High mit Spitzenzeugnissen verlassen und waren derzeit in Princeton beziehungsweise West Point. Die Eltern, hiesige Aktivisten, engagierten sich in Hartford ständig für dies oder das und wurden dementsprechend oft in der Zeitung erwähnt. Was der Junge wohl auf dem Herzen hatte? Es musste ziemlich gravierend sein, sonst würde er wohl kaum so großen Wert auf die Geheimhaltung ihres Gesprächs legen. Aber warum kam er dann nicht? Amanda hatte Mühe, die Augen offen zu halten. Der Tag war zwar anstrengend gewesen, aber diese Müdigkeit rechtfertigte er nicht. Könnte es ein frühes Schwangerschaftssymptom sein? Bei dem Gedanken verkrampfte sich Amandas Magen vor Nervosität. Sie schaute an sich hinunter und malte sich eine Wölbung unter dem Oberteil ihres pflaumenblauen Hosenanzugs aus weich fließendem Stoff aus. In ihrem Job verlangte auch die Wahl der Kleidung Sorgfalt. Sie durfte nicht einschüchternd–streng wirken, musste aber Autorität und Reife vermitteln, was für Amanda, die mit ihrer zierlichen Figur und den ungebärdigen blonden Locken eher wie fünfundzwanzig als wie fünfunddreißig aussah, eine echte Herausforderung darstellte.
Plötzlich krachte draußen etwas gegen die Tür. Ein unterdrückter Schreckenslaut folgte, dann trat wieder Stille ein. Das musste Quinn sein! War er gestürzt? Amanda sprang, alle Vorsicht vergessend, alarmiert auf und durchquerte im Laufschritt das Zimmer.
Es war nicht Quinn, dem sie sich gleich darauf gegenübersah, sondern der Hausmeister.
»Johnny ist da!«, krähte der Papagei aus seiner Ecke. Amanda atmete auf. »Mr Dubcek.« Der weißhaarige, gebeugte Mann war über achtzig, doch er weigerte sich, in den Ruhestand zu treten. Er hatte nicht nur die Eltern der jetzigen Schüler kommen und gehen sehen, sondern auch deren Großeltern, und entsprechend war der Respekt, der ihm entgegengebracht wurde. Niemand sprach ihn mit seinem Vornamen Johann an, für alle war er »Mr Dubcek« – außer für Maddie, aber die beiden standen auch auf sehr vertrautem Fuß miteinander. Er fütterte sie, machte ihren Käfig sauber und nahm sie über Nacht mit in seine kleine Wohnung im Untergeschoss der Schule.
»Entschuldigen Sie«, sagte der Greis mit altersheiserer Stimme. »Der Mopp ist mir aus der Hand gefallen. Ich wollte Sie nicht stören.«
»Sie haben mich nicht gestört«, beruhigte Amanda ihn mit einem freundlichen Lächeln, das jedoch erlosch, als sie plötzlich etwas Warmes, Feuchtes zwischen ihren Beinen spürte. Ohne ein weiteres Wort hetzte sie, so schnell ihre zitternden Beine sie trugen, den Gang hinunter zum Waschraum. Sie wusste, was sie erwartete – was sie gefühlt hatte, war nicht zu missdeuten –, doch als sie gleich darauf die Bestätigung bekam, sank sie schluchzend auf die Toilette und schlug die Hände vors Gesicht.
Ein lautes Klopfen an der äußeren Tür ließ sie aus ihrer Verzweiflung hochschrecken. »Mrs O’Leary!«, hörte sie den Hausmeister besorgt rufen. »Ist alles in Ordnung mit Ihnen?«
Mrs O’Leary. Wie stolz war sie darauf gewesen, diesen Namen zu tragen, mit welcher Vorfreude hatte sie sich ausgemalt, ihn bei der Einschulung ihrer Kinder anzugeben. Hatte sie ohne Kinder überhaupt ein Recht auf ihn?
Wieder kamen ihr die Tränen.
»Mrs O’Leary?«
Schniefend fuhr sie sich mit den Handwurzeln über die Augen. »Ich bin okay«, antwortete sie mit einer Stimme, die ihr in den Ohren schrillte.
Als sie schließlich auf den Gang hinaustrat, war Mr Dubcek gottlob verschwunden. In ihr Büro zurückgekehrt, richtete sie mit Hilfe ihres Taschenspiegels ihr Make-up, fuhr den Computer herunter und schloss die Akten weg. Ein Blick auf die Uhr zeigte ihr, dass die für Quinn bereitgestellte Zeit abgelaufen war. Ein Segen, dass er nicht gekommen war – sie wusste nicht, wie sie ihm in dieser Verfassung eine Hilfe hätte sein können.
Graham war auf dem Heimweg, als das Telefon klingelte. Sein Herz machte einen Satz.
»Hallo?«, meldete er sich atemlos, doch es war nicht Amanda, sondern eine Immobilienmaklerin, die ihn beauftragt hatte, das Gartengrundstück, auf dem ihr Bürogebäude stand, neu zu gestalten. Der Arbeitsaufwand wäre minimal, doch es könnte sich einiges daraus ergeben. Die Klientel der Frau rekrutierte sich aus der Oberschicht. Wenn das Resultat seiner Bemühungen ihren Beifall fände, würde sie ihn weiterempfehlen. Er hatte zwar gut zu tun, begrüßte aber jeden zusätzlichen Auftrag als eine weitere willkommene Ablenkung von den Spannungen zwischen Amanda und ihm. »Ich wollte mich nur mal in Erinnerung bringen«, sagte die Maklerin in herzlichem Ton.
»Sie standen ohnehin für heute auf meiner Anrufliste«, antwortete Graham. Während er mit der linken Hand steuerte, angelte er sich sein kleines schwarzes Buch vom Beifahrersitz und schlug es auf. »Ihre Pläne sind in den nächsten Tagen fertig.« Er blätterte ein paar Seiten um, wobei er jede überflog. »Wie wär’s heute in einer Woche? Sagen wir um sechzehn Uhr?« – »Wunderbar. Also dann bis nächsten Dienstag um vier.«
Sekunden später klingelte das Telefon erneut. Wieder machte Grahams Herz einen Satz, doch auch diesmal war es nicht Amanda.
»Gibt’s was Neues?«, erkundigte sich sein Bruder Joe.
»Nein«, seufzte Graham.
»Mom wollte es wissen.«
»Manchmal wünsche ich mir, ich hätte keinem davon erzählt. Von Anfang an nicht.«
»Das Thema auszusparen wäre gar nicht möglich gewesen«, erinnerte Joe ihn.
»Da hast du allerdings Recht.« Die Fragerei hatte einen Monat nach ihrer Hochzeit angefangen und seitdem nicht mehr aufgehört. Hätte er damals gewusst, was er heute wusste, hätte er einfach behauptet, Amanda und er wollten keine Kinder. Dass die ganze Familie ihre vergeblichen Bemühungen mitbekam, war fast ebenso erniedrigend wie der Samenerguss in den Plastikbecher. O’Leary–Männer hatten so etwas nicht nötig. Joe und Christine waren kürzlich zum fünften Mal Eltern geworden, und Graham vermutete, dass sie es dabei nicht bewenden lassen würden. »Sie verzweifelt allmählich«, sagte Joe, womit er ihre gemeinsame Mutter Dorothy meinte. »Sie befürchtet, dass sie deine Kinder nicht mehr erleben wird.«
»Aber sie ist doch erst siebenundsiebzig.«
»Wenn du sie hörst, macht sie nächste Woche die Augen zu.«
Seine Hilflosigkeit machte ihn wütend. »Was soll ich denn ihrer Meinung nach noch tun?«, blaffte Graham. »Sie sagt, es sei ihr letzter Wunsch.«
»O Mann – so einen Text brauche ich jetzt ganz dringend!«
»He – es ist nicht meiner. Ich wollte dich nur informieren. Mom redet ständig davon, dass du mit Megan hättest zusammenbleiben sollen.«
»Das ist doch idiotisch!«, erregte sich Graham. »Joe, du musst mir unbedingt helfen. Mom soll endlich akzeptieren, dass ich mit Amanda verheiratet bin, und wenn ich ein Kind bekomme, dann von Amanda. Hör zu – lass uns die Leitung frei machen: Ich warte auf Amandas Anruf.« Das stimmte zwar, aber er war auch froh, die Unterhaltung damit beenden zu können.
Vor sich hin brütend fuhr er weiter. Der Tag ging dem Ende zu. Warum spannte Amanda ihn so auf die Folter? Es mochte ja sein, dass sie noch nichts zu berichten hatte – aber auch das hätte sie ihm sagen können.
Graham bog vom Highway ab und fuhr durch Straßen, die er in- und auswendig kannte. Er liebte es, wie sie sich durch die bewaldeten Hügel wanden. Der Grundriss von Woodley erinnerte an einen Baum, dessen in zwei Richtungen abzweigende Äste mit Verwaltungsgebäuden, Bürohäusern und Geschäften belaubt waren, und an den aus den Ästen sprießenden Zweigen hingen die hübschen Wohnhäuser.