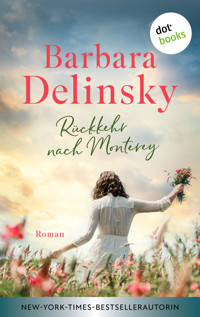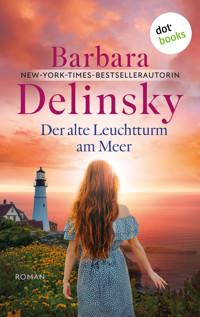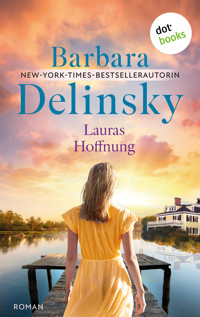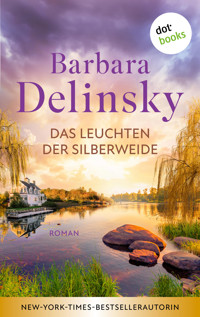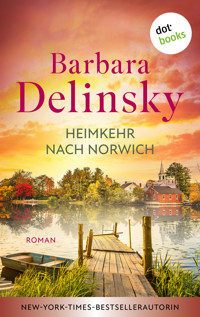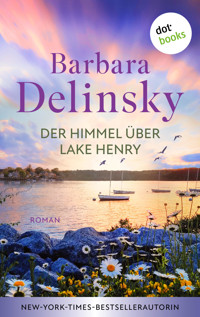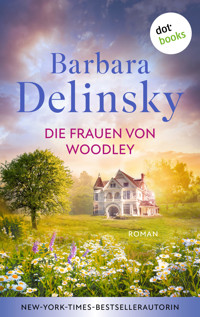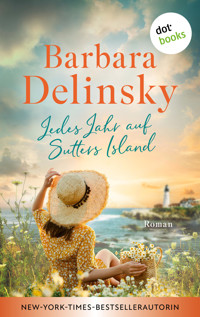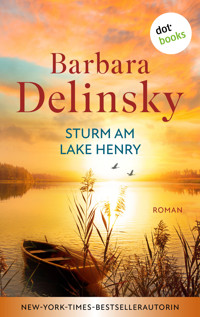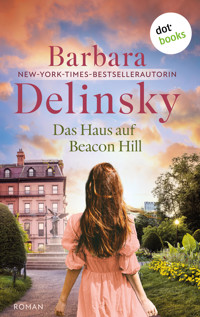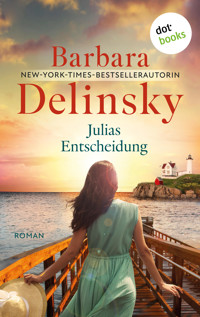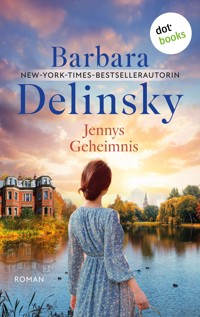1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Erbe, das einen hohen Preis verlangt … Der bewegende Generationenroman »Die alte Mühle am Fluss« von Barbara Delinsky als eBook bei dotbooks. Schon seit Generationen ist das alte Anwesen mit der weinumrankten Mühle am Fluss das Wahrzeichen der Familie Dorian. Doch Grace, einst die gefeiertste Kolumnistin der USA, verliert langsam, aber sicher ihre Erinnerung. Nun ist es an ihrer Tochter Francine, alles zusammenzuhalten … bis diese von einem wohlgehüteten Familiengeheimnis erfährt, das alles auf den Kopf stellt, was sie je über ihre Herkunft zu wissen glaubte. Halt findet Francine ausgerechnet in dem Mann, der für sie Tabu sein sollte: dem jungen Arzt ihrer Mutter. Aber dann widerfährt Francines Tochter Sophie etwas Schreckliches, das erneut alles verändert. Und nur, wenn es den drei Dorian-Frauen gelingt, gemeinsam an einem Strang zu ziehen, werden sie die Schatten der Vergangenheit überwinden können … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der bewegende Familienroman »Die alte Mühle am Fluss« von New-York-Times-Bestsellerautorin Barbara Delinsky wird Fans von Nora Roberts und Lucinda Riley begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 638
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch:
Schon seit Generationen ist das alte Anwesen mit der weinumrankten Mühle am Fluss das Wahrzeichen der Familie Dorian. Doch Grace, einst die gefeiertste Kolumnistin der USA, verliert langsam, aber sicher ihre Erinnerung. Nun ist es an ihrer Tochter Francine, alles zusammenzuhalten … bis diese von einem wohlgehüteten Familiengeheimnis erfährt, das alles auf den Kopf stellt, was sie je über ihre Herkunft zu wissen glaubte. Halt findet Francine ausgerechnet in dem Mann, der für sie Tabu sein sollte: dem jungen Arzt ihrer Mutter. Aber dann widerfährt Francines Tochter Sophie etwas Schreckliches, das erneut alles verändert. Und nur, wenn es den drei Dorian-Frauen gelingt, gemeinsam an einem Strang zu ziehen, werden sie die Schatten der Vergangenheit überwinden können …
Über die Autorin:
Barbara Delinsky wurde 1945 in Boston geboren und studierte dort Psychologie und Soziologie. Nach der Geburt ihres ersten Sohnes arbeitete sie als Fotografin für den Belmont Herald, erkannte aber bald, dass sie viel lieber die Texte zu ihren Fotos schrieb. Ihr Debütroman wurde auf Anhieb zu einem großen Erfolg. Inzwischen hat Barbara Delinsky über 70 Romane veröffentlicht, die in mehr als 20 Sprachen übersetzt wurden und regelmäßig die New-York-Times-Bestsellerliste stürmen. Sie engagiert sich außerdem sehr stark für Wohltätigkeitsvereine und Aufklärung rund um das Thema Brustkrebs. Barbara Delinsky lebt mit ihrem Mann in New England und hat drei erwachsene Söhne.
Die Website der Autorin: barbaradelinsky.com/
Bei dotbooks veröffentlichte Barbara Delinsky auch ihre Romane:
»Die Schwestern von Star’s End«
»Jennys Geheimnis«
»Das Weingut am Meer«
»Julias Entscheidung«
»Lauras Hoffnung«
»Der alte Leuchtturm am Meer«
»Das Haus auf Beacon Hill«
»Sturm am Lake Henry«, Die Blake-Schwestern 1
»Der Himmel über Lake Henry«, Die Blake-Schwestern 2
»Heimkehr nach Norwich«
»Das Leuchten der Silberweide«
»Das Licht auf den Wellen«
»Die Frauen Woodley«
»Ein Neuanfang in Casco Bay«
»Im Schatten meiner Schwester«
»Rückkehr nach Monterey«
»Drei Wünsche hast du frei«
»Ein ganzes Leben zwischen uns«
»Jedes Jahr auf Sutters Island«
»Was wir nie vergessen können«
***
eBook-Neuausgabe März 2024
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1995 unter dem Originaltitel »Shades of Grace« bei Harper Collins, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1998 unter dem Titel »Niemals werde ich dich vergessen« bei Droemer Knaur.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1995 by Barbara Delinsky
Published by Arrangement with Barbara Delinsky
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1998 bei Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive
von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98690-939-0
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die alte Mühle am Fluss« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Barbara Delinsky
Die alte Mühle am Fluss
Roman
Aus dem Amerikanischen von Georgia Sommerfeld
dotbooks.
KAPITEL 1
Der Charakter ist eine Ware, die man am besten in geschmackvoller Kleidung, mit gepflegter Sprache und aufrechter Körperhaltung präsentiert. Jeder gute Verkäufer weiß, daß die Verpackung einen Vorgeschmack auf das darin enthaltene Geschenk darstellt.
– Grace Dorian in einem Interview mit Barbara Walters
Grace Dorian starrte ratlos auf die Papiere auf ihrem Schreibtisch hinunter. Sie hatte keine Ahnung, wie sie dorthin gekommen waren, keine Ahnung, was es mit ihnen auf sich hatte.
Auf der Suche nach Hinweisen blätterte sie den Stapel durch. Keine Papiere. Briefe. Einige handgeschrieben, andere mit der Maschine, einige auf weißem Papier mit gedrucktem Briefkopf, andere auf buntem, auf herausgerissenen Notizbuchblättern ...
»Liebe Grace ...«
»Liebe Grace ...«
»Liebe Grace ...«
Denk nach! beschwor sie sich, die aufsteigende Panik niederkämpfend. Leute schrieben ihr Briefe – nach der Kuriertasche zu urteilen, die offen auf dem Stuhl stand, viele Leute: Sie quoll regelrecht über von Schreiben wie die auf dem Schreibtisch. Es gab einen Grund für ihre Existenz.
Grace preßte die Hand auf die Brust und zwang sich zur Ruhe, spürte unter der Handwurzel ihr hämmerndes Herz, und unter ihren Fingerspitzen kleine Kugeln.
Ein Rosenkranz? Nein. Kein Rosenkranz. Eine Perlenkette, Grace. Eine Perlenkette.
Angstvolle Augen irrten auf der Suche nach Vertrautem durch den Raum, verweilten kurz auf dem Mahagoni-Bücherschrank, den Samtvorhängen, dem zierlichen Brokatsofa, den polierten Messinglampen. Die Lampen brannten nicht. Es war Morgen. Sonnenlicht ergoß sich über den Aubusson-Teppich.
Mit zitternden Händen setzte sie ihre Lesebrille auf und betete, daß es, wenn sie die Briefe nur lange genug, aufmerksam genug studierte, irgendwann in ihrem Kopf Klick machen würde. Sie las Adressen auf Rückumschlägen – Morgan Hill, Kalifornien, Burley, Alabama, Little River, South Carolina, Parma, Ohio ... Leute aus dem ganzen Land schrieben ihr. Und sie befand sich in ... hier war ... sie lebte in ... Connecticut. Da stand es, über den Rand ihrer Brille zu lesen, in geschwungener Schrift auf einer Landkarte an der gegenüberliegenden Wand. Grace legte die Brille weg, ging zu der Karte hinüber, berührte den Goldrahmen und schöpfte Trost aus seiner Stabilität und, ja, seiner Vertrautheit.
Sie wohnte im Westen von Connecticut, auf dem weitläufigen Anwesen, das John ihr hinterlassen hatte. Das ursprüngliche Haus war fast ebenso viele Generationen im Besitz seiner Familie gewesen wie die alte Sägemühle. Die Sägemühle war nicht mehr in Betrieb, von Wein überwuchert und so gebeugt wie John in seinen letzten Jahren, doch was die Zeit der Mühle genommen hatte, hatte sie dem Haus gegeben. Ehemals ein rechteckiger, nach Westen ausgerichteter Steinklotz, hatte es einen Nordflügel dazubekommen und dann einen Südflügel; schließlich war eine Garage aus dem Boden geschossen, bei der es nicht geblieben war. An der Rückseite des Hauses waren eine Reihe von Büroräumen angebaut worden, in dessen größtem sie gerade stand, und ein Wintergarten vor der Terrasse, die sie so liebte, mit Steinplatten gefliest und aprilkahl, aber vielversprechend, bevor er in die sanft hügelige Rasenfläche überging, jenseits derer, von Föhren gesäumt, der Housatonic floß. Im Spätsommer zog er gemächlich an der Ostgrenze ihres Besitzes entlang. Zu dieser Jahreszeit war er in Eile; das hörte sie sogar jetzt durch die geschlossenen Flügelfenster.
Diese Dinge waren ihr vertraut. Und die anderen? Sie warf einen ängstlichen Blick zur Tür, ehe sie wieder zu ihrer Brille griff.
»Liebe Grace, ich lese Ihre Kolumne nun schon seit zwanzig Jahren, aber es ist heute das erstemal, daß ich Ihnen schreibe. Meine Tochter wird im Herbst heiraten, und nun besteht mein Exehemann darauf, daß, wenn sie ihn als Brautführer haben will, die Kinder aus seiner zweiten Ehe an der Hochzeit teilnehmen. Es sind fünf, alle unter zehn und unerzogen, und sie haben sich meiner Tochter gegenüber abscheulich benommen ...«
»Liebe Grace, Sie müssen einen Streit zwischen meinem Freund und mir schlichten. Er behauptet, daß der erste Junge, mit dem ein Mädchen schläft, ihren Unterleib seinen Gegebenheiten entsprechend formt, so daß es später mit einem anderen nie mehr so schön ist ...«
»Liebe Grace, einige der Briefe, die Sie veröffentlichen, sind zu weit hergeholt, um echt sein zu können ...«
»Liebe Grace, danke für den Rat, den Sie der armen Frau gegeben haben, deren Geschenke von ihren Enkeln nie anerkannt werden. Sie hat ein Recht auf ein Dankeschön – auch innerhalb der Familie. Ich habe Ihre Kolumne ausgeschnitten und an einer Stelle aufgehängt, wo meine Kinder sie sehen konnten ...«
Grace hielt den letzten Brief, jetzt aus Erleichterung zitternd, noch eine Weile in der Hand, ehe sie ihn weglegte.
Grace Dorian. »Die Vertraute«. Natürlich.
Wenn sie einen Beweis brauchte – am Ende des Zimmers hingen Plaketten an der Wand, die sich auf Vorträge bezogen, die sie vor Berufsverbänden gehalten hatte, und darunter lagen Ordner voller Zeitungsausschnitte, in denen ihre landesweit erscheinende Kolumne gelobt wurde. Die Posttasche auf dem Stuhl enthielt die neueste Leserbriefsendung aus New York. Bis zum Ende der Woche würde sie die meisten gelesen, eine Auswahl getroffen und fünf Kolumnen geschrieben haben.
Hoffte sie.
Nein, hätte sie. Sie mußte.
Was wußte David Marcoux schon? Seinem eigenen Eingeständnis nach hatte er lediglich ein paar Alternativen ausgeschlossen. Aber er irrte sich. Ihre Anfälle waren vorübergehende Blackouts, winzige Schlaganfälle vielleicht, die keinen bleibenden Schaden verursachten. Sie wußte jetzt wieder, was das für Briefe waren. Sie wußte wieder, was für einen Beruf sie hatte. Sie hatte sich in der Gewalt.
Das Telefon summte. Sie zuckte zusammen und starrte dann eine ganze Weile verwirrt auf den Apparat hinunter, bevor sie den Hörer von der Gabel riß. »Ja?« sagte sie. Freizeichen. Ihre Finger schwebten unsicher über einer Tastenleiste. Sie drückte auf eine davon, doch nichts geschah, und dann auf eine zweite, die ihr das Besetztzeichen bescherte. Sie überlegte noch, welche sie als nächste nehmen sollte, als das Summen verstummte. Sie stand mit dem Hörer in der Hand und zorniger Miene da, als die Tür aufflog.
»Ich kann mit diesem Telefon nicht umgehen, Francine«, erklärte sie in scharfem Ton. »Es ist zu verwirrend. Ich hatte vom ersten Tag an Probleme damit. Was war denn so schlimm an den alten Apparaten?«
Francine hatte eine Tasse Tee und ein Lächeln für sie. »Über die alten Apparate liefen maximal zwei Leitungen – aber wir brauchen fünf.« Sie stellte den Tee auf den Schreibtisch und drückte Grace kurz an sich. »’Morgen, Mom. Schlecht geschlafen?«
Graces Unmut legte sich. Francine würde nie ein dynamischer Mensch werden, aber sie war beständig – eine ergebene Tochter, eine loyale Freundin, eine fähige Assistentin. In diesem Punkt – wie in so vielen anderen Punkten auch – war Grace mit Glück gesegnet. Ja, Davis Marcoux irrte sich ganz sicher. Sie hatte es nicht so weit gebracht, um jetzt plötzlich von einer Krankheit aus dem Verkehr gezogen zu werden. Kurzzeitige Blackouts, mehr steckte nicht dahinter – und die mußten noch nicht einmal einen körperlichen Grund haben. Wenn man es recht bedachte, hatte sie sich das Recht auf gelegentliche Ausfälle weiß Gott erworben.
»Ich schlafe nicht so gut wie früher«, beantwortete sie Francines Frage. »Kaum mehr als zwei Stunden am Stück. Es heißt, daß alte Leute nicht so viel Schlaf brauchen. Ich brauche ihn – aber er ist mir nicht vergönnt.«
»Einundsechzig ist nicht alt«, sagte Francine.
Die Ermutigung tat Grace gut. »Mein Kopf funktioniert auch nicht mehr so richtig.«
Auch dieser Äußerung widersprach Francine. »Dein Kopf funktioniert einwandfrei, und darum bist du auch so gefragt. Das war der Grund dafür, daß ich dich angesummt hatte: Annie Diehl hat angerufen und wollte wissen, ob du interessiert daran wärst, in einer Talk-Show in Houston aufzutreten.«
Annie Diehl war die PR-Agentin, die die Zeitung dafür bezahlte, daß sie Graces Auftritte in der Öffentlichkeit koordinierte – daran erinnerte Grace sich sehr genau. Und sie erinnerte sich ebenfalls an die Panik, die sie bei ihrem letzten Flug befallen hatte. Plötzlich hatte sie nicht mehr gewußt, wohin sie unterwegs war und warum. Die Desorientierung hatte nicht lange angehalten und war zweifellos durch die Höhe ausgelöst worden, aber Grace wollte sich nicht noch einmal in diese Gefahr begeben, wenn es nicht unbedingt sein müßte.
»Ich bin schon in einem Dutzend Talk-Shows in Houston aufgetreten.«
»In vier – und die letzte liegt Jahre zurück.«
»Sinkt meine Leserschaft in Houston?«
»Nein. »
»Dann möchte ich lieber nicht fliegen – ich habe hier zu viel zu tun.« Sie warf einen Blick auf den Schreibtisch. »Zusätzlich zu alledem ist da noch mein Buch. Ich hätte ohnehin längst damit anfangen müssen, und Gott weiß, wann ich angesichts der sechs Vortragstermine bis Juni endlich dazu kommen werde.« Früher hatte sie die Kolumnen einer Woche in zwei Tagen erledigt und drei Tage für das »Rahmenprogramm der ›Vertrauten‹«, wie sie es nannte, zur Verfügung gehabt. Jetzt brauchte sie für alles länger. »Warum haben wir all diese Einladungen zu den Abschlußfeiern überhaupt angenommen?«
Francine grinste. »Weil du für dein Leben gern Ehrentitel verliehen bekommst.«
»Würde dir das nicht genauso gehen, wenn du einen haben könntest?« gab Grace ohne Scham zurück. »Es ist nicht komisch, ständig mit Leuten auf Listen zu stehen, deren akademische Grade mehr Platz beanspruchen als ihre Namen. Außerdem sind College-Abgänger, sogar High-School-Abgänger, so ängstliche Geschöpfe.« Ihre Enkelin fiel ihr ein, und sie schränkte ihre Aussage ein: »Abgesehen von Sophie. Sophie ist ein couragiertes Kind.«
»Kein Kind – sie ist dreiundzwanzig.«
»Und persönlich verantwortlich für diese Telefone und alles andere hier, womit ich nicht zurechtkomme.« Grace warf einen verzweifelten Blick in die Richtung des Computers, der auf einem Ausleger ihres Schreibtischs stand. Sie sehnte sich nach ihrer alten Olivetti.
»Ja, sie sind eine Verbesserung«, sagte Francine in dem Moment, als Grace das in Frage stellen wollte. »Sie machen die Arbeit leichter. Sie machen Sophie die Arbeit leichter. Und sie machen eine wichtige Aussage über ›Die Vertraute‹.«
»Daß sie computergesteuert ist?« fragte Grace bestürzt. »Die Vertraute« war sanft und eine angenehme Erscheinung, sie gab Informationen, aber auch Mitgefühl, und sie war durch und durch menschlich. Sie war absolut keine Maschine.
»Daß sie auf dem laufenden ist. Wirklich, Mom. Wenn heute jemand von dir etwas über Kondome wissen möchte, dann gibst du ihm eine andere Antwort als früher, als Schwangerschaft das Gebot der Stunde war. Deine Ratschläge wandeln sich mit den Zeiten – sollten deine technischen Voraussetzungen das nicht auch tun?«
Die Geschäftsfrau in Grace wußte, daß es unumgänglich war, aber trotzdem ängstigten sie technische Neuerungen, und sie hielt es sogar für möglich, daß die Kompliziertheit der modernen Welt für ihre zeitweisen Blackouts verantwortlich war. Schließlich konnte man einen Verstand nur bis zu einer gewissen Grenze belasten.
Sie lächelte, als sich ein rotköpfiges Finkenpärchen an dem Futterspender vor dem Fenster niederließ. »Gott sei Dank gibt es noch Dinge, die sich nicht ändern. Der Frühling ist im Anmarsch. Ich liebe diese Jahreszeit. Wenn alles blüht, fangen meine Besucher an, einzutrudeln. Weiß Margaret, daß sie allmählich die Gästezimmer herrichten muß?«
»Ja.«
»Hast du neuen Teppichboden für die Mansarden-Suite bestellt?«
»Mmm.«
»Was ist mit den Einladungen für meine Mai-Party? Sind sie schon gekommen?« Sie hatte Karten mit einer wunderschönen, handgemalten Blumenbordüre geordert, die kein Computer jemals zustandebringen würde – gottlob.
»Noch nicht.«
»Hast du mal nachgefragt?«
»Nein.«
»Du darfst Dinge nicht schleifen lassen, Francine – wie oft habe ich dir das schon gesagt?«
Irritierenderweise sah Francine nicht im mindesten besorgt aus. »Die Einladungen sind uns für Ende der Woche zugesagt worden – dann haben wir noch mehr als genug Zeit, sie dem Kalligraphen zu schicken. Hast du die Gästeliste fertig?«
Die Gästeliste. Grace sah ihre Tochter verdutzt an. »Hast du die denn nicht?«
»Nein. Du warst gestern noch damit beschäftigt, als ich ging – und du sagtest, ich hätte sie heute früh auf dem Schreibtisch.«
»Dann liegt sie da auch. Du mußt etwas daraufgelegt haben.«
»Ich bin gerade erst gekommen – ich habe meinen Schreibtisch noch nicht angerührt.«
»Gerade erst gekommen?« echote Grace ungehalten. Unpünktlichkeit war ihr ein Greuel. »Es ist schon nach zehn. Mußt du so spät kommen? Und muß dieser Jogginganzug unbedingt sein?«
»Jogginganzüge sind bequem.«
»Aber nicht passend fürs Büro. Ebenso wenig wie ...« Sie warf einen vielsagenden Blick auf Francines Haare, die oben auf dem Kopf zu einem unordentlichen Knoten zusammengezwirbelt waren, aus dem sich in alle Richtungen Strähnen schlängelten. Sie hatten einen weichen Braunton, und die Frisur wirkte sexy, was völlig unangebracht war. Kürzer war ordentlicher, kürzer wirkte auf jeden Fall professioneller.
Francine räusperte sich. »Ich arbeite doch nicht in einer Bank.« »Aber unsere äußere Erscheinung sagt etwas über uns aus – genauso wie der Besitz eines Computers.«
»Das ist ein Unterschied: Wenn wir einen Computer haben, dann wissen das die Leute – was ich anhabe, wissen sie nicht.«
»Gott sei Dank«, stieß Grace hervor. »Und das gilt auch für deine Tochter.« Der größte Teil von Sophies Garderobe entsetzte sie. So ein hübsches Kind. Was für ein Jammer. »Hast du bei dem Mädchen denn gar nichts zu sagen?«
»Sie ist kein Mädchen mehr«, widersprach Francine gewohnheitsmäßig, als sie auf dem Tablett auf dem Bücherschrank ein Blatt Papier entdeckte. »Hier liegt deine Gästeliste.« Sie runzelte die Stirn. »Aber sie ist nicht fertig.«
Grace griff nach der Liste und dann nach ihrer Brille.
Sie sah eine Menge Namen. »Sieht ganz fertig aus.« Sie gab sie Francine zurück.
»Du hast nur die Zeitungsleute aufgeführt. Was ist mit Buchverlagen? Mit Kritikern? Mit den Medien? Ich dachte, der Sinn dieser Party sei der Beginn der Promotion des Buches? Was ist mit Annie um Himmels willen?«
»Siehst du – da hast du’s«, sagte Grace. »Du weißt genau, wer auf der Liste stehen muß – du kannst sie selbst aufstellen. Vergiß die Nachbarn nicht. Und Robert.«
»Robert?«
Grace ersparte sich einen längeren Vortrag über den bejammernswerten Stand von Francines gesellschaftlichem Leben und beschränkte sich auf einen eindringlichen Blick.
»In Ordnung«, gab Francine nach. »Ich werde Robert einladen – aber nur als Freund. Er ist nicht die Liebe meines Lebens.«
»Wenn du ihm nur den Hauch einer Chance gäbest, könnte er es vielleicht werden«, sagte Grace. »Ich mag den Mann.« Nach einer kleinen Pause fuhr sie fort: »Ja, ja, ich weiß – Lee mochte ich auch und außerdem ist es nicht meine Sache. Aber diese Party ist es. Also was ist – bist du ein braves Mädchen und machst die Gästeliste fertig? Außerdem brauche ich die neuesten Zahlen über sexuellen Mißbrauch in der Familie und die Langzeitwirkungen der Fettabsaugung. Sei ein Engel und beschaff sie mir, ja?« Sie nickte zum Schreibtisch hinüber. »Ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll.«
»Mir geht’s nicht anders«, protestierte Francine, aber nicht energisch. »Na schön – aber schrei mich nicht an, wenn ich auf der Liste jemanden vergesse.«
»Ich schreie nie.«
»Nein – aber du bringst deine Meinung sehr deutlich rüber.«
»Nun – einer muß den Laden schließlich am Laufen halten. Ich brauche wirklich eine Sekretärin.«
»Du hast eine: Marny Puck. Sie sitzt am anderen Ende des Flures und schickt nette Dankesbriefe an all die Leute, die dir schreiben, aber sie ist nicht in dein Privatleben einbezogen. Sie stellt keine Gästelisten zusammen.«
Grace war bestürzt. Marny. Natürlich. »Warum habe ich keine Privatsekretärin?«
Francine lächelte. »Weil du mich hast«, antwortete sie auf dem Weg zur Tür. Sie hob die Hand mit der Liste. »Ich zeig’ sie dir dann.«
Als die Tür sich schloß, setzte Grace sich an ihren Schreibtisch, holte einen Spiralblock aus der obersten Schublade und blätterte über frühere Notizen hinweg zu einem leeren Blatt. Marny Puck, schrieb sie in Großbuchstaben. Sekretärin. Sitzt am Ende des Flures. Beantwortet Leserbriefe. Mit einem Gefühl der Zuneigung setzte sie hinzu: Gehört zu Father Jims Leuten. Räumt ordentlich auf. Befolgt Anordnungen gewissenhaft. Und dann fügte sie sarkastisch hinzu: »Schwester von Gus, meinem Chauffeur. Ebenso achtbar, wie er es nicht ist.«
Auf der nächsten Seite machte sie sich Notizen über die Bedienung des Telefons. Francine und Sophie hatten es ihr abwechselnd ungezählte Male erklärt. Sie wußte, wie es funktionierte – sie kam nur manchmal etwas durcheinander.
Und so schrieb sie die einfachen Anweisungen auf – nur für den Fall ...
Auf der dritten Seite listete sie – noch vor fünf Jahren wäre das undenkbar gewesen – die Programmpunkte des Tages auf. Nur für den Fall ...
Als es ihr zu karg erschien, um als Gedächtnisstütze zu taugen, erläuterte sie jeden Punkt ausführlich – nur für den Fall ... Daraufhin ein wenig beruhigt, legte sie den Block wieder in die oberste Schublade und wandte sich den Briefen zu, die ihr Leben bestimmten. Sie mußte die Zeit nutzen, in der sie den Sinn darin erkannte.
Francine war gerade erst acht gewesen, als »Die Vertraute« aus der Taufe gehoben wurde. Sie hatte mit in den Debatten gesessen, aber sie hatte keinen Augenblick gezweifelt. Natürlich sollte Grace eine Ratgeber-Kolumne für die örtliche Zeitung schreiben. Gab sie nicht unentwegt Ratschläge? Kamen ihre Freundinnen nicht darum ständig vorbei? Gestanden sie ihr nicht ihre tiefsten, dunkelsten Geheimnisse? Tat Francine das nicht selbst?
Grace hatte etwas an sich – eine Direktheit, eine Herzlichkeit –, das schon bei der ersten Begegnung Vertrauen erweckte. Wie konnte man sich jemandem nicht anvertrauen, der einen mit so mitfühlendem Blick ansah, mit solcher Geduld zuhörte, fasziniert von dem zu sein schien, was man sagte, und immer einen vernünftigen Rat parat hatte? Francine hatte sich mit einer Mutter, an die sie sich mit allen Problemen wenden konnte, ihren sämtlichen Freunden gegenüber glücklich geschätzt. Und noch dazu war die Beziehung nicht einseitig. Als »Die Vertraute« ihr Spektrum erweiterte, wurde Francine zu einer Informationsquelle: Sie war ein Teenager und sah sich den gleichen Problemen gegenüber, die Gegenstand vieler der Briefe an Grace waren. Sie war ein Spätentwickler, und dann schoß sie erst einmal in die Höhe, bevor sich schließlich die ersten Rundungen einstellten. Sie haßte ihre Haare, haßte ihre Nase, haßte ihre Hände. Sie bekam Pickel. Sie verliebte sich unerwidert. Sie machte sich schon Monate vorher Gedanken über die Gestaltung des Silvesterabends.
O ja, sie war wirklich eine Informationsquelle. Sie wußte, wie es schmerzte, wenn man die Wahl zur Klassensprecherin in der zweiten Klasse Oberschule nur um Haaresbreite verlor, wie demütigend es war, wenn man im ersten Durchgang eines Tennisturniers ausschied, das die eigene Familie sponserte, wußte, welche Enttäuschung man empfand, wenn man von seinem Wunsch-College nicht angenommen wurde. Und sie wußte auch, wie es war, eine Mutter zu haben, deren Berühmtheit im Gegenzug zur eigenen Mittelmäßigkeit wuchs.
Francine und Grace unterschieden sich wie Erd- von Pastelltönen, wie braune Augen von blauen, wie attraktiv von schön, wie irdisch von göttlich.
Einfach ausgedrückt – Francine war fehlbar. Und ihre Fehlbarkeit bescherte ihr Erfahrungen, die Grace nie gemacht hatte. Grace war nie geschieden worden. Grace hatte sich nie wegen Sophies Diabetes schuldig gefühlt oder weil sie sie nach dem College nach Hause zurückbeorderte, anstatt darauf zu bestehen, daß sie in der Stadt bei Freunden blieb. Grace konnte Francines Bedürfnis, sich hervorzutun, nicht begreifen – und auch nicht, daß sie, Grace, ihr das durch ihre hinmelhoch angesetzten Maßstäbe unmöglich machte. Sie verstand nicht, daß Francine sich nach Großeltern, Tanten, Onkeln und Cousinen sehnte.
Francine schätzte sich in vieler, vieler Hinsicht glücklich, dennoch hatte sie Träume, die Zweifel in ihr weckten. Grace wußte nicht, was es hieß, von Zweifeln gepeinigt zu werden, denn sie hatte nie welche. Ihr Weltbild war ein absolutes. Man gewann die Kontrolle über sein Leben, indem man Entscheidungen traf und sie durchsetzte.
So verschieden sie beide auch waren – Grace war immer dagewesen, wenn Francine sie brauchte. Und so kehrte sie an ihren Schreibtisch zurück und nahm sich die Gästeliste vor. Was sexuellen Mißbrauch in der Familie und Fettabsaugungen betraf, war Sophie die Statistikerin, aber Francine wollte sie nicht wecken. Die Zahlen konnten warten.
Francine hatte inzwischen auch Bedenken wegen der Party-Einladungen und rief die Firma an, bei der sie sie bestellt hatte. Der Besitzer versprach, den Künstler anzurufen, der die Bordüre malte, und sich dann wieder zu melden. Francine nutzte die Zeit bis dahin dazu, Annie Diehl anzurufen. »Grace möchte im Augenblick lieber nicht nach Houston kommen«, erklärte sie, den Hörer mit der hochgezogenen Schulter am Ohr haltend, während sie die Gästeliste ergänzte, so freundlich sie konnte, aber Annie war trotzdem eingeschnappt.
»Es ist eine gute Show.«
»Ich weiß, aber das Timing ist schlecht. Das Schuljahr geht zu Ende, und in den nächsten Wochen wird der Teufel los sein.«
»Wir reden hier vom Fernsehen, Francine – damit erreicht sie doch ungleich viel mehr Menschen als bei einer der Abschlußfeiern.«
»Sagen Sie Grace das, und sie wird Ihnen einen Vortrag über die Bedeutung von Qualität gegenüber Quantität halten. Können Sie Houston auf einen anderen Zeitpunkt vertrösten?«
»Sie werden enttäuscht sein – ich hatte ihnen gesagt, daß sie verfügbar sei. Heißt das, daß sie bis Juli gar nichts machen wird? Dann kann ich keine Auftritte garantieren – nach dem Vierten ist tote Hose.«
»Das macht nichts«, erwiderte Francine, noch immer freundlich, obwohl sie Ultimaten haßte, denn sie verfrachteten sie zwischen zwei Stühle, und nicht selten war sie dann der Buhmann. »Wir haben hier genug zu tun. Bitte entschuldigen Sie uns in Houston.«
Annie schickte einen Laut durch die Leitung, gegen den Grace noch heftiger protestiert hätte als Francine, und Francine hätte ihn nicht unwidersprochen gelassen, wenn in diesem Moment nicht der Besitzer der Papierhandlung angerufen hätte, um ihr Bescheid zu sagen, daß die Einladungen am Montag der kommenden Woche fertig sein würden.
Francine war entsetzt. »Nächste Woche? Sie sollten diesen Montag fertig sein!« Grace hatte recht, sie hätte sich früher erkundigen sollen.
»Künstler können so launisch sein.«
»Kolumnisten auch«, gab Francine zurück. Es behagte ihr ganz und gar nicht, Grace mitteilen zu müssen, daß die Einladungen zu spät kommen würden.
»Was halten Sie davon, daß ich den Künstler bitte, sie direkt an Ihren Kalligraphen zu schicken?«
Und wenn die Bordüre nicht erwartungsgemäß ausfiel? Dieses Szenario behagte Francine noch weniger. »Nein – Grace muß sie vorher sehen. Ihr Künstler soll sie direkt an uns schicken.« Frustriert hängte sie ein. Grace legte Wert darauf, daß Dinge termingerecht erledigt wurden. Sie sah die »Vertraute« als eine elegante Frau, die sich in vornehmer Gelassenheit ihre Handschuhe überstreifte. Francines Aufgabe war es, dieses Bild zu bewahren. Unglücklicherweise funktionierte der Rest der Welt nicht so untadelig, wie Grace Dorian es tat.
Getan hatte, korrigierte sich Francine mit einem Blick auf die unfertige Gästeliste, doch bevor sie sich wieder daran machen konnte, klingelte erneut das Telefon.
Es war Tony Colletti, der für Grace zuständige Redakteur bei der Zeitung. »Was soll ich von dieser Kolumne halten, Francine?«
»Von welcher Kolumne?«
»Ich meine die für nächsten Mittwoch – über Gäste, die allergisch gegen die Katzen ihrer Gastgeber sind. Sie ist völlig wirr.«
Das war auch Francines Eindruck gewesen, als sie den Entwurf gelesen hatte. Die arme Grace hatte offenbar Probleme mit dem Computer gehabt. Anstatt wie sonst Korrekturen anzubringen, hatte Francine die Kolumne neu geschrieben und sie mit dem Rest von Sophie durchgeben lassen.
Nein. Sophie hatte nichts durchgegeben – Sophie war nicht dagewesen. Also hatte sie, Francine, es selbst getan. Da mußte sie selbst einen Wurm hineingebracht haben.
Das würde sie Tony natürlich nicht wissen lassen. »Ach herrje – Sie müssen den Text bekommen haben, der auf dem Boden des Schneideraumes hätte liegenbleiben sollen.«
»So geht’s mir immer mit Ihnen.«
»Tony!«
»Ich habe Karten für die Knicks für Sonntag nachmittag.«
Sie seufzte.
»Okay. Vergessen Sie die Knicks. Wie wär’s mit ’nem Brunch? Das ist was Sinnvolles – essen müssen Sie schließlich.«
Sie gab keinen Laut von sich.
»Okay. Vergessen Sie den Brunch. Wie schnell können Sie mir die verdammte Kolumne auf den Schirm geben?«
»In zwei Minuten, wenn ich es allein kann – wenn ich Hilfe brauche, dauert es ein bißchen länger. Ich rufe Sie in beiden Fällen an, okay?«
Sie legte auf, setzte sich an ihren Computer und machte die fragliche Datei auf. Graces ursprüngliches Durcheinander erschien auf dem Bildschirm. Sie ließ es vorlaufen und dann zurück, ging wieder ins Inhaltsverzeichnis und überflog andere Dateien, in denen sie die neu geschriebene Kolumne vielleicht unabsichtlich gespeichert hatte.
Das Telefon klingelte. »Ich habe sie noch nicht bekommen«, beschwerte sich Tony.
»Natürlich nicht – ich habe sie ja auch noch nicht abgeschickt. Wir haben ein technisches Problem. Ich sagte Ihnen doch, ich rufe Sie an.« Sie legte den Hörer auf.
In ihrer Verzweiflung machte sie sich auf den Weg in den Südflügel des Hauses. Sie brauchte Sophie. Sie über die Sprechanlage anzupiepsen wäre schneller gegangen, doch Francine liebte es, ihre Tochter persönlich zu wecken – das hatte sie schon immer getan. Es hatte so etwas Intimes.
Vorausgesetzt, Sophie war allein.
Francine zögerte einen Moment, beschloß, es zu riskieren, und ging weiter. Ja, sie mußte die Gästeliste fertigstellen. Ja, sie mußte eine Kuriertasche durcharbeiten, die ebenso dick war wie die von Grace. Ja, Tony wartete in all seiner Macho-Herrlichkeit darauf, daß eine Kolumne auf seinem Schirm erschien. Aber sie fand immer Zeit für Sophie, die, Graces kleinen Seitenhieben zum Trotz, Francines Glanzleistung war. Sophie war ein Genie. Sie war schön und lebhaft und sensibel, ja, das war sie. Mütter wußten solche Dinge.
Mit Sophie verbrachte Zeit war immer ein Genuß, und wenn sie dazu führte, daß Francine mit ihrer Arbeit ins Hintertreffen geriet, so störte sie das nicht: Je beschäftigter sie war, um so weniger befaßte sie sich mit Dingen, die sie nicht ändern konnte.
In dieser Hinsicht war Sophie anders als ihre Mutter – sie befaßte sich ständig mit Dingen, die sie nicht ändern konnte. Sie bestimmten ihr Verhalten. Sie genoß es, dagegen aufzubegehren, wann immer sie konnte.
Das war einer der Gründe dafür, daß sie noch im Bett lag. Ihr Wecker hatte vor einer Stunde geklingelt. Da es ein Arbeitstag war, hatte sie ihn ausgeschaltet und weitergeschlafen.
»Sophie? Wach auf, Süße.«
Das leise Flüstern ihrer Mutter hätte eine Erinnerung aus der Vergangenheit sein können, doch das Rütteln an ihrer Schulter war sehr real. Sie überwand sich, ein Auge zu öffnen, denn die Stimme ihrer Mutter vermittelte eine gewisse Dringlichkeit.
»Ich habe eine Kolumne im Computer verloren. Tony macht mir die Hölle heiß, weil er sie unbedingt braucht, und ich habe überall danach gesucht, aber vergeblich. Kommst du mal nachsehen?«
Sophie machte ihr Auge wieder zu. Sie spürte, wie die Matratze heruntergedrückt wurde und dann den Druck von Francines Hüfte.
»Bitte, Schatz! Ich hätte dich nicht geweckt, wenn es nicht ein Notfall wäre. Ich hatte die gesamte Kolumne neu geschrieben, aber durchgegeben habe ich das Original. Typisch, was? Tony reibt sich die Hände – er liebt es, wenn ich Mist baue.«
»Er ist gekränkt, weil du nicht mit ihm ausgehst.«
»Kann man mir das verübeln? Er steht emotional auf der Stufe eines Zweijährigen, aber seine Arroganz würde für zehn Männer reichen. Eine Stunde zusammen, und wir wären ein Knäuel – aber nicht aus Leidenschaft, meine Liebe.«
»Ein Jammer.« Sophie gähnte. »Leidenschaft ist so ein großartiges Ventil.«
Es folgte eine Pause und dann ein vorsichtiges: »Hattest du gestern einen netten Abend?«
»Mmm.«
»Mit Gus.«
»Mmm.« Sie streckte sich.
»Ich mache mir Sorgen um dich, Schatz.«
Das wußte Sophie, und es bekümmerte sie. Aber sie fand Gus aufregend. Er kam ihrem perversen Bedürfnis entgegen, den Teufel am Kinn zu kitzeln und gesellschaftlichen Einengungen eine lange Nase zu machen. Ihre Beziehung zu Gus widerstrebte Grace zutiefst – und das war Grund genug, sie fortzusetzen. Aber ihre Mutter tat ihr leid. Also raffte sie sich auf und verließ ihr Bett. »Keine Sorge, es geht mir gut.« Sie kramte in den Kommodenschubladen herum.
»Schicker Schlafanzug«, sagte Francine.
Sophie war nackt. »Zumindest bequem.« Sie zog ein Höschen, schwarze Leggings und ein schwarzes Bustier an.
»Ahhh«, konstatierte Francine seufzend. »Graces Lieblingsoutfit.«
»Ich weiß.« Sophie grinste.
»Du bist ein schlimmes Mädchen.«
»Aber du liebst mich trotzdem.«
»Vergiß deine Spritze nicht.«
Sophie ignorierte den Hinweis. Sie fuhr sich mit der Bürste durch die Haare und sorgte mit einem Steckkamm für Asymmetrie, dann bestückte sie ihr Ohr mit der Reihe Ohrringen, die Grace wirklich liebte. Nach einem kurzen Aufenthalt im Bad, wo sie den Geschmack der Scampi vom gestrigen Abend fortspülte und, ja, ihrem Diabetes Rechnung trug, winkte sie Francine in Richtung Flur.
»Insulin?« hakte Francine nach.
Sophie brummte bestätigend.
»Hast du vorher einen Test gemacht?«
»Ja, ja«, grummelte sie. »Wie habe ich nur die College-Zeit überlebt, ohne daß du meine Gesundheit überwachtest?«
»Das habe ich mich oft gefragt.«
Sophie agierte ihre Frustration in großen Schritten aus. Francines Besorgnis störte sie nicht halb so sehr wie die Krankheit selbst. Damals, mit neun Jahren, als sie festgestellt wurde, war sie sich wie eine Mißgeburt vorgekommen. Manchmal tat sie das heute noch.
Und so machte es ihr nichts aus, von ihrer Mutter geweckt worden zu sein, um im Computer nach einer verlorenen Kolumne zu suchen, denn der Umgang mit Computern war nichts für Mißgeburten. Er gab ihr eine gewisse Verantwortung. Expertin auf einem Gebiet zu sein – noch dazu auf einem, das für Grace ein Buch mit sieben Siegeln war –, verlieh ihr Machtgefühl.
»Ich habe das ganze Ding neu geschrieben«, murmelte Francine. »Wenn ich es noch mal machen muß, kriege ich einen Schreikrampf.«
Sophie setzte sich an Francines Computer. »Vielleicht ist es an der Zeit, noch jemanden einzustellen – diese Kolumne ist nicht die erste, die du in den letzten Monaten neu schreiben mußtest.«
»Aber die erste, die ich verloren habe.«
»Nicht verloren – falsch eingeordnet. Sie ist hier irgendwo.«
»Wenn ich sie nicht aus Versehen gelöscht habe.«
Diese Gefahr hatte Sophie allerdings auf ein Minimum reduziert, als sie das System programmierte. Sie holte die Ausschuß-Datei auf den Schirm und begann sie zu durchforsten.
»Katzenallergie«, hakte Francine ein.
»Worüber wir«, sinnierte Sophie, während sie weiterarbeitete, »beide nichts wissen, da wir nie eine Katze hatten. Und interessiert uns das Thema? Nein.«
»Natürlich tut es das.«
»Sagt Grace. Manchmal kommen mir Zweifel.«
»An der Arbeit? So schlecht ist sie doch nicht. Deine Freundinnen beneiden dich – das hast du selbst gesagt.«
»Sie neiden mir meine Arbeit, und ich neide ihnen ihre Freiheit.«
»Hilft es dir nicht, in einem eigenen Flügel des Hauses zu wohnen?«
»Doch. Nein. Ich weiß es nicht.« Sie hatte ihr eigenes kleines Reich auf diesem Anwesen, komplett mit Küche und Fitneßraum, und konnte jederzeit ungestört Freunde bei sich haben, aber das war nicht das gleiche wie mit diesen Freunden zusammen in einer Wohnung zu leben – und dann war da noch das Kapitel Diabetes mit seinen Spritzen und Blutzuckertests und der ständig notwendigen Wachsamkeit, das sie zu einem gesellschaftlichen Außenseiter machte.
Francines Hand strich sanft über ihre Haare. »Du hättest nicht zurückkommen müssen.«
»Doch – ich mußte.« Abgesehen von ihrer Gesundheit, die zu Hause einfach besser zu überwachen war, gab es da noch Grace, mit der sie eine Haßliebe verband. »Die Firma ist auch ein Teil von mir – sie ist das Werk der Dorians, der Dorian-Frauen. Ich kann es nicht erklären. Ahhh – da haben wir’s ja: Katzenallergie. Worüber Grace ebenfalls nichts weiß. Wie konnte sie eine Kolumne darüber schreiben?«
»Sie hat es ja nicht getan«, erinnerte Francine sie. »Ich habe es getan – mit Hilfe meines Lieblingstierarztes.«
»Mit dem du zwar ausgehen, den du aber nicht heiraten willst. Tom ist der netteste Kerl der Welt. Aber sein Stammbaum befriedigt Grace nicht – liegt es daran?«
»Zum Teil.«
»Und ansonsten?« Sie hatte keine Schwierigkeiten, den sarkastischen Blick ihrer Mutter zu deuten. »Ahhh – er ist zu zahm. Weißt du was? Gus würde dir gefallen.«
Francine zog eine Augenbraue hoch. »Gibst du die Kolumne bitte Tony durch, Schatz? Oh, und Grace braucht neues statistisches Material über sexuellen Mißbrauch in der Familie und Fettabsaugung. Aber sei so gut und frühstücke erst.«
Sophie schickte die Kolumne auf den Weg und erwog gerade, das Frühstück aus Prinzip zu verschieben, als Grace aus ihrem Büro kam. »Sophie, du hattest mir Material über Inzest versprochen.« Sie wedelte mit einem Brief. »Ich bekomme ständig Anfragen von Betroffenen. Es ist Zeit, das Thema wieder aufzugreifen.«
»Das hast du gerade erst getan«, sagte Sophie. »Letzte Woche.«
»Das stimmt nicht.«
»Doch, sie hat recht, Grace«, mischte Francine sich von ihrem Schreibtisch auf der anderen Seite des Raumes ein. »Die Briefe müssen Reaktionen darauf sein.«
»Es ist Monate her, daß ich etwas über Inzest gemacht habe«, beharrte Grace.
»Ich zeige es dir«, erbot sich Sophie, erfreut darüber, Grace einen Irrtum nachweisen zu können. »Ich habe die Kolumne gestern ausgeschnitten.«
»Guter Gott, Sophie – du siehst aus, als seist du gerade aus dem Bett gefallen. Francine?« appellierte Grace an ihre Tochter. Francine führte sie in ihr Büro zurück. »Sie wird sich später umziehen.«
»In diesem Aufzug im Büro zu erscheinen, ist genau so schlimm, wie sich die Nase mit der Serviette zu putzen. Ich bitte dich, Francine – sprich mit ihr.«
Die Tür fiel zu, und Sophie konnte der Unterhaltung nicht weiter folgen. Sie hockte sich auf eine Ecke des Schreibtischs und wappnete sich für einen Kampf, falls Grace zurückkäme. Aber Francine kam allein heraus.
Sie legte die Arme auf Sophies Schultern. »Das war vorauszusehen.«
»Es gefällt mir, sie auf die Palme zu bringen«, erklärte Sophie ohne Reue.
»Das tust du, weiß Gott. Sie fragt mich ständig, was aus dem lieben, kleinen Mädchen geworden ist, das so gern auf ihrem Schoß saß. Sie sagt, sie kenne dich nicht mehr.«
Dieser Eindruck beruhte auf Gegenseitigkeit. Sophie hatte wundervolle Erinnerungen an herzliche Zeiten mit ihrer Großmutter, an gemeinsame Ausflüge, gemeinsames Schmökern, gemeinsame Waldspaziergänge, gemeinsames Lachen. Ihr Großvater hatte eine untergeordnete Rolle gespielt – Granny war von Anfang an der Star gewesen. Sie hatte ihre Enkelin vergöttert, und Sophie hatte das ebenso verinnerlicht wie die Überzeugung, daß die Dorians unbesiegbar seien. Dann war aus Granny Grace geworden, und die Vergötterung endete. Erwartungen waren erwacht, die Realität hatte sie eingeholt.
Doch einige Dinge, wie die Macht des Namens Dorian, hatten sich nicht verändert. »Ich bin gar nicht so anders«, sagte Sophie seufzend. »Wenn dem so wäre, wäre ich nicht hier.«
»Ich bin froh, daß du hier bist.«
Das war ein gewisser Trost, dachte Sophie. Francine brauchte einen Champion – Sophie war der einzige, den sie hatte.
»Kalt?« fragte Francine und rieb Sophies nackte Arme.
Sophie antwortete mit einem leichten Kopfschütteln. »Wie konnte Grace die Kolumne über Inzest vergessen? Wir haben tagelang darüber diskutiert.«
»Sie hat so viele Kolumnen geschrieben – da ist es kein Wunder, wenn sie die Übersicht verliert.«
»Aber es war erst letzte Woche. Sie baut ab, Mom. Sie ist geistig nicht mehr so fit wie früher.«
»O doch, das ist sie. Sie hat mich gerade gefragt, ob du die alten Reden herausgesucht hättest, um die sie letzte Woche gebeten hatte. Das hat sie nicht vergessen.«
Sophie entzog sich ihrer Mutter. Auf dem Weg zur Tür sagte sie über ihre Schulter. »Dateien nach irgendwas zu durchforsten, ist das Schlimmste an diesem Job. Es ist geistlos und langweilig, nicht gerade der beste Verwendungszweck für einen akademischen Grad von der Columbia.«
»Wenn du nicht willst, dann mache ich es eben.«
»Nein, nein«, protestierte Sophie. Besser sie als Francine.
»Dann mach’ es gleich, damit du es hinter dir hast«, schlug Francine vor. »Aber frühstücke vorher.«
Sophie ging gehorsam den Flur hinunter, aber nicht, weil ihre Mutter es so wollte, und auch nicht, weil die Ärzte es ihr vorschrieben – sie würde frühstücken und sich reichlich Zeit dafür nehmen, weil alles besser war, als in Dateien herumzukramen.
Unter Margarets wachsamem Blick aß sie ein weiches Ei, eine Scheibe Toast und eine Banane. Als sie mit der Zeitung fertig war, war ihre dritte Tasse Kaffee inzwischen kalt geworden, und sie starrte aus dem Küchenfenster und fragte sich wie fast jeden Morgen, was in aller Welt sie wieder hier zu Hause mache. Ihre Freunde lebten in New York, Washington, Atlanta und Dallas, hatten die ersten reizvollen Jobs und genossen nach Herzenslust ihr Leben. Sie hätte bei ihnen sein können. Statt dessen hockte sie mit ihrer Mutter und Großmutter wieder in dem Haus, in dem sie aufgewachsen war – und das auch noch freiwillig.
Quasi als Strafe zog sie sich ins Archiv zurück, grub Graces alte Abschlußfeier-Reden aus und gab sie mit Datum und Inhalt in den Computer ein. Inzwischen hatte sie, weil ihr doch kühl geworden war – ganz sicher nicht wegen Graces Empörung über ein Bustier –, einen Pullover angezogen, und sie hatte die neuesten Zahlen zum sexuellen Mißbrauch in der Familie rausgesucht.
Zu Mittag machte sie eine Pause – nicht, weil sie Hunger hatte, sondern weil das Mittagessen mit Grace ein Ritus war. Es bestand grundsätzlich aus drei Gängen: Salat, Hauptgericht und Obst. Sophie mußte sich nicht mehr ermahnen, zu warten, bis Grace zu essen anfing, oder die Bestecke in der Reihenfolge von außen nach innen zu benutzen, oder ihren Mund mit der Serviette abzutupfen und nicht abzuwischen – diese Dinge waren ihr inzwischen in Fleisch und Blut übergegangen.
Nicht in Fleisch und Blut übergegangen war ihr bis heute Graces Alleinherrscheranspruch. Sie war empört, als Grace aus heiterem Himmel erklärte, sie habe die Reservierung für den gemeinsamen Kurzurlaub über den vierten Juli in Marthas Weindomäne storniert. Nicht, daß Sophie daran gelegen hätte, hinzufahren – ihre Freunde würden sich in Easthampton treffen –, aber Francine hatte sich sehr auf die Tage dort gefreut.
Ebenso empört war sie, als Grace kurz danach darauf zu sprechen kam, daß der »Architectural Digest« das Haus fotografieren wolle. »Meinen Teil des Hauses«, präzisierte sie, bevor sie eine Liste erforderlicher Vorbereitungen herunterratterte. Nicht, daß Sophie daran gelegen hätte, daß ihre Zimmer einbezogen würden – sie bewohnte sie, und so sahen sie auch aus. Das gleich galt für Francines. Graces Räume waren – wie Grace selbst – perfekt, und das ging Sophie gehörig gegen den Strich. Eine kleine Genugtuung erlebte sie, als Legs – häßlich wie die Sünde, aber ungeheuer lieb, wie es für Greyhounds typisch ist – begierig auf ein paar Streicheleinheiten von Francine, in die Küche stürmte. Grace sprang auf und stieß angewiderte Laute aus, als sei der Hund ein Streuner, der von der Straße hereingekommen war. Ihr Entsetzen legte sich zwar sofort, als Francine Legs hinausbrachte, aber es bereitete Sophie eine boshafte Befriedigung.
Trotzdem war sie immer noch in aufsässiger Stimmung, als Grace ihr im Aufstehen, um an die Arbeit zurückzukehren, in die Augen schaute und sagte: »Ich wollte gestern abend wegfahren, aber Gus war nicht zu finden.«
»Wir waren beim Tanzen.«
»Er tanzt?«
»Das kann man wohl sagen. So in der Art ...« Sie hob die Arme und begann sich hin und her zu wiegen.
Grace wandte sich an Francine. »Macht dir das keine Sorgen?« Francine lächelte. »Es macht mich neidisch – ich könnte mich nie so bewegen.«
Grace bedachte beide mit einem mißbilligenden Blick und sagte im Hinausgehen: »Wenn ich ihn heute abend brauche, möchte ich, daß er da ist.«
Ihre Worte hallten noch eine lange, frustrierende Stunde durch Sophies Kopf. Dann schlüpfte sie, keine Arbeit ungetan lassend, die sie nicht ebensogut am nächsten Morgen erledigen könnte, in eine Lederkombination und machte sich auf den Weg zur Garage.
Um vier Uhr nahm Grace wie jeden Tag den Tee, und Father Jim gesellte sich zu ihr, wie er es immer tat, wenn seine Verpflichtungen es erlaubten. Auch Francine schaute auf einen Sprung herein, bevor sie an ihren Schreibtisch zurückkehrte.
Grace hatte keine Lust, an ihre Arbeit zurückzukehren. Sie hatte ein paar Stunden straff gearbeitet, aber die Mühe, sich zu konzentrieren, ihre Gedanken mit Gewalt von dem Abgrund der Angst fernzuhalten, in den sie an diesem Morgen geblickt hatte, hatte bohrende Kopfschmerzen ausgelöst, gegen die weder der Tee noch Father Jims Gesellschaft etwas ausrichten konnten.
Nachdem sie ihn zur Tür gebracht und ihm nachgewinkt hatte, wanderte sie durch das Haus, doch die Angst begleitete sie ebenso hartnäckig wie ihre Kopfschmerzen, nur noch quälender.
Sie wollte sprechen, aber sie konnte nicht.
Sie wollte arbeiten, aber sie konnte nicht.
Sie wollte schlafen, aber sie konnte nicht.
Also holte sie ihren Wollmantel aus dem Schrank, setzte eine Baskenmütze auf, streifte pelzgefütterte Handschuhe über und machte sich auf die Suche nach Gus.
Er war nicht in der Garage und auch nicht im Gewächshaus oder dem Häuschen, das er mit seiner Schwester bewohnte.
Und seinen Piepser hatte er offenbar abgeschaltet.
Aber Grace wollte ausgehen. Nun, sie hatte wirklich alles versucht, um den Chauffeur zu finden – niemand könnte ihr einen Vorwurf machen. Sie kehrte in die Garage zurück, stieg in den Mercedes und lenkte den Wagen, beflügelt von einem Gefühl der Selbständigkeit und der momentanen Herrschaft über ihren Geist, die Zufahrt hinunter.
KAPITEL 2
Verleugnung ist des Unschuldigen Methode, auf morgen zu verschieben, was einzugestehen heute zu sehr schmerzt.
– Grace Dorian in »Die Vertraute«
»Grace? Können Sie mich hören, Grace?«
Grace schlug die Augen auf und blickte in das gutgeschnittene Gesicht von Davis Marcoux. Stirnrunzelnd schaute sie um sich, und ihre Augen weiteten sich, als sie die weißen Laken, den weißen Vorhang und die weiße Zimmerdecke sah. Sie war nicht zu Hause – soviel wußte sie. Ihr Haus war nicht so steril. Und, soweit sie sich erinnerte, Davis’ Büro ebenfalls nicht.
»Wo bin ich?«, fragte sie beunruhigt.
»Im Krankenhaus – noch in der Notaufnahme. Sie haben sich den Kopf angeschlagen, und zwar ganz ordentlich.«
Als er das erwähnte, registrierte sie einen hämmernden Schmerz. Vorsichtig ertasteten ihre Finger auf der Stirn einen Gazetupfer. »Was ist passiert?«
»Sie hatten einen Autounfall.«
»Ich?« Sie versuchte sich zu erinnern, doch das Hämmern in ihrem Kopf vereitelte es. »Ich hatte in meinem ganzen Leben noch keinen Unfall.«
»Dann war dies die Premiere. Sie haben eine rote Ampel überfahren.«
»Ich überfahre keine roten Ampeln. Wo habe ich mir den Kopf angeschlagen?«
»Sie knallten aufs Steuer, als Sie in den anderen Wagen hineinkrachten.«
Als sie in einen anderen Wagen hineinkrachte? Wieder versuchte sie sich zu erinnern, aber da war nur eine vage Angst, das Gefühl, sich verirrt zu haben, die Kontrolle zu verlieren, in Panik zu geraten. »Was ist mit dem anderen Auto?«
»Das ist schrottreif, soviel ich gehört habe, aber der Fahrer ist unverletzt.«
»Gott sei Dank!«, stöhnte sie. »Bin ich so schnell gefahren?«
»Erinnern Sie sich nicht?«
Doch – jetzt, wo er es sagte, fiel ihr ein, wie erschrocken sie über ihr Tempo gewesen war und deshalb versucht hatte, es zu drosseln.
»Was ist passiert?«, fragte Davis mit jetzt leiserer Stimme. In seinem Tonfall schwang eine Vertrautheit mit, die an frühere Gespräche erinnerte.
Grace ging sofort in die Defensive – sie wollte nicht auf diese anderen Gespräche eingehen. »Ich habe keine rote Ampel gesehen, sie muß durch Bäume verdeckt gewesen sein.«
»Es geschah an der Kreuzung South Webster und Elm – die ist von allen Seiten bestens einsehbar.«
So schnell würde sie sich nicht geschlagen geben. »Es dämmerte bereits – wir wissen beide, wie tückisch das Licht um diese Zeit sein kann.«
»Ja, das kann es. War das der Grund?«
»Nun, es muß so gewesen sein. Ich hätte ganz sicher angehalten, wenn ich die rote Ampel gesehen hätte.«
»Und wenn Sie sie sahen, aber die Bedeutung nicht begriffen?«
Sie starrte ihn feindselig an. »Ich bitte Sie – ich weiß, was eine rote Ampel bedeutet!«
»Jetzt ja, aber vielleicht waren Sie verwirrt.«
»Nein, das war ich nicht. Nun ja – für einen Moment vielleicht. Ich muß übersehen haben, daß die Ampel auf Rot schaltete – der andere Wagen muß schon bei Gelb losgefahren sein.«
»Der andere Wagen war der dritte auf der Kreuzung – so lange hatten Sie schon Rot.«
»Na ja – dann war es eben ein Unfall.« Sie weigerte sich, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen. »Das passiert doch jedem mal.«
»Und wenn jemand verletzt worden wäre – wie wäre Ihnen dann zumute?«
»Schrecklich«, antwortete sie ehrlich.
»Ich hatte Sie doch gebeten, nicht zu fahren.«
»Ich tue es ja nicht oft. Aber ich wollte ausgehen, und mein Chauffeur war nicht zu finden. Also setzte ich mich selbst ans Steuer.«
»Und gelandet sind Sie hier.«
»Es war ein Unfall, Doktor Marcoux, ein simpler Unfall.«
»Mir macht seine Ursache Sorgen.« Nach einer Pause fragte er:
»Haben Sie mit Ihrer Familie gesprochen?«
Graces Augen weiteten sich. Ihre Familie würde eine Erklärung erwarten. »Wissen sie, daß ich hier bin?«
»Ihre Tochter wartet draußen – sie ist im Krankenwagen mitgefahren. Einer Ihrer Nachbarn hatte den Unfall beobachtet und sie aus seinem Wagen angerufen.«
Grace hätte es wissen sollen. Der Fluch des Interesses, nichts blieb lange ein Geheimnis.
Sie schloß die Augen. Das Hämmern hinter ihrer Stirn fand Widerhall in dem Hämmern in ihrer Brust. Grace atmete tief durch, und als sie den Arzt wieder ansah, stand Vorsicht in ihrem Blick. »Was haben Sie alles gesagt?«
»Nur, daß Sie nicht ernsthaft verletzt sind. Das heißt nicht, daß die Situation nicht ernst ist.«
Sie hielt seinem Blick stand. »Das ist sie nicht.«
»Grace.«
»Sie haben mit Ihren Tests nicht das geringste bewiesen«, gab sie heftig zurück. »Das haben Sie selbst gesagt. Sie haben lediglich ein paar Alternativen ausgeschlossen.«
»Mehr als ein paar. Ihre Symptome sind klassisch.«
»Vergeßlichkeit ist in meinem Alter etwas Unvermeidliches«, erwiderte sie mit einer wegwerfenden Handbewegung.
»Aber Phasen geistiger Verwirrung nicht – und derentwegen haben Sie mich seinerzeit aufgesucht. Was Ihnen da vorhin im Auto passiert ist, ist typisch für Alzheimer-Patienten.«
»Ich bin kein Alzheimer-Fall.«
»Und wenn der Fahrer des anderen Autos verkrüppelt oder gar tot wäre? Wenn Sie tot wären?«
»Mein Nachlaß ist geregelt.«
»Darum geht es nicht. Ihre Familie sollte wissen, was vorgeht.« Grace schüttelte den Kopf. »Ich möchte auf keinen Fall, daß sie aufgrund einer so vagen Diagnose in Panik geraten.«
Er bedachte sie mit einem tadelnden Blick. Sie schaute weg.
»Haben Sie es Father Jim gesagt?«, fragte er leise.
Ihr Blick flog zu ihm zurück. »Natürlich nicht.«
»Das sollten Sie aber – vielleicht kann er Ihnen helfen.«
»Inwiefern?« rief Grace. »Indem er mich füttert, wenn ich nicht mehr selbständig essen kann? Mich an der Hand herumführt, wenn ich nicht mehr weiß, wohin ich gehe? Mir erklärt, wer er ist, wenn ich mich nicht mehr an seinen Namen erinnere?« Sie tippte sich an die Brust. »Ich habe viel über diese Krankheit gelesen – ich habe sie nicht.«
Davis schob die Hände in die Taschen und starrte stirnrunzelnd zu Boden. Grace versuchte seine Gedanken zu erraten, als er sich umdrehte und sich, von ihr abgewandt, auf die Bettkante setzte. »Weiß Ihre Familie von Ihren Anfällen?« fragte er mit gesenktem Kopf.
»Nein.«
»Dann weiß sie auch nichts von den Tests, denen Sie sich unterzogen haben?«
»Ich sagte damals, ich besuche Freunde in der Stadt.«
Er schaute über seine Schulter und fand ihren Blick. »Lassen Sie mich mit ihnen reden. Ich erkläre ihnen, zu welchen Schlußfolgerungen ich gekommen bin, und sie können mir zustimmen oder nicht.«
»Und wenn sie Ihnen zustimmen?« faßte Grace ihre größte Angst in Worte. »Wenn sie Ihnen zustimmen, werden sie mich von da an mit anderen Augen sehen. Alles, was ich tue, wird ihr Mißtrauen erregen, jeden kleinen Fehler werden sie auf die Krankheit zurückführen, ob er damit zu tun hat oder nicht. Da würde eine Lawine losgetreten.«
»Sie dürfen es nicht länger für sich behalten. Haben sie denn keine Veränderung in Ihrem Verhalten bemerkt?«
»Sie üben sich in Nachsicht – ich bin einundsechzig.«
»Einundsechzig ist nicht alt.«
Grace fand diese Äußerung aus Davis Marcoux’ Mund nicht annähernd so erfreulich wie aus Francines.
»Früher oder später werden Sie es ihnen sagen müssen.«
»Nicht, wenn Ihre Diagnose falsch ist«, widersprach sie.
»Stellen Sie sich für einen Moment vor, daß sie das nicht ist – sollte Ihre Familie dann nicht vorbereitet sein? Soviel ich aus dem entnehmen konnte, was Sie mir erzählt haben, stehen Sie und Ihre Tochter sich sehr nahe. Meinen Sie nicht, sie wüßte gerne Bescheid?«
»Über mein Todesurteil? Sie wäre verzweifelt.«
»Sie ist kein Kind mehr.«
»Sie wäre verzweifelt«, wiederholte Grace. »Ich spreche aus Erfahrung.«
Sie selbst hatte gegen dieses Gefühl angekämpft, seit ihr der Gedanke gekommen war, ihre Symptome könnten auf die Alzheimersche Krankheit zurückzuführen sein, und das war viele Monate vor ihrem ersten Besuch bei Davis Marcoux gewesen. Sie las die Zeitungen. Sie las medizinische Fachblätter. Sie erhielt eine wachsende Anzahl von Leserzuschriften zu diesem Thema. Sie wußte um die Seelenqualen, die Menschen litten, die sich über ihren Zustand im klaren waren, und darum, wie verheerend er sich auf die Familien auswirkte. Verzweiflung war nur ein kleiner Teil davon.
»Sie verstehen das nicht, Doktor. Ich bin der Angelpunkt meiner Familie, die Dorians stehen und fallen mit meinem Beruf – und meinem Erfolg. Wie könnte ich ihnen sagen, daß damit vielleicht bald Schluß ist? Sie haben es doch selbst gesagt: Es ist durchaus möglich, daß ich auch in den nächsten Jahren nur gelegentliche Ausfälle habe.«
»Aber was ist mit dem Unfall, den Sie vorhin hatten? Was wäre gewesen, wenn Ihre Tochter oder Ihre Enkelin mit im Wagen gesessen hätte?«
»Dann hätte eine von ihnen am Steuer gesessen – ich fahre grundsätzlich nur, wenn niemand da ist, der mich chauffieren kann.«
»Das ist keine Rechtfertigung«, schalt er, doch sein Ton blieb sanft und machte es Grace zusehends schwerer, gegen seine Worte aufzubegehren. Ja, sie war der Angelpunkt ihrer Familie, aber sie war ihr auch lieb und teuer. Wenn sie dafür verantwortlich wäre, daß einem von ihnen etwas geschähe, würde sie sich das niemals verzeihen.
Sie preßte die Fingerspitzen gegen ihre schmerzende Stirn. »Ich bin im Augenblick außerstande, mich damit auseinanderzusetzen.«
»Ihre Tochter wartet draußen, um zu erfahren, wie es Ihnen geht. Wäre das nicht eine günstige Gelegenheit, ihr die Wahrheit zu sagen?«
»Nein.«
»Sie wird doch bestimmt fragen, wie es passieren konnte, daß Sie eine rote Ampel übersahen.«
»Nein. Ich habe sie gelehrt, Prioritäten zu setzen – das Übersehen einer roten Ampel ist nicht so wichtig wie die Tatsache, daß es mir gutgeht.«
»Aber es geht Ihnen nicht gut.«
Er gewann die Oberhand, sie spürte es. Sie wollte seine Argumente entkräften, aber ihre immer gleichen Antworten verfehlten ihre Wirkung. Ja, sie war manchmal verwirrt und desorientiert und vergeßlich, und ja, sie hatte in ihrem Alter das Recht dazu – aber es geschah immer öfter. Sie konnte es nicht verleugnen, auch das Entsetzen nicht, das es auslöste.
Sie legte die Fingerspitzen auf die Lippen, um ihr Zittern zu stoppen.
»Lassen Sie mich mit ihr reden, Grace«, drängte er mit tiefer, beschwörender Stimme. »Wenn sie wenigstens über die Möglichkeit informiert ist, kann Sie Ihnen besser helfen, falls sich die Notwendigkeit ergeben sollte. Das gleiche gilt für Father Jim.« Es kann mir doch niemand helfen! schrie Grace im stillen. Wenn Sie recht haben, bin ich verloren. »Father Jim weiß von den Anfällen.«
»Aber nicht, was sie auslöst. Er wird bestürzt sein, daß Sie es ihm nicht früher gesagt haben. Ach ja, er ist übrigens ebenfalls draußen.«
Grace drehte den Kopf weg. Jim durfte es nicht erfahren! Sie würde lieber sterben als sich ihm als geistigen Krüppel zu offenbaren.
»Also – wie ist es, Grace?« insistierte Davis. »Diesmal ist niemand verletzt worden, aber nächstes Mal geht es vielleicht nicht so glimpflich ab. Unfälle können vermieden werden, aber nur, wenn die Verkehrsteilnehmer die Regeln beachten.«
»Wer tut das schon immer?« gab sie zurück, doch ihrem Protest fehlte jetzt der Biß. Es mochte auf die Nachwehen des Unfallschocks zurückzuführen sein, auf die unbarmherzig hämmernden Kopfschmerzen oder auf die vage Erinnerung daran, den Wagen anhalten zu wollen und nicht zu wissen, wie, oder auf Davis’ unbeirrbare Hartnäckigkeit – jedenfalls war sie todmüde.
Und dann kam ihr plötzlich ein Gedanke. Wenn Davis ihrer Familie seinen Verdacht mitteilte, würden sie vielleicht ebenso entschieden darauf bestehen, daß er sich irrte, wie sie. Es wäre schön, ein oder zwei Verbündete zu haben, nachdem sie so lange allein gekämpft hatte.
Francine hatte eine angsterfüllte Ewigkeit im Wartezimmer zugebracht, als ein Mann aus der Notaufnahme kam und zielstrebig auf sie zueilte. Er war hochgewachsen, langbeinig und schlank, mit bernsteinfarbenen Haaren, die wie windzerzaust aussahen, einem kantigen, bartschattendunklen Gesicht und wirkte so durchtrainiert, daß sie ihn niemals für einen Arzt gehalten hätte, wenn er keinen weißen Kittel getragen und Father Jim nicht gesagt hätte: »Ah, da kommt Doktor Marcoux.«
Mit bis zum Hals klopfendem Herzen stand sie auf.
Der Arzt streckte ihr die Hand hin. »Francine? Davis Marcoux.«
»Wie geht es meiner Mutter?«
»Sie hat eine Beule am Kopf, ist mit ein paar Stichen genäht worden und hat eine leichte Prellung erlitten. Ich würde sie gern über Nacht zur Beobachtung hierbehalten. Morgen früh dürfte sie soweit sein, daß ich sie entlassen kann.«
»Gott sei Dank«, hauchte Francine erleichtert. Sie hatte keine Erfahrung mit einer kranken Grace. Mütter wurden nicht krank.
»Haben Sie vielleicht ein paar Minuten Zeit?« fragte Davis. »Ich würde gern kurz mit Ihnen sprechen.«
Sofort schrillte eine Alarmglocke in ihrem Kopf. »Worüber?«
»Am Ende des Flurs befindet sich ein Personal-Aufenthaltsraum.«
Ihr Herz schlug schneller. Derartige Aufenthaltsräume waren für ernste Gespräche vorgesehen. »Es stimmt etwas nicht, habe ich recht?«
Er deutete mit einer Kinnbewegung den Flur hinunter.
Sie wollte sich in keinen solchen Raum verschleppen lassen.
»Wäre es nicht besser, ich würde mich an Graces Bett setzen?«
Father Jim legte die Hand auf ihren Arm. »Lassen Sie mich das tun.«
Sie wandte sich ihm zu. »Wissen Sie etwas, das ich nicht weiß?«
»Nein, aber Sie sind Graces Tochter, da ist es doch ganz natürlich, daß der Arzt mit Ihnen über den Unfall sprechen möchte. Sie können sich ja zu uns gesellen, nachdem Sie mit ihm geredet haben.«
»Ich will aber nicht mit ihm reden«, rief sie, doch als sie ihre trotzige Kinderstimme hörte, gab sie beschämt nach. »Okay. Sagen Sie Grace, ich komme gleich.« Als sie halb den Flur hinuntergegangen war, wobei sie Mühe hatte, mit dem Arzt Schritt zu halten, kam ihr der Gedanke, zurückzulaufen und Father Jim zu holen. Bereits vor dem Tod ihres Vaters war er im Hause Dorian ständig präsent gewesen, und seitdem um so mehr. Er war eher ein Freund als ein geistlicher Ratgeber, bemerkenswert liberal und immer bereit, zu helfen. Es wäre ihr wohler gewesen, ihn bei dem Gespräch in Davis Marcoux’ Aufenthaltsraum an ihrer Seite zu haben.
Doch sie waren schon am Ziel. Der Raum war klein, mit einem Sofa, mehreren Sesseln und einer Kaffeemaschine ausgestattet. Davis deutete auf letztere. »Möchten Sie eine Tasse?«
»Glauben Sie, ich werde sie brauchen?« fragte sie zurück.
Er lächelte verständnisvoll. »Sie mögen keine Krankenhäuser, stimmt’s?«
»Entbindungsstationen sind angenehmer. Alle anderen ...« Sie machte eine abwinkende Handbewegung und ließ sich in einen Sessel sinken. »Meine Tochter ist Diabetikerin. Wenn es um Menschen geht, die ich liebe, machen Krankenhäuser mich kribbelig.« Zum Teufel, warum sollte sie nicht ehrlich sein?
»Und Ärzte machen mich kribbelig.«
»Das ist gut zu wissen«, erwiderte er.
»Ich rede nicht gern um den heißen Brei herum. Was ist mit meiner Mutter?«
»Ich habe sie heute nicht zum erstenmal gesehen.«
Francines Unbehagen wuchs. »Wann war das erste Mal?«
»Vor einigen Monaten. Ihr Internist hatte sie an mich überwiesen, wegen der Anfälle von Desorientierung. Ich bin Neurologe – Symptome wie dieses sind mein Fachgebiet.«
»Sie hat es mir gegenüber nicht erwähnt.«
»Sie wollte Sie nicht beunruhigen – sie hielt es für schwache Schlaganfälle.«
Francine schlang die Arme ineinander. »Und – hatte sie recht damit?«
»Nein, das haben wir ausgeschlossen.«
Irgendwie tröstete sie das nicht. »Wie?« fragte sie.
»Durch Bluttests, EEGs, Computertomografien und Magnet-Resonanz-Untersuchungen. Wir haben nichts ausgelassen.« Francine schaute ihn verwirrt an. »Aber wann haben Sie das alles gemacht? Diese Tests brauchen doch ihre Zeit. Wie war es möglich, daß ich nichts davon erfuhr? Grace und ich arbeiten zusammen – wie hat sie das hinter meinem Rücken bewerkstelligt?«
»War sie in den letzten Monaten nicht öfter unterwegs?«
»Doch, das schon – aber da war keine Rede von irgendwelchen Tests. Sie fuhr in die Stadt, um Freunde zu besuchen oder Matineen oder Proben der Philharmoniker – oder den Schönheitssalon.« Francine brauchte kein Genie zu sein, um seinen Gesichtsausdruck zu deuten. »Sie hat mich angelogen? Ausgeschlossen. Grace lügt nicht.«
Er ließ sich auf dem Sofa nieder und stützte die Ellbogen auf die gespreizten Knie. »Diesmal hat sie gelogen – aber in der besten Absicht. Sie hat diese Tests machen lassen – ich habe einen ganzen Ordner voller Ergebnisse.«
»Und wie lauten die?« fragte Francine. Als sie sah, wie Davis’ Blick behutsam wurde, wappnete sie sich für das Schlimmste.
»Sie besagen, daß die logischste Erklärung für ihre Anfälle senile Dementia ...«
»Auf keinen Fall!« fiel Francine ihm ins Wort. »Grace doch nicht!«
»... vom Typ Alzheimer ist.«
Sie schnappte nach Luft. Dann schüttelte sie den Kopf. »Das kann nicht sein. Grace ist nicht geisteskrank.«
»Mit Geisteskrankheit hat das nichts zu tun.«
»Aber Graces Verstand ist Grace. Er ist das, was sie von allen anderen Menschen auf der Welt unterscheidet.«
»Das gleiche kann ich von allen anderen Alzheimer-Patienten sagen, die ich kennengelernt habe.«
Francine sprach nicht von allen anderen Alzheimer-Patienten – sie sprach von ihrer Mutter. »Wissen Sie, für wie viele Menschen ihr Wort wie die Bibel ist?«
»Inwiefern ist das hier von Bedeutung?«