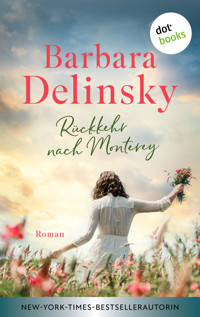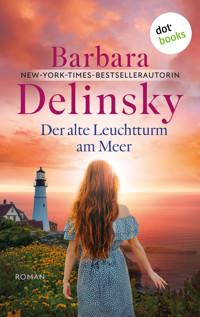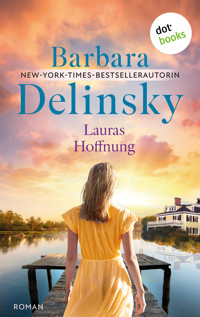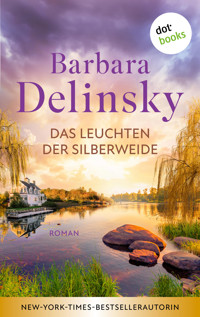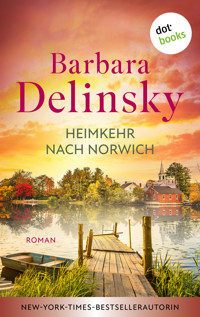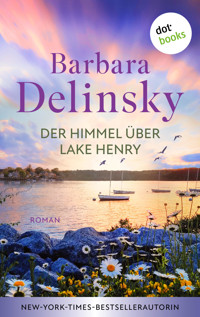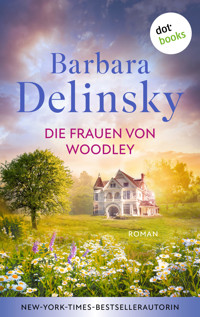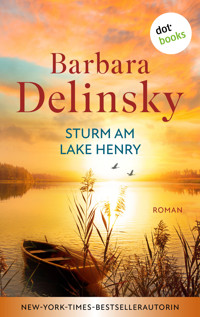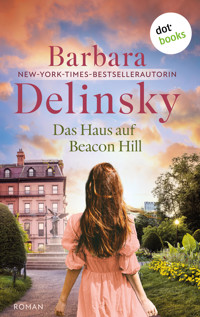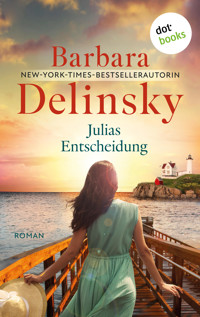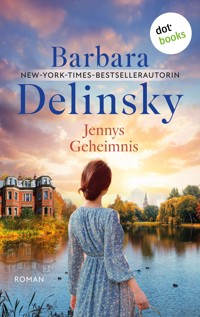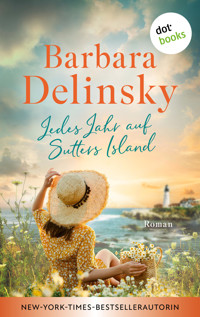
5,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn ein einziger Augenblick alles verändert: Der bewegende Familienroman »Jedes Jahr auf Sutters Island« von Barbara Delinsky als eBook bei dotbooks. Auch dieses Jahr treffen sich die Maxwells und Popes wieder in ihren Sommerhäusern an der Küste Maines: Zwei Familien, die ein tiefes Band der Freundschaft verbindet. Doch ein einziger Moment erschüttert alles: Der dreizehnjährige Michael Maxwell wird von einem Auto angefahren und schwer verletzt, als er völlig aufgelöst auf die Straße rennt – doch was hat er so Aufwühlendes mitansehen müssen? Hat es etwas mit dem Brief zu tun, den Michaels Mutter nach vielen Jahren von dem Mann erhalten hat, den sie insgeheim schon lange liebt – und der nun am Steuer des Unfallwagens saß? Schon bald drängen zwischen beiden Familien noch andere lang vergrabene Geheimnisse ans Licht: Nach diesem Sommer wird nichts mehr sein wie zuvor … »Barbara Delinsky zeigt erneut, wie intensive sie das menschliche Herz kennt – und seine große Fähigkeit zur Liebe und zum Hoffen.« Washington Observer Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der berührende Schicksalsroman »Jedes Jahr auf Sutters Island« von Barbara Delinsky wird Fans von Jojo Moyes und Cecilia Ahern begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 735
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über dieses Buch:
Auch dieses Jahr treffen sich die Maxwells und Popes wieder in ihren Sommerhäusern an der Küste Maines: Zwei Familien, die ein tiefes Band der Freundschaft verbindet. Doch ein einziger Moment erschüttert alles: Der dreizehnjährige Michael Maxwell wird von einem Auto angefahren und schwer verletzt, als er völlig aufgelöst auf die Straße rennt – doch was hat er so Aufwühlendes mitansehen müssen? Hat es etwas mit dem Brief zu tun, den Michaels Mutter nach vielen Jahren von dem Mann erhalten hat, den sie insgeheim schon lange liebt – und der nun am Steuer des Unfallwagens saß? Schon bald drängen zwischen beiden Familien noch andere lang vergrabene Geheimnisse ans Licht: Nach diesem Sommer wird nichts mehr sein wie zuvor …
»Barbara Delinsky zeigt erneut, wie intensive sie das menschliche Herz kennt – und seine große Fähigkeit zur Liebe und zum Hoffen.« Washington Observer
Über die Autorin:
Barbara Delinsky wurde 1945 in Boston geboren und studierte dort Psychologie und Soziologie. Nach der Geburt ihres ersten Sohnes arbeitete sie als Fotografin für den Belmont Herald, erkannte aber bald, dass sie viel lieber die Texte zu ihren Fotos schrieb. Ihr Debütroman wurde auf Anhieb zu einem großen Erfolg. Inzwischen hat Barbara Delinsky über 70 Romane veröffentlicht, die in mehr als 20 Sprachen übersetzt wurden und regelmäßig die New-York-Times-Bestsellerliste stürmen. Sie engagiert sich außerdem sehr stark für Wohltätigkeitsvereine und Aufklärung rund um das Thema Brustkrebs. Barbara Delinsky lebt mit ihrem Mann in New England und hat drei erwachsene Söhne.
Die Website der Autorin: barbaradelinsky.com/
Bei dotbooks veröffentlichte Barbara Delinsky auch ihre Romane:
»Die Schwestern von Star’s End«
»Jennys Geheimnis«
»Das Weingut am Meer«
»Julias Entscheidung«
»Lauras Hoffnung«
»Die alte Mühle am Fluss«
»Der alte Leuchtturm am Meer«
»Sturm am Lake Henry«, Die Blake-Schwestern 1
»Der Himmel über Lake Henry«, Die Blake-Schwestern 2
»Heimkehr nach Norwich«
»Das Leuchten der Silberweide«
»Das Licht auf den Wellen«
»Die Frauen Woodley«
»Ein Neuanfang in Casco Bay«
»Im Schatten meiner Schwester«
»Rückkehr nach Monterey«
»Drei Wünsche hast du frei«
»Ein ganzes Leben zwischen uns«
»Jedes Jahr auf Sutters Island«
»Was wir nie vergessen können«
***
eBook-Neuausgabe September 2023
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1993 unter dem Originaltitel »More Than Friends« bei HarperCollins, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1996 unter dem Titel »Freunde und Liebhaber« bei Knaur.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1993 by Barbara Delinsky
Published by Arrangement with Barbara Delinsky
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1996 Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98690-808-9
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Sutters Island« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Barbara Delinsky
Jedes Jahr auf Sutters Island
Roman
Aus dem Amerikanischen von Georgia Sommerfeld
dotbooks.
Innigen Dankan die Männer in meinem Lebenfür Inspiration,Ermutigung, Geduldund Liebe
Prolog
Michael Maxwell hob den Camcorder ans Auge, lehnte sich an das Verandageländer und ließ den Film anlaufen. Er fing zuerst das Meer-Panorama ein und folgte mit dem Objektiv dann dem Felsenpfad, der zum Haus heraufführte.
Seine dreizehn Jahre alte Stimme um eine Oktave senkend, begann er mit seinem Kommentar: »Labor Day, 1992, Sutters Island, Maine. Auf der Vorderveranda des Popewell-Sommersitzes befinden sich – mit mir – die Popes und die Maxwells, die an diesem denkwürdigen Tag ihr zehntes gemeinsames Ferienende-Freßfest zelebrieren werden.«
»Das zehnte!« kam ein erstauntes Echo von der Verandaschaukel hinter ihm. »Ist das zu glauben?«
»Schwerlich«, wurde eine andere, diesmal männliche Stimme laut, und dann eine zweite, die ihrer Äußerung ein Räuspern vorausschickte.
»Mir bereitet es keine Schwierigkeiten, es zu glauben – ich habe gerade erst die Kostenvoranschläge für ein neues Dach, einen neuen Boiler und einen neuen Faulbehälter durchgesehen. Die Hütte bricht in die Knie.«
»Aber wir lieben sie«, erklärte Annie Pope. »Stimmt’s, Teke?«
»Stimmt«, bestätigte Teke und zwinkerte in Michaels Richtung, als das Auge der Kamera sich auf die Gruppe richtete. Die große Holzschaukel aufs Korn nehmend, setzte Michael seine mit tiefer Stimme ausgeführte Erläuterung fort. »Hier haben wir die Popewell-Eltern. Von links nach rechts sind das J. D. Maxwell, der seinen Arm hinter seinem besten Freund, Sam Pope, auf der Lehne ausgestreckt hat. Sams Frau, Annie, sitzt, die Arme um die Knie geschlungen und die Füße gegen ihre beste Freundin, Teke, gestemmt, auf Sams Schoß. Sie tragen ein Sammelsurium von T-Shirts und Shorts und sehen aus wie alt gewordene Pennäler.«
»He!« protestierte Teke.
»Wir sind alt geworden«, konstatierte J. D. Auf einen Blick von Sam hin fügte er hinzu: »Ich sehe dich nicht aufspringen, um den Whaler ins Trockendock zu bringen.«
»Jon sagte, er würde es tun.«
»Weil du geschafft bist.«
»Immerhin haben wir heute früh ein Klafter Holz gehackt!«
»Vor zehn Jahren hätte das unseren Elan nicht bremsen können.«
»Vor zehn Jahren hatten wir keine fünf Teenager, an die wir Arbeiten hätten delegieren können.«
Teke seufzte. »Vor zehn Jahren waren wir dreißig. Sieh der Tatsache ins Gesicht, Sam, wir sind auf dem Weg in die Vergreisung.«
»Ich nicht«, widersprach Sam und schlang mit einem Zucken seines Schnurrbarts die Arme um Annie. »Ich trete gerade erst in die Blütezeit meines Lebens ein – siehst du das nicht auch so, Sonnenschein?« Er schloß seine Lippen um ihr Ohrläppchen und saugte daran.
»Nicht schlecht, Sam«, bemerkte Michael. Er fragte sich, wie Kari Stevens reagieren würde, wenn er das bei ihr versuchte. Wahrscheinlich würde sie ihn als Perversling beschimpfen. Aber was wußte Kari Stevens schon über Zungen?
»Er sieht alles«, warnte J. D. Sam. »Wenn er ein Weiberheld wie Geraldo wird, mache ich dich dafür verantwortlich.«
»Geraldo!« tönte es amüsiert vom Ende der Veranda her. Michael schwenkte den Camcorder herum und fing das lachende Gesicht seiner Schwester Jana ein. »Aus dem wird nie ein zweiter Geraldo.«
»Warum nicht?« fragte Michael leicht gekränkt. Sicher, er war eher ein Filmemacher als ein Polizeireporter – aber er war fest entschlossen, Karriere zu machen.
Zoe Pope, die bei Jana stand, sagte: »Weil du zu nett bist.«
»Oh, ich kann auch gemein sein.« Er stellte die Kamera auf Nahaufnahme ein und ging langsam auf die Mädchen zu. »Ich kann allen Leuten erzählen, daß Jana Maxwell sich heimlich zu drei Fahrstunden weggeschlichen hat.«
»Michael!«
»Hast du das wirklich getan, Jana?« rief Teke herüber.
Aber Michael hatte noch mehr in petto – und Besseres. »Ich kann Josh Vaccaro verraten, daß das Telefon nicht deshalb die ganze Nacht besetzt ist, weil Jana mit Zoe quatscht, sondern weil sie mit Danny Stocklan und Doug Smith telefoniert.«
»Trau dich ja nicht!« warnte Jana.
»Das würde er doch nie tun«, versicherte Zoe ihr. Sie wirkte stets beruhigend auf Jana ein, wie Annie auf Teke. Und sie sah wie ihre Mutter aus, hatte Annies feine Züge und das gleiche kurze, blonde, wellige Haar, während Jana dunkelhaarig war und das exotische Aussehen ihrer Mutter hatte.
Sam schnalzte mit den Fingern. »Komm her, Michael.« Michael zog das Teleobjektiv ein und schwenkte mit einer fließenden Bewegung auf seine Eltern. »Schwestern zu verpetzen ist genauso übel, wie den Schiedsrichter zu beschimpfen. Echte Männer tun das nicht. Kapiert?«
»Kapiert«, antwortete Michael, denn Sam war ein zu guter Freund, als daß er sich mit ihm hätte streiten wollen. Nicht jedem Kind war ein Sam in seinem Leben vergönnt. Er war wie ein Vater – aber ohne die Konflikte. Außerdem war er ein hervorragender Sportler. Ohne ihn als Trainer wäre Michael kein halb so guter Basketballspieler gewesen.
Aber Basketball war etwas für den Herbst und das Festland, nicht für den Labor Day auf Sutters Island. »Wann spielen wir Volleyball?« fragte er Sam hinter dem Camcorder hervor.
»Sobald ich wieder zu Kräften gekommen bin.«
J. D. schaute auf seine Uhr. »Bis dahin wird es Zeit zum Aufbruch sein. Ich habe vereinbart, daß das Boot uns um fünf abholt. Vorher müssen wir noch kochen und saubermachen ...«
»Das Hühnchen!« japste Annie. »Ich habe es total vergessen. Es liegt in der Marinade, und wenn ich es nicht vorkoche ...« Sie wollte aufspringen, doch Sam verhinderte es, indem er seine Arme noch fester um sie schloß, und Teke, indem sie die Hand auf ihren Arm legte und aufstand.
»Ich werde mich darum kümmern, du bleibst bei Sam.«
»Laß mich los, Sam. Ich habe mir geschworen, daß ich heute helfe. Teke hat den größten Teil der Woche mit Kochen zugebracht, und das ist nicht fair, es sind auch ihre Ferien.«
Aber Sams Arme öffneten sich nicht, und auf Tekes Gesicht erschien ein selbstbewußtes Lächeln. »Das kann ich nun mal am besten«, sagte sie, und dann öffnete sich die Fliegentür mit einem Quietschen und klappte hinter ihr zu.
Michael hielt die Kamera auf den Durchgang gerichtet, bis Teke außer Sicht war. Er filmte seine Mutter für sein Leben gern. Sie war ein außergewöhnlicher Mensch mit einem außergewöhnlichen Geschmack. Heute zum Beispiel trug sie ein neongrünes T-Shirt und passende Shorts und hatte die Haare oben auf ihrem Kopf mit einem purpurroten Band zusammengebunden, dessen Farbe der der flippigen Blitze entsprach, die an ihren Ohren baumelten. Keiner seiner Freunde hatte eine so tolle Mutter, und das meinte er nicht nur, weil sie zu Hause und für ihn da war und auch eine gute Köchin. Sie war lustig.
Wieder senkt er seine Stimme in den Bariton. »Und da haben wir sie – Theodora Maxwell in Aktion. Sie speist die Hungrigen, pflegt die Kranken, hetzt bis ans Ende der Welt, um Zeichenkarton, Pickelcreme und schwarze Elastik-Badehosen zu besorgen. Sag mal, Annie«, fragte er, weil das eine Frage war, die Annie häufig selbst stellte, »was hätten wir all die Jahre ohne sie gemacht?«
Annie schenkte der Videokamera ein offenes Lächeln. »Ich wäre nie Universitätsprofessorin geworden und du wärst niemals geboren worden.«
Sam schaute J. D. an. »Wie gefällt dir das als Tribut an deine Frau?«
»Nicht schlecht.« J. D. stand auf, trat ans Geländer und schaute den sanften Hang hinunter zum Dock. »He, Leute! Ihr müßt uns beim Einmotten helfen.«
Michael trat neben ihn und richtete den Camcorder auf Jonathan und Leigh am Ende des Docks. Leigh lag in einem Bikini auf den verwitterten Planken und nutzte die letzten Sonnenstrahlen. Jon lag dicht neben ihr, mit dem Rücken zum Haus. Das Teleobjektiv fing eine Handbewegung ein.
Mit seiner gewollt tiefen Stimme sagte Michael: »Die Pope-Männer sind heute aber gut drauf: Sam bohrt mit der Zunge in Annies Ohr, und Jon hat die Hand in Leighs Oberteil. Bloß gut, daß keine Kinder in der Gegend sind – die bekämen einen Schock.«
»Verdammt noch mal, Jon«, brüllte J. D. in Richtung Dock, »das ist meine Tochter, die du da befummelst! Übe etwas Zurückhaltung!«
Vom Ende der Veranda her klang Gelächter auf. »Sie üben doch Zurückhaltung!« prustete Jana.
J. D. warf Sam einen Blick zu. »Was macht dein Sohn da hinten?«
Sam hatte sich mit Annie auf der Schaukel ausgestreckt.
»Entspann dich – sie sind in Ordnung.«
»Hast du dich in letzter Zeit mal mit ihm unterhalten?«
»Er tut nichts, was du in seinem Alter nicht auch getan hast.«
»Ich habe in seinem Alter überhaupt nichts getan.«
Michael hörte auf zu filmen. »Überhaupt nichts? Mit siebzehn?«
»Ich habe Mädchen geküßt«, informierte J. D. ihn.
»Und weiter?«
»Nichts weiter.«
»Oh.«
»Was heißt ›oh‹?«
Es hieß, daß Michael sich nicht vorstellen konnte, sich die nächsten vier Jahre nur auf Küsse zu beschränken. Nicht, daß er vorhatte, seine Jungfräulichkeit schon in allernächster Zeit zu verlieren, aber er begann sich zu fragen, wie es wohl wäre, ein Mädchen zu berühren – und nicht nur an der Hand.
»Was heißt ›oh‹?« wiederholte J. D.
»Nichts.« Michael hob den Camcorder wieder ans Auge, drückte auf die Aufnahmetaste und kommentierte: »Jonathan Pope hat sich besonnen – seine Hände liegen jetzt deutlich sichtbar auf dem Dock. Oh, wow!« rief er plötzlich ganz aufgeregt. »Schau dir das Boot an, Dad!« Er stellte den Sucher auf einen Schoner ein, der in sein Gesichtsfeld gekommen war. »Ein Viermaster! Wow!«
»Nicht übel.«
»Er ist phantastisch!«
»Bei schwerer See aber nicht mehr, dann wird es da drauf ziemlich ungemütlich. Das kann uns nicht passieren.«
»Aber wir sind nicht so mobil wie die.«
»Der Walfänger ist auch mobil.«
»Aber nicht wie ein Schoner.«
»Der Walfänger ist zuverlässiger.«
»Er ist ein trauriger Fall«, erklärte Michael ihm. »Mit einem Walfänger kann man nirgendwohin, wo es interessant ist. Ich möchte reisen.« Kameraleute konnten sich keinen Namen machen, wenn sie sich darauf beschränkten, auf Sutters Island zu filmen oder in Constance-on-the-Rise, wo die Popewells lebten, oder in Boston, wo J. D. und Sam arbeiteten. Sie konnten sich keinen Namen damit machen, daß sie Familienfeiern filmten oder Schulaufführungen oder – und es war ihm egal, ob er eine Auszeichnung dafür bekommen hätte – eine Dokumentation über einen Tag im Leben eines Zehncentstücks. Michael wollte wichtige Dinge filmen. Er hatte vor, noch vor seinem zwanzigsten Geburtstag um die Welt zu reisen.
»Spezialisiere dich auf Internationales Recht«, riet J. D. ihm.
»Das ist immer mehr im Kommen, und dann kannst du reisen, während du arbeitest.«
»Ich habe mit Jura nichts am Hut«, erwiderte Michael.
»Warum nicht?« wollte J. D. wissen.
Michael filmte weiter den Schoner, der einer der phantastischsten war, die er bisher gesehen hatte. »Es würde mich langweilen.«
»Mich langweilt es nicht.«
»Du bist nicht ich.«
»Langweilt es Sam?«
»Sam ist auch nicht ich.« Michael mußte zwar zugeben, daß Sams Fachgebiet – Strafprozesse, im Gegensatz zu J. D.s, der sich mit Körperschafts- und Eigentumsrecht befaßte – aufregender war, aber trotzdem sah er sich nicht von acht Uhr früh bis acht Uhr abends in einem Büro sitzen.
»Dein Großvater rechnet damit, eines Tages drei Generationen Maxwells in der Kanzlei zu haben«, sagte J. D.
»Dann soll eben Jana Anwältin werden, die ist wie dafür geboren.«
J. D. verfiel in Schweigen. Nach einer Weile spürte Michael seinen Blick, und es lag Verwirrung in seiner Stimme, als er fragte: »Was siehst du da draußen?«
»Den Himmel. Das Meer. Ein Boot.« Nach einer kleinen Pause setzte Michael hinzu: »Neue Dinge, andere Dinge. Unsere Leben sind zu berechenbar.«
»Da spricht deine Jugend aus dir. Du bist zu jung, um den Wert von Beständigkeit zu kennen.«
»Ich will Abenteuer erleben.«
»Wie ich sagte – aus dir spricht deine Jugend.«
Michael erwiderte nichts. Wenn er etwas über seinen Vater genau wußte, dann, daß J. D. seine Meinung nicht änderte, was okay war, da Michael Teke auf seiner Seite hatte. Teke würde hinter ihm stehen, was auch immer er tun würde. Sie war cool. Sie war sein Kumpel. Angesichts der Mütter seiner Freunde dankte er seiner Glücksfee, die sie ihm beschert hatte.
Kapitel 1
Sam Pope klappte die Akte des Gerichtsurteils zu, das er gerade gelesen hatte, stand von seinem Schreibtischstuhl auf, atmete tief und zufrieden ein und mit einem genießerischen Seufzer wieder aus. Er zupfte an seinem Schnurrbart, und seine Lippen verzogen sich zu einem Lächeln. Das Lächeln wurde breiter. Er straffte seine Schultern und spürte, wie sich seine Brust in freudiger Erregung ausdehnte. Unfähig, sich zu beherrschen, gestattete er sich mit einem gutturalen »Gut gemacht, Sam!« ein inbrünstiges Eigenlob und verließ sein Büro.
»Wir haben es geschafft, Joy«, sagte er, ohne innezuhalten.
Die Augen seiner Sekretärin leuchteten auf. »Das erklärt den Ansturm der Medien.« In dem Moment, als sie ihm die rosafarbenen Zettel hinhielt, auf denen die Anrufe notiert waren, die Sam entgegenzunehmen verweigert hatte, während er das Urteil las, klingelte das Telefon erneut.
Aber Sam war schon weg, ging mit großen Schritten den Flur hinunter. Sein Gang hatte etwas Beschwingtes. Er fühlte sich wie im siebten Himmel. Eine Bürotür nach der anderen passierend, wurde er erst langsamer, als er die letzte erreicht hatte. Er wollte J. D. die Neuigkeit als erstem seiner Partner berichten. John David Maxwell war sein ältester und bester Freund.
Das Zimmer war leer.
»Er ist heute den ganzen Tag bei Continental Life in Springfield«, rief seine Sekretärin von ihrem Platz herüber.
Sam verspürte einen Anflug von Enttäuschung, doch sie war gleich wieder verflogen: Er war zu euphorisch, um sich die Laune verderben zu lassen. »Wenn er sich meldet, sagen Sie ihm, daß wir den Prozeß ›Dunn gegen Hanover‹ gewonnen haben.«
Die Sekretärin strahlte. »Er wird begeistert sein. Was für ein Sieg!«
»Ja«, nickte Sam und deutete dann mit dem Kinn in die Richtung eines weiteren Korridors, an dessen Ende ein großes Eckbüro lag, von dem aus man einen schönen Blick auf das State House, den Boston Common und den Stadtpark hatte, und in dem der Gründer der Kanzlei, Maxwell senior, residierte. »Ist John Stewart da?«
»Er ist zu einer Aufsichtsratssitzung in New York – aber er wird beeindruckt sein.«
Das sollte er auch, dachte Sam. Vor zwölf Jahren hatte John Stewart keine Strafrechtsabteilung in seiner Kanzlei haben wollen. Wenn Geld das wichtigste war, wie John Stewart glaubte, dann war sie jetzt gerechtfertigt. Schmerzensgeld in Höhe von satten sechs Millionen Dollar mußte sogar ihn überzeugen.
Auf dem Rückweg zu seinem Zimmer war er sich seines selbstgefälligen Gesichtsausdrucks durchaus bewußt, sah jedoch keinen Grund dafür, ihn zu ändern. Zwei Türen vor seiner eigenen machte er halt und klopfte an den Rahmen.
Vicki Cornell war die Partnerin, die über einen Zeitraum von vier Jahren eng mit ihm zusammengearbeitet hatte, den Fall »Dunn gegen Hanover« vom Obersten Gericht des Staates zum Appellationsgericht und schließlich vors Bundesgericht zu bringen. Beim Anblick von Sams Miene weiteten sich ihre Augen.
»Ja?«
Er nickte grinsend.
Sie stieß einen Freudenschrei aus. Er war kaum über ihre Lippen gekommen, als sie auch schon auf den Füßen war und an der Tür die Hand zur Gratulation ausstreckte. Sam schlug die zwischen ihnen herrschende kollegiale Korrektheit in den Wind und umarmte sie.
Es schien ihr nichts auszumachen. Als er sie freigab und sie einen Schritt zurücktrat, drückte ihr Gesicht die gleiche freudige Erregung über den Sieg aus, die er empfand. »Wir haben es geschafft! Wow! Haben Sie eine Kopie des Urteils?«
Er nickte. »Sie liegt auf meinem Schreibtisch.«
»Weiß Marilyn Dunn es schon?«
»Ja, und die anderen wissen es ebenfalls bereits. Sie kommen um drei zu einer Pressekonferenz hierher. Tun Sie mir den Gefallen und rufen Sie Sybil Howard an? Channel Five hat uns mit seiner Berichterstattung auf unserem Weg treu begleitet, und ich möchte Sybil die Möglichkeit geben, die ersten Fragen zu stellen. Und rufen Sie bei Locke-Ober’s an und lassen Sie ein Séparée reservieren.« Er wandte sich zum Gehen. »Bitten Sie Ihren Mann dazu und Tom und Alex und deren Partnerinnen, denen wir sie vorenthielten, während sie an dem Fall arbeiteten. Wir haben uns eine Feier verdient, schließlich geschieht es nicht jeden Tag, daß ein Präzedenzfall geschaffen wird.« Im Vorbeigehen sagte er zu Joy: »Wir sehen uns in ein paar Stunden.«
»Was haben Sie vor?«
»Ich fahre nach Hause und dann vielleicht ins College – kommt ganz darauf an, wo ich meine Frau finde.« Er hatte nicht die Absicht, Annie die Neuigkeit telefonisch zu berichten – dazu war er zu aufgeregt. Der Sieg im Fall »Dunn gegen Hanover« war eine Sensation. Er wollte seine Frau ansehen, wenn er ihr davon erzählte, sie in die Arme nehmen. Ohne das wäre keine Feier vollkommen.
Constance-on-the-Rise lag achtzehn Meilen nordwestlich von Boston. Es war ein kleiner, wohlhabender Ort, dessen Luxus-Importwagen die Pendelstrecke in die Stadt normalerweise in vierzig Minuten zurücklegten. Sam schaffte es in dreißig. Natürlich war um elf Uhr vormittags kein so dichter Verkehr wie zur Stoßzeit, und er brauste an Teams von Straßenarbeitern vorbei, ohne ein einziges Mal zu bremsen. Er war in Hochstimmung.
Sein ganzes Leben lang hatte er davon geträumt, einmal etwas Bedeutendes zu tun, Punkte für den kleinen Mann zu machen, einen Wandel herbeizuführen. Als stellvertretender Bezirksstaatsanwalt hatte er in einigen großen Mord- und Drogenprozessen die Anklage vertreten, aber keiner konnte sich mit »Dunn gegen Hanover« messen.
Annie wußte das. Annie verstand es.
Ein zweiter Grund für seine Hochstimmung war die Tatsache, daß sie dienstags immer zu Hause arbeitete. Sie würde allein sein – ohne Kind, ohne Freunde. Sie würde Zeitschriften lesen oder Examensarbeiten korrigieren oder Berichte diktieren – bis sie seine Neuigkeit hörte. Dann würde sie vor Aufregung außer sich geraten. Das war immer so, wenn er ihr eine gute Nachricht brachte.
Er rief sich andere Gute-Nachricht-Zeiten in Erinnerung. Als seine Zulassung zum Jurastudium mit der Post gekommen war, hatte er die Bibliothek nach Annie durchsucht, sie schließlich in einem entlegenen Winkel entdeckt, in eine Abstellkammer gezogen und sie, die Tür mit dem Rücken zuhaltend, geliebt. An dem Abend, als er an der Universität einen übungshalber geführten, hypothetischen Prozeß gewann, hatten sie es in seinem Auto getan. Als er erfuhr, daß er das Abschlußexamen bestanden hatte, waren sie zu dem Gasthaus hinübergelaufen, das neben dem College lag, an dem Annie sich auf ihre Abschlußprüfung vorbereitete. Ihr Zimmer war hübsch gewesen, und sie nutzten es zwei Stunden lang ausgiebig. Neun Monate später war Jonathan zur Welt gekommen.
Er fuhr mit einem Lächeln auf dem Gesicht und einem Ziehen in den Lenden dahin, und beides verstärkte sich, als er die halbrunde Zufahrt hinauf zum Eingang des Tudor-Ziegelbaus rollte. Mit von Vorfreude gerötetem Gesicht schwang er sich aus dem Wagen, eilte mit großen Schritten den kurzen Weg entlang und stieß die Tür auf.
»Annie? Gute Neuigkeiten, Sonnenschein!«
Immer zwei Stufen auf einmal nehmend, lief er in den ersten Stock und dann weiter in den zweiten zu ihrem Arbeitszimmer. Zu dieser Tageszeit würde die Sonne durch die Oberlichter auf ihren Schreibtisch scheinen. Er malte sich aus, Annie darauf zu lieben.
»Annie?«
Ihr Aktenkoffer war offen und der Schreibtisch mit Papieren übersät – aber sie war nicht da. Er durchsuchte den ersten Stock und anschließend das Parterre, wobei er immer wieder ihren Namen rief. Als er in die Garage schaute, sah er, daß ihr Wagen nicht dastand.
Irritiert, aber nicht besorgt ging er in die Küche, nahm den Telefonhörer ab und wählte die Nummer ihres Büros in der Schule. Er könnte in zehn Minuten dort sein.
Aber da war sie auch nicht.
Er schaute auf den Küchenkalender: kein Eintrag für diesen Tag. Vielleicht war sie unterwegs, um Lebensmittel zu kaufen oder etwas zum Anziehen für die Kinder. In diesem Fall würde sie, da sie nur sehr begrenzte Geduld in Läden hatte, bald zurücksein. Vielleicht hatte sie sich aber auch mit einer Freundin zum Mittagessen verabredet – dann würde es später werden.
Enttäuscht, ja sogar leicht verärgert, und mit dem Gefühl, vor Aufregung zu platzen, wenn er sich nicht schnellstens jemandem mitteilen könnte, verließ er das Haus durch die Hintertür und machte sich auf den Weg durch das Wäldchen. Die Bäume schimmerten in frischem Goldgelb und Rostrot und dufteten nach Herbst. Er trat mit einem großen Schritt über den Bach, ging unter dem Baumhaus hindurch, das er und J. D. vor langer Zeit für die Kinder gebaut und das er und Annie vor gar nicht langer Zeit für höchst erwachsene Zwecke genutzt hatten, und folgte dem Pfad, der sich durchs Unterholz schlängelte, zum Garten der Maxwells.
Nachdem er den gepflasterten Patio durchquert hatte, trat er durch die Hintertür in die Küche. »Teke?«
Die Kaffeemaschine lief – ein gutes Zeichen. Der Gedanke, daß Annie hier sein könnte, steigerte seine Erregung um ein weiteres. Teke würde es verstehen, wenn er Annie eilends durch den Wald nach Hause zöge. Teke verstand ihn beinahe so gut, wie Annie es tat – sie stand ihm so nahe wie eine Schwester.
Das Haus der Maxwells war ihm fast ebenso vertraut wie sein eigenes. Er schaute in das hinter der Küche liegende Arbeitszimmer: keine Teke. Und Annies Wagen stand nicht in der Zufahrt. Allerdings konnte es auch sein, daß sie vor dem Haus geparkt hatte.
»Teke?« rief er wieder, und dann noch einmal, lauter: »Teke?«
*
Teke hörte Sams Stimme wie aus weiter Ferne. Sie saß im Wohnzimmer in eine Ecke des Sofas gekuschelt und hielt eine Kaffeetasse umfaßt, deren Inhalt längst kalt geworden war. Sie trug den seidenen Morgenmantel, den J. D. ihr letztes Weihnachten geschenkt hatte. Er war für ihren Geschmack zu konservativ, nicht so ausgefallen wie ihre anderen Sachen, aber sie brauchte jede nur mögliche Hilfe, um sich daran zu erinnern, wer sie war. Sie fühlte sich, als habe ihr jemand den Boden unter den Füßen weggezogen. Schuld an diesem Zustand war Grady Pipers Brief.
Grady war ihre Jugendliebe gewesen, das Licht ihres jungen Lebens, der Erwecker ihrer Leidenschaft. Sie war in seinen Armen aufgewachsen, sowohl wörtlich als auch im übertragenen Sinn. Ihre letzte Begegnung lag zweiundzwanzig Jahre zurück – aber nicht etwa, weil die Trennung ihrem Wunsch entsprochen hätte. Sie hatte gefleht, sie hatte Briefe geschrieben, sie hatte versucht, ihn anzurufen. Aber er hatte auf ihr Flehen nicht reagiert, ihre Briefe ungeöffnet zurückgeschickt und sich geweigert, mit ihr zu telefonieren. Er hatte sie in jeder Weise zurückgewiesen, und schließlich hatte er ihr ins Gesicht gesagt, daß er sie nicht mehr wolle.
Mit gebrochenem Herzen und vernichtet, glaubte sie, daß er aus ihrem Leben verschwunden sei. Sie war aufs College gegangen, hatte Annie und Sam kennengelernt, J. D. Maxwell getroffen und geheiratet, drei Kinder geboren, sich ein neues Leben eingerichtet.
Jetzt war Grady wieder da – zumindest in Briefform –, und das zu einer Zeit, da es in ihrer Ehe kriselte. Es war ein unspektakulärer Prozeß, der sich in stiller Frustration äußerte, in einer Ungeduld, die vorher nicht dagewesen war – und nicht nur auf Tekes Seite. J. D. spürte es ebenso, das erkannte sie an der Art, wie er mit ihr sprach, an der Art, wie er sie anschaute. Ihre Beziehung hatte nichts Aufregendes mehr, sie waren in einen stumpfsinnigen Trott verfallen. Gradys Brief hätte zu keinem ungünstigeren Zeitpunkt kommen können.
Als er eintraf, war sie zuerst regelrecht geschockt gewesen, hatte ihn in der Hand gehalten und angestarrt und am ganzen Leib zu zittern begonnen. Seitdem hatte sie ihn oft genug gelesen, um ihn Wort für Wort auswendig zu kennen.
Er habe an sie gedacht, schrieb er. Er habe sich gefragt, wie es ihr gehe. Er spiele mit dem Gedanken, vorbeizukommen und hallo zu sagen. Um der alten Zeiten willen.
Der lässige Ton des Briefs hatte ihr einen schmerzhaften Stich versetzt. Nichts zwischen ihr und Grady war jemals lässig gewesen. Mochten auch zweiundzwanzig Jahre vergangen sein – sie glaubte nicht, daß sie ihm in die Augen schauen und sich auch nur im entferntesten ungezwungen fühlen könnte. Wie früher, so löste auch jetzt der Gedanke an ihn erregende und intensive Phantasien aus.
Und gleichzeitig Zorn. Er hatte sie einmal weggeworfen, hatte gesagt, er wolle sie nicht mehr, und obwohl es sie beinahe umgebracht hatte, war es ihr gelungen, ihn aus ihrem Kopf zu verbannen. Sie hatte sich ein Leben ohne ihn aufgebaut – er hatte kein Recht, einfach einzubrechen. Sein Wiederauftauchen würde nichts Gutes bringen – absolut nichts Gutes.
Sie war unendlich dankbar, daß Sam gekommen war – sie brauchte ihn, um sich von Grady abzulenken.
»Im Wohnzimmer!« rief sie.
Er stürmte herein, sah aus, als würde er jeden Moment vor Aufregung platzen. »Wir haben den Dunn-Prozeß gewonnen.« Sie versuchte, diese Information einzuordnen. »Den Dunn-Prozeß?«
»Es ist ein Präzedenzfall auf dem Gebiet der Beurteilung von Delikten sexuellen Mißbrauchs«, erklärte er, durch ihre mangelnde Erinnerung nicht in seiner Begeisterung beeinträchtigt.
»Bis jetzt lag die Anzeigefrist bei nur drei Jahren – aber es gibt mißbrauchte Frauen, denen erst viel später klar wird, daß sie mißbraucht wurden. Marilyn Dunn erkannte erst nach siebzehn Jahren, warum sie in der Hölle gelebt hatte. Siebzehn Jahre später war sie in die Lage, ihren Peiniger zu verklagen – und zu gewinnen. Weißt du, was das für die Heerscharen betroffener Frauen in diesem Staat bedeutet?«
Teke erinnerte sich, daß er den Fall ihr gegenüber schon erwähnt hatte. Der Funke seiner Erregung sprang auf sie über. »Du hast den Prozeß gewonnen?«
»Ich habe sechs Millionen Dollar Schmerzensgeld rausgeschlagen«, antwortete er mit einem breiten Grinsen.
Sie stand vom Sofa auf, um ihn zu umarmen. »Das ist großartig, Sam.«
Übermütig schwenkte er sie im Kreis herum. »Ein Präzedenzfall! Endlich ein Sieg für Menschen, die ihn bitter nötig haben.«
»Das ist sehr gut«, sagte sie und genoß seine Nähe. Sam war ihr bester Freund. Er war ein Fels, nicht wie J. D. und nicht wie Grady, sondern ein Mann, der Stärke und Zuverlässigkeit vermittelte.
»Ah, es ist ein so gutes Gefühl, Teke. Wir haben so hart dafür gearbeitet.«
Sie stieß einen kleinen, wohligen Laut aus und schlang unter seinem Jackett die Arme um seine Taille. Sam war ein »Berührer« – wie sie. Es würde ihn nicht stören, und sie brauchte es. Seine Körperlichkeit verdrängte das gähnende schwarze Loch, das sie zu verschlingen gedroht hatte.
»Ich habe mir immer einen solchen Fall gewünscht«, sagte er in ihre wirren Locken hinein. Seine Stimme drückte die tiefe Befriedigung aus, die er empfand. »Aber es gibt sie nur alle heiligen Zeiten.«
Sie schloß die Augen und überließ sich dem Echo seiner Stimme. Es war eine kraftvolle Stimme, eine sehr männliche Stimme. »Du hast dafür geschuftet«, gurrte sie. »Du hast den Sieg verdient.«
»Meine Klienten haben den Sieg verdient.«
»Du hast ihn für sie verdient.« Sie zog hörbar die Luft ein. Sein Körper fühlte sich plötzlich zu gut an dem ihren an, aber sie konnte sich nicht von ihm lösen. Er erinnerte sie auf seltsame Weise an Grady. Nach dem Gefühl der Leere, das von ihr Besitz ergriffen hatte, war seine Umarmung eine Erlösung und ein Genuß. Was war schon dabei? »Hast du’s Annie schon erzählt?«
»Sie war nicht zu Hause«, erwiderte er mit einem leisen Stöhnen. Eigentlich war jetzt der Zeitpunkt gekommen, Teke loszulassen, doch statt dessen drückte er sie noch fester an sich. »Ich dachte, sie sei vielleicht hier.«
»Nein«, flüsterte Teke. Eine Flamme loderte in ihrem Leib auf. Es lag an Grady, verdammt noch mal – Grady, der die Vergangenheit und die Gegenwart miteinander verschmelzen ließ.
»Mein Gott, Teke.«
Sie flüsterte seinen Namen, zumindest glaubte sie, es sei sein Name, obwohl es kaum mehr als ein Seufzer war. Das Feuer in ihr trieb sie dazu, sich an ihn zu drängen, und er kam ihr entgegen.
»Mein Gott!« keuchte er.
Sie wußte, was ihn dazu veranlaßte: Sie spürte das Pulsieren seines Blutes – oder des ihren – und ihrer beider Widerstand in der Hitze schmelzen. Sie wollte sich zwingen, sich loszureißen, doch ihr Körper nahm den Befehl nicht entgegen. Sie war wieder der Teenager von damals in Gullen, getrieben von einem lange unterdrückten und überwältigenden Verlangen.
Er berührte sie, und das schwelende Feuer brach sich Bahn. Eine verzehrende Begierde bemächtigte sich ihrer.
Irgendwie öffnete sich der Reißverschluß seiner Hose. Sie konnte ihre Hände nicht daran hindern, in seine Boxershorts zu gleiten, und als sie ihn erst einmal angefaßt hatte, war an ein Aufhören nicht mehr zu denken. Sein Penis war erigiert, und sie sehnte sich so sehr nach der Erfüllung eines Traumes, daß sie den Gürtel ihres Morgenmantels löste.
Und dann war es um sie beide geschehen. Er taumelte mit ihr zum Sofa, und während sie sein Hemd so heftig aufriß, daß die Knöpfe wegsprangen und dann ihre weitgeöffneten Lippen über seine Brust wandern ließ, stieß er immer und immer wieder in sie hinein, mit wachsender Leidenschaft, bis er mit einem langgezogenen, gutturalen Schrei zum Höhepunkt kam. Sie wollte ihm gerade folgen, als ein hartes Klappen ihren Genuß unterbrach. Es dauerte mehrere Sekunden, bis ihr umnebelter Verstand das Geräusch identifizieren konnte.
»O Gott!« schrie sie und wand sich unter Sam heraus. Sie band ihren Hausmantel zu und lief zur Tür. »Das war Michael! Er hat uns gesehen!« Sie hatte gerade die Vordertreppe erreicht, als auf der Straße ein unheilvolles Quietschen von Bremsen und blockierenden Reifen ertönte.
»Michael!« schrie sie gellend und rannte los. Jetzt hämmerte ihr Herz nicht aus Leidenschaft, sondern in Panik. Sie hetzte den Fußweg hinunter, wagte nicht zu denken. Eine Hecke aus Zwergtannen und Rhododendron verwehrte ihr die Sicht auf die Straße. Erst als sie den Bürgersteig erreichte, sah sie den schmutzigblauen, offenen Lieferwagen, der seitwärts schleudernd zum Stehen gekommen war. Sie hastete um das Fahrzeug herum und fiel auf die Knie. Michael lag auf dem Bauch, ein Arm und ein Bein standen in einem unnatürlichen Winkel von seinem Körper ab. Seine Augen waren geschlossen, unter seinem Kopf rann Blut hervor.
Ihr Herz donnerte gegen ihre Rippen. Entsetzt streckte sie die Hand nach seinem Gesicht aus, berührte es jedoch nicht, bewegte sie zu seinem Hinterkopf und weiter zu seinem Nacken, hielt sie aber aus Angst auch hier ein Stück weg. »Michael?« Ihre Stimme zitterte. »Kannst du mich hören, Michael?«
Er reagierte nicht. Vorsichtig ließ sie die Hand auf seinen Kopf sinken.
Sam hockte auf der anderen Seite des Jungen. »Beweg ihn nicht. Wir müssen Hilfe holen.«
»Ich habe ihn nicht gesehen«, wurde irgendwo hinter oder neben ihnen eine tiefe, männliche Stimme laut. »Er kam plötzlich zwischen den Bäumen herausgeschossen. Ich habe versucht, anzuhalten.«
Tekes Pulsschlag setzte aus. Es war die Stimme – die Stimme, an die sie sich so gut erinnerte. Aber das war unmöglich. Sie mußte es sich einbilden. Kein Gott, der seine Sinne beieinander hatte, würde ihr das antun.
»Wir brauchen einen Krankenwagen«, schnauzte Sam in Richtung der Stimme. »Gehen Sie zu den Clingers ...«
»Ich habe schon angerufen«, rief Virginia Clinger, die in einem rosafarbenen Jogginganzug und einer Wolke »Obsession« über den Rasen vor ihrem Haus gelaufen kam. »Sie sind unterwegs. Was ist denn passiert?« Sie beugte ihren blonden Kopf über Michaels. »Lebt er noch?«
»Ja!« schrie Teke, verzweifelt bemüht, zu glauben, daß es so war. Sie hatte eine Hand auf Michaels Rücken gelegt, um den kaum spürbaren Rhythmus seines Atems zu überwachen. »Was kann ich tun?« jammerte sie, hektisch vor Hilflosigkeit. »Was kann ich tun?«
»Halte seine Hand«, drängte Sam sie sanft. »Laß ihn wissen, daß du hier bist.« Zart strich er dem Jungen über das glänzende, braune Haar.
»Michael?« versuchte Teke es noch einmal. Sie beugte sich noch weiter zu ihm hinunter. »Kannst du mich hören? Ich bin’s – Mommy ist hier, mein Schatz. Mach die Augen auf.«
»Er ist bewußtlos«, verkündete Virginia.
»Wir haben ihm gesagt, er solle nicht aus der Schule weggehen«, erklang eine neue, ängstliche Stimme. »Wir haben es ihm gesagt! Aber er war sicher, er könnte es vor dem Ende der Mittagspause nach Hause und wieder zurück schaffen.«
Teke schaute zu den aschfahlen Gesichtern von Michaels besten Freunden auf, den Zwillingen Terry und Alex Barker. Während Alex mit offenem Mund auf Michaels reglose Gestalt hinabstarrte, plapperte Terry: »Wir hatten erfahren, daß es für Club-MTV nächste Woche in Great Woods noch Karten gab. Joshs Vater erklärte sich bereit, sie heute abend abzuholen, aber nur, wenn wir alle sie vorher bezahlten. Michael wollte heim, um sich die Erlaubnis seiner Mutter und das Geld zu holen.«
»Er kam aus dem Haus«, verkündete Virginia.
Tekes Blick flog zu ihr und folgte dann dem ihren zu Sam. Sein Hemd klaffte auf, sein Gürtel war offen. Er schloß die Schnalle, aber das war alles, was er zur Wiederherstellung seines Erscheinungsbildes tat, bevor seine Hand zu Michaels Kopf zurückkehrte. »Wo bleibt der verdammte Krankenwagen?« murmelte er.
Sam, o Sam, was haben wir getan? schrie Teke stumm, doch selbst ohne Ton war ihre Stimme ihr fremd, nicht kräftig wie sonst, nur ein schwacher Abglanz, der ihre ganze Seelenqual ausdrückte. Sie war nicht mehr so verzweifelt gewesen, seit sie an der nördlichsten Küste von Maine bettelarm in einer stinkenden Fischerhütte gehaust hatte. Damals hatte Grady sie gerettet, jetzt könnte nicht einmal er sie retten.
»Du bist bald wieder okay, Mikey«, brachte sie mühsam hervor. »Die Ärzte verstehen ihr Handwerk.« Und an sich selbst richtete sie mit zitternder Stimme die Aufforderung: »Bleib ruhig. Reg dich nicht auf.«
»Warum ist er so unbedacht aus dem Haus gestürmt?« fragte Virginia. »Warum hat er nicht nach rechts und links geschaut, ehe er auf die Straße lief?«
»Er ist reingelaufen und gleich wieder rausgestürzt gekommen«, schluchzte Terry. »Wir haben ihn vom Hügel der Carters aus beobachtet. Er war nicht länger als eine halbe Minute im Haus.«
»Hat er dich wegen des Konzerts gefragt?« wollte Virginia von Teke wissen.
Sie konnte nicht antworten – sie war außerstande, im Moment an etwas anderes zu denken. Sie hielt seine Hand, streichelte den Arm, der unverletzt schien, und plötzlich wurde ihr schwindlig und sie schwankte.
Sam streckte die Hand aus, um sie aufrecht zu halten. »Er kommt wieder in Ordnung, Teke.«
Sie nickte ruckartig kund flehte inbrünstig darum, daß er recht hätte.
»Kinder sind stark, sie verkraften eine Menge.«
Das ferne Heulen einer Ambulanzsirene durchbohrte die Luft. Es erschien ihr ebenso unwirklich wie der Rest der Welt.
Das Heulen wurde lauter, brach abrupt ab, als der Krankenwagen in ihre Straße einbog. Hinter ihm folgte ein Streifenwagen. Beide fuhren nahe an die Unglücksstelle heran, ehe ihre Insassen ausstiegen.
Teke nahm unscharf wahr, daß weitere Nachbarn am Gehsteig erschienen, aber sie konzentrierte sich weiterhin auf Michael. Als Sam sie packte und wegzog, um Platz für die Sanitäter zu machen, wehrte sie sich, aber er hielt sie fest. »Die Männer sind für so was ausgebildet, sie können ihm helfen.«
»Er ist mein Baby«, flüsterte sie und versuchte, um die uniformierten Rücken herum ihren Sohn zu sehen. »Wenn er es nicht schafft, sterbe ich.«
»Er wird es schaffen.«
»Es ist meine Schuld.«
»Nein.«
»Haben Sie gesehen, wie es passiert ist?« wandte einer der Polizeibeamten sich an die Umstehenden.
Ehe einer von ihnen antworten konnte, sagte der Fahrer des Lasters: »Der Truck gehört mir. Ich habe versucht, anzuhalten, aber es war zu spät.«
Tekes Blick flog zu ihm, und ein stummer Schrei stieg in ihr auf. Grady! Nein, nein – nicht Grady! Bitte, lieber Gott – nicht Grady! Bitte! Aber die zweiundzwanzig Jahre hatten seine Züge kaum verändert. Allerdings hätte er auch eine Maske tragen können, sie hätte ihn sofort an seinen Augen erkannt. Es waren dunkle Augen, tief wie Seen, in denen man ertrinken konnte, immer voller Gefühle für sie – und sie waren jetzt nicht anders. Sie begann, wie Espenlaub zu zittern.
Sam hatte den Arm um ihre Schulter gelegt und drückte sie fest an sich. »Mach dir keine Sorgen, Teke, er wird wieder. Er ist ein kräftiger, gesunder Bursche.«
Teke beobachtete, wie der Polizist Grady außer Hörweite zog, und richtete den Blick dann auf die Sanitäter, die dabei waren, Michael auf eine Bahre zu schnallen.
»Sie sollte sich anziehen, meinen Sie nicht?« wandte Virginia sich an Sam, der versuchte, Teke in Richtung Haus herumzudrehen. Aber sie weigerte sich. »Ich kann ihn nicht allein lassen.« Sie war überzeugt, daß er sterben würde, wenn sie es täte.
»Ein Pullover und Leggins wären das beste«, meinte er. »Wir werden vielleicht eine ganze Weile im Krankenhaus sein.«
»Ich kann ihn nicht allein lassen!«
»Laufen Sie doch bitte rein und holen ein paar Sachen für sie«, bat Sam Virginia. »Sie kann sich dann umziehen, wenn wir dort sind.«
Virginia lief los.
Einer der Sanitäter blickte von seiner Tätigkeit auf. »Wir haben es hier mit Knochenbrüchen zu tun, vielleicht auch mit einer inneren Blutung, aber besorgniserregend ist die Kopfverletzung. Ist es Ihnen recht, wenn wir ihn ins Massachusetts General Hospital bringen?«
Teke wußte nicht, was sie antworten sollte, sie kannte die Alternativen nicht. Sie wußte überhaupt nichts, und das Leben ihres Kindes stand auf dem Spiel.
»Ist okay«, sagte Sam zu dem Sanitäter, und zu Teke: »Es ist die beste Klinik – da können wir nichts falsch machen.«
Michael wurde auf der Bahre in die Ambulanz geschoben. Teke stieg ebenfalls ein.
»In Ordnung – fahr mit ihm«, sagte Sam. »Ich komme in meinem Wagen nach. Ich kann ja dort telefonieren. Annie wird die Kinder einsammeln. Wir treffen uns im Krankenhaus.«
Ein schrecklicher Gedanke schoß Teke durch den Kopf: J. D.! Er mußte angerufen werden, mußte informiert werden, mußte kommen.
»Ich kümmere mich darum«, versprach Sam. In seinen Augen stand das gleiche unausgesprochene Entsetzen, das sie empfand.
»Hier«, sagte Virginia und reichte Teke eine Tasche. »Ich habe auch Unterwäsche dazugetan.«
Teke sah gerade noch den Blick, den Virginia Sam zuwarf, bevor Sam ihr in den Krankenwagen hinaufhalf, dann wandte sie ihre Aufmerksamkeit Michael zu. Während der Fahrt lösten sich ihre Blicke kein einziges Mal von seinem Gesicht, und als sie am Ziel waren, blieb sie bei ihm, hielt seine Hand, wünschte sich verzweifelt, er würde die Augen öffnen und sein freches Grinsen aufsetzen.
Aber seine Augen blieben geschlossen, und sein Mund wurde sehr bald um einen Beatmungsschlauch herum zugeklebt. Sie verließ die Kabine in der Notaufnahme erst, als die Ärzte ihr nachdrücklich erklärten, daß sie den Platz brauchten, den sie einnahm. In einem leerstehenden Zimmer in der Nähe zog sie sich um und lehnte dann mit hängenden Schultern an der Wand im Flur und starrte unverwandt auf die Tür, hinter der die Ärzte sich um Michael bemühten.
Sam gesellte sich zu ihr. »Schon was Neues?«
Nach der kurzen Zeit, die vergangen war, und angesichts der Distanz, die jetzt zwischen ihnen bestand, brachte sie es, nach dem, was sie getan hatte, nicht über sich, ihn anzusehen, und so schüttelte sie nur den Kopf.
»Teke ...«
Sie unterbrach ihn mit einer Handbewegung – sie wollte nicht darüber nachdenken, was geschehen war, geschweige denn darüber reden.
Aber er bestand darauf. »Es war meine Schuld.«
Sie legte einen zitternden Finger an die Stirn und versuchte, sich auf Michael zu konzentrieren, darauf, was die Ärzte taten und auf die Frage, ob es helfen würde oder nicht.
»Es muß Michael einen Schock versetzt haben, als er uns sah.«
»Bitte!« flehte sie. Ihr Kopf war randvoll mit schrecklichen Gedanken – sie hatte keinen Platz mehr für einen weiteren.
»Nicht jetzt.«
»Es wird später nicht einfacher sein.«
»Doch – wenn Michael überlebt. Wenn er überlebt, wird alles einfach sein.«
»Er wird überleben«, versicherte Sam ihr mit einer Sicherheit, die ihr guttat. Sie hatte eine Ermutigung dringend nötig. Sie ließ ihre Hand sinken, ihr Blick traf sich mit dem seinen, und seine tiefblauen Augen, die energische Kinnlinie und der Entschlossenheit vermittelnde Schwung des Mundes unter dem Schnurrbart – dies alles drückte aus, daß er von dem überzeugt war, was er sagte. »Ganz bestimmt, Teke.«
Sie nickte und bemühte sich darum, sich wieder auf Michael zu konzentrieren, doch andere Bilder schoben sich davor. Sie sah Sams breite Brust, spürte seine Erektion, hörte den Schrei, der seinen Orgasmus begleitete, dann das Zuschlagen der Tür, das Quietschen von Bremsen, das Heulen einer Sirene. Sie sah die blitzenden Lichter des Krankenwagens, die Blutlache unter Michaels Kopf, den schmutzigblauen Laster, der schräg auf der Straße stand, das erschütterte, schmerzhaft vertraute Gesicht des Fahrers. Grady. O Grady. Verdammt noch mal, Grady.
Ein gequälter Aufschrei entschlüpfte ihr. Sam streckte beruhigend die Hand nach ihr aus, doch sie wich zurück. »Ich bin okay.« Sie atmete tief durch und verbannte Grady aus ihren Gedanken. Michael war der einzige, der jetzt eine Rolle spielte. »Sein Bein ist gebrochen. Das wird ihn nicht gerade freuen, denn in einem Monat beginnt die Basketball-Saison.«
»Das macht nichts«, erwiderte Sam. »Er wird auf der Bank sitzen und als Hilfstrainer fungieren, bis er wieder fit zum Spielen ist.«
»Er wird niedergeschmettert sein, wenn er auch nur ein Spiel auslassen muß.«
»Das Team auch, schließlich ist er der Star.«
»Was wird, wenn er für die ganze Spielzeit ausfällt?«
»Dann wird er nächsten Sommer trainieren und in der darauffolgenden Saison doppelt so gut sein.«
»Und wenn er dann noch immer nicht spielen kann?«
»Er wird spielen.«
»Und wenn er nie wieder spielen kann?« Es war das Undenkbare, an das zu denken sie nicht umhinkonnte.
Sam blieb zunächst still. Dann stieg ein qualvoller Laut aus den Tiefen seiner Kehle empor. Trotz ihrer eigenen ungeheuren Angst nahm sie sich seine Situation zu Herzen. »Nicht gerade eine rauschende Feier zu Ehren deines Prozeßsieges, was?« sagte sie traurig.
»Vergiß den Prozeß«, erwiderte er scharf. »Ich habe die Pressekonferenz und das Dinner abgesagt. Ich kann an so was jetzt nicht denken, geschweige denn feiern.« Er fuhr sich mit der Hand durch die Haare. »Seltsam, wie das Leben so spielt: Vor drei Stunden war ich der Größte – jetzt bin ich das letzte.«
»Hast du mit Annie gesprochen?« fragte Teke und verspürte einen schmerzhaften Stich: Das war ein weiterer Schrecken, mit dem sie sich befassen müßten.
»Nur über Michael. Sie wollte reinkommen, um dir beizustehen, aber ich sagte ihr, wir brauchten sie, damit die Kinder von der Schule abgeholt würden.«
Teke preßte die Wange an die Wand. »Annie ist so anständig«, flüsterte sie. »Sie hätte das niemals getan, was ich getan habe.«
»Es war nicht deine Schuld.«
»Ich habe dich ja regelrecht bedrängt.« Der Gedanke entsetzte sie – und er hatte etwas Verwirrendes. »Ich weiß nicht, was plötzlich in mich gefahren war. Ich habe mir noch nie vorgestellt, auf diese Weise mit dir zusammenzusein, aber als du auftauchtest, war ich mit meinen Gedanken gerade ganz woanders, und ich wollte ... ich wollte ...« Sie hatte Grady gewollt – so einfach war das. Ihre Ehe stagnierte. Sie hatte sich nach den Empfindungen gesehnt, die Grady stets in ihr weckte, nach der Gefühlstiefe, der freudigen Erwartung und der sich bis in die Seele erstreckenden Befriedigung, die das Zusammensein mit ihm für sie bedeutete und woran zu denken sie sich jahrelang untersagt hatte. Sein Brief hatte alles wieder an die Oberfläche geholt. Nachdem sie ihn ungezählte Male gelesen hatte, war ihr Verlangen nach seiner Leidenschaft ins Unermeßliche gewachsen.
Ekel, Selbstverachtung, Bedauern – all das vermischte sich in ihr, und sie drehte sich noch weiter zur Wand. Dann öffnete sich die Tür, und Teke fuhr herum. Den Atem anhaltend, sah sie einen der Ärzte auf sich zukommen.
»Wir bringen ihn auf die Intensivstation. Wir werden einige Tests machen, aber ich möchte seine Funktionen genauer beobachten.«
Teke schluckte trocken. »Ist er aufgewacht?«
»Noch nicht.«
»Wird er aufwachen?«
»Wir hoffen es.«
»Wann?«
»Das wissen wir nicht.«
»Haben Sie keine Vermutung?«
Der Arzt schenkte ihr ein trauriges Lächeln. »Zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Vielleicht später, wenn wir eine präzisere Vorstellung vom Ausmaß der Verletzung haben. Sie können mit uns raufkommen, wenn Sie wollen, es gibt ein behagliches Zimmer dort.«
Kurze Zeit später fand Teke sich in dem Warteraum des fünften Stockwerks wieder, wo sie versuchte, sich bei einem Tee zu entspannen, den Sam ihr gebracht hatte, doch daran war gar nicht zu denken. Sie dachte an Sam und an seinen Kummer, an J. D. und den Zorn, der mit Sicherheit über sie hereinbrechen würde – aber hauptsächlich dachte sie an Grady und den Schock, den das Wiedersehen mit ihm für sie bedeutet hatte.
Dann kam Annie. Sie brachte Jana und Zoe mit, die beide nah an den Tränen waren und Trost brauchten, was Teke ihnen nicht geben konnte. Ihr Herz war zu schwer, ihre Sorge zu groß. Und als Annie sie in die Arme schloß, stieg ein alles verschlingendes Schuldgefühl in ihr auf.
Die liebe, mitfühlende, verständnisvolle Annie – diesmal verstand sie gar nichts.
Teke erinnerte sich an den Tag im September 1970, als sie sich kennengelernt hatten. Sie war ein ängstlicher Neuankömmling gewesen, der um Selbstvertrauen betete, während sie ihre Reisetaschen den Flur des Wohnheims hinunterschleppte. Die Taschen enthielten ihre gesamten weltlichen Besitztümer, die ihr plötzlich samt und sonders unpassend erschienen. Und ihre Sorge wuchs mit jedem Zimmer, an dem sie vorbeikam. Mit jeder eifrigen Mutter, die Vorhänge anbrachte, mit jedem hübsch gekleideten Neuling, der dabei war, seine neuen Sachen auszupacken, fühlte sie sich fehl am Platz. Dann kam sie zu dem ihr zugewiesenen Zimmer und sah auf der Fensterbank ein Mädchen sitzen, das einen abgegriffenen Terminkalender auf den Knien liegen hatte und ebenso ängstlich aussah wie sie.
»Theodora?« fragte Annie mit kleiner Stimme.
»Teke«, korrigierte Teke lapidar. »Theodora ist zu lang.«
Annie stieß erleichtert die Luft aus und lächelte. »Gott sei Dank! Ich war schon völlig fertig, weil ich mir nicht vorstellen konnte, was ich je mit einem Mädchen zu tun haben könnte, das Theodora heißt. Teke ist perfekt. Und ich finde deine Ohrringe toll. Aus was sind sie?«
Sie waren aus Angelschnur, die Teke vom Fußboden des Fischereizubehörladens aufgehoben und zu großen Blüten geknüpft hatte, die gegen ihren Hals stießen, wenn sie sich bewegte. Annie hatte sie wunderschön gefunden – ebenso wie die Jeans, die Teke vom Sohn des Pastors »geerbt« und bestickt hatte, und die übergroßen Westen, die sie aus der Truhe ihres Vaters genommen hatte, bevor sie den Rest verkaufte.
Sie waren schnell Freundinnen geworden. Annies Stärke war das Schreiben, Tekes die Mathematik. Annie war die Denkerin, Teke die Technikerin. Sie hatten sich als Team durch vier Collegejahre gearbeitet, Männer geheiratet, die beste Freunde waren, die Teamarbeit durch einen Doktor der Philosophie, je eine Wohnung und zwei Häuser, zahllose Schulsammlungen, Feiertage und Ferien und fünf Kinder fortgesetzt.
Jetzt war plötzlich alles anders. Teke hatte die Beziehung sabotiert, und Annie hatte noch keine Ahnung davon.
»Er wird wieder gesund«, sagte Annie leise.
Teke, die sich wie eine falsche Schlange fühlte, entfloh der Umarmung. »Darum bete ich.«
»Die Ärzte hier sind die besten. Ist J. D. schon auf dem Weg hierher?«
Teke nickte. Das Bedürfnis, sich zu bewegen und die Qual zu lindern, die sie empfand, ließ sie den Flur hinunter zu Michaels Zimmer gehen. Sie ging nicht hinein, sondern stellte sich ans Fenster und beobachtete die Aktivitäten im Raum. Annie und die Mädchen gesellten sich zu ihr.
»Was machen sie denn?« fragte Zoe.
»Tests«, antwortete Teke.
Jana lehnte sich an sie. »Kriegt er das mit?«
Teke schluckte. »Nein, er ist immer noch bewußtlos.«
»Dann hat er keine Schmerzen?«
»Ich glaube nicht.«
»Wann können wir zu ihm?«
»Wenn sie fertig sind.«
»Kommt er wieder in Ordnung?«
»Ich hoffe es.«
Jana schaute sie an – nicht mehr zu ihr auf, sie waren beinahe gleich groß, wobei Teke sich im Augenblick winzig klein fühlte, und sagte: »Annie hat uns erzählt, daß sie den Kerl erwischt haben.«
Wieder sah Teke Gradys Gesicht vor sich, und ihr Herz krampfte sich zusammen. So viele Jahre waren vergangen, seit sie es zuletzt gesehen hatte, und auch damals hatte es Erschütterung ausgedrückt.
Er hätte nicht kommen sollen, schrie sie stumm. Ihr Leben gehe ihn nichts an, hatte er ihr einmal gesagt, warum hatte er sich dann nicht heraushalten können?
Sie hätte gerne geweint. Statt dessen atmete sie tief durch und antwortete mit kontrollierter Stimme: »Sie brauchten ihn nicht zu ›erwischen‹, er hat den Unglücksort nicht verlassen.«
»Haben sie ihn festgenommen?«
»Das weiß ich nicht.«
»Ist er zu schnell gefahren?«
»Das kann ich nicht beurteilen, ich habe ihn nicht kommen sehen.«
»Warum hat Michael ihn nicht gehört oder gesehen?«
Das wußte Teke nicht, aber sie konnte es sich denken, und der Gedanke war nicht dazu angetan, sie zu beruhigen. Ebensowenig wie der, daß Janas Fragen im Vergleich zu denen, die J. D. ihr nach seinem Eintreffen stellen würde, ein »Spaziergang« waren.
Kapitel 2
Auf dem Weg von Springfield in die Stadt wurde J. D. wegen überhöhter Geschwindigkeit angehalten. Der Polizist sagte, er sei achtzig Meilen pro Stunde gefahren. Unter anderen Umständen hätte er eine Diskussion mit ihm begonnen. Er war Rechtsanwalt und wußte Bescheid. Radargeräte waren in höchstem Maße unzuverlässig. Wenn er den Polizeibeamten auf sechzig »herunterhandeln« konnte, würden Rechtsmittel den Strafzettel aus der Welt schaffen.
Doch diesmal reichte er widerspruchslos Führerschein und Fahrzeugpapiere aus dem Fenster und sagte: »Ich war mitten in einer schwierigen Besprechung, als ich telefonisch informiert wurde, daß mein Sohn von einem Auto angefahren wurde. Er ist offenbar bewußtlos. Mehr weiß ich noch nicht. Er ist dreizehn.«
»Dreizehn?« Der Officer runzelte die Stirn. »Das ist hart.«
»Meine Frau und mein bester Freund sind bei ihm im Krankenhaus. Ich habe versucht, sie zu erreichen, aber sie halten sich irgendwo zwischen der Notaufnahme und der Intensivstation auf. Ich konnte nicht einmal einen Arzt an den Apparat bekommen – sie nehmen meine Anrufe nicht entgegen.«
»Seien Sie dankbar, wenn sie sich um Ihren Sohn kümmern.«
»Aber ich kann nicht in Erfahrung bringen, wie es um ihn steht«, klagte J. D. »Und gar nichts zu wissen, ist eine Qual. Ich male mir die schrecklichsten Dinge aus. Es tut mir leid – ich habe nicht auf die Geschwindigkeit geachtet. Ich war nicht bei der Sache.«
Der Polizist gab ihm die Papiere zurück. »Sie haben eine bessere Entschuldigung als die meisten. Ich werde Sie nicht aufhalten und Ihnen einen Strafzettel ausstellen – aber passen Sie den Rest der Fahrt auf, okay? Vor allem, wenn Sie telefonieren. Es wäre bestimmt nicht im Sinne Ihres Sohnes, wenn Sie auf dem Highway sterben würden.«
J. D. achtete darauf, daß die Tachonadel nicht über hundert hinausging. Wenn er gerade nicht das Krankenhaus drängte, ihn zu jemandem durchzustellen, der Bescheid wußte, sprach er mit mit Vicky Cornell, seiner Sekretärin, über Sams Fall. »Dunn gegen Hanover« war ein Meilenstein – die Publicity würde großartig für die Kanzlei werden.
Sein Vater würde sich ärgern – und das war erst eine Befriedigung! John Stewart hatte sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, Sam in die Anwaltsfirma aufzunehmen. Er war der Ansicht, Sam fehlten die Verbindungen und die gesellschaftliche Stellung, um Karriere zu machen. Aber J. D. war entschlossen gewesen, es zu riskieren. Zum einen hatte Sam sich im Büro des Bezirksstaatsanwalts profiliert, zum anderen wurde er von Ehrgeiz getrieben, und zum dritten hatte er Annie geheiratet, die Tekes beste Freundin war. Doch vor allem hatte J. D. Sam in der Kanzlei haben wollen, weil sie beide ihrerseits beste Freunde waren. Sam bewirkte, daß er menschlich, gesellig und locker blieb.
J. D. war froh, daß Sam bei Teke im Krankenhaus war. Er vertraute seinem Urteilsvermögen. Falls Entscheidungen zu fällen wären, würde Sam Teke die besten plausibel machen, und sie würde mit Sicherheit der Führung bedürfen. Wahrscheinlich war sie im Augenblick »lahmgelegt«. Sie besaß nicht seine Fähigkeit, in Krisensituationen einen klaren Kopf zu bewahren. Sie war nicht entsprechend aufgewachsen. In dieser Hinsicht war sie eindeutig provinziell, hinterwäldlerisch. Sie würde niemals auf die Idee kommen, ihn im Auto anzurufen, um ihm nähere Einzelheiten mitzuteilen und seine Sorge zu mindern.
Wie sich herausstellte, gab es herzlich wenig, was die Sorge hätte mindern können. Als J. D. in die Klinik kam, erfuhr er, daß Michaels äußere Verletzungen behandelt worden waren, daß er an einem Beatmungsgerät hing, daß die Ärzte dabei waren, Tests zu machen, die Resultate bisher jedoch keine eindeutigen Schlüsse zuließen. Niemand wußte etwas Genaues, und das beunruhigte J. D. unendlich.
»Keine Prognose?« fragte er Teke, die am Fenster stand und völlig fertig aussah.
»Es ist noch zu früh.«
»Ärzte stellen immer Prognosen«, widersprach er.
»Nicht bei Kopfverletzungen.«
»Ist das Gehirn geschädigt?«
»Das wissen sie noch nicht.«
»Warum nicht?«
»Das weiß ich nicht. Sie sagen eben, daß sie es nicht wissen.«
Er wußte, daß sie aufgeregt war, aber das war er auch. Schließlich war Michael genauso sein Sohn. Sie hätte die Ärzte auf Trab bringen müssen, aber das war nicht ihre Art. Sie war eine gute Köchin, eine gute Hausfrau, sie verstand es, gut einzukaufen. Sie präsentierte sich optimal und arrangierte eindrucksvolle Dinnerpartys. Sie nähte ungewöhnliche Halloween-Kostüme, half den Kindern bei den Hausaufgaben, trainierte die Little League, veranstaltete Schulauktionen, die Tausende von Dollar für Kunstkurse einbrachten – aber bei privaten Krisen versagte sie.
Bei diesen Gelegenheiten war Annie ein wahrer Segen für sie. Annie half ihr in die Realität zurück.
In der Absicht, Annie zu ihr zu schicken, ging J. D. den Flur hinunter zum Warteraum, aber Annie war mit Jonathan und Leigh beschäftigt. Also winkte J. D. Sam auf den Gang hinaus.
»Was wissen wir über den Mann, der ihn angefahren hat?«
»Ich habe gerade mit der Polizei gesprochen«, berichtete Sam bedrückt. »Er ist Zimmermann, nicht aus diesem Staat und derzeit arbeitslos, aber sein Führerschein und die Fahrzeugpapiere sind in Ordnung. Er wird nicht angeklagt.«
J. D. starrte ihn ungläubig an. »Aber er hat meinen Sohn angefahren.«
»In Wahrheit«, korrigierte Sam, »ist Michael ihm ins Auto gelaufen.«
Das glaubte J. D. keine Sekunde. »Der Kerl muß zu schnell gefahren sein.«
»Fünfundzwanzig – laut dem Experten, der die Bremsspuren untersucht hat.«
»Dann waren seine Bremsen schadhaft.«
Sam schüttelte den Kopf. »Die Polizei sagt, nein.«
»Was wissen die Dorftrottel denn schon?« schnaubte J. D. »Deren Spezialität ist es doch, Autofahrer vor den Kadi zu bringen, weil sie zu weit vom Randstein geparkt haben. Ich werde einen Privatdetektiv einschalten. Deinen Mann – diesen Mundy. Der wird Beweise finden, die diesen arbeitslosen Zimmermann hinter Gitter bringen.«
»Nicht, wenn es keine gibt.« Sam schaute ihn bekümmert an.
»Hör zu, J. D. Ich weiß, daß du einen Schuldigen finden möchtest – das ist das Natürlichste von der Welt, aber der Bursche ist es nicht. Er hielt sich an die Geschwindigkeitsbeschränkung. Michael kam plötzlich wie aus dem Nichts auf die Straße herausgeschossen, prallte gegen das Frontblech des Trucks, wurde in die Luft geschleudert und stürzte von der Kühlerhaube auf die Straße, und während der ganzen Zeit stand der Fahrer auf dem durchgetretenen Bremspedal. Er war nicht betrunken. Er war nicht high. Er war einfach nur da, als Michael angerannt kam.«
»Willst du damit sagen, daß es Michaels Schuld war?«
Sam fuhr sich mit der Hand durch die Haare und blickte stirnrunzelnd zu Boden. Mit einem Seufzer hob er den Kopf und schaute J. D. wieder an. »Ich sage nur, daß es reine Energieverschwendung wäre, den Versuch zu machen, dem Fahrer etwas am Zeug zu flicken. Der Unfall ist geschehen, es mag ein Dutzend Gründe dafür geben, aber sie sind nicht wichtig. Wichtig ist allein, dafür zu sorgen, daß Michael die bestmögliche Pflege erhält. Ich habe Bill Gardner dafür gewonnen, die Leitung der Behandlung zu übernehmen.«
»Aber ist der denn hier?« wollte J. D. wissen. »Chefärzte sind manchmal zu sehr mit der Ausbildung der Studenten beschäftigt, um ihren Patienten genügend Zeit zu widmen.«
Sam deutete mit dem Kinn in die Richtung von Michaels Zimmer, aus dem gerade ein Arzt trat. »Das ist Bill.«
J. D. ging auf ihn zu, stellte sich vor und sprudelte seine aufgestauten Fragen hervor. Unglücklicherweise erfuhr er nicht viel mehr, als Teke erfahren hatte. Bill Gardner war ein netter Mann, aber er konnte nur wenig Konkretes anbieten. Während er zuhörte, zog J. D. ein Notizbuch aus der Innentasche seines Jacketts, um sich zu notieren, was Gardner sagte – einschließlich der Namen der Ärzte seines Teams. Dann schaute er zu Michael hinein, der immer noch von medizinischem Personal umringt war. »Wie oft dürfen wir ihn besuchen?«
»Wann immer Sie wollen. Ich habe eine unbegrenzte Besuchserlaubnis unterschrieben. Vielleicht hilft es ihm, vertraute Stimmen zu hören.«
»Dann kann er also hören?«
»Möglicherweise. Sicher sind wir nicht.«
Die vage Auskunft ärgerte J. D. Er wollte Antworten. »Wann kommen die Patienten in solchen Fällen meistens wieder zu Bewußtsein?«
»Das kann jederzeit passieren.«
»Oder nie. Liegt er im Koma?«
Bill Gardner zuckte nicht mit der Wimper. »Technisch gesehen, ja. Ich scheue mich jedoch, dieses Wort in Gegenwart Ihrer Frau zu gebrauchen, sie hat schon genug Angst.«
Das war Tekes Problem. J. D. hatte nicht die Zeit, ihre Hand zu halten, und noch weniger den Wunsch. Annie würde ihr helfen.
»Was kann man tun, um Michael durchzubringen?«
»Im Augenblick nicht viel. Wir haben ihn stabilisiert. Er atmet. Er bekommt Infusionen. Seine eventuellen Schmerzen sind auf ein Minimum reduziert worden. Jetzt warten wir.«
»Auf Komplikationen?« fragte J. D.
»Oder auf eine Besserung.«
»Welche Komplikationen könnten eintreten?«