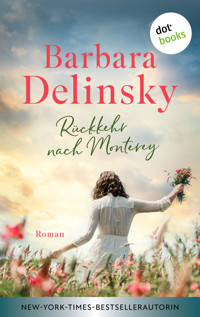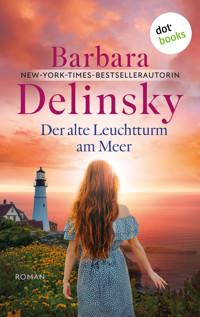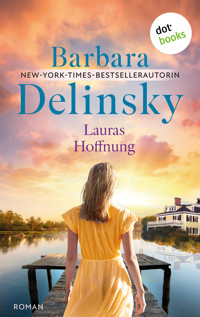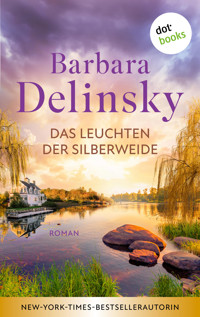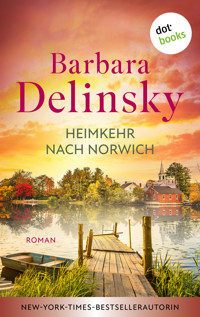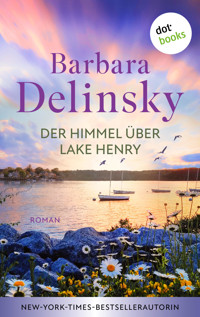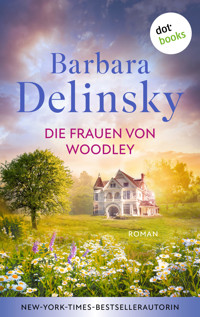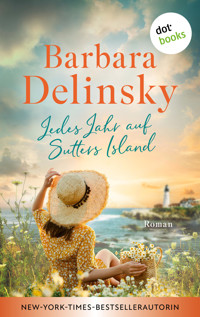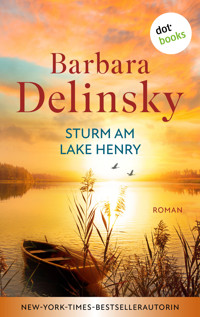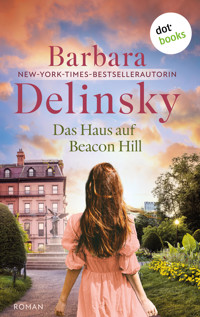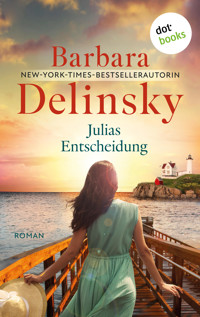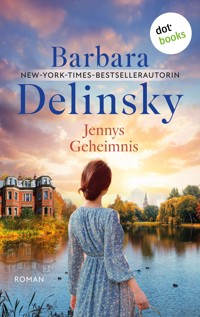5,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kann aus einem schmerzlichen Verlust neue Hoffnung wachsen? Der Schicksalsroman »Ein ganzes Leben zwischen uns« von Barbara Delinsky als eBook bei dotbooks. In ihrer idyllischen Heimstadt in Vermont hat sich die junge Kinderärztin Paige stets geborgen und glücklich gefühlt – doch all das zersplittert in tausend Scherben, als ihre beste Freundin sich das Leben nimmt. Wie soll sie nur mit diesem Schmerz umgehen, wenn sie sich auch noch um Maras Tochter kümmern muss? Paige wollte nie Mutter werden … und merkt zu ihrer eigenen Überraschung, dass es ihr ungeahnte Kraft verleiht, diesen kleinen Menschen in ihren Armen zu halten. Aber dann fällt plötzlich ein dunkler Verdacht auf Peter, einen Arztkollegen von Paige – welche Schuld hat er auf sich geladen? Die Kleinstadt gerät in Aufruhr, und es scheint allein in Paiges Hand zu liegen, die Wahrheit herauszufinden … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der bewegende Roman »Ein ganzes Leben zwischen uns« von New-York-Times-Bestsellerautorin Barbara Delinsky. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 731
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über dieses Buch:
In ihrer idyllischen Heimstadt in Vermont hat sich die junge Kinderärztin Paige stets geborgen und glücklich gefühlt – doch all das zersplittert in tausend Scherben, als ihre beste Freundin sich das Leben nimmt. Wie soll sie nur mit diesem Schmerz umgehen, wenn sie sich auch noch um Maras Tochter kümmern muss? Paige wollte nie Mutter werden … und merkt zu ihrer eigenen Überraschung, dass es ihr ungeahnte Kraft verleiht, diesen kleinen Menschen in ihren Armen zu halten. Aber dann fällt plötzlich ein dunkler Verdacht auf Peter, einen Arztkollegen von Paige – welche Schuld hat er auf sich geladen? Die Kleinstadt gerät in Aufruhr, und es scheint allein in Paiges Hand zu liegen, die Wahrheit herauszufinden …
Über die Autorin:
Barbara Delinsky wurde 1945 in Boston geboren und studierte dort Psychologie und Soziologie. Nach der Geburt ihres ersten Sohnes arbeitete sie als Fotografin für den Belmont Herald, erkannte aber bald, dass sie viel lieber die Texte zu ihren Fotos schrieb. Ihr Debütroman wurde auf Anhieb zu einem großen Erfolg. Inzwischen hat Barbara Delinsky über 70 Romane veröffentlicht, die in mehr als 20 Sprachen übersetzt wurden und regelmäßig die New-York-Times-Bestsellerliste stürmen. Sie engagiert sich außerdem sehr stark für Wohltätigkeitsvereine und Aufklärung rund um das Thema Brustkrebs. Barbara Delinsky lebt mit ihrem Mann in New England und hat drei erwachsene Söhne.
Die Website der Autorin: barbaradelinsky.com/
Bei dotbooks veröffentlichte Barbara Delinsky auch ihre Romane:
»Die Schwestern von Star’s End«
»Jennys Geheimnis«
»Das Weingut am Meer«
»Julias Entscheidung«
»Lauras Hoffnung«
»Die alte Mühle am Fluss«
»Der alte Leuchtturm am Meer«
»Sturm am Lake Henry«, Die Blake-Schwestern 1
»Der Himmel über Lake Henry«, Die Blake-Schwestern 2
»Heimkehr nach Norwich«
»Das Leuchten der Silberweide«
»Das Licht auf den Wellen«
»Die Frauen Woodley«
»Ein Neuanfang in Casco Bay«
»Rückkehr nach Monterey«
»Drei Wünsche hast du frei«
»Im Schatten meiner Schwester«
»Jedes Jahr auf Sutters Island«
»Was wir nie vergessen können«
***
eBook-Neuausgabe November 2023
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1993 unter dem Originaltitel »Suddenly« bei Doubleday, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1996 unter dem Titel »Der Tag, an dem alles anders wurde« bei Knaur.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1993 by Barbara Delinksy.
Published by Arrangement with Barbara Delinsky
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1996 bei Knaur Taschenbuch. Ein Unternehmen der Droemerschen Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. GmbH & Co. KG, München.
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-98690-911-6
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: info@dotbooks.de. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Ein ganzes Leben zwischen uns« an: lesetipp@dotbooks.de (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Barbara Delinsky
Ein ganzes Leben zwischen uns
Roman
Aus dem Amerikanischen von Georgia Sommerfeld
dotbooks.
Kapitel 1
Paige Pfeiffer lief an der Spitze, gab ein Tempo vor, das eine weniger mutige Neununddreißigjährige sich vielleicht nicht zugetraut hätte – aber sie mußte etwas beweisen und eine Wette gewinnen. Bei der Wette ging es um ein Dinner in Bernie’s Béarnaise, Zentral-Vermonts absolutem In-Restaurant. Bei dem Beweis ging es darum, daß eine Frau ihres Alters, sofern sie in Form war, mit Leichtigkeit eine nur halb so alte Frau besiegen konnte, die es nicht war. Und nicht zuletzt ging es um das Ansehen der Mädchen-Geländelaufmannschaft der Mount Court Academy, deren Trainerin sie jetzt das fünfte Jahr war.
Der Lauf war zu einer Tradition geworden – wenn auch einer mit vorhersehbarem Ablauf. Auf den ersten drei Meilen warfen die Mädchen den jeweils nachfolgenden Mädchen überhebliche Bemerkungen zu. Auf der zweiten Meile, die durch Wald führte und den Teenagern, die den Sommer über im Luxus der Reichen geschwelgt hatten, körperlich einiges abverlangte, scheiterten diese Bemerkungen an Luftmangel. Die dritte Meile, auf der es wieder die Straße entlang ging, dünnte den Pulk aus. Die schwächeren Läuferinnen blieben zurück. Nur die Stars des Teams hielten sich bei Paige.
Es gab in diesem Jahr sechs Stars. Fünf davon waren schon letztes Jahr für sie gelaufen, die sechste war neu in der Schule. »Na – wie geht’s denn?« fragte Paige nach hinten und bekam keuchende Beschwerden zur Antwort. »Legen wir noch einen Zahn zu«, trieb sie die Mädchen an und startete durch. Drei setzten sich neben sie. Minuten später, als sie die Geschwindigkeit erneut erhöhte, war nur noch eine übrig. Es war die Neue, bisher so still, daß Paige kaum mehr von ihr wußte als ihren Namen. Sara Dickinson. Ihr Durchhaltevermögen überraschte Paige – und sie war noch mehr überrascht, als das Mädchen plötzlich in Führung ging.
Paige hatte Mühe, mit ihr Schritt zu halten, als sie unter dem schmiedeeisernen Torbogen hindurchliefen, der den Eingang der Schule markierte, und für einen Moment fragte sie sich, ob sie ihre beste Zeit vielleicht doch schon überschritten habe. Als der Gedanke sich als ärgerlich erwies, mobilisierte sie ihre Reserven und schaffte es, gleichzuziehen. Schulter an Schulter rannten sie an den mit sattem Septembergrün belaubten hohen Eichen entlang die Zufahrt hinunter und bogen, ohne die Schnelligkeit zu drosseln, in den Weg zur Sporthalle ein.
»Du bist gut«, keuchte Paige mit einem Blick auf das Mädchen neben ihr. Sie war groß für ihr Alter, hatte einen biegsamen Körper, lief scheinbar mühelos, und auf ihrem Gesicht lag ein Ausdruck von Konzentration, der ihre Züge streng wirken ließ. Als Paige wieder einmal zu ihr hinüberschaute, sah sie, wie Saras Konzentration sich plötzlich verlagerte – und Sekunden später war sie allein. Das Mädchen hatte den Kurs geändert, steuerte zielsicher auf das Gebüsch am Rande des Weges zu. Eine nach der anderen gesellten sich die übrigen Läuferinnen hinzu.
Paige lief eine große Kurve, und, ihr Tempo auf Abkühlgeschwindigkeit drosselnd, zurück. In verschiedenen Stadien der Atemlosigkeit umringten die Mädchen Sara, die vor einem ausladenden Taxusbusch kauerte. Paige brauchte einen Moment, um zu erkennen, was sich unter dem tiefsten Ast befand.
»Es ist so winzig!«
»Wem gehört es?«
»Wie ist es hierher gekommen?«
Den Lauf vergessend, kniete Paige sich hin, nahm das Kätzchen, ein orangegraues, jämmerlich miauendes Fellknäuel, in die Hand und fragte Sara: »Wie hast du es gesehen, um Himmels willen?«
»Ich bemerkte, daß sich etwas bewegte«, antwortete das Mädchen, und der Chor setzte wieder ein.
»Es gehört nicht hierher – im Mount Court gibt es nur Hunde.«
»Jemand muß es hereingeschmuggelt haben ...«
»Und dann ausgesetzt!«
»Es sieht halbverhungert aus.«
Paige dachte das gleiche und überlegte gerade, was mit dem Tierchen geschehen sollte, als sich die Blicke aller auf sie richteten.
»Wir können es unmöglich hierlassen.«
»Es ist so klein – es würde sterben.«
»Das wäre grausam.«
»Sie müssen es nehmen, Dr. Pfeiffer.«
Paige sah ihr vollgestopftes Haus vor sich. »Ich habe keinen Platz für ein Haustier – und auch keine Zeit.«
»Katzen sind leicht zu halten – sie brauchen nicht viel Aufmerksamkeit.«
»Dann behaltet ihr es!« konterte Paige.
»Das können wir nicht.«
»Es ist gegen die Hausordnung.«
Paige war lange genug Trainerin am Mount Court, um zu wissen, daß die Übertretung von Vorschriften hier an der Tagesordnung war, und obwohl sie das natürlich nicht guthieß, war sie belustigt. »Gegen die Hausordnung? Was gibt es sonst Neues?«
»Der Rektor ist neu.«
»Er ist ein Arschloch.«
»Ein Großkotz!«
»Er hat schon am zweiten Schultag zwei Jungs rausgeschmissen.«
»Aus welchem Grund?« erkundigte sich Paige, die drastische Ausdrucksweise für dieses eine Mal übergehend.
»Potrauchen.«
»Ohne eine Verwarnung oder so was.«
»Er ist total bescheuert.«
»Es geht abwärts mit der Schule.«
»Wir können sie bald in ›Mount Court Strafanstalt‹ umtaufen.«
Paige hatte den neuen Rektor noch nicht kennengelernt und stellte sich gerade eine Kreatur mit Hörnern und Bocksfuß vor, als das Flehen erneut begann.
»Nehmen Sie das Kätzchen, Dr. Pfeiffer.«
»Es wird sterben, wenn Sie es nicht tun.«
»Wollen Sie das auf Ihr Gewissen laden?«
Paige streichelte das winzige Geschöpf, das kaum mehr als eine Handvoll Fell und Knochen war und wie Espenlaub zitterte.
»Ich werde manipuliert.«
»Für einen guten Zweck«, sagte eines der Mädchen.
Paige warf ihr einen tadelnden Blick zu. »Es ist für einen guten Zweck«, war der Satz, den sie immer sagte, wenn sie die Mädchen zu einer Extrarunde um den Campus antrieb.
»Aber ich habe keine Ahnung von Katzen«, protestierte sie, was sich als schwerer Fehler erwies, denn sie hatte den Satz kaum ausgesprochen, als es auch schon von allen Seiten Ratschläge bezüglich Ernährung, Einstreu und Unterbringung hagelte. Zehn Minuten später saß sie in ihrem Auto und das Kätzchen in einer Pappschachtel auf dem Beifahrersitz.
»Nur, bis ich ein Zuhause dafür gefunden habe«, erklärte sie durch das offene Fenster und fuhr, entschlossen, dies sofort in die Wege zu leiten, geradewegs in die Stadt. Sie hielt vor dem Polizeirevier, um das Kätzchen dem für entlaufene Tiere zuständigen Beamten zu präsentieren, doch dieser hatte bereits Feierabend gemacht. Sie hinterließ ihm eine Nachricht und versuchte es im General Store. Die Familie, der er gehörte, hatte Katzen. Viele Katzen. Sie dachte, eine mehr würde keine Rolle spielen – vor allem eine so winzige.
»Ich kann sie leider nicht nehmen«, lehnte Hollis Weebly mit einem betrübten Kopfschütteln ab. »Ich mußte eben erst eine von unseren einschläfern lassen: Leukose. Die anderen werden sie auch kriegen – und ihre Kleine auch, wenn ich sie nehmen würde. Es wäre am besten, wenn Sie sie behielten. Sie sind Ärztin – bei Ihnen ist sie gut aufgehoben.«
Verzweiflung stieg in Paige auf, während sie ihm hin und her durch die kurzen Gänge zwischen den Regalen folgte und ihren Standpunkt klarzumachen versuchte. »Ich bin Kinderärztin – ich verstehe nicht das geringste von Katzen.«
»Aber Sie kennen den Tierarzt, und der tut es. Bringen Sie die Kleine morgen früh zu ihm – er wird Ihnen sagen, was Sie wissen müssen.« Er drückte ihr eine große, braune Papiertüte in die Arme. »Da ist alles drin, was Sie bis dahin brauchen.« Er brachte sie zur Tür. »Stellen Sie ihr Wasser neben das Essen hin, und richten Sie ihr einen warmen Schlafplatz her.«
»Aber ich kann sie nicht behalten.«
»Sie wird Sie lieben, Doc. Jeder liebt Sie.«
Plötzlich saß sie wieder in ihrem Wagen, mit Katzenzubehör und dem Kätzchen, und Hollis war in seinen Laden zurückgekehrt.
»Na toll«, sagte sie zu dem Winzling, der zusammengerollt in einer Ecke seiner Schachtel eingeschlafen war. »Ich bin kein Mensch für Haustiere – aber interessiert das irgendwen?« Sie war ein Menschen-Mensch: Im Krankenhaus, in der Praxis, in der Schule – ihre Tage waren angefüllt mit zwischenmenschlichen Kontakten der unterschiedlichsten Art, und es gefiel ihr so. Ihr Leben verlief in festen Bahnen.
Mara! Ja – Mara wäre die Richtige für das Kätzchen! Sie hatte eine Schwäche für alles Hilflose, ein goldenes Herz, und nach dem Verlust ihres letzten Pflegekindes und angesichts der Tatsache, daß das Baby aus Indien erst in ein paar Monaten kommen würde, konnte sie eine Ablenkung gut gebrauchen.
Zu Hause angekommen, versuchte sie ihre Freundin und Kollegin anzurufen, aber diese ging nicht an den Apparat. Also trug Paige den Karton mit dem Kätzchen hinein und holte anschließend die Tüte. Als sie Futter in einem Schüsselchen zerdrückt hatte, war das Kätzchen wach und schrie. Sie hatte es kaum vor das Futter gesetzt, als er auch schon hastig zu fressen anfing.
Sie setzte sich hin und schaute ihm zu. Das kleine Ding war noch so jung, daß es eher wie eine Maus aussah als wie eine Katze. Vielleicht sollte sie ihm Milch geben. Menschenbabys tranken Milch – wenn nicht Muttermilch, dann ein Ersatzprodukt, und wenn eine Laktose-Unverträglichkeit bestand, so gab es auch dafür eine Lösung. Paige kannte alle Möglichkeiten, die einem bei der menschlichen Babyernährung offenstanden – aber ein Katzenbaby war etwas anderes.
Das Kätzchen fraß weiter. Paige stand auf, wischte eine alte Plastikwanne aus und schüttete etwas Streu hinein. Sie stellte sie nicht weit vom Futternapf auf den Boden und wollte das Kätzchen eben hineinsetzen, so wie die Mädchen sie instruiert hatten, als das Telefon klingelte.
Es war ihr Auftragsdienst mit einem Notfall. Das Opfer war ein Fünfjähriger, der im Laufe eines Baseballspiels im heimischen Hinterhof einem seiner Mitspieler in den Schläger gelaufen war, der ihn – Gottlob war er aus Plastik – an der Augenbraue getroffen hatte.
Paige sagte Bescheid, daß sie Vater und Sohn in zwanzig Minuten in der Notaufnahme des Tucker General treffen würde, was ihr gerade genügend Zeit ließ, um zu duschen und selbst dorthin zu kommen.
Der Junge zeigte keine Symptome für eine Gehirnerschütterung, aber die Platzwunde war so tief, daß eine unansehnliche Narbe entstünde, wenn sie nicht ordentlich genäht würde. Der Kleine fürchtete sich schrecklich vor der Krankenhausatmosphäre und vor Paige. Also setzte sie sich erst einmal ein Weilchen zu ihm und brachte ihm so schonend wie möglich bei, was sie tun würde, aber selbst dann war es noch schwierig. Die Injektion des Mittels zur örtlichen Betäubung war schmerzhaft, und dagegen war alles Mitgefühl von Paige machtlos. Doch als dann die Wirkung einsetzte, war das Nähen ein Spaziergang. Sie belohnte die Tapferkeit des Jungen mit einem Lutscher und begleitete ihn und seinen Vater zum Wagen.
Sie war eben in die Klinik zurückgekehrt, als ihr Piepser sich meldete. Eine ihrer neueren Patientinnen, ein acht Monate altes Mädchen, das schon fast den ganzen Tag gefiebert hatte, war aufgewacht, glühte regelrecht und schrie. Die Eltern waren in Panik. Paige, die sich größere Sorgen um die Eltern machte als um das Kind, wies sie an, die Kleine hereinzubringen.
»Sie möchten nicht zufällig ein Kätzchen?« fragte sie die Schwester an der Anmeldung, die daraufhin hastig den Kopf schüttelte. »Wissen Sie vielleicht jemanden?« Als die Schwester sie fragend ansah, erklärte sie: »Ich habe eines – für den Fall, daß Ihnen irgendeine Möglichkeit einfällt.«
Wieder versuchte sie Mara zu erreichen, wieder ohne Erfolg.
Das Baby hatte eine Mittelohrentzündung. Nachdem sie den Eltern die schnellste Möglichkeit zur Fiebersenkung genannt und ihnen die Menge Antibiotika gegeben hatte, die sie brauchen würden, bis sie am nächsten Morgen in die Apotheke gehen könnten, brachte Paige sie, ihnen versichernd, daß es ihrem Kind bald wieder gutgehen würde, zum Parkplatz. In diesem Augenblick hielt mit quietschenden Reifen und ersterbender Sirene eine Ambulanz vor der Tür.
In den Stunden, die folgten, wurde Paige wieder einmal bewußt, warum sie sich entschlossen hatte, in Tucker, Vermont, zu praktizieren, anstatt in Boston, Chicago oder New York. In Tucker kam sie dem Tätigkeitsbereich eines Allgemeinarztes so nahe, wie es einem modernen Arzt nur möglich war. Kinderheilkunde war zwar ihr Spezialgebiet, aber die Gegebenheiten der Region und der ärztlichen Gemeinschaft diktierten: Bei Sturm alle Mann an Deck! In diesem Fall handelte es sich um eine Massenkarambolage, und obwohl Klinikärzte da waren, hatte man durchaus Verwendung für ein Paar zusätzliche Hände. Sie nähte Platzwunden, richtete Knochen ein, machte sogar eine Ultraschallaufnahme bei einem der Unfallopfer, das im achten Monat schwanger war. Hätte die Frau Wehen bekommen, hätte Paige sich auch darum gekümmert. Babys zur Welt zu bringen war fast ebenso befriedigend, wie zu erleben, daß kranke Kinder gesund wurden, worum es in ihrem Beruf ja ging.
Natürlich gelang es ihr nicht immer zu helfen. Es gab Kinder, die so krank waren, daß sie sie an einen Spezialisten überweisen mußte, und gelegentlich konnten diese nicht mit positiven Prognosen aufwarten. Aber das waren die Ausnahmen. Zum größten Teil hatte sie es in ihrer Praxis mit mehr oder weniger »normalen« Fällen zu tun.
Als sie, auf befriedigende Weise erschöpft, nach Hause kam, war es ein Uhr nachts. Sie wäre wahrscheinlich durch die dunkle Wohnung gegangen, auf ihr Bett gesunken und Sekunden später eingeschlafen – wenn sie nicht über die Katzenschachtel gefallen wäre. Sie hatte ihren neuen Hausgenossen völlig vergessen. Offenbar hatte das Kätzchen sie gehört: Ihr Sturz löste ein aus der Ferne ertönendes Miauen aus. Sie folgte dem Geräusch durch das Wohnzimmer und den kurzen Flur zu ihrem Schlafzimmer. Dort lag das winzige Fellknäuel, eingekuschelt zwischen Patchworkkissen, auf ihrem Bett.
Sie hob es hoch. »Was machst du denn hier, Baby? Du sollst doch in der Küche bleiben.« Das Tierchen begann zu schnurren. Sie kraulte es zwischen den Ohren. Eingelullt von dem zarten Geräusch sank sie auf das Rattan-Zweiersofa, das quer vor einer Ecke des Raumes stand, lehnte sich gegen weitere Patchworkkissen, zog die Füße hoch, die sie die letzten achtzehn Stunden getragen hatten, und hätte beinahe auch angefangen zu schnurren.
»Das gefällt dir, was?« fragte sie. Eine vage Freude stieg in ihr auf. Sie wußte natürlich, daß sie das kleine Ding nicht behalten konnte – aber für den Augenblick war es gar nicht schlecht, es bei sich zu haben.
Sie spielte mit dem Gedanken, noch einmal bei Mara anzurufen. Mara ging kaum je vor zwei Uhr nachts ins Bett und dann nie für lange. Sie war eine Denkerin. Außerdem war sie eine Aktivistin, was bedeutete, daß sie viel zu denken hatte. Im Moment dachte sie bestimmt über Tanya John nach, ihr Pflegekind, das weggelaufen war. Die Geschichte hatte Mara schwer getroffen.
Aus diesem Grund und weil Mara in letzter Zeit müde ausgesehen hatte, beschloß Paige, doch nicht bei ihr anzurufen – vielleicht schlief sie ja bereits.
Das Kätzchen hatte sich zusammengerollt, das Näschen in das Fell seines Bauches gebohrt, die Augen waren fast geschlossen. Sie trug es in die Küche und legte es vorsichtig in die Schachtel, aber sie war kaum wieder im Flur, als es an ihr vorbeischoß. Als sie ins Schlafzimmer kam, schaute es ihr vom Bett entgegen. Plötzlich zu müde, um sich daran zu stören, zog sie sich aus, glitt ins Bett, und ihr Verstand formulierte keinen Gedanken mehr, bis am nächsten Morgen neben ihrem Ohr das Telefon klingelte. Ginny, ihre Empfangssekretärin, teilte ihr mit, daß es halb neun und Mara nicht erschienen sei. Sie nehme den Hörer nicht ab und reagiere nicht auf ihren Piepser.
Besorgnis erwachte in Paige. Sie holte sich das Telefon ins Bett und versuchte ihrerseits, Mara zu erreichen, hatte jedoch nicht mehr Glück als am Abend zuvor. Sie konnte sich nicht vorstellen, daß Mara verreist war – schließlich hatte sie Patienten zu versorgen. Es konnte höchsten sein, daß sie gestern abend herumgefahren war – das tat sie oft, wenn sie etwas quälte –, und irgendwann, als sie müde wurde, am Straßenrand angehalten hatte und im Auto eingeschlafen war.
Dankbar für die familiäre Kleinstadtatmosphäre tippte sie die Nummer des Tucker Police Department ein und erklärte das Problem dem Hilfssheriff, der versprach, die Straßen und Maras Haus zu überprüfen, und erfreut klang, etwas zu tun zu haben. Abgesehen von gelegentlichen Autounfällen, war Tucker, Vermont, eine verschlafene Gemeinde. Jede Aufregung war willkommen.
Paige legte den Hörer auf und ging duschen. Als sie ein paar Minuten später die Kabinentür öffnete und nach einem Handtuch griff, stieß sie einen spitzen Schrei aus, als irgend etwas Kleines durch den Dampf auf sie zugeschossen kam.
Sie atmete tief durch. »Du hast mich vielleicht erschreckt, Kitty! Ich hatte dich ganz vergessen. Schaust du dich ein bißchen um?« Sie trocknete sich ab. »Viel zu sehen gibt es ja nicht – das Haus ist nicht gerade groß.«
Plötzlich sah sie ihr nicht-großes Haus mit nicht-großen »Geschenken« des nicht-großen Kätzchens übersät, dem sie sein Klo nicht gezeigt hatte. Mit dem Schlimmsten rechnend, ging sie ins Schlafzimmer und zog in aller Eile eine schwarze Latzhose und ein weißes T-Shirt an. Nachdem sie ihre Haare gebürstet hatte, die in Wellen fast bis auf ihre Schultern herabfielen, trug sie das Kätzchen in die Küche und setzte es dort hin, wo sie es am Abend vorher hätte hinsetzen sollen. »Okay – mach dein Geschäft.« In diesem Augenblick bemerkte sie eine Erhöhung in dem Streu. »Ahhh – du hast es schon gemacht. Braves Kätzchen.« Der nächste Blick zeigte ihr, daß der Futternapf fast leer war. Also füllte sie ihn wieder, ebenso das Wasserschüsselchen, stürzte ein Glas Orangensaft hinunter und stellte das Glas dann ins Spülbecken.
»Ich muß zur Arbeit«, erklärte sie dem Kätzchen, das sie mit winzigen, runden Augen musterte. »Schau mich nicht so an – ich gehe jeden Tag zur Arbeit. Deshalb kann ich mir auch kein Haustier halten.« Sie ging in die Knie und tätschelte das Tierchen. »Und wenn Mara dich nicht nimmt, dann nimmt dich jemand anderer. Ich werde ein Zuhause für dich finden, wo sie mit dir schmusen.«
Sie richtete sich auf und schaute auf das Kätzchen hinunter. Es wirkte so klein und allein, daß es ihr einen Stich gab. »Genau darum will ich kein Haustier«, murmelte sie und zwang sich, das Haus zu verlassen.
In der Praxis war die Hölle los. Paige wechselte von einem Behandlungsraum zum nächsten, ohne eine Pause oder einen Gedanken an Mara, bis sie alle Patienten behandelt hatte. Als sie schließlich in ihr Büro zurückkam, sah sie sich dem Polizeichef gegenüber.
Etwas stimmte nicht – das spürte sie sofort. Norman Fitch war ein massiger Mann mit üblicherweise rosigem Gesicht, doch jetzt sah er aus, als habe er einen Tritt in die Weichteile bekommen.
»Das Benzin ging aus – aber leider erst, als sie es geschafft hatte«, sagte er leise. »Das Garagentor war fest zu.«
Paige schaute ihn verständnislos an. »Was?«
»Dr. O’Neill. Sie ist tot.«
Das Wort hallte zuerst durch den Raum, dann durch Paiges Kopf. Sie mochte es nicht. Sie hatte es nie gemocht, was sie – nachdem sie sich rettungslos in den Arztberuf verliebt hatte – hauptsächlich dazu bewog, die Kinderheilkunde zu wählen. In diesem Spezialgebiet kam dieses Wort am seltensten vor.
»Mara ist tot?« Das konnte nicht sein.
»Wir haben sie ins Leichenschauhaus gebracht«, sagte Norman.
»Sie werden die Leiche identifizieren müssen.«
Die Leiche. Paige preßte eine Hand auf den Mund. Mara war keine Leiche. Sie war eine Macherin, eine Kämpferin, ein Wirbelwind. Mara als lebloser Körper in der Leichenhalle – das war ein Widerspruch in sich.
»Mara? Tot?«
»Der Gerichtsmediziner wird eine Autopsie vornehmen«, fuhr Norman fort, »aber es gibt keine Anzeichen für Gewaltanwendung.«
Es dauerte eine Minute, bis Paige begriff, was das hieß, und eine weitere, bis ihr Entsetzen ihr zu sprechen erlaubte.
»Dann ... glauben Sie, es war Selbstmord?«
»Sieht so aus.«
Paige schüttelte den Kopf. »Unmöglich! Das hätte sie nie getan. Es muß anders gewesen sein.« Mara tot? Das konnte nicht sein! Paige warf einen Blick zur Tür, erwartete beinahe, daß die fragliche Person hereinstürmen und wissen wollen würde, warum Norman gekommen war.
Aber sie stürmte nicht herein – die Tür blieb geschlossen. Und Norman beharrte auf seiner Meinung. »Es ist die klassische Technik. Kinderleicht und schmerzlos.«
»Mara hätte niemals Selbstmord begangen«, protestierte Paige erneut. »Nicht bei den vielen Patienten, die sich auf sie verließen. Und wegen des Babys erst recht nicht.«
»Sie war schwanger?« fragte Norman mit einer Betroffenheit, die er bei seinem Bericht über »die Leiche« nicht hatte erkennen lassen, was Paige zu einem schärferen Ton veranlaßte.
»Sie erwartete ein Adoptivkind. Aus Indien. Es hat ewig gedauert, aber jetzt ist alles in Ordnung – das hat Mara mir gerade erst erzählt. Sie sagte, die Behörde in Indien habe sie als Mutter akzeptiert, und das Baby käme in einem Monat oder so. Sie hat ein Zimmer für das Kind eingerichtet, alles besorgt, was ein Baby so braucht, Spielzeug gekauft ... Sie war so aufgeregt.«
»Warum erst in einem Monat?«
»Amtsschimmel.«
»Hat sie das deprimiert?«
»Es frustrierte sie.«
»War sie wegen des John-Mädchens deprimiert?«
»Nicht so deprimiert. Das hätte ich gewußt – wir waren eng befreundet.«
Norman nickte und verlagerte sein Gewicht auf den anderen Fuß. »Möchten Sie vielleicht, daß jemand anderer die Leiche identifiziert?«
Die Leiche. Da war es wieder, das Bild einer plötzlich erstarrten Gestalt, des Verstandes und der Seele beraubt – die Antithese zu Mara O’Neill. Paige schloß unwillkürlich die Augen, um es nicht mehr sehen zu müssen. Es war falsch, obszön, pervers. Wieder flammte Zorn in ihr auf – und dann Verzweiflung.
»Dr. Pfeiffer?«
»Schon gut«, brachte sie mühsam hervor. »Ich mache es.« Sie bemühte sich zu denken. »Aber ich brauche jemanden, der hier inzwischen die Stellung hält.« Sie rief Angie an, erwähnte Normans Behauptung jedoch nicht. Die Worte auszusprechen würde ihnen Realität verleihen. Aus dem gleichen Grund bestand sie darauf, Norman mit ihrem Wagen hinterherzufahren: Je »normaler« sie sich verhielte, sagte sie sich, umso weniger würde sie sich als Närrin fühlen, wenn sich die ganze Sache als übler Scherz herausstellte. Aber sie machte sich etwas vor – das wurde ihr in dem Moment klar, als sie das Leichenschauhaus betrat. Die ganze Stadt kannte Mara, einschließlich Norman Fitch und sein Stellvertreter und der Gerichtsmediziner, und daß sie, Paige, die Leiche identifizieren sollte, war nur eine Formalität.
Der Tod war still und reglos. Er war eine schwachblaue Färbung der Haut, die immer rosig gewesen war. Er war ein intensives, jäh aufflammendes Gefühl von Furcht und Verlust und Trauer. Und er war auf eine seltsame und unerwartete Weise friedvoll.
Paige rief sich die Mara ins Gedächtnis, die auf dem College ihre Zimmerkameradin gewesen war, die Mara, die mit ihr in den Kanadischen Rockies Ski gefahren war, die Geburtstagstorten gebacken, Pullover gestrickt und Seite an Seite mit ihr in Tucker, Vermont, als Ärztin praktiziert hatte. Sie rief sich die Mara ins Gedächtnis, die sie im Laufe der Jahre für mehr als einen guten Zweck ins Feld zu ziehen überredet hatte.
»O Mara«, flüsterte sie, »was ist passiert?« Ihr war, als würde sie in Stücke gerissen.
»Sie haben nichts bemerkt?« fragte der Gerichtsmediziner neben ihr. »Keine plötzlichen Stimmungsschwankungen?«
Paige brauchte eine Minute, um sich zu fassen. »Nichts, was zu der Vermutung Anlaß gegeben hätte, daß sie sich etwas antun würde. Sie machte sich Sorgen wegen Tanya John. Als ich das letzte Mal mit ihr sprach ...«
»Wann war das?« hakte Norman ein.
»Gestern früh in der Praxis. Sie war außer sich, weil das Labor einige Tests verpfuscht hatte – aber heftige Reaktionen waren typisch für Mara.« Für die Tests hatte sie Todd Fiske, einem ihrer vierjährigen Lieblingspatienten, Blut abnehmen müssen. Auch Paige wäre in diesem Fall wütend gewesen. Sie haßte es, Kindern Blut abzunehmen – und jetzt müßte es noch mal gemacht werden.
Sie konnte sich nicht vorstellen, Todd und seiner Familie zu erzählen, daß Mara gestorben war. Sie konnte sich nicht vorstellen, es irgend jemandem zu erzählen.
»O Mara«, flüsterte sie wieder. Sie sehnte sich danach, diesen schrecklichen Ort zu verlassen, aber gleichzeitig fiel es ihr unendlich schwer. Es war nicht richtig, daß Mara hier blieb – sie hatte noch so viel vor sich.
Maras Familie in Eugene, Oregon, reagierte auf Paiges Nachricht mit einem Schweigen, das keine Rückschlüsse auf ihre Gedanken zuließ. Mara hatte sich ihnen schon vor Jahren entfremdet. Paige war traurig, jedoch nicht überrascht, als sie baten, sie in Tucker zu beerdigen.
»Sie hatte sich entschlossen, dort zu leben«, sagte Thomas O’Neill kurz und bündig. »Sie lebte länger dort als irgendwo sonst.«
»Was für Arrangements soll ich treffen?« fragte Paige. Sie wußte, daß die O’Neills streng gläubig waren, und obwohl das auf Mara nicht zutraf, hätte sie jeder Bitte entsprochen, die sie äußerten – besonders, wenn sie Zuneigung verraten hätte.
Doch es erfolgte keine Bitte, nur ein kurzes: »Das überlassen wir Ihnen – Sie kannten sie besser als wir.« Was Paige noch trauriger machte.
»Werden Sie kommen?« fragte sie und hielt den Atem an.
Es entstand eine Pause, die sie als unendlich verletzend für Mara empfand – und dann kam schließlich langsam ein widerstrebendes: »Wir werden kommen.«
Angie schaute sie fassungslos an. »Was?«
Paige wiederholte es und durchlebte noch einmal ihre eigene Fassungslosigkeit. Mara O’Neill war so voller Leben und Energie gewesen – der Tod paßte einfach nicht in dieses Bild.
Angies Augen baten sie, ihre Worte zurückzunehmen, und Paige wünschte inständig, sie könnte es. Aber angesichts dessen, was sie im Leichenschauhaus gesehen hatte, wäre eine Verleugnung absurd gewesen.
»Mein Gott«, murmelte Angie nach einer quälend langen Minute voller Hilflosigkeit. »Tot?«
Paige atmete zittrig ein. Sie war diejenige, die Angie mit Mara bekanntgemacht hatte, und die beiden hatten sich so gut angefreundet, daß kaum ein Wochenende verging, ohne daß Mara bei Angie vorbeischaute – wenn nicht zum Sonntagsbrunch, dann am Nachmittag, um mit Ben über Politik zu diskutieren oder Dougie ein Eis hineinzuschmuggeln.
Dougie. Paige ging das Herz auf, wenn sie an ihn dachte. Angie hatte ihn bisher gegen die dunkle Seite des Lebens abgeschirmt – aber in diesem Fall könnte sie das nicht. Der Tod war etwas Absolutes – da gab es keine Halbheiten oder Beschönigungen.
Als habe Angie Paiges Gedanken gelesen, sagte sie: »Dougie wird völlig vernichtet sein. Er vergötterte Mara. Letzten Sonntag waren sie noch beim Bergwandern.« Sie sah ungewöhnlich verstört aus – aber nur für eine Minute, denn so lange brauchte sie, um ihre Gedanken zu ordnen. Dann befragte sie Paige nach dem Wie und Wo von Maras Tod. Paige berichtete ihr, was sie wußte, was Angie viel zu wenig war.
»Was ist mit dem Warum?« wollte sie wissen. »Selbstmord ist das erste, was einem einfällt, wenn jemand bei laufendem Motor tot in einer geschlossenen Garage gefunden wird – aber Selbstmord paßte nicht zu Mara. Ebensowenig wie der Tod an sich. Mara sah müde aus. Sie könnte eingeschlafen sein, ohne zu bemerken, daß der Motor noch lief – aber Selbstmord? Ohne einen Hilferuf? Ohne eine von uns wissen zu lassen, daß sie sich auch nur in der Nähe eines Zusammenbruchs befand?«
Diese Abwegigkeit frustrierte auch Paige. Sie hielt sich für eine aufmerksame Beobachterin, aber es war ihr nicht das Geringste aufgefallen, das darauf hingedeutet hätte, daß Mara am Abgrund stand.
»Was ist mit ihren Patienten?« fuhr Angie aufgeregt fort. »Sie müssen informiert werden. Die meisten werden es gerüchteweise hören und bei uns anrufen, um zu erfahren, was los ist. Sollen wir Ginny das an der Anmeldung erledigen lassen?«
Ginny war eine fähige Empfangssekretärin, aber die Handhabung des Terminkalenders war himmelweit von der Aufgabe, Menschen zu trösten und zu beruhigen, entfernt.
Glücklicherweise brauchte Paige nicht darauf hinzuweisen – Angie schüttelte bereits den Kopf.
»Wir werden selbst mit ihnen reden müssen. Mara war ihr Idol. Sie werden Hilfe brauchen, um mit ihrem Tod zurechtzukommen ... Ihrem Tod. Mein Gott, ist das schrecklich!«
Sie lehnte sich an Angies Schreibtisch und teilte ihren Schmerz mit jemandem, der tüchtig genug war, um ihr bei ihren Entscheidungen helfen zu können, und da gestattete Paige sich endlich, zum ersten Mal, seit Norman sie an diesem Morgen in ihrem Büro aufgesucht hatte, Schwäche zu zeigen. Sie griff sich an die Kehle. Die Realität von Maras Tod erstickte sie fast.
Angie umarmte sie und drückte sie an sich. »Es tut mir so leid, Paige«, sagte sie leise. »Du standest ihr näher als ich.« Sie rückte von ihr ab. »Hast du es Peter schon gesagt?«
Paige schüttelte den Kopf. »Er ist der nächste auf meiner Liste.« Das Sprechen bereitete ihr unsägliche Mühe. »Er wird ebenso fassungslos sein wie wir – er hielt Mara für unverwüstlich.« Sie stieß einen Selbstverachtung ausdrückenden Laut aus. »Wie ich. Nicht im Traum hätte ich mir vorstellen können, daß sie ... daß sie sich ...« Sie konnte sich nicht dazu überwinden, es auszusprechen.
Wieder drückte Angie sie an sich. »Vielleicht hat sie es ja gar nicht getan.«
»Wie sollte es sonst passiert sein? Es gab keine Anzeichen von Gewaltanwendung.«
»Ich weiß es nicht – wir müssen abwarten.«
»Abwarten« bedeutete Zukunft und versetzte Paige einen schmerzhaften Stich. »Die Praxis wird ohne Mara nicht mehr dieselbe sein. Wir waren ein unglaubliches Quartett – vier unterschiedliche Charaktere, aber als Team Spitze. Die Gruppe funktionierte.«
Paige war der gemeinsame Nenner. Sie kannte Mara vom College und Angie von ihrer einjährigen Facharztausbildung in Chicago. Angie hatte eine Berufspause eingelegt, um in Ruhe ihren Sohn Dougie aufziehen zu können, wohnte in New York und war bereit, ins Berufsleben zurückzukehren, als Paige sich mit Peter zusammentat, einem Einwohner von Tucker mit der Art streßfreier Kleinstadtpraxis, wie sie die anderen reizte. Angesichts der Tatsache, daß das kleine Gemeindekrankenhaus gleich nebenan lag und keiner der vier Ärzte auf das große Geld aus war, legten sie ihre Zeit, ihre Bemühungen und ihr Können in einer Weise zusammen, die sie befähigte, hochqualifizierte medizinische Versorgung zu bieten und sich trotzdem in einem vernünftigen Arbeitsstundenplan zu bewegen. Angies Bedächtigkeit war ein starker Kontrast zu Maras dynamischer Natur, Paiges Geschäftssinn stand im krassen Gegensatz zu Peters Unbedarftheit. Sie ergänzten einander und waren Freunde.
»Mara war eine gute Ärztin«, zollte Angie ihr Tribut. »Sie liebte Kinder, und sie liebten sie, weil sie wußten, daß sie sich für sie stark machte. Es wird schwer werden, jemanden zu finden, der in ihre Fußstapfen treten kann.«
Paige konnte nur zustimmend nicken – das Verlustgefühl, das sie empfand, raubte ihr die Sprache.
»Kümmerst du dich um die Beerdigung?« fragte Angie.
Wieder nickte sie. Dann räusperte sie sich. »Keine schöne Aufgabe.«
»Kann ich dir helfen?«
Sie schüttelte den Kopf. »Nein – das muß ich allein machen.« Das war sie Mara schuldig.
»An dem Tag lassen wir die Praxis geschlossen«, sagte Angie.
»Wenn deine Planung steht, kann Ginny den Patienten neue Termine geben. Bis dahin übernehme ich so viele von Maras Patienten wie möglich. Den Rest kann Peter versorgen. Soll ich ihn anrufen?«
»Nein, nein – das tue ich schon.« Schließlich war Paige die Nabe des Rades. Schwer zu glauben, daß unwiederbringlich eine Speiche herausgebrochen worden war.
Peter wurde aus dem Tiefschlaf gerissen, und er klang nicht sonderlich begeistert. »Ich hoffe, du hast einen guten Grund für deinen Anruf – mein Dienst beginnt erst um eins.«
»Gut ist er nicht«, sagte sie, seelisch zu mitgenommen, um den Schlag zu dämpfen. »Mara ist tot.«
»Das war ich auch, verdammt noch mal – ich bin erst um zwei ins Bett gekommen.«
»Tot. Ich komme gerade aus dem Leichenschauhaus.«
Eine Pause entstand. Dann kam ein vorsichtiges: »Wovon redest du?«
»Man hat sie in ihrem Auto in ihrer Garage gefunden«, erklärte Paige. Mit jeder Wiederholung wurde die Geschichte absurder. »Wie es aussieht, starb sie an einer Kohlenmonoxydvergiftung.« Wieder eine Pause, diesmal eine längere, und dann ein verwirrtes: »Sie hat sich umgebracht?«
Paige hörte Murmeln im Hintergrund und wartete, bis Peter es gereizt unterbunden hatte, ehe sie sagte: »Sie wissen nicht, was passiert ist. Vielleicht bringt die Autopsie eine Aufklärung. Wie auch immer – ich brauche dich hier. Ich muß Vorbereitungen für die Beerdigung treffen, und Angie ist bereits ...«
»War ein Abschiedsbrief da?« fragte er scharf.
»Nein – kein Abschiedsbrief. Angie ist bereits bei Maras Patienten eingesprungen, aber alle kann sie nicht bewältigen. Und die nicht akuten Leute müssen wir benachrichtigen ...«
»Kein Abschiedsbrief?«
»Norman hat keinen erwähnt, und ich bin sicher, daß sie nachgesehen haben.«
»Die Polizei ist im Spiel?« Peters Stimme war eine Oktave höher geworden.
Jetzt war Paige verwirrt. »Sie haben sie gefunden. Ist das schlecht?«
»Nein«, erwiderte er, wieder ruhiger. »Eigentlich nicht. Es gibt der Sache nur etwas Geheimnisvolles.«
»Der unpassende Zeitpunkt macht sie geheimnisvoll. Und wenn sie für uns schon ein Schock ist, denk nur mal daran, wie ihre Patienten sich fühlen werden. Mara war eine so engagierte Ärztin.«
»Zu engagiert«, sagte er. »Das habe ich ihr schon seit Jahren gepredigt.«
Das wußte Paige nur zu gut: Peter und Mara hatten mehr als eine Teamkonferenz mit ihren Sticheleien gewürzt. Jetzt war Mara nicht mehr da, um ihren Standpunkt zu verteidigen, und so tat Paige es für sie. »Maras Engagement war gut gemeint. Sie empfand ihren Patienten gegenüber eine starke moralische Verpflichtung, und sie liebten sie.«
»Die Lösung des Rätsels muß Tanya John sein. Sie war sehr deprimiert deswegen.«
»Im klinischen Sinn deprimiert? Genug, um sich etwas anzutun?« Das konnte Paige sich nicht vorstellen. »Außerdem hatte sie es endlich durchgesetzt, das indische Baby zu bekommen. Sie freute sich so darauf.« Paige würde die Adoptionsagentur benachrichtigen müssen – aber sie nahm an, daß das bis nach der Beerdigung Zeit hätte.
»Vielleicht hat die Adoption nicht geklappt.«
»Das hätte sie mir erzählt, und sie hat kein Wort davon gesagt. Ich habe ja gestern früh noch mit ihr gesprochen. Wann hast du sie denn zuletzt gesehen?« fragte sie Peter.
»Gestern nachmittag, so gegen halb fünf. Das Wartezimmer war schon ziemlich leer, und sie fragte mich, ob ich den Rest übernehmen könne, weil sie früh weg wolle.«
»Hat sie gesagt, wohin?«
»Nein.«
»Machte sie einen beunruhigten Eindruck?«
»Einen zerstreuten. Einen sehr zerstreuten, wenn ich darüber nachdenke. Aber das war nicht unangenehm – für gewöhnlich war sie ja so energisch.«
Die hilflose Art, in der er das sagte, entlockte Paige ein Lächeln. Aber er hatte recht. Mara führte immer irgendeinen Krieg. Sie war ein Advokat für diejenigen, die nicht für sich selbst sprechen konnten. Und jetzt war der Advokat plötzlich verstummt.
Paige senkte den Kopf. »Ich muß telefonieren, Peter. Wie schnell kannst du hier sein?«
»Gib mir eine Stunde.«
Sie strich sich eine Handvoll Haare aus dem Gesicht und schaute auf. »Eine Stunde ist zu lang. Angie braucht Hilfe, und du bist nur fünf Minuten weit weg. Hör mal, es tut mir leid, daß ich dich gestört habe« – die murmelnde Stimme im Hintergrund war eine weibliche gewesen, zweifellos die von Lacey, Peters neuer Liebe –, »aber ich brauche dich. Die Gruppe funktioniert, weil uns allen etwas an der Praxis liegt, und jetzt sind wir noch mehr gefordert als sonst. Die Patienten verlassen sich auf uns. Wir sind es ihnen schuldig, das Trauma, das Maras Tod für sie bedeuten wird, nach Möglichkeit zu entschärfen.«
»Ich komme, so schnell ich kann«, erklärte er knapp und legte auf, bevor Paige ihn noch weiter bedrängen konnte.
Kapitel 2
Paige setzte die Beerdigung für Freitag an, zwei Tage, nachdem Maras Leiche gefunden worden war, was den O’Neills genügend Zeit geben würde, um aus Eugene anzureisen, und ihr – wie sie meinte –, um sich mit Maras Tod abzufinden. Doch in diesem Punkt irrte sie sich. Sie hatte nicht nur Schuldgefühle, weil sie das Begräbnis arrangierte, als könne sie Mara nicht schnell genug unter die Erde bringen – sie weigerte sich auch zu akzeptieren, daß die Frau, die sie als Kämpferin gekannt hatte, sich das Leben genommen haben sollte.
Der Gedanke verfolgte sie, daß Maras Tod das Resultat einer Unbesonnenheit, eines impulsiven Entschlusses war. Tanya Johns Weglaufen war nur die letzte einer Reihe von Enttäuschungen gewesen, die Mara ständig widerfuhren, und vielleicht hatte die Summierung in einem Moment der Schwäche bewirkt, daß sie zusammenbrach.
Wenn das zutraf, mußte Mara mehr gelitten haben, als Paige auch nur geahnt hatte. Sie dachte immer wieder, daß die Tragödie eventuell hätte verhindert werden können, wenn sie nur aufmerksamer, verständnisvoller oder einfühlsamer gewesen wäre.
Ihre Zweifel spiegelten sich in den Äußerungen aller Erwachsenen, die an diesem Tag in der Praxis erschienen. Sie wollten wissen, ob irgend jemand Maras Tod habe kommen sehen, und obwohl Paige wußte, daß die Fragen auf Ängsten bezüglich der seelischen Verfassung ihrer Kinder, Ehepartner oder Freunde beruhten, quälten sie Gewissensnöte.
Der Bericht des Gerichtsmediziners setzte noch eins drauf. »Sie war vollgepumpt mit Valium«, gab Paige die Information fassungslos weiter.
»Valium?« wiederholte Angie entgeistert.
»Sie hat eine Überdosis genommen?« fragte Peter.
Paige hatte dasselbe Wort im Kopf, aber es war nicht das, was der Gerichtsmediziner benutzt hatte. »Er sagt, daß das Kohlenmonoxyd sie umgebracht hat, aber daß sie genügend Valium im Körper hatte, um nicht mehr klar bei Verstand gewesen zu sein.«
»Was bedeutet«, folgerte Angie in der für sie typischen, präzisen Art, mit der sie stets zum Kern der Dinge kam, »daß wir nie mit Bestimmtheit wissen werden, ob sie zufällig am Steuer einschlief oder absichtlich dort sitzen blieb, bis sie das Bewußtsein verlor.«
Paige war völlig verwirrt. »Ich wußte nicht einmal, daß sie das Zeug nahm – und ich dachte, ich sei ihre engste Freundin.«
»Keiner von uns wußte, daß sie es nahm«, versuchte Angie sie aufzurichten. »Sie hatte eine heftige Abneigung gegen Medikamente. Von uns schrieb sie am wenigsten Rezepte aus. Ich kann gar nicht zählen, wie viele Diskussionen wir über dieses Thema geführt haben – hier in diesem Zimmer.«
Von der zehn Jahre zurückliegenden Eröffnung ihrer Gemeinschaftspraxis an war Paiges Büro der Schauplatz der allwöchentlichen Zusammenkünfte gewesen, bei denen sie über neue oder Problempatienten sprachen, über Entwicklungen auf dem Gebiet der Medizin oder über Praxispolitik. Ihr Zimmer unterschied sich mit dem hellen Eichenmobiliar, dem in Malve und Moos gehaltenen Dekor und den Aquarellen an den Wänden in nichts von den anderen drei Büros, aber Paige hatte das Team zusammengebracht und war gewissermaßen die »Säule des Geschäfts«, um die die anderen sich naturgemäß versammelten.
Im Augenblick fühlte sie sich jedoch ganz und gar nicht als »Säule«. Valium. Sie konnte es immer noch nicht glauben. »Menschen nehmen Valium, wenn sie extrem nervös oder beunruhigt sind. Ich hatte keine Ahnung, daß das eine oder andere – oder beides – auf Mara zutraf. Sie war ein leidenschaftlicher Mensch – aber leidenschaftlich hat nichts mit nervös oder beunruhigt zu tun. Als ich sie zuletzt sah, wollte sie gerade zum Labor fahren, um dort wegen der verhunzten Tests des Fiske-Jungen Rabatz zu machen.« Sie versuchte, sich an die Einzelheiten jener Begegnung zu erinnern, doch es war ihr nichts Ungewöhnliches aufgefallen. »Ich hätte sie aufhalten können. Ich hätte mit ihr sprechen können, sie vielleicht etwas beruhigen können – aber ich versuchte es gar nicht. Ich sah, wie müde sie war ...« Sie hob den Blick und schaute die anderen an. »Das kann das Valium gewesen sein. Ich kam nicht auf die Idee, daß es an etwas anderem liegen könnte, als an zuviel Arbeit und zuwenig Schlaf. In dem Augenblick wollte ich nichts sagen, was sie vielleicht noch mehr in Rage gebracht hätte. Feige, was?«
»Das war früh am Morgen«, gab Angie tröstend zu bedenken.
»Es kann ihr später ja bessergegangen sein.«
»Und dann innerhalb von Stunden so schlecht, daß sie eine Kurzschlußhandlung beging?« Paige schüttelte den Kopf. »Wenn sie Pillen schluckte, muß schon längere Zeit etwas im argen gelegen sein. Warum habe ich es nicht bemerkt? Wo war ich mit meinen Gedanken?«
»Bei deinen Patienten – wo sie hingehören«, antwortete Peter.
»Aber sie brauchte Hilfe.«
»Mara brauchte immer irgendwelche Hilfe«, entgegnete er. »Sie engagierte sich doch ständig in dieser oder jener Weise. Du warst nicht ihre Hüterin.«
»Ich war mit ihr befreundet – wie du.« Paige rief sich die dutzende Male ins Gedächtnis, die er und Mara zusammengewesen waren. Nicht nur waren beide begeisterte Skifahrer, sie waren auch beide begeisterte Fotografen. »Stellst du dir nicht die gleichen Fragen?« Falls er das tat, wirkte er bemerkenswert ruhig. »Du sagst, du hast sie gegen Abend gesehen und sie habe zerstreut gewirkt. War sie da auch müde?«
»Sie sah katastrophal aus – und das habe ich ihr auch gesagt.«
»Peter!«
»Die Beziehung, die wir hatten, erlaubte das. Und sie sah wirklich katastrophal aus – als hätte sie sich nicht die Mühe gemacht, sich zu schminken oder zu frisieren. Aber sie scherte sich nicht um meine Kritik. Ich sag’s euch doch – sie war mit ihren Gedanken woanders. Wo, weiß ich nicht.«
»Hast du sie denn nicht gefragt?« erkundigte sich Angie.
»Ich wollte nicht aufdringlich sein«, ging er in die Defensive. »Außerdem war sie in Eile. Wann hast du sie denn zuletzt gesehen?«
»Mittags.« Sie wandte sich Paige zu. »Ich hielt sie auf dem Flur auf, um sie nach dem Barnes-Fall zu fragen. Sie hatte mit der Versicherung wegen der Kostenübernahme für eine Magnetresonanz-Tomographie gekämpft, und sie haben ihr das Leben ganz schön schwergemacht. Wie sie wirkte? Müde, ja – aber nicht zerstreut. Sie wußte genau, worüber ich sprach, und gab mir eine völlig klare Antwort – allerdings nicht mit der üblichen Heftigkeit. Es war, als gehe ihr der Treibstoff aus.«
»Welch überaus passendes Gleichnis«, meinte Peter sarkastisch. Paige sah Maras Garage vor sich, unterdrückte die Übelkeit, die das Bild in ihr auslöste, und zwang ihre Gedanken in eine andere Richtung. Sie hatte das dringende Bedürfnis, Maras letzten Tag zu rekonstruieren – vielleicht ergab sich ja ein schlüssiger Hinweis. »Okay. Jeder von uns hat sie zu einer anderen Zeit gesehen. Als ich sie morgens sah, war sie auf Hundertachtzig; als Angie sie mittags sah, wirkte sie müde, als Peter sie nachmittags sah, zerstreut.« Nach einer kleinen Pause fragte sie: »Machte sie auf einen von euch beiden einen deprimierten Eindruck?«
»Nicht auf mich«, antwortete Peter.
»Nein«, schüttelte Angie nach kurzem Nachdenken den Kopf.
»Nicht deprimiert – nur erschöpft.« Sie schaute Paige traurig an.
»Als sie sich umdrehte und in ihr Büro ging, ließ ich sie gehen. Es warteten eine Menge Patienten – wir waren bis zum Abend ausgebucht.«
Sie ging die Sache vernunftmäßig an. Das taten sie alle, dachte Paige. Sie suchten Entschuldigungen für ihren Mangel an Scharfblick. Wenn Maras Tod ein Unfall gewesen war, hätten sie sich nichts vorzuwerfen. Wenn nicht, lag die Sache anders.
Das Tückische war, daß sie es nie erfahren würden.
Während Peter und Angie sich an die Arbeit in der Praxis machten, beschäftigte Paige sich mit den Details der Beerdigung. In dem verzweifelten Bemühen, jede Entscheidung nach Möglichkeit in Maras Sinn zu treffen, wurde sie von einem Motiv getrieben, das über Liebe und Achtung hinausging: Sie verstand ihre besondere Sorgfalt als Entschuldigung dafür, keine bessere Freundin gewesen zu sein.
Sie besprach mit dem Priester, was er sagen sollte, verpflichtete einen ortsansässigen Laienchor, wählte einen schlichten Sarg aus, schrieb einen beredten Nachruf.
Und sie suchte die Kleidungsstücke aus, in denen Mara begraben werden sollte. Was diese Aufgabe so schmerzlich machte, war die Tatsache, daß sie dazu Maras Sachen durchsehen mußte. Maras Haus war durch und durch Mara, und Paige spürte ihre Gegenwart so deutlich, daß sie einfach nicht glauben konnte, daß ihre Freundin nicht mehr da war. Paige ertappte sich dabei, daß sie nach Hinweisen suchte – einem Abschiedsbrief auf dem Kaminsims, einem Hilferuf, per Magnet an der überfüllten Pinwand befestigt, einem Flehen um Rettung, mit Lippenstift auf den Badezimmerspiegel geschmiert –, aber alles, was man mit viel gutem Willen als Alarmzeichen interpretieren konnte, waren das Valium im Medizinschränkchen und der chaotische Zustand des Hauses. Er war wirklich chaotisch. Hätte Paige zu wilden Spekulationen geneigt, hätte sie vermutet, daß jemand das Haus nach etwas durchsucht hatte. Aber Hausarbeit war keine von Maras Stärken gewesen. Und so machte Paige auf ihrem Weg durch die Räume ein wenig Ordnung – für den von ihr erhofften Fall, daß Maras Familie den Wunsch äußern würde, zu sehen, wie sie gelebt hatte.
Die O’Neills kamen am Donnerstag an. Paige war ihnen nur einmal zuvor begegnet: Bei ihnen zu Hause, am Ende einer Reise, die sie und Mara so nah an Eugene vorbeiführte, daß Mara keinen einleuchtenden Grund finden konnte, nicht vorbeizuschauen. Nicht, daß sie es nicht versucht hätte. Ihre Familie sei unangenehm, sagte sie. Ihre Familie sei spießig, sagte sie. Ihre Familie sei engstirnig und hasse Fremde, sagte sie.
Paige fand sie nicht halb so schlimm, aber sie hatte allerdings auch eine andere Perspektive. Als Einzelkind gefiel ihr die Idee, sechs Brüder nebst Ehefrauen und einen Schwung Nichten und Neffen zu haben, und verglichen mit ihren eigenen Eltern, die es nie lange an einem Ort aushielten, war die geradezu fanatische Verwurzelung der O’Neills in ihren Augen recht angenehm. Paige kam zu dem Schluß, daß sie einfach altmodische, hart arbeitende, strenggläubige Menschen waren, die aufgrund ihrer Lebenseinstellung nicht begreifen konnten, was Mara tat.
Das war so, als Mara sich als Kind mit einer unstillbaren Neugier, einem Herzen für die Schwachen und Kranken und einer Begeisterung für Sozialfälle erwies. Das war so, als sie sich entschied, aufs College zu gehen und, mit der Weigerung ihrer Eltern konfrontiert, es zu finanzieren, jeden Cent selbst aufbrachte. Und so war es auch mit ihrem Medizinstudium.
Es war noch immer so. Die O’Neills hatten nie verstanden, weshalb Mara sich in Vermont niedergelassen hatte – und jetzt, als sie auf der Fahrt vom Flughafen in der Sicherheit von Paiges Wagen die Umgebung betrachteten, hätte man denken können, sie befänden sich in einem fremden Land, in einem feindlichen.
Es waren nur fünf Familienmitglieder gekommen: Maras Eltern und drei der Brüder. Paige redete sich ein, daß die anderen sich die Reise nicht hatten leisten können. Sie hoffte, Mara werde es glauben.
Sie hielten in dem gleichen Schweigen vor dem Beerdigungsinstitut, in dem sie den größten Teil der Fahrt zugebracht hatten. Nachdem sie sie hineinbegleitet hatte, ließ Paige sie allein, damit sie ungestört Abschied nehmen könnten. Wieder draußen auf der Vordertreppe versuchte sie sich zu erinnern, wann Mara ihre Familie das letzte Mal erwähnt hatte. Es gelang ihr nicht. Es war schrecklich traurig. Sicher – Paige besuchte ihre eigenen Eltern nicht oft, aber sie besuchte regelmäßig ihre Großmutter, die nur vierzig Meilen entfernt in West Winter wohnte. Nonny war lustig und unabhängig. Sie hatte in Paiges Jugend sowohl die Vater- als auch die Mutterrolle gespielt und genügte Paige als Familie vollauf. Paige vergötterte sie.
»Sie sieht hübsch aus«, sagte plötzlich Maras Vater neben ihr mit gepreßter Stimme. Hochgewachsen und kräftig gebaut, stand er mit den Händen in den Taschen seiner abgetragenen Anzughose da und starrte mit stahlharten Augen auf die Straße. »Wer immer sie hergerichtet hat, hat gute Arbeit geleistet.«
»Sie hat immer hübsch ausgesehen«, verteidigte Paige Mara.
»Manchmal blaß, manchmal verärgert – aber immer hübsch.« Unfähig, es dabei zu belassen, setzte sie eindringlich hinzu:
»Sie war glücklich, Mr. O’Neill. Sie hatte ein erfülltes Leben hier.«
»Hat sie sich deshalb umgebracht?«
»Wir wissen nicht, ob sie das getan hat. Es kann ebensogut ein Unfall gewesen sein.«
Er schnaubte. »Das Ergebnis ist das gleiche.« Er starrte stur geradeaus. »Nicht, daß es eine Rolle spielt – wir haben sie schon vor langer Zeit verloren. Wenn sie auf uns gehört hätte, wäre es nicht passiert. Sie wäre noch am Leben, wenn sie zu Hause geblieben wäre.«
»Aber dann wäre sie keine Ärztin geworden«, entgegnete Paige, die diese Erklärung nicht unwidersprochen lassen konnte, obwohl sie seinen Kummer durchaus spürte. »Sie war eine wundervolle Kinderärztin. Sie liebte Kinder, und sie liebten sie. Sie engagierte sich für sie. Sie engagierte sich für die Eltern. Sie werden morgen alle hiersein – Sie werden es sehen –«
Zum ersten Mal schaute er sie an. »Haben Sie ihr eingeredet, Medizin zu studieren?«
»O nein – das wollte sie schon, bevor wir uns kennenlernten.«
»Aber Sie haben sie hierhergeholt.«
»Sie ist aus freien Stücken hergekommen – ich hatte ihr nur die Möglichkeit eröffnet.«
Wieder ein Schnauben. Wieder starrte er auf die Straße. Nach einer Weile sagte er: »Sie sehen aus wie sie, wissen Sie das? Vielleicht hat sie Sie deshalb gemocht. Die gleichen dunklen Haare, die gleiche Größe – Sie könnten Schwestern sein. Sind Sie verheiratet?«
»Nein.«
»Waren Sie es?«
»Nein.«
»Haben Sie je ein Kind bekommen?«
»Nein.«
»Dann versäumen Sie ebensoviel im Leben, wie sie es getan hat. Sie versuchte es mit diesem Daniel, aber er konnte es nicht aushalten, daß seine Frau unentwegt weg war, ich wüßte nicht, welcher Mann das könnte, und als sie nicht schwanger wurde – wozu ist eine solche Frau gut?«
Paige begann zu ahnen, was Mara aus Eugene weggetrieben hatte. »Mara konnte nichts für Daniels Probleme. Er nahm Drogen, bereits lange bevor sie ihn kennenlernte. Sie dachte, sie könne ihm helfen, aber es hat einfach nicht funktioniert. Mit dem Schwangerwerden war es genauso. Vielleicht, wenn sie mehr Zeit gehabt hätten ...«
»Die Zeit hatte damit nichts zu tun – es lag an der Abtreibung.«
»Abtreibung?« Paige wußte nichts von einer Abtreibung.
»Sie hat es Ihnen nicht erzählt? Kann ich verstehen. Nicht jedes Mädchen, das mit sechzehn schwanger wird, läuft davon und läßt das Kind wegmachen, ohne daß die Eltern was mitzureden haben. Sie hat einen Mord begangen. Ihre Strafe dafür war, daß sie nicht mehr schwanger wurde.« Er gab ein blubberndes Geräusch von sich. »Das traurige daran ist, daß Kinder ihre Rettung gewesen wären. Wenn sie zu Hause geblieben wäre und geheiratet und Kinder bekommen hätte, wäre sie heute noch am Leben, und wir hätten nicht die Hälfte unserer Ersparnisse ausgeben müssen, um zu ihrer Beerdigung zu fliegen.«
In diesem Moment wünschte Paige, sie wären nicht gekommen. Sie wünschte, sie hätte nie ein Wort mit Thomas O’Neill gesprochen. Am meisten wünschte sie, sie hätte nie von der Abtreibung erfahren. Sie verurteilte Mara deswegen nicht – sie konnte sich vorstellen, wieviel Angst eine Sechzehnjährige in einer so intoleranten Familie wie der ihren gehabt haben mußte –, aber sie wünschte, Mara hätte ihr selbst davon erzählt.
Paige hatte geglaubt, ihre beste Freundin zu sein, doch in all den Gesprächen über ihre Ehe und ihre Kinderlosigkeit, über die Kinder, die sie im Laufe der Jahre in Pflege genommen hatte, und das Kind, das sie adoptiert hätte, wenn sie am Leben geblieben wäre, hatte sie die Abtreibung mit keinem Wort erwähnt – und auch nicht im Zuge einer der vielen, vielen Diskussionen, die sie bezüglich ihrer weiblichen Patienten im Teenageralter über dieses Thema geführt hatten.
Die Erkenntnis, daß es ein so wichtiges Ereignis – und vielleicht war es nicht das einzige!? – im Leben eines Menschen gab, den sie als enge Freundin betrachtet hatte, von dem sie nichts gewußt hatte, brach ihr das Herz.
Der Freitagmorgen dämmerte warm und grau herauf, die Luft war schwer, als sei sie mit Maras Geheimnissen geschwängert. Paige schöpfte einen gewissen Trost daraus, daß die Kirche übervoll war. Wenn es je einen Beweis dafür gegeben hatte, auf wie viele Menschenleben sie in dieser oder jener Form Einfluß genommen hatte und welche Wertschätzung sie genoß – hier war er. Besonders angesichts der Gegenwart der Familie, die ihre Leistungen niemals anerkannt hatte, empfand Paige für Mara ein Siegesgefühl.
Doch der kleine Triumph hielt nicht an, wurde ebenso tief in Gram begraben wie Mara in dem dunklen Loch am Hang des Hügels über der Stadt, und ehe Paige es merkte, hatte sie den Friedhof verlassen, den Leichenschmaus im »Tucker Inn« hinter sich gebracht und die O’Neills aus Eugene, Oregon, am Flughafen abgeliefert.
Danach kehrte Paige in Maras Haus zurück, ein viktorianisches Gebäude mit hohen Decken, einer geschwungenen Treppe und einer umlaufenden Veranda. Sie wanderte von Zimmer zu Zimmer, dachte daran, daß Mara es geliebt hatte, Feuer in dem schmalen Kamin anzuzünden, einen Christbaum in das Fenster des Salons zu stellen, an einem warmen Sommerabend auf der hinteren Veranda Zitronenlimonade zu trinken. Die O’Neills hatten Paige angewiesen, das Haus zu verkaufen und den Erlös wohltätigen Zwecken zuzuführen, und sie würde diesem Wunsch nachkommen – aber nicht sofort. Sie konnte Maras Leben nicht an einem Tag zusammenpacken und wegschaffen. Sie brauchte Zeit, um sich an Maras Abwesenheit zu gewöhnen. Sie brauchte Zeit, um Abschied zu nehmen.
Außerdem brauchte sie Zeit, um einen Käufer zu finden, der das Haus ebenso lieben würde, wie Mara es getan hatte – das war sie ihr schuldig.
Sie verließ die Küche durch eine bogenförmige Fliegentür, die hinter ihr zuklappte, ließ sich auf die Schaukel auf der hinteren Veranda sinken und beobachtete die Vögel, die von Baum zu Baum flogen, von Futterspender zu Futterspender.
Fünf Futterspender konnte sie sehen, aber sie vermutete, daß weitere zwischen den Ästen verborgen waren. Mara hatte nichts mehr genossen, als auf eben dieser Schaukel zu sitzen, das Kind, das sie gerade in Pflege hatte, auf dem Schoß zu halten und ihm zu jedem Vogel, der vorbeiflog, eine kleine Geschichte zu erzählen.
Ich werde sie für dich füttern, versprach Paige. Ich werde dafür sorgen, daß, wer immer das Haus kauft, sie füttert. Sie werden nicht im Stich gelassen. Das ist das mindeste, was ich für dich tun kann.
Mara hätte Paiges Kätzchen genommen, ohne jeden Zweifel. Sie hatte alles Wilde gemocht, alles Schwache, alles Kleine. Und Paige? Paige hatte keine so abenteuerlustige Natur. Sie liebte die Hilflosen auch – aber in einem überschaubareren Ausmaß. Sie legte Wert auf Beständigkeit, Ordnung und Einschätzbarkeit. Veränderungen verunsicherten sie.
Paige stand auf und ging in den Garten. Die Vögel flogen davon. Sie blieb regungslos stehen, hielt den Atem an und wartete, aber sie kamen nicht zurück. Sie fühlte sich schrecklich allein.
Ich werde dich vermissen, Mara, dachte sie, und ging zum Haus zurück. Sie kam sich leer und alt vor, und plötzlich kam ihr das Haus auch so vor. Es brauchte einen neuen Anstrich.
Ich werde mich darum kümmern. Die Fliegentür brauchte eine neue Bespannung. Kein Problem. Ein Laden am Fenster des linken Schlafzimmers im oberen Stock mußte ersetzt werden. Keine Geschichte. Und beim rechten Schlafzimmer ... beim rechten Schlafzimmer ... O Gott ...
Es klingelte an der Haustür, weit entfernt, aber deutlich. Dankbar für die Ablenkung ging Paige ins Haus. Vielleicht hatte ein Freund ihren Wagen gesehen und angehalten, oder jemand aus der Stadt hatte es nicht zur Beerdigung geschafft und wollte wenigstens jetzt sein Beileid aussprechen.
Die geriffelte Glasscheibe in der Haustür ließ eine massige, aber nicht große Gestalt erkennen. Sie öffnete die Tür und erkannte, daß es sich nicht um eine einzelne Gestalt handelte, sondern um eine Frau mit einem Kind auf dem Arm. Und es waren auch keine Einheimischen – sie hatte sie noch nie gesehen.
»Kann ich etwas für Sie tun?« fragte sie.
»Ich bin auf der Suche nach Mara O’Neill«, sagte die Frau beunruhigt. »Ich habe versucht, sie zu erreichen. Sind Sie eine Freundin von ihr?«
Paige nickte.
»Wir hatten uns für heute vormittag in Boston verabredet«, fuhr die Frau hastig fort, »aber wir haben uns offenbar verpaßt. Ich habe auf der Herfahrt immer wieder auf dem Highway angehalten und bei ihr angerufen, aber sie geht nicht ans Telefon.«
»Nein.« Paige musterte die Frau prüfend. Sie war mittleren Alters, weiß, ganz offensichtlich nicht die Mutter des Kindes, dessen Hautfarbe an Pekannüsse erinnerte und das die größten und seelenvollsten Augen besaß, die Paige je gesehen hatte. Sie nahm an, daß die beiden in irgendeinem Zusammenhang mit der Adoptionsorganisation standen, mit der Mara verhandelt hatte.
»Ist Mara da?« fragte die Frau.
Paige schluckte. »Nein.«
»Oje. Wissen Sie, wo sie ist oder wann sie wiederkommt? Es ist schrecklich. Wir hatten alles arrangiert. Sie war so aufgeregt.«
Das Kind schaute Paige an, die feststellte, daß sie den Blick nicht von ihm lösen konnte. Es war ein kleines Mädchen. Der Größe nach war sie noch kein Jahr alt, doch dem Ausdruck ihrer Augen nach war sie älter.
Paige hatte diesen Ausdruck schon gesehen – auf einem Foto, das Mara ihr gezeigt hatte. Ihr Herzschlag geriet ins Stolpern, die Hand, die die Wange des Kindes berührte, begann zu zittern. »Woher kennen sie Mara?« fragte sie die Frau.
»Ich arbeite bei der Adoptionsagentur. Es ist unter anderem meine Aufgabe, am Flugplatz zu sein, wenn Adoptivkinder aus anderen Ländern ankommen. Die Kleine hier kam aus einem winzigen Ort in der Nähe von Kalkutta. Sie hatte eine Begleitung von der Agentur in Bombay. Das arme Ding ist schon mehr als drei Tage unterwegs. Mara muß den Tag oder die Zeit mißverstanden haben. Ist die Praxis geschlossen? Ich habe nur den Auftragsdienst erreicht.«
»Sameera«, stieß Paige atemlos hervor. Maras Baby! »Aber ich dachte, sie käme erst in ein paar Wochen!« Sie streckte die Hände nach dem Kind aus.
»Wir raten unseren Eltern oft, keine Termine zu nennen – politische Unruhen können die Dinge verzögern.«
Paige dachte an das rechte Schlafzimmer im Oberstock mit seinen leuchtend gelben Wänden und den schiefsitzenden, marineblauen Sternen, die sie vom Garten aus hatte sehen können. Ihre Augen füllten sich mit Tränen, sie drückte das Kind an sich. »Sami.«
Das Kind gab keinen Laut von sich. Es war Paige, die leise weinte, in Trauer um die Mutter, die Mara gewesen wäre, und um das Glück, das sie kennengelernt hätte. Die Ankunft des Kindes machte Maras Tod noch rätselhafter. Mara hätte sich nicht das Leben genommen, wenn sie wußte, daß Sami drei Tage später kommen würde.
Sie nahm das Kind auf einen Arm und wischte sich mit dem anderen über die Augen. Es dauerte eine Minute, bis sie sich so weit gefaßt hatte, daß sie die Frau anschauen und sagen konnte:
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: