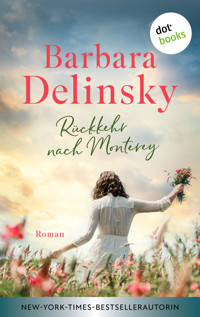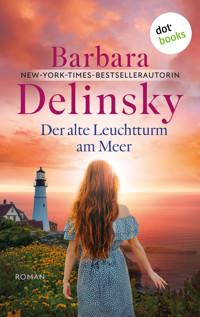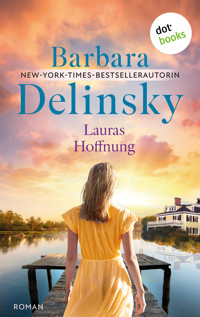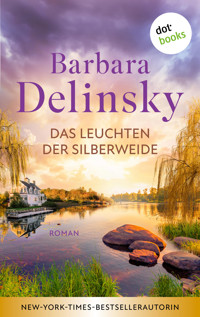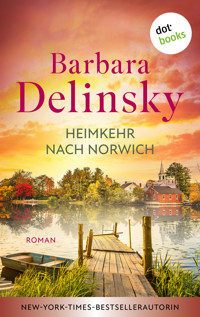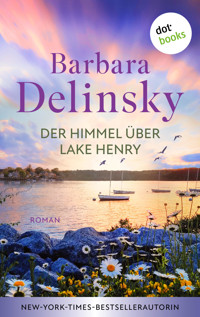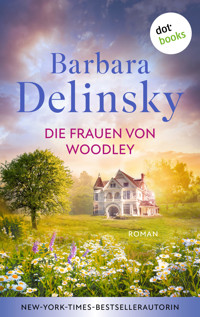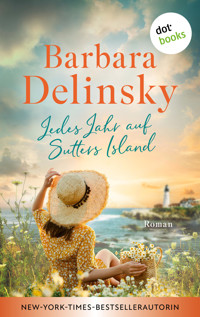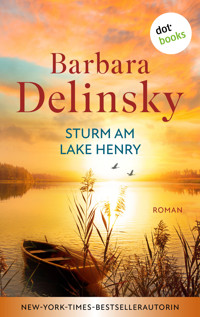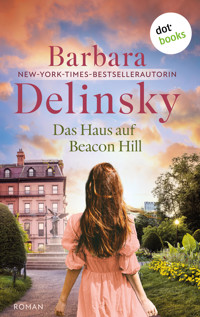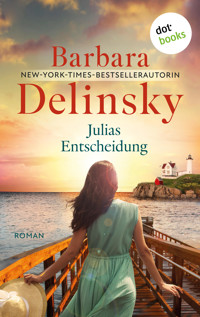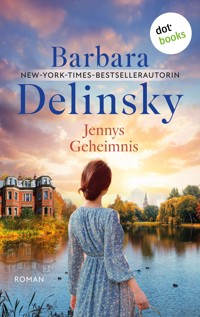5,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine zweite Chance … Der bewegende Roman »Drei Wünsche hast du frei« von Barbara Delinsky als eBook bei dotbooks. Eine winterglatte Straße, ein einziger Moment – danach ist nichts mehr wie zuvor … Als erfolgreichem Anwalt wird Tom gern nachgesagt, er sei hartherzig und kalt. Doch als er eines Abends auf der Heimfahrt eine Frau anfährt, zerbricht sein Leben in tausend Scherben. Wochenlang wacht er am Bett der Fremden, während sie im Koma liegt … bis sie wie durch ein Wunder wieder erwacht. In Bree ruht die Gewissheit, dass sie ein zweites Leben geschenkt bekommen hat – und ihr drei Wünsche gewährt wurden. Als Tom ihr bald darauf gesteht, sich in sie verliebt zu haben und die beiden tiefstes Glück erleben, ist Bree sicher, dass ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Vielleicht kann sie so auch endlich herausfinden, wer ihre unbekannte Mutter ist – während Tom das Band zu seinem fremd gewordenen Vater neu knüpft. Doch was wird geschehen, wenn Brees letzter Wunsch aufgebraucht ist? »Herzergreifend!«, sagt People Magazin – ein bewegender Roman über Familie, Vergebung und die unermessliche Macht der Liebe. Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der berührende Schicksalsroman »Drei Wünsche hast du frei« von New-York-Times-Bestsellerautorin Barbara Delinsky. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch:
Eine winterglatte Straße, ein einziger Moment – danach ist nichts mehr wie zuvor … Als erfolgreichem Anwalt wird Tom gern nachgesagt, er sei hartherzig und kalt. Doch als er eines Abends auf der Heimfahrt eine Frau anfährt, zerbricht sein Leben in tausend Scherben. Wochenlang wacht er am Bett der Fremden, während sie im Koma liegt … bis sie wie durch ein Wunder wieder erwacht. In Bree ruht die Gewissheit, dass sie ein zweites Leben geschenkt bekommen hat – und ihr drei Wünsche gewährt wurden. Als Tom ihr bald darauf gesteht, sich in sie verliebt zu haben und die beiden tiefstes Glück erleben, ist Bree sicher, dass ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Vielleicht kann sie so auch endlich herausfinden, wer ihre unbekannte Mutter ist – während Tom das Band zu seinem fremd gewordenen Vater neu knüpft. Doch was wird geschehen, wenn Brees letzter Wunsch aufgebraucht ist?
Über die Autorin:
Barbara Delinsky wurde 1945 in Boston geboren und studierte dort Psychologie und Soziologie. Nach der Geburt ihres ersten Sohnes arbeitete sie als Fotografin für den Belmont Herald, erkannte aber bald, dass sie viel lieber die Texte zu ihren Fotos schrieb. Ihr Debütroman wurde auf Anhieb zu einem großen Erfolg. Inzwischen hat Barbara Delinsky über 70 Romane veröffentlicht, die in mehr als 20 Sprachen übersetzt wurden und regelmäßig die New–York–Times–Bestsellerliste stürmen. Sie engagiert sich außerdem sehr stark für Wohltätigkeitsvereine und Aufklärung rund um das Thema Brustkrebs. Barbara Delinsky lebt mit ihrem Mann in New England und hat drei erwachsene Söhne.
Die Website der Autorin: barbaradelinsky.com/
Bei dotbooks veröffentlichte Barbara Delinsky auch ihre Romane:
»Die Schwestern von Star’s End«
»Jennys Geheimnis«
»Das Weingut am Meer«
»Julias Entscheidung«
»Lauras Hoffnung«
»Die alte Mühle am Fluss«
»Der alte Leuchtturm am Meer«
»Sturm am Lake Henry«, Die Blake–Schwestern 1
»Der Himmel über Lake Henry«, Die Blake–Schwestern 2
»Heimkehr nach Norwich«
»Das Leuchten der Silberweide«
»Das Licht auf den Wellen«
»Die Frauen Woodley«
»Ein Neuanfang in Casco Bay«
»Im Schatten meiner Schwester«
»Rückkehr nach Monterey«
»Ein ganzes Leben zwischen uns«
»Jedes Jahr auf Sutters Island«
»Was wir nie vergessen können«
***
eBook–Neuausgabe März 2024
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1997 unter dem Originaltitel »Three Wishes« bei Simon & Schuster, New York.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1997 by Barbara Delinsky
Published by Arrangement with Barbara Delinsky
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2000 bei Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook–Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
978-3-98690-933-8
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Drei Wünsche hast du frei« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Barbara Delinsky
Drei Wünsche hast du frei
Roman
Aus dem Amerikanischen von Georgia Sommerfeld
dotbooks.
WÜNSCHE
Eine Vorbemerkung der Autorin
Ich nutze seit jeher alle Wunschmöglichkeiten, die der Aberglaube bietet – das Erscheinen des ersten Sterns am Abendhimmel, das längere Ende des Truthahn-Wunschknochens, geheime Notizen, die, auf Birkenrinde geschrieben, in ein Lagerfeuer geworfen werden, und – natürlich – mit einem Atemzug ausgeblasene Geburtstagskerzen. Einige meiner Wünsche sind allgemein und gleichbleibend, wie die Gesundheit und Glück betreffenden. Andere sind speziellerer Natur.
Anläßlich des Erscheinens dieses Buches spreche ich drei der letzteren aus. Der erste gilt Steve und unserem Hochzeitstag – ich hoffe auf dreißig weitere Jahre. Der zweite gilt Andrew und Jeremy und ihrem Ausbildungsabschluß – mögt ihr beide, für welches Gebiet ihr euch auch entscheidet, Befriedigung in eurer Arbeit finden. Der dritte gilt Jody und Eric und ihrer Hochzeit – mögen euch Gesundheit, Glück und, ich kann nicht widerstehen, immerwährende, wahre Liebe beschieden sein.
Ich hatte in diesem Jahr auch noch andere Wünsche. Dank meiner Agentin, Amy Berkower, und meiner Redakteurin, Laurie Bernstein, sind viele davon bereits in Erfüllung gegangen. Ihr wißt beide, worauf es jetzt noch ankommt. Wir werden es uns gemeinsam wünschen.
KAPITEL 1
Es war nicht der erste Schnee in diesem Herbst. Panama, Vermont, lag nördlich genug, um bereits mehrmals einen flockenbestäubten Tagesanbruch erlebt zu haben. Doch jetzt war Abend, und was da seit dem frühen Nachmittag aus den Wolkenbetten geschüttelt wurde, sank flauschig und dicht zu Boden.
Trucker, die in dem Imbißlokal Station machten, klagten über zunehmend tückische Straßenverhältnisse, womit sie die, wenn auch im Augenblick nur wenig tröstliche Erwiderung der Einheimischen ernteten, daß der Spuk schnell vorbei wäre. Sie wußten aus Erfahrung, daß bald wieder die Sonne scheinen und dem Indian Summer noch einmal zu voller Pracht verhelfen würde, ehe der Winter einsetzte. Der Schnee, der die leuchtenden Farben des Laubes dämpfte, dicke weiße Kissen auf die Bänke am Anger legte und die noch verbliebenen Blumen am Rand der kurzen Wege zu den Häusern und ein an einem offenen Gartentor lehnendes Fahrrad zudeckte, war nur ein Intermezzo.
Wäre es nach Bree Miller gegangen, hätte er allerdings ruhig liegenbleiben können. Der Winter war ihre Lieblingsjahreszeit. Verschneit, fand sie, wirkte die Welt irgendwie weicher, beinahe märchenhaft. Obwohl Bree, wäre sie eines Hanges zur Romantik bezichtigt worden, dies weit von sich gewiesen hätte, hatte sie ihre verträumten Momente.
Die Einheimischen wollten essen, bevor das Wetter noch schlechter würde, und immer mehr Trucker drängten herein. Bree war von dem Trubel so erhitzt, daß sie gar nicht auf die Idee kam, eine Jacke anzuziehen, als sie sich schließlich zu einer kleinen Atempause aus der Tür stahl und das Stimmengewirr, das Zischen des Grills und das erotische Timbre von Shania Twain hinter sich ließ. In der plötzlichen, tiefen Stille lief sie die Stufen hinunter, über den Parkplatz und dann über die Straße. Drüben angekommen, lehnte sie sich an den dicken Stamm eines altehrwürdigen Ahorns, der die schneenassen, matt bernsteinfarbenen Blätter hängen ließ, und schaute hinüber. Das Lokal war ein Traum in Edelstahl mit roten und grünen Neonakzenten, ein Anblick, dem der Flockenvorhang etwas Unwirkliches verlieh. Die von ihr aufgelisteten, kleinen Schönheitsfehler – die Schramme, die Morgan Willis’ Truck an einer Ecke der Verkleidung hinterlassen hatte, die Delle im Treppengeländer, der Vogeldreck am Rand des Daches – waren beseitigt, und der Imbiß erstrahlte in makelloser Sauberkeit, warm und einladend. Das Logo an der Straße lockte mit konzentrischen Neonringen, die eine große Bratpfanne bildeten, aus deren Mitte wie Fettspritzer die Buchstaben hüpften, aus denen sich der Namenszug »FLASH AN’ THE PAN« zusammensetzte. In jedem der fünf breiten, die Front des Diners einnehmenden Fenster prangten goldfarbene Lampen, und hinter diesen Fenstern saßen in Nischen zufrieden aussehende Gäste.
Der Imbiß gehörte Bree nicht, sie arbeitete nur dort, aber sie schaute ihn immer wieder gerne an.
Ebenso wie Panama. Hügelaufwärts, dort, wo die East Main abflachte und in einem Oval um den Stadtplatz herumführte, saßen dicke Schneemützen auf den Dächern der Reihe von Häusern aus der Bürgerkriegszeit und dahinter, weiß auf Weiß, auf dem Kirchturm. Hügelabwärts, dort, wo die Straße an dem alten Eisenbahndepot vorbeiführte, verbarg der Schnee die häßlichen, von jahrelangem Dieselmißbrauch kündenden Flecken und setzte dem großen, hölzernen Bierkrug, dem Firmenzeichen der Sleepy Creek Brewery, eine üppige Blume auf.
Panama lag zehn Minuten abseits der Truck-Strecke zwischen Concord und Montreal, und diese Abgeschiedenheit war einer der größten Vorzüge des Ortes. Hier gab es keine Bestrebungen, eine Vorortsiedlung anzulegen und Designer-Häuser mit umlaufenden Veranden zu bauen. In Panama hatten die Häuser schon seit der Revolution umlaufende Veranden, aber nicht aufgrund architektonischer Finesse, sondern aus Gemeinschaftssinn. Diese Veranden dienten einem echten Zweck. Obwohl fernab vom Weltgetriebe, war Panama keineswegs hinterwäldlerisch. Da Bauland billig zu haben war, hatte nicht nur die Brauerei zugegriffen, sondern auch eine Großbäckerei, Werkstätten, die handgeschnitzte Möbel und Spielsachen herstellten, und eine Speiseeisfabrik. Die Einheimischen boten Stabilität, die Zuziehenden brachten Geld, und so war für das Fortbestehen des Städtchens gesorgt.
Bree füllte ihre Lungen mit kalter Winterluft und ließ sie ganz langsam wieder ausströmen. Gelegentlich fand eine Schneeflocke den Weg durch das Laub und landete weich und kalt auf ihrem Arm wie eine flüchtige Liebkosung, ehe sie schmolz. Einem Impuls folgend, glitt Bree an dem Stamm entlang zur Rückseite des Baumes und schaute zum Wald hinüber. Vor der dunklen Kulisse fing sich das Licht des Lokals in den Schneeflocken. Sie sehen aus wie spielende Feenkinder, dachte Bree, und plötzlich kamen aus dem Nichts Kindheitserinnerungen an Karussells, Clowns und Weihnachtsfeste, doch sie waren seltsam unwirklich, als träume sie. Bree lauschte angestrengt und glaubte fast, die Stimmen der Märchenwesen zu hören, aber natürlich war es nur das Wispern der Flocken.
Dumme Bree. Berauscht von Schnee. Zeit, wieder hineinzugehen.
Aber sie rührte sich nicht, wurde von etwas festgehalten, das ihre Augen feucht werden ließ und ihr die Kehle zuschnürte. Wenn es Sehnsucht war, so wußte sie nicht, wonach. Sie hatte ein schönes Leben. Sie war zufrieden. Trotzdem blieb sie stehen.
Hinter ihr wurde die Tür des Lokals geöffnet, und Bruchstücke einer Unterhaltung wehten herüber, und kurz darauf röhrte, durch den Schnee gedämpft, der Motor eines Trucks auf und gleich danach ein zweiter. Die Trucks brummten vom Parkplatz, den Hügel hinunter und bogen in Richtung Highway ab, und dann war wieder nur das Geräusch von Schnee auf Schnee zu hören.
Als die Tür des Lokals erneut geöffnet wurde, galt die Stimme ihr: »Bree! Ich brauche dich!«
Sie wischte sich die Tränen aus den Augen, stieß sich von dem Baumstamm ab und lief, den Kopf gesenkt, um ihr Gesicht gegen die Flocken zu schützen, wie gehetzt über die Straße. Sie hatte es plötzlich so eilig, der Unwirklichkeit zu entfliehen, daß sie unvorsichtig wurde. Sie geriet ins Rutschen, versuchte sich, mit den Armen rudernd, auf den Beinen zu halten, und landete doch im Schnee. Eiligst rappelte sie sich auf, putzte mit den Händen die Sitzfläche ihrer schwarzen Jeans ab und lief, die kalten Handflächen aneinanderreibend, die Stufen hinauf. Als sie die Tür aufriß, wurde sie von Applaus und schrillen Pfiffen empfangen, und einer rief: »Reife Leistung, Bree!«
Es war ein Trucker, einer der Stammgäste. Eine zweite Applauswelle brandete auf, als sie auf dem Weg zur Küche ihre eisigen Hände um seinen Stiernacken legte und ihn kurz, aber herzlich drückte.
Flash, der Besitzer des Diners und Küchenchef, empfing sie an der Schwingtür. Ein fast voller Milchkanister baumelte an seinen Fingern. »Ist schon wieder schlecht geworden«, sagte er und ließ die Tür los, sobald sie eingetreten war. »Was sollen wir jetzt machen? Bei den Straßenverhältnissen kommt so schnell keine Lieferung.«
»Wir haben Reserven«, beruhigte Bree ihn und öffnete den Kühlschrank, um es zu beweisen.
Flash warf einen prüfenden Blick hinein. »Und du glaubst, das reicht?«
»Locker.«
»Die Sieben ist fertig, Bree«, rief der Koch am Grill.
Das Lokal bot, auf zehn Nischen und zwölf Hocker am Tresen verteilt, zweiundfünfzig Gästen Platz. An guten Tagen standen die Leute bis vor der Tür Schlange, aber das momentane Wetter war schlecht fürs Geschäft. Heute abend waren gerade noch sechsunddreißig Gäste da. Die eine Hälfte betreute LeeAnn Conti, für die andere war Bree zuständig.
Nische sieben hatte eine Großbestellung aufgegeben, und so balancierte sie vier Teller mit insgesamt zwölf Eiern, zwölf gebratenen Speckschnitten, sechs Würstchen, je sechs Scheiben Ahornsirup- und Rosinentoast und Berge von Bratkartoffeln zu den Männern, die sie schon ihr ganzes Leben lang kannte. Auch sie waren hier zur Schule gegangen und danach in der Gegend geblieben. Sam und Dave arbeiteten in dem Sägewerk drei Ortschaften weiter, Andy im elterlichen Angel-Shop und Jack auf der Farm, die sein Vater ihm und seinem Bruder hinterlassen hatte. Sie waren allesamt große, starke Burschen mit einem ebensolchen Appetit.
Die Littles zwei Nischen weiter waren ein ganz anderer Fall. Ben und Liz waren aus der Hektik einer New Yorker Werbeagentur geflohen, betrieben nun in Vermont per Computer, Fax und Telefon ihre eigene Agentur und kamen mehrmals in der Woche mit ihren Kindern, dem siebenjährigen Benji, der fünf Jahre alten Samantha und dem zweijährigen Joey, um sich an Flashs riesigen Portionen gütlich zu tun, wobei sie alle zusammen mit Leichtigkeit von drei Portionen Truthahn mit Kartoffelbrei und Erbsen oder Schäferpastete mit Milchbrötchen oder amerikanischen Chop-sueys statt wurden. Im Augenblick teilten sie sich gerade eine Portion warmen Apfelstreusel- und ein überdimensionales Stück Schokosplitterkuchen.
Als Bree an den Tisch trat, legte der Zweijährige sein Kuchenstück aus der Hand, stellte sich auf die Bank und breitete die Arme aus. Sie nahm ihn hoch. »Hat alles geschmeckt?«
Er schenkte ihr ein Schokoladenschnäuzchenlächeln, das sie dahinschmelzen ließ.
»Darf es noch etwas sein?« fragte sie seine Eltern.
»Nur die Rechnung«, antwortete Ben. »Es hört nicht auf zu schneien, und die Heimfahrt wird kein Vergnügen werden.«
Als Joey sich in ihren Armen zu winden begann, drückte sie einen Kuß auf seinen Scheitel und stellte ihn auf die Bank zurück. Dann schrieb sie am Seitentresen die Rechnung, brachte sie an den Tisch und ging daran, in der angrenzenden Nische Ordnung zu machen, wo die beiden Trucker gesessen hatten, die eben weggefahren waren. Sie stellte das schmutzige Geschirr ineinander, steckte ihr Trinkgeld ein, wischte die schwarze Resopalplatte ab, rückte die Streuer und Gewürzflaschen und die kleine schwarze Vase mit dem Goldrutenzweig zurecht. Dann legte sie neue Platzdeckchen hin, Nachbildungen der Bratpfanne des Logos, in deren Mitte die reguläre Speisekarte auf gedruckt war. Die Tagesgerichte – »The Daily Flash« – waren den handgeschriebenen Angaben auf den elliptischen Schiefertafeln zu entnehmen, die an beiden Enden des Tresens hoch oben an der Wand hingen.
Bree ging ein paar Nischen weiter, wo Panamas Machtelite versammelt war – der Postmeister Earl Yarum, der Polizeichef Eliot Bonner und die Vorsitzende der Wählerversammlung, Emma McGreevy. Die vor ihnen stehenden Teller waren leer, der Rindfleischeintopf, das Spezialkotelett und der Salat aus gegrilltem Hähnchenfleisch waren restlos weggeputzt, und auch die Sauerteigbrötchen, die Bree in einem Körbchen auf den Tisch gestellt hatte, waren verschwunden. Sehr gut, dachte sie – gesättigt waren die drei harmlos.
»Bereit fürs Dessert?« fragte Bree lächelnd.
»Was gibt’s denn?« wollte Earl wissen.
»Was soll’s denn sein?«
»Kuchen.«
»O-kay. Wir haben Apfel, Pfirsich und Blaubeer. Wir haben Kürbis. Wir haben Erdbeer, Rhabarber, Bananensahne, Ahornsahne, Ahorn mit Pekannüssen, Kürbis mit Pekannüssen, Zitronenbaiser …«
»Nichts mit Schokolade?«
»Schokolade mit Pekannüssen, Schokoladenmousse, Schoko-Rum-Sahne …«
»Keine Brownies?«
Sie hätte sich denken können, daß es darauf hinauslaufen würde – Earl war berechenbar.
»Ein Brownie«, sagte sie und wandte sich mit fragend hochgezogenen Brauen an Emma. »Tee?«
»Bitte, ja.« Emma trank immer nur Tee.
Eliot spielte sein übliches Spiel, ließ Bree alle Eissorten aufzählen – Flash war Miteigentümer von Panama Rich und hatte stets alle dreiundzwanzig Geschmacksrichtungen der Angebotspalette vorrätig –, um am Ende ein schlichtes Erdbeereis zu bestellen.
Parallel zu LeeAnn, dem Griller, dem Koch, dem Spüler und Flash arbeitend, machte sie den Brownie warm und versah ihn mit Schlagsahne, heißer Schokoladencreme und Nüssen, wie Earl es mochte, und löffelte Eliots Eis in ein Schälchen. Danach servierte sie auf Platz sechs am Tresen Panamas einzigem Rechtsanwalt, Martin Sprague, Hühnergeschnetzeltes aus dem Wok, und Ned und Frank Wright, den örtlichen Klempnern, zwei Hocker weiter, Koteletts und Chili. Mit einer Glaskanne in jeder Hand ging sie die beiden Nischenreihen entlang und schenkte Kaffee nach, und anschließend nahm sie sich die Tassen auf dem Tresen vor.
An dessen hinterem Ende saßen Dotty Haie und ihre Tochter Jane, beide groß und schlank, aber während Dottys Gesicht verkniffen war, wies Janes weichere Züge auf, was jedoch nicht altersbedingt war. Allerdings war Bree in diesem Fall nicht objektiv, denn Jane war eine ihrer engsten Freundinnen.
LeeAnn stand, die Ellbogen auf den Tresen gestützt, vor den beiden. Im Gegensatz zu den Hales war sie klein und lebhaft, ihre kurzen blonden Haare standen wie Stacheln von ihrem Kopf ab, und auf den ersten Blick schien ihr Gesicht nur aus Augen zu bestehen. Im Moment waren sie noch größer als sonst.
»Abby Nolan hat die Nacht wo verbracht? Sie ist doch gerade von John geschieden worden!«
»Letzte Woche«, bestätigte Dotty mit einem Nicken ihres spitzen Kinns. »Das Urteil kam mit der Post. Earl hat es gesehen.«
»Warum schläft sie dann mit ihm?«
»Das tut sie ja nicht«, sagte Jane.
Dotty wandte sich ihr zu. »Diese Geschichte kommt nicht von mir. Eliot hat ihren Wagen in Johns Einfahrt stehen sehen.« Sie richtete den Blick wieder auf LeeAnn. »Warum? Weil sie schwanger ist.«
»Von John?« LeeAnn war fasziniert. »Wie denn das?«
»Auf dem normalen Wege, denke ich«, meinte Bree mit einem spöttischen Lächeln, als sie bei ihnen ankam. »Aber das Kind ist nicht von John, es ist von Davey Hillard.«
»Wer sagt das?« fuhr Dotty auf.
»Abby«, antwortete Bree. Sie, Abby und Jane waren seit der Grundschule befreundet.
»Warum hat sie dann die Nacht mit John verbracht?« wollte LeeAnn wissen.
»Das hat sie nicht«, sagte Jane.
»Warst du dort?« fragte Dotty spitz.
»Abby und John haben sich in Freundschaft getrennt«, erklärte Bree, um Dottys Aufmerksamkeit von Jane abzulenken. »Sie ist zu ihm gegangen, um ihm die Neuigkeit persönlich mitzuteilen.«
»Da habe ich von Emma aber was anderes gehört«, widersprach Dotty. Emma war ihre Schwester und ihre größte Informationsquelle. »Und ich weiß noch was von ihr!« trumpfte sie auf. »Julia Dean hat eine Postkarte bekommen.«
»Mutter!« beschwor Jane sie.
Aber Dotty war nicht zu bremsen. »Es ist so. Earl hat die Karte gesehen und Eliot davon erzählt, denn er hat hier für Ruhe und Frieden zu sorgen, und Familienstreitigkeiten können leicht ausarten. Julias Familie ist nicht begeistert davon, daß sie hier ist. Die Postkarte kam von ihrer Tochter aus Des Moines, und sie schrieb, daß es ein Jammer sei, daß Julia sich abkapsele, daß sie verstehe, wie tief Daddys Tod sie getroffen habe, daß es ihnen allen so gegangen sei, aber daß drei Trauerjahre genügen müßten, und wann sie endlich nach Hause käme.«
»Das alles stand auf einer Postkarte?« staunte Bree. Sie wußte nicht viel mehr über Julia, als daß sie vor drei Jahren einen kleinen Blumenladen eröffnet hatte und zweimal wöchentlich die Tischdekoration in Flashs Diner erneuerte. Gelegentlich kam sie auch zum Essen, blieb jedoch für sich. Sie machte einen schüchternen Eindruck, war aber immer freundlich und nett und hatte es nicht verdient, zum Gegenstand des Dorftratsches gemacht zu werden.
»Julias Familie weiß nichts von Earl«, murmelte Jane. »Ach, wirklich.« Brees Blick glitt zur Fensterfront, als die Scheinwerfer eines Trucks hereinleuchteten, der auf den Parkplatz fuhr.
»Und dann ist da noch Verity.« Auch Dotty schaute kurz zu den hellen Lichtern hinüber. »Sie behauptet schon wieder, ein Ufo gesehen zu haben. Eliot sagt, es sei bloß ein Truck hinter ihr hergefahren, doch sie besteht darauf, von dem Mutterschiff verfolgt worden zu sein.«
LeeAnn beugte sich vor. »Hat sie die Babyschiffe wieder gesehen, die wie große Glühwürmchen in der Luft tanzen?«
»Ich hab sie nicht gefragt.« Dotty schauderte. »Die Frau ist unheimlich.«
Bree fand Verity seit jeher eher amüsant als unheimlich und hätte das jetzt auch gesagt, wenn Flash nicht gerufen hätte: »Die Sechs ist fertig, LeeAnn.«
Bree legte LeeAnn die Hand auf den Arm. »Laß nur, ich kümmer mich darum.«
Sie schenkte Dotty Kaffee nach und stellte die Glaskannen auf ihre Warmhalteplatten zurück. Dann nahm sie den Teller mit Hähnchenschnitzel und Spaghetti und trug ihn am Tresen entlang zu Nische sechs, in der Ecke neben der Musikbox, wo auch heute, wie immer wieder einmal in den letzten sieben Monaten, ein Mann saß, der nie viel sagte und auch nicht dazu animierte, eine Unterhaltung mit ihm zu beginnen. Meistens – wie auch jetzt – las er in einem Buch.
Sein Name war Tom Gates. Er hatte das Hubbard-Haus gekauft, einen schindelverkleideten Flachdachbau in der West Elm, an dem in all den Jahren des Dahinsiechens der Hubbards kein Streich getan worden war. Seit Tom Gates das Haus übernommen hatte, waren fehlende Schindeln ersetzt, Fensterläden geradegerückt und die Veranda gestrichen worden, und der Rasen wurde regelmäßig gemäht. Welche Renovierungen das Innere erfahren hatte, entzog sich Brees Kenntnis – abgesehen von der neuen Elektroinstallation, die Skipper Boone vorgenommen hatte, und der neuen Heizung, für die die Wrights verantwortlich zeichneten. Bree hatte das Hubbard-Haus schon immer geliebt. Obwohl kleiner als ihr viktorianisches, hatte es zehnmal mehr Charme. Hätte sie nicht ihres gehabt, das sie von ihrem Vater geerbt hatte, der es von seinem Vater geerbt hatte, hätte sie es vielleicht selbst gekauft, aber wie die Dinge lagen, war sie der Tradition verpflichtet. Die Millers lebten schon seit einer Ewigkeit in der South Forest – zu lange, um von dort wegzuziehen. Bree hätte Tom Gates gerne gefragt, in welcher Weise er das Haus umgestaltet hatte, aber sie wagte es nicht.
Tom Gates war kein geselliger Mann. Ein gutaussehender, ja, sogar ein sehr gutaussehender. Zu gutaussehend, um allein zu sein. Aber nicht gesellig.
»Ihr Essen«, verkündete Bree und stellte, als er sein Buch beiseite legte, den Teller vor ihn hin. Sie wischte sich die Handflächen an ihren Jeans ab und schob die Hände in die Gesäßtaschen. »Ist das Buch interessant?«
Sein Blick wanderte von seinem Dinner zu dem Buch zurück. »Es geht so.«
Sie verdrehte sich den Hals, um den Titel lesen zu können, doch das Deckblatt wirkte wie maschinengeschrieben. »Das sieht ja merkwürdig aus.«
»Es ist noch nicht erschienen.«
»Wirklich? Wie sind Sie dann darangekommen?«
»Ich kenne da jemanden.«
»Den Autor?« Als er den Kopf schüttelte, fing sich das Licht in seinen seidig glänzenden, hellbraunen, für ihren Geschmack eine Spur zu langen Haaren. »Sind Sie Kritiker?«
»Nicht ganz«, erwiderte er ausweichend.
»Sie lesen also nur gerne«, war ihre Schlußfolgerung. Wobei er mit seiner Größe, seinen breiten Schultern und seinem energischen Gang ganz und gar nicht dem Prototyp eines Bücherwurms entsprach. Flash hielt ihn für einen Politiker, der nach einem Wahlbetrug geflohen war. Dottys Meinung nach war er ein erschöpfter Geschäftsmann, denn Earl berichtete von Post aus New York. LeeAnn verfocht die Überzeugung, daß er ein Abenteurer war, der sich von einer anstrengenden Reise erholte.
Diese Version erschien Bree die einleuchtendste. Er hatte etwas Verwegenes, und daß er das Haus gekauft hatte, sprach nicht dagegen. Selbst Abenteurer mußten sich irgendwann einmal ausruhen. Aber sie blieben niemals lange an einem Ort. Für Männer, die das Risiko liebten, war Panama tödlich langweilig, und dieser Mann würde wohl bald auf und davon sein.
Der Gedanke weckte Bedauern in Bree, denn er hatte eindrucksvolle Hände, und darauf achtete sie bei Männern besonders. Seine Finger, lang und dünn mit flachen Kuppen, wirkten handwerklich geschickt. Allerdings hatte sie noch nie Schmutz unter seinen Nägeln gesehen, was ihn von den meisten Männern, die hier aßen, unterschied, doch obwohl seine Hände auch deren Schwielen vermissen ließen, sahen sie arbeitsgewohnt aus. Er hatte sich vor ein paar Monaten geschnitten, und die Wunde war genäht worden. Die Narbe war fast fünf Zentimeter lang und verblaßte allmählich.
»Ich bin gerade mit dem neuen Dean Koontz fertig geworden«, erzählte sie. »Haben Sie ihn schon gelesen?«
Er betrachtete angelegentlich seine Gabel. »Nein.«
»Er ist ziemlich spannend. Sie sollten mal reinsehen. Kann ich Ihnen noch was bringen? Ein zweites Bier vielleicht?« Sie deutete mit dem Kinn auf das hohe Glas auf der anderen Seite seines Tellers. »Sie wissen doch, daß das ein hiesiges ist, oder? Sleepy Creek Pale. Wird ein Stück die Straße runter gebraut.«
Seine Augen begegneten den ihren. Sie waren von einem wunderschönen Grau. »Ja«, sagte er. »Das weiß ich.«
Sie hätte sich vielleicht von diesen Augen verleiten lassen, noch etwas zu sagen, wäre nicht in diesem Moment die Tür geöffnet worden und, begleitet von einem Flockenwirbel, ein Trupp von vier Truckern hereingestampft. Sie schüttelten sich den Schnee von den Köpfen und Jacken, bedachten die Allgemeinheit mit launigen Begrüßungsworten und die Männer in der Sieben mit Handschlag, wonach sie sich in der Fünf niederließen, was bedeutete, daß Bree für sie zuständig war.
»Nichts mehr?« fragte sie Tom Gates noch einmal, und als er den Kopf schüttelte, wünschte sie ihm lächelnd »Guten Appetit« und ging, um sich um die Neuankömmlinge zu kümmern. »Hey, Jungs, wie geht’s denn so?«
»Kalt.«
»Müde.«
»Hungrig.«
»Das Übliche zur Einstimmung?« fragte sie, und auf das vierköpfige, nachdrückliche Nicken hin beeilte sie sich, aus dem Kühlschrank mit der Edelstahltür hinter dem Tresen zwei Sleepy Creek Pales, ein Sleepy Creek Amber und ein Heineken zu holen. Wieder am Tisch, fischte sie den Flaschenöffner aus der kurzen, schwarzen Schürze, die ihre Hüften umspielte, und schenkte ein.
»Ahhhh!« seufzte John Hagan nach einem herzhaften Schluck genießerisch. »Das tut gut nach dieser Höllenfahrt.«
Bree warf einen Blick aus dem Fenster. »Wie hoch liegt er denn schon?«
»Zehn Zentimeter«, antwortete John.
»Quatsch – mindestens zwanzig«, widersprach Kip Tucker.
»Geht auf die fünfzig zu«, tönte Gene Mackey, als die bekanntermaßen leichtgläubige LeeAnn vorbeikam. »Fünfzig?«
Bree versetzte Gene einen freundschaftlichen Schubs. »Er veralbert dich nur, Lee. Kommt, Jungs – benehmt euch.«
»Das macht doch keinen Spaß«, meinte Gene, legte den Arm um ihre Taille und zog sie zu sich heran.
Sie entzog sich ihm. »Mir schon«, gab sie grinsend zurück.
»Überlegt euch, was ihr haben wollt, ich mache inzwischen Ordnung in der Küche.«
»Ich nehme das gleiche wie immer«, sagte T. J. Kearns hastig, ehe sie sich entfernen konnte.
»Ich auch«, schloß Gene sich an.
John deutete auf sich und nickte, was Rindfleischpastete mit Kartoffelbrei und Bratensauce plus dicke Brotscheiben zum Tunken und Buttergemüse bedeutete.
Kip nahm die Tageskarte in Augenschein. »Was schmeckt mir von da oben?«
Bree kannte Kips Geschmack. »Bachforelle«, sagte sie in geziertem Ton. »In Butter sautiert und auf einem Basmatireisbett serviert, mit sonnengetrockneten Tomaten, Portobellopilzen und Brokkoli.«
Kip seufzte verzückt. »Schaff mir eine her. Danke, mein Mädchen.«
Panama lag in einer hügeligen Gegend. Am ersten November standen an fast allen Ecken Streusandkisten, die Trucks waren mit Schneeketten versehen, und die Leute mit Wagen ohne Vierradantrieb zogen Winterreifen auf. Aber heute war nicht der erste November – es war der neunte Oktober, und es schneite wie verrückt. Um acht Uhr war nur noch eine Handvoll Gäste da.
Mit einem Laptop und ihrer Portion Forelle bewaffnet, setzte Bree sich Flash gegenüber in eine der freien Nischen. Er las die Zeitung, wobei er abwechselnd an seinem Kaffee nippte und Stücke von einem zuckergußklebrigen Krapfen abriß, der auf einem Teller neben seiner Tasse lag. Es verwunderte sie immer wieder, daß ein Mann, der so unendlich kreativ war, wenn es darum ging, für andere kulinarische Köstlichkeiten zu zaubern, selbst so einfallslose Eßgewohnheiten hatte.
»Du solltest lieber die Forelle essen«, meinte Bree. »Sie ist himmlisch.«
»Ich hasse Gräten.«
»In deinen Forellen gibt es keine Gräten.«
»Das sagen wir unseren Gästen«, erwiderte er, ohne aufzuschauen, »aber ich bin nie sicher, ob ich alle erwischt habe, und die Angst würde mir die ganze Freude am Essen verderben. Außerdem« – jetzt hob er doch den Blick – »sind nach fünf Uhr für gewöhnlich keine Krapfen mehr da. Warum heute?«
Bree klappte den Laptop auf. »Weil Angus, Oliver und Jack nicht da waren.« Und das war gut so, denn die Straßenverhältnisse wären für die drei, die bereits in den Achtzigern waren, viel zu gefährlich gewesen.
»Flash«, sagte LeeAnn mit einem Blick zu dem letzten Mann am Tresen. »Gav sagt, er würde mich heimfahren, aber er kann nicht warten, bis wir schließen. Meine Gäste sind alle weg …«
»Da mußt du Bree fragen«, antwortete Flash. »Schließlich muß sie dann für dich einspringen.«
»Geh nur«, entließ Bree sie in ihren Feierabend. »Heute kommt bestimmt niemand mehr.«
LeeAnn verabschiedete sich.
»Sie macht alle naselang früher Schluß«, monierte Flash. »Du hast ein weiches Herz.«
»Deines ist noch weicher, darum hast du es auch nicht fertiggebracht, nein zu sagen. Außerdem hat sie Kinder zu Hause. Ich nicht.«
»Warum nicht?« fragte er.
Bree nahm sich die Bestandsliste vor. »Das haben wir doch schon durchgekaut.«
»Erzähl’s mir noch mal. Die Stelle in deiner Argumentation, wo du anführst, daß man einen Mann braucht, um Kinder zu bekommen, gefällt mir besonders. Als ob du nicht jeden haben könntest, der durch diese Tür hereinkommt. Weißt du, was sie antörnt? Dein Desinteresse.«
»Es ist kein Desinteresse, es ist Vorsicht.«
Vorsicht klang freundlicher – Desinteresse traf es genauer. Die Männer, die zum Essen in Flashs Diner kamen, waren keine ernstzunehmenden Kandidaten. Sie konnte mit ihnen lachen und sich nett mit ihnen unterhalten, doch obwohl sie durchaus die anerkennenden Blicke registrierte, mit denen ihre dicken, dunklen Haare, die jedwedem Bändigungsversuch trotzten, und ihre Figur bedacht wurden, wußte sie doch genau, daß die Männer am meisten ihre prompte Bedienung schätzten – und die Tatsache, daß sie ihre Wünsche meistens vorausahnte. Bei ihrem Vater war es ebenso gewesen. Sie hatte als seine Köchin fungiert, als sein Dienstmädchen, seine Schneiderin, seine Friseuse, seine Sekretärin … die Liste war endlos. Nach seinem Tod hatte sie zum erstenmal in ihrem Leben Zeit für sich selbst gehabt, und es war jetzt, drei Jahre später, noch immer keine Selbstverständlichkeit für sie.
»Vorsicht. Ja, ja, so bist du, Bree. Vorsichtig bis zum Gehtnichtmehr. Hast du jetzt endlich jemanden damit beauftragt, eine ordentliche Heizung bei dir einzubauen, oder bist du immer noch dabei, Kostenvoranschläge einzuholen?«
»Ich hole noch immer Kostenvoranschläge ein.«
Flash warf einen Blick auf das Schneetreiben vor dem Fenster. »Also heißt es für dich jetzt wieder frieren.«
»Das Wetter bleibt doch nicht so. Vielleicht scheint morgen schon wieder die Sonne.«
»Aber du wirst nicht um diese Anschaffung herumkommen. Warum schiebst du sie vor dir her?«
»Weil an erster Stelle auf meiner Liste ein neues Auto steht. Die Heizung ist zweitrangig.«
»Das ist doch verrückt.«
»Warum? Ich habe einen Holzofen und warme Decken – aber ohne Auto bin ich aufgeschmissen.«
Sie tippte auf den Bildschirm des Laptops. »Wir müssen uns nach einem anderen Milchlieferanten umsehen.«
»Nein.«
»Ich weiß, ich weiß. Stafford ist vor Ort, und du willst ihn nicht hängenlassen. Mir widerstrebt das auch, aber er liefert nicht nur meistens unpünktlich, sondern neuerdings auch großenteils verdorbene Ware. Denk doch mal zwei Stunden zurück – da warst du in Panik.«
»Ich war nur erschöpft. Stafford hat mit Gesundheitsproblemen zu kämpfen.«
»Das tut er schon seit zwei Jahren, und sein Zustand bessert sich nicht.«
»Gib ihm noch ein bißchen Zeit.« Flash vertiefte sich wieder in seine Zeitung.
Bree wußte nicht, ob sie lachen oder schimpfen sollte. O ja, Flash war weichherzig, so gutmütig, daß es schon an Dummheit grenzte, um die Wahrheit zu sagen, doch der Reiz des Diners stand und fiel mit seiner Persönlichkeit. Er war ein Künstler. Sosehr er sich auch bemühte, in den schwarzen Jeans, dem dunkelroten T-Shirt und der Schirmmütze – der Uniform des Lokals – wie ein Trucker zu wirken, er schaffte es nicht. Und das lag nicht an der langen Mähne, die aus der hinteren Öffnung seiner Kappe quoll – er hatte einfach einen zu sanften Augenausdruck, und das nicht nur, wenn er einem der Ärmsten des Ortes einen Preisnachlaß gewährte, wenn sich am Ende seiner Mahlzeit herausstellte, daß er nicht genügend Geld hatte.
Nicht, daß Bree sich beschwert hätte. Wäre ihr Boß ein anderer Mensch gewesen, würde sie immer noch ausschließlich bedienen. Aber Flash sah das nicht so eng. Sie konnte gut rechnen, und so hatte er ihr die Buchhaltung übertragen. Sie war pünktlich und gewissenhaft, und so hatte er sie mit der Bezahlung der Rechnungen betraut. Darüber hinaus sorgte sie dafür, daß immer genügend Nachschub an Platzdeckchen aus der Druckerei kam, daß die Getränkezapfanlagen regelmäßig gewartet wurden und stets frische Eier, Gemüse und Fisch verfügbar waren.
Sie schob einen Bissen Forelle und Brokkoli in den Mund und konzentrierte sich dann wieder auf ihre Arbeit, gab die für diese Woche erwarteten Lieferungen in den Computer ein, vermerkte Warenknappheiten, die sich ergeben hatten, und Bestellungen, die sie tätigen würde, sobald sie den Laptop im Büro an das Modem angeschlossen hätte. Auch hier hatte sich Flashs Gutmütigkeit gezeigt: Das Modem war innerhalb von vierundzwanzig Stunden installiert worden, nachdem sie geäußert hatte, daß es praktisch wäre, eines zu haben.
Das Singen durchdrehender Räder ließ ihren Blick zum Fenster wandern, vor dem ein Truck den Parkplatz verlassen wollte. Nach einer Minute griffen die Reifen, das Motorgeräusch mäßigte sich zu einem tiefen Brummen, und gleich darauf wurden die Rücklichter von dem immer dichter fallenden Schnee verschluckt.
Um zehn vor acht waren die letzten Gäste gegangen, die zweiundfünfzig Plätze fürs Frühstück gedeckt, das Geschirr abgewaschen, die Lebensmittel weggeräumt, der Grill gereinigt. Und nur Minuten, nachdem Flash den Feierabend ausgerufen hatte, waren die Angestellten verschwunden.
Bree war gerade dabei, ihre Jacke anzuziehen, als er ihr anbot: »Ich fahr dich heim.«
Sie schüttelte den Kopf. »Danke, das ist lieb, aber zu Fuß bin ich schneller.« Sie zog ein Hosenbein hoch, um ihm zu zeigen, daß sie Stiefel trug. »Außerdem wohnst du hügelabwärts, und ich muß den Hügel hinauf. Das brauchst du dir bei dem Wetter wirklich nicht anzutun.«
Aber Flash ließ sich nicht beirren. Er nahm ihren Arm und führte sie zur Tür hinaus.
Die Welt hatte sich seit Brees kurzem Ausflug zuvor dramatisch verändert. Abgesehen von den schneefreien Stellen, an denen die Wagen der Angestellten gestanden hatten, die gerade weggefahren waren, war alles leuchtend weiß – und es war bitterkalt geworden.
»Es ist viel zu früh dafür«, grummelte Flash, als sie auf seinen Explorer zugingen. Während er unter dem Fahrersitz nach einem Eiskratzer tastete, begann Bree mit dem Ärmel ihrer Jacke die Scheiben abzuwischen. Als er sie mit einem Handfeger ablöste, stieg sie ein, beugte sich über den Schaltknüppel, startete den Motor und schaltete, sobald die Windschutzscheibe frei war, die Scheibenwischer ein.
Seit der Schneepflug den Parkplatz geräumt hatte, waren schon wieder etwa zehn Zentimeter Schnee gefallen. Flash ließ den Explorer im Rückwärtsgang über den Schneehügel rumpeln, den der Pflug dort angehäuft hatte, und lenkte den Geländewagen dann auf die Straße hinaus.
Bree starrte angestrengt nach vorn. Die Fahrbahn war nur daran zu erkennen, daß der Schnee hier nicht ganz so hoch lag wie an den Rändern. Die Scheinwerfer des Explorers bogen in die East Main ein. Flash beschleunigte. Die Räder drehten durch, griffen und rollten hügelaufwärts. Sie waren noch nicht weit gekommen, als die Räder erneut durchdrehten. Der Explorer geriet ins Rutschen. Flash bremste, schaltete herunter und versuchte es wieder.
»Schlechtes Profil?« fragte sie.
»Schlechte Straße«, erwiderte er.
»Hügelabwärts stört das nicht. Bitte laß mich zu Fuß gehen.«
Er wollte sich noch nicht geschlagen geben, schaffte es durch Hin-und-her-Schalten immer wieder kurzzeitig, daß die Reifen Halt fanden, doch als sie das erste der fünf Häuser erreichten, die in einigem Abstand voneinander die Straße bis zum Anger hinauf säumten, und der Explorer wieder zur Seite ausbrach und dann rückwärts rutschte, hatte Flash ein Einsehen.
Bree setzte die Kapuze auf und stieg aus. »Danke für den Versuch. Bis morgen.« Sie schlug die Tür zu, verkroch sich in ihrer Jacke und machte sich an den Aufstieg.
Zunächst beleuchteten die Scheinwerfer des langsam rückwärts rollenden Explorers ihren Weg, doch als Flash in die Zufahrt des Diners einbog, verschwanden sie, und Sekunden später verlor sich auch das Motorgeräusch. Stille umfing Bree. Der Schnee auf der Fahrbahn war nicht tief, reichte nur bis zur Oberkante ihrer Stiefel, aber sie hatte mit dem gleichen Problem zu kämpfen wie vorher der Explorer. Aufgrund des Absinkens der Temperatur war die dünne Schneeschicht, die der Pflug liegenlassen hatte, unter dem frischen Schnee gefroren, und sie geriet an dem stetig steiler werdenden Hang immer wieder ins Rutschen.
Sie band ihre Kapuze zu und steckte die Hände in die Taschen, riß sie jedoch im nächsten Moment wieder heraus, als sie erneut ausrutschte, und kämpfte mit ausgebreiteten Armen um ihr Gleichgewicht. Aber gleich darauf verlor sie endgültig den Halt und landete, instinktiv die Hände vorstreckend, bis zu den Handgelenken im Schnee. Sie rappelte sich auf, klopfte sich ab und ging weiter. Nach weiterem Rutschen wich sie an den Straßenrand aus, wo der Schnee ihr bis zu den Waden reichte, was das Vorankommen zwar mühsamer, aber auch sicherer machte. Den Kopf gesenkt, um ihr Gesicht gegen den Schnee zu schützen, kämpfte sie sich mit vorgebeugtem Körper die Steigung hinauf. Als sie das letzte der Häuser passierte, begann sie die Muskeln in ihren Schenkeln zu spüren, doch das Ziehen ließ augenblicklich nach, als sie oben ankam und die Straße flach weiterging.
Sie wandte sich nach links und lief im bernsteinfarbenen Schein der Gaslaternen um den Anger herum. Es waren keine Autos unterwegs, und die in den Zufahrten der Häuser stehenden waren unter den dicken Schneedecken nur zu erahnen. Hier und da stieg duftender Holzrauch aus Kaminen auf, und ab und zu rutschte leise rauschend Schnee von Dächern und landete mit einem dumpfen Laut auf dem Boden.
Ihr Weg führte sie an dem Haus vorbei, in dem die Bank untergebracht war, über der sich die Räumlichkeiten des Rechtsanwalts, des Maklers und des Chiropraktikers befanden. Ein Haus weiter wohnten die Chalifoux, daneben die Nolans, und das nächste Haus beherbergte die Bücherei. Danach kam das – bescheidenere – Heim des Pfarrers und seiner Familie, und an der Stirnseite des Ovals stand, mit ihrem hohen Spitzturm und schneebekränzten, grünen Fensterläden und Türen, die Kirche.
Der hölzerne Friedhofszaun war ebenso unter Schnee verschwunden wie der eiserne um den Anger. Noch vor kurzem hatten sich auf dieser Grünanlage Sonnenanbeter, Picknicker und Sternengucker getummelt. Jetzt bogen sich die Äste der stattlichen Ahornbäume, Birken und Tannen unter der Last des Schnees.
Plötzlich durchbrach das Brummen eines Motors die feierliche Stille, und gleich darauf bog am anderen Ende des Angers ein Pick-up von der Pine Street ein und umrundete langsam die Gemeindewiese. Als er bei Bree ankam, hielt er, und Curtis Lamb kurbelte die Scheibe herunter. »Kommst du von der Arbeit?«
Bree hob den Arm, um ihre Augen gegen den Schnee abzuschirmen. »Ja.«
»Soll ich dich mitnehmen?«
Sie schüttelte lächelnd den Kopf, denn Curtis wohnte hügelabwärts, in der Nähe von Flash. »Ich bin ja gleich da. Fahr nur.«
»Na, dann gute Nacht.« Curtis kurbelte das Fenster wieder hoch, ließ den Pick-up langsam anrollen, bog bei der Bank rechts ab und fuhr die East Main hinunter.
Bree setzte ihren Weg fort. Sie kam jetzt gut voran und genoß das Schneetreiben geradezu.
Wieder hörte sie einen Motor brummen, und sie sah gerade die Scheinwerfer die Birch Hill heraufkommen, in der sie wohnte, als ein zweiter Pick-up rechter Hand die Pine herunterkam. Er fuhr schnell. Zu schnell. Sie sah ihn in das Oval schlittern. Dann griffen die Reifen, und er kam mit hoher Geschwindigkeit auf sie zu. Sie beschleunigte ihre Schritte, bog, an der Ecke angelangt, in die Birch Hill ein – und rettete sich in den hohen Schnee am Straßenrand, denn das ihr entgegenkommende Fahrzeug – ein Jeep – war nur noch etwa sechs Meter entfernt.
Der Pick-up hatte sein Tempo immer noch nicht gedrosselt, und sie beobachtete ihn mit einer Mischung aus Faszination und Entsetzen. Es war ein älteres Modell und entweder dunkelblau oder schwarz. Der Fahrer mußte betrunken oder unerfahren oder schlicht und einfach dumm sein.
»Langsam!« beschwor sie ihn. Bei der Geschwindigkeit würde er mit Sicherheit ins Schleudern geraten, wenn er abbog, und er müßte zwangsläufig abbiegen, entweder rechts in die Birch Hill oder links um das Oval. Wenn er weiter geradeaus führe, würde er sie auf die Hörner nehmen.
Plötzlich bekam sie es mit der Angst und hetzte, so schnell es der tiefe Schnee erlaubte, die Birch Hill hinunter, doch der Zeitpunkt war schlecht gewählt. Sekunden, nachdem sie den Jeep passiert hatte, hörte sie Metall auf Metall krachen, und dann schlitterte der Jeep rückwärts, schneller, als sie rennen konnte, und genau in ihre Richtung.
Sein Zusammenstoß mit ihr war weniger geräuschvoll. Ein stechender Schmerz durchfuhr sie, dann fühlte sie sich einen Moment lang seltsam schwerelos, und danach wurde es dunkel um sie.
KAPITEL 2
Der erste Aufprall ließ den Jeep seit- und rückwärts schlittern. Als der Pick-up ein Ausweichmanöver versuchte, schlitterte er breitseits in den Jeep, woraufhin dieser gegen eine Steinmauer krachte. Der Pick-up wurde in die Mitte der Straße geschleudert und rutschte den Hügel hinunter.
Tom Gates bekam das nicht mit. Er hatte anderes im Kopf. Mit hämmerndem Herzen rammte er die Schulter gegen die Tür des Jeeps, erkannte, daß sie sich hoffnungslos verklemmt hatte, und kämpfte sich über die Gangschaltung zur Beifahrertür hinüber. Als auch die sich nicht öffnen ließ, lehnte er sich zurück, zog die Füße an, trat die Scheibe aus dem Rahmen und zwängte sich hindurch, streifte auf dem Weg in den Schnee die Mauer, war jedoch sofort auf den Füßen und sprang über den niedrigen Wall.
Auf der Straße war nichts zu sehen. Er ließ sich neben dem Jeep auf die Knie fallen, spähte darunter, vergewisserte sich anschließend, daß niemand zwischen Auto und Mauer eingeklemmt war, und schaute dann in heller Panik ratlos in die Runde. Sekunden vor dem ersten Zusammenstoß mit dem Pick-up war jemand um die Ecke gebogen, da war er ganz sicher, und er hatte denjenigen erfaßt. Auch da war er sicher.
Er hatte gerade eine dunkle Silhouette im Schnee entdeckt, als in dem Haus jenseits der Mauer das Licht anging. »Jemand verletzt?« rief Carl Breen aus dem Fenster. »Ja!« rief Tom zurück. »Rufen Sie einen Krankenwagen.« Er sank neben der leblosen Gestalt auf die Knie, streckte die Hand aus, um sie zu berühren, hielt jedoch mitten in der Bewegung inne. Was konnte er tun, ohne Schaden anzurichten? Die Beine schienen unversehrt, zumindest standen sie nicht in unnatürlichen Winkeln ab, aber alles oberhalb davon verbarg eine unförmige Jacke. Als er sich über den Kopf beugte, sah er ein Gesicht, was bedeutete, daß der Verletzte wenigstens nicht im Schnee erstickte. Vorausgesetzt, er hatte den Zusammenprall überlebt. »Hey!« sagte er drängend. »Hey! Können Sie mich hören?«
Der größte Teil des Gesichtes war durch eine fest zugezurrte Kapuze verdeckt. Vorsichtig öffnete er die zu einer Schleife gebundenen Schnüre, lockerte sie – und erstarrte. Die feingeschnittenen Züge, die dunklen Haare … Tom schloß die Augen und setzte sich auf seine Fersen. Es war Bree, die süße Bree aus dem Imbißlokal.
»Großer Gott«, flüsterte er und beugte sich wieder über sie, berührte behutsam ihre kalte Wange und zog ihr die Kapuze so weit wie möglich über das Gesicht, um es gegen den noch immer stetig fallenden Schnee zu schützen. Dann tastete er nach ihrem Puls, doch sein eigener hämmerte so wild, daß er nicht eindeutig erkennen konnte, wessen Puls er da fühlte. Immerhin war die Haut unter der Kleidung warm, was ihm Hoffnung machte. Er zog seine Jacke aus und breitete sie über sie, und da entdeckte er ihre Hand, die mit angewinkelten Fingern aus dem Ärmel schaute. Sie war kalt und schlaff. Er nahm sie und versuchte ein wenig Wärme hineinzureiben.
»Bree?«
Sie rührte sich nicht, sie stöhnte nicht, sie blinzelte nicht. Er schob eine Hand in ihre Kapuze und legte sie an ihre Wange. »Können Sie mich hören, Bree?«
Ein Lichtstrahl glitt über ihn hinweg und kehrte zurück. Tom blickte auf und sah Carl Breen mit einem Südwester auf dem Kopf durch den Schnee auf sich zustapfen. Unter seinem Wollmantel lugten die Beine einer Schlafanzughose hervor, und seine nackten Füße steckten in Überschuhen. Er richtete den Strahl seiner Taschenlampe auf Bree. »Ist sie tot?«
»Noch nicht. Haben Sie angerufen?«
»Die Ambulanz ist auf dem Weg.«
»Wie lange wird sie brauchen?«
»Bei diesem Wetter? Zwanzig Minuten.«
»Zwanzig?« rief Tom entsetzt. »So lange kann sie unmöglich hier liegenbleiben.«
»Das muß sie auch nicht.« Carl beugte sich über Bree und hob die Kapuze an. »Der Chief wird gleich dasein, und Travis auch. Er ist Sanitäter. Soll ich eine Decke holen?«
»Ja, bitte.« Während Carl zum Haus zurücktrottete, behielt Tom Brees Hand in der seinen und ließ die andere an ihrer Wange liegen. Sie war zwar bewußtlos, aber vielleicht konnte er ihr ja doch irgendwie vermitteln, daß sie nicht allein war.
»Es tut mir leid«, murmelte er verzweifelt. »Es tut mir so leid. Drei Meter weiter oben oder weiter unten, und Sie wären verschont geblieben.« Angestrengt forschte er in ihrem Gesicht nach irgendeiner Regung. »Hören Sie mich, Bree?« Er wußte nicht, was er tun würde, wenn sie stürbe, konnte sich nicht vorstellen, damit leben zu können, den Tod eines Menschen verschuldet zu haben. »Halten Sie durch! Halten Sie, um Himmels willen, durch!« murmelte er beschwörend und schaute ungeduldig die Straße hinunter. »Jetzt kommt doch endlich! Was dauert denn das so lange?«
Carl kam zurück und zog den Reißverschluß eines High-Tech-Schlafsacks auf. »Gehört meinem Enkel«, erklärte er und breitete ihn über Bree. Dann ging er neben Tom in die Hocke. »Das war ja ein ganz schöner Krach vorhin«, sagte er. »Was ist denn überhaupt passiert?«
Tom schaute nervös die Straße entlang. »Wo bleiben die denn?«
»Der Chief war unten in der Creek Road, als ich anrief. Er wird die East Main rauf kommen.« Er richtete den Strahl seiner Taschenlampe auf Toms Gesicht. »Sie bluten ja.« Tom schob die Stablampe weg. »Sie haben eine Schnittwunde im Gesicht«, informierte Carl ihn.
Tom spürte keinen Schmerz, er empfand nichts als Angst. Wieder tastete er an Brees Hals nach ihrem Puls, und diesmal war er sicher, daß es ihrer war, den er fühlte. Schwach, sehr schwach. »Sie kommen gleich, Bree«, versicherte er ihr. »Es kommt jeden Moment Hilfe.«
Und wunderbarerweise war es auch so. Eine Welle der Erleichterung durchflutete ihn, als er die Scheinwerfer des Chevy Blazer, der Eliot Bonner, dem Chef der Polizei von Panama, als Streifenwagen diente, um die Ecke biegen sah. Dicht hinter ihm folgte Travis Fitch in seinem Wagen. Die beiden Fahrzeuge hielten dem Jeep gegenüber an, die Fahrertüren öffneten sich synchron, und dann kamen die beiden Männer durch den Schnee herübergelaufen.
Travis, Anfang Dreißig, lang und dürr, trug dunkle Hosen und eine dunkle Kapuzenjacke. Eliot war etwas älter, etwas kleiner und etwas dicker. Er sah mit seiner großkarierten Jacke und der orangefarbenen Wollmütze eher wie ein Jäger als ein Gesetzeshüter aus, und dieser Eindruck war gar nicht mal so falsch, denn angesichts der minimalen Kriminalität in Panama war er öfter auf der Pirsch als dienstlich unterwegs.
Tom rückte zwar ein wenig beiseite, um Travis Platz zu machen, nahm jedoch nicht die Hand von Brees Wange. »Sie hat sich nicht gerührt«, berichtete er mit vor Panik leicht zittriger Stimme, »die Augen nicht geöffnet und kein Wort gesagt.«
Travis entfernte den Schlafsack und Toms Jacke von Bree, öffnete den Reißverschluß ihrer Jacke und tastete sie vorsichtig ab.
Der Polizeichef ging neben Tom in die Hocke und sagte mit seiner zu seinem Bierbauch passenden, volltönenden Stimme: »Der Jeep sieht ja übel aus. Was ist passiert?« Ohne Travis aus den Augen zu lassen, antwortete Tom: »Ein Pick-up ist mir reingefahren, und ich habe sie erwischt.«
»Offenbar mit einer ganz schönen Wucht, sonst wäre sie nicht so weit weggeschleudert worden. Wo ist der Pick-up?«
Tom schaute suchend die Straße hinunter. Der Wagen war nirgends zu sehen. Leise fluchend, drehte er sich wieder zu Bree um. »Wie sieht’s aus?« fragte er Travis ängstlich.
»Genick und Rückgrat sind okay. Sie muß innere Verletzungen haben.«
»Woraus schließen Sie das?«
»Ich spüre da was Hartes in ihrem Bauch.«
»Sie meinen, sie hat innere Blutungen?«
»Scheint so.«
»Wer hat den Pick-up gefahren?« wollte der Chief wissen. Aber Tom war im Moment nicht an dem Pick-up interessiert. »Kann sie verbluten?« erkundigte er sich, als Travis Brees Beine abtastete. »Möglich wär’s. Hier ist nichts gebrochen, soweit ich es beurteilen kann.«
»Wie können Sie die Blutung stoppen?«
»Ich kann das überhaupt nicht, das ist Sache der Ärzte.« Er deckte Bree wieder zu und stand auf. »Ich werde anrufen, damit sie Zeit haben, einen Fachmann zu holen.« Er lief zu seinem Wagen zurück.
»Wo wird sie denn hingebracht?« wollte Tom von Bonner wissen. Bree durfte nicht sterben. Zum erstenmal seit sieben Monaten wünschte er sich, wieder in New York zu sein. Dort hätten sich Spitzenärzte um sie gekümmert. Hier war er dessen nicht so sicher.
»Ins Medical Center nach Ashmont.«
Das kannte Tom, er hatte sich dort seine Hand nähen lassen. Aber Bree hatte keine simple Schnittwunde. »Sie muß in ein richtiges Krankenhaus!«
»Sie muß schnellstens behandelt werden«, gab der Chief zurück. »Bei diesem Schneetreiben startet kein Hubschrauber, und darum kommt sie nach Ashmont. Sie werden einen Arzt aus Saint Johnsbury holen. Wenn er jetzt losfährt, ist er da, wenn die Ambulanz mit ihr eintrifft.«
»Gibt es denn einen Operationssaal in Ashmont?« Bonner bedachte ihn mit einem ärgerlichen Blick. »Was glauben Sie denn, Mann? Wir sind doch keine Hinterwäldler. Unsere Operationssäle sind vielleicht nicht so schick wie eure in der Großstadt, aber sie erfüllen ihren Zweck. Wir hängen nämlich genauso am Leben wie ihr.« Tom richtete sich auf. Er haßte es, hilflos zu sein, und was er im Moment empfand, ähnelte dem Gefühl, das ihn gequält hatte, als er vor Monaten am Grab seiner Mutter gestanden und nichts hatte tun können, als zu trauern. »Jemand muß ihrer Familie Bescheid sagen.«
»Sie hat keine«, antwortete Bonner. »Ihre Mutter ließ sie im Stich, als Bree noch ein Baby war. Sie wurde von ihrem Vater aufgezogen, aber der ist vor drei Jahren gestorben. Es gibt keine Geschwister, keinen Ehemann und keine Kinder.«
Das überraschte Tom. Er hatte sie bei der Arbeit beobachtet und aus ihrem Selbstvertrauen geschlossen, daß sie eine Familie hatte, die hinter ihr stand. Hatte sie sich mit einem Mann und ein, zwei Kindern vorgestellt und angenommen, daß ihre Mutter oder vielleicht eine Schwester die Kinder betreute, während sie in der Arbeit war. Er hatte sie um diese Geborgenheit beneidet. Bonner stand auf. »Sie hat niemanden außer Flash. Ich rufe ihn an.« Als er sich auf den Weg zu seinem Wagen machte, kam Travis zurück. »Die Ambulanz ist in drei Minuten hier«, berichtete er. »So lange kann sie jetzt auch noch da liegenbleiben.«
Tom kniete neben Bree im Schnee, streichelte zart ihre Wange, wollte etwas für sie tun und wußte nicht, was. Vorsichtig wischte er den Schnee von ihrer Kapuze. Sie war zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Wie er.
In dem verzweifelten Wunsch, die Last der Schuld von seinen Schultern zu wälzen, schaute er himmelwärts, mußte den Blick jedoch gleich wieder senken, da es ihm in die Augen schneite. »Es ist erst Oktober, mein Gott! Wann hört das wieder auf?«
Carl, der seine Taschenlampe auf Bree gerichtet hielt, antwortete: »Laut Wetterbericht morgen.«
»Der hatte für heute Regen angekündigt!«
»Na ja, die können auch nicht alles wissen.«
Tom wollte ihm gerade erklären, was er davon hielt, als ein tiefes Motorbrummen die Ankunft der Ambulanz ankündigte. Gleich darauf bog sie mit blitzenden roten und weißen Warnlichtern um die Ecke und kam zum Stehen. Tom beugte sich über Bree. Er empfand Erleichterung, Furcht und so etwas wie Zugehörigkeit. Leise auf sie einredend, sagte er ihr, daß Hilfe gekommen sei, daß sie wieder gesund werde, daß sie sich keine Sorgen zu machen brauche. Er ließ sich nur sehr widerstrebend von den Sanitätern beiseite schieben, sich eine Decke umlegen und sein Gesicht begutachten und protestierte energisch, als sie ihm eröffneten, daß er nicht im Krankenwagen mitfahren könne.
»Sie hat im Moment niemanden außer mir«, erklärte er den Männern aufgebracht, wobei ihm das »im Moment« sehr bewußt war. Bree mochte keine Familie haben, aber sie hatte mit Sicherheit viele Freunde. Sobald bekannt würde, daß sie verletzt war, würden sie sich um ihr Bett versammeln, und er wäre dann nur noch ein Außenseiter, der Bösewicht in dem Stück.
Die Art, wie Eliot Bonner ihn am Arm packte, zeigte ihm, daß der Augenblick bereits gekommen war. »Wir müssen uns unterhalten, Sie und ich«, sagte er. »Wir fahren mit dem Streifenwagen hinterher.« Die Hecktüren der Ambulanz schlossen sich. »Ist das nicht makaber? Da muß erst ein Unfall passieren, damit ich etwas über Sie erfahre. Was machen Sie eigentlich beruflich?«
Tom war gerade erst nach Panama gezogen, als der Polizeichef bei ihm vorbeigeschaut hatte. »Ich möchte Sie willkommen heißen«, sagte er, und Tom wollte nicht abstreiten, daß das ein Grund für den Besuch war, aber das Hauptmotiv war Neugier.
Tom hatte es geschafft, das zehnminütige Gespräch vor seiner Haustür hinter sich zu bringen, ohne wirklich etwas von sich zu erzählen. Er hatte anonym bleiben wollen, und das wollte er noch immer, doch jetzt, da er in einen Unfall verwickelt war, bei dem eine Einheimische ernsthaft verletzt worden war, befand er sich in einer heiklen Lage. Er mochte seine Freunde und seine Familie belogen haben und, was noch schlimmer war, sich selbst, doch er würde sich hüten, einen Gesetzesvertreter zu belügen. »Ich bin Schriftsteller«, sagte er.
»Na, so was. Auf der Suche nach Inspiration, ja?«
»Eigentlich nicht.« Es gab sehr viel Wichtigeres für ihn zu suchen.
»Was dann?«
Tom antwortete nicht. Er war nach Panama gekommen, um Abstand zu dem arroganten, egozentrischen Mann zu gewinnen, zu dem er sich entwickelt hatte, um »Nabelschau« zu betreiben, wie es so schön hieß, in seiner Seele nach etwaigen Resten von Anstand zu forschen, was wiederum ausschließlich selbstbezogen war, von keinerlei Bedeutung für das, was in jener Nacht geschehen war.
Als er die Ambulanz davonfahren sah, merkte er plötzlich, wie kalt es war, und die Vorstellung, wie Bree mit einer Halsmanschette, an die Bahre gefesselt und an Monitore und Infusionen angeschlossen, in dem Krankenwagen lag, ließ ihn noch zusätzlich frösteln. Er hoffte inständig, daß sie durchhalten würde.
Der Chief zog ihn zu dem Blazer. »Sie zittern ja. Lassen Sie uns einsteigen.«
Dieser Aufforderung nachzukommen, erwies sich als Herausforderung – Toms Knochen und Muskeln begannen zu schmerzen.
Bonner warf ihm vom Fahrersitz einen prüfenden Blick zu. »Sind Sie okay?«
»Ja, ja, mir fehlt nichts.« Einer der Sanitäter hatte ihm einen Mulltupfer für die Schnittwunde in seiner Wange gegeben, und er drückte ihn darauf. »Bitte fahren Sie los«, drängte er. Die Ambulanz war bereits außer Sicht.
Der Blazer setzte sich qualvoll langsam in Bewegung. Tom beugte sich unwillkürlich vor, als könne er ihn dadurch beschleunigen.
»Also«, sagte der Chief, »wie war das nun mit dem Unfall?«
Das Zittern wurde stärker, doch jetzt ging es von seinem Bauch aus.
»Gates?«
Tom zwang sich, zurückzudenken, doch seine Erinnerung war nicht präzise. »Ich war hügelaufwärts in Richtung Anger unterwegs.«
»Sie gerieten ins Schleudern, stimmt’s?«
Er konnte sich nicht erinnern, ins Schleudern geraten zu sein. »Nein. Ich habe neue Winterreifen drauf.«
»Wo wollten Sie hin?«
Er hatte kein bestimmtes Ziel gehabt. Zu Hause war ihm die Decke auf den Kopf gefallen, und er hatte seinem Selbstmitleid entfliehen wollen. »Ich bin nur so herumgefahren.«
»Hatten Sie getrunken?«
Tom warf dem Chief einen genervten Blick zu. »Sie sind mir vorhin sehr nahe gekommen, als Sie sich Bree anschauten. Hat mein Atem da nach Alkohol gerochen?« Bonner schüttelte den Kopf. »Nein, nur nach Kaffee.«
»Sie haben mich bei Flash gesehen. Ich habe ein Bier zu meinem Huhn getrunken. Bree fragte, ob sie mir noch eins bringen solle, aber ich lehnte ab. Und nach dem Essen trank ich zwei Tassen Kaffee.« Die Scheibenwischer schoben die Schneeflocken von einer Seite zur anderen. Tom spähte zwischen ihnen hindurch nach vorn und kam sich wie in einem Tunnel aus Licht vor, den die Scheinwerfer des Blazers in die Dunkelheit bohrten. Die Vorstellung war so unheimlich, daß ihm ein kalter Schauer über den Rücken lief.
»Wann haben Sie den Diner verlassen?« wollte Eliot wissen.
»Gegen acht.« Seine linke Seite schmerzte. Er setzte sich anders hin, um sich Erleichterung zu verschaffen, spürte jedoch jede Bewegung des Wagens. »Ich fuhr nach Hause und eine halbe Stunde später wieder los.«
»Nur so, aus Spaß an der Freude.«
Freude hatte es ihm nicht gemacht. Es war schon lange her, daß ihm etwas Freude gemacht hatte. »Wenn Sie so wollen.«
»Und wohin?«
»Durch den Ort, in Richtung Lowell. In die Montgomery. Wie ich schon sagte, habe ich neue Winterreifen drauf.«
»Und die wollten Sie testen.«
»Sie meinen, ich bin zu schnell gefahren, und der Jeep brach aus? Das tat er erst, als der Pick-up wie ein Bulldozer in ihn reindonnerte.«
»Wann haben Sie ihn bemerkt?«
Tom atmete tief ein – und gleich wieder aus, denn es tat höllisch weh. Eine Rippenprellung, nahm er an. Außerdem hatte er sich bei seiner Flucht aus dem Wagenfenster geschnitten, doch das alles war nichts, verglichen mit dem, was Bree zugestoßen war.
»Gates?«
Tom schloß die Augen und versuchte, die fraglichen Sekunden zu rekonstruieren. »Ich weiß nur noch, daß plötzlich Scheinwerfer auf mich zukamen«, sagte er schließlich kleinlaut.
»Was war es für ein Wagen?«
»Weiß ich nicht. Ziemlich groß. Ein Pick-up vielleicht.«
»Welche Farbe?«
Wieder versuchte er, sich zu erinnern. »Dunkel. Mehr konnte ich nicht erkennen – das Licht war zu grell. Aber an meinem Jeep müssen Spuren sein – schauen Sie einfach nach.«