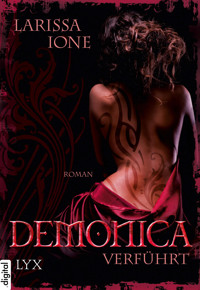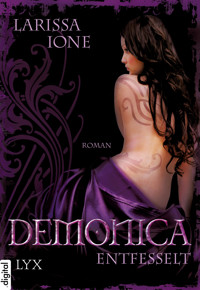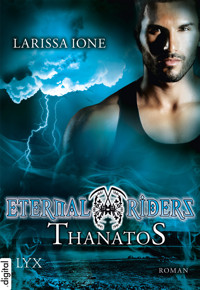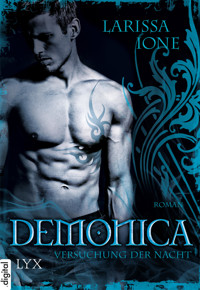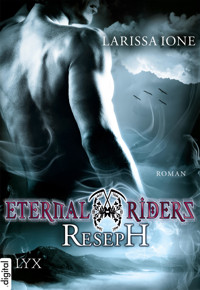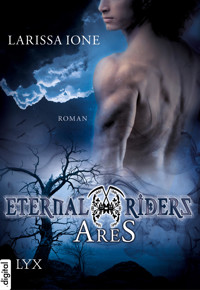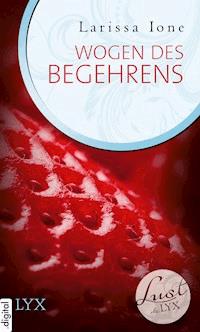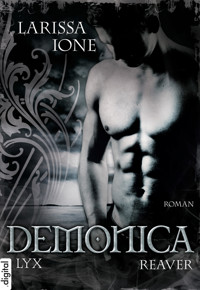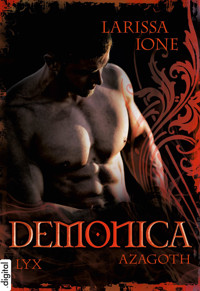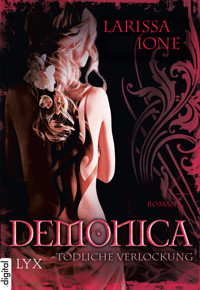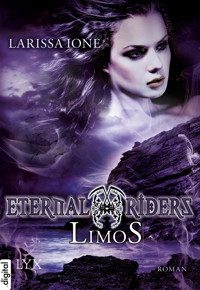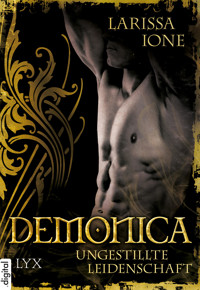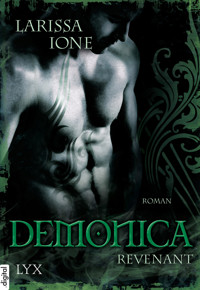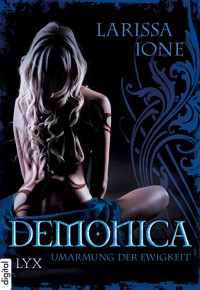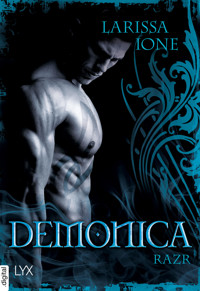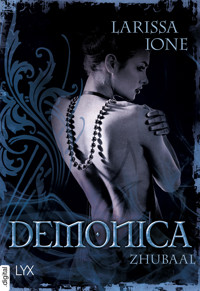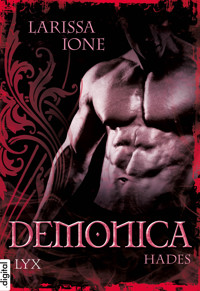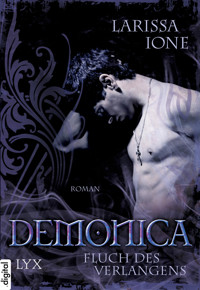
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Demonica-Reihe
- Sprache: Deutsch
Serena Kelley ist Archäologin und Schatzsucherin und birgt ein magisches Geheimnis. Seit ihrem siebten Lebensjahr ist sie im Besitz eines Amuletts, das ihr Unsterblichkeit verleiht - solange sie ihre Unschuld bewahrt. Bisher konnte kein Mann sie in Versuchung führen. Doch als sie dem atemberaubend gut aussehenden Dämon Wraith begegnet, gerät Serena zum ersten Mal ins Wanken. Kann sie seiner Anziehungskraft widerstehen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 635
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhalt
Titel
Widmung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Demonica: Ein Dämonen-Handbuch
Danksagungen
Impressum
LARISSA IONE
DEMONICA
FLUCH DES VERLANGENS
Roman
Ins Deutsche übertragen von
Bettina Oder
Für Brennan, weil ich ohne Dich nie erfahren hätte, welches Glück es bedeutet, Mutter zu sein, ebenso wenig wie meine Figuren, vermute ich. Du bist meine Welt, Goob!
1
»Wenn du mit einem Dämon speist, musst du einen langen Löffel haben.«
Navjot Singh Sidhu
Drei Dinge gab es, in denen Wraith gut war: Jagen, Kämpfen und Ficken. Und alle drei standen heute Nacht in seinem Terminkalender. In genau dieser Reihenfolge.
Wraith hockte zusammengekauert lauernd auf dem Dach eines Ladens, der von Immigranten geführt wurde. Sie stammten aus einem derartig beschissenen Land, dass nicht einmal die Gewalt auf den Straßen von Brownsville, Brooklyn, sie abschreckte.
Er hatte die Gangmitglieder vor einer Weile entdeckt, hatte ihre Aggression gewittert, ihr Bedürfnis, Blut zu vergießen, und dabei hatte sich Wraiths eigenes Bedürfnis geregt, genau dasselbe zu tun. Wie jedes Raubtier hatte er seine Beute sorgfältig ausgewählt, doch im Gegensatz zu den meisten anderen Raubtieren hatte er es nicht auf die Schwachen und Alten abgesehen. Scheiß darauf. Er wollte die Stärksten, die Größten, die Gefährlichsten.
Er zog es vor, sein Glas Blut mit einem Schuss Adrenalin zu würzen.
Leider durfte Wraith heute Nacht nicht töten. Der Vampirrat hatte ihm ein Limit von einem Menschen pro Monat gesetzt – dieses Limit hatte er bereits erreicht, und er würde es unter keinen Umständen überschreiten.
Seltsam, dass er sich deswegen Sorgen machte, angesichts der Tatsache, dass er vor zehn Monaten froh und vergnügt seine S’genesis durchgemacht hatte – einen Wandel, der aus ihm ein Ungeheuer hätte machen sollen, das sich ausschließlich von seinem Instinkt leiten ließ: dem Instinkt, so viele weibliche Dämonen zu ficken wie nur möglich. Und zwar mit dem Ziel, sie zu schwängern. Ein zusätzlicher Bonus der S’genesis war, dass sich männliche Seminus-Dämonen ausschließlich auf ihren Sextrieb konzentrierten und ihnen so ziemlich alles andere egal war. Aber Wraith war außerdem noch Vampir. Das Töten lag ihm also im Blut. Sozusagen.
Wraith hatte sein neues Leben gar nicht erwarten können und darum einen Weg gefunden, den Wandel früher auszulösen. Unglücklicherweise hatte sich dadurch in seinem Leben verdammt wenig gewandelt. Oh, sicher wollte er Frauen ficken und schwängern, aber das war nichts Neues. Der einzige Unterschied war, dass er sie jetzt schwängern konnte. Ach ja, und um das zu tun, musste er sich in ein männliches Exemplar der jeweiligen Dämonenspezies verwandeln, denn keine Frau auf der Erde oder in Sheoul, dem Dämonenreich im Kern des Planeten, würde wissentlich mit einem Seminus ins Bett gehen, der die S’genesis durchlaufen hatte. Niemand wollte Nachwuchs gebären, der trotz unterschiedlicher Eltern ein reinrassiger Seminus-Dämon sein würde.
Also ja, ein paar Dinge hatten sich schon verändert, aber nicht genug. Wraith erinnerte sich immer noch an die Gräuel seines früheren Lebens. Ihm lag immer noch etwas an seinen beiden Brüdern und an dem Krankenhaus, das sie gemeinsam aufgebaut hatten. Manchmal war er nicht sicher, was davon schlimmer war.
Wraith sog witternd die Luft ein. Er roch den kürzlich gefallenen Regen, den widerlichen Gestank von altem Urin, verfaulenden Abfällen und der würzigen haitianischen Küche aus dem Schuppen nebenan. Dunkelheit umgab ihn, hüllte ihn in Schatten, und eine kalte Januarbrise zerzauste sein schulterlanges Haar, ohne jedoch die Hitze zu lindern, die durch seine Adern rann.
Er mochte wie der Inbegriff der Geduld erscheinen, wie er da auf seine Beute lauerte, aber das hieß nicht, dass er nicht innerlich vor Erwartung bebte.
Denn es waren keine normalen Gangmitglieder, die er jagte. Nein, die Bloods, Crips und Latin Kings konnten den gnadenlos grausamen Upir nicht das Wasser reichen.
Schon beim bloßen Gedanken an diesen Namen verzogen sich Wraiths Lippen zu einem höhnischen Grinsen. Die Upir funktionierten im Grunde wie jede andere an ein bestimmtes Revier gebundene Gang, nur dass die, die hinter den Kulissen die Fäden zogen, Vampire waren. Sie benutzten ihre menschlichen Trottel dazu, Verbrechen zu begehen, Blut – und blutiges Vergnügen – bereitzustellen, wenn nötig, und den Sündenbock zu spielen, wenn die Polizei sie hochgehen ließ. Für ihre Dienste und Opfer würden die Menschen mit dem ewigen Leben belohnt werden. Zumindest glaubten sie das.
Idioten.
Die meisten Vampire hielten sich an strenge Regeln, was die Wandlung menschlicher Wesen anging, und da einem Vampir in seiner gesamten Lebenszeit nur eine Handvoll Wandlungen gestattet war, würde er sie sicher nicht an solchen Abschaum vergeuden.
Aber das wussten diese Mistkerle natürlich nicht. Sie machten die Straßen unsicher, mit ihren Tattoos von bluttriefenden Fangzähnen und den Gangfarben in Blutrot und Gold, die jeden warnten, sich von ihnen fernzuhalten. Niemand legte sich mit den Upir an.
Niemand außer Wraith.
Da kamen die Upir. Sieben insgesamt. Sie rissen die Mäuler auf, redeten Unsinn und stolzierten mit einer Arroganz durch die Gegend, die nur von ihrer Dummheit übertroffen wurde.
Showtime.
Wraith richtete sich zu seiner vollen Größe von beinahe zwei Metern auf und ließ sich von seinem Aussichtspunkt ungefähr fünf Meter über dem Boden fallen, sodass er direkt vor der Gang landete.
»Hey, ihr Arschlöcher. Was geht?«
Der Anführer, ein untersetzter Weißer, der sich ein Bandana um den knollenförmigen Kopf gewickelt hatte, taumelte einen Schritt zurück, ehe es ihm gelang, seine Überraschung mit einem Fluch zu überspielen. »Eh, was soll der Scheiß?«
Einer der Strolche, ein kleiner, fetter Troll – leider nicht im wörtlichen Sinne, denn dann hätte Wraith ihn umbringen können, ohne mit Sanktionen rechnen zu müssen – mit krummer Nase zog ein Messer aus der Jackentasche.
Wraith lachte.
Zwei weitere Rowdys zogen ihre Klingen.
Wraith lachte noch lauter. »Der Abschaum der menschlichen Gesellschaft amüsiert mich«, sagte er. »Nager mit Waffen. Nur dass Nagetiere schlau sind. Und sie schmecken grauenhaft.«
Blitzschnell zog der Anführer eine Pistole aus seiner tief hängenden Schlabberhose. »Scheiße, du Arsch, du hast wohl ’n Todeswunsch, oder was ist mit dir los?«
Wraith grinste. »Wie recht du hast. Allerdings ist es dein Tod, den ich mir wünsche.« Er schmetterte dem Anführer die Faust mitten ins Gesicht.
Der Anführer schwankte zurück und hielt sich die gebrochene, blutende Nase. Der Geruch des Blutes hob Wraiths Laune. Und da war er nicht der Einzige. Die beiden Typen ganz hinten reagierten sofort, ihre Köpfe fuhren herum.
Vampire. Ein Schwarzer und eine Latina, beide genau wie die anderen in Baggy Pants, Kapuzenshirts und schäbigen Sneakers.
Jackpot, Baby! Wraith würde also heute Nacht doch noch jemanden umbringen.
Ehe sich einer der verblüfften Menschen von dem Schreck erholen konnte, rannte Wraith schon eine der Seitengassen entlang.
Wütende Schreie erklangen hinter ihm, als sie sich an die Verfolgung machten. Er verlangsamte sein Tempo, um die Gang näher kommen zu lassen. Behände sprang er auf einen Müllcontainer, schwang sich von dort auf ein Dach und wartete, bis sie vorbeigelaufen waren. Ihre Wut hinterließ eine Duftspur, der er auch mit verbundenen Augen hätte folgen können, doch stattdessen sprang er wieder hinab und nutzte seine vampirische Infrarotsicht, um sie in den dunkelsten Schatten aufzuspüren. Er hasste es, irgendeine seiner Vampirfähigkeiten einzusetzen, inklusive Supergeschwindigkeit und -stärke, aber das Sehvermögen war es, das ihn wahrhaftig anekelte.
Weil er nicht damit auf die Welt gekommen war. Diese Kraft hatte er erst zweiundzwanzig Jahre später erhalten, mit den Augen, die Eidolon ihm vor beinahe achtzig Jahren transplantiert hatte. Jedes Mal, wenn Wraith diese babyblauen Glupscher im Spiegel sah, wurde er an die Folter und die Qualen erinnert, die den neuen Augäpfeln vorausgegangen waren.
In Gedanken trat er sich selbst in den Hintern, weil er sich von der Vergangenheit ablenken ließ, und machte sich in aller Stille auf die Jagd. Normalerweise hätte er zuerst die Vampire erledigt, aber nur ein kleines Stück vor ihm keuchte und schnaufte der Troll dem Rest der Gang hinterher.
Mit einem Satz warf sich Wraith auf ihn, quetschte dem Dicken die Luft aus den Lungen und ließ ihn bewusstlos hinter einem Stapel Kartons zurück. Als Nächstes kümmerte er sich um den männlichen Vampir, der sich einbildete, besonders schlau zu sein, indem er sich von hinten an Wraith herangemacht hatte.
Wraith gab vor, nicht weiterzuwissen, und blieb mitten im hellen Schein einer Straßenlaterne stehen, während der Vampir sich heranschlich. Näher … noch näher …ja.
Wraith wirbelte herum und ließ einen Regen aus Fausthieben und Fußtritten auf den wuchtigen Mann niederprasseln. Der Vampir hatte nicht die geringste Chance, selbst auch nur einen einzigen Schlag zu landen. Sobald Wraith ihn in die Dunkelheit unter einer Überführung gezerrt hatte, warf er ihn zu Boden. Ein Knie in den Unterleib des Mannes gestemmt und eine Hand um dessen Kehle gedrückt, zog Wraith einen Pfahl aus dem Waffengurt unter seiner Lederjacke.
»Was …«, keuchte der Mann, die Augen in seiner Todesangst weit aufgerissen. »Was … bist … du?«
»Junge, dieselbe Frage stelle ich mir auch manchmal.« Er rammte ihm den Pfahl ins Herz, wartete aber nicht einmal ab, bis sich der Vampir auflöste. Auf ihn wartete noch einer von der Sorte.
Vorfreude rauschte durch seine Adern, als er die Frau durch Seitenstraßen und Gassen verfolgte. Wie der Mann glaubte auch sie, die Jägerin zu sein, und Wraith überrumpelte sie, als sie sich in die Schatten hinter einem Gebäude schlich. Er schubste sie gegen die Mauer, legte ihr die Hände um den Hals und hob sie hoch, bis ihre Füße hilflos über dem Boden baumelten.
»Das war viel zu einfach«, sagte Wraith. »Was bringt der Vampirrat euch Küken heutzutage eigentlich bei?«
»Ich bin kein Küken.« Ihre Stimme glich einem leisen, verführerischen Schnurren, und noch während sie sprach, hob sie die Beine und legte sie um Wraiths Hüften. »Ich werd’s dir zeigen.«
Der Duft der Lust ging wellenförmig von ihr aus. Sein Inkubus-Körper reagierte instinktiv, wurde hart und heiß, aber lieber würde er sich selbst töten, als einen Vampir zu ficken – oder einen Menschen, auch wenn seine Weigerung, mit menschlichen Frauen ins Bett zu gehen, einen völlig anderen Grund hatte.
Er beugte sich vor, bis seine Lippen ihr rundherum gepierctes Ohr streiften. »Bin nicht interessiert«, knurrte er.
Sie drückte sich an ihn, von seinen Inkubus-Pheromonen angeheizt.
Du sollst nicht mit deinem Essen spielen. Eidolons Stimme erklang in seinem Kopf, aber Wraith ignorierte sie, so, wie er so ziemlich alles ignorierte, was seine Brüder zu ihm sagten. Er hatte nicht vor, sich von dieser Frau zu nähren.
»Und das soll ich dir glauben?«, fragte sie und rieb die Hüften an seiner Erektion.
»Vielleicht muss ich dich erst noch überzeugen.« Wraith zog sich ein Stück zurück und ließ sie einen Blick auf seinen Holzpflock erhaschen.
Panik trat in ihre Augen. »Bitte …« Sie schluckte, ihre Kehle zog sich unter seiner Handfläche zusammen. Ihr Körper erschlaffte wie eine sterbende Blume, und mit einem Schlag war die Verführerin verschwunden. »Bitte. Tu es … einfach nur schnell.«
Er blinzelte. Eigentlich hatte er erwartet, dass sie um ihr Leben betteln würde. Er sah ihr in die weit aufgerissenen, gequälten Augen; seine Hände bewegten sich langsam, mit einem übelkeiterregenden Anflug von Furcht, über ihren Hals. Unter dem Kragen ihres Shirts wurde ein leicht erhöhtes Muster sichtbar. Verdammt.
Er schob den Pfahl in die Tasche und zog ihr Sweatshirt beiseite, sodass eine Narbe von der Größe seiner Faust sichtbar wurde.
Ein Sklavenzeichen. Und zwar nicht irgendeins. Das Brandmal mit den gekreuzten Knochen der neethulischen Sklavenherren, der grausamsten unter allen dämonischen Sklavenhändlern. Diese Frau war seit Gott weiß wie langer Zeit gezwungen, in der Hölle zu leben. Irgendwie war es ihr gelungen, ihre Freiheit wiederzuerlangen, vermutlich durch Flucht … und jetzt tat sie, was sie tun musste, um zu überleben.
Sie hatte schwer gelitten. Litt vermutlich auch in diesem Augenblick.
Irgendetwas regte sich in seinem Bauch. Erst als er sie wieder zu Boden ließ, ohne es überhaupt zu merken, wurde ihm klar, worum es sich bei diesem seltsamen Gefühl handelte. Mitleid.
»Geh«, sagte er mit rauer Stimme. »Ehe ich es mir anders überlege.«
Das ließ sie sich nicht zweimal sagen. Im Nu war sie verschwunden, genau wie Wraith. Erschüttert durch diesen ganz und gar untypischen Akt der Barmherzigkeit, verdrängte er den ganzen Vorfall. Er musste sein Gleichgewicht wiederfinden. Er musste sich nähren. Er musste irgendjemandem Schmerz zufügen.
Die Gang hatte sich aufgeteilt, und er spürte einen nach dem anderen mit beinahe mechanischer Effizienz auf, bis nur noch der Anführer übrig war. Ganz in der Nähe ertönte ein Schuss; ein vertrautes Geräusch in diesem Teil der Stadt, so vertraut, dass er zu bezweifeln wagte, dass sich jemand die Mühe machen würde, die Cops zu rufen.
Der Anführer befand sich direkt vor ihm, lief an einem mit Brettern verbarrikadierten Laden vorbei, während er mit aufgebrachter Stimme Befehle in sein Handy brüllte.
»Yo, Schleimscheißer!«, rief Wraith. »Ich bin hier drüben! Soll ich mir dir zuliebe vielleicht ein Leuchtzeichen umschnallen?«
Mit vor Wut puterrot verfärbtem Gesicht folgte der Anführer Wraith in eine Seitengasse. In der Mitte der Gasse angekommen, wirbelte Wraith herum. Der Gangster zog seine Waffe, doch Wraith hatte ihn bereits entwaffnet, ehe er auch nur einmal blinzeln konnte. Die Waffe schlitterte über den nassen Asphalt, während Wraith den Kerl mit dem Rücken gegen eine Mauer schleuderte und den Unterarm gegen den dicken Hals des Menschen drückte.
»Was für eine Enttäuschung«, sagte Wraith gedehnt. »Ich hatte einen richtigen Kampf erwartet. Du musst wissen, ich klopfe mir mein Fleisch vor dem Essen gern weich. Wann begreift ihr endlich, dass eine Waffe einfach kein Ersatz für das Erlernen gewisser Kampftechniken im Kampf Mann gegen Mann ist?«
»Fick dich!«, brachte der Typ heraus.
»Ein Kerl wie ich?« Wraith lächelte und beugte sich vor, bis seine Lippen die Wangen des Mannes streiften. »Das hättest du wohl gern.«
Ein wütendes Brüllen verstärkte sein Lächeln noch. Tief sog er das Aroma des Mannes ein; Wut, gemischt mit einem überaus verführerischen Hauch von Angst. Hunger brauste durch Wraith hindurch, und seine Fänge wurden langsam länger. Das Spiel war vorbei. Er versenkte die Fangzähne tief in den Hals des Gangsters. Warmes, seidiges Blut füllte seinen Mund, und nach ein paar Zuckungen erschlaffte der Körper seiner Beute.
Wraith hätte seine Seminus-Gabe dazu benutzen können, den Kopf dieses Typen mit glücklichen, heiteren Bildern zu erfüllen, aber der Kerl war nur Abschaum. All die Dinge, die er verbrochen hatte, prasselten wie rasch aufeinanderfolgende Salven einer Schnellfeuerwaffe auf Wraiths Gehirn ein. Sicher, Wraith war kein Engel – wenn er auch den einen oder anderen falschen Engel, oder auch zehn, gefickt hatte. Aber mit Ausnahme von Aegis-Wächtern verletzte er niemals menschliche Frauen oder Kinder.
Doch dieser Kerl … Wraith wünschte nur, er hätte seine monatliche Tötungsquote nicht an diesen Wilderer aus Sumatra vergeudet. Trotzdem würde es Spaß machen, diesen Scheißkerl ein bisschen zu quälen. Genüsslich schluckte Wraith das reichlich mit Alkohol versetzte Blut, während er seine Geisteskräfte dazu einsetzte, dem Kerl grauenhafte Bilder davon einzupflanzen, was Wraith alles mit ihm tun würde, sollte er je herausfinden, dass er auch nur noch ein einziges Gewaltverbrechen begangen hatte. Im Grunde genommen war es ihm vollkommen gleichgültig, ob ein Mensch lebte oder starb, aber dieser Typ genoss es, Schwache und Alte zu seinen Opfern zu machen.
Wo blieb denn da der Spaß?
Ungeheure Kräfte brandeten durch Wraith; Macht und Adrenalin und Blitze, die unter seiner Haut aufleuchteten. Sein Dermoire, das die Geschichte seiner Seminus-Vorfahren erzählte, pulsierte von den Fingerspitzen seiner rechten Hand bis zu seiner Schulter und seinem Hals und sogar bis zur rechten Seite seines Gesichts, wo die durcheinanderwirbelnden schwarzen Glyphen ihn als einen Seminus kennzeichneten, der die S’genesis durchlaufen hatte. Menschen hielten es meist für ein Tattoo; einige fanden es cool, andere waren abgestoßen.
Menschen waren so verdammt verklemmt.
Der Puls seines Opfers beschleunigte sich, als sich sein Herz bemühte, den Blutverlust zu kompensieren. Wraith nahm noch zwei tiefe Schlucke, löste dann seine Fänge und zögerte, ehe er über die beiden Löcher leckte, um die Wunden zu versiegeln. Es hatte ihm noch nie etwas ausgemacht, von seinen Opfern zu trinken, doch er hasste es, über ihre Haut zu lecken, Schweiß, Schmutz und Parfum – und, schlimmer noch, ihre individuelle Essenz zu schmecken. Innerlich fluchend fuhr er mit der Zunge über die Haut. Obwohl er sich alle Mühe gab, nicht zu erschaudern, bebte er vor Widerwillen am ganzen Leib.
»Du solltest ihn umbringen.«
Die männliche Stimme, tief und ruhig, erschreckte ihn. Niemand schlich sich an Wraith heran. Niemand.
Er ließ den Anführer los, sodass der Kerl mit einem dumpfen Geräusch auf dem Asphalt aufschlug. Mit einer einzigen fließenden, anmutigen Bewegung fuhr er zu dem Neuankömmling herum, doch viel zu spät erst sah er etwas verschwommen aufblitzen und fühlte das Stechen eines Pfeils in seiner Kehle.
»Scheiße!« Wraith riss sich den Pfeil aus dem Hals und warf ihn zu Boden, während er bereits den Kerl angriff, der ihn angeschossen hatte. Dem würde er den Arsch aufreißen!
Wraith griff nach dem Hemd des Mannes, eine Art Tunika aus Sackleinen, aber seine Finger streiften lediglich den Kragen. Der Kerl war übernatürlich schnell – übernatürlich schnell für einen Menschen. Dieser Mann gehörte den Dämonen an, Spezies unbekannt.
Der Kerl verursachte nicht den kleinsten Laut, als er durch die Nacht auf einen Kanaldeckel zuglitt.
Wraiths linke Seite wurde immer schwächer; unbeholfen zog er einen Wurfstern aus seinem Waffenharnisch und schleuderte ihn auf den Fremden. Er traf ihn in den Rücken.
Der ohrenbetäubend hohe Schrei des Mannes zerriss die Nacht, als er stürzte. Wraith wurde langsamer. Mit einem Mal lastete ein Gefühl nie gekannter Angst auf ihm und ließ seine Glieder schwerfällig und unkoordiniert werden.
Als er stolperte, versuchte er, sich an einer Hauswand festzuhalten, doch seine Muskeln schienen sich in Wasser verwandelt zu haben. Seine Sehkraft ließ nach, sein Mund wurde trocken, und mit jedem Atemzug schien er Feuer in seine Lungen zu saugen.
Er versuchte, sein Handy zu greifen, doch sein Arm gehorchte nicht mehr. Und dann hörte auch sein Verstand auf zu funktionieren, und alles wurde schwarz.
Pochender Schmerz in seinem Kopf weckte Wraith. Sein Mund war so ausgedörrt, dass er zu würgen begann. Er roch Erbrochenes. Blut. Desinfektionsmittel.
Scheiße, was hatte er letzte Nacht bloß angestellt? Dabei war er doch schon monatelang clean gewesen … na ja, zumindest hatte er sich nicht nur deshalb an einem Junkie gelabt, um high zu werden. Sicher, er hatte von einer ganzen Reihe Menschen und Dämonen getrunken, die Drogen intus hatten, aber das war nicht der Grund gewesen, aus dem Wraith sie sich ausgesucht hatte. Zumindest hatte er sich das eingeredet.
Jedenfalls war er schon seit Monaten nicht mehr mit einem Kater aufgewacht, aber das hier … das war die Mutter aller Kater.
Mit viel Mühe gelang es ihm, die Augen zu öffnen, auch wenn der Schmerz ihn warnte, dass seine Lider inwendig mit Sandpapier ausgekleidet waren. Die Augen füllten sich mit Tränen, und er musste einige Male blinzeln, ehe er endlich etwas erkennen konnte. Wenn auch verschwommen, gelang es ihm, Ketten zu identifizieren, die von einer dunklen Decke herabhingen. Leise, gedämpfte Stimmen vermischten sich mit dem Piepen medizinischer Apparate und dem Klingeln in seinen Ohren. Er war im Underworld General.
Eigentlich hätte er erleichtert sein sollen, froh, dass er sich in Sicherheit befand. Stattdessen versetzte diese Erkenntnis ihm einen Schlag in den Magen. Offensichtlich hatte er mal wieder Mist gebaut, und seine Brüder würden ihm den Arsch aufreißen, und zwar gründlich.
Wenn man von Dämonen spricht, dachte er, als Eidolon und Shade das Zimmer betraten. Wraith versuchte, den Kopf zu heben, doch sofort begann sich alles in einem übelkeiterregenden, dunklen Wirbel um ihn zu drehen.
»Hey, Brüderchen«, sagte Shade und ergriff Wraiths Handgelenk.
Ein warmes, pulsierendes Gefühl schoss durch Wraiths Arm. Es verriet ihm, dass Shade dabei war, seinen Körper eingehend zu erforschen, seine Vitalfunktionen zu überprüfen und was sonst noch für Mist gecheckt werden musste. Vielleicht konnte er ja auch dafür sorgen, dass ihm nicht mehr so entsetzlich schwindelig war.
»Was is los?«, krächzte er. »Wieso glotzt ihr denn alle so ernst?«
Offenbar saß er noch viel tiefer in der Scheiße, als er gedacht hatte.
Eidolon lächelte nicht. Nicht einmal dieses künstliche, doktorhafte Alles-wird-wieder-gut-Lächeln. »Was ist in jener Nacht passiert?«
»In jener Nacht?«
»Du warst zwei Wochen lang bewusstlos«, sagte E. »Was ist passiert?«
Wraith richtete sich so abrupt auf, dass sein Kopf abzufallen drohte. »O nein! Scheiße, nein! E, hab ich jemanden umgebracht?«
Seine Brüder drückten ihn aufs Bett zurück. »Nicht dass wir wüssten. Noch nicht jedenfalls. Aber wir müssen wissen, was passiert ist.«
Vor Erleichterung ließ er sich tief in die Matratze sinken, während er das schwarze Loch in seinem Kopf durchsuchte. Eine Gasse. Er war in einer Gasse gewesen. Und er hatte Schmerzen gehabt. Aber wieso? »Ich bin nicht sicher. Wie bin ich hierhergekommen?«
Shade grunzte. »Ich habe deinen Schmerz gespürt, und auch, dass du dich in einer Notlage befindest. Also hab ich mir ein Team geschnappt und bin durch ein Höllentor zu dir gekommen.«
»Woran erinnerst du dich noch?«, fragte E. Er verstellte das Kopfteil des Betts, sodass sich Wraith aufrecht hinsetzen konnte.
Wieder durchkämmte er seine verschwommenen Erinnerungen, doch es kam ihm vor, als müsste er mit verbundenen Augen ein Puzzle zusammensetzen. »Ich hatte gerade von dem Anführer einer Gang getrunken. Ziemlich lecker, überraschenderweise frei von Drogen.« Er runzelte die Stirn. Hatte er den Kerl umgebracht? Nein, wohl eher nicht … er erinnerte sich noch daran, dass er die Wunden versiegelt hatte. »Dann hab ich einen Stich im Nacken gespürt. Und da war ein Mann. Ein Dämon, glaub ich. Warum?«
Das Pulsieren in seinem Arm hörte auf, doch Shade ließ seine Hand liegen, wo sie war. Obwohl er seine heilenden Kräfte in diesem Moment nicht mehr einsetzte, drehte und wand sich sein Dermoire nach wie vor. »Du bist von einem Auftragsmörder angegriffen worden. Der von Roag geschickt wurde.«
»Hey, habt ihr die Mitteilung nicht bekommen, in der steht, dass Roag futschikato ist?« Wraith beäugte seine Brüder, wartete auf die Pointe, aber sie wirkten nicht, als wollten sie ihn auf den Arm nehmen. »Ach, kommt schon, Roag ist so gut wie tot. Und diesmal wirklich.«
Ihr älterer Bruder hatte einen grausamen Racheplan gegen sie drei geschmiedet, der um ein Haar gelungen wäre. Wenn Wraith niemals wieder die dunklen Tiefen eines Kerkers sehen würde, wäre das immer noch zu früh.
Eidolon fuhr sich mit der Hand durch das kurze dunkle Haar. »Ja, also, er hat den Mörder angeheuert, um sich im Falle seines Todes an uns zu rächen. Du musst ihn verletzt haben, denn er war in keinem guten Zustand. Tayla hat ihn verfolgt und gefangen, während Shade dich hierherbrachte. Er hat alles gestanden, ehe Luc ihn aufgefressen hat.«
»Er hat ihn gefressen?«
E nickte. »Der Mörder war ein Leoparden-Wandler. Und denen jagt nichts mehr Angst ein als ein Werwolf, darum haben wir ihn in Lucs Keller angekettet, um ihn zum Reden zu bringen. Wir dachten, wir hätten ihn weit genug von Luc entfernt untergebracht.« Er zuckte mit den Achseln. »Das war offensichtlich eine Fehleinschätzung.«
»Ich liebe Werwölfe«, sagte Wraith. Er schenkte Shade ein hinterhältiges Grinsen. »Pass bloß auf, dass du Runa nicht sauer machst, sonst frisst sie am Ende noch dich auf.«
Shade war im vergangenen Jahr die Verbindung mit einer Werwölfin eingegangen und seitdem geradezu widerwärtig glücklich. »Warum bist du überhaupt hier? Solltest du ihr nicht mit den kleinen Ungeheuern helfen?«
»Meinst du mit denen, die du bisher noch nicht ein einziges Mal besucht hast?«
»Shade.« Eidolons Stimme enthielt eine leise Warnung, was merkwürdig war. Für gewöhnlich war Shade die Stimme der Vernunft, wenn es sich um Wraith handelte.
Aber seit Runa ihre Drillinge auf die Welt gebracht hatte, war Shade grauenhaft überfürsorglich und nur allzu leicht verletzt. Er kapierte einfach nicht, dass nicht jeder so begeistert von seinem Nachwuchs war wie er.
Als Wraith das Laken wegschob, stellte er fest, dass er nackt war. Nicht, dass ihm das etwas ausmachte, er hoffte nur, dass sie ihm den Mantel nicht ruiniert hatten. Da er Shades Begeisterung für Traumascheren kannte, ging er allerdings lieber mal davon aus, dass er sich einen neuen würde kaufen müssen.
»Und warum seht ihr aus, als würde gleich die Welt untergehen? Der Kerl hat versagt.«
Shade und E wechselten einen Blick, der bei Wraith augenblicklich sämtliche Alarmglocken schrillen ließ. Das war gar nicht gut.
»Nein, er hat nicht versagt«, sagte Shade leise. »Er hat einen Partner. Der läuft immer noch frei da draußen rum und ist hinter uns her.«
»Na, dann werde ich halt seinen traurigen Arsch aufspüren und den Typen um die Ecke bringen. Wo ist das Problem?«
Wraiths Magen nutzte Shades verdächtig lange Pause dazu, sich bis zu seinen Füßen zurückzuziehen. »Das Problem ist, dass der erste Mörder dich mit einem Pfeil getroffen hat, der ein langsam wirkendes Gift enthielt.«
Wraith schnaubte. »Ist das alles? Gebt mir einfach das Gegenmittel.«
»Erinnerst du dich noch an Roags Ausflug in unseren Lagerraum?«, fragte E.
Ja, klar, Wraith erinnerte sich. Letztes Jahr hatte sich Roag im Zuge seiner Rachekampagne Zugang zu Es Sammlung seltener Artefakte und anderem Mist verschafft, den Wraith in seinem Auftrag zusammengetragen hatte.
»Eines der Dinge, die er damals mitgenommen hat, war das Mordlair-Nekrotoxin. Das hat der Auftragskiller benutzt.« E atmete langsam aus. »Es gibt kein Gegengift.«
Kein Gegengift? »Dann eben einen Zauber. Sucht nach einem Zauber, der es heilen kann.« Panik begann, an den Rändern seiner Selbstbeherrschung zu nagen. Shade musste es gespürt haben, denn sein Griff festigte sich.
»Wraith, wir haben jeden Text gelesen, jeden Schamanen und jede Hexe zurate gezogen … Es gibt nichts, was das Gift aus deinem Körper entfernen könnte.«
»Und was heißt das jetzt unterm Strich?«
E reichte Wraith einen Spiegel. »Sieh dir mal deinen Hals an.« Er strich Wraiths Haar zurück, sodass dessen persönliches Symbol am oberen Ende seines Dermoires sichtbar wurde. Das Stundenglas, dessen unterer Teil immer voll gewesen war, war nach Abschluss seines ersten Reifezyklus im Alter von zwanzig erschienen.
Wraith sog scharf die Luft ein, als er es jetzt sah: Das Stundenglas stand auf dem Kopf, der Sand floss vom oberen in den unteren Teil und zeigte so den Verlauf der Zeit an.
»Du liegst im Sterben«, sagte Eidolon. »Du hast noch einen Monat zu leben, maximal sechs Wochen.«
2
Serena Kelley lag im Sterben. Na ja, nicht im wörtlichen Sinne. Aber genauso kam es ihr vor, so, wie ihr die Luft von einem extrem heißen Vampir aus den Lungen gesaugt wurde, der sie küsste, bis sie nicht mehr wusste, wo oben und unten war.
Eigentlich stand sie gar nicht darauf, in Gothic-Klubs abzuhängen, aber heute Abend lief im Alchemy diese Nasenbluten-Euro-Grufti-Mucke, die versprach, jede Menge Vampire herbeizulocken – sowohl die menschlichen Möchtegerns als auch die tatsächlich Untoten.
Die Musik hallte dermaßen laut von den Wänden des alten Schlachthauses wider, dass es ihren Herzschlag in einen chaotischen, ungleichmäßigen Rhythmus trieb. Der Geruch nach Parfum, Schweiß und Sex lag schwer in der Luft und brachte ihre Libido auf Touren. Sie bewegte sich mit dem Gewühl von Körpern auf der Tanzfläche, überließ sich der Strömung, während der Vampir, dessen Namen sie soeben erfahren hatte, sie führte.
Sie spürte seinen Hunger, sein dunkles Verlangen, und ja, es war falsch von ihr, ihn auf diese Weise zu verführen. Falsch, ihn glauben zu lassen, sie würde ihm zu einer Mahlzeit und einer weiteren Kerbe in seinem Sarg verhelfen.
Aber egal. Jedes Mädchen musste ab und zu mal flirten.
Vor allem, wenn ein Flirt das Äußerste war, das sie von einem Kerl erwarten konnte.
»Komm«, sagte Marcus in diesem leisen Flüsterton, mit dem sich Vampire irgendwie immer verständigen konnten, ganz egal, wie groß der Lärm war. »Mein Tisch wartet.«
Marcus war ein alter Vampir und seine steife, förmliche Ausdrucksweise ein Teil seiner Anziehungskraft. Serenas Hormone liefen Amok, während er sie in eine düstere Ecke führte, in der bereits eine ganze Reihe menschlicher Groupies wartete, die wie aufgeregte Schoßhündchen zu zittern begannen, als er sich ihnen näherte.
Wie so viele Vampire der älteren Generation kleidete er sich geschmackvoll, wenn auch eher konservativ, unter einem mitternachtsblauen Trenchcoat, der es ihm erleichterte, sich unauffällig unter die Gruftis und Punks in den Bars zu mischen. Glänzendes, schwarzes, hüftlanges Haar und rubinrote Lippen in einem ernsten, bleichen Gesicht vervollständigten den Look.
Auf sein Winken hin verstreuten sich die Schoßhündchen, nicht ohne ihr den einen oder anderen eifersüchtigen Blick zuzuwerfen. Sie fragte sich, wie viele von ihnen wohl wussten, dass er ein echter Vampir war. Nur wenige, die voll auf den vampirischen Lifestyle abfuhren, glaubten tatsächlich an Untote, und diese Menschen endeten häufig als Renfields – untertänige, katzbuckelnde Anhänger, die einem Vampir gestatteten, sie auf jede nur erdenkliche Weise auszunutzen.
Serena mochte ja durchaus etwas für Vampire übrig haben, aber sie würde niemals diese unsichtbare Linie übertreten und sich als Mahlzeit oder Wegwerfbetthäschen missbrauchen lassen. Sie ließen sich in der Nische nieder; ihre schwarze Cargohose glitt über die Sitzflächen aus Kunstleder. Marcus legte ihr den Arm um die Taille und zog sie an sich.
Perfekt. Denn ja, sie fuhr in einer Weise auf Vampire ab, derentwegen ihr Boss, Wohltäter und persönlicher Aegis-Wächter, Valeriu Macek glatt einen Anfall bekäme, wenn er davon wüsste. Und ja, es gefiel ihr, ein Leben voller Risiken zu führen. Aber es gefiel ihr auch, Geschäftliches und Vergnügen miteinander zu vermischen, und in diesem Augenblick brachte ihr Job als Schatzjägerin es mit sich, Marcus sein überaus wertvolles, sehr altes Armband vom Handgelenk zu stehlen.
Langsam, ganz behutsam, ließ sie ihre Hand über seine gleiten, sodass ihre Finger auf dem antiken mazedonischen Schmuckstück zu liegen kamen. Marcus bemerkte davon nichts; der Blick seiner halb geschlossenen Augen konzentrierte sich voll und ganz auf ihren Hals, und seine Erektion drückte sich gegen ihre Hüfte.
»Sollen wir rausgehen oder hierbleiben?«, fragte er.
Sie fragte sich, ob er wohl wusste, dass ihr voll und ganz bewusst war, was er war.
So wie er seine Fänge verborgen hielt, vermutlich nicht. Andererseits war es ihm nach Jahrhunderten des Daseins als Untoter vermutlich in Fleisch und Blut übergegangen, seine Vampirzähne zu verbergen. Außerdem waren seine Eckzähne in Wahrheit gar nicht so spektakulär, solange der Vampir nicht erregt war, aber dann stießen sie durch das Zahnfleisch empor, wurden länger, größer … so erotisch.
Serena hob das Kinn und entblößte damit ihre Kehle. Verlockend. Ablenkend. »Hier«, schnurrte sie. Mit der einen Hand löste sie sein Armband, mit der anderen fuhr sie über seine Brust.
Mächtige Muskeln regten sich unter ihrer Handfläche, und zum ungefähr tausendsten Mal wünschte sie sich, sie würde kein keusches Leben führen. Wünschte, sie könnte all die dummen, riskanten Dinge tun, die Menschen in den Zwanzigern normalerweise so taten.
Marcus’ Lächeln ließ gerade eben die Spitzen seiner Fänge sehen, als er sich vorbeugte, doch dann zuckte er zusammen, als sich ihr Anhänger in seine Brust bohrte. Mit gerunzelter Stirn starrte er auf den Kristall, der die Größe einer Weinbeere hatte. »Das ist aber ein verdammt großes Schmuckstück.«
»Ein Geschenk von meiner Mami«, sagte sie leichthin, obwohl die Kette weitaus mehr war als das.
Das Armband löste sich. Sie ließ es in eine Tasche am Bein ihrer Hose gleiten und blickte auf die Uhr. »Oh, jetzt sieh dir nur mal an, wie spät es schon ist! Ich muss gehen. Schließlich möchte ich mich ja nicht in Aschenputtel zurückverwandeln.«
Marcus’ Hand drückte ihren Bizeps. »Ich bin noch nicht fertig mit dir.«
Sie schenkte ihm ein strahlendes Lächeln. »O doch, das bist du. Ich bin kein Schwan.«
Schwan war ein Ausdruck für Menschen, die Vampiren ihr Blut oder ihre psychische Energie darboten, auch wenn sie für gewöhnlich davon ausgingen, dass die Vampire auch nur Menschen waren, die genauso atmen mussten wie sie selbst; das, was wahre Untote Fakire nannten.
Eiskalte Wut spiegelte sich in seinen Augen, und seine Lippen entblößten dolchartige Eckzähne. Jeder gesunde Mensch wäre starr vor Entsetzen gewesen, aber nicht Serena.
Sie hatte ein kleines Geheimnis. Seit achtzehn Jahren wurde sie von einem göttlichen Segen beschützt; seit dem Tag, an dem er ihr im Alter von sieben Jahren übergeben worden war.
Niemand konnte ihr ein Leid antun.
Nicht, solange sie Jungfrau blieb.
Marcus versuchte, sich über ihren Hals herzumachen. Serena wich ihm aus, und der Vampir verlor ohne ersichtlichen Grund das Gleichgewicht, rutschte von seinem Sitz und landete auf dem Boden. Die Groupies, die sich nicht allzu weit von ihrem Idol entfernt hatten, wichen entweder zurück oder eilten herbei, um ihm aufzuhelfen – doch da war er schon wieder aufgesprungen, außer sich vor Zorn.
Seine Augen wurden schmal, und er ballte die Fäuste, doch es war ihm nicht gelungen, seit Jahrhunderten den Wächtern der Aegis aus dem Weg zu gehen, die hinter Vampiren her waren, indem er mit einer Szene alle Augen auf sich zog. In seiner Weisheit entschloss er sich, ihr nichts Schrecklicheres anzutun, als ihr einen Fluch hinterherzuschicken. Dann drehte er sich in typischer Vampirmanier in einem wilden Wirbel um und verschwand in der Menge, während seine Renfields ihm auf den Fersen folgten.
Jetzt musste sie sich aber beeilen, ehe Marcus noch merkte, dass sie ihm sein Armband geklaut –
Irgendetwas blitzte vor ihr auf. Nein …in ihr. Ein scharfer Knall ertönte in ihren Ohren – der Widerhall eines Lautes irgendwo in ihrem Kopf. Als eine Welle der Übelkeit sie überrollte, brach ihr der kalte Schweiß aus. Instinktiv griff sie nach ihrem Anhänger, suchte den Trost der kühlen, glatten Kugel.
Nur, dass der Trost diesmal nicht von Dauer war. Der Anhänger leuchtete auf. Eine Warnung. Ihre Tarnung … geplatzt. Sie war aufgeflogen.
Zitternd sprang sie auf die Füße, stolperte auf wackeligen Beinen Richtung Ausgang. Sie musste sofort nach Hause. Zurück zu Vals Villa.
Denn zum ersten Mal seit achtzehn Jahren eines sorglosen, gesegneten Lebens hatte Serena Angst.
Byzamoth ließ sich in seinen Sitz zurücksinken. Er keuchte, bebte am ganzen Körper. Orgiastische Wellen der Macht durchfluteten ihn, als er leise den Namen murmelte, den er soeben erfahren hatte.
Serena Kelley.
Er hatte die Identität des Menschen, dem er auf der Spur war, nicht gekannt, aber jetzt war alles an ihr so klar wie die Kristallkugel einer Hexe.
Viel zu rasch verflog das Gefühl der Macht, und er blieb schwach, wenn auch kein bisschen weniger ekstatisch zurück. Seine Handfläche brannte, aber es war ein süßer Schmerz, den er nur zu gern ertrug. Er öffnete die Faust, in der die Ursache seines Unbehagens rot glühte: eine Kugel in der Größe eines Golfballs, die unter dem Namen Auge von Eth bekannt war. Rot statt golden, da sie nicht für Gutes, sondern für böse Zwecke benutzt worden war.
Erschöpft ließ er den Kopf gegen die Lehne sinken und blickte zur Decke des israelischen Hauses auf, das er heute Morgen beschlagnahmt hatte. Die Familie, die es bewohnt hatte, lag in verschiedenen Haltungen mit starren, blinden Augen um ihn herum. Die jüngste Jungfrau unter ihnen hatte sich aus freiem Willen als Blutopfer darbringen lassen, das Byzamoth benötigt hatte, um das Potenzial des Bösen des Auges von Eth zu aktivieren.
Vielleicht war »aus freiem Willen« nicht ganz der richtige Ausdruck, aber jedenfalls hatte Byzamoth erreicht, was er wollte. Er hatte den wichtigsten Menschen im ganzen Universum ausfindig gemacht, denjenigen, der eine entscheidende Rolle dabei spielen würde, das bedeutendste Ereignis in der Geschichte der Dämonen in Gang zu setzen.
»Es hat begonnen«, sagte er zu dem Dämon, der in der Tür zum Wohnzimmer stand.
Lore trat ein; ein kräftiger Mann, der von Kopf bis Fuß, die Hände eingeschlossen, mit schwarzem Leder bedeckt war, das zu seinem kurzen Haar passte. Er war einer der effizientesten Mörder, denen Byzamoth je begegnet war; ein Mann, dessen Berührung alles tötete, womit seine bloße Hand in Kontakt kam.
Byzamoth mochte unsterblich sein, aber selbst er hielt Abstand zu Lore.
»Dein Krieg ist mir scheißegal. Ich will mein Geld.«
»Wieso die Eile?«
»Mein Partner hat versagt, und der Vampirdämon ist immer noch am Leben. Ich muss den Job zu Ende bringen.«
Byzamoth winkte ab. »Du bekommst dein Geld, aber das wird keine Rolle spielen. Bald wird Geld vollkommen wertlos sein. Schmerz wird die neue Währung sein.«
»Von mir aus, aber im Augenblick bekomme ich immer noch Bier für mein Geld, also rück die Kohle raus.«
Byzamoth lächelte. In ebendiesem Augenblick würde sich das Gefühl, dass irgendetwas Bedeutsames in Gang geraten war, in der ganzen Unterwelt verbreiten; selbst wenn dieses Etwas immer noch ein Mysterium für sie war. Nur wenige würden die Bedeutung dessen erfassen, was Byzamoth soeben getan hatte: Er hatte den göttlichen Mantel der Unsichtbarkeit gelüftet, der Serena so lange Zeit vor den Augen der Dämonen verborgen hatte.
Jahrelang war sie in der Verkleidung eines gewöhnlichen Menschen über die Erde gewandelt, und nur wenige, wenn überhaupt jemand, wussten davon. Bis jetzt.
Ihr Glück war, dass sie immer noch unter der Obhut eines Segens stand und immer noch die Hüterin der Halskette – Heofon – war. Und niemand war in der Lage, ihr die gegen ihren Willen zu nehmen.
Niemand außer einigen wenigen Auserwählten. Wie Byzamoth.
Genau das war seine Absicht – ihr beides gegen ihren Willen zu nehmen.
Und wenn er mit ihr fertig war, würde er im Besitz der mächtigsten Waffe sein, die man sich vorstellen konnte, und endlich würden die Dämonen die Welt regieren.
Doktor Gemella Endri saß im Konferenzraum; Tayla, ihre Schwester und Eidolons Gefährtin, zu ihrer Rechten und Shade zu ihrer Linken. Eidolon und die Ärzte Shakvan und Reaver saßen ihnen gegenüber. Anspannung lag in der Luft, wurde immer bedrückender, je weiter die Nacht vorrückte ohne auch nur eine einzige neue, praktikable Idee, wie sie Wraith retten könnten.
Den sie ruhiggestellt hatten, nachdem Shade und E ihm mitgeteilt hatten, dass er sterben würde. Wraith hatte die Nachricht überraschend gut aufgenommen, aber weder Shade noch Eidolon wollten darauf vertrauen müssen, dass er sich nicht umgehend auf die Jagd nach dem zweiten Auftragsmörder machen würde. Sie wollten ihn hier haben, wo sie seinen Zustand überwachen konnten, obwohl sie wissen mussten, dass es ihnen nicht allzu lange gelingen würde, ihren kleinen Bruder festzuhalten. Dieser Dämon konnte einfach nicht still sitzen, und nichts zu tun, lag ihm nun mal nicht im Blut.
Was das Ganze noch verschlimmerte, war die Tatsache, dass das Krankenhaus in letzter Zeit immer wieder von seltsamen, unerklärlichen Störungen und Ausfällen von Geräten und Technik heimgesucht wurde. Sämtliche Fenster innerhalb des Verwaltungstrakts waren gesprungen; die Lampen in der Cafeteria flackerten ununterbrochen, und im Lavabad im dritten Flügel hatte es ein Leck gegeben, das das Schwefeldampfbad gleich daneben zerstört hatte. Eidolon war viel zu beschäftigt mit all diesen Problemen gewesen, um sich auf die Medizin zu konzentrieren, denn jedes Mal, wenn er etwas in Ordnung gebracht hatte, ging wieder irgendetwas anderes kaputt.
»Ich habe heute Morgen einen Orphmagus aufgesucht«, sagte Gem, »aber der konnte mir auch nicht helfen.«
Im Grunde genommen hatte sie gar nicht erwartet, dass der mächtige Cruentus-Magier ihr würde helfen können, aber einen Versuch war es wert gewesen. Cruenti wurden von einer blutgierigen Liebe zum Töten angetrieben, die nicht einmal vor ihrer eigenen Spezies haltmachte, deshalb war sie auf die Idee gekommen, dass ein Cruentus-Magier, der zur abscheulichsten Todesmagie fähig war, vielleicht auch etwas darüber wissen könnte, wie man Mordlair-Nekrotoxin unschädlich macht.
Er war mehr an der Frage interessiert gewesen, wie er selbst wohl in den Besitz dieses Gifts kommen könnte.
»Ich könnte noch einmal versuchen –« Sie schnappte nach Luft und verstummte.
Eine finstere Energiewelle war über sie hinweggespült, gefolgt von einigen kleineren Erschütterungen, als wäre ein Stein in verpestetes Wasser gefallen. Sie wollte gerade fragen, ob außer ihr noch jemand dasselbe gespürt hatte, aber den Mienen der anderen zufolge war sie nicht die Einzige, die dieses … was auch immer es war … gefühlt hatte. Selbst nachdem die kleineren Wellen aufgehört hatten, hielt sich dieses beklemmende Gefühl; das Gefühl, dass etwas sehr Böses das Gefüge des Lebens selbst zerrissen habe.
Etwas Schlimmes, etwas sehr, sehr Schlimmes war in Gang gesetzt worden.
»Was zur Hölle war das denn?«, fragte E mit krächzender Stimme.
Er schien davon noch mehr in Mitleidenschaft gezogen zu sein als Gem, aber schließlich war er auch ein Vollblutdämon, und sie war zur Hälfte Mensch und darum den Gezeiten des Bösen gegenüber weniger empfindlich.
Gem schüttelte den Kopf, was sie allerdings nicht im Mindesten von dem Gefühl des unmittelbar bevorstehenden Verhängnisses befreite.
»Reaver?« Tayla sprang auf die Füße. »Scheiße!«
Alle Köpfe drehten sich zu dem gefallenen Engel um, der in seinem ledergepolsterten Stuhl mit der hohen Lehne saß und … sich in Krämpfen wand. Auf der Stelle legten ihn die anwesenden Ärzte und Shade, der Rettungssanitäter war, auf den Boden und begannen, seinen Zustand zu untersuchen, aber dies war kein medizinisches Problem, wie Gem und Tayla wussten.
»Lasst ihn in Ruhe.« Taylas Stimme zitterte genauso stark wie Gems Hände.
Dank ihrer Abstammung von einem Seelenschänder waren die Schwestern in der Lage zu sehen, dass sich Reavers Körper entlang einer unsichtbaren Narbe weit geöffnet hatte, die von seinem Hals bis zum Unterleib reichte.
Seelenschänder besaßen die Fähigkeit, Narben, sowohl körperlicher als auch emotionaler Art, zu erkennen, die niemand sonst sehen konnte, sie zu erforschen und zu verschlimmern. Ihre Spezies nutzte diese Gabe, um alte Wunden freizulegen, ihren Nutzen daraus zu ziehen und sie zu verschlimmern. Gem hatte sechsundzwanzig Jahre damit verbracht, gegen ihre Natur anzukämpfen, manchmal ohne Erfolg. Aber ihre Natur brachte ihr auch viele Vorteile, wenn es um ihren Beruf ging.
Gem eilte zu Reaver und hockte sich neben ihn, während er nach wie vor krampfte. Seine saphirblauen Augen waren so weit verdreht, dass nur noch das Weiße zu sehen war. Die anderen Ärzte standen dicht um die beiden herum, und als sich Tayla zu Gem gesellte, schob sie sie alle beiseite. Undeutlich hörte Gem E fragen, was zur Hölle bloß los sei, aber ihre Konzentration war voll und ganz auf Reaver gerichtet.
Mit einer Hand packte er Gems Handgelenk und drückte so fest zu, dass sie die Zähne zusammenbeißen musste, um nicht aufzuschreien. »Jemand hat … sie gefunden.«
Sie legte ihre Hand auf seine Brust, gleich neben die emotionale Narbe, die sich geöffnet hatte, als wäre ein Reißverschluss aufgegangen. Als Seelenschänder konnte sie ihre Macht sowohl dazu benutzen, Narben verheilen zu lassen wie sie zu verschlimmern – obwohl ihre Fähigkeit aufgrund ihrer gemischten Abstammung schwächer ausgebildet war. Etwas so Gewaltiges übertraf ihr Können eigentlich bei Weitem. Aber sie musste es wenigstens versuchen.
»Wer, Reaver? Wovon sprichst du?«
Er schien sie nicht zu hören, murmelte nur vor sich hin – größtenteils unzusammenhängendes Zeug. »Serena … Hüterin … enttarnt …Scheiße.«
Gem war vollkommen verwirrt, aber Tayla beugte sich vor und legte ihre Hand neben Gems. »Reaver? Was ist mit Serena? Willst du damit sagen, sie wird gesegnet?«
Reaver antwortete nicht, aber seine Krämpfe ließen nach, bis es sich nur noch um leichte Zuckungen handelte. Etwas Hässliches bäumte sich in Gem auf, weckte in ihr das Verlangen, die Narbe offen zu halten, tiefer und fester in sie einzudringen. Der Impuls, zu wühlen und Schmerz zu verursachen, jagte ihr eine Höllenangst ein. Hastig zog sie die Hand weg, doch Tayla packte sie und legte sie zurück.
»Das ist wichtig«, knurrte Tay, deren Seelenschänder-Instinkt zum Vorschein gekommen war. »Wir müssen mehr erfahren.«
Gem holte tief Luft, immer noch etwas zittrig, und gab dem Dämon in ihr ein wenig mehr Raum. Erbarmungslos grub sie die Finger in seine Narbe und zerrte, während Tayla dasselbe tat. Reaver schrie gellend auf, aber Gem ignorierte es und beugte sich über ihn, bis ihr Gesicht nur noch Zentimeter von seinem entfernt war.
»Wer ist Serena?«
»Kelley …«, stöhnte Reaver. Dann murmelte er etwas in einer Sprache, die Gem unbekannt war.
»Ist sie eine gezeichnete Hüterin?«, fragte Tayla, und Reaver erstarrte. Dann flog er mit einem Mal in einem blendend grellen Lichtblitz quer durch das ganze Zimmer, als wäre er von einem Gargantua-Dämon ausgeknockt worden, und landete als jämmerliches Häufchen Elend an der Wand.
»Scheiße.« Eidolon drückte auf die Gegensprechanlage an der Wand und verlangte eine Liege, und innerhalb weniger Augenblicke waren Krankenschwestern und ein weiterer Arzt erschienen, um Reaver in die Notaufnahme zu bringen. Doktor Shakvhan begleitete ihn, sodass Gem mit Tayla, E und Shade zurückblieb.
Shade begann, quer durch das Zimmer auf und ab zu laufen, während sich seine Hände reflexartig immer wieder zu Fäusten ballten. »Will mir vielleicht mal jemand erklären, was zum Teufel da gerade passiert ist? Hat sonst noch einer diese komischen Schwingungen gespürt, kurz bevor sich Reaver in Spasti-Boy verwandelt hat?«
»Ja, ich. Das hat mir echt eine Heidenangst eingejagt. Ich kann’s immer noch fühlen.« Tayla rieb sich die Arme, als ob ihr plötzlich kalt wäre, und Eidolon zog sie beschützend an seine Brust.
Schmerz und ein Gefühl der Sehnsucht perlten durch eine alte Wunde auf. Gem war glücklich, dass ihre Schwester Liebe gefunden hatte, aber sie schaffte es einfach nicht, der Eifersucht ein Ende zu bereiten, die sich in ihr Herz geschlichen hatte, nachdem Kynan sie vor zehn Monaten verlassen hatte – gerade als sie endlich zueinandergefunden hatten.
»Ich auch.« Gem räusperte sich, um ihre Kehle von der Bitterkeit zu befreien, die in ihrer Stimme mitschwang. Es war nicht Taylas Schuld, dass Gem die Liebe ihres Lebens verloren hatte. »Irgendetwas regt sich in der Unterwelt.«
»Das gefällt mir nicht«, murmelte Eidolon. »Das könnte etwas richtig Übles sein.«
»Oder aber«, Shade verschränkte die Arme vor der breiten Brust, »es könnte überhaupt nichts sein.«
»Stimmt«, sagte Eidolon ironisch. »Schließlich hat Reaver bekanntermaßen öfter solche Anfälle und beginnt, in Zungen zu reden.«
Tayla löste sich von Eidolon. »Reaver hat etwas gesagt, das wichtig sein könnte. Für Wraith.«
E und Shade war ihre Anspannung anzumerken, und Gem zog an einem ihrer schwarz-pinkfarbenen Zöpfe. »Die Sache mit der gezeichneten Hüterin?« Als Tayla nicht antwortete, legte Gem ihrer Schwester eine Hand auf den Arm. »Tay?«
Tayla nickte. »In der Aegis erzählt man sich von … na ja, eigentlich sind es nur Gerüchte … von Menschen, die von Engeln gesegnet wurden. Niemand weiß, warum, oder ob es überhaupt wahr ist, aber es heißt, dass diese Menschen unbesiegbar sind. Unsterblich.«
»Und wie sollte das Wraith helfen?«, fragte Shade.
Tayla zögerte, bis sich Shade räusperte. Sie warf ihm einen entnervten Blick zu, ehe sie weitersprach. »Der Legende nach können gezeichnete Hüter ihren Segen an jemand anderen weitergeben.« Sie scharrte mit den Füßen. Offensichtlich war es ihr mehr als unangenehm, vertrauliche Geheimnisse der Aegis mit anderen zu teilen, selbst wenn es sich dabei um ihren eigenen Schwager handelte. »Wenn wir diese Serena Kelley finden könnten, dann hat Wraith vielleicht eine Chance zu überleben. Alles, was er dazu tun müsste, ist, ihr die Jungfräulichkeit zu nehmen.«
3
Gem und Tayla brauchten weniger als einen Tag, um Serena Kelley aufzuspüren, allerdings kostete ihre Entdeckung sie einen hohen Preis. Sie hatten einen Schamanen der Darquethoth konsultieren müssen, der sich sehr für diesen Menschen interessiert hatte, nachdem er einen Suchzauber gewirkt hatte. Zu sehr. Eidolon hatte das Gefühl, dass der Schamane den Aufenthalt des gesegneten Menschen nur zu gern dem höchsten Bieter verraten würde.
Wraith musste Serena auf der Stelle aufsuchen, da nicht nur sein Leben, sondern die Zukunft des ganzen Krankenhauses auf dem Spiel stand.
Aber bevor Eidolon seinen Bruder über all das in Kenntnis setzte, würde er erst noch eine kurze Unterhaltung mit Reaver führen, der sich von seinem Martyrium erholt hatte und bald entlassen werden würde.
E betrat Reavers Krankenzimmer gerade in dem Moment, als der tropfnasse Engel die Dusche verließ.
»Wir müssen uns über Serena Kelley unterhalten.«
Eidolon hätte schwören können, dass Reavers Hände zitterten, ehe er sie zu beiden Seiten seines Körpers zu Fäusten ballte. »Wen?«
»Diese gesegnete Menschenfrau, von der du uns gestern erzählt hast. Wir glauben, dass sie Wraith heilen –«
In der nächsten Sekunde hatte sich Reavers Faust in Eidolons Arztkittel verkrallt und den Dämon an sich herangezogen, sodass sich sein Gesicht nur wenige Zentimeter vor dem des gefallenen Engels befand. »Haltet Wraith fern von ihr.« Reavers Stimme war ein tiefes, gefährliches Knurren, aber die Schriftzüge an den Wänden – ein Schutzzauber gegen Gewalt – hatten nicht zu pulsieren begonnen, was bedeutete, dass er niemandem Schaden zufügen wollte.
Shade betrat den Raum. Angesichts Reavers Nacktheit hoben sich seine schwarzen Brauen. »Ich störe euch doch nicht etwa?«
Eidolon beantwortete Reavers erhitzten Blick mit einem eisigen. »Ich schlage vor, du lässt mich los«, sagte er kühl. »Sofort.«
Reaver trat mit einem Fluch zurück. »Eidolon, das darfst du nicht zulassen.«
»Wraith wird sterben.«
»Das tut mir leid.« Reaver zog sich eine Hose über. »Aber das hat er allein sich selbst zuzuschreiben. Serena ist unschuldig.«
»Er wird ihr nichts tun, er wird nur Sex mit ihr haben. Und du weißt, dass er sie nicht vergewaltigen kann, solange sie von dem Amulettzauber beschützt wird, also wird sie es freiwillig tun.«
Im Grunde genommen war das alles nur ein Bluff; Eidolon wollte bei dem gefallenen Engel auf den Busch klopfen. Die Informationen, die Tayla von der Aegis über gesegnete Menschen erhalten hatte, war zum größten Teil spekulativer Natur, aber bis jetzt schien es, als könnten sie sich darauf verlassen.
Reaver fuhr sich durch sein goldenes Haar und behielt die Hände dort, als müsste er seinen Kopf festhalten. »Warum sie? Es gibt ein halbes Dutzend gesegneter Menschen – warum nicht einer von denen?«
»Es gibt nur sechs von ihnen?« Als Reaver nicht antwortete, zuckte Eidolon mit den Achseln. »Du hast uns ihren Namen gegeben. Gem und Tay haben einen Schamanen aufgesucht, der einen Lokatorzauber ausgeführt hat. Sie hat geleuchtet wie eine billige Bierreklame.«
»Verdammt«, flüsterte Reaver. »Die Tarnung, die alle gesegneten Menschen vor den Augen der Dämonen verbirgt, wurde gebrochen. Das war es, was meinen … Anfall ausgelöst hat. Jemand will sie für etwas grauenhaft Böses benutzen.« Noch ehe Eidolon weitere Fragen stellen konnte, schüttelte Reaver den Kopf. »Ihr müsst Serena vergessen. Wraith darf sie nicht anrühren.«
Der hartnäckige Kopfschmerz, an dem E schon seit Tagen litt, kletterte noch eine Markierung weiter auf der Schmerzskala. »Das hast du nicht zu entscheiden.«
»Tut es nicht. Ich mein’s ernst, E. Sie braucht den Segen.«
»Wieso?«
»Weil«, sagte Reaver mit einer Stimme, die so kalt war wie ein Grab, »der Segen alles ist, was sie am Leben erhält. Wenn sie ihn verliert, stirbt sie.«
Reaver sah, wie Eidolons Gesichtszüge entgleisten. Shade sah einfach nur wütend aus, wie immer.
»Was zur Hölle meinst du damit, sie stirbt?«, fragte Shade schroff. »Geschieht das mit allen gesegneten Menschen, die ihren Segen aufgeben?«
Reaver hätte am liebsten keine ihrer Fragen beantwortet, hätte am liebsten über etwas derartig Geheiligtes gar nicht gesprochen, und am allerliebsten hätte er sich selbst kräftig in den Arsch getreten, dass er überhaupt den Mund aufgerissen und über gezeichnete Hüter gequatscht hatte. Die Existenz gesegneter Menschen war ein seit Jahrtausenden sorgsam gehütetes Geheimnis, und wenn es herauskam … Reaver drehte sich der Magen um.
»Beantworte die Frage.« E strahlte die typische Kaltblütigkeit des Rechtsprechers aus, was allerdings täuschte. Der Kerl geriet im Handumdrehen von unter null auf glühend heiß. Er war von den Judicia aufgezogen worden, Dämonen, die für die Rechtsprechung zuständig waren, und seine sachlich-kühle Veranlagung machte ihn nur umso tödlicher, da er sich nur selten von Gefühlen leiten ließ.
»Serena ist ein einzigartiger Fall.« Reavers Stimme klang kehlig; der Instinkt, den gesegneten Menschen zu beschützen, war etwas, das er einfach nicht unterdrücken konnte, auch wenn er das Recht dazu längst verwirkt hatte. Eigentlich durfte sich kein Engel in das Leben eines Hüters einmischen – jedenfalls nicht direkt. Diesen Job übernahmen deren menschliche Aegis-Wächter.
Er rieb sich die Schläfen, überlegte, wie viel er preisgeben sollte. An der Tatsache, dass irgendjemand ihre Tarnung hatte auffliegen lassen, konnte er nichts ändern, aber wenn er sie vor Wraith schützen wollte, sollte Reaver wohl besser an die medizinische Seite der Brüder appellieren – die Seite, die Leben rettete.
»Serenas Mutter, Patrice, war die Hüterin des Amuletts, bis Serena sieben Jahre alt war und Patrice es ihr überließ.«
»Augenblick mal«, unterbrach ihn Shade. »Patrice musste doch Jungfrau sein, oder? Dann war Serena also adoptiert?«
»Patrice war Jungfrau«, bestätigte Reaver, »aber sie war Serenas biologische Mutter. Sie wurde durch künstliche Befruchtung schwanger.«
Eidolon stützte sich mit der Hüfte am Waschbecken ab und beobachtete Reaver mit der Intensität eines Falken. »Woher weißt du das alles?«
»Wenn es auf der ganzen Welt nur eine Handvoll gesegneter Menschen gibt, dann weiß man über sie Bescheid«, sagte er, auch wenn das nicht die ganze Wahrheit war.
»Und warum wurde ihr diese spezielle Gabe zuteil?«
»Das spielt keine Rolle.« Reaver verriet den Dämonen sowieso schon viel zu viel. Eidolon und Shade waren für Dämonen wirklich anständige Kerle, aber wenn Reaver noch die geringste Hoffnung hegte, wieder in den Himmel aufgenommen zu werden, dann hatte er nicht vor, sich das zu vermasseln, indem er Dämonen gegenüber lebenswichtige Informationen ausplauderte. Er bewegte sich sowieso schon auf einem schmalen Grat – er hatte Umgang mit Dämonen, arbeitete in einem Dämonenkrankenhaus …
»Was hingegen sehr wohl eine Rolle spielt, ist die Tatsache, dass ein Mara-Dämon die Wahrheit über Patrice erfuhr, kurz nachdem sie auf die Welt gekommen war. Er biss Patrices Eltern … und Serena.«
Von einem Mara gebissen zu werden, war wirklich übel. Jeder von ihnen trug eine einzigartige Krankheit in seinem Körper, die durch einen Biss weitergegeben wurde, und nur dieser eine Dämon besaß das Gegenmittel für seine individuelle Krankheit.
»Er wollte den Segen im Austausch für das Heilmittel. Patrice stand vor einer grauenhaften Wahl, und sie entschloss sich, den Dämon zu töten. Mit dem Ergebnis, dass ihre Eltern monatelang schwer litten, ehe sie starben. Serena verbrachte einen großen Teil ihrer Kindheit in Krankenhäusern, aber die Ärzte dort konnten nichts für sie tun. Kurz vor ihrem siebten Geburtstag war ihre Zeit abgelaufen.« Reavers Stimme war rau von der Reise in die Vergangenheit. »Als klar wurde, dass Serena sterben würde, dass es für sie keine Heilung gab, überließ Patrice ihren Segen Serena, um sie am Leben zu erhalten –«
»Wie denn?«, unterbrach Shade. »Ich dachte, Sex wäre der Schlüssel.«
»Serena war ein Sonderfall«, sagte Reaver knapp. Die Wahrheit, dass dieser Transfer niemals hätte geschehen sollen, war etwas, über das er lieber nicht redete.
Oder nachdachte.
Shade verstand den Wink mit dem Zaunpfahl und lenkte die Unterhaltung in eine neue Richtung. »Und was ist passiert, nachdem Serena den Segen übernommen hatte?«
»Ihre Gesundheit verbesserte sich augenblicklich, aber sobald sie den Segen verliert, wird die Krankheit fortschreiten. Sie wird innerhalb von Tagen, vielleicht Stunden, sterben.«
»Oh, Mist«, murmelte Shade. »Wir können es Wraith nicht sagen.«
Eidolons dunkle Brauen schossen in die Höhe. »Er muss es wissen.«
»Wenn er es weiß, nimmt er ihr möglicherweise den Segen nicht ab.«
Reaver starrte sie an. »Reden wir hier über denselben Wraith, der alles und jeden fickt und aussaugt?«
»Wraith bringt keine menschliche Frau um.«
»Das ist mal ein Charakterfehler, mit dem ich wirklich nicht gerechnet habe«, murmelte Reaver.
»Wenn du dich dann besser fühlst – er macht eine Ausnahme bei weiblichen Aegis«, sagte Shade. Dann wandte er sich an E. »Sie ist nur ein Mensch. Ich weiß nicht, was der ganze Zirkus soll.«
»Deine eigene Gefährtin ist ein Mensch.«
»War ein Mensch. Inzwischen ist sie davon geheilt.«
Reaver verdrehte die Augen. Was für ein dämliches Argument. Werwölfe, sowohl gebürtige als auch gewandelte, besaßen menschliche Seelen und gehörten damit im Grunde genommen zu den Menschen. Genau wie Vampire, auch wenn das Schicksal ihrer Seelen etwas komplizierter war als das von Menschen, Wertieren und Gestaltwandlern.
»Findet einen anderen Weg, um Wraith zu heilen«, sagte Reaver, »denn ich werde nicht zulassen, dass das geschieht.« Es war ein Bluff; unter keinen Umständen war es Engeln, insbesondere gefallenen Engeln, gestattet, in das Leben eines gezeichneten Hüters einzugreifen.
Andererseits wäre es nicht das erste Mal für ihn. Er hatte genau das schon einmal getan, als er den Übergang des Segens von Patrice auf Serena erleichtert hatte.
Und hatte teuer dafür bezahlt.
Shade baute sich direkt vor Reavers Nase auf. »Wenn du es wagst, dich einzumischen, wirst du es bitter bereuen.«
»Du kannst mich nicht töten, Inkubus.«
»Aber ich kann’s zumindest versuchen. Und sollte es mir nicht gelingen, kann ich deinen traurigen Arsch immer noch in die Tiefen von Sheoul zerren, um ein bisschen ewigen Spaß mit dir zu haben.«
Schweiß erschien auf Reavers Schläfen. In diesem Moment steckte Reaver zwischen zwei Reichen fest; man hatte ihn aus dem Himmel geworfen, aber noch war für ihn nicht alles verloren. Ein gefallener Engel, der in der menschlichen Welt blieb, hatte immer noch eine Chance, in den Himmel zurückzukehren – aber einer, der Sheoul betrat, war für alle Zeit verloren.
»Shade.« Eidolon packte Shades dicken Bizeps. »Du gehst zu weit. Damit hilfst du niemandem. Wraith wird das Richtige tun.«
Wraith? Das Richtige tun? Reaver konnte nicht fassen, dass Eidolon das gerade gesagt hatte.
Reaver brachte sein Herz mit purer Willenskraft dazu, langsamer zu schlagen, damit er nicht nur das Rauschen des Blutes in seinen Ohren hörte. Ihm war vollkommen gleichgültig, ob Wraith nun überlebte oder nicht; ihm war sogar gleichgültig, ob Serena überlebte oder nicht, ganz egal, wie sehr sie ihm am Herzen lag. Denn hier ging es in Wahrheit nicht um ihr Leben oder ihren Tod.
Jeder gezeichnete Hüter wurde aus einem ganz bestimmten Grund gesegnet. Alle waren im Besitz eines Gegenstands, der für das Wohlergehen der Menschheit von entscheidender Bedeutung war.
Und das Objekt, das Serena besaß, war das Wichtigste von allen.
Shade ließ den Kopf hängen. »Dann sagen wir es ihm also. Die Götter mögen uns beistehen, wir sagen es ihm.«
Dunkelheit stürzte von allen Seiten auf Serena ein, so schnell wie die Dämonen, die sie umzingelten. Es waren insgesamt vier. Die hässlichen, krötenartigen Kreaturen, die ihr lediglich bis zur Taille reichten, hatten ihr aufgelauert, als sie den Wagen am Briefkasten vor dem Haupttor von Valerius Villa angehalten hatte.
Gestern hatte sie ihre gesamten Ersparnisse dafür ausgegeben, eine Zauberin zu bezahlen, um ihre Tarnung wieder instand zu setzen, aber offensichtlich hatte sich die Nachricht herumgesprochen.
Val hatte sie davon immer noch nichts erzählt. Es gab keinen Grund, es zu diesem Zeitpunkt zu tun, und außerdem war er sowieso nervös genug, nachdem innerhalb der Aegis, dessen getreues und hochrangiges Mitglied er war, ein Alarm ausgelöst worden war.
Val zufolge rüstete sich die Aegis für etwas, das sich ihrer Meinung nach als feindlicher Übergriff durch Dämonen erweisen konnte. Es hatte einen deutlichen Anstieg der Dämonensichtungen durch die normale menschliche Bevölkerung gegeben; außerdem häuften sich Auseinandersetzungen zwischen Dämonen und Aegis, bei denen die Menschen schwere Verluste hinnehmen mussten.
Bei ihren Bemühungen, sich gegen die wachsende Bedrohung zu stemmen, hatte die Organisation, die sich die Bekämpfung der Dämonen zum Ziel gesetzt hatte, ihre Standards für die Rekrutierung herabgesetzt und ehemalige Wächter in Alarmbereitschaft versetzt und darauf vorbereitet, zurückbeordert zu werden. Außerdem wurden aktuelle Mitglieder auf Forschungs- und Aufklärungsmissionen ausgesandt.
Serena juckte es in den Fingern, weil sie helfen wollte, und sie hegte die Hoffnung, dass Val ihr eine eigene Aufgabe übertragen würde. Nachdem sie eine Textnachricht von ihm erhalten hatte, in der er sie aufforderte, augenblicklich nach Hause zu kommen, konnte es endlich so weit sein, dass ihr Jucken gelindert würde.
Jedenfalls sobald es ihr gelungen war, sich diesen Dämonen zu entziehen. Ihre abscheulichen, riesigen Mäuler waren weit aufgerissen, sodass sie bis tief in ihre Rachen hineinspähen konnte. Die letzten Reihen scharfer Zähne verloren sich in ihnen. Ein erregtes Beben durchzuckte sie – sie erhielt nur selten Gelegenheit, mit einer solchen Situation fertigzuwerden. Ihre Spezialität war die Schatzjagd, und normalerweise bestanden ihre einzigen Herausforderungen in dicken Staubschichten, giftigen Insekten und der einen oder anderen Falle, sei sie physischer oder magischer Art.
Vermutlich sollte sie vorsichtig sein. Wenn ihre Tarnung versagt hatte, konnte sie sich möglicherweise auch nicht mehr auf ihren Segen verlassen, aber eigentlich glaubte sie das nicht.
Jeder Zauber, jeder Segen und jeder Fluch kann außer Kraft gesetzt werden. Wie oft hatte sie Val diese Worte mit seinem rumänischen Akzent sagen hören … Der Kerl war ernsthaft paranoid.
Einer der Dämonen stieß ein Zischen aus und stürzte sich auf sie. Sie schleuderte ihm ihre Handtasche mitten ins Gesicht, sodass er zurücktaumelte, wobei er zwei weitere Dämonen mit sich riss. Sie wirbelte herum, riss die Fahrertür des Landrovers auf und nietete damit den vierten Dämon um, der sich gerade über sie hermachen wollte. Eilig legte sie einen Gang ein und überfuhr die Dinger mit ihrem SUV, zerquetschte sie wie Ungeziefer.