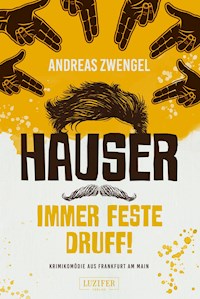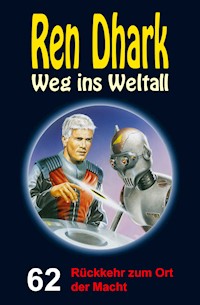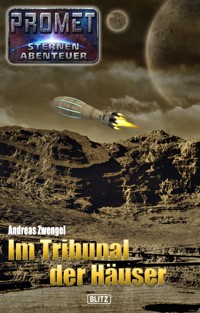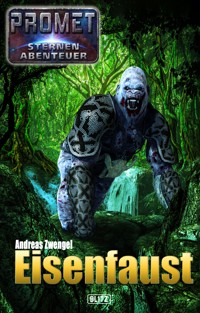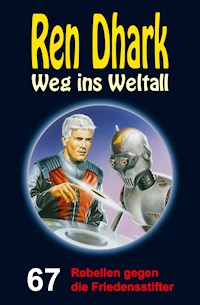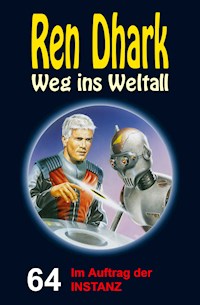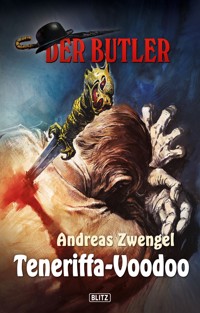Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Der Butler (Kriminalromane)
- Sprache: Deutsch
Nach den aufregenden Ereignissen der letzten Zeit hat sich Lady Marbely in ihr Haus auf Föhr zurückgezogen. Butler James versucht vergebens, sie aufzumuntern. Er weiß, dass sie eine Aufgabe benötigt, eine Herausforderung, die sie ablenkt.Im Führungsstab eines weltweit operierenden Verbrechersyndikats ist eine Stelle frei geworden. Gangster aus aller Welt wollen den Platz unbedingt besetzen. Sieben Aufgaben sollen über den geeigneten Kandidaten entscheiden. Unter den Bewerbern befindet sich auch eine reiche englische Lady, die gemeinsam mit ihrem Butler angereist ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DER BUTLERBand 10
In dieser Reihe bisher erschienen:
2401 J. J. Preyer Die Erbin
2402 J. J. Preyer Das Rungholt-Rätsel
2403 Curd Cornelius Das Mädchen
2404 Curd Cornelius Die Puppe
2405 Andreas Zwengel Die Insel
2406 Andreas Zwengel Die Bedrohung
2407 Andreas Zwengel Teneriffa-Voodoo
2408 Andreas Zwengel Das Haus Etheridge
2409 Andreas Zwengel Die Jäger
2410 Andreas Zwengel Die sieben Aufgaben
2411 Andreas Zwengel Tod dem Butler
2412 Andreas Zwengel Alte Schule
2413 Andreas Zwengel Dirty Old Town
Andreas Zwengel
DIE SIEBEN AUFGABEN
Diese Reihe erscheint als limitierte und exklusive Sammler-Edition!Erhältlich nur beim BLITZ-Verlag in einer automatischen Belieferung ohne Versandkosten und einem Serien-Subskriptionsrabatt.Infos unter: www.BLITZ-Verlag.de© 2022 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckNach einer Idee von Jörg KaegelmannRedaktion: Andreas ZwengelLektorat: Dr. Richard WernerTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerLogo: Mark FreierSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-514-2Dieser Roman ist als Taschenbuch in unserem Shop erhältlich!
Kapitel 1
Der Butler betrat das Wohnzimmer von Lady Marbelys Haus auf Föhr und riss erschrocken die Augen auf. Der Anblick vor ihm ließ ihn schwanken. Er hätte es kommen sehen müssen, die Anzeichen waren alle da gewesen. Er hatte sie nicht übersehen, sondern nur verdrängt und das Beste gehofft. Doch nun musste er erkennen, dass all seine Hoffnung vergebens gewesen war.
Der große Raum war erfüllt von Tschaikowskis Dornröschen, Myladys Lieblingsmusik aus ihrem liebsten Ballett. Der Butler kannte das Stück inzwischen gut genug, um ebenfalls daran Gefallen zu finden, auch wenn er noch nicht in der Lage war, die jeweilige Aufführung und das Orchester bestimmen zu können. Seine Arbeitgeberin besaß genügend Geld, um ein Symphonieorchester einfliegen zu lassen, damit es die Musik live in ihrem Wohnzimmer spielte, aber eine solche Geldverschwendung wäre ihr natürlich nicht in den Sinn gekommen. Da gab es bessere Verwendungsmöglichkeiten für ihr Vermögen. Zum Beispiel die Finanzierung der Privatorganisation Schattenchronik, deren Aufbau und Leitung der Butler bis vor Kurzem noch übernommen hatte. Bis er merkte, in welche Gefahr er die Menschen brachte, die ihm wichtig waren. Also in erster Linie Lady Marbely und ihr Mündel Claire Hendriksen. Also hatte er den Dienst quittiert und die Leitung der Schattenchronik seinen qualifizierten Partnern überlassen, um sich wieder ganz auf den Schutz von Mylady zu konzentrieren.
Es war Ironie des Schicksals, dass ihnen Claire gleichzeitig verkündete, die wahre Berufung ihres Lebens gefunden zu haben und zukünftig im Dienst der Schattenchronik gegen das Böse kämpfen zu wollen. Mylady war natürlich dagegen gewesen, wusste aber, dass sie die Entscheidung der jungen Frau nicht ändern konnte. Ihr blieb nur, sich noch mehr Sorgen um Claire zu machen. Lady Marbely hatte einige Einsätze der Schattenchronik miterlebt. Sie musste am Kampf gegen Fischwesen auf Föhr teilnehmen.1 Sie war in einem lebendigen Haus gefangen gewesen, das versucht hatte, seine Bewohner umzubringen.2 Und sie hatte ertragen müssen, wie Anschläge auf alle Helfer des Butlers verübt wurden, darunter auch ihr Mündel Claire, das ihr wichtiger war als alle anderen Menschen auf der Welt.3 Aus all diesen Gründen hatte sie genug von dieser permanenten Bedrohung gehabt. Doch auf den Rückzug folgte keine Entspannung. Stattdessen war Lady Marbely in ein tiefes Loch gefallen und hatte sich nach Föhr zurückgezogen, wo sie in Untätigkeit erstarrte.
Diese antriebslose Phase dauerte nun schon über zwei Wochen an. Lady Marbely war mit ihren einundsiebzig Jahren immer noch außerordentlich rüstig, doch neuerdings wirkte sie entkräftet und niedergeschlagen. Sie verbrachte ganze Tage trübsinnig im Haus, grübelte endlos und hörte dabei schwermütige Musik. Zum Frühstück nahm sie nur noch Obstsalat zu sich, und obwohl James ausschließlich ihre Lieblingsfrüchte anrichten ließ, stocherte sie nur gedankenverloren in der Schale herum.
Der Butler hatte sich in den letzten Tagen immer mehr um Mylady gesorgt, doch an diesem Morgen war der Tiefpunkt erreicht: Lady Marbely hatte sich auf dem Sofa zusammengerollt, leerte geistesabwesend einen Eisbecher und sah sich eine Seifenoper im Fernsehen an. Ihre gräulich-roten Haare waren aus der Form geraten, und ihre wasserblauen Augen hatten viel von ihrer Leuchtkraft verloren. Das allein war schon beunruhigend genug, aber was den Butler bei ihrem Anblick wirklich bis in seine Grundfesten erschütterte, war ihre Kleidung: Amanda Marbely trug ein Sweatshirt, mit dem Johann höchstens den Maybach poliert hätte, und eine Leggings. Eine Leggings! Ein geblümtes Stück Stoff, das keine eigene Form besaß und sich ganz seiner Füllung anpasste. Der Butler musste an einen Ausspruch denken, den man Karl Lagerfeld, Gott hab ihn selig, zuschrieb: Wer Leggings trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. James konnte nicht sagen, ob diese Aussage Allgemeingültigkeit besaß, aber auf Lady Marbely traf sie in diesem Moment leider zu.
„Mylady?“
„Schon gut, James, ich weiß schon, was Sie sagen möchten.“
„Mit Verlaub, das glaube ich kaum.“
Lady Marbely seufzte. „Sie wollen Ihre Verwunderung über mein Verhalten äußern, mir Ihr Missfallen über diese Bekleidung bekunden und Ihre Besorgnis über meinen Allgemeinzustand teilen.“
„Nun, in diesem Fall wissen Sie tatsächlich, was ich sagen möchte.“
„Gut, James, zur Kenntnis genommen. Möchten Sie noch etwas hinzufügen?“
„Nun, wenn Sie schon fragen und es nicht zu vermessen klingt: Sie verlassen Ihr Haus nicht mehr und empfangen keine Gäste. Ihre wenigen Sozialkontakte beschränken sich auf Lieferanten und die Menschen, die ihr Umfeld verwalten. Die Garage ist gefüllt mit teuren und schnellen Fahrzeugen, aber wir verlassen nie das Anwesen. Warum machen Sie nicht mal eine Spritztour oder laden sich ein paar Gäste ein? Oder wie wäre es mit einem Kinobesuch?“
Das Haus verfügte zwar über einen eigenen Kinosaal mit zehn äußerst komfortablen Sitzplätzen, aber alleine machte es dort keinen Spaß. Kinoatmosphäre entstand durch andere Menschen, auch wenn einem die Popcornwerfer, Chipsknusperer und Filmerklärer meist des Vergnügens beraubten.
„Müssen wir das schon wieder durchkauen?“, fragte Lady Marbely gelangweilt. „Ich habe hier alles, was ich brauche.“
„Das hat Howard Hughes sicher auch gesagt.“
„Lassen Sie mich allein, James!“, sagte sie in einem scharfen Ton, der keinen Widerspruch zuließ. Der Butler wertete dies sogar als ein gutes Zeichen. Immerhin schien sie noch über etwas Kampfgeist zu verfügen. Er fügte sich ihrer Anweisung und verließ das Wohnzimmer.
Der Butler zog sich in sein kleines Arbeitszimmer zurück, in dem er noch eine Menge seiner Unterlagen aus SSI-Zeiten aufbewahrte. Viele Jahre war er für den Spezial Service International tätig gewesen, bevor er seine dauerhafte Anstellung bei Lady Marbely angetreten hatte. Die schlagkräftige Organisation hatte ihren Sitz in London mit Niederlassungen auf der ganzen Welt. Die SSI arbeitete eng mit den meisten Geheimdiensten der Welt zusammen und wurde überall dort eingesetzt, wo sich niemand sonst die Hände schmutzig machen wollte oder die Risiken unkalkulierbar waren. Unter seinem echten Namen Richard Wallburg war er in Deutschland für den SSI tätig gewesen, wo er in enger Kooperation mit BND, BKA und MAD gearbeitet hatte. Manchmal dachte er noch an die aufregenden Zeiten zurück.
Der Butler verbrachte eine Stunde am Computer. Schließlich griff er sein Handy und wählte eine Nummer, die er schon eine ganze Weile nicht mehr angerufen hatte.
Kapitel 2
Burg Frankenstein lag auf dem Schlossberg, einem nördlichen Ausläufer der Bergstraße, südöstlich von Darmstadt. Neben der Burgruine lockte das Restaurant mit seiner beeindruckenden Aussicht über die Rheinebene die Besucher an. Der Saal war hoch und lichtdurchflutet, da sich in der oberen Hälfte rundum Panoramafenster befanden. Er bot einen angemessenen Rahmen für besondere Anlässe, und normalerweise konnten dort bis zu 150 Gäste bewirtet werden. Doch an diesem Tag gab es nur eine einzige Tafel für etwa fünfundzwanzig Personen.
Bei der kleinen Gruppe, die an diesem Tag den Saal gemietet hatte, handelte es sich weder um eine Hochzeitsgesellschaft noch um Literaturfreunde oder Gourmets. Offiziell fand eine geschäftliche Konferenz statt. Die Bezeichnung war nicht völlig falsch, aber sie kratzte nur an der Oberfläche.
Die Gäste standen paarweise im Saal zusammen, mit Ausnahme eines einzelnen Mannes, der mit einem freundlichen Gesichtsausdruck am Rand stand und beobachtete. Man hätte ihn für einen Leibwächter halten können, auch wenn er bereits etwas zu alt für eine solche Aufgabe erschien. Außerdem wirkte er auch nicht besonders Furcht einflößend. Der Name des Mannes lautete Maxwell Quiller, und man sah ihm weder seine Tätigkeit noch seinen Rang innerhalb des weltweit operierenden Syndikats an.
Quiller war die entscheidende Hürde zur Teilnahme an diesem Treffen gewesen, da er alle Bewerber überprüft hatte. Gesuchte Verbrecher und Clanchefs mit jahrzehntelanger Berufserfahrung hatten natürlich keine Probleme, die Zulassung zu bekommen. Schwieriger wurde es bei unbekannten Bewerbern und solchen, die bisher nicht durch kriminelle Tätigkeiten in Erscheinung getreten waren und sich erst noch beweisen mussten.
Die Anwesenden im Saal stellten die Auswahl aus 120 Bewerbungen dar, die Quiller hatte überprüfen müssen. Die Hälfte von diesen 120 wäre nicht einmal in die engere Wahl gekommen und hätte auch nicht von dem Treffen erfahren sollen. Doch auf verschlungenen Wegen war es natürlich trotzdem geschehen. Das lag daran, dass viele Verbrecher geschwätzig waren und entweder andere beeindrucken wollten oder jemandem einen Gefallen schuldeten und ihm im Gegenzug diesen wertvollen Tipp schenkten.
Quiller hatte nicht damit gerechnet, sein Vorhaben völlig geheim halten zu können, aber nach dieser Erfahrung hatte er die Sicherheitsvorkehrungen noch einmal erhöht. Von dem Treffen auf Burg Frankenstein wussten nur die zehn geladenen Teams. Wenn etwas durchsickerte, musste folglich einer der Teilnehmer das Leck sein.
Alle Wege zur Burgruine waren gesperrt worden. In der Zufahrt zum Parkplatz standen zwei gepanzerte Limousinen quer. Die vier Männer, die um die Fahrzeuge herumstanden, verhielten sich so bedrohlich, dass niemand wagen würde, sich zu beschweren.
Bisher war Quiller allen Gesprächen ausgewichen. Solange noch nicht alle Teams eingetroffen waren, wollte er keine Auskunft geben. Aber er beobachtete die Anwesenden ganz genau. Parteien aus verschiedenen Ländern waren eingeladen worden: Italiener, Griechen, Österreicher, Japaner, Dänen und Afrikaner. Viele bekannte Gesichter befanden sich darunter. Allen voran Mario Cucchini, ein Mafiapate der vierten Generation, der wie eine Karikatur wirkte. Er trug ausnahmslos schwarze Anzüge mit einer Rose im Knopfloch und strahlend weiße Hemden. Wenn er nicht aussehen würde wie ein langweiliger Buchhalter mit Essstörung, hätte er durchaus als Brando-Imitator durchgehen können.
Doch seine Vorstellung von einem Mafioso war noch unauffällig, verglichen mit der seines Sohnes Sergio, der wirklich alle Klischees in sich vereinte. Öliges Haar, Narbe auf der Wange und Nadelstreifenanzug. Man hielt unwillkürlich nach einem Geigenkasten Ausschau. Cucchini nippte an seinem Rotwein und betrachtete missbilligend seinen Sohn, der gerade sein zweites Glas zügig geleert hatte und sich schon wieder nachschenkte. Sergio trank zu viel, und wenn er betrunken war, neigte er dazu, seinen Vater zu beschuldigen, ihm keine Verantwortung für seine Geschäfte zu übertragen. Allerdings würde Cucchini Senior den Teufel tun und einem Trinker Verantwortung übertragen. Das nannte man wohl einen Teufelskreis.
Auf der gegenüberliegenden Seite des Saals stand Cucchinis alter Rivale Nikolos Pachis und tat so, als würde er die Anwesenheit des Italieners nicht bemerken. Der Grieche schien ebenfalls ein Vorbild für seine Aufmachung gewählt zu haben. Einen Landsmann, berühmten Reeder und Ehemann einer ehemaligen Präsidentengattin. Nikolos trug sein weißes Haar gegelt und streng nach hinten gekämmt. Zwischen den dünnen Strähnen war tief gebräunte Kopfhaut zu erkennen. Seine schwarze Sonnenbrille war so groß wie eine dieser Virtual-Reality-Brillen, die den halben Kopf verdeckten. In seinem Fall ging es aber eher darum, die Zeichen des Alters zu verbergen.
Der Grieche war in Begleitung seines Bruders Jannis erschienen. Ein Nachzügler in der elterlichen Familienplanung, deshalb wirkten sie optisch eher wie Vater und Sohn. Während der jüngere Pachis ein passionierter Sportler war und auf seine Ernährung achtete, was Nikolos ein ausgesprochener Genussmensch, der höchstens beim Essen ins Schwitzen geriet.
Zwei hochgewachsene Afrikaner traten ein und marschierten grußlos durch den Saal bis zur gegenüberliegenden Wand. Dort blieben sie stehen und drehten sich um. Sie grüßten niemanden und sahen auch keinen an. Ihre Blicke waren starr geradeaus gerichtet. In dieser Haltung warteten sie ab, was als Nächstes geschah, aber sie waren ganz eindeutig nicht hier, um neue Bekanntschaften zu schließen.
Den nächsten Kandidaten kannte Quiller nur von Fotos, aber der attraktive Mittvierziger sorgte auch stets dafür, dass genug Bilder von ihm im Umlauf waren. Valdemar Paulsen war ein dänischer Medienmogul, der seine illegalen Aktivitäten dadurch tarnte, dass er sie niemals publik werden ließ. Selbst wenn die Konkurrenzsender über einen Vorfall berichteten, streute Paulsen so viele Falschmeldungen in seinen eigenen Nachrichtensendungen und Zeitungen, dass irgendwann die eigentliche Meldung in Vergessenheit geriet oder zumindest völlig verfälscht worden war. Er verfügte über eine Unmenge nützlicher Kontakte. Jeder in der Branche schien ihm einen Gefallen zu schulden oder seine Gunst erlangen zu wollen. Sein Einfluss auf den europäischen Nachrichtenmarkt machte ihn zum aussichtsreichsten Kandidaten für eine Mitgliedschaft im Syndikat. Paulsen war zusammen mit seinem Neffen Malthe erschienen und hatte gleich einen spektakulären Auftritt hingelegt, indem er mit einem Helikopter in der Ruine gelandet war.
Nun betraten zwei riesige Gestalten den Saal und blieben im Eingang stehen, den sie dadurch komplett versperrten. Iwan und Mikail Renko waren eineiige Zwillinge. Die beiden Russen hatten sich als Schläger und Killer unter verschiedenen Paten nach oben gedient, bis sie Ambitionen entwickelten, selbst in die obere Führungsebene aufzusteigen. Trotz ihres Jobs galten die Zwillinge als umgängliche Kerle, die nur gegen Bezahlung aktiv wurden. Dann allerdings kannten sie keine Hemmungen. Gegen Cash würden sie jeden umbringen, den man ihnen wies. Deshalb lohnte es sich auch nicht, mit ihnen Freundschaft zu schließen, um sich sicher fühlen zu können. Die Friedhöfe waren voll mit Leuten, die sich für Freunde der Renkos gehalten hatten.
Maxwell Quiller wechselte seine Position im Saal und bewegte sich dichter an die japanischen Bewerber heran, die sich leise und in ihrer Muttersprache über die Konkurrenz unterhielten. Sie störten sich nicht an der Nähe ihres Gastgebers, da sie arrogant genug waren, zu glauben, dass niemand sie verstehen konnte.
Haruki Kento war ein Gangster, der auch international erfolgreich sein wollte. Er war zusammen mit seinem Sohn Maximus erschienen, dessen Name bereits die Ambitionen des Vaters verdeutlichte. Maximus selbst schien seinen Namen nicht sonderlich zu mögen und hätte wohl einen traditionellen japanischen Namen bevorzugt. Jedes Mal, wenn er mit seinem Namen angesprochen wurde, verzog er das Gesicht, als würde es ihm Schmerzen verursachen.
„Wer ist der Dicke?“, fragte Maximus und blickte zu einem korpulenten Mann im Maßanzug. Die gut geschnittene Kleidung schaffte es tatsächlich, das krankhafte Übergewicht recht vorteilhaft zu verhüllen. Der Mann sah dadurch nicht dünner aus, aber er machte einen stattlichen Eindruck.
„Das ist Alphonse Stegmueller aus Graz“, erklärte sein Vater. „Er betreibt eine Spezialistenagentur, die einen äußerst guten Ruf besitzt. Das unscheinbare Männlein neben ihm ist sein Assistent Burkhart. Ein schüchterner Typ, der meiner Meinung nach keinen ersichtlichen Nutzen bei diesem Treffen hat.“
Maximus grunzte. „Körperliche Fähigkeiten können es jedenfalls nicht sein.“
„Was ist das denn für eine lahme Veranstaltung?“, dröhnte eine Stimme vom Eingang des Saals.
Quiller lächelte innerlich. Die beiden Amerikaner legten Wert auf einen großspurigen Auftritt. Damit hatte er bereits gerechnet, als er die Namen der Bewerber gelesen hatte: Rex Baxxter und Tank Colorado. So hießen Wrestler oder Pornodarsteller, aber keine ernst zu nehmenden Geschäftsleute. Nicht einmal in Gangsterkreisen oder in Amerika.
Ähnlich dachten wohl auch die beiden Franzosen, die direkt hinter ihnen eintraten.
„Merde, muss man denn wirklich jedes Klischee erfüllen“, sagte der Ältere auf Englisch, damit die beiden bulligen Kerle es auch verstanden. Allerdings war sein Englisch so sehr Französisch eingefärbt, dass die beiden Amerikaner nicht einmal bemerkten, dass sie gerade in ihrer Landessprache beleidigt wurden.
Philippe und Adrien Moreau trennte ebenfalls ein großer Altersunterschied, aber in ihrem Fall hatte das seine Richtigkeit, denn bei ihnen handelte es sich um Großvater und Enkel. Enttäuscht über die ausbleibende Wirkung seiner Bemerkung umrundete der alte Moreau das amerikanische Team und steuerte die große Tafel in der Saalmitte an, an die sich noch niemand gesetzt hatte.
Als Quiller das letzte noch fehlende Team im Eingang bemerkte, begab er sich zum Kopfende der Tischreihe, um dort Platz zu nehmen.
Rex Baxxter, der kräftige Hüne mit dem Walrossschnurrbart, bemerkte ebenfalls die beiden Neuankömmlinge. Überrascht hob er die Augenbrauen, dann wandte er sich an die übrigen Anwesenden: „Los, sagt schon, wer von euch hat seine Mutter mitgebracht?“
„Soll das ein Scherz sein?“, wollte Tank Colorado wissen. „Da ist ein Butler! Ein echter Butler!“
Baxxter rief zu der älteren Dame hinüber: „Seid ihr zum Maskenball falsch abgebogen?“
Lady Marbely ließ sich davon nicht abschrecken und marschierte mit vorgereckter Brust durch die Männergruppe, die ihr amüsiert Platz machte. Der Butler folgte ihr.
„Im Ernst, Lady, Sie sind hier falsch“, versuchte einer der Russen, an ihre Vernunft zu appellieren.
„Das denke ich nicht“, erwiderte Lady Marbely und nahm an der Tafel Platz.
Kapitel 3
Die Burg befand sich auf der Spitze des Berges, am Ende einer Straße, die sich in engen Serpentinen den Steilhang hinaufschlängelte. Talwärts gab es Leitplanken, die nur an wenigen Stellen unterbrochen waren, wo Waldwege von der Straße abzweigten. In einer scharfen Kurve auf dem Kamm lag die Zufahrt zur Burgruine.
Es gab massive Sicherheitsvorkehrungen rund um Burg Frankenstein. Der Butler hatte an dem Kontrollpunkt den Tarnnamen von Mylady genannt, woraufhin die Wächter den Namen auf der Liste abhakten und den Weg freigaben.
Der Parkplatz lag erhöht und war nur über eine einspurige Rampe zu erreichen. Mehrere Reihen eingezeichneter Parkplätze standen zur Verfügung, aber niemand nutzte sie. Als er die hintere Tür öffnete, wunderte sich der Butler, wie leer der Parkplatz war, schließlich waren sie nicht früh genug, um die Ersten bei diesem Treffen zu sein.
Über den Bäumen konnten sie eine Turmspitze erkennen. Auf der rechten Seite des Parkplatzes führte ein Trampelpfad zwischen den Bäumen hindurch. Aber ein Hinweisschild wies zur linken Seite, wo Treppenstufen nach unten auf den offiziellen Weg führten, eine schmale asphaltierte Straße zur Burg. Rechts von ihnen ragten bereits ihre Außenwände bedrohlich empor.
„Diese Burg ist wirklich der Schauplatz der Frankenstein-Geschichte?“, fragte Lady Marbely zwischen zwei Schnaufern.
„Eher Ort der Inspiration“, erklärte der Butler. „Mary Shelley hat die Burg Frankenstein mehrmals besucht und fand in Johann Conrad Dippel das Vorbild für ihren Viktor von Frankenstein. Dippel wurde 1673 auf Burg Frankenstein geboren und war Anatom, Alchemist und Theologe. Die strenggläubige Landbevölkerung hielt ihn für einen Hexer, der mit dem Teufel im Bunde war. Wahrscheinlicher ist allerdings, dass es sich um einen hochintelligenten Menschen handelte, der seiner Zeit voraus war und Dinge sagte, die damals niemand hören wollte.“
Lady Marbely wollte etwas fragen, fand aber nicht genug Atem, also gab sie ihm mit einer Handbewegung zu verstehen, dass er fortfahren sollte.
„Neben diesen Herren sollen noch zwei andere Wissenschaftler für die Figur Pate gestanden haben. Nämlich Erasmus Darwin, der in Ingolstadt lehrte und dort Experimente mit Elektrizität und Leichen betrieb.“
Lady Marbely blieb stehen, als sie einen angelegten Aussichtspunkt erreichten. „War der Herr verwandt mit Charles Darwin?“
„Jawohl. Erasmus war sein Großvater.“
„Tatsächlich? Interessant. Und wer war der andere? Sie sprachen von zwei Wissenschaftlern.“
„Bei dem anderen handelte es sich um niemand Geringeren als Benjamin Franklin.“
„Der ja auch sehr bekannt für sein Interesse an der Elektrizität war.“
Der Butler nickte. „Alles Bestandteile für eine weltberühmte Geschichte.“
Lady Marbely und ihr Begleiter mussten feststellen, dass sie die Einzigen waren, die den offiziellen Parkplatz nutzten. Die anderen Gäste waren direkt vorgefahren. Rechts neben dem Eingangstor zur Burgruine parkte ein Hummer-Geländewagen, wohl aber nur aus dem Grund, weil er aufgrund seiner Breite nicht durch die Toröffnung passte. Hinter ihm stand ein Mini-Van mit dem Logo einer bekannten Mietwagenfirma.
Durch das Tor gingen sie direkt auf die Kapelle zu, die gerne für Trauungen genutzt wurde. Neben dem steinernen Gebäude standen zwei Motorräder. Rechts befand sich nun die Ruine, und nach links ging es zum Restaurant. Dort gab es sieben Parkbuchten, die laut Beschilderung für Brautpaare und Gehbehinderte vorgesehen waren. Momentan standen dort vier Fahrzeuge großzügig über die gesamte Parkfläche verteilt. Eine Mercedes-Limousine parkte neben einem Ferrari und einem Range Rover. Die übrige Fläche wurde von einem BMW eingenommen, der quer eingeparkt hatte, um sich ein Höchstmaß an Bequemlichkeit beim Ein- und Aussteigen zu sichern.
Ein Porsche stand direkt vor dem Restauranteingang auf dem gepflasterten Hof, sodass alle anderen Gäste an ihm vorbeimussten. Der Butler schaute zurück zum Brückenturm, dem eigentlichen Zugang zur Burg. Stirnrunzelnd erblickte er auf dem Innenhof der Kernburg einen Helikopter. Es handelte sich sicher nicht um einen offiziellen Landeplatz, aber diese Gäste setzten sich offenbar über jede bestehende Regelung hinweg.
Beim Betreten des Restaurants wurden sie von einer Angestellten in Empfang genommen und zum Saal geführt, wo sie sofort viel Aufsehen erregte.
Viele der Anwesenden gaben sich vordergründig freundlich und begrüßten sich wie alte Freunde, die sie nicht waren. Keiner von ihnen vergaß, dass sie an diesem Ort Konkurrenten waren. Neue Gesichter wurden misstrauisch gemustert. Auch wenn niemand offene Feindseligkeit zeigte, herrschte doch eine wachsame Atmosphäre. Erst durch das Erscheinen von Lady Marbely änderte sich die Stimmung etwas, denn die ältere Dame löste pure Verblüffung aus.
Ihr Gastgeber bat alle, an der Tafel Platz zu nehmen. Tischkarten wiesen ihnen den Weg. Quiller blieb am Kopfende stehen, bis sich alle gesetzt hatten, und stellte sich anschließend den Anwesenden auf Englisch vor: „Mein Name ist Maxwell Quiller, Ihr Gastgeber bei diesem Treffen.“ Er machte eine Pause, als würde er auf Applaus warten. „Sie haben sich beworben, um die freigewordene Stelle im Syndikat zu besetzen. Unter allen Mitbewerbern waren Sie nach unserer Meinung die aussichtsreichsten Kandidaten. Dazu darf ich Sie alle beglückwünschen.“
„Oh ja, wir sind alle Gewinner“, höhnte Rex Baxxter.
„Dabei sein ist alles“, sagte Valdemar Paulsen und verriet durch seinen Tonfall, wie viel er vom olympischen Gedanken hielt.
„Verraten Sie uns lieber, für wen Sie sich entschieden haben“, rief Sergio Cucchini ungeduldig und erntete dafür viel zustimmendes Gemurmel.
„Und weshalb wir alle herkommen mussten“, knurrte Haruki Kento, der wohl die weiteste Anreise gehabt hatte. „Ein Anruf hätte doch ausgereicht.“
Das war das richtige Stichwort, um alle zu Wortmeldungen zu veranlassen.
„Ich hätte Besseres mit meiner Zeit zu tun, als hier unverrichteter Dinge wieder abzureisen“, sagte der ältere Grieche.
Mario Cucchini, der ihm am Tisch gegenübersaß, grinste. „Warum bist du dann überhaupt gekommen, wenn du eh nicht damit rechnest, ausgewählt zu werden?“
Sein Sohn grinste ebenfalls. „Hättest du uns doch vorher gefragt, wir hätten dir sagen können, dass du nicht gewinnst und zu Hause bleiben kannst.“