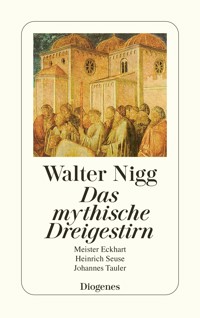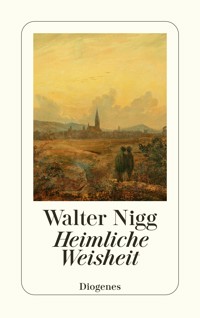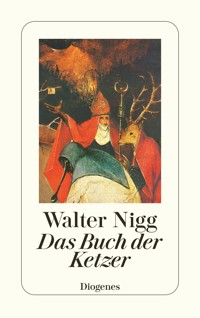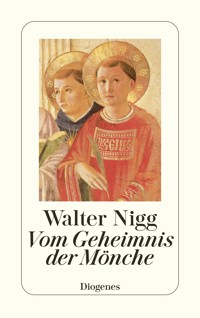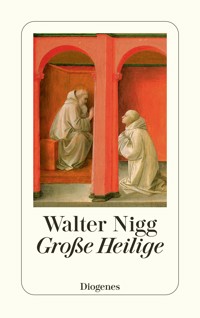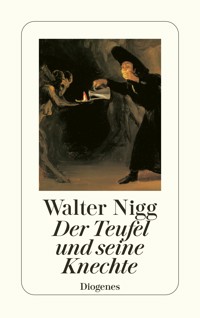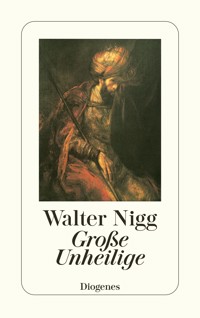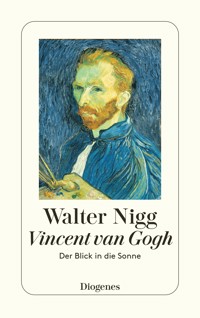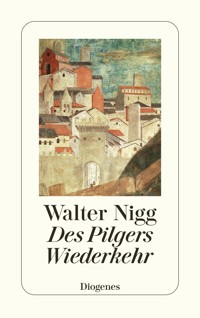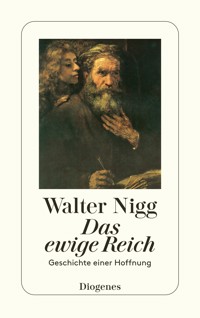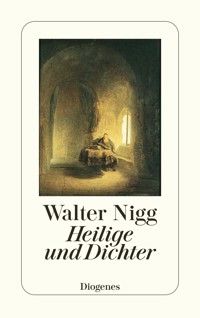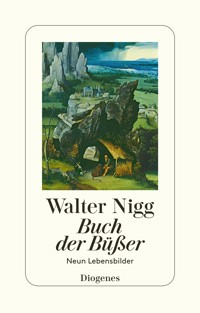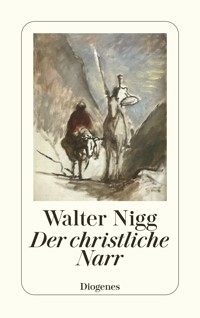
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Das Menschenbild der Antike war der Weise. Salomo, Lao Tse und Konfuzius, sie alle verherrlichten den weisen Menschen. Unvergänglich ist das Hohelied, das Plato über den Weisheitsliebenden angestimmt hat. Das Christentum entthronte die Weisheit und lobte den heiligen Narren. Diese Umwälzung hielt nicht lange an. Der christliche Narr mit seinem Hinweis auf die Übervernunft taucht aber immer wieder auf. An ausgewählten Beispielen zeigt Walter Nigg das dramatische und zugleich beglückende Leben christlicher Narren: Erasmus von Rotterdam (›Das Lob der Torheit‹), Ordensstifter Philipp Neri und Heinrich Pestalozzi. Beispielhaft in der Literatur sind Miguel de Cervantes' ›Don Quixote‹ und Dostojewskijs ›Idiot‹.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 787
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Walter Nigg
Der christliche Narr
Von Symeon von Edessa bis Dostojewski
Diogenes
Verstehst du diese Schrift nicht, so mache es nicht wie Luzifer; nimm nicht den Geist der Hoffart zur Hand mit Spotten, sondern suche das demütige Herz Gottes; das wird dir ein kleines Senf körnlein vom Gewächse des Paradieses in deine Seele bringen, und so du in Geduld verharrest, so wird ein großer Baum daraus werden. Wie du wohl denken magst, daß es diesem Autor auch ergangen ist; denn er ist gar eine einfältige Person gegen die Hochgelehrten zu achten. Jakob Böhme
AUFTAKT Vernunft und Übervernunft
Das Altertum kannte noch ein Bild des Menschen. Es war nicht nur von der Frage nach Sinn und Ziel des Menschenlebens bedrängt, es besaß auch eine Antwort auf dieses Problem. Das damalige Bild vom Menschen hatte die Bedeutung eines richtunggebenden Vorbildes, dem die junge Generation nachstreben konnte. Ein solches Ideal gab der alten Welt eine feststehende Norm, die sich als eine erzieherische Hilfe erwies.
Unsere Gegenwart besitzt kein voranleuchtendes Menschenbild mehr und ist deswegen in geistiger Beziehung so schwer zu ertragen. Pseudobilder von Rennfahrern und Filmstars haben das wahre Vorbild überdeckt, eine Verdrängung, die nicht unwesentlich zur Verwirrung der modernen Zeit beigetragen hat. Auf das emporstufende Bild des Menschen verzichten, bedeutet soviel wie Klärung und Richtlinie preisgeben. Dieser Verlust, mit anderen Motiven zusammen, verursachte die Verfinsterung der neuzeitlichen Situation.
Das Menschenbild der Antike war der Weise. Die alte Welt hat das Vorbild des weisen Menschen mit mannigfachen Färben geschildert und es der heranwachsenden Jugend in anspornendem Sinne vor Augen gestellt. Der abgeklärte Mensch, der seine dumpf-dunkle Drangperiode überwunden hat und durch viele Erfahrungen des Lebens zur Reife gelangt ist, der einen wirklichen Schatz von Weisheit in seinem Herzen gesammelt und ihn auch seinem ratlosen Nächsten mitgeteilt hat, ist in seiner geistigen Ruhe eine überaus erfreuliche Erscheinung. Es ist eine Gabe des Himmels, wenn sich die Besonnenheit auf einen Menschen herabsenkt und er alle Dinge in ruhiger Überlegung abwägt und nicht mehr in verblendeter Leidenschaft dahinjagt. Der Weise, der aus überlegener Sicht heraus des Daseins buntes Spiel zu deuten vermag, kann in seiner appollinischen Haltung nicht anders denn als eine erhabene Gestalt bezeichnet werden, zu der man in Verehrung und Liebe emporschaut. Ihm im verworrenen Leben zu begegnen, bedeutet ein ebenso freudiges wie seltenes Ereignis von innerem Gewinn. Der Weise ist ein Phänomen, das nicht als eine Selbstverständlichkeit hingenommen werden darf. Er bildet die Krönung menschlichen Werdens, die frohe Dankbarkeit verdient.
Das Bild des Weisen findet eine beredte Schilderung in den Sprüchen Salomos. Die altjüdische Spruchweisheit fordert den Menschen unaufhörlich auf: «Erwirb Weisheit, erwirb Einsicht! Vergiß es nicht und weiche nicht vom Wort meines Mundes »(4, 5). Sie preist den weisen Menschen mehr denn Korallen, und er wird nach ihrem Dafürhalten durch alle Kleinodien nicht aufgewogen. In einem geradezu beschwörenden Ton redet die ewige Weisheit in den Sprüchen Salomos:
So höret denn auf mich, meine Söhne,
höret auf Mahnung, daß ihr weise werdet,
und schlaget sie nicht in den Wind!
Wohl dem Menschen, der auf mich höret,
wohl denen, die meine Wege einhalten,
an meinem Tor wachen Tag für Tag
und meine Türpfosten hüten!
Denn wer mich findet, der findet das Leben
und erlangt Wohlgefallen beim Herrn. (8,32–35)
Es ist unrichtig, die Sprüche Salomos lediglich der philiströsen Hausbackenheit zu bezichtigen. Sie enthalten das Vorbild des Weisen, und es ist gewiß nicht zufällig, daß der spürsinnige Friedrich Christoph Ötinger seine heilige Philosophie aus der alttestamentlichen Spruchweisheit entwickelt hat, die er auch die «rufende Weisheit auf der Gasse» nannte.
Die Verherrlichung des weisen Menschen findet sich auch bei den alten Chinesen. Unvergeßlich ist das Loblied der Lebensweisheit, das Laotse in seinem Tao-Te-King dem Berufenen in den Mund legt, mit dem niemand anderer als der Weise gemeint ist:
Wahre Worte sind nicht schön,
schöne Worte sind nicht wahr.
Tüchtigkeit überredet nicht,
Überredung ist nicht tüchtig.
Der Weise ist nicht gelehrt,
Der Gelehrte ist nicht weise.
Der Berufene häuft keinen Besitz auf.
Je mehr er für andere tut,
desto mehr besitzt er.
Je mehr er andern gibt,
desto mehr hat er.
Des Himmels Sinn ist segnen, ohne zu schaden.
Des Berufenen Sinn ist wirken ohne zu streiten.1
Die östliche Religionsphilosophie besitzt eine wahre Fundgrube tiefschürfender Weisheit, die jedem Menschen zum unvergeßlichen Erlebnis wird. Konfuzius verdichtet die ostasiatische Lebensweisheit zu einer Form, die den Menschen direkt der ewigen Harmonie entgegenführt. Die chinesischen Weisen wußten um das bedeutsame Verharren in der Mitte, eine kostbare Wahrheit, die ihre Gültigkeit besitzt, solange Menschen auf dieser Welt leben.
Das Ideal des Weisen trieb in Hellas eine seiner schönsten Blüten. Unvergänglich ist das Hohelied, das Plato über den Weisheitsliebenden angestimmt hat, welcher die Wahrheit zu schauen begehrt. Solange die Philosophen nicht Könige werden, ist nach dem großen Denker Griechenlands keine gute Staatsführung zu erwarten. Der Stoiker mit seiner Selbstbeherrschung, der die Affekte gebändigt und sich die Leidenschaftslosigkeit erkämpft hat, ist eine Variation des Weisen. Auch der Stoizismus kennt den vollkommenen Menschen, der in innerer Freiheit über alle äußeren Dinge triumphiert. Er war unabhängig und besaß in der antiken Welt ein unantastbares Ansehen. Seine Strahlungskraft erlosch erst in der werdenden Neuzeit. Das Vorbild des Weisen, der die ungesunden Extreme vermeidet und überlegen Maß hält, ist von geschichtlicher Größe. Noch heute ist er als ausgeglichener Mensch eine edle Gestalt von bezwingender Anziehung. Zum Verständnis des Weisen bedarf es keiner Geheimwissenschaft, er trägt die einleuchtende Wahrheit in sich selbst. Wer ihn zum Vorbild wählt, beschreitet sicher den Weg des Lebens; die Ruhe überträgt sich auf ihn und kommt seinem eigenen Dasein zugute. Augustin bekannte einmal aus dieser Überzeugung: «Ich liebe die Weisheit ganz allein um ihrer selbst willen, alles übrige aber, Leben, Ruhe, Freunde, wünsch ich nur ihretwegen zu besitzen und fürchte ihretwegen den Verlust2.»
Der Leitstern, dem der weise Mensch unablässig folgt, ist die Vernunft. Im Gegensatz zu dem von seinen Trieben gehetzten Menschen strebt der Weise nach einer klaren Ratio, die ihm auf allen Lebenswegen voranleuchtet. Ihr leiht er sein Ohr, sie hat von ihm Besitz ergriffen, und ihren Anweisungen gehorcht er als einer Führerin. Der weise Mensch ist der vernünftige Mensch, der über die Dinge des Lebens allezeit nachdenkt und dem nichts Unberechenbares innewohnt. Nie kommt die Größe des Verstandes stärker zur Geltung, als wenn man sich mit der Weisheit beschäftigt. Der Vernunft ist alle diffuse Gefühligkeit und alle ruhelose Leidenschaft fremd, sie besitzt die Klarheit des Kristalls. Allezeit wahr bleibt Platos Ausspruch, daß den Menschen kein größeres Unglück treffen könne, als ein Verächter der Vernunft zu werden. Es gibt auch eine von Gott erleuchtete Ratio, der der religiöse Mensch eine hohe Bedeutung beimißt. Wird der Verstand beiseitegesetzt, so hört alles sinnvolle Reden zwischen den Menschen auf. Er ist eine herrliche Gabe Gottes, die der Verfasser der «Pensées» ins richtige Licht gesetzt hat: Das Denken macht die Würde des Menschen aus. Es wäre unweise, die Vernunft zu übersteigern, anstatt dem Worte Matthias Claudius’ zuzustimmen: «Wer die Vernunft kennt, verachtet sie nicht. Sie ist ein Strahl Gottes, und nur das radikal Böse hat ihr die himmelblauen Augen verderbt. Aber es schwebt noch um den blinden Tiresias etwas Großes und Ahnungsvolles, und sie hat, wie der König Lear, auch wenn sie irre redet, noch die Königsmiene und einen Glanz an der Stirn3.» Natürlicherweise sucht der denkende Mensch nach vernünftigen Gründen für seine Überzeugung. In ihm meldet sich auch das Bedürfnis, den religiösen Glauben dem Verstande annehmbar zu machen. Einer mit Hilfe der Vernunft begründeten Darlegung der Religiosität kann die Berechtigung nicht bestritten werden, zumal wenn sie um die Grenze ihres Tuns Bescheid weiß. Bei aller Verständigkeit maßt sich die Vernunft des Weisen nie an, allein darüber zu entscheiden, was in religiöser Hinsicht angenommen werden kann und was nicht.
Zu dem geschichtlichen Zeitpunkt, da der von der Vernunft beherrschte Weise auf der Höhe seines Ruhmes und Glanzes angelangt war, trat das Christentum in die Welt und bewirkte eine der tiefgreifendsten Umwälzungen in der Weltgeschichte. Gleich in seinen Anfängen führte es eine ungeheuerliche Tat aus: die Entthronung der Weisheit! Fortan sah man im weisen Menschen nicht mehr das leuchtende Vorbild, und man erschrickt zutiefst über diese gewaltige Umdrehung. Unfaßlicheres hat sich selten ereignet. Diese christliche Umwertung bedeutet für die Geistesgeschichte eine revolutionäre Tat von gewaltigem Ausmaß. Das absolut Neue, das mit dem Christentum in die Welt gekommen ist, wird dem Menschen durch den Sturz des Ideals des Weisen eindringlich bewußt. Das Christentum steht im Widerspruch zu allen vorangegangenen Geschichtsepochen, was aus der prinzipiellen Umkehrung der antiken Auffassung von Weisheit und Torheit besonders deutlich hervorgeht.
Die neue Lebenshaltung führt geradewegs auf den Stifter des Christentums zurück. Jesus Christus selbst hat hierin die entscheidende Bresche geschlagen. Aus seinem Munde stammt das alle bisherigen Wertungen auf den Kopf stellende Wort: «Ich preise dich, Vater des Himmels und der Erde, daß du solches den Weisen und Klugen verborgen hast, und hast es den Unmündigen geoffenbart» (Mt.II, 25). Rätselvoller Ausspruch, der den Einfältigen dem Verständigen vorzieht. An Unbegreiflichkeit steht er um nichts hinter Jesu Antwort an die Pharisäer zurück: «Die Zöllner und Dirnen kommen vor euch in das Reich Gottes» (Mt. 21,31). Was mag das wohl sein, das den Verständigen unzugänglich bleibt, dafür aber den Kindern geschenkt wird? Christi Lobpreis hat, wenn man ihn nicht gedankenlos überfliegt, etwas Aufreizendes an sich, er wirkt wie ein Peitschenhieb gegen alle theologischen Hochschulen und philosophischen Doktoren, die noch nie das Geheimnis dieses überrationalen Ausrufes nur annähernd zu erklären vermochten. Die Verherrlichung des Unmündigen reißt einen wahren Abgrund auf, und aller intellektuelle Scharfsinn stürzt hinab. Jesu Jubelruf, daß die Klugen ausgeschlossen sind und die Einfältigen bevorzugt werden, deutet eine neue, bisher völlig unbekannte Seinsordnung an.
Christus hat noch ein anderes Wort gesprochen, das im Hinblick auf die Weisheit dieser Welt unverständlich ist. Von jeher hat sich der gesunde Menschenverstand gleich an der ersten Seligpreisung gestoßen, die den «geistlich Armen» das ewige Reich zuerkennt (Mt. 5,3). Sie konnte nicht anders denn als Hohn auf alle Bildung empfunden werden, will man in ihr nicht sogar ein hohes Lob der Einfalt sehen. Der auf sein Wissen stolze Mensch kann keine stärkere Abwertung erfahren: «Selig sind, die da geistlich arm sind; denn das Himmelreich ist ihrer.» An Stelle des Gescheiten wird der Einfältige gepriesen, der nicht über viele Geistesgaben verfügt und den alle Welt bis dahin gering geachtet hat. Man begreift das unergründliche, empörende Wort von den «geistlich Armen» rational nicht. Es hat bei den Intellektuellen immer nur Kopfschütteln erregt und oft gar innere Erbitterung herausgefordert. Sie mühten sich und kamen sich dabei erst noch verhöhnt vor. Jesus Christus ordnet ihnen kurzerhand die geistlich Armen über und stellt die Klugen stillschweigend auf die Seite, eine Bevorzugung, die alle menschlichen Werte außer Kurs setzt.
Entsprechend diesen umstürzenden Worten war auch der unfaßliche, beinahe ans Unheimliche grenzende Eindruck von Jesu Persönlichkeit auf seine unmittelbare Umgebung. Der Menschensohn sprach mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten, er sprengte alle Vorstellungen, und seine Zuhörer konnten ihn nicht in ihre Weltanschauung einordnen. Es ging von ihm ein Schrecken aus, den Petrus beim wunderbaren Fischzug empfand, und wer den nicht verspürt hat, ist wohl noch nie in die geistige Nähe des Menschensohnes gekommen, der nicht nur Worte sprach, wie sie noch nie vernommen wurden, sondern sich selbst außerhalb des vernünftigen Seins stellte.
Im Leben Christi gab es eine Szene, die in dieser Beziehung von bedrängender Dramatik war. Jesu Predigttätigkeit erfüllte seine Angehörigen nicht mit Stolz, im Gegenteil, sie mißtrauten seinen Reden und waren eher darauf bedacht, ihn heimzuholen; dies um so mehr, als sie unter dem niederschmetternden Eindruck standen: «Er ist von Sinnen» (Mk. 3,21). Offenbar benahm sich Jesus nicht so vernünftig, wie sie es für schicklich hielten. Ihnen schien es, der Wahnsinn sei bei ihm ausgebrochen, ein furchtbares Urteil, das nicht ganz zu jenem harmlosen Idyll der heiligen Familie paßt. Man darf diese tragische Begebenheit nicht schnell überschlagen und sie mit einer nur vorübergehenden Trübung des Verhältnisses von Jesus mit seinen Angehörigen verkleistern. Dieses Vorgehen entspricht einer wässerigen Bibelerklärung ohne Sinn für das umwälzende Wirken Jesu, das den Hohenpriester veranlaßte, seine Kleider zu zerreißen! Durch die verräterischen Worte «er ist von Sinnen» schimmert noch heute das Antlitz jener himmlischen Narrheit hindurch, die allezeit das Dasein des Normalbürgers über den Haufen warf und vor der man sich noch heute am besten so schnell als möglich in Sicherheit zu bringen sucht.
Den gleichen unfaßlichen Eindruck bekamen die Menschen auch von den ersten Jüngern. Als die in Jerusalem versammelten Apostel das Pfingstwunder erlebten und sich im Hause ein noch nie gehörtes Brausen erhob, während der Geist gleich Feuerflammen auf die Jünger fiel, da wußten die Draußenstehenden nicht, wie sie den einzigartigen Vorgang deuten sollten. Bestürzt und verwundert, begriffen sie das Sprachenwunder keineswegs, denn es bot sich ihnen nicht die geringste Vergleichsmöglichkeit, und sie standen deshalb vor einem restlos unerklärlichen Ereignis. Das pfingstliche Geschehen erweckte bei ihnen keinen erbaulichen Eindruck, der ihm fälschlicherweise in späteren Jahrhunderten zugesprochen wurde. Das ungewöhnliche Gebaren der Jünger fiel aus dem Rahmen des Gewohnten. Die verblüfften Zuschauer waren vor den Kopf gestoßen und wußten mit der Geistesausgießung nichts anzufangen. In ihrer Verständnislosigkeit kamen die Männer von Jerusalem schließlich zu der banalen Schlußfolgerung: «Sie sind voll süßen Weines» (Ap. 2, 13). Trunken schienen ihnen diese enthusiastischen Menschen zu sein, obwohl es doch erst die neunte Stunde des Tages war. Diese Vermutung war ein fataler Kurzschluß: die Bürger von Jerusalem verwechselten den Geist mit dem Weingenuß. Geistige Trunkenheit verzückte die Jünger, die ganz benommen taumelten. Der spöttische Ausdruck «voll süßen Weines » deutet ihr unfaßliches Benehmen an, das sich nicht im gleichen Raum vollzog wie das anderer Leute, die der Vernunft verschrieben waren. Dermaßen elementar wirkte sich das ursprüngliche Pfingstereignis in unmittelbarer Nähe aus. Wie der innerlich Unbeteiligte darüber urteilen muß, hat Nietzsche mit brutaler Ehrlichkeit ausgesprochen, als er das Urchristentum mit einer Welt verglich «wie aus einem russischen Roman, in der sich der Auswurf der Gesellschaft, Nervenleiden und kindliches Idiotentum ein Stelldichein zu geben scheinen».
Als Paulus nach seinem visionären Damaskuserlebnis, das den Hasser in einen Liebenden verwandelte, zu der Urgemeinde kam, wurde auch er von der geistigen Trunkenheit überwältigt. Der ehemalige Schüler Gamaliels geriet in einen hinreißenden Enthusiasmus. Er hat sich in seinem Leben mehr als einmal benommen, als wäre er ein Tor. Diesen Eindruck gewannen jedenfalls seine Mitmenschen, und mit Recht, gehörte doch Paulus an die Spitze der christlichen Narren. Anläßlich einer seiner Reden rief Festus voller Entsetzen aus: «Paulus, du rasest, deine große Gelehrsamkeit macht dich verrückt (Apg. 26, 24).» Mit einer unmißverständlichen Deutlichkeit hat der jüdische Landpfleger dem unheimlichen Gefühl Ausdruck gegeben, das die damaligen Weltmenschen gegenüber den ersten Christen empfanden. Die Apostel flößten mit ihrer Raserei diesen Leuten ein undefinierbares Gemisch von Bewunderung und Abscheu ein, sie schienen ihnen verrückt, und Schauder vor diesem himmlischen Wahnsinn ergriff sie unwillkürlich.
Der Völkerapostel verbarg die Geisttrunkenheit in seinen Briefen keineswegs. Im Gegenteil, er scheute sich nicht, seinen Lesern die alle bisherigen Auffassungen umstürzenden Worte zu schreiben: «Niemand betrüge sich selbst. Welcher sich unter euch dünket weise zu sein, der werde ein Narr in dieser Welt, daß er möge weise sein» (I.Kor. 3,18). Man traut im ersten Moment seinen Augen nicht und glaubt falsch gelesen zu haben. Und doch steht die erstaunliche Parole schwarz auf weiß im Neuen Testament und beruht auf keinem Druckfehler. Die erschreckende Aufforderung war Paulus überaus wichtig, denn ganz bewußt fährt er weiter: «Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott» (I.Kor. 3,19). Es ist merkwürdig, wie wenige Christen das Ungeheuerliche dieser Aussage auch nur spüren und daß ein diesseitig gebundener Mensch wie Goethe kommen mußte, der mit ablehnender Gebärde erklärte: «Es wäre nicht der Mühe wert, siebzig Jahre alt zu werden, wenn alle Weisheit der Welt Torheit wäre vor Gott.» Vielleicht lohnt sich auch tatsächlich dieses Alter nicht, und jedenfalls ändert Goethes mißbilligender Ausruf nichts daran, daß das Paulinische Wort dem Geist des Urchristentums entspricht. Die ärgerniserregende Losung, ein Narr in der Welt zu werden, wirkte wie Dynamit und brachte den ganzen Bau der antiken Weltauffassung krachend zum Einsturz. Einmal bei diesem zentralen Thema angelangt, bedrängt der bis in den dritten Himmel entrückte Paulus mit einem ganz befremdlichen Tone seine betroffenen Leser: «Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weltweisen? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn dieweil die Welt, durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch törichte Predigt selig zu machen, die daran glauben» (I.Kor. 1,20 und 21).
Es geziemt sich, bei diesen Worten innezuhalten. Wer den ersten Korintherbrief unvoreingenommen und nicht als ein erbauliches Spruchkästlein liest, wird ihn als hochnotpeinlich empfinden. Stellt er sich diesen Worten wirklich, dann schlagen sie allem, was der normale und vernünftige Mensch zu denken gewohnt ist, was er für richtig hält und was ihm liebenswert erscheint, direkt ins Gesicht, es wird ihm schwarz vor den Augen, und er muß nach Atem ringen. Sie lösen einen regelrechten Schock aus, liest man sie unvorbereitet und nicht gewohnheitsmäßig. Diesen Stoß in die Herzgegend muß einer fühlen, es sei denn, er habe die revolutionäre Tragweite nicht verstanden oder die Paulinischen Worte alsogleich in ein frommes Papier eingewickelt, wodurch sie unwirksam werden. Diese tiefgründigen Gedanken von der christlichen Narrheit spotten aller Theologie und Philosophie, sie lassen sich schlechterdings nicht mit irgendeiner logisch aufgebauten Weltanschauung vereinbaren. Statt zu sagen, was man selbst auch schon immer gedacht hat, flammt in Paulus ein Wahrheitsfunke auf, der alles in eine neue Beleuchtung rückt. Seine Ausführungen greifen das Bollwerk dieser Welt an und unterminieren alles Bestehende. Der Aufruf, ein Narr zu werden, ist keine nebensächliche Bemerkung des Apostels, die ihm in einem unbedachten Moment entschlüpft ist; er führt geradewegs in die tragende Mitte der christlichen Botschaft.
Die radikale Neuheit von Paulus' Aufforderung, «ein Narr in dieser Welt zu werden», wird einem bestürzend bewußt, vergleicht man sie mit den Sprüchen Salomos über den Narren. In der Spruchsammlung, die sich in der gleichen Bibel befindet wie der Korintherbrief, wird der Narr stets als abschreckendes Beispiel dem Weisen gegenübergestellt, wodurch ein Kontrast von unerhörter Schärfe entsteht. Dem Narren soll man nicht nach seiner Narrheit antworten, damit man ihm nicht gleich werde (26,4). Der Narr ist in den Proverbien des Alten Testamentes der törichte Gegenspieler des Weisen, dem die große Liebe des jüdischen Verfassers galt. Doch ist es ein ungleiches Spiel, das sie miteinander spielen, denn ein Weiser und ein Narr verhalten sich zueinander wie Tag und Nacht. Der Narr ist der Affe des Weisen, er bildet in jeder Beziehung den negativen Abdruck zum Vorbild des weisen Menschen. Nach der Meinung der altjüdischen Spruchweisheit ist der Narr ein hoffnungsloser Fall, der nicht von seiner Torheit läßt, selbst wenn man ihn in einem Mörser mit einem Stößel wie Grütze zerstampfte (27,22). Der Narr ist die abschreckende Karikatur des Menschen, vor dem der Verfasser der Sprüche Salomos nicht genug warnen kann. In seiner eitlen Schwatzhaftigkeit redet der närrische Mensch so viel, daß nicht zehn Weise ihm zu antworten vermöchten. Die Sprüche Salomos werden nicht müde, mit beredten, überaus eindringlichen Worten vor dem Narren zu warnen, dem beim besten Willen nicht zu helfen sei, hierin Georges Bernanos ähnlich, der ebenfalls immer wieder mit heiligem Eifer auf die heutigen Dummköpfe zu sprechen kommt. Ein törichter Sohn bildet seiner Mutter Herzeleid, und doch vermag sie ihn mit allem gütigen Zureden nicht zu ändern, weil es in seinem Wesen liegt, daß er ein Narr bleibe sein Leben lang.
Paulus scheut sich nicht, ausgerechnet diese negative Bewertung des närrischen Gesellen ins Gegenteil umzukehren. Er wagt es, dem Narren einen positiven Wert zu verleihen, und erhebt ihn zu einem der Grundgedanken der neutestamentlichen Verkündigung: «Wir sind Narren um Christi willen» (1.Kor. 4,10). In dieser kühnen und überkühnen Aussage enthüllt sich das verschleierte Antlitz des Evangeliums, in ihr werden jene Worte auf den Dächern gepredigt, die Christus seinen Jüngern ins Ohr geflüstert hat. Ein neues, nicht leicht zu begreifendes Selbstverständnis des Christen keimt auf und schließt doch eine der tiefsten Bestimmungen der Nachfolge Christi in sich. Die Proklamierung der evangelischen Narrheit bringt das große Umdenken, zu dem Jesus seine Zuhörer um des hereinbrechenden Reiches willen aufgefordert hat, auf eine lapidare Formel, die Gültigkeit hat für Zeit und Ewigkeit. Wer das Christentum nicht mit konventionellen Augen betrachtet, sondern ihm auf den Grund kommen will, der muß die Paulinische Ausführung über den Narren in Christo zum Gegenstand einer eingehenden Meditation machen. In ihr schaut man, um eine unschöne, aber zutreffende Formulierung Nietzsches zu gebrauchen, dem Christentum direkt in den Bauch. Was man bei dieser ungewöhnlichen Blickrichtung Außerordentliches zu sehen bekommt, schlägt alle üblichen Vorstellungen zu Boden: der neue Mensch des Christentums ist kein Ausbund kluger Verständigkeit, er pocht als Narr an die Tore dieser Welt! Unheimliche, abgründige Wahrheit, vor der man schaudernd zurückbebt und die nur durch die Ahnung erträglich gemacht wird, daß der Narr in Christo eine ohne Vergleichsmöglichkeit dastehende charismatische Erscheinung ist. Die meisten heutigen Christen haben von seiner Existenz nicht mehr die geringste Kenntnis, geschweige denn einen Begriff von der christlichen Narrheit als einer Torheit eigenster Art und höherer Ordnung, deren Erreichung unendlich viel Mühe kostet und die nicht allen zugänglich ist.
Alles kluge Reden und alles feige Ausweichen hilft nichts gegen die eine Tatsache: das ursprüngliche Christentum war vom Willen zur Narrheit erfüllt. Das jesuanische Lob der Einfältigen wirkt sich wie ein seelischer Aufstand der Ungelehrten gegen die sich wissend dünkenden Pharisäer aus. Doch hat diese Erhebung nichts mit dem einfachen Mann aus dem Volke zu tun. Jegliche demokratische Tendenz liegt der neutestamentlichen Verherrlichung der Schwachen und Unbegabten völlig fern. Die Paulinische Umwertung aller Werte tendiert auf eine neue Rangordnung, die sich auf einer gänzlich andern Ebene vollzieht. Der christliche Narr lebt in der urtümlichen Verwirklichung des Evangeliums, das bei ihm noch nicht zu einem lendenlahmen Ersatzgebilde entartet ist. Wer sich dieser heiligen Torheit schämt, ist offenkundig nicht geschickt zum Reiche Gottes. Wie beunruhigend, daß der Christ, gleichsam mit einer Schellenkappe angetan, über diese Erde schreitet, verlacht und verspottet von den Weltkindern. Aber diese Narrheit gehört zur Andersartigkeit des echten Christen, der allezeit bei dem normalen Menschen ein Befremden erregt, das sich bis zur Anstößigkeit und Ablehnung steigert. Wo diese närrische Haltung vertuscht wurde und die laugewordenen Christen vor allem darauf bedacht waren, ihre pfiffige Weltklugheit unter Beweis zu stellen, da ging eine der wichtigsten Einsichten des Evangeliums verloren.
Der christliche Narr mit seiner inneren Stimme ist der Übervernunft verpflichtet. Übervernunft ist nicht Unvernunft. Nur zu oft wurde sie damit verwechselt und deswegen zugleich auch verkannt. In der Übervernunft steckt, wie schon das Wort sagt, auch Vernunft, aber sie übersteigt den gesunden Menschenverstand beträchtlich und kann von ihm in der Regel gar nicht begriffen werden. Ebenso eindeutig ist der Unterschied zwischen Übervernunft und Irrationalismus. Während das Irrationale, zum Prinzip erhoben, gerne in eine gefühlige Unklarheit abgleitet, wohnt der Übervernunft der ewige Logos inne. Tertullian war einer der ersten nachneutestamentlichen Menschen, die das Übervernünftige des Christentums mit einer föhnartigen Klarheit gesehen haben. Aus seiner Feder stammen die Worte: «Gottes Sohn ist gekreuzigt worden – ich schäme mich dessen nicht, gerade weil es etwas Beschämendes ist. Gottes Sohn ist gestorben – das ist erst recht glaubwürdig, weil es eine Torheit ist; er ist begraben und wieder auferstanden – das ist ganz sicher, weil es unmöglich ist4.» Man schüttelt im ersten Moment den Kopf über diese närrische Formulierung, und doch muß man zugeben, daß sie beinahe im Neuen Testament stehen könnte. Die Entschlossenheit, mit der sich Tertullian von den Fesseln der gewöhnlichen Vernunft befreite und zur Übervernunft vorstieß, grenzt an Erleuchtung. Bei aller Lust zur paradoxen Formulierung ist die aufreizende Äußerung des afrikanischen Kirchenvaters doch ein Zeugnis von der närrischen Denkweise der Christen. Die Übervernunft der christlichen Narrheit hat es mit dem lebendigen Glauben zu tun, dem die gewöhnliche Vernunft allezeit widerstrebt. Ihr religiöses Anliegen besteht in der Betonung der rationalen Unfaßlichkeit des Christentums. Das Evangelium ist eine Botschaft, die sich jenseits der Ratio bewegt. Das Christentum ist tief von dem alogischen Rest überzeugt, der nach Peter Wusts Formulierung gerade «den eigentlichen Grundkern des Seins ausmacht»5. Es vertritt auch eine Logik, eine religiöse Logik allerdings, die das Gebiet des Verstandes weit überschreitet und von der die Logik der Wissenschaft völlig verschieden ist. Die Quellen des Evangeliums liegen nicht im Bereich des Vernünftigen. Sie können mit dem Verstand wohl umspielt, aber nicht restlos begriffen werden. Diese überrationale Seinswirklichkeit ist geistig derart mächtig, daß man sich ihr nur schwer entziehen kann, ist man einmal in ihre Nähe gekommen. Sie hat auch ihre Süßigkeit, die noch tausendmal herrlicher ist als die Freude am natürlichen Erkennen. Die Übervernunft besitzt eine unbegreifliche Seligkeit für den, der in täglicher Verbundenheit mit ihr lebt. Vor allem bedarf es eines besonderen Organes, um sie überhaupt wahrzunehmen: es ist die wundersame Einfalt des Herzens!
Denkt man an die christliche Narrheit mit ihrer geheimnisvollen Übervernunft, so erhebt sich alsobald die Frage: Was hat die Christenheit aus dieser Anweisung zur göttlichen Torheit gemacht? Wie hat sie auf die ungewöhnliche Forderung des Neuen Testamentes reagiert?
Nur ungern, denn es ist auch gar zu betrüblich, gibt man auf diese Frage die einzig ehrliche Antwort: Die Christenheit hat die Aufforderung, ein Tor in dieser Welt zu werden, in Bälde wieder vergessen. Nach wenigen Jahren schon hat sie die einzigartige Losung in den Wind geschlagen, und anstatt sich der Übervernunft blind anzuvertrauen, ließ sie sich immer mehr in einen unerlaubten Schwatz mit der gewöhnlichen Vernunft ein. Die Christen hatten in ihrer Entwicklung nichts Eilfertigeres zu tun, als die christliche Narrheit in einen Winkel abzuschieben, wo ihrer nicht geachtet wurde und sie unbemerkt vermoderte. Da sie nicht mehr gelebt wurde, verstaubte sie zusehends, man sprach schließlich nicht mehr von ihr, und auf diesem Weg galt sie zuletzt als erledigt. Auch die göttliche Torheit gehört zu den Seinsforderungen, die in der Christenheit verschüttet wurden, die gar nie zum richtigen Grünen und Blühen kamen, wodurch sich die Christen um etwas vom Seligsten brachten, das einst in ihrer Mitte leuchtete. Durch dieses Vergessen der Paulinischen Parole wußte die große Mehrzahl der Christen von dieser übervernünftigen Haltung nichts mehr oder bewertete sie höchstens als eine sonderbar spaßige Kuriosität, über die man mit einer wegwerfenden Handbewegung schnellstens zur Tagesordnung hinwegging. Wie ferne die Christenheit schließlich dieser neutestamentlichen Lebenseinstellung rückte, zeigt das Werk von Adelung, «Geschichte der menschlichen Narrheit»6, das im Zeitalter der Aufklärung erschien und eine Reihe von Mystikern, Heiligen, Gottsuchern, Theosophen, Chiliasten usw. behandelt, die alle dem biederen Leser als abschreckende Beispiele vor Augen geführt werden. Adelung, der sein mehrbändiges Werk anonym herausgab, betrachtete die christlichen Gestalten als Charlatane, Schwärmer, Querköpfe und philosophische Unholde, die er als Schädlinge der Menschheit anprangerte. Nicht die leiseste Ahnung stieg in ihm auf, daß er mit seinen schmähenden Worten über die Gottesliebhaber gegen das Christentum selbst schrieb. Welch einer kleinlichen Denkweise huldigte doch Adelung, der alles, was sein aufklärerisches Gehirn nicht verstehen konnte, kurzerhand als menschliche Narrheit verhöhnte, vor deren Ausschweifungen er die Leute warnte und damit unfreiwillig dartat, wie das rein vernünftige Verstehen in der Regel zum Ersatz für die verlorenen metaphysischen Werte wird. So weit war die Christenheit mit ihrem Vergessen der christlichen Torheit gekommen, daß sie die Wahrheit in das Gegenteil verkehrte und es nicht einmal merkte.
Obschon die Christenheit alles daran setzte, ihren aus der Übervernunft stammenden Ursprung zu vergessen – vollständig gelang ihr diese Bemühung doch nicht. Immer wieder wurde sie, ob sie wollte oder nicht, an die christliche Narrheit gemahnt. Von Zeit zu Zeit meldete sich der christliche Narr in ihrer Mitte, und sie mußte widerstrebend und gruselnd seine umwertende Botschaft hören. Er ließ sich trotz allen Bemühungen auf die Dauer weder unterdrücken noch ausschalten. Eine seiner vornehmsten Aufgaben besteht darin, die Menschen an die Übervernunft des Evangeliums zu erinnern. Von diesem erregenden Erinnern berichten die nachfolgenden Blätter in historischer Form, obschon ihre Intention letztlich nicht geschichtlich ist. Es geht ihnen weder um eine unterhaltsame Zerstreuung noch um ein ausgefallenes Thema, das noch niemandem in den Sinn gekommen ist. Bloße Paradoxien aufzustellen, die den Leser lediglich verblüffen, wäre sinnlos. Dies alles käme einem geistlichen Sport gleich, der in der bedrohten Weltstunde der abendländischen Selbstauflösung in keinerlei Weise gerechtfertigt wäre. Vielmehr ist die verdeckte Wahrheit vom Einfältigen auszugraben, von ihren Schalen zu reinigen und als die unumgängliche Voraussetzung aller christlichen Seligkeit aufzuzeigen. Es ist freilich nicht möglich, eine lückenlose Geschichte der christlichen Narrheit zu schreiben, weil es hierin kaum eine Kontinuität und Tradition im üblichen Sinne gibt. Der christliche Narr taucht mit seinem Hinweis auf die Übervernunft immer wieder auf und verschwindet so rasch als er gekommen ist. Man steht bei ihm beinahe vor einer geschichtslosen Geschichte, um diesen widerspruchsvollen Begriff zu gebrauchen. Der christliche Narr ist kaum einzufangen und kann nur in skizzenhafter Weise umkreist werden. In seiner Erscheinung läßt sich weder Wandlung noch Entwicklung feststellen, wie es sonst zum Geschichtsprozeß gehört. Einzig einige Momentaufnahmen, die wie Blitzlichter aufleuchten und gleich wieder erlöschen, können von seinem Leben gegeben werden. Dieser eine Augenblick jedoch erhellt das Dasein des Menschen und bringt dem Leser zum Bewußtsein, was in der Geschichte stets durchbrechen möchte und bis jetzt nur in den seltensten Momenten durchgebrochen ist. Die Darstellung der ebenso aufwühlenden wie hintergründigen Geschichte der christlichen Narrheit bleibt notwendig ein fragmentarischer Versuch, der zu einer Lektüre zwischen den Zeilen auffordert. Sie ist weder um der Wissenschaft im Sinne neuer Forschungsergebnisse noch um der «Erbaulichkeit auf hoher Ebene» willen verfaßt worden, sondern will als dritte Möglichkeit die rein religiöse Thematik von Vernunft und Übervernunft zur Sprache bringen.
Der christliche Tor beweist erneut mit unwidersprechlicher Anschaulichkeit der Menschheit, daß sich das Christentum nie und nimmer in einer bürgerlichen Rechtschaffenheit und weltlichen Klugheit erschöpft. Zwar wurde das Christentum schon früh in eine gut funktionierende Organisation verwandelt, und die Notwendigkeit dieser Entwicklung ist historisch nicht schwer einzusehen. Gleichwohl ist das Evangelium in seinem Wesen das Gegenteil von jeder anstaltsmäßigen Institution. Wo immer es mit der bürgerlich-gesellschaftlichen Denkweise identifiziert wurde, hat man das Christentum verraten. Es wurde bis zur Unkenntlichkeit plattgewalzt und sank in diesen säkularisierten Formen zu einem Spottgebilde herab. Gegen diese für das Christentum verhängnisvoll verlaufende Degeneration erhebt der christliche Narr, der auf eine Wiederherstellung des Ursprünglichen gerichtet ist, seinen leidenschaftlichen Protest. Mit aller Entschiedenheit verneint er das Christentum als eine Sache der bourgeoisen Gesinnung, mit der man Karriere machen könne und die dem Geltungstrieb des Menschen zur Befriedigung seines Ehrgeizes diene. Ein heiliger Zorn lodert in ihm gegen die alles ertötende Mittelmäßigkeit der offiziellen Christlichkeit. Für den christlichen Narren ist das Christentum keine poesievolle und gemütsinnige Zugabe zum Leben, recht für sentimentale Weihestunden des Daseins oder als Beruhigungspille gegen eine seelische Gleichgewichtsstörung. Die in der Geschichte der Christenheit in allen Variationen anzutreffende unglückselige Verquickung von Evangelium und Weltsinn, bei der man unermüdlich Geld zusammenscheffeln, eine hochelegante Dame, ein gefeierter Generalissimus und zugleich ein frommer Christ sein kann, ist ein Lügengespinst, das der christliche Narr mit einer wilden Gebärde zerrissen hat. Er macht all diesen gesellschaftlichen Verunstaltungen, die so viel zum Niedergang des Christentums beigetragen haben, ein resolutes Ende. Es ist wahrhaftig nicht ein Geringes, wird man durch den christlichen Narren ein für allemal von diesen karikaturähnlichen Ausprägungen einer entarteten Evangeliumsauffassung befreit.
Erregend am Auftreten des christlichen Narren ist sein tiefes Selbstverständnis, das ihn seine eigene Person als jenes Schlachtfeld begreifen läßt, auf dem die Vernunft und die Übervernunft ihren metaphysischen Kampf ausfechten. Es ist der Vernunft eigentümlich, den Anspruch auf die oberste Norm alles Lebens zu erheben. Diesem Maßstab haben sich auch die Christen in der Neuzeit allzu bereitwillig gebeugt. Der neue Sachlichkeit-Stil, der marxistische Materialismus, der westliche Existentialismus, die sozialistische Planwirtschaft usw. sind alles nur verschiedene Ausdrucksformen des konsequent durchgeführten Rationalismus, der das Abendland überflutet hat und das eigentliche Thema der Neuzeit wurde. Man hat die Vernunft zum obersten Prinzip erhoben, und dadurch ist der moderne Mensch mit dem Christentum in Konflikt geraten, um nicht zu sagen, mit ihm zerfallen. Der strikte Rationalismus hindert ihn zu glauben oder gestattet ihm nur, ein bis zur Vernünftigkeit kahlgeschorenes Christentum anzunehmen, wie es im englischen Deismus erstmals proklamiert wurde. Gegen die ausschließliche Herrschaft der Vernunft setzt sich der christliche Narr zur Wehr. Nicht indem er die Ratio ablehnt, das wäre ein zu einfaches Verfahren, zumal der Narr nicht weniger als alle andern Menschen die Vernunft in sich hat, von der man sich nicht kurzerhand befreien kann, was auch in keiner Weise wünschbar wäre. Aber der Narr nimmt sie auch nicht als eine undiskutierbare Gegebenheit hin, der er sich wortlos beugt, sondern setzt ihr die Übervernunft entgegen, der er ein viel größeres Vertrauen entgegenbringt. Vernunft und Übervernunft sind in ihm vorhanden und liegen miteinander in ununterbrochenem Streit. Der christliche Narr hat die zweideutige Weltklugheit der modernen Pseudochristlichkeit erkannt und läßt es nicht zu, daß man alles der kurzsichtigen Ratio unterstellt und einfach ausscheidet, was mit ihr nicht übereinstimmt. Die Vergötterung der Klugheit, wie sie in der Gegenwart geübt wird, ist auch nach Kierkegaard der Götzendienst der modernen Zeit. Die bloße Verständigkeit führt zuletzt unweigerlich zur Empörung gegen das Unbedingte. Der vom Geist der Narrheit erfüllte Christ empfindet die rationalistische Haltung auf religiösem Gebiet als eine unerträgliche Tyrannei, die er im Namen des Christentums in sich selbst niederringt. Es ist die Sprache des christlichen Narren, wenn Leo Schestow sagt: «Gehorchst du der Vernunft, so erhältst du eine strenge Wissenschaft, entfernst dich aber unendlich weit von den Wurzeln aller Dinge. Willst du aber die Wurzeln aller Dinge, das heißt, gibst du zu, daß das Allerwertvollste sich dort befindet, wo diese tieferen Wurzeln verborgen liegen, so mußt du auf die Vernunft und auf die Hoffnung verzichten, jemals zu der vollen Gewißheit zu gelangen, daß das, was du für Wurzeln hältst, in der Tat Wurzeln sind7.» Scheinbar eine närrische Alternative, und doch rührt sie an das Entweder-Oder, von dem der Christ nie loskommt. Wenn es im alltäglichen Leben schon tausend unerklärliche Dinge gibt, die auf die Übervernunft hinweisen, wie erst dann in religiöser Hinsicht. Da die Rechnung der Welt nie aufgeht, verkündet der christliche Narr: die Übervernunft ist mehr als die Vernunft, die nicht zum obersten Gesetz gemacht werden darf, dieweil sie sich sonst als ein Ersticker des Geistes auswirkt. Im Überrationalen besteht die Seligkeit des Christentums, es allein stellt die Verbindung mit dem Göttlichen her. Nur diese Einstellung hat mit dem Christentum etwas zu tun, und allezeit wissen die Narren mit Pascal, daß der Philosophie spotten wahrhaftig philosophieren heißt.
Der Ringkampf zwischen Vernunft und Übervernunft im christlichen Narren weist auf seine eminent wichtige Position hin. Der Form nach muß die christliche Narrheit als eine Demonstration verstanden werden, die absichtlich, um nicht übersehen zu werden, ihre törichte Haltung so auffallend unterstreicht. Ihrem Inhalt nach aber ist der Narr ein Entblößter, der sich freiwillig dem Gelächter der Welt preisgibt und damit eine eindrucksvolle Realisierung des Evangeliums erstrebt. In diesem Bemühen tritt der innerste Kreis seines Wollens hervor; es braucht Mut, Demut, Tapferkeit und Unbekümmertheit dazu. Die Narren in Christo vertreten eine kühne Verwirklichung des Christentums, das sie nie nur als lammfromme Erbaulichkeit auffassen. Sie haben die Paulinische Aufforderung, ein Narr zu werden in dieser Welt, buchstäblich und nicht bloß geistig verstanden, wodurch sie allein die Kraft zu ihrer außerordentlichen Lebenshaltung bekamen. Der christliche Narr ist aus den üblichen Ordnungen der menschlichen Gesellschaft herausgebrochen, ohne sich gleich einem Einsiedler vom Leben des Nächsten zu trennen. In seiner Abgelöstheit, die nie eine völlige Abgeschiedenheit wird, ist er eine therapeutische Gestalt, sein Bestreben ist auf Heilen und Heiligen gerichtet, und er tut es auf eine ungewohnte Weise. Schon durch seine Bezeichnung «Narr in Christo » zeigt er, in welcher Nähe und in wessen Dienst er steht. Sein Sinnen kreist eindeutig um das zentrale Thema der Realisierung des Evangeliums, so daß sein inneres Wissen immer zugleich ein Gewissen ist. Er will die christliche Lebensführung verkörpern, er trachtet darnach, das evangeliumgemäße Verhalten in beinahe übersteigerter Form und mit solch vehementem Nachdruck zu betonen, daß es nicht länger übersehen werden kann. Der religiöse Tor lebt das christliche Dasein wieder im Zustand der Erniedrigung, eine Situation, von der es nicht abgetrennt werden kann, da es weder mit Prunk noch mit Macht etwas zu tun hat. Wer diese Realisierung des Evangeliums nicht achtet, erliegt nur zu leicht der Gefahr, den Sinn des Christentums überhaupt zu verfehlen. Christ sein heißt, in einem fortwährenden närrischen Ringen um den Durchgang durch die enge Pforte zu kämpfen. Furcht und Zittern begleiten diese restlose Bereitschaft, das Christliche bis ins Letzte in sein Leben hineinzunehmen. Allezeit schreitet der christliche Narr über das gewöhnliche Maß hinaus, immer will er für das Göttliche wirklich glühen. Es ist gelebte Heiligkeit, was ihn erfüllt. In seinem Leben wird das Christwerden zu einem geistigen Abenteuer, in das sich der aufgeschreckte Mensch stürzt. Für ihn ist die neutestamentliche Lösung: «Stellet euch dieser Welt nicht gleich» (Röm. 12, 2) keine theoretische Angelegenheit. Was das Evangelium verkündet, kleidet er nicht in abstrakte Sätze, es gibt bei ihm weder System noch Lehre, die er in der Form einer wissenschaftlichen Untersuchung doziert. Alles Christliche ist bei ihm Leben, ist praktische Daseinsgestaltung und anschaubare Realität. Wer diese Unmöglichkeit nicht oft inmitten allem Seligkeitsgefühl wiederum als eine drückende Last empfindet, versteht das Evangelium wohl kaum. Man kann das Christentum nur außerordentlich und ungewöhnlich leben. Der religiöse Tor hat diese Wahrheit erfaßt, er sprengt das übliche Dasein und lebt es mit all seinen Worten und Taten in bestürzender Weise. Wie der leidenschaftliche Christ durch die Gesellschaft hindurchschreitet, wie er von der Welt abgelöst und doch mit ihr fürbittend verbunden ist, führt der christliche Narr inmitten der menschlichen Existenz in solcher Vorbildlichkeit aus, daß der brennenden Frage nach seinem Geheimnis nicht mehr ausgewichen werden kann.
Selbstverständlich kann der christliche Narr seiner Sendung nur als Einzelner nachkommen. Eine ganze Gesellschaft von Toren wäre unerträglich und würde nur zu bald in einen Karneval ausarten. Nur ein Einzelner kann es sich leisten, so ganz anders zu sein als die andern, als ein Außenseiter aus der Reihe zu tanzen, indem er an sein bürgerliches Dasein gleichsam Hand anlegt und darüber hinwegschreitet. Man ist immer, volkstümlich ausgedrückt, ein «Narr auf eigene Faust», aber doch stets im göttlichen Auftrag und niemals aus persönlicher Willkür.
Vielleicht erhebt sich die irrtümliche Annahme, daß ein solches Narrendasein ausschließlich der Vergangenheit angehöre. In der alten und mittelalterlichen Kirche sei wahrscheinlich eine solch wundersame Figur noch möglich gewesen, sicher aber nicht mehr in der Gegenwart. Heutzutage sei das Leben eines christlichen Narren undurchführbar, auf der Stelle würde die Polizei eingreifen und einen derartigen Menschen sofort der Irrenanstalt übergeben. Es kann sein, daß dem so geschehen würde, was jedoch nichts anderes als ein erneuter Beweis von der Selbstauflösung des christlichen Abendlandes wäre. Gleichwohl ist der christliche Narr auch in der modernen Zeit nicht auszurotten. Er gehört so wesensgemäß zum Evangelium, daß er nur mit ihm selber untergehen kann. Allen Schwierigkeiten zum Trotz erscheint er auch in unserer verhängten Gegenwart, wo die Menschen es lieben, die entsetzliche Katastrophe des christlichen Abendlandes zu einer bloßen Krise zu verharmlosen. Er tritt inmitten des europäischen Zusammenbruches auf, eines apokalyptischen Vorganges, den man nur mit tiefstem Schmerz miterleben kann und über den sich die heutigen Menschen kaum Rechenschaft geben.
Wie die Zeichen des Menschensohnes immer da erscheinen, wo sie gar nicht erwartet werden, so meldet sich der christliche Narr unmißverständlich in der heutigen Kunst, am eindrücklichsten in der Malerei eines Georges Rouault. Dieser Franzose gehört zu den wenigen echt religiösen Malern der Gegenwart. Seine aufrüttelnde Kunst gründet ganz im Christentum und ist aus ihm überhaupt nur zu verstehen. Seit den Tagen, da Rouault als Knabe durch eine Vorstadt von Paris schritt und den melancholisch wirkenden Trapezvorführungen einiger Zirkusleute zuschaute, die, mit glitzerndem Flittertand bekleidet, auf dem Seil ihre artistischen Kunststücke zum besten gaben, ist der Clown nicht mehr aus seinem malerischen Werk verschwunden. Er hat nichts mit dem französischen Charme zu tun, sondern hat ihn wie eine Vision überfallen und taucht neben seinen anklägerischen Dirnenbildern immer wieder auf. Im Kunstwerk Rouaults hat der Clown die Funktion eines Zeichens, das nach einer religiösen Deutung verlangt. Rouault hat den Pierrot immer wieder gemalt und ihm in allen Stellungen jene unendlich traurigen Gesichtszüge verliehen, deren Bleichheit man nie mehr vergißt, bis man zu seiner maßlosen Überraschung die unverkennbare Ähnlichkeit mit seiner Christusgestalt wahrnimmt! Dieser leise Hinweis verrät, wer sich unter der Maske des Clowns verbirgt – es ist der christliche Narr. In Rouaults aus religiöser Inspiration hervorgegangener Kunst tritt der Narr in Christo in leibhaftiger Gestalt vor den modernen Menschen, mit einer verhüllten und doch eindringlichen Gebärde, die die verborgene Sehnsucht ahnen läßt. Unvergeßlich blickt er aus jenem Bild, dem der Künstler die Überschrift gab: «Wer zeigt sein wahres Gesicht?8» Niemand tut dies in dieser verdorbenen, verlogenen Welt außer dem verlachten Narren, der, den Clownshut auf den Kopf gesetzt, uns mit einem unaussprechlichen Blick anschaut, als wollte er sagen: Werde ein Tor in dieser Welt!
ALLES, WAS TIEF IST, LIEBT DIE MASKE … Symeon von Edessa [CA. 550]
MEIN GEHEIMNIS GEHÖRT MIR
Palladius erzählt in seinem «Leben der heiligen Väter» eine selten erwähnte Begebenheit, die jedoch, je weniger sie beachtet wird, ein um so stilleres Leuchten ausstrahlt. Auf den innerlichen Leser wirkt sie wie ein geistliches Miniaturbild, nicht unähnlich jenen Initialzeichnungen, die man in alten, von Mönchshand abgeschriebenen Bibeln findet. Trotz der Kleinheit erzeugt eine solche Miniaturzeichnung oft einen stärkeren Eindruck als ein in großen Zügen hingeworfenes Freskogemälde. Wie eine liebevolle und fein ausgeführte Malerei steht der unscheinbare Bericht des Palladius da, an dem man immer wieder neue Schönheiten entdeckt.
Nach dem Versinken des apostolischen Zeitalters dauerte es lange, bis der erste Mensch kam, der die freiwillige Narrheit auf sich nahm. Unerwarteterweise war es eine Frau. Wie war es nur möglich, daß ein weibliches Wesen zuerst wieder auf eine der tiefsten christlichen Wahrheiten stieß? Kam es daher, weil in religiöser Beziehung «die Frauen es immer einen halben Meter vor den Männern wissen », wie Hermann Kutter einmal sagte?1 Wie dem auch sei, an dem tatsächlichen Befund läßt sich nicht rütteln: der Reigen der christlichen Narren wird in der alten Christenheit von einer Nonne eröffnet, die kaum eine Nachfolgerin gefunden hat.
Es war im Nonnenkloster zu Tabenna, darin sich «auch eine Jungfrau befand, die sich den Anschein gab, als ob sie verrückt und besessen sei. Darum hegte man allgemein solchen Abscheu vor dieser, daß keine mit ihr essen wollte; sie aber hatte das freiwillig auf sich genommen. Sie weilte beständig in der Küche, tat jede Arbeit, war sozusagen das Wischtuch des Klosters und erfüllte so, was geschrieben steht: Dünkt sich jemand weise zu sein unter euch, der soll ein Tor werden, auf daß er weise werde! Mit einem Lumpen hielt sie den Kopf umhüllt, während die andern geschoren waren und Kapuzen trugen. So war sie angetan und versah den Dienst einer Magd. Keine von den vierhundert sah sie jemals essen während der vielen Jahre; sie setzte sich niemals zu Tisch, genoß kein Stücklein Brot und war mit dem zufrieden, was sie beim Spülen der Geschirre fand. Sie kränkte niemand, murrte nicht, sagte weder viel noch wenig, obgleich sie beschimpft, geschlagen, verwünscht und verächtlich behandelt wurde2.» Palladius’ Schilderung ist kurz und läßt viele Fragen offen, die der neuzeitliche Forscher gerne wissen möchte. Es wird nichts über Herkunft und Werdegang der allseitig geringgeschätzten Nonne ausgeführt. Nur die Verachtung, die der angeblich verrückten Schwester entgegengebracht wurde, ist deutlich vermerkt. Die bösen Worte und harten Schläge, die sie über sich ergehen lassen mußte, mögen den modernen Leser des «Lebens der heiligen Väter» davor bewahren, sich das altchristliche Klosterleben allzu ideal vorzustellen. Wenn das monastische Leben auch eine religiöse Einrichtung ist, so hat es doch immer noch an der Unvollkommenheit und der gebrechlichen Einrichtung der Welt Anteil, was in dieser geistlichen Miniaturzeichnung mit Wahrheitsliebe festgehalten ist. Den Dienst einer Magd im Kloster verrichtend, steht die Nonne scharf umrissen da. Sie war nicht einmal gleich gekleidet wie die Mitschwestern, denn sie trug einen um den Kopf gewickelten Lumpen und wurde schlechthin als das «Wischtuch des Klosters» behandelt. In diesem einen Ausdruck liegt ein ganzes, nicht auszuschöpfendes Leben beschlossen.
Wahrscheinlich wäre die ausdrücklich dem Pauluswort nachlebende Einfältige in ihrer Stellung als Spülmagd bis zu ihrem Tode geblieben, wenn sie darüber hätte entscheiden können. Allein, ein ganz unerwartetes Ereignis brachte eine Wendung in ihr klösterliches Küchendasein. Im Porphyrgebirge hatte der heilige Piterum eine Vision, in der ein Engel zu ihm sagte: «Was bist du stolz auf deine Frömmigkeit und dein weltfernes Leben? Willst du ein Weib sehen, das frömmer ist als du, so geh’ nach dem Frauenkloster der Mönche von Tabenna! Dort wirst du eine finden, die einen Lumpen um den Kopf gebunden hat; diese ist besser als du; denn obgleich sie von allen Seiten Unbill erfährt, hat sie niemals ihr Herz von Gott gewendet; du dagegen sitzest hier, deine Gedanken aber schweifen in den Städten umher3.» Die Leute machen sich gewöhnlich von den Visionen falsche Vorstellungen. Zu oft sehen sie darin nur eine Bevorzugung, deren sie auch gerne teilhaftig werden möchten. In Wirklichkeit lassen Entrückungen, und mögen sie bis in den dritten und vierten Himmel sich ereignen, die Menschen nicht nur unaussprechliche Süßigkeiten kosten. Sie dienen keineswegs bloß einer religiösen Selbstbefriedigung, wie die Draußenstehenden argwöhnen. Die Verzückung, die den heiligen Piterum überkam, war alles andere als schmeichelhaft. Sie zertrümmerte mit einem Schlag seine selbstgerechte, stolze Einbildung auf seine tugendsame Frömmigkeit. Wie in einem ungebetenen Spiegel sah sich plötzlich Piterum in dieser Vision wohl mit dem Körper in der Zelle sitzend, mit dem Geist aber flatterte er in der Welt herum. Das Engelwort drang durch alle Wände der Selbstgenügsamkeit: «Willst du ein Weib sehen, das frömmer ist als du …», womit der Gottesbote ihm zu verstehen gab, daß es mit seiner Christlichkeit trotz aller Weltfremdheit nicht zum besten bestellt sei. Piterum erlebte eine unangenehme Demütigung; es gereicht ihm einzig zur Ehre, daß er sich ihr beugte und sich nicht vor ihr in nutzlose Selbstrechtfertigungen flüchtete.
Obgleich Piterum sonst nie seine abgelegene Einsiedelei verließ, machte er sich nach der Vision auf den Weg nach Tabenna. Der Ruf seiner Heiligkeit verschaffte ihm ohne weiteres Einlaß im Kloster, und er wünschte die Nonnen zu sehen. Die Vorsteherin stellte sie ihm alle vor, aber nach Piterums Vision fehlte gerade die unter ihnen, die er suchte. Auf seine Frage, ob dies alle seien, erwiderten die Nonnen: «Eine haben wir noch in der Küche draußen; aber die ist närrisch.» «Führt sie herein », sprach Piterum, «ich möchte sie sehen.» Die Nonnen gingen hinaus und versuchten, die gewünschte Schwester zu holen, aber die angebliche Närrin weigerte sich kurzerhand, hineinzugehen, ahnend, daß ihr Geheimnis verraten werden könnte. Doch die andern zogen sie mit Gewalt und sagten: «Der heilige Piterum wünscht dich zu sehen.»
Als Piterum nun die eintretende Nonne sah, ereignete sich eine höchst überraschende Szene, auf die keine der Schwestern vorbereitet war und die mit Blitzesschnelle die bisherige Situation ins Gegenteil umkehrte. Zu ihrem maßlosen Erstaunen fiel der heilige Piterum alsogleich vor dem «Wischtuch des Klosters » zu Füßen und sagte zu ihm: « Segne mich!» Im gleichen Moment kniete jedoch auch die verachtete Nonne nieder und bat Piterum: «Segne du mich, Herr!», die einzige verbale Äußerung, die von diesem ganz in die Welt des Schweigens eingetauchten Menschen überliefert ist. Über die beinahe komische Situation dieses gegenseitigen Wunsches, gesegnet zu werden, wunderten sich die verdutzt zuschauenden Nonnen aufs höchste. Sie konnten das Geschehen in keiner Weise begreifen, glotzten einander nur fassungslos an und sprachen schließlich zu Piterum: «Vater, laß dich doch nicht zum besten halten. Sie ist ja närrisch.» Piterum aber antwortete: «Ihr seid närrisch; denn sie ist meine und eure Mutter – so nennen sie jene, die ein Leben des Geistes führen –, und ich wünsche nur ihrer würdig befunden zu werden am Tage des Gerichtes4.» Ein größeres Lob hätte er ihr gar nicht zollen können. Der kniende Piterum hebt die verachtete Närrin über alle Insassen der Klostergemeinde und möchte so werden, wie sie ist. Welch zarte religiöse Schönheit steckt doch in dieser einen Ausführung des geistlichen Miniaturbildchens.
Nach dieser unerwarteten Mitteilung Piterums kam eine wirkliche Betroffenheit über die versammelten Nonnen. Mit Schrecken gewahrten sie, wie unchristlich sie die begnadete Küchenmagd behandelt hatten. Sie fielen der Verachteten ebenfalls zu Füßen, und jede gestand ein anderes Vergehen, dessen sie sich schuldig gemacht hatte. Die eine bekannte, sie mit Spülwasser begossen zu haben, die andere, sie so stark geschlagen zu haben, daß sie blaue Flecken bekommen hatte, und die dritte klagte sich an, ihr die Nase mit Senf bestrichen zu haben. Alle ohne Ausnahme hatten sich ihr gegenüber gar nicht als fromme Klosterschwestern benommen, sondern sich die unstatthaftesten Übergriffe erlaubt und baten nun voll Reue für ihr häßliches Verhalten um Verzeihung.
Die Närrin im Kloster wollte nicht Ruhm und Ehre bei den Schwestern genießen und fand die vielen Abbitten lästig. Sie fühlte sich in ihrer verborgenen Herzensgemeinschaft mit Gott ertappt «und entwich nach wenigen Tagen aus dem Kloster. Wohin sie ging, wo sie sich verbarg und wo sie gestorben ist, hat niemand erfahren5.» Mit diesen Worten schließt der kurze Bericht über diese unbekannte Nonne, die sich « den Anschein » gab, als «ob sie verrückt sei», und in Wirklichkeit das Leben einer Heiligen geführt hat.
Palladius’ Ausführungen sind tatsächlich nur eine feinsinnige Miniaturzeichnung, die nicht gestattet, eine biographische Skizze dieser weiblichen Närrin zu schreiben. Dafür ist das ihr gewidmete Kapitel im Leben der Altväter viel zu fragmentarisch und ließe der Phantasie einen allzu großen Spielraum. Trotzdem ist es voll kostbaren Inhaltes, an dem man sich nicht genug erlaben kann. Durch alle Lücken schimmern in wunderbarem Glanz die entscheidenden Züge, auf die es ankommt: die Berufung auf das Pauluswort vom Narren in Christo, die Verachtung, die sie um ihrer freiwilligen Torheit willen in Kauf nimmt, und die Auserwählung zu dem Menschen, der sich sein Geheimnis nicht entreißen läßt. Dies alles ist bei dieser Nonne schon angedeutet, die mit der Durchführung ihrer lächerlichen Rolle den ersten Auftakt in der Kirchengeschichte zu dem kaum zu bewältigenden Thema des christlichen Narren gegeben hat. Mitnichten liegt eine Vergeßlichkeit des Palladius vor, wenn er sie als eine Namenlose in die Geschichte eingeführt hat. Diese Anonymität gehört dem Wesen nach zu ihrem Schicksal. Es hätte ihr nichts Schöneres widerfahren können als diese Ungenanntheit, zumal es keinen zu hohen Preis gibt für das Unbemerktbleiben in der Welt. Gar viele Menschen begehren eine Tat auszuführen, bei der die linke Hand nicht wissen soll, was die rechte tut. Aber trotz aller Sorgsamkeit gelingt ihnen dies nicht, die unscheinbare Frömmigkeit und stille Wohltätigkeit wird doch bemerkt und von den Biographen rühmend ans Tageslicht gezerrt – womit sie ihren Lohn dahin haben. Dieses als Abschaum geringgeachtete «Wischtuch des Klosters » hat erreicht, was den andern versagt blieb. Sie wollte unerkannt bleiben, und als gegen ihren Willen für eine kurze Zeit ihr Geheimnis gelüftet wurde, da flüchtete sie sich schnell in das sie schützende Dunkel zurück, das ihre Gestalt endgültig allen neugierigen Blicken entzog. Diese Nonne hat als eine der wortlosen und leidensbereiten Christen die immer wieder übersehene Wahrheit verstanden, daß Gott nur in der Verborgenheit gegenwärtig ist. Jede Zurschaustellung, jede Öffentlichkeit und jede Ruhmsucht vertreibt Gottes unsichtbare Anwesenheit, und nur in der verborgenen Stille schenkt sie sich dem Menschen als unaussprechliche Seligkeit. Die innere und äußere Abgeschiedenheit der Einfältigen war so groß, daß bis zum heutigen Tag nicht einmal der Name der Nonne feststellbar ist. Als eine den Menschen unbekannte und nur Gott bekannte Gestalt ist sie in die Geschichte eingegangen. Sie erfuhr die Herrlichkeit des biblischen Wortes: «Mein Geheimnis gehört mir!», und zählt zu den bevorzugten Menschen, die ein wirkliches Geheimnis besaßen, das ihr nicht auf den Lippen brannte und das sie auch gegenüber aller zudringlichen Neugier zu bewahren verstand. Tatsächlich hat niemand ein Recht, es ihr zu entreißen. Um ihrer Unbekanntheit willen gebührt dieser ägyptischen Nonne der Erstlingsplatz unter den christlichen Narren. Vor ihrer verhüllten Heiligkeit kann man nur mit Piterum in die Knie sinken und mit dem alten Einsiedler bitten: «Segne mich!»
WIE EIN BYZANTINISCHES MOSAIKBILD
Die byzantinischen Mosaiken bilden eine Welt von fremdartiger Schönheit. Man kann sich zuerst mit der Strenge ihrer Form nicht recht befreunden und findet sie von lebloser Starrheit. Der moderne Betrachter vermißt vor allem die psychologische Belebung, die er von einem Bild erwartet und die ihm das Gefühl der Beseligung vermittelt. Er hat zunächst zu der byzantinischen Kunst keinen Zugang, sie ist seinem Lebensgefühl verschlossen. Allzu andersartig ist ihre Ästhetik, als daß der heutige Kunstfreund nicht befremdet vor dem Anblick der Mosaiken stehenbliebe. Vertieft man sich aber in die geheimnisvollen Farben, so wird man von der magischen Kraft dieser byzantinischen Kunstwerke ergriffen, und alsobald bricht aus ihnen ein wahrer Lichtstrom hervor. Die Mosaiken sind zu der großen Kunst zu zählen, die ihren Liebhabern nicht mehr aus dem Sinn geht.
Ein byzantinisches Mosaikbild im übertragenen Sinn ist die Lebensbeschreibung des Bischofs Leontios von Neapolis auf Kypros über Symeon von Edessa. Bischof Leontios lebte im 7. Jahrhundert unter dem Kaiser Konstanz und war ein gebildeter Mensch, der auch die Luft der ägyptischen Großstadt Alexandrien einmal eingeatmet hatte. Er war Schriftsteller, schrieb über das Leben von Heiligen und wählte mit Vorliebe Gestalten, die seine Gewährsmänner persönlich noch gekannt hatten. Auch bei der Vita des Symeon berief er sich auf den Diakon Johannes, der dem Bischof Leontios versicherte, keinerlei Zusätze zu dem Bericht gemacht zu haben, und der ihn zugleich lehrte, dieses außergewöhnliche Leben unter dem Gesichtspunkt einer göttlichen Mission zu betrachten. Die Lebensbeschreibungen des Leontios sind unpsychologisch geschrieben, sie erwähnen die wichtigen Begebenheiten oft nur kurz und bringen den springenden Punkt nur selten plastisch zur Geltung. Aus lauter einzelnen Steinchen scheinen sie zusammengesetzt zu sein, die man lange betrachten muß, bis man endlich die verbindende Linie wahrnimmt, die das Ganze zu einem Gemälde rundet. Er zeichnete mit seinem Griffel die Heiligenleben und dachte dabei weder an literarischen Ruhm noch an schriftstellerische Eitelkeit. Leontios’ Arbeit stand bewußt in einem religiösen Dienst, er wollte im Leser die «Sehnsucht wecken, daß er den Schlaf der Seele von sich schüttle und den engen, beschwerlichen Pfad betrete, der hinaufführt zum ewigen Leben»6. Der christliche Impuls ist seine primäre Absicht, und wer den nicht spürt, der empfindet bei der Lektüre bald eine gähnende Langeweile.
Die ausschließlich religiöse Zielsetzung der Lebensbeschreibung über Symeon ist einer rein wissenschaftlichen Untersuchung wenig zugänglich. Wohl hat die Gelehrsamkeit über Leontios’ Werk all das Material zusammengetragen, das hierüber in Erfahrung zu bringen war. Aber wie merkwürdig! Trotz des anerkennenswerten Fleißes prallte die wissenschaftliche Forschung an der Erfassung des tieferen Sinnes völlig ab und blieb in einer grotesken Ahnungslosigkeit befangen. Sie ist nur daraus zu erklären, daß immer wieder als Wissenschaft ausgegeben wird, was im Grunde gar nicht Wissenschaft, sondern lediglich weltanschauliche Voraussetzung des Historikers ist. Bei aller Akribie kamen die verehrten Forscher nur zu der Feststellung, Leontios habe selbst ein dunkles Gefühl dafür gehabt, daß er in seiner Biographie über Symeon den «ungebildeten Massen» eine «unverdauliche Kost» vorgesetzt habe7. Da die wissenschaftlichen Gelehrten Symeons Leben zum voraus für ungenießbar hielten, ist ihnen denn auch der unverdauliche Brocken fortwährend wieder aufgestoßen. In der Folge vermochten sie – humoristisch ausgedrückt – über ihn nur «rülpsende Töne» von sich zu geben. Nach ihrer Ansicht erinnern Symeons «Scherze, Unanständigkeiten und Verrücktheiten lediglich an das Treiben mohammedanischer Fakire, Sufis und Marabuts, welche vom Pöbel abwechslungsweise mit Kot beworfen und adoriert wurden»8. Nicht nur ein Wissenschaftler hat mit dieser unglaublichen Verständnislosigkeit Symeon abgelehnt, auch der verdienstliche Übersetzer von Leontios’ Lebensbeschreibung sah in ihr ebenfalls nur «historische Erinnerungen an einen mit abergläubischer Scheu als heilig betrachteten Geisteskranken mit altüberkommenen Schwänken verbunden »9. Jeder, der vorwiegend an der Schilderung des byzantinischen Kulturlebens interessiert ist, wird diese alte Vita kaum anders bewerten, zumal wenn sich der Forscher so viel zugute darauf tut, wirklich «Verrückte und halb Blödsinnige » nicht mit Heiligen zu verwechseln.
An sich anerkennt die Wissenschaft in der Regel nur das, was sich analysieren läßt. Gewiß hat sie Mannigfaches erforscht, was zunächst unerklärlich war, und wenn ihr auch vieles zugänglich ist, so vermag sie doch nicht alles zu erfassen. Es gibt eine Grenze, von der ihre Methode nicht weiterführt. Eine ganze Reihe von Phänomenen verhält sich der wissenschaftlichen Bemühung gegenüber spröde, weil sie nicht mit der Welt des Wissens zusammenhängen. Maßt sich die Wissenschaft hierin trotzdem ein Verständnis an, dann entstehen in der Regel nur Mißverständnisse. Zu diesen Erscheinungen, die sich durch eine rein rationale Erfassung nicht erschließen lassen, gehört auch das Leben Symeons von Edessa, das man in keinen akademischen Rahmen einfügen kann, da es von aller neuzeitlichen Bürgerlichkeit meilenweit entfernt ist. Bei ihm müßte man zum allermindesten die wissenschaftliche Fragestellung durch eine religiöse Sicht ergänzen und überhöhen, die sich in dieses andersartige Sein hineinzufühlen und seine Verschlossenheit mit einerinnern Schau zu öffnen vermöchte. Der religiöse Spürsinn allein bleibt nicht im äußeren Vorhof stecken, er lüftet das Geheimnis, das um das verborgene literarisch-byzantinische Mosaik schwebt, und weiß es zuletzt auch in sinnvoller Weise zu deuten, denn: Ähnliches wird nur durch Ähnliches erkannt. Es grenzt an christliche Rutengängerei, will man die Quellwasser sprudeln hören, die in Symeons tiefem Schacht fließen. Sein geheimnisvolles Anliegen ist nur von einer übernatürlichen Dimension aus zu begreifen, man muß das Unsagbare intuitiv fühlen, das in diesem Menschen lebte, und dann ersteht ein neues Bild von ihm, voll seltener Hintergründe und tiefer Einsichten in das Christliche.
Sind einmal die Vorurteile weggeschafft, die sich wie eine Mauer um das Byzantinische gelegt haben, dann ist der Weg frei für die Andersartigkeit der morgenländischen Ausdrucksformen. Mit geöffnetem Sinn und aufnahmebereiter Liebe wird man ihre Welt anerkennen und auch das ungewöhnliche Leben eines Symeon geistig erfassen. Das Christentum des byzantinischen Reiches war stark mit dem Mönchtum verbunden und hat außerordentliche Gestalten hervorgebracht, die alles hinter sich lassen, was sich heutzutage der Durchschnittsmensch unter Frömmigkeit vorstellt. Johannes Climacus’ «Leiter zum Paradies» ist eine ebenso lichtvolle als kühne Anweisung, zum Ewigen aufzusteigen. Den unzugänglichen Säulenheiligen Symeon wird niemand schmähen, ohne sich zu versündigen. Hugo Ball hat in seinem «Byzantinischen Christentum» diese grandiose, ganz unabendländische Welt mit beschwörender Gebärde geschildert, ein Ruhm, der ihm bei allen Mängeln immer unbenommen bleiben wird.
Aller Sinn für die Eigenart der byzantinischen Lebensäußerung genügt jedoch zum Verständnis von Symeon noch nicht. Dieser außerordentliche Mann überschreitet auch das byzantinische Kulturgefühl; sein Gebaren wird nur aus seiner verborgenen Religiosität verständlich. Hat man sich das Byzantinische und das, was noch mehr ist als das Byzantinische, klargemacht, so ersteht plötzlich jene Geheimnistiefe, aus der dieser Mensch gelebt hat. Seine unterirdische Verkettung mit dem Christentum ist das Ausschlaggebende; man blickt mit neuen Augen auf Symeons Lebensführung, wenn man erkennt, daß sie eine hinreißende Verkörperung der christlichen Torheit ist. Ernst Benz hat in seiner aufschlußreichen Studie über «Heilige Narrheit» als erster die religiösen Kategorien Symeons namhaft gemacht: «Der Narr spielt seine heilige Rolle vor Gott, als die höchste Form der Selbsterniedrigung und Selbstentäußerung. Die heilige Narrheit ist die Darstellung der Torheit Gottes in ihrer radikalsten Form; sie ist gelebte, nicht gedachte christliche Dialektik10.»
Was man auch ausführen mag, es bleibt bei der Feststellung: Die Lebensbeschreibung über Symeon ist mit einem byzantinischen Mosaik von fremdartiger Schönheit zu vergleichen, das man sich geistig erobern muß. Sie schenkt sich nicht dem Leser, sie verlangt von ihm ein langes, unbeirrbares Werben um sie. Die kleinen Steinchen wollen ebenso sorgfältig als geduldig zusammengesetzt sein, bis sie endlich im einzigartigen Farbenspiel aufflammen, vor dem man wie gebannt stehen bleibt. In diesem Moment überkommt uns eine kleine Ahnung von der Seelenschönheit Symeons. Aber nur einen Augenblick lang, und dann zeigt er wieder sein beinahe unbewegtes Maskengesicht. Den byzantinischen Kunstwerken gleich, die immer eine gewisse Fremdheit behalten, gibt auch die Lebensbeschreibung nicht alle Rätsel preis. Wer jedoch einen leisen Anfang ertastet hat, für den fängt dieses literarische Mosaikbild in nie erwartetem Glanz zu leuchten an. Aus seinen schlichten Worten leuchtet ein Strahl von jenem Taborlicht, das zu schauen die einzige Bemühung der Athosmönche war. Vielleicht teilt es sich auch ein wenig dem empfänglichen Leser mit, sein Inneres erhellend und Trost spendend für seinen Lebensweg.