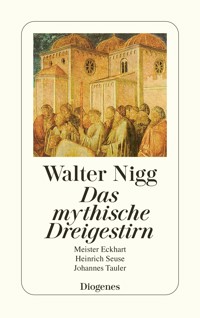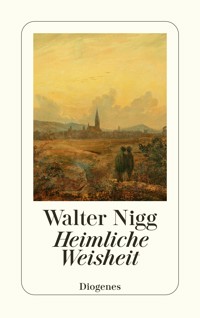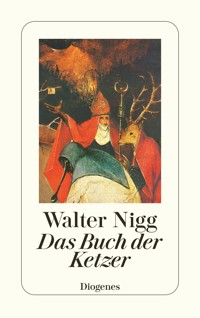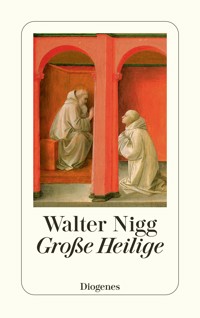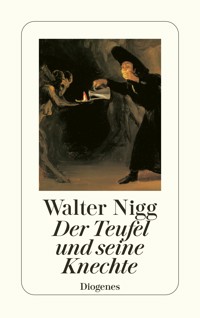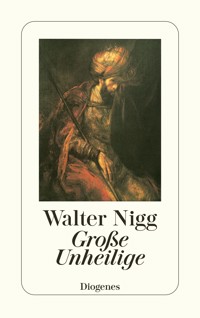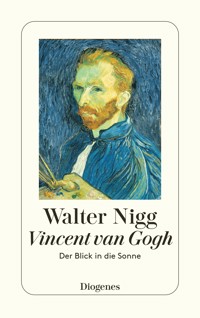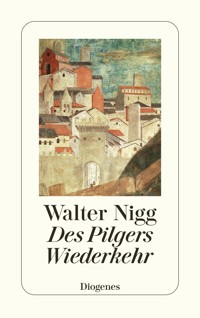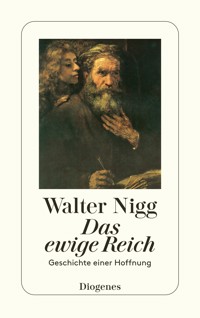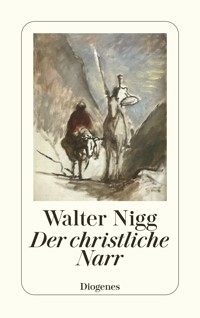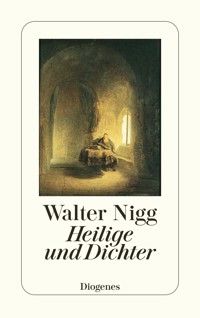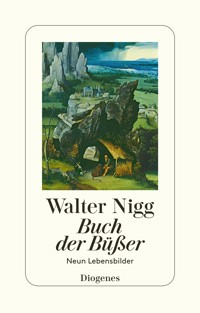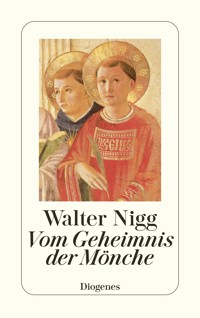
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Nach den beiden Klassikern ›Große Heilige‹ (detebe 21459) und ›Das Buch der Ketzer‹ (detebe 21460) jetzt auch der dritte Klassiker von Walter Nigg: Er geht dem Geheimnis der großen Ordensgründer nach, erzählt aus dem Leben von Augustinus, Benedikt, Franz von Assisi, Bernhard von Clairvaux, Teresa von Avila, Ignatius von Loyola und vielen anderen mehr. Da werden keine trockenen Forschungsergebnisse aneinandergereiht, da blüht alles zu lebendigem Leben auf. Walter Niggs Darstellungsart und Sprache zeichnen sich bei aller sachlichen Zuverlässigkeit aus durch das Bekenntnishafte der Mitteilung und durch einen erfrischenden Mut der Aussage. Dieses Werk macht uns bekannt mit den großen Ordensgründern, die dem ewig-gleichen Getümmel einer lärmenden Welt Andacht und Inbrunst gläubiger Herzen gegenüberstellen, der Zerstreuungssucht der Vielen das Gesammelte der Wenigen. Das ganze Buch legt Zeugnis davon ab, wie durch alle Zeiten hindurch immer wieder in einzelnen Menschen und kleineren oder größeren Gemeinschaften das Verlangen nach einer reineren und höheren Form des Menschseins aufflammt und wie aus der Abkehr von der Welt Heilskräfte für die Welt ausstrahlen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 889
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Walter Nigg
Vom Geheimnis der Mönche
Von Bernhard von Clairvaux bis Teresa von Avila
Diogenes
«MÖNCHLEIN, MÖNCHLEIN, DU GEHST JETZT EINEN GANG …»
Altes lehren ist schwerer als Neues lehren
(Hebräisches Sprichwort)
IN Rainer Maria Rilkes «Stundenbuch», dessen erster Teil vom mönchischen Leben handelt, findet sich ein seltsames Gedicht, das ganz der östlichen Atmosphäre angehört. Von Mönchen ist in ihm die Rede, die «sich tief in die Erde gruben» und dadurch gleichsam in ihrer Mutter Schoß zurückkehrten. Ihr unterirdisches Leben ward wie «tausend Jahre groß», seitdem sie es «nicht mehr in Nacht und Helle schieden». Jetzt wallen Pilger zu den in den Kiewer Höhlenklöstem «Eingegrabenen» und betrachten ehrfürchtig die Heiligen, deren in die Erde eingetauchten Leiber nicht verwesen1. Trotz der mehr ästhetischen als religiösen Einstellung des jungen Dichters ist in diesen beinahe melancholisch klingenden Versen eine altrussische Stimmung heraufbeschworen. Das Gedicht wirkt wie ein Symbol für das Schicksal des Mönchtums in der Neuzeit, sein sinnbildlicher Gehalt verträgt noch eine andere Deutung, als sie Rilke selbst gegenwärtig sein mochte.
Seitdem die Ideen der Französischen Revolution und der deutschen Säkularisation sich im Abendland durchsetzten, brachten die Menschen für das monastische Leben kein Verständnis mehr auf. Mit ihrer rein diesseitigen Nützlichkeitseinstellung konnten sie das klösterliche Dasein nicht länger ihrem Lebensgefühl einordnen. Das Ordenswesen verfiel einer Verkennung, die sich in immer ungünstigeren Urteilen über die Mönche bekundete. An sich waren die Einwände gegen das Kloster als einer unnatürlichen Lebensweise nicht neu. Von Jovian bis zu Erasmus von Rotterdam läßt sich die Ablehnung des Mönchtums verfolgen. Im Zeitalter der Aufklärung verdichtete sich diese Abneigung zu einem wahren Sturm gegen die Mönchsorden und führte zur Aufhebung zahlreicher Klöster. Was blieb den Mönchen anderes übrig, als gleichsam in die Erde schlafen zu gehen, um ihr Geheimnis vor den allzu profanen Blicken zu bewahren. Wie die Kiewer Mönche, von denen Rilke in seinem dunklen Gedicht singt, ist das Mönchtum in der sich ausbreitenden Neuzeit immer mehr in die Katakomben untergetaucht und überwinterte, symbolisch verstanden, in der Tiefe der Erde. Die Außenstehenden verstanden das Hintergründige dieses merkwürdigen Vorganges nicht und sprachen hierauf von der Erstarrung des Klosterwesens, dessen Geschichte nun zu der «erkaltenden Objektivierung» zu rechnen sei und als solche nichts mehr zur Lösung der Weltgeschichte beitrage2.
Doch nicht für alle Zeiten vergruben sich die Mönche in der Erde. Das Verlangen nach dem monastischen Leben ist viel zu tief im Menschen verankert, als daß es je völlig verschwinden könnte. Es meldete sich immer wieder, und nie wird es eine Zeit ohne Klöster geben. Bereits im 19. Jahrhundert begann es, gleich einem ersten Erwachen aus dem Winterschlaf, in verschiedenen Orden mächtig zu rauschen. Wie Paulus in seinen Ausführungen über die Auferstehung der Toten schließlich den Korinthern zurief: «Siehe, ich sage euch ein Geheimnis», ist man bei diesem Thema heute innerlich genötigt, nicht minder eindringlich zu flüstern: Sehet, das Mönchtum zog sich deshalb in die Erde zurück, um dereinst wieder aufzuerstehen! Wahrhaftig, der tiefere Sinn der Eingrabung in die Erde liegt darin, der Zeit einer neuen Auferweckung, die unmittelbar bevorsteht, entgegenzuharren. Den nur auf die äußern Tagesereignisse eingestellten Augen entgeht dieser sich unter der Oberfläche abspielende Prozeß, der, geistig gesehen, zu den bedeutsamsten Ereignissen unserer Zeit gehört.
Dieser unsichtbar-sichtbare Vorgang ruft nach einer neuen Begegnung mit dem Mönchtum. Sie hat sich einen Augenblick an das Wort Franz Overbecks zu erinnern, der das Mönchtum eine Erscheinung nannte, «zu deren Würdigung freilich die katholische Theologie die Reinheit des Verständnisses längst verloren, die protestantische die Gerechtigkeit nie besessen hat»3. Statt über die angriffige Behauptung des profanen Kirchenhistorikers alsogleich entrüstet zu sein, wäre es weit besser, sie als eine Warnungstafel aufzufassen, über die es sich lohnte, länger nachzudenken. Offenbar ist es nicht so leicht, das innere Wesen des Mönchtums zu begreifen, wie es sich der Durchschnittsmensch vorstellt. Es müssen dazu Berge von Vorurteilen überwunden werden, die sich beinahe wie unübersteigbare Mauern vor dem Mönchtum auftürmen. Es gilt in erster Linie, das Thema aus den konfessionalistischen Auseinandersetzungen herauszunehmen, in welchen der Mensch ohnehin kein Phänomen in seinen reinen Umrissen erkennt. Der gerne zur Gehässigkeit verführende Gesichtspunkt des Konfessionalismus – nicht zu verwechseln mit der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Konfession, in die Gott einen Menschen hineingestellt hat – büßte im Zeitalter des Totalitarismus wesentlich an Wichtigkeit ein, ganz abgesehen davon, daß die großen Ordensbildungen noch in der wundervollen Landschaft der ungeteilten Christenheit beheimatet waren. Eine über aller Polemik stehende Christlichkeit, die sich der Aufgabe verpflichtet weiß, allen Konfessionen zu dienen, muß schon aus ökumenischen Gründen den einengenden Parteistandpunkt durchbrechen. Sie wird auch dem Mönchtum mit ganz neuer Aufgeschlossenheit gegenübertreten und dieser mächtigen Gestaltung christlicher Geistigkeit mit einer liebenden Verehrung begegnen, die keineswegs mit Kritiklosigkeit identisch ist.
Die religiöse Ehrfurcht bedient sich selbstverständlich der Mittel, die ihr die Wissenschaft zur Erfassung des Mönchtums zur Verfügung stellt. Die historisch-kritische Methode hat zur Herbeischaffung des Materials eine unermeßliche Arbeit geleistet. Mit aufrichtiger Dankbarkeit gedenkt der Verfasser der nachfolgenden Ausführungen der vielen Einzelstudien, die sich selbstlos der Erhellung einer Detailfrage der Klosterbewegung gewidmet haben. Allerdings führt die wissenschaftliche Objektivität oft zu einer innern Unbeteiligung, die mit ihrer Kühle das Entscheidende gar nicht wahrnimmt. Bei aller Notwendigkeit der gelehrten Untersuchungen verbleiben diese im Vorfeld und sind nicht zum letzten Maßstab zu machen. Es geht zur gegenwärtigen Stunde um mehr als um eine wissenschaftliche Darstellung, die für die neue Begegnung mit dem Mönchtum nicht ausreicht. Die akademische Wesenserfassung bedarf der überhöhenden Ergänzung durch eine verwandelte Haltung, die bereits im Zeitalter des Rationalismus jene magische Sehergestalt ausgesprochen hat, die sich selbst Novalis nannte. Dieser johanneische Gottesbote, der durch die «Spitzbogen der reinen Vernunft» hindurchgeschritten war und nun von einer höheren Wirklichkeit in das Land der Sinne hineinblickte, sprach in einem seiner zauberhaftesten Gedichte von einer kommenden Zeit, wo «die, so singen oder küssen, mehr als die Tiefgelehrten wissen»4. Jener Mensch, der in «Märchen und Gedichten, erkennt die wahren Weltgeschichten» gewinnt wieder die viel tiefsichtigere Position eines Novalis, auf die es in steigendem Maße ankommt. Die Erringung dieser neuen Sehweise deutet auch einmal Romano Guardini an, wenn er über den Unterschied zwischen Forschung im modernen Sinn und schauender Durchdringung schreibt, der ihm erst, nachdem er das Licht im Engadin gesehen habe, aufgegangen sei: «Vielleicht ist es mir vergönnt, einmal genauer zu entwickeln, was ich da gelernt habe – besonders als noch, gleichsam jene hohe Klarheit erläuternd, das milde Oktoberlicht des Allgäus und die schimmernde Süßigkeit jenes Lichtes hinzutrat, das von den Hügeln Venetiens auf die Bilder Tizians geflossen ist. Jedenfalls habe ich da von Platon einiges verstanden, was in keinem Buche steht – außer in seinen eigenen; aber in denen liest man es erst, wenn man jene Klarheit gesehen hat und einem darin das Herz übergegangen ist; jenes im Herzen, welches zugleich das Innerste des Geistes ist. Auch einiges verstanden hat von Plotin und wieder von Augustinus, denn in ihnen allen lebt es, wenn auch in jedem nach seiner besonderen Art. Und als ich sah, wie dieses Licht sich um die Bäume legte, um Blattrand, Zweig und Gestalt; was es aus den Bergen macht, am späten Nachmittag, wenn alles sich verwandelt, da habe ich geahnt, welche Bewandtnis es wohl mit der Lehre von der Verklärung haben müsse5.» Diese bekenntnishaften Worte sprechen es genau wie Novalis kündende Verse aus, daß es sich bei dieser überwissenschaftlichen Betrachtungsweise nicht um eine bloße gefühlsmäßige Begeisterung handelt. Die intuitive Erfassung weiß sich auf den Beistand des erleuchteten Logos angewiesen, wodurch auch alsogleich das neue Eindringen in das Mönchtum aus einer Angelegenheit der gelehrten Akribie in eine Haltung lebendiger Religiosität verwandelt wird, die allein dem geheimnisvollen Auferstehen des Ordenswesens aus dem Winterschlaf entspricht. Dabei wird es nicht ohne zahlreiche Durchkreuzungen und Überraschungen abgehen, die an mehr als einer Stelle ein radikales Umdenken erfordern, das sich entschlossen von festgefahrenen Meinungen befreit. Die Bereitschaft, mit geöffneter Seele an eine Erscheinung heranzutreten, um sie in sein Inneres aufzunehmen und sie nicht zum voraus mit feindselig eingestellten Argumenten abzuwürgen, erlebt als Dankesfreude dafür die Wahrheit von Friedrich Nietzsches Wort: «Die Vergangenheit ist vielleicht immer noch wesentlich unentdeckt! Es bedarf noch vieler rückwirkender Kräfte6.»
Der Versuch, das Mönchtum neu zu umschreiten, macht von vielfachen Aspekten Gebrauch. Die historische Sicht hilft dem modernen Menschen, dem die geschichtliche Orientierung ein selbstverständliches Bedürfnis geworden ist, zu einer ersten Einführung in das Mönchtum. Daraus geht gleich zu Beginn eindeutig hervor, daß das Ordenswesen auf eine lange Tradition zurückblicken kann und nicht einer Eintagsfliege gleichzusetzen ist. Auch nur eine historische Skizze vermag von den weitreichenden Schicksalen des Mönchtums in aller Welt wenigstens eine kleine Vorstellung zu vermitteln.
Das Mönchtum ist in verschiedenen Religionen anzutreffen. Der Hinweis auf den religionsgeschichtlichen Ursprung eröffnet keine ins Abwegige führende Blickrichtung. Sie stellt vielmehr die neue Begegnung mit dem Mönchtum von Anfang an in eine Weite und Freiheit, zu der es immer tiefer hindurchzudringen gilt. Nach der religionsgeschichtlichen Phänomenologie hangt das monastische Leben mit der religiösen Anlage des Menschen tief zusammen. Als nachdenkliches Beispiel erweist sich das religiös so reich begabte Indien mit seinen vielen Klöstern. Die geistesmächtigste Ausprägung erhielt das indische Mönchtum durch Gotamo Buddha, über den in ihm entsprechender Weise zu reden bis dahin noch die Kraft keines Abendländers ausgereicht hat. Dieser nicht zu bewältigende Mann beginnt seine lapidaren Reden stets mit der stereotypen Formulierung, «dies, ihr Mönche, ist die heilige Wahrheit …», womit er sich ausschließlich an Ordensmenschen richtet. In Buddhas echtem Jünger tritt faszinierend der strahlende Mönch auf, der als ein Losgesprochener und von der innern Meeresstille erfüllter Mensch durch diese Welt schreitet. «Liebevollen Gemütes weilend strahlt er nach einer Richtung, dann nach einer zweiten, dann nach der dritten, dann nach der vierten, ebenso nach oben und nach unten: überall in allem sich wieder erkennend durchstrahlt er die ganze Welt mit liebevollem Gemüte, mit weitem, tiefem, unbeschränktem, von Grimm und Groll geklärtem7.» Die von allen menschlichen Banden gelösten Mönche sandte Buddha aus zum Heil und zur Freude für viel Volk, aus Erbarmen für die Welt und zum Segen der Menschen, um zu verkünden die Lehre, die sie allseitig begütigend in einem reinen Wandel der Heiligkeit darstellen. Fürwahr, Buddhas strahlender Mönch ist ein Wesen, das rein ist vom Staube des Irdischen, der genau wie der Mondschein den Glanz der Sterne überstrahlt, ebenso mit seiner aus der Befreiung des Herzens hervorgegangenen Liebe all das niedere Tun der meisten Menschen überglänzt. Bereits die buddhistische Erscheinungsform des monastischen Lebens nötigt den reflektierenden Menschen, das allzu schnellfüßige, gewöhnlich gar nicht näher überdachte Urteil über das Mönchtum einer grundsätzlichen Revision zu unterziehen, die viel Erstarrtes wieder in Fluß bringt.
Vor allem ist das Mönchtum eine legitime Ausprägung des Christentums. Den größtenteils unfruchtbaren Diskussionen über die Entstehung des Mönchtums im Christentum ist der eine Satz entgegenzuhalten, daß die christliche Kirche das monastische Leben implizite in sich hat und daß dasselbe ihr nicht aus heidnischen Einflüssen zugeflossen ist. Die endgeschichtliche Botschaft Jesu führte zu einer Abkehr vom diesseitigen Leben, die bereits bei Paulus deutliche Form annahm. Die Wurzeln des christlichen Mönchtums gehen auf das Neue Testament zurück, in welchem sich zahlreiche Ansätze finden, die in diese Richtung weisen und an die ohne weiteres angeknüpft werden konnte. Bereits die ersten Einsiedler beriefen sich für ihr Tun auf die Bibel. Nach dem akonfessionell eingestellten Geschichtsphilosophen Oswald Spengler «beginnt das christliche Mönchtum nicht mit Pachomius, der nur das erste Kloster gebaut hat, sondern mit der Urgemeinde in Jerusalem»8. Geschichtlich gesehen hat sich das monastische Leben in gradliniger Weise aus dem altchristlichcn Asketenstand herausentwickelt, als Gefahr drohte, innerhalb einer verweltlichten Christenheit kein ernstes religiöses Leben mehr fuhren zu können. Das Mönchtum und die Patristik sind die schönsten Blüten am altkirchlichen Lebensbaum. Unmöglich ist es, die alte Kirche in ihrer grundlegenden Bedeutung für alle nachkommenden christlichen Generationen anzuerkennen und das ihr zugehörende Mönchtum als eine Verirrung abzulehnen. Gegenüber der unseligen Verquikkung von kirchlichem und politischem Geschehen, die bereits im 4. Jahrhundert begann, stellen die Mönche «gleichsam die andere Seite der Kirche» dar, die «durch ihre Askese die Waage im Gleichgewicht hielten»9. Diese Aussage weist auf die tiefste Bedeutung des Mönchtums hin: Das rein Religiöse des Christentums kommt in ihm am leuchtendsten zum Vorschein. Auf diese andere, oft übersehene Seite der Kirche gilt es, das Augenmerk zu richten und das Ordenswesen als einen integrierenden Bestandteil des Corpus Christi zu begreifen, das auch in allen seinen Ausprägungen anzutreffen ist.
Für die Ostkirche wurde das Mönchtum bestimmend, und es nahm auch von ihr den Ausgang. Das morgenländische Christentum ist ohne Kenntnis seines Klosterwesens, von dem es weitgehend getragen wurde, schlechterdings nicht zu verstehen. «Wenn Sie den Geist des Christentums gründlich erfassen wollen, müssen Sie das Mönchtum kennenlernen», sagte Kirejewskij, damit den Weg zum tieferen Verständnis der Ostkirche weisend10. Er äußerte keine Sondermeinung, Konstantin Leontjew hat den gleichen Ratschlag erteilt, der auch zu Recht besteht11. Ein Blick in die Welt der «russischen Heiligenlegenden», wie sie neuerdings Ernst Benz zugänglich gemacht hat, zeigt aufs anschaulichste, wie allseitig das Mönchtum die Ostkirche durchdrungen hat. Das Interesse am östlichen Christentum, das in den letzten Jahrzehnten stark anstieg, ist nur dann keine modische Schwärmerei über die russische Seele, wenn es auch auf deren Klosterwelt eingeht, die unter einer fremdartig anmutenden Schale eine geradezu wundervolle Frömmigkeit verbirgt und die Rilke vom alten Rußland sagen ließ, es sei das Land, das an Gott grenze. Die religiösen Russen waren stets von der enormen Wichtigkeit des Mönchtums für das Volksleben durchdrungen. Wie tier die östliche Gläubigkeit mit dem monastischen Leben verbunden ist, bezeugt der religiös erschütterte Dichter Nikolaj Gogol, dessen metaphysischer Roman «Tote Seelen» in die Weltliteratur eingegangen ist und der am Ende seines Lebens selbst vom Heiligkeitsringen ergriffen wurde: «Es gibt keinen höheren Beruf als den Mönchsberuf. Gott gebe, daß es uns einmal beschieden sei, die schlichte Mönchskutte anzulegen, nach der sich meine Seele so sehnt! Schon der bloße Gedanke an sie ist mir eine große Freude. Allein aus eigener Kraft, ohne von Gott dazu berufen zu werden, können wir solches nicht vollbringen12.» Sogar der Gegner der Ostkirche, Leo Tolstoj, hat die Wohltat des russischen Klosters erfahren, als er auf seiner letzten Flucht in Nacht und Nebel an eine Klosterpforte klopfte und auf die Frage, ob er trotz seiner Exkommunikation bei ihnen übernachten könnte, die klösterliche Antwort erhielt: «Wir nehmen alle auf!» Diese schlichten Pfbrtnerworte enthüllen mit einem Schlag den echt christlichen Geist, der in den östlichen Klöstern bis in unsere Gegenwart hinein lebte. Morgenländisches Christentum ist wesentlich monastisches Christentum, diese Wahrnehmung läßt sich nach Igor Smolitschs Buch «Russisches Mönchtum» gar nicht mehr bestreiten.
Die reichhaltigste Entwicklung erfuhr das Mönchtum in der westlichen Christenheit. Bei der Sintflut der Völkerwanderung und ihren Folgen haben sich die Klöster wie eine Arche Noah betätigt, indem sie zum großen Teil die antike, urchristliche und patristische Literatur retteten. Den Höhepunkt erlebte das Mönchtum im Mittelalter, das völlig in seinem Schatten steht. Die damaligen religiösen Gestalten gehören fast durchweg seinem Stand an, und was in jenem Zeitalter auf christlichem Gebiet Großes vollbracht wurde, haben meistens Mönche geleistet. Es waren vorwiegend Ordensmänner, die der Kirche das geistige Arsenal zur Verfügung stellten. An den Mönchen hatte die mittelalterliche Christenheit den stärksten Rückhalt. Obgleich fast alle Orden vor der Glaubensspaltung entstanden sind, so haben sie nachher einzig vom Katholizismus die ihnen zukommende Pflege erfahren. Für den heutigen Blick sind deswegen katholische Kirche und Mönchtum beinahe identisch. Jedenfalls sind sie eng miteinander verbunden und haben sich gegenseitig immer wieder befruchtet. Die katholische Kirche besitzt in den Orden ihre unversiegliche Brunnenstube, in der alle Wasser rieseln und ohne die das christliche Land weitgehend eingetrocknet wäre. Das Mönchtum bildet ihr geistiges Reservoir, aus dem zu einem großen Teil auch alle jene Heiligen hervorgegangen sind, die das Christentum mit einem überragenden Format vertraten und es zugleich liebenswert gemacht haben. Tatsächlich ist ein Katholizismus ohne Mönchtum nicht vorstellbar. Begreiflich, daß, wer die katholische Kirche tödlich verwunden will, immer den Angriff gegen die Klöster als ihre wahren Kraftzentren zu richten hat. Von der religiösen Substanz ihrer Orden und nicht von ihren politischen Aktionen lebt sie vorwiegend. Dort liegen die unerschöpflichen Quellen ihres Glaubenslebens. Zwar bewegt sich das Mönchtum innerhalb der katholischen Kirche nicht in gerader Linie vorwärts. Die Kurve zeigt neben steilen Anstiegen auch tiefe Abstürze, die aber immer wieder aufgeholt wurden. Allezeit schuf der Katholizismus neue Orden, was seiner innern Lebenskraft das beste Zeugnis ausstellt. Diese Fruchtbarkeit hat keineswegs seit der Gründung der Gesellschaft Jesu aufgehört, mit der unsere Ausführungen schließen. Die in den nachfolgenden Darstellungen behandelten Mönchsväter sind nur die wichtigsten, lange aber nicht alle. Leider müssen wir es uns aus Raumgründen versagen, noch andere Orden in die Schilderung einzubeziehen. Nach dem Tridentinischen Konzil erfuhr das Mönchtum eine straffere Organisation, indem die Kirche allseitigen Einblick in die mannigfachen Klöster zu gewinnen begehrte. Dadurch erlitt das Ordenswesen eine viel tiefer greifende Veränderung als gewöhnlich angenommen wird.
Viel zuwenig wird beachtet, daß der Protestantismus in einer einsamen Klosterzelle das Licht der Welt erblickte. Luther gehörte neunzehn Jahre lang dem Mönchsstand an; das Kloster war für ihn weit mehr eine Förderung als ein Hemmnis auf seinem Weg. Freilich geriet Luther in seiner religiösen Entwicklung in einen schweren Konflikt mit der Klosterwelt, und erst ganz am Ende seines Lebens lernte er wieder die erneuerten Klöster als «eine Burg des Friedens in der bösen Welt» schätzen13. Doch vermochte diese späte Einsicht nicht mehr zu verhindern, daß sein antimönchischer Affekt sich auf den Protestantismus vererbte, der sich bis heute noch nicht von diesem Komplex befreit hat. Luthers tragische Wendung wird gewöhnlich zu einlinig gesehen, auch wird zuwenig in Rechnung gesetzt, wie er im Grunde seiner Seele «Mönch blieb, obgleich er nicht mehr dem Mönchtum angehörte»14. Noch in Melanchthons Apologia Confessionis Augustanae schwingt bei aller Polemik gegen das Ordenswesen ein positiver Unterton mit, da sie doch etliche Klöster kennt, welche um «das heilige Evangelium von Christo wissen»15 und namentlich die Ordensstifter «Bernhard, Franziskus und andere» vom damaligen verderbten Mönchtum distanziert16.
Der Altprotestantismus war in diesen Fragen ohnehin kaum zuständig, da ihn seine Kampfsituation veranlaßte, das Mönchtum bis auf die verschwindenden Überreste der Stifte für adelige Damen, aus seiner Mitte auszumerzen. Wie der heutige Protestantismus über diese Austilgung denkt hat Adolf Harnack in seinem «Wesen des Christentums» ausgeführt: «Die Reformation hat das Mönchtum abgetan und abtun müssen. Mit Recht hat sie es für eine Vermessenheit erklärt, sich durch ein für das ganze Leben abgelegtes Gelübde zur Askese zu verpflichten; mit Recht hat sie jeden weltlichen Beruf, gewissenhaft vor den Augen Gottes geführt, dem Mönchsstande gleich, ja überlegen erachtet. Aber es trat nun etwas ein, was Luther so nicht vorausgesehen und gewollt hat – das ‚Mönchtum‘, wie es evangelisch denkbar und notwendig ist, verschwand überhaupt. Eine jede Gemeinschaft aber braucht Persönlichkeiten, die ausschließlich ihrem Zwecke leben; so braucht auch die Kirche Freiwillige, die jeden andern Beruf fahren lassen, auf die ‚Welt‘ verzichten und sich ganz dem Dienst des Nächsten widmen, nicht weil dieser Beruf ein ‚höherer‘ ist, sondern weil er notwendig ist und weil aus einer lebendigen Kirche auch dieser Antrieb hervorgehen muß. Er ist aber in den evangelischen Kirchen gehemmt worden durch die dezidierte Haltung, die sie gegen den Katholizismus einnehmen mußten. Das ist ein teurer Preis, den wir bezahlt haben; die Erwägung, wie viel schlichte und ungefärbte Frömmigkeit dagegen in Haus und Familie entzündet worden ist, kann ihm nichts abziehen!»17 Obschon in Harnacks Worten das Problem eines evangelischen Mönchtums nicht umfassend aufgerollt wird, stellen sie ein bemerkenswertes Einverständnis eines Gelehrten dar, der mit seiner liberalen Ansicht sicher nicht einer Voreingenommenheit für die mönchische Institution bezichtigt werden kann. Er wiederholte auch in anderm Zusammenhang seine Aussage, daß der Protestantismus Gemeinschaften brauche, die von jenem Geist erfüllt sind, wie ihn die lauteren Mönche besessen haben und noch besitzen; dem wird kein Einsichtiger widersprechen, der sich eingehender mit diesem Thema beschäftigt.
Der Protestantismus erlitt durch die Ausrottung des Mönchtums eine Verarmung, die bereits die Täufer in ihrer Art korrigieren wollten und deswegen von Bullinger der neuen Möncherei bezichtigt wurden. Mehrfach unternahmen evangelische Christen Versuche zur Einführung der monastischen Lebensweise, welche Bemühungen nicht einfach aus einer romantischen Schwärmerei entstanden. Der stille Gerhart Tersteegen richtete auf dem Gut Otterbeck eine evangelische Klostergemeinschaft ein und gab ihr auch Satzungen, die ein ehrwürdiges Dokument protestantischen Mönchtums sind. Nach dem Mülheimer Bandweber versuchte Labadie in Holland ein ähnliches Unternehmen ins Leben zu rufen. Albrecht Ritschl fiel die innere Verwandtschaft von Mönchtum und pietistischer Lebenseinstellung auf, die in den Verhaltungsmaßnahmen der Diakonissinnen ihren Niederschlag fand.
Es gibt auf protestantischem Gebiet ganz unerwartete Anklänge an das Klosterwesen. So spricht vor allem Sören Kierkegaard in seinem Hauptwerk «Unwissenschaftliche Nachschrift» mehrfach von der mittelalterlichen Klosterbewegung18. Bezeichnenderweise betrachtete sich der Mann, der zuerst wieder das Christentum als eine Existenzmitteilung verstand, selbst dahin gehörend. In seiner Selbstdarstellung «Der Gesichtspunkt für meine Wirksamkeit als Schriftsteller» bemerkt Kierkegaard, wie er zur Zeit der Niederschrift des ästhetisch-ethischen Werkes «Entweder-Oder» «religiös bereits im Kloster war – was hinter dem Namen ‚Victor Eremita‘ sich verbirgt»19. Als ein im Kloster lebender Mensch ist sich Kierkegaard vorgekommen, eine Wesenseinsicht, die auch Martin Thust in seiner Monographie über den dänischen Religionsphilosophen betonte: «In diesem Sinn ist Kierkegaard ein protestantischer Mönch, der das Tiefste des alten Klosterdaseins mit der reformatorischen Rechtfertigung des Weltlebens einzigartig zu verbinden wußte20.» Der Gedanke vom Mönch aus Kopenhagen würde, wenn durchgeführt, nicht nur die heutige monotone Kierkegaard-Auffassung auflockern, sondern man bekäme auch das verhüllte Antlitz eines neuen Mönchtums zu sehen, das im gegenwärtigen Moment mehr geahnt als verwirklicht werden kann. Auf alle Fälle bildet Kierkegaard eine der besten Vorschulen zu einem tieferen Verständnis für das Mönchtum, wie denn sein schwerwiegender Kampf gegen die dänische Staatskirche vorherrschend von asketischen Gesichtspunkten aus entworfen wurde.
Man wird diese mannigfachen Versuche gewiß nicht überschätzen dürfen, sie gelten aber als Symptome einer Mangelerscheinung im Protestantismus, die beseitigt werden sollte. Das Problem ist in der evangelischen Kirche nie ganz zur Ruhe gekommen; die Wunde muß auch offengehalten werden. Ihre Behandlung ist heute aktueller als je, weil die zu schmale Basis für ein nur auf das Gemeindebewußtsein abgestelltes Christentum offenbar geworden ist. Die Katastrophe ist in dem Augenblick da, wo die Gemeinde, wie eine Romanfigur von Bernanos sagt, zur «toten Gemeinde» absinkt. Das christliche Leben bedarf unbedingt weiterer Verankerungen als derjenigen der Kirchgemeinden, und eine solche Möglichkeit bietet die christliche Bruderschaft.
Der historische Überblick über die Auswirkung des Mönchtums in den drei Konfessionen der Christenheit erheischt eine Ergänzung durch die religiöse Sicht. Sie fragt nach dem Sinn des Mönchseins und ist prinzipieller Natur. Die in ihr enthaltene Wertfrage legt das Ordenswesen gleichsam auf Hiobs Waage und will sich über seine Bedeutung angesichts der Ewigkeit klar werden. Diese zweite Betrachtung knüpft an das berühmte Wort des Feldhauptmann Georg von Frundsberg an: «Mönchlein, Mönchlein, du gehst jetzt einen Gang, einen solchen Stand zu tun, dergleichen ich und mancher Oberste auch in unserer allerernstesten Schlachtordnung nicht getan haben; bist du auf rechter Meinung und deiner Sache gewiß, so fahre in Gottes Namen fort und sei nur getrost, Gott wird dich nicht verlassen21.» Die in denkwürdiger Situation gesprochene Äußerung enthält einen gewichtigen, für jeden Mönch gültigen Hinweis. Niemals ist der angewandte Diminutiv geringschätzend gemeint, deutlich verrät er einen beinahe zärtlichen Unterton. Zu allen Zeiten ist der Weg des Mönches weder leicht noch selbstverständlich, sein Pfad führt immer an lichten Höhen und dunklen Abgründen vorbei, und ihn zu begehen, erfordert kühnen Mut.
Eine religiöse Wertung des Mönchtums darf von keiner Schönfärberei des Ordenswesens ausgehen. In der blinden Verherrlichung besteht der Fehler des umfangreichen Werkes von Montalembert, «die Mönche des Abendlandes», der wahrscheinlich der eigenen Unerfahrenheit im monastischen Leben zuzuschreiben ist. Der gereifte Mönch spricht anders als der französische Romantiker und ist deswegen von keiner geringeren Liebe zum klösterlichen Dasein erfüllt. Gegenüber den vor Gesalbtheit nur so triefenden, alles nicht engelhaft Aussehende unterdrückenden Darstellungen ist das Wort Nietzsches angebracht: «Wollt ihr die besten Dinge und Zustände zuletzt um alle Ehre und Wert bringen, so fahrt fort, sie in den Mund zu nehmen wie bisher!»22 Ein unheimlich wahres Wort, das die Mißlichkeit der vorwiegend moralisch anstatt religiös eingestellten Hagiographie des 19. Jahrhunderts, die in eine tödliche Langweiligkeit abgeglitten war, rücksichtslos aufdeckt. Die Mahnung des Verfassers der «Fröhlichen Wissenschaft» kann von dem heutigen Christen als beständiges Memento nicht ernst genug genommen werden. Sie legt ihm eine schwere Verantwortung auf, der er sich gerade bei der neuen Begegnung mit dem Mönchtum nicht entziehen darf. Nicht in dem faden, oft auch direkt unehrlichen Ton des Lobredners des Ordenstandes gilt es weiterzusprechen, ein neues Alphabet ist vielmehr vonnöten. Mit Enthüllungspsychologie, die einen niedrigen Standort vertritt, hat diese vertiefende Bemühung nichts zu tun. Wohl aber schließt sie die grundsätzliche Befreiung von jener Apologetik in sich, die gleich Hiobs Freunden «Gott mit Trug verteidigt» (Hiob 13,7) und deswegen sich so erschreckend oft gegen die Wahrhaftigkeit versündigt. Sie ist ohnehin mit der erwähnten neuen Position von Novalis nicht zu vereinen, die wieder das liebende Schauen der ewigen Werte an Stelle der zergliedernden Besserwisserei setzt. Wer sich um das neue Alphabet bemüht, hat auch vom Unerfüllten offen zu reden, womit man keineswegs gegen die notwendige Ehrfurcht verstößt. Die Schmach des Mönchtums soll nicht vertuscht werden, ohne die es nicht teil hätte an der Herrlichkeit Gottes. Das oberste Bestreben geht dahin, zur monastischen Wirklichkeit vorzudringen, die auch die ungenügende Betrachtung von Idee und Praxis überwindet, welches das Zusammengehörende unzulässig auseinander spaltet. Die lebendige Bemühung ist auf jene tiefere Realität gerichtet, die heroische Erfüllung und klägliches Versagen zugleich umschließt und das Mönchtum als jene gottbewirkte Bewegung erfaßt, die, schwerste Schläge aushaltend, gerade darin ihre christliche Lebenskraft bewies. Durch die düstersten Schatten brach bei den Orden immer wieder das Licht siegreich hindurch. Einzig eine vom religiösen Realismus getragene Bewertung vermag zur mönchischen Wirklichkeit vorzustoßen, die in aller Niedrigkeit noch gotterfüllter ist als die übertünchten Zurechtrückungen.
Der Weg des Mönches ist der außergewöhnliche, und das Unglück besteht darin, daß er von zu vielen gewöhnlichen Menschen beschritten wurde, die ihm nicht gewachsen waren und denn auch folgerichtig an ihm scheiterten. Franz Xaver Bronners bekannte Autobiographie «ein Mönchsleben aus der empfindsamen Zeit», redet in dieser Beziehung eine unüberhörbare Sprache. Als Jüngling wurde Bronner zum Mönchsleben gegen seinen Willen überschwatzt und sann dann im Kloster seiner tändelnden Liebelei weiter nach. Da er sich um sein Leben betrogen fühlte, erzählte er aus seinem Ressentiment heraus ekelhafte Szenen mönchischer Verwilderung23. Es gibt kein stilwidrigeres Bild als diese unreligiösen Klostermemoiren; die großen Fragen des Mönchtums sind dem Verfasser in keiner Stunde seines Lebens auch nur annähernd aufgedämmert. Nicht nur im Rokokozeitalter traten viele unberufene Naturen in das Kloster ein, auch in der Gegenwart geschieht dies immer wieder. Sie verursachen jene komische Vorstellung von sich selbst gefangen haltenden Menschen, die trübsinnig hinter Klostermauern versauern und dadurch als Arbeitskräfte ihrem Volke verloren gehen. Diese Unberufenen täten besser, wie Monica Baldwin «über die Mauern zu springen», um ihr verfehltes Leben wenigstens noch notdürftig zu korrigieren, so gewiß ihnen auch kein wirklich Berufener nachspringen wird.
Diese ungeeigneten Menschen führten zu der abstoßenden Erscheinung jener Mönche, die Gott mit ihrer Tonsur belügen, wie sich Benedikt von Nursia einmal in seiner Regel ausdrückt. Sie sind in allen Jahrhunderten anzutreffen und veranlaßten François Mauriac das böse Wort vom «Snobismus der großen Orden» zu schreiben: «Zwar würde man bestimmte Ordensleute bestimmter Abteien in Staunen setzen, wenn man ihnen bewiese, daß ihr Geisteszustand sich nicht allzusehr von dem der Mitglieder eines Jockeyklubs unterscheidet24.» Das Bedrückende an diesem traurigen Vorkommnis liegt in dem über das Einzelschicksal weit hinausgehenden allgemeinen Verderben, was sich aus dieser abwegigen Entwicklung notwendig ergab. Der aus dem Verfall der Klosterzucht resultierende Niedergang des Mönchtums hat sich jeweilen verheerend für die gesamte Christenheit ausgewirkt, seine katastrophalen Folgen können nur mit den schwärzesten Farben geschildert werden. Diese ungünstigen Auswirkungen des Ordenswesens sind unlösbar mit dem nicht leichten Gang verbunden, den der Mönch allezeit zu gehen hat.
Die Nachtseite des Mönchtums, die gewöhnlich seine Feinde mit Frohlocken anzuführen pflegen, ohne dabei nur zu ahnen, welch schlechtes Zeugnis sie sich damit selbst ausstellen, erschließt natürlich niemals dessen tieferen Sinn. Neben den Gefahren gibt es noch eine andere Auswirkung, die, in die Waagschale geworfen, auf der Stelle die Gewichtsverteilung vollständig verändert. Keineswegs ist damit eine Überschätzung des Mönchtums, als der höchsten christlichen Lebensform, verbunden. Vor solcher Überspannung haben die Mönche selbst gewarnt. In den Briefen des russischen Staretz Feofan, des Einsiedlers, stehen die Worte: «Es ist besser, nicht darüber nachzusinnen, ob einem das Kloster beschieden ist oder nicht, denn darauf kommt es nicht an. Wenn man das Kloster im Herzen hat, dann ist es gleichgültig, ob das Klostergebäude vorhanden ist oder nicht. Das Kloster im Herzen ist: Gott und die Seele25.» Dies ist vortrefflich geurteilt; in der Anerkennung des monastischen Lebens sollte man sich nicht mönchischer als die Mönche selbst gebärden. Sinnvoll aber ist es, daran zu denken, daß moderne Dichter wie Hugo von Hofmannsthal und Gerhard Hauptmann den Wunsch aussprachen, in einem Mönchshabit begraben zu werden. Nicht anders ist dieser letzte Wille zu deuten, als daß sie noch mit ihrem Tode ein Bekenntnis zum Mönchtum abzulegen begehrten.
Eine religiöse Überlegung über das monastische Thema wird vorbehaltlos die Größe des Mönchtums anerkennen. Ihm kommt tatsächlich ein dermaßen gewaltiges Gewicht zu, daß seine bedenklichen Verfallsepochen bei weitem aufgewogen werden. Die Tat jener Mönche, die ihren Auftrag erfüllten, stellt alle Versager in den Schatten. Vor aller Augen liegen die kulturellen Leistungen der Ordensleute aus den früheren Jahrhunderten, die bleibende Werte schufen. Doch geht der einseitige Hinweis auf die kulturfördernde Arbeit der Mönche am tiefsten Sinn des monastischen Lebens vorbei.
Das Mönchtum ist aus seinen eigenen Voraussetzungen heraus zu begreifen, und die liegen ausschließlich auf religiösem Gebiet. Nur die absolut christliche Erfassung des Ordenswesens entspricht seiner Wesensbestimmung. Jeder andere Gesichtspunkt verfehlt das Entscheidende. Wesentlicher als alle äußern Verdienste ist die rein auf das Ewige ausgerichtete Gottesliebe, die im Monasterium wie ein Rosenstrauch erblüht. Der Mönch ist der religiöse Mensch schlechthin, bei dem die brennende Sorge um die Seele im Mittelpunkt steht. Alles opfert er seiner christlichen Glut, die in ihm wie ein neuer Dornbusch lodert. Um der Regel willen, der er nachzuleben strebt, ist er ein disziplinierter Mensch. Der Mönch unterwirft sich bewußt einer christlichen Norm, die sein ganzes Leben formt und erleuchtet. Die vorbehaltlose Anerkennung eines Unbedingten verleiht seinem Dasein das geordnete Aussehen, wodurch ihm alle äußere und innere Zerfahrenheit fremd ist. In dieser inneren Festigkeit besteht der göttliche Glanz, der über dem monastischen Leben ausgebreitet ist.
Diese normative Einstellung befreit den Mönch von aller Unruhe und aller Ratlosigkeit, mit denen es die Menschen sonst beständig zu tun haben. Er kennt sein Lebensziel und weiß den Weg, den er zu gehen hat; mit dem Eintritt ins Kloster entschloß er sich auch, ihn konsequent zu beschreiten. Im schärfsten Gegensatz zur modernen Orientierungslosigkeit ist der Mönch der wegweisende Mensch, der einen Pfad nicht nur den andern predigt, sondern ihn auch selbst geht. Größeres kann von einer menschlichen Existenz kaum ausgesagt werden, und hier nähert man sich dem ewigen Geheimnis allen Mönchtums. Die geistige Mächtigkeit, jede Frage des verworrenen Lebens aus einer überlegenen Religiosität heraus richtunggebend zu beantworten, bildet einen der Hauptgründe für die tiefe Anziehungskraft, die das Mönchtum immer wieder ausstrahlt. Nichts fehlt unserer dunklen Gegenwart so sehr, als diese zu innerer Führung befähigten Persönlichkeiten, von denen eine therapeutische Wirkung ausgeht. Um der mönchischen Wegsicherheit willen ist es von bleibender Bedeutung, sich ernsthaft mit den Vätern des monastischen Lebens zu beschäftigen, was sich auch für ein in der Welt sich abspielendes Leben erhellend auswirkt
Der Einwand, «aber es ist nicht der Weg, der sich für alle Menschen eignet», verfängt nicht. Gewiß ist er das nicht; allein, von welchem Weg kann dies behauptet werden? Nie ist eine Möglichkeit für alle gegeben, dieweil sie stets nur für eine bestimmte seelische Konstitution in Frage kommt. Gleichwohl schließt die mönchische Wegweisung das Geheimnis in sich, eine stille Leuchtkraft auszusenden, welche die Finsternis des Lebens überhaupt zu durchdringen vermag. Bei wenigen Bewegungen werden die enormen Kräfte, die das Evangelium im Menschen zu entbinden imstande ist, so deutlich sichtbar wie beim Studium des Mönchtums, aus dessen Mitte weithin die größten Söhne des Christentums hervorgegangen sind. Wir müssen wieder lernen, die Mönche mit den Augen Léon Bloys anzuschauen: «Diese Männer des Gebetes, diese Einfältigen, die sich ohne Murren unterdrücken ließen, die unser idiotenhafter Dünkel verachtet, sie trugen das heilige Jerusalem in ihren Herzen und Hirnen. Sie übertrugen, wie sie es nur zu tun vermochten, ihre Verzückungen auf die Steine der Kirchen, auf die strahlenden Glasfenster der Kapellen, auf das Pergament der Stundenbücher. Unser ganzes Bestreben muß – wenn wir nur ein wenig Größe in uns haben – dahin gehen, wieder zu dieser leuchtenden Quelle emporzusteigen26.»
Die erwähnten Worte des französischen Christen fuhren zu der aktuellen Sicht, welche die Folgerungen aus der historischen und religiösen Schau zu ziehen hat. Sie ist gegenwartsbezogen und geht von der Frage nach der Sendung des Mönchtums in der heutigen Zeit aus. Dabei handelt es sich nicht um eine These, die mit monomaner Leidenschaft verfochten werden soll, sondern um ein Ergebnis, das hier vorweggenommen wird. Die nachfolgenden Ausführungen sind als ein Resultat der ganzen Arbeit aufzufassen; sie stellen in Wirklichkeit ein Nachwort dar, das ausnahmsweise als Vorwort geboten wird.
Wer dem 20. Jahrhundert, das sich weigert, die Erlebnisse zweier Weltkriege zu verarbeiten, ins Angesicht schaut, der wird nicht umhin können, als vom Zeitalter der Zerstörung zu reden. Es stürzt von einer Katastrophe zur andern und findet aus dem tödlichen Wirbel keinen Ausweg mehr. Sein Fratzenbild ist der Mann mit der Maschinenpistole, der über ihre endlosen Trümmerfelder hinwegstampft. «Der Mann steht im Dienste der Maschinenpistole und nicht umgekehrt, man sollte nicht vom Mann mit der Maschinenpistole sprechen, sondern von der Maschinenpistole mit dem Mann», sagte Georg Bernanos in seiner erschütternden Genfer Rede «Welt ohne Freiheit»27. Diese entsetzliche Vernichtungsvision, welche die Dinge so sieht, wie sie wirklich sind, starrt den Menschen an. Entscheidende Fragen bedrängen jeden wahren Christen unablässig: Wie ist auf diese dämonische Apokalypse zu antworten? Wessen bedarf es, um dem Tier aus dem Abgrund wirksam zu begegnen? Wer ist dem Roboter unserer Zeit innerlich gewachsen und imstande, als Gegenspieler ihn im geistigen Kampf zu schlagen? Diese gewaltigen Fragen bilden das tiefste Thema der christlichen Geschichte der kommenden Jahrzehnte. Von den Staatsmännern irgendeine Lösung in der allgemeinen Zersetzung zu erhoffen, ist eine vergebliche Erwartung. Sie können nicht geben, was sie nicht haben. Die Regierungen der Gegenwart denken zu ausschließlich in politisch-militärischen Kategorien und fassen die Probleme völlig ungeistig auf. Deswegen sind sie zur Stunde auch aller neuen Ideen bar und kennen kein anderes Mittel als die Diplomatie, die noch immer versagt hat. Eine wirkliche Überwindung der drohenden Vernichtung der menschlichen Kultur kann nur vom Christentum herkommen. Allerdings nicht von einem Evangeliumsverständnis, das selbst von dem Fäulnisprozeß angesteckt ist, sondern von einem erneuerten Christentum, dessen Boten wieder in völliger Wehrlosigkeit wie Schafe mitten unter die Wölfe gehen, die mit dem neuen Gebot der Liebe, daran jedermann Christi Jünger erkennt, ganz Ernst machen und denen als kleine Herde auch wiederum die lebendige Hoffnung auf das Reich gegeben ist. Diese christlichen Christen versuchen, sich leidenschaftlich über die große Funktion Klarheit zu verschaffen, die dem Mönchtum bei der zukünftigen Gestaltung der Dinge im christlichen Raum zukommt.
Jeder Versuch der Erneuerung eines kompromißfreien Christentums wird auf die Ordensväter zurückgreifen. Eine Neubelebung der Orden in ihrem ursprünglichen Sinn wäre eine der wirksamsten Hilfeleistungen im Geisteskampf der Gegenwart. Diese unvoreingenommene Rückbesinnung, nein, Urbesinnung auf die großen Stiftergestalten gliche einer Fruchtbarmachung der edelsten Tradition abendländischer Christlichkeit. Die Stifter der großen Orden verkörpern die ursprünglichsten Kräfte, die von zeitloser Dauer sind, in reinster Ausprägung. Ihnen allein ist es gegeben, die von ihrem ersten Eifer abgewichenen Klöster wieder zu ihren Anfängen zurückzuführen. Die Mönchsväter schließen die Möglichkeit einer neuen Beschwörung der Urkräfte in sich. Sie sind einem Samenkorn zu vergleichen, welches die Fähigkeit hat, noch nach Jahrhunderten ganz unerwarteterweise wieder zu keimen. Darum ist eine geistige Wiederkehr der Ordensgründer die grundlegende Voraussetzung für eine neue Sendung des Mönchtums in unserer Zeit. Wenn ihre erste Erscheinung schon unübersehbare Wirkungen hervorgerufen hat, was für gewaltige Felgen hat erst ihre zweite Epiphanie für das Sein der Welt! Wie niemand anderer haben die großen Väter der Mönche die Verantwortung für das Ganze auf ihren Seelen getragen. Die Ordenstradition enthält ebenfalls die bedeutsame Auseinandersetzung mit der Zeit, doch sie muß dem Gründer gegenüber untergeordnet werden. Über alle sich im Laufe der Jahrhunderte herausgebildeten Gewohnheiten hinweg, gilt es stets den Ursprung in seiner Reinheit bloßzulegen, der allein einen Orden wieder in Bewegung bringen kann. Eine religiöse Wiedergeburt des monastischen Lebens hat auf die geistigen Intentionen zurückzugreifen, wenn «die Antwort der Mönche», um mit Walter Dirks aufgeschlossenem Buch zu reden, zu einem neuen Frühling führen soll.
Neben der Reaktivierung der alten Orden tritt als zweite, gewichtige Möglichkeit der bewußte Wille zu neuen Ordensgründungen. Ein im ersten Moment phantastisch scheinendes Unternehmen, das aber im Zeitalter, da sich die Form des Mönchtums von Grund auf wandelt, nicht eine bloße Utopie sein muß. Vielmehr nähert man sich damit jenem entscheidenden Punkt, um dessentwillen allein dieses Buch geschrieben wurde. Entschuldbar, wenn die Rede mehr einen stammelnden Charakter annimmt, wo sie am liebsten in den Ton der Beschwörung übergehen würde. Obschon der Christ weiß, daß der Ewige tausend Möglichkeiten hat, seine Pläne zu verwirklichen, die der Mensch gar nicht erwägt, ist man innerlich gedrängt, in der heutigen Zeit vor allem von neuen Ordensgründungen eine Wendung zu erwarten. Das Heil kommt durch ein neues, verwandeltes Mönchtum! Mag diese Erwartung als ein Beißen auf Granit verlacht werden, so hat dieser Hohn wie aller ungläubige Spott nichts zu bedeuten. Um die unumgängliche Notwendigkeit neuer Ordensgründungen zu erkennen, braucht man sich nur einmal die Bedeutung der geistlichen Ritterorden für das Mittelalter zu vergegenwärtigen. Was fehlte doch in der Christenheit, als es diese Querverbindungen zwischen Religion und Staat nicht mehr gab! Nur mangelndes Verantwortungsgefühl für das Abendland kann deren einstige Wirksamkeit als unwesentlich beurteilen. Auch die neuzeitliche Christenheit wird auf die Dauer nicht ohne eine neue Übertragung des Ordensgedankens auf die Gegenwart auskommen. Sie kann sich deren Dringlichkeit nicht länger verschließen, sobald sie das Problem nicht von einem konfessionellen Parteistandpunkt aus betrachtet, der immer der Wahrheit Abbruch tut. Die bedrohte Christenheit bedarf der neuen Orden, weil nur eine neue «Bruderschaft der vom Schmerze Gekennzeichneten», wie Albert Schweitzer sagt, auf die geistige Not der Jetztzeit die richtige Antwort geben kann. Vielleicht ist auch nur sie imstande, in der heutigen Aufspaltung der Welt zwischen dem kapitalistischen Westen und dem kommunistischen Osten jenes dritte Sein herbeizuführen, das allein der abendländischen Christlichkeit entspricht. Der Ausblick auf eine solche Möglichkeit gehört zu den tiefsten Hoffnungen, die unsere trübe Zeit erhellen.
Keineswegs sind neue Ordensbildungen ein Ding der Unmöglichkeit, wie der moderne Skeptizismus behauptet, der meint, Menschen von dieser selbstlosen Verzichtleistung und überbürgerlichen Lebenseinstellung gäbe es in unserer Zeit nicht mehr. Diesem Zweifel hält der Glaube den Ausspruch Christi entgegen: Bei Gott sind alle Dinge möglich. Bereits künden sich die ersten zaghaften Versuche an. Von den verschiedenen Anzeichen seien nur das protestantische Unternehmen von Taizé bei Cluny erwähnt, wenn es auch noch ganz in den Anfängen steht. Welchem unabweisbaren Bedürfnis es entgegenkommt, beweist die Entstehung weiblicher Parallelbewegungen in der Westschweiz und in Deutschland. Ebenso ist auf den mutigen Versuch der katholischen Arbeiter-Priester hinzuweisen, die mit ihren einfachen Gelübden das harte Leben von Schlossern, Mechanikern usw. in den Fabriken von Paris fuhren, um den verlorenen Kontakt mit dem einfachen Volk wieder herzustellen, nicht durch Predigt und Bekehrungsversuche, sondern einzig durch ihre Gegenwart und ihr Beispiel. Hierin und anderswo liegen Ansätze zu einer neuen Ordensgründung vor, wobei man sich fragen kann, ob dafür nicht auch ein neuer Begriff einzuführen wäre.
Bestimmt kann die Rettung aus unserer verwirrten Zeit nur aus kleinen Kreisen hervorgehen, die zunächst des Mutes bedürfen, klein zu bleiben, um nicht durch ungeeignete Elemente zum voraus belastet zu werden. Die neuen Bruderschaften dürfen jedoch nicht mit einem interessanten «Ring» oder gerissenen «Klub» verwechselt werden, die im Unverbindlichen hängen bleiben. Ihre Lebensgemeinschaft wird sich zu dem monastischen Dasein bekennen, dessen Satzungen verpflichtende Gelübde in sich schließen und die auf dem religiösen Opfergedanken aufgebaut sind. In diesen neuen Ordensgründungen beginnen wieder die Quellen der Mystik zu fließen, die eine der wesentlichsten Voraussetzungen für eine christliche Wiedergeburt sind. Gedeiht doch nur in der Stille der neuen Klosterbehausungen und nicht in den geistreichen Caféhaus-Unterhaltungen jenes mystische Leben, das dem Menschen wieder die wirkliche Gottesverbundenheit vermittelt, ohne die es keine Genesung gibt.
Ein neues Mönchtum kann jedoch nur dann eine wirksame Umgestaltung des ganzen Zeitbewußtseins herbeiführen, wenn es nicht einfach in den bisherigen Vorstellungen eingemauert bleibt. Statt bloß rückwärts gewandte Hüter der Vergangenheit zu sein, hat es sich entschlossen, der Zukunft sich zuzuwenden. Die neuen Ordensgründungen müssen neue Bahnen beschreiten und dürfen nicht nur Imitationen sein. In der Mönchsgeschichte ist es immer wieder zu solch kühnen Schritten gekommen. Bei aller Ewigkeitsverwurzelung haben die neuen Orden die Farbe des 20. Jahrhunderts zu tragen, genau wie das Anachoretentum vom vierten Säkulum geprägt war. In ihrer Sendung wissen sie, daß Gott unendlich viel wichtiger ist als alle Klöster zusammen, der sich jedoch ihrer bedient, was nicht bezweifelt werden kann. Die neuen Mönche werden auch das, was mehr ist als der Orden, erkennen und gerade mit dieser Einsicht ins Übermönchische die Haltung des neuen monastischen Lebens unter Beweis stellen.
Bei aller brennenden Sehnsucht nach neuen Ordensgründungen können diese doch nicht künstlich gemacht werden, wenn sie nicht zur bloßen Farce werden wollen, die keinen Bestand hat. Göttliches empfängt man nie auf Bestellungen, stets wächst es organisch und beinahe lautlos. Nicht zufällig waren die Stifter der früheren Orden Heilige, die immer von Gott zu einer ganz bestimmten, geschichtlichen Stunde gesandt wurden. Die Heiligkeitsatmosphäre ist eine davon so wenig abzulösende Bedingung, wie die damit verbundene providentielle Geschichtsmission. Das Entstehen neuer Orden kann nur erbeten werden und ist vom Wehen des Geistes abhängig. Jeder Mönchsvater war ein Gefäß göttlicher Erwählung. Seine Gründung war ein Werk der Gnade. Echte Orden sind stets Geist-Schöpfungen, daher jeweils die Unwiderstehlichkeit ihrer Ausbreitung. Aus diesem Grunde kann es aber auch jeden Moment zu einem neuen Aufbruch kommen. Ohne diese Hoffnung müßte der Christ im Pfuhl des trostlosen Pessimismus versinken, mit diesem Glauben dagegen ist er in der dunkelsten Stunde nicht verzweifelt. Das Warten auf neue Ordensgründungen kreist unablässig um die eine Frage: Ist die Stunde für eine neue Antwort gekommen? Kann die neue Ordensform noch nicht geprägt werden? Hüter, ist die Nacht bald hin?
Bis es zu diesen, vom Geist bewirkten neuen Ordensgründungen kommt, erinnere man sich an Dostojewskijs Aljoscha aus den «Brüdern Karamasoff». Aljoscha ist zwar ein einmaliger Mensch, der in seiner unheiligen Heiligkeit nur mit Vorsicht als Vorbild genommen werden kann. Der Dichter, der so viel getan hat für das Verständnis des russischen Mönches und in ihm das Bollwerk gegen den Nihilismus sah, läßt überraschenderweise den Lieblingsschüler Aljoscha nicht im Kloster des Staretz Sossima bleiben, sondern er schickt ihn ausdrücklich in die Welt hinaus, die seiner so dringend bedarf. Nicht um sich an der «karamasoffschen Gemeinheit» zu beteiligen, welche Mitja und Iwan ins Unglück stürzt. Vielmehr eilt Aljoscha wie ein Cherub in Menschengestalt davon, um die erlösende Botschaft in die Verstrickungen seiner leidvollen Brüderwelt hineinzutragen. Innerlich bleibt Aljoscha ganz dem Kloster des Staretz Sossima verhaftet, aber äußerlich trägt er fortan ein weltliches Kleid. In seiner Doppelhaltung verkörpert er das geheime Kloster inmitten der in Finsternis eingehüllten Welt der Karamasoffs. In dieser Sendung gibt er sich als einer der ersten Vorboten des verwandelten Mönchtums zu erkennen, nach welchem man sehnsüchtig Ausschau hält und das gewiß noch einmal aus seiner Unsichtbarkeit heraustritt. Ein Aljoscha in unserer Zeit wird als neuer Mönch der modernen Welt wieder jenes christliche Wort verkünden, welches sie allein aus der gegenwärtigen dritten Sintflut errettet …
ANTONIUS UND DAS EREMITENTUM
IN einer ägyptischen Kirche ereignete sich im 3. Jahrhundert ein scheinbar alltägliches Vorkommnis, das jedoch eine nicht alltägliche Wirkung nach sich zog. Schon öfters geschah es, daß in einem Gottesdienst aus dem Evangelium der Abschnitt vom reichen Jüngling verlesen wurde, und immer fühlten sich durch diese Gepflogenheit die Zuhörer lediglich in ihrer eigenen Erbaulichkeit bestärkt. Lange Zeiten schlummern gleichsam die Bibelworte als friedliche Lesungen in der Heiligen Schrift, bis sich plötzlich die in ihnen eingeschlossenen Kräfte zu regen beginnen und die Welt in Brand stekken. Das an sich gewöhnliche Vorkommnis führte unerwarteterweise zu einem ungewöhnlichen Ereignis, weil ein junger Mann mit Namen Antonius in jener Kirche saß. Er hörte aufmerksam zu und ihm war es «als ob um seinetwillen jene Lesung der Schriftstelle geschehen sei»1. Einzig diese Einstellung ließ den häufigen kirchlichen Brauch zu einem bestürzenden Vorgang werden. Antonius bezog die verlesenen Worte direkt auf sich. Sie gingen ihn und nicht den frommen Nachbarn an. Es war ihm, als hörte er aus dieser Erzählung nur den einen Anruf: Du bist der Mann! Mit einem Schlag kam er sich als der wiedergekehrte reiche Jüngling vor. Nur ein Bibelwort, das der Einzelne auf sich anwendet, kann überhaupt fruchtbar werden. Die Beziehung auf die eigene Person bildet die unumgängliche Voraussetzung seiner Keimfähigkeit. Der Eindruck: «um seinetwillen sei jene Lesung der Schriftstelle geschehen», machte diesen sonst harmlosen Gottesdienstbesuch zu einer der folgenschwersten Stunden für die gesamte Christenheit.
Die Antwort Jesu an den reichen Jüngling: «Willst du vollkommen sein, so gehe hin, verkaufe was du hast, und gib es den Armen und du wirst einen Schatz in den Himmeln haben; komm und folge mir nach» (Mt. 19,21) stürzte Antonius zunächst in eine schwere, innere Unruhe, die den Anfang des geistigen Erwachens bildete. Die Forderung des Evangeliums bewirkte in ihm eine seelische Erschütterung, die bis in seine Wurzeln reichte und sein bisheriges Leben grundsätzlich in Frage stellte. Wie in einem Spiegelbild sah er sich in diesem Bibelwort als ein zweiter, reicher Jüngling, da er ebenfalls viele Güter besaß. Totenblaß traf ihn das Wort von dem Vollkommenheitsstreben, ohne welche Bemühung das ewige Leben nicht zu erlangen ist. Aber Antonius begann doch nicht wie der Reiche nach dem Hebräer-Evangelium «unwillig in seinen Haaren zu kratzen», eine hilflose Gebärde, die das tragische Versagen des Jüng lings verdecken wollte, der so großmaulig gesagt hatte, «das habe ich alles getan». Die Situation bestand gleichwohl nicht in einer bloßen Wiederholung, sondern in Antonius war ein anderer reicher Jüngling wiedergekehrt. In seiner Aufgewühltheit wartete er nicht einmal das Ende des Gottesdienstes ab. Die Lesung hatte ihn dermaßen ins Gewissen getroffen, daß die Angelegenheit keinen verzögernden Aufschub duldete. Auf der Stelle mußte gehandelt werden, und zitternd ging Antonius aus der Kirche hinaus, weil er seiner innern Erregung nicht mehr Herr zu werden vermochte. Welch denkwürdige Begebenheit! Nur ein einziges Mal wurde in einem christlichen Gottesdienst die Geschichte vom reichen Jüngling ohne jede Abschwächung ganz ernst genommen, und dieses eine Mal genügte, um daraus eine unübersehbare Bewegung hervorgehen zu lassen. Erst der wiedergekehrte reiche Jüngling hat diese Begebenheit des Evangeliums zum richtigen Abschluß geführt. Im Matthäusevangelium bricht sie infolge des traurigen Davongehens des jungen Mannes unbefriedigend ab. Antonius begriff, daß dieses Ereignis der wiederaufnehmenden Weiterführung harrt, und durch sein Verhalten wird das Neue Testament in der Kirchengeschichte gleichsam zu Ende «gedichtet», wenn man diesen gewagten Ausdruck für diese neue Auflassung gebrauchen darf.
Die religiöse Bestürzung kam nicht völlig unerwartet über Antonius. Der um das Jahr 250 im oberägyptischen Koma von christlichen Eltern geborene Antonius war schon früh von empfänglicher Gemütsart gewesen. Er war ein in sich gekehrter Knabe, spielte kaum mit Gleichaltrigen und hielt sich von ihnen absichtlich fern. Nach dem Tode seiner Eltern verwaltete er den geerbten Grundbesitz, der ihn zum reichen Jüngling machte und ihm zugleich durch die damals unerfreulichen Steuerverhältnisse in Ägypten mit allerlei Sorgen belastete. Inmitten dieser Situation übte die Botschaft der Bergpredigt mit ihrer Aufforderung «sorget nicht um den morgigen Tag» auf ihn eine verlockende Anziehung aus. Die Gütergemeinschaft der Urgemeinde kam ihm in den Sinn und zugleich die großen Opfer, welche die Apostel im Unterschied zu den Christen seiner Tage sich kosten ließen, um das Gottesreich zu gewinnen. Alle diese Momente haben die Voraussetzungen jener Lebenskrise geschaffen, die über den Zwanzigjährigen hereinbrach und die durch die Lesung in der Kirche zum offenen Ausbruch kam. In diesem Augenblick stürmten sie alle in verdichteter Weise auf Antonius ein und bewirkten die ungeheure Verschärfung seiner seelischen Erschütterung, die eine radikale Lösung erheischte.
Die Bedingung, die Jesus zur Erreichung der Vollkommenheit nannte, war die Veräußerung des Besitzes. «Verkaufe was du hast und gib es den Armen», diese Worte hallten in den Ohren Antonius’. Er konnte sie nicht wie eine wässerige Bibelerklärung nur «geistig» verstehen, oder als eine Mahnung Jesu, die bloß jenem längst verstorbenen Menschen gegolten habe. Mit diesen Auslegungen wird dem Text nur eine wächserne Nase gedreht, und von einer solchen Eulenspiegelei war Antonius weit entfernt. Das Wort Jesu stand in seinem ganzen Radikalismus als unerbittliche Forderung unmißverständlich vor ihm. Er begann demzufolge seine Besitzungen an die Bewohner seines heimatlichen Ortes abzugeben. Seine übrige Habe verkaufte er, schenkte den Erlös den Armen, und nur eine geringe Summe legte er mit Rücksicht auf die unerwachsene Schwester beiseite. Die Güterverteilung war eine Tat von grundsätzlicher Bedeutung. Pflegt doch der Mensch an seinem Eigentum mit allen Fasern seines Wesens zu hängen, das preiszugeben ihn beinahe übermenschliche Selbstüberwindung kostet. Es bedarf eines scharfen Schnittes ins eigene, blutende Fleisch, um dem Radikalismus von Jesu Forderung nachzukommen. Das ewige Leben verlangt den höchsten Einsatz des Menschen, welche nach Jesu Auffassung die Weggabe der Habe in sich schließt. Wer zwischen Gott und dem Mammon geteilt ist, wird die Vollkommenheit nicht erreichen. Darum muß der Besitz fallen, welchem der Mensch doch hörig wird und der ihn deswegen an der Erlangung seiner Freiheit hindert. Jedoch sind nur ungewöhnliche Naturen zu diesem einschneidenden Bruch mit der bürgerlichen Welt des Besitzes fähig. Während der Jüngling des Evangeliums wegen dieser Forderung traurig von dannen schlich, gehörte Antonius zu diesen heroischen Gestalten und verkörperte damit eine Wiederkehr des reichen Jünglings auf höherer Ebene. Durch seine Güterabgabe befreite er sich von seinen goldenen Fesseln und betrat den Pfad des Außerordentlichen. Es gibt nicht nur die politische Freiheit und die herrliche Geistesfreiheit, welche dem Menschen mit Recht teuer sind, sondern auch die viel zuwenig beobachtete Freiheit von den Dingen, die dem Christen nur unter schwerstem Ringen zuteil wird. Die Befreiung aus der Eigentumskette ist der überraschende und vielversprechende Auftakt im Leben des Antonius. Sie ließ ihn jenen unermeßlichen «Schatz in den Himmeln» erwerben, von dem Jesus sprach und der die positive Ergänzung zu der negativen Entäußerung der Güter bildet.
Aus dieser Begegnung mit Jesu Wort an den reichen Jüngling ist Antonius zu verstehen und nicht aus der ägyptischen Landschaft. Gewiß darf seine Herkunft von Ägypten auch einmal unterstrichen werden, obschon er mit der Kultur eines Echnaton nicht in Berührung kam, da er keine Bildung genossen hatte und nur die koptische Sprache verstand. Seit den Tagen Herodots hat das geheimnisvolle Land der Pyramiden in den Menschen mehr als nur ein neugieriges Interesse geweckt. «In den Bauwundern der Ägypter, hinter den Stirnen ihrer Steinriesen leben gewaltige Gedanken: aber wer wagt es, sie zu lesen? Dies und nichts anderes ist die ägyptische Sphinx. Sie waren kein größeres und kein geringeres Rätsel, als es alle Kreatur ist; aber daß sie nicht sprechen, ist das Unbegreifliche. Ihr Schicksal war, ein großes Rebus zu bleiben: sich und der Nachwelt2.» Wenn auch Antonius, neben Origenes und Athanasius zu den einflußreichsten Christen gehört, welche Ägypten der Kirche geschenkt hat, so darf er trotzdem nicht aus seiner ethnographischen Abstammung erklärt werden, zumal der koptische Volksstamm sich als der Hellenisierung des Christentums am wenigsten zugänglich erwies. Vielmehr ist er aus jener Tiefe zu deuten, welche in seinem prinzipiellen Zu-Ende-Denken von Jesu Vollkommenheitsforderung liegt und wodurch er erst die «ägyptische Finsternis» endgültig erhellte. Nur die religiöse Erfahrung machte ihn zu jenem Menschen, der ein völlig neues Element in die Christenheit hineinbringen konnte, dem man vor ihm in dieser Ausgestaltung nicht begegnet.
Nachdem sich Antonius auf radikale Weise seines Besitztums entledigt hatte, trat die zweite Forderung Jesu an ihn heran: «Komm und folge mir nach.» Antonius hat die Nachfolge Jesu mit der Askese gleichgesetzt. Dieses Verständnis war durch die Aufforderung der Güterverteilung naheliegend und war doch seine persönliche Deutung von Jesu Wort. Um die Nachfolge zu verwirklichen siedelte Antonius in ein Wohngemach am Rande des Dorfes über. Die Trennung von den Menschen vollzog sich etappenweise, womit jedes überstürzte Vorgehen vermieden wurde. Sie geschah nach dem Vorbild eines alten Mannes, einem Vertreter des Asketenstandes, der in seiner Nähe ein einsames Leben führte. Von ihm erlernte er die Anfangsgründe seiner neuen Daseinsform.
An der Grenze der menschlichen Behausungen begann für Antonius die Schule der Askese, welche sich zur großen Aufgabe seines Lebens auswuchs. Dem jungen Antonius wurde die Arbeit an sich selbst wichtig, die der Anfang der Selbstheiligung ist. Er faßte die Askese nach den Ausführungen des ersten Timotheusbriefes (4,16) als ein Achthaben auf sich selbst auf und als eine verschärfte Kontrolle über seine eigene Person. Sachte begann Antonius mit seiner Askese, die er während seines ganzen Lebens nicht mehr preisgab. Nach der ältesten Lebensbeschreibung «beobachtete er bei dem einen die Freundlichkeit, bei dem andern den Gebetseifer, an diesem sah er seine Ruhe, an jenem die Menschlichkeit, bei dem einen merkte er auf das Wachen, bei dem andern auf die Wißbegierde, den bewunderte er wegen seiner Standhaftigkeit; jenen wegen des Fastens und des Schlafens auf bloßer Erde»3. Was er an verschiedenen Übungen bei den Menschen sah, versuchte er sich anzueignen. Immer härtere Lebensbedingungen legte er sich auf und wurde durch diese asketische Schulung ein anderer Mensch. «Er wachte so lange, daß er oft sogar die ganze Nacht schlaflos zubrachte und dies nicht etwa einmal, sondern des öftern … Nahrung nahm er einmal des Tages zu sich nach Sonnenuntergang; bisweilen aß er nur alle zwei, oft aber auch bloß alle vier Tage; er lebte von Brot und Salz und als Getränk diente ihm nur Wasser4.» Zum Schlafen benützte er eine Binsenmatte, oder er legte sich einfach auf den Erdboden nieder. Antonius wollte auf seinem asketischen Weg nichts wissen von der Zeit, die schon verstrichen sei, weil nach seiner Erfahrung «die Askese täglich aufs neue beginnt»5. Nicht in die Vergangenheit darf der Nachfolger Jesu blicken, um auf dem Erreichten selbstgefällig auszuruhen. Immer von neuem ist der schwere Anfang zu machen, gemäß dem Worte des Propheten Elias: «Es lebt der Herr, vor dem ich heute stehe» (1. Kön. 18,15). Dieses «heute» des Mannes vom Berge Karmel war dem Antonius wichtig geworden, sagt er doch einmal: «Der Asket müsse in dem Lebenswandel des großen Elias wie in einem Spiegel beständig sein eigenes Leben sehen6.»
Mit seiner asketischen Arbeit hat Antonius das gewaltige Thema eröffnet, welches sich durch die ganze Geschichte des Mönchtums hindurch verfolgen läßt und in ihr oft einen Umfang angenommen hat, über den man nur staunen kann. Der von blinder Lebensgier erfüllte Mensch ist geneigt, die Askese zu verkennen und in ihr nur eine unfruchtbare Selbstquälerei zu sehen. Er fühlt sich von ihr wie vor den Kopf geschlagen and kann sie seinem Lebensgefühl nicht einordnen. Doch läßt sich diese Ablehnung bei längerem Nachdenken nicht aufrecht erhalten. Die Askese ist dem Evangelium in die Wiege gelegt. Nach Franz Overbecks Wesenserfassung ist «das Christentum zweifellos in seinem Grundcharakter asketisch, und zwar exzessiv asketisch»7. Die Weltverneinung kann nicht von ihm weggedacht werden. Die Askese sieht, von innen betrachtet ganz anders aus als es das vorschnelle Urteil über sie vermutet. In ihrem Wesen ist sie die tägliche Übung, um den geistigen Werten die Vorherrschaft zu sichern. Antonius hält dann «die Spannkraft der Seele für groß, wenn die Begierden des Körpers ohnmächtig sind»8. Um diese prachtvolle Spannkraft der Seele geht es bei der Askese und um nichts anderes. Sie bildet ihren entscheidenden Nerv, und sie kann nie genügend erhöht werden. Die Steigerung der seelischen Kräfte eröffnet dem Menschen eine ganz neue Welt, welche die äußere Wirklichkeit unwillkürlich verdunkelt. Sie versteht sich aber nicht von selbst, sondern hat die Anspannung der Seele bis zum Äußersten zur Voraussetzung. Die seelische Realität ist nur auf dem Weg über den Leib zu erreichen, diese Erkenntnis verleiht Antonius’ erster Station eine ungewöhnliche Größe. Kein geistiger Mensch kann auf das unablässige Ringen mit sich selbst verzichten, wenn er nicht unmerklich abgleiten will. Man merkt es jedem Christen an, ob er nach einer Sublimierung seiner Triebwelt strebt und sie für die geistigen Werte fruchtbar machen will oder ob er sich einfach seinen niedern Bedürfnissen überläßt, was immer den Tod der Seele zur Folge hat. Die echte Askese geht nicht aus einer Verneinung hervor; der sie ausübende Mensch hat einen köstlichen Schatz entdeckt, der ihn von den Niederungen des Daseins zu den hohern Regionen aufruft. In der Geschichte der Menschheit hat sich die Askese mit ihrer Erhöhung der Spannkraft der Seele als ein schöpferisches Element erwiesen, welches gewaltige geistige Kraft entband. Zwar gab es im Mönchtum auch Überspannungen der asketischen Übungen, die sich feindselig gegen das Geschöpf richteten und damit ins Unfruchtbare abglitten. Dieser negative Asketismus ist als eine Entartung zu bezeichnen, welcher zwar nicht die Gefahr ist, die der heutigen Menschheit droht und vor der die Vertreter der wahren Askese selbst gewarnt haben. Von Antonius wird die Äußerung überliefert: «Es gibt einige, die ihren Leib durchs Fasten schwächen; sie sind aber von Gott fern, weil sie keine Diskretion (Maßhalten) beobachten9.» Dem Mißbrauch gegenüber steht die positive Auffassung, die asketische Zucht als notwendiges Mittel und nicht als Ziel aufstellend. Für sie ist die Bändigung der Leidenschaft ein unumgängliches Durchgangsstadium. Die heroische Askese realisiert im Kampf mit der niedrigen Natur höchste religiöse Werte, die alles überstrahlen, was die Genußsucht dem Menschen vermittelt. Das asketische Ringen in seiner Jugendkraft haben die Mönche vertreten, bei denen über die Steigerung der seelischen Mächte unvergängliche Erkenntnisse zu finden sind.
Auch Antonius gelangte mit seiner Askese nicht ohne Kämpfe zum Ziel. Da sie der Weg zur Vollkommenheit ist, bekam er es bald mit schweren Versuchungen zu tun. In seiner Behausung am Rande des Dorfes stiegen alte Erinnerungen an seinen früheren Besitz auf, die Anhänglichkeit an die kleine Schwester erwachte in ihm wieder und ein Bedürfnis nach dem traulichen Verkehr mit Menschen meldete sich. Geldgier regte sich in ihm, die mannigfache Lust des Gaumens kitzelte ihn, und tausend andere Lustbarkeiten des Lebens traten verführerisch vor seine Seele. Zugleich stellte er sich vor, wie rauh die Tugendübung und wie groß die Anstrengung dabei sei; die Schwachheit seines Leibes und die Länge der Zeit kamen ihm drückend zum Bewußtsein. Darüber hinaus machte ihm das brünstige Verlangen der Sinnlichkeit zu schaffen, erotische Vorstellungen umgaukelten seinen Geist, und des Nachts sah er holde Mädchengestalten sich ihm nähern. Nach Athanasius regte sich «ein gewaltiger Sturm von Gedanken»10 in seinem Innern, der, einem Wirbelwind gleich, seine guten Vorsätze zerstreuen wollte. Antonius war den versucherischen Mächten ausgeliefert, die von allen Seiten auf ihn einstürmten, um ihn aus seinem innern Gleichgewicht hinauszuwerfen. Es war ein seelischer Taifun im wahrsten Sinne des Wortes. Wie Wasserwogen gingen die Anfechtungen über ihn hinweg und drohten ihn zuzudecken Der elementare Aufruhr, der in seiner Seele tobte, machte Antonius zum Prototyp des versuchten Menschen. Es ist unmöglich, von Antonius zu reden, ohne seine rasenden Versuchungen zu erwähnen, die er tapfer bekämpfte und gegen die er sich verzweifelt mit den Mitteln eines Asketen, wie Gebet und Fasten, zur Wehr setzte. Seine zahlreichen Versuchungen sind in die Weltgeschichte eingegangene Begriffe geworden. Von Hieronymus Bosch bis zu Gustav Flaubert wurde der allezeit angefochtene Antonius zum Gegenstand einer ernsthaften Kunstdarstellung gemacht, und erst Wilhelm Busch blieb es vorbehalten, das Thema leider zu verulken, wobei ihm erst noch eine Verwechslung mit Antonius von Padua unterlief.
Was ist Versuchung? Wissenschaftlich ist darauf kaum eine Antwort zu geben, weil sie gewöhnlich in ihr doch nur eine längst überholte Einbildung sieht. Viel aufschlußreicher sind die Ausführungen Leopold Zieglers über dieses Problem: «Von wem wird eigentlich Antonius versucht? Von den unterdrückten, nie ganz zu unterdrückenden Süchten seines Fleisches? Oder von den wollustatmenden Frauenleibern, in die seine Süchte sich verkleiden? Oder von Mächten durchaus nicht bloß innerseelischer Herkunft und Wirklichkeit, sondern von irgendwie heimatlosen, irgendwie irrenden Triebfedern an sich und für sich, die ihrerseits nach einer Art Verleihung gieren und diese durch Vermittlung eines anfälligen Menschen zu erlangen hoffen? … Gesetzt aber, wir vermöchten Antonius darüber zu befragen, dürfte er wohl den ganzen Vorgang dem Versucher in eigener Person zugeschrieben haben. Er selbst wähnte sich, es ist zu wetten, weder von innen versucht noch von außen. Sondern von unten, vom Widergott und seiner Hölle11