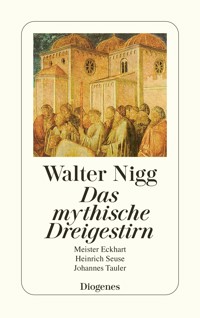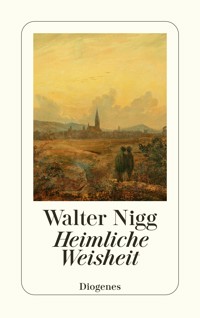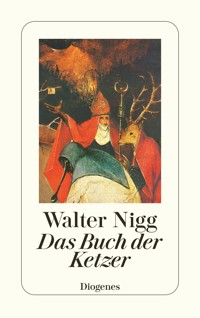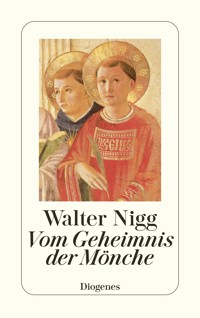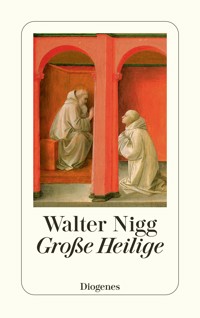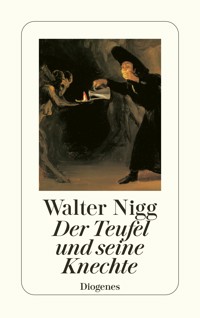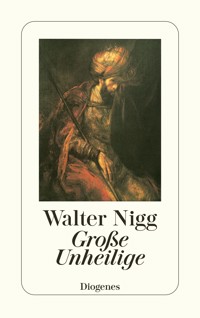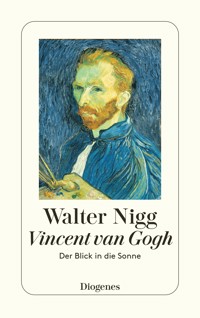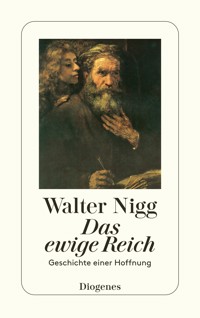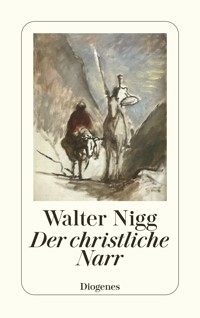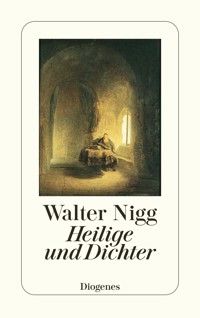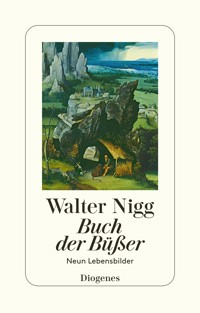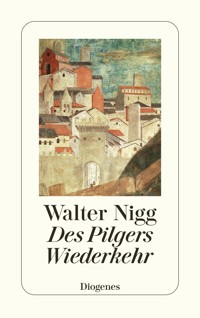
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
In einer zunehmend mobilen Welt, in der Schnelligkeit Trumpf ist und Langsamkeit verpönt, erleben Pilgerreisen seit einigen Jahren einen unerwarteten Aufschwung. Walter Nigg befaßt sich anhand dreier Beispiele mit dem Thema der zeitlosen Wanderschaft und lädt uns dazu ein, die jahrhundertealte Tradition des Pilgerns kennenzulernen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 298
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Walter Nigg
Des Pilgers Wiederkehr
Drei Variationen über ein Thema
Diogenes
ThemaDER PILGRIM
DER PILGRIM
SCHWER legt sich dem heutigen Menschen der unübersehbare Flüchtlingsstrom auf die Seele. Nicht enden will die Reihe der Vertriebenen, die durch die politischen und kriegerischen Ereignisse unerbittlich von ihrem häuslichen Herd hinweg in die Heimatlosigkeit hinausgestoßen werden. Oft sind sie genötigt, nur mit einem kleinen Bündel in der Hand, ihr trautes Heim zu verlassen, und irren fortan unstet auf dieser Welt umher, nirgends willkommen geheißen und überall nur ungern geduldet. Die nackte Flüchtlingsnot greift mit ihrer Ausweglosigkeit ans Herz, man kann diese Bilder nicht wie einen quälenden Traum von sich abschütteln, sie verfolgen den Menschen und lassen ihn nicht mehr los. Auch die schreibgewaltigste Feder ist außerstande, das namenlose Elend der Flüchtlinge aus allen Ländern nur annähernd zu schildern, weil eine Wirklichkeit mit Worten nie entsprechend wiedergegeben werden kann.
Das Flüchtlingsproblem stellt die betroffenen Länder vor beinahe nicht zu bewältigende Aufgaben. Inmitten dieser kaum lösbaren Bedrängnis erhebt sich die gewöhnlich übersehene Frage nach der Bedeutung dieses Umherirrens in metaphysischer Beziehung. Werden diese an den unmöglichsten Orten eingepferchten Flüchtlinge nur zu einem materiellen Problem oder verkörpern sie nicht auch eine religiöse Frage, die an das Mark des menschlichen Lebens greift? Muß nicht der Mensch, der den hinter allen sichtbaren Erscheinungen stehenden Wesensvorgang zu erfassen bestrebt ist, schließlich auf einen seltsamen, verborgenen Zusammenhang dieser Flüchtlingsnot mit einer tiefen Wahrheit des Christentums stoßen? Diese Frage im voraus verneinen, hieße als ein Mensch erfunden zu werden, der sich weigert, die ihm und seiner Generation von Gott aufgegebene Lektion zu lernen!
Der Mensch des 19. Jahrhunderts kannte den Pilger, abgesehen von konventionellen Redensarten, als ein Wesen, das Anlaß zu einem Gelächter gab, wie es Wilhelm Busch in seiner «frommen Helene» ironisiert hat:
Ach! da schaun sich traurig an
Pilgerin und Pilgersmann.
Das Wallertum existierte für den aufgeklärten Durchschnittsmenschen höchstens noch in der Karikatur, er sah im Pilgertum lediglich eine dumme Heuchelei, eine unter dem Deckmantel der Frömmigkeit sich vollziehende Reiselust mit allerlei fragwürdigen Abenteuern, die nichts anderes als eine beißende Satire und kalten Spott verdiene.
Dieser gedankenlosen Oberflächlichkeit wurde, gleichsam als Strafe des Himmels, der gehetzte Flüchtlingsstrom vor Augen geführt, der das überhebliche Lächeln über den Peregrinus jäh zum Verstummen brachte. Die von Gott losgelöste Heimatlosigkeit, worunter die modernen Vertriebenen zu verstehen sind, stellt unter anderem ein furchtbares Gericht dar, das über die Menschen wie ein Orkan hereinbrach. In metaphysischer Sicht nimmt sich dieses Geschehen als eine erschreckende Mahnung aus: das unfreiwillige Flüchtlingswesen steht mit dem Vergessen des freiwilligen Pilgertums in einem innern Zusammenhang.
Die zeitlose Wanderschaft konnte dieser Vergessenheit anheimfallen, weil es nicht ihrer Art entspricht, von sich ein großes Aufsehen zu machen. Beinahe unbeachtet von der Welt, geht der echte Pilger seinen stillen Weg. Er gründet keine neue Partei und entwirft kein ideales Programm für die Erneuerung der Welt. Das alles liegt seinem Wesen unendlich fern. Man kann deswegen über ihn lediglich mit bescheidenen Worten reden, und niemals ist es möglich, ihn aufzubauschen und ins Überdimensionale zu steigern, will man seine Gestalt nicht zum voraus verfälschen. Ist das enttäuschend? Hat nicht schon Jeremia zu Baruch gesagt: «Du begehrst Großes für dich? Begehre es nicht! »(Jer. 45, 5.) Es liegt eine tiefe Weisheit in diesem Wort des Propheten. Wenn das Pilgertum auch keine lärmige Angelegenheit ist, keineswegs bedeutet es deswegen eine unwichtige Sache, denn im Unscheinbaren liegt die Wahrheit; in die Dinge, welche die ganze Welt übersieht, muß man sich vertiefen, um den verborgenen Schatz im Ackerzu finden.
In aller Lautlosigkeit nimmt das Pilgertum ein wesentliches Anliegen auf, das dem Christentum in die Wiege gelegt ist. Wer Christentum sagt, der sagt auch homo viator, wie der Lateiner im Mittelalter den nach der Ewigkeit wandernden Christen nannte. Die Pilgerschaft ist unablöslich mit der christlichen Botschaft verbunden. Bereits ihre Vorläufer kennen sie. Im Alten Bund betet der Psalmist aus dem ergreifendsten Kreaturgefühl heraus: «Ich bin ein Pilgrim bei dir und ein Beisasse wie alle meine Väter», damit das Bekenntnis des religiösen Menschen aussprechend (Ps. 39,13). In diesem alttestamentlichen Selbstverständnis ist der Grundakkord angetönt, der durch alle Jahrhunderte hindurch nicht mehr verklingt. Zwar ist es eine verborgene und infolgedessen übersehene Geschichte, die bis jetzt noch nie geschrieben wurde. Auch in diesem Zusammenhang kann sie nur in einigen Stichworten skizziert werden, aber schon diese gedrängte Übersicht eröffnet den Blick in eine wenig bekannte Welt und zeigt das Christentum von einer bedeutsamen Seite.
Der Menschensohn verkörpert auch in dieser Haltung das für den Christen normative Vorbild. Jesus, als Pilger gesehen, erschließt neue Perspektiven. Keineswegs ist damit von einem abschließenden Grundbegriff die Rede, doch macht er auf den tieferen Untergrund aufmerksam. Aus Christi Munde stammt das bestürzende Wort: «Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber des Menschen Sohn hat nicht, da er sein Haupt hinlege» (Mt. 8, 20). Diese befremdliche Äußerung ist nicht als Klage zu verstehen, sprach sie doch Jesus als Warnung zu einem Schriftgelehrten, der ihm unüberlegt nachfolgen wollte. Sie ist vielmehr Klarstellung der Seinslage des wahren Jüngers. Mächtiger kann man der zeitlosen Wanderschaft nicht mehr Ausdruck geben, als es Jesus in diesen unbürgerlichen Worten getan hat. Mit einer schneidenden Schärfe stellen sie sein heimatloses Sein aller biederen Seßhaftigkeit gegenüber. Das Jesuswort reißt die abgrundtiefe Kluft zwischen seiner als Fremdling über diese Erde schreitenden Menschensohnsschaft und aller späteren, in dieser Welt allzu heimisch gewordenen Christlichkeit auf. Jesus ist in seiner endgeschichtlichen Gebärdensprache das Urbild des Pilgers, er spricht auch hierin zu den Menschen: Du aber folge mir nach.
Entsprechend dieser grundsätzlichen Haltung ist das ganze Neue Testament vom Bewußtsein der Pilgerschaft durchdrungen. Es ist jenes Buch, in welchem unwiderlegbare Worte stehen, Worte, die gleich Fanfarenklängen den Menschen nicht zur Ruhe kommen lassen. Paulus macht den Korinthern klar, daß sie jetzt noch «ferne vom Herrn auf der Wanderung» sich befinden (2. Kor. 5,6), und schreibt den Philippern, «das Reich, in dem wir Bürger sind, ist in den Himmeln» (Phil. 3,20). Der gleiche Hauch weht aus der Adresse des ersten Petrusbriefes, der sich «an die erwählten Fremdlinge» richtet und die Leser ermahnt, sich auch «als die Fremdlinge und Pilgrime» zu fühlen (1.Pet. 1,1 und 2,11). Ebenso eindrucksvoll erzählt der unbekannte Verfasser des Hebräerbriefes von den Patriarchen, die «Gäste und Fremdlinge auf Erden waren. Und die solches sagen, geben zu verstehen, daß sie ein Vaterland suchen» (Heb. 11,8–14). Die Eindrücklichkeit aller Aussagen, wonach die Christen «hier keine bleibende Statt haben, sondern die zukünftige suchen», wirkt stets erschütternd und bringt die unvergängliche Peregrinatio in immerwährende Erinnerung (Hebr. 13, 14). Doch genug der Bibelworte, die alle mit gleicher Unerbittlichkeit das Pilgergefühl der urchristlichen Gemeinden dartun, womit sie sich von dem im Schlamm der Welt versunkenen Heidentum unterschieden. Die unüberhörbare Betonung der Pilgerschaft verleiht dem Neuen Testament die überweltliche Atmosphäre, die den durch keine Erbaulichkeit verdorbenen Bibelleser aus der Fassung bringt. Die Begründung für die zeitlose Pilgerschaft lag in der gespannten endgeschichtlichen Erwartung, aus welcher der urchristliche Mensch die Kraft seines Lebens schöpfte.
Die auf Erden keinen festen Wohnsitz kennende Wanderschaft war auch in der Epoche der alten Kirche keineswegs vergessen. Die stets wieder einsetzenden Christenverfolgungen hielten das Bewußtsein der Weltfremdheit wach. Ephräm der Syrer, eine hymnologische Natur unter den Kirchenvätern, schildert in seiner religiösen Lyrik zunächst die Mühsale des Pilgertums. Mit der lebhaften Hervorhebung der beschwerlichen Plagen bekundete dieser altkirchliche Mönch, daß die Peregrinatio für ihn eine Wirklichkeit und nicht bloß ein rhetorischer Kanzeleffekt war. Trotz aller Beschwernisse muß der Christus suchende Mensch auf die Pilgerfahrt gehen, denn nach Ephräms elementarem Evangeliumsverständnis ist Gott nur im Pilgerleben zu finden. Es allein schließt den Weg zur Vollkommenheit in sich. Unzählige Christen haben damals praktisch ausgeführt, was in dieser geistlichen Ode aus dem 4. Jahrhundert besungen wurde. Die alte Kirche kannte die Wandermönche, die sich die asketische Heimatlosigkeit zur Aufgabe ihres Lebens gestellt haben, eines der überraschendsten Kapitel in der so ungeheuer reichhaltigen Mönchsgeschichte. Wie verbreitet das Wallertum damals war, geht aus dem Verhalten Peters, des Iberers, hervor, der im 5. Jahrhundert noch als Bischof das Leben eines Pilgers führte, von Ort zu Ort wandelnd und nirgends Fuß fassend. Als man ihm die Reliquien Lukas’ übergeben wollte, brach er in Tränen aus und sagte weinend: «Wie kann ich sie in Empfang nehmen und mit mir herumführen, da ich ein Pilgrim und Fremdling bin und keinen Ort habe, an dem ich sie besitzen und nach Gebühr ehren könnte.»
Der Pilger, der durch diese Welt seiner himmlischen Heimat entgegenwanderte, war auch das Vorbild des mittelalterlichen Christen, der das Evangelium noch viel unmittelbarer erlebte als der späte Mensch des 20. Jahrhunderts. Die iroschottischen Wandermönche brachten das Christentum von Britannien nach Deutschland und verbanden mit dem Wallertum eine asketische Bestimmung. Franz von Assisi hat in seinem beschwörenden «Testament» sein unergründliches Armutsverhältnis niedergeschrieben: «Nur als Pilger und Fremdlinge wollen wir hier wohnen», eine Bestimmung, mit der derselbe Franziskus, der jedes Würmlein vom Erdboden aufhob, die Haltung seiner Söhne umriß. Auch die Kreuzfahrer sind teilweise als Pilger zu verstehen, die zwar oft von unreinen Motiven aufgestachelt sich ins Heilige Land begaben, aber trotzdem unsägliche Opfer für diese Wanderung auf sich nahmen. Die geistesmächtige Seherin aus dem Norden, Birgitta von Schweden, brachte die Hälfte ihres Lebens als Pilgerin zu, viele Länder durchwandernd und allezeit die Lauen aufrüttelnd und die Gleichgültigen entzündend. Nicht alle Menschen konnten im Mittelalter ein immerwährendes Pilgerleben fuhren, viele Christen waren aber wenigstens bestrebt, vorübergehend Wallfahrer zu sein. Auch damit waren offenkundige Mühen verbunden, die zu jeder Annäherung ans Heilige gehören. Der Wallfahrer unterschied sich wesentlich von dem zu Hause hinter dem Ofen sitzenden Menschen. Er war auch tatsächlich ein anderer Mensch, denn er gehörte während dieser Zeit zu den sich auf heiliger Straße befindlichen Pilgern. Im Mittelalter nahm das Wallfahrtswesen zuweilen überbordende Formen an, vor denen Thomas a Kempis in seiner «Nachfolge Christi» leise warnte: Die zu viel wallfahren, werden selten heilig! Allein, dieser aufgehobene Finger vermochte dem enthusiastischen und geistigkämpferischen Element, das wesensnotwendig mit der religiösen Wanderschaft verbunden war, nicht Abbruch zu tun. Dem gotischen Menschen kam das Pilgertum mit seiner kühnen Ablösung vom verflachenden Alltagsleben und seinem außerordentlichen Aufbruch zum Ewigen viel zu sehr entgegen, als daß er auf diese heroische Parole verzichtet hätte. Der volkstümliche Prediger Geiler von Kaysersberg forderte seine Zuhörer direkt zum Wallertum auf, und aus Savonarolas Feder stammt die Schrift: Trost der Pilgrimschaft. Noch Ignatius von Loyola nennt sich selbst in seinen aufschlußreichen «Lebenserinnerungen» ausschließlich Pilger und nie mit seinem Namen, eine Bezeichnung, die seinem wahren Wesen entsprach, und zwar nicht nur wegen seiner Pilgerreise nach Jerusalem, auf der er hinkenden Fußes weite Strecken zurücklegte.
Das christliche Lebensverständnis als Pilger findet sich auch im Reformationszeitalter. Man muß nur nicht auf jenen Reformator achten, den das Denkmal zu Worms allzu massig darstellt, sondern auf den angefochtenen Luther, der stets an die Gnade Gottes glaubte und dabei immer der eigenen und fremden Erwählung ungewiß blieb. Dieser vom Ewigen zeitlebens beunruhigte Prediger Gottes ermahnte denn auch in seiner «Kirchenpostille» die Christen gar mächtiglich, «dies Leben auf Erden nicht anders anzusehen denn als ein Waller oder Pilgrim das Land, da er durch reiset, und seine Herberge, da er über Nacht lieget; denn da denket er nicht zu bleiben und weder Bürgermeister noch Bürger zu werden, sondern nimmt sein Futter und Mehl und lenkt zum Tor hinaus, da er daheim ist. Also müsset ihr euer Leben auch ansehen. Denn ihr seid nicht darum Christen worden, daß ihr allhier auf Erden herrschen und bleiben sollet; es wohnet, bürgert und herrschet sich anderswo mit dem Christen, nicht in dieser Welt; darum denket und richtet euch, als Pilgrim auf Erden, in ein ander Land und Eigentum da ihr sollet Herren sein und bleibend Wesen haben, da kein Unfried, Unglück sein wird, wie ihr hier in dieser Herberg müsset leiden.» Ein anderer Luther als der, der im Familienkreis die Laute spielte, meldet sich hier zu Wort und bekundet damit, wie der Altprotestantismus, trotz seiner Verschwisterung mit der städtischen Kultur, hierin noch ganz in der christlichen Tradition stand. Dem Bewußtsein, daß der Christ der der Ewigkeit entgegenwandernde Mensch ist, hat in der nachreformatorischen Zeit Paul Gerhardt in einem seiner bekanntesten Choräle – welche Kräfte schlummern in ihnen! – unvergänglichen Ausdruck gegeben:
Ich bin ein Gast auf Erden
Und hab hier keinen Stand;
Der Himmel soll mir werden,
Da ist mein Vaterland.
Hier reis ich aus und abe;
Dort in der ewigen Ruh
Ist Gottes Gnadengabe
Die schleußt all Arbeit zu.
Auch Gerhard Tersteegens «Pilgerlied» ist auf die gleiche Ewigkeitsmelodie gestimmt: «Kommt, Brüder, laßt uns gehen», hier ist der Christ ebenfalls als «ein fremder Gast» auf dieser Erde angesprochen. Einem letzten Klang gleich tönt des Bandwebers Lied vom «schmalen Pilgerpfad» in das heraufziehende Aufklärungszeitalter hinein; man muß den Ton gehört haben, will man etwas Ernsthaftes über das Christentum aussagen.
Diese notdürftige Skizze der Pilgergeschichte löst ein nicht alltägliches Gefühl aus. Gewiß waren es die denkbar verschiedensten Individualitäten, die sich darin aussprachen. Und doch, wie rücken sie in diesem einen Anliegen der Peregrinatio in die gleiche Linie; Menschen mit sonst gegensätzlichen Anschauungen reichen sich die Hand als Christen, die sich alle auf dem Wege zum ewigen Reich befinden. Sie bilden einen Reigen und singen im Chor das gleiche Pilgerlied, das dem besinnlichen Menschen gar vieles zu denken aufgibt.
Das Zeitalter der Renaissance brachte eine folgenschwere Änderung in diese nur in großen Linien angedeutete Einstellung des christlichen Menschen. Die Renaissance wird gewöhnlich zu einseitig unter dem Gesichtspunkt der neu gewonnenen Möglichkeiten beurteilt, und man vergißt, was der Mensch in ihr an substantiellem Gehalt verloren hat. Namentlich damals, als die christlich begonnene Renaissance von der heidnischen Welle überflutet wurde, setzte sich eine für das Abendland bedrohliche Strömung durch. Nicht der einzelne Mensch ist für diese prinzipielle Weichenstellung verantwortlich zu machen, die humanistische Bewegung als Ganzes erfaßte das menschliche Leben nicht mehr als den Weg von der Zeit in die Ewigkeit. Die Welt, welche die Christenheit so lange als eine von Menschen nur zu beschreitende Straße betrachtete, erfuhr in der Renaissance eine andere Wertung. Sie wurde zu einem Aufenthaltsraum, in dem der Mensch sich dauernd niederließ. Der Pfad verwandelte sich zur bleibenden Stätte! Das Ziel der Ewigkeit entschwand dem humanistischen Menschen aus den Augen, der Weg wurde ihm zum Selbstzweck, und er richtete sich auf der Straße des Lebens wohnlich ein. Das Lebensgefühl der zeitlosen Wanderschaft verblaßte zusehends und machte einer reinen Diesseitigkeit Platz, die mehr und mehr überhand nahm. Diese Wandlung des christlichen Lebensgefühles ist bedingt durch die Wiederbegegnung mit der Antike. Sie ist aus der Fülle der neuen Eindrücke begreiflich, die in jenem Zeitraum auf die Menschen einstürmten. Zunächst wirkte sich diese Horizonterweiterung auch als eine farbige Bereicherung des Daseins aus, es begann alles viel intensiver zu leuchten, und verständlicherweise brachen damals die Menschen in den begeisterten Ausruf aus: es ist eine Lust zu leben! Die Berechtigung dieser Daseinsfreude ist nicht anzuzweifeln. Gleichwohl geriet der damalige Christ in eine innere Gefahr. Weit entfernt, daß in der Renaissance die Entdeckung des Menschen erfolgte – wie Jakob Burckhardt meinte – dies geschah bereits im Evangelium, als die Seele des Menschen wahrgenommen wurde, die durch die ganze Welt nicht aufgewogen werden kann und dann nochmals in der mittelalterlichen Mystik mit ihrem innern Reich. Der Christ im humanistischen Zeitalter war vielmehr nahe daran, sein wahres Selbst zu verlieren, weil die äußern Weltdinge ihn allzu stark überwältigten. Eine erste und beinahe nicht wiedergutzumachende Veränderung hatte sich ereignet, deren Schaden im Moment nicht stärker sichtbar wurde, da die großen Humanisten immer noch ein gutes christliches Erbe in sich trugen.
Die dadurch eingeleitete Säkularisation nahm mit jedem Jahrhundert, da der Mensch weiter in die Neuzeit hineinschritt, größere Formen an. Das Lebensgefühl erfuhr in der modernen Zeit die denkbar tiefgreifendste Umdrehung. Der christliche Pilger früherer Jahrhunderte wollte wie ein zweiter Abraham aus seinem Vaterland, aus seiner Freundschaft und aus seiner Häuslichkeit herausgehen, sein Bestreben ging dahin, sich von all diesen Dingen zu befreien und sie hinter sich zu bringen. Der neuzeitliche Mensch dagegen ist vom umgekehrten Verlangen geleitet, er will in dieses Leben eingehen, sich mit seiner Lust und Qual aufs innigste vermählen, weil er diese Welt nicht mehr der Sünde gleichsetzt. Die Tendenzen laufen in völlig verschiedener Richtung, und darin besteht einer der tiefsten inneren Wesensunterschiede zwischen christlichem Zeitalter und modernem Lebensgefühl. Der Mensch begann in der Neuzeit das Leben allzusehr zu lieben, es mit einer triebhaften Gier zu betrachten und sich mit einer Ausschließlichkeit ihm zuzuwenden, die man nur Gott entgegenbringen darf. Darum verstrickte sich der heutige Mensch auch hoffnungslos in seinen Wirbel und vermag das Leben nicht mehr von einer höheren Warte aus zu überblicken. Das Resultat dieser lebenshungrigen Einstellung ist die reine Diesseitigkeit, die alles über die greifbare Existenz Hinausweisende als bloße Illusion verdächtigt. Das Ewige bedeutet für das moderne Lebensgefühl höchstens noch einen poetischen Gedanken, aber Realität anerkennt es einzig dem Zeitlichen zu, in dem sich alsobald die berüchtigte Eigengesetzlichkeit der Dinge geltend machte.
Der Verzicht auf die Jenseitsgerichtetheit ist für die bürgerliche Lebensform charakteristisch, das Wort nicht im politischen Sinn verstanden, sondern als eine Seinshaltung, die sich auch im freidenkerisch orientierten Proletariat findet. Die bloße Diesseitigkeit ist eine Lebensauffassung, die in der Kolchosenwirtschaft nicht weniger triumphiert als in der sich auflösenden Bourgeoisie. Weder ist das Bürgerliche der Spießigkeit zu bezichtigen, noch sind seine Probleme zum voraus als gottlos abzulehnen. Es hat in seinen kultiviertesten Vertretern unstreitig große Werte hervorgebracht und darf an sich nicht geschmäht werden. Trotzdem wohnt im Bürgerlichen eine unüberwindliche Neigung zur Selbstzufriedenheit, eine Behäbigkeit und Indifferenz, die im Laufe der Zeit den Menschen rettungslos der in sich ruhenden Endlichkeit ausliefert, die immer den Tod aller Geistigkeit bedeutet. Dieses unmerkliche Versinken in die irdische Gegebenheit, das zuletzt das Besitztum zum obersten Ziel des Lebens macht, ist ein verhängnisvoller Prozeß, der nur mit einer Katastrophe endigen kann. Es hat auch die Gegenwart in einen Zustand des Chaos geführt, der in seiner Ausweglosigkeit alles unter sich zu begraben droht. «Der tiefste Grund dessen, was jetzt vorgeht, ist, daß in der europäischen Menschheit kolossale Hohlräume entstanden sind, die vom entschwundenen Christentum herrühren, und in diese Hohlräume stürzt nun alles ein» (Rosanow). Das christliche Bild vom Leben gerät unweigerlich in eine sinnstörende Unordnung, die Perspektiven verkürzen sich und der Mensch büßt die entscheidende Tiefendimension ein. Aus der Preisgabe der zeitlosen Wanderschaft läßt sich zu einem wesentlichen Teil die Wirrnis des modernen Geisteslebens erklären. Wenn der Weg zum Ziel gemacht und der Ausgang in den Eingang verkehrt wird, dann stehen die Dinge nicht mehr an dem von Gott bezeichneten richtigen Ort, das Lebensgefüge wird verschoben und die wahre Seinslage des Menschen ist zerbrochen. Die Auffassung von der Welt als Endziel anstatt als Durchgangsstation trug zu jener absoluten Finsternis bei, in die das düstere Finale der Neuzeit ausklingt.
Die besten Söhne der Neuzeit haben sich gegen diese moderne Versumpfung aufgelehnt. Allen voran Friedrich Nietzsche, dem sich besonders leidenschaftlich der ohnmächtige Schrei gegen das unheilvolle Untergehen in die flache Endlichkeit entrang. Freilich nicht jenem Nietzsche, der als Verherrlicher des «Willens zur Macht» selbst diesem wahnsinnigen Taumel verfallen war und sich in rätselhaftem Widerspruchsgeist darin gefiel, zu sagen, wie der Atheismus bei ihm sich aus Instinkt verstehe. Tragische Verkennung seiner selbst. Es besteht weit eher die Pflicht, jenes Nietzsche zu gedenken, dessen Blut nach eigenem Geständnis mit demjenigen der Priester verwandt war und der als ungewöhnlich religiös veranlagter Mensch Einsichten hatte, die zu seiner Stunde wenige Christen besaßen. Diesem andern Nietzsche, der unser Bruder ist, war es unmöglich, sich nur vorzustellen, wie man in diesem öden Heute überhaupt zu Hause sein könne, und er sandte unablässig «Pfeile der Sehnsucht» nach dem andern Ufer ab. In Nietzsche dämmerte wieder das Menschenbild vom «Wanderer und seinem Schatten», wie er eines seiner Werke nannte. Der tief verwundete Verfasser des «Zarathustra» war nur der wortgewaltigste Rufer im Kampfe gegen die Verebbung des modernen Lebens, aber er war nicht der einzige. Sein Name steht hier für viele; was er als Schicksal des geistig heimatlosen Menschen aufs bitterste durchlitten hat, haben Künstler wie Heinrich Altherr in seinen Bildern vom «ruhelosen Wanderer» erschütternd gestaltet. Bis zur Jugendbewegung des Wandervogels läßt sich diese Auflehnung gegen die Sinnentleerung der modernen Zeit verfolgen, die jugendliche Empörung richtet sich gegen die Herrschaft einer leblosen Dingwelt, mit der sie sich nicht abfinden konnte.
Dem Aufschrei aber war kein Durchbruch beschieden. Nur schmerzlich zuckend gab die Protesthaltung immer aufs neue ihrer Not beredten Ausdruck: «Dies Suchen nach meinem Heim: O Zarathustra, weißt du wohl, dies Suchen war meine Heimsuchung, es frißt mich auf. Wo ist – mein Heim? Darnach frage und suche und suchte ich, das fand ich nicht. O ewiges Überall, o ewiges Nirgendwo, o ewiges – Umsonst.» In dieser ruhelosen Vergeblichkeit wirkt Nietzsche wie eine moderne Verkörperung von Ahasverus. Nietzsche und seine Nachfahren – in aller Demut sei es gesagt – konnten nicht den Ausweg aus dem Wirrsal finden, weil ihre Marschrichtung trotz aller Ablehnung des verdinglichten Lebens der Neuzeit doch in einem bloß innerweltlichen Ziel steckenblieb. Selbstgefangen in der verweltlichten Denkweise, faßten sie die Wanderschaft allzusehr als Urtrieb auf, in die Ferne zu schweifen, was einem rein biologischen Verständnis entspricht. Zwischen dem christlichen Pilger und dem modernen Wanderer besteht bei allen Berührungspunkten wiederum ein ganz tiefgreifender, deutlich zu markierender Unterschied: der eine ist jenseits gerichtet, während der andere in einer innerweltlichen Denkweise gefangen bleibt. Der heutige Wanderer vermochte den trostlosen Ablauf der Entwicklung nicht zu durchbrechen, er läuft im Grunde seinem eigenen Schatten nach. Der christliche Pilger dagegen kennt eine ganz bestimmte, religiöse, außerhalb ihm liegende Zielsetzung, was etwas grundsätzlich anderes ist.
Der furchtbare Gerichtssturm des 20. Jahrhunderts läßt die Vision vom Pilger wieder am Horizont aufleuchten. Den Heiligen und Mönchen ebenbürtig, gehört der Pilger zu den wesentlichsten Geburtshelfern eines erneuerten Christentum-Verständnisses. Eine neue Beschwörung des homo viator kommt einer nach innen gehenden Besinnung gleich. Die Christenheit muß auf die zeitlose Wanderschaft zurückgreifen, sie ist ein Thema von ganz eigenartiger Musikalität. Ohne den geringsten Lärm zu machen, gehört der Pilger zu den großen Mahnern und Erweckern, nicht durch Worte, wohl aber durch das eigene Beispiel. Er ist der Mensch, der sich losgerissen hat, der sich aufmachte, der sich in Bewegung befindet, der unterwegs ist, der vom Haus in die Hauslosigkeit geschritten ist, um diesen von Buddha geprägten Ausdruck zu gebrauchen. Ein ungewöhnliches Fluidum geht von dieser außerordentlichen Haltung aus, das jeden Christen unwillkürlich aufschreckt. Der Peregrinus ist das Gegenteil jenes geistlosen Banausen, dem Gemütlichkeit mit Klubsessel und Radioanschluß oberstes Ziel bedeutet. Der Pilger ist der Mensch, der von weither kommt und der in seiner Fremdartigkeit nicht ohne weiteres eingeordnet werden kann. Er ist der Hindurchschreitende, dessen Anblick seltsame Schauergefühle hervorruft. Als einer, der Gott mit der ganzen Glut seines Wesens sucht, ist er notwendig auf dieser Erde heimatlos geworden. Der Mensch, dem der Ruf des Evangeliums zum entscheidenden Erlebnis geworden ist, wird sich automatisch von seinen bisherigen Bindungen und Gewohnheiten lösen, eine gewisse Fremdheit in dieser Welt empfinden und das Leben als ein Unterwegssein betrachten. Der sich als homo viator verstehende Christ läßt sich durch nichts aufhalten und will von nichts gefesselt werden, er dringt durch alles hindurch und nimmt um seines Ewigkeitsdurstes auch Einsamkeit und Verkennung auf sich. Von zeitloser Größe ist der status viatoris, der die menschliche Seele als ewige Pilgerin nach der wahren Heimat, die nicht auf dieser Welt ist, auffaßt. Das echte Pilgertum ist nichts Geringeres als das Suchen nach dem verlorengegangenen Paradies, ein Verlust, mit dem sich die Seele nicht abfinden kann. Es hat die Unzulänglichkeit aller irdischen Verhältnisse erkannt und strebt aus der Vorläufigkeit seiner Existenz hinaus zu einem göttlichen Sein, das nicht mehr der Vergänglichkeit unterworfen ist. Die Peregrinatio will dem Überzeitlichen entgegenpilgern und hütet sich, in diesem Leben zu «erliegen», wie der altertümliche Ausdruck heißt. Allezeit ist der Pilger entschlossen, gerüstet und gegürtet dem Unbekannten entgegenzuschreiten und nicht in Gleichgültigkeit zu verharren, bis die Ewigkeit ihn wie ein gewappneter Mann überfällt. Gespannt hält er Ausschau nach der ewigen Welt, er ist von einem wahren Lechzen nach ihr erfüllt, das durch kein irdisches Gut gestillt werden kann. Der zeitlose Wanderer entzieht sich nicht bequemlichkeitshalber den Pflichten dieser Erde. Dieser Argwohn macht sich einer schlimmen Fehldeutung schuldig. Auch unsere Welt lebt von dem, was mehr ist als Welt, was über sie hinaus will und was sie überwindet. Es geschieht aber nur durch den Menschen, der sich stets bewußt bleibt, daß er allezeit als Pilger nur notdürftig unter Zelten wohnt.
Freilich bedarf das neue Pilgertum einer Modifikation. Die zeitlose Wanderschaft ist heute im buchstäblichen Sinn des Wortes kaum mehr möglich. Durch Grenzvorschriften, Paßkontrollen und Devisenbestimmungen sind ihr in der Gegenwart allzu viele Schranken auferlegt. Es ist nicht mehr möglich, mit Pelerine und Stab in der Hand von dannen zu schreiten, will man sich keines Anachronismus schuldig machen. Was aber frühere Geschlechter im Wortsinn ausführten, das muß der heutige Christ im Geiste wiederholen, es in seiner Seele noch einmal und womöglich auf eine viel verinnerlichtere Art vollziehen, was eine nicht minder mühsame Anstrengung erfordert. Auch heute wieder steht der christliche Mensch zwischen Zeit und Ewigkeit. Gleich Elia, der einen großen Weg vor sich hat, muß er abermals nach neuen Fernen Ausschau halten. Der Schritt vom buchstäblichen zum geistigen Pilger ist keine Abschwächung, denn auch im Neuen Testament ist diese Fremdlingsschaft bereits im übertragenen Sinn verstanden. Ein durch die Welt Hindurchschreitender zu sein ist die Bestimmung jedes Christen, wie es die Mystiker aller Zeiten erkannt haben, die in der Symbolik der Pilgerschaft die Lebensgeschichte jeder aufsteigenden Seele gesehen haben: «Wie der wahre Pilger, der nach Jerusalem wallfahrtet, Haus und Land, Weib und Kind hinter sich läßt und sich aller Dinge, die er hat, entblößt, auf daß er leicht und unbehindert dahinwandern kann, ebenso mußt du, wenn du geistlicher Pilger sein willst, dich alles dessen, was du hast, entblößen … Darauf sollst du in deinem Herzen voll und ganz beschließen, daß du in Jerusalem sein willst und an keinem andern Ort als dort allein» (Hilton).
Das Pilgertum im Geiste vertritt nur wenige Gedanken; geht es ihm doch nicht um eine spekulative Religionsphilosophie voller Tiefsinnigkeit. Es ist ihm wesentlich um eine jenseitsgerichtete Haltung zu tun, die nicht aus einem Weltekel und Weltüberdruß hervorgeht. Nie ist Weltmüdigkeit das treibende Motiv des zeitlosen Wandermannes. Was aus der Weltangst hervorzugehen pflegt, verbleibt in der Not und bedeutet nicht Rettung. Es geht dem Pilgertum gewiß nicht darum, das Leben, das ein wundervolles Geschenk Gottes ist, gering zu schätzen. Der neue homo viator weiß durchaus um die Schönheit der Welt, um das Aufflammen der ersten Liebe und den absichtslosen Vogelgesang, kurz, um all das Blühende im Leben, das so unsagbar köstlich ist. Wie sollte nicht gerade auch er das «irdische Vergnügen in Gott» kennen? Bei allem süßen Finden Gottes in den Dingen aber ist er sich auch der Gefahr bewußt geworden, die im unersättlichen Begehren nach den Gütern dieser Welt liegt, das blindwütig alles zusammenrafft und es mit leidenschaftlichem Griff umklammert hält. Dem zeitlosen Wanderer ist wieder der Sinn für das Transitorische der menschlichen Existenz erwacht, eine Erkenntnis von unbedingter Notwendigkeit, auf die kein ernsthafter Christ verzichten kann. Das Wort Teresas von Avila «alles geht vorüber» gibt diese Wahrheit wieder, die wie ein Lichtstrahl leuchtet, der alle Verlockung dieser Welt versengt. Was immer auch in dieser Welt lebt und den Menschen oft in so verführerischer Weise gefangennimmt, es sind alles nur vorübergehende Erscheinungen. Es ist eine erregende Wahrnehmung, bis ins Innerste davon überzeugt zu sein, daß man nicht nur selbst, sondern auch alles, was den Menschen beschäftigt und anlächelt, wie Liebe und Ehe, Kunst und Wissenschaft, Technik und Mode usw., keine bleibende Existenz hat. Alle diese Phänomene sind eine kleine Weile in beglückender Gegenwart da und entschwinden dann plötzlich wieder, ohne daß sie der Mensch zu halten vermöchte. Diese Erkenntnis, real erlebt, bringt in das Dasein des Menschen eine dramatische Spannung, sie wirkt sich wie ein ewiger Impuls aus: du hast hier keine bleibende Stätte, du mußt weiter und immer noch weiter, deine Bestimmung geht über all das hinaus. Merkwürdig, wie der Mensch diese Wahrheit im Handumdrehen vergißt. Er tut so, als ob er für alle Zeiten hier bleiben würde. Die Betonung des transitorischen Charakters alles Lebens ist weder Daseins-Entwertung noch Weltverneinung, ihr liegt vielmehr eine überlegene Anleitung zum richtigen Gebrauch der Dinge zugrunde. Das «vorübergehend» will keineswegs bloß sagen: bald ist alles zu Ende, es ist keine niederdrückende Traurigkeitsphilosophie, die das Leben wehmütig stimmt, sondern Erkenntnis, daß dieses Hiersein nur Phase eines viel größeren Prozesses ist. Im Hier steckt nur der Anfang, der gewöhnlich unfertig und stümperhaft ist. Erst nachher kommt die Ausreifung und Vollendung. Alles ist viel größer, als es der Mensch sich gewöhnlich denkt. Der Sinn für das Transitorische übt eine tröstende Wirkung aus: neue und höhere Perspektiven eröffnen sich, es dehnt sich alles ins Unermeßliche aus. Um dieses Glaubens willen vermittelt der «Pilger des Absoluten», den Léon Bloy auch als den «Pilger ohne Rückkehr» bezeichnet, einen unwiderstehlichen Eindruck von der Wirklichkeit des Göttlichen, er ist die leibhaftige Verkörperung dieser Wahrheit. Das religiöse Verständnis erfaßt den Pilger als Träger eines Charisma, durch den unverkennbare Heilandszüge hindurchschimmern.
Aus diesen Ausführungen geht hervor, daß das Pilgertum einem positiven Ansporn entspringt. Auf eine kurze Formel gebracht, ist der neue Pilger der Mensch der brennenden Sehnsucht. Er versteht darunter nicht, wie die Halbwüchsigen, ein bloß vages Gefühl nach irgend etwas Unbekanntem, das sich wohl noch einmal finden wird. Was wahre Sehnsucht ist, hat vielleicht niemand besser formuliert als Novalis, der Dichter, der so viel von Leben und Tod verstanden hat und der in einem seiner geistlichen Lieder singt:
Hätten die Nüchternen
Einmal gekostet,
Alles verließen sie
Und setzten sich zu uns
An den Tisch der Sehnsucht,
Der nie leer wird.
Nach Novalis kann in dieser Zeitlichkeit der heiße Durst nicht gestillt werden, und ebenso senden uns die Verstorbenen «der Sehnsucht Hauch», damit wir ihnen entgegenstreben, ja dieser Meister der Fragmente begriff auch die «Philosophie als ein Heimweh». Der Mensch der Sehnsucht spürt das Ungenügende dieses Daseins, er möchte darüber hinausgreifen und mit augustinischer Inbrunst übersteigen, er sieht das Unfertige und Unabgeschlossene alles irdischen Lebens, er verlangt nach dem Vollkommenen, wo das Stückwerk aufhört. Er verspürt zuweilen, wie einst Paulus, die heimliche Lust, abzuscheiden, um bei Christo zu sein, und flüstert sogar wie der Puritaner Alexander Henderson: «Niemals hat sich ein Schuljunge mehr auf die Spielpause gefreut, als ich mich freue, aus dieser Welt zu gehen!» Die echte Sehnsucht ist eine gewaltige Kraft im Menschenleben, die ungeahnte Energien zu entbinden vermag. Sie ist ein brennendes Feuer, deren Flammen den Christen förmlich verzehren. Es greift tief in sein Seelengewebe ein, ob ein Mensch eine lebendige Sehnsucht in sich trägt oder ob ihm dieses nie zur Ruhe kommende Gefühl gänzlich unbekannt ist. Menschen, denen dieses Brennen im Geist in die Wiege gelegt wurde, verstehen sich, ohne viele Worte zu machen, trotz aller Verschiedenheit der Geschlechter, der Nation und der Konfession, und wenn ihnen dieses Gefühl fremd ist, bleibt eine Sprachverschiedenheit zwischen ihnen, mögen sie noch so nahe zusammenrücken. Die lodernde Sehnsucht nach dem Höchsten allein läßt den Menschen nicht im Niedrigen versanden, sie ist Antrieb und Aufschwung zum Unendlichen. Nur wer sie kennt, tritt in das Ringen mit dem Überzeitlichen ein und kann dereinst Gott auf seinem Sterbebett danken, daß er ein Mensch der Sehnsucht sein durfte.
Dem wirklichen Pilger, der, im Gegensatz zu dem mit bequemen Verkehrsmitteln Reisenden, die inneren Mühsale nicht scheut, kommt eine bedeutsame Funktion in unserer Zeit zu. Sein bloßes Dasein ist eine machtvolle Erinnerung daran, daß alles irdische Leben nur vorläufigen Charakter hat und nie endgültiges Sein in sich schließt. Diese Absage an die der reinen Endlichkeit verschriebene Lebensform greift letztlich viel tiefer als die sozialen Revolutionen, die meistens nur eine Vertauschung der Rollen innerhalb der Besitzesverhältnisse bewirken, ohne sie in entscheidender Weise zu durchbrechen. Der Pilger dagegen durchstößt sie in prinzipieller Weise, er durchschaut das Haften an den Dingen von innen heraus und erringt dadurch die wahre Freiheit. Durch seine religiöse Überwindung der bloßen Diesseitigkeit gewinnt er ein reales Verhältnis zur Ewigkeit, eine Verbundenheit, durch die allein der Mensch in der Todessituation nicht der Verzweiflung anheimfällt. Die Verleiblichung der transitorischen Haltung ist von erneuter Aktualität, besonders heute, da die Menschheit im Begriffe steht, sich ihres Christentums zu entledigen, und auch bereits weitgehend nicht mehr von dessen Gedankenwelt beherrscht wird. Die moderne Menschheit geht in ihrer kriegerischen Zerstörungssucht einer immer finsterer werdenden Zeit entgegen, wo bald nur noch einige wenige Pilger über eine zertrümmerte Welt schreiten werden, die einer entchristlichten Christenheit die Botschaft des Evangeliums in neuen Zungen verkünden. Um dieser düsteren Aussicht willen gehört der Pilger nicht der Vergangenheit an, er ist eine wiederkehrende Gestalt, und zwar eine in unserer Gegenwart aktualisierte christliche Erscheinungsform. Der zeitlose Wanderer wird als Charismaträger aufs neue auftauchen, er ist in aller Unscheinbarkeit bereits unterwegs und wird in einer entgöttlichten Welt, die entweder nur noch wirtschaftliche Systeme hervorbringt, deren regelmäßige Krisenzeiten jeweilen einzig durch grauenhafte Kriege beseitigt werden können, oder die Menschen in einen lebensunwürdigen Ameisenstaat versklaven, in aller Demut wieder den ewig gültigen, allein zur Rettung führenden Gotteswillen vorleben. Denn zu allen Zeiten haben die Menschen nur dann die richtige Einstellung zu ihren Mitmenschen gefunden, wenn sie vorher in der wahren Übereinstimmung mit Gott standen und vom Gesichtspunkt der Ewigkeit aus die Dinge betrachteten. Mehr als je ist in der Gegenwart der wiederkehrende Pilger eine dringende Notwendigkeit, der von der Klarheit in die Wirrnis dieser Welt schaut und nicht mehr länger vermeint, umgekehrt aus dem Chaos zu einer neuen Ordnung zu kommen.
Im vorliegenden Zusammenhang vollzieht sich der Aufruf zu einem verwandelten Pilgertum in der Form dreier Pilgerleben, und zwar an Menschen, die bezeichnenderweise Laien waren. Das eine Thema der zeitlosen Wanderschaft wird in drei Variationen abgewandelt, die diesen Persönlichkeiten eine über ihre historische Existenz hinausreichende Bedeutung zuerkennt. Die erste Variation stammt aus dem 17. Jahrhundert und ist aus der Welt des englischen Protestantismus hervorgegangen, die zweite ist dem 18. Jahrhundert entnommen und ist im Katholizismus beheimatet, während die dritte dem 19. Jahrhundert angehört und die Ostkirche zu Worte kommen läßt. Damit dürfte klargemacht sein, daß der religiöse Wanderer eine zeitlose Erscheinung ist, der eine genuin christliche Haltung verkörpert. Jede Variation zeigt, wie ihr Vertreter selbstverständlich in einer historisch gewordenen Konfession steht, aber alle beweisen, daß sie letztlich nicht konfessionalitisch gesinnt sind.
Ihre verschiedene Kirchenzugehörigkeit ist nur der Rahmen, aus dem sie ganz in die zeitlose Christlichkeit hinausgewachsen sind, und damit haben sie ungewollt einen bedeutsamen Beitrag zum Thema der Ökumene beigesteuert, von der in den letzten Jahren so viel geredet wird. Segen über die in Stockholm und Amsterdam versammelte Ökumene; ihren Bestrebungen ist nur Erfolg zu wünschen. Man darf sich aber keiner Täuschung hingeben, die auf diesem Weg erhoffte Kircheneinheit wird immer nur ein frommer Wunsch bleiben und schwerlich je eine Bedeutung von religiöser Tragweite erlangen. Die wahre Einheit, die über allem Trennenden das Verbindende viel stärker erlebt, kann doch nicht durch Konferenzen bewerkstelligt werden, weil sie nie und nimmer eine Angelegenheit der Organisation ist, in der sich stets menschlicher Geltungsdrang ungebührlich in den Vordergrund schiebt. Wer jedoch die drei Pilgerleben in sich aufnimmt, der erhält eine Ahnung davon, daß es heute einzig eine Ökumene des glaubenden Herzens gibt, die über alle Zweifel erhaben ist. Die Una Sancta braucht nicht erst mühsam begründet zu werden, sie war in unsichtbarer Weise schon immer vorhanden. Sie ist eine von Gott geschaffene Wirklichkeit, der alle jene Menschen angehören, die wieder als ewige Pilger an die Tore unserer Welt klopfen …
I. VariationDIE REISE NACH DER EWIGKEIT
SEELENKÄMPFE EINES KESSELFLICKERS
ALS