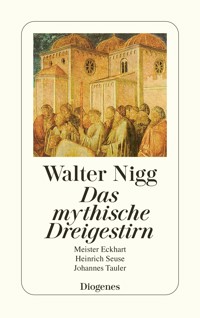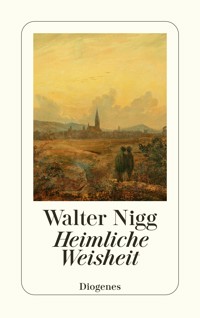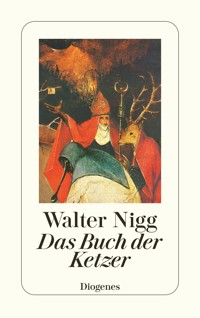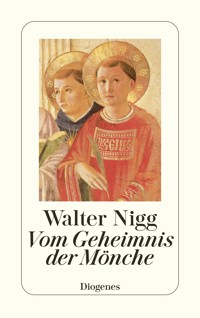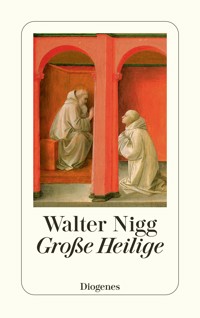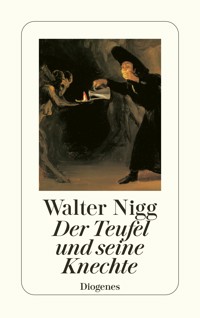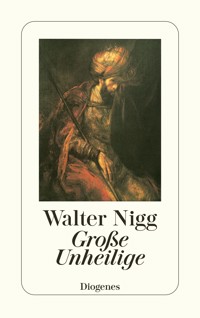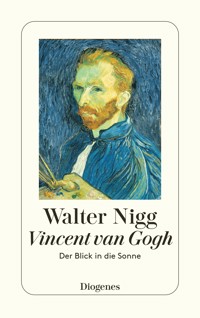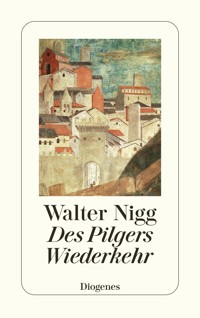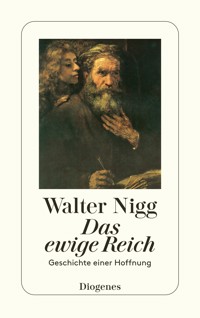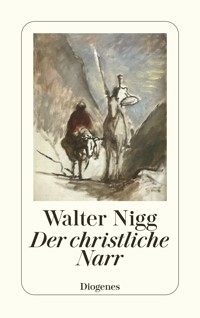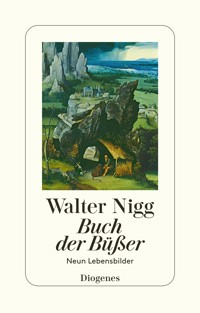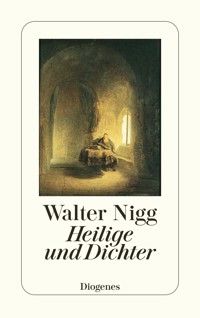
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Der reformierte Theologe, Schriftsteller und em. Professor für Kirchengeschichte Walter Nigg veranschaulicht in diesem Werk zunächst das Wesen der Heiligen an den konkreten Gestalten von Augustinus, Konrad von Konstanz, Heinrich und Kunigunde, Hildegard von Bingen, Albertus Magnus und Thomas von Aquin. Der zweite Teil ist den Dichtern gewidmet. Mit Ausnahme von Nikolai Lesskow gehören sie alle Niggs Generation an. Es sind Menschen, die dem Autor auf seinem Lebensweg perönlich begegnet sind, Menschen, die Dichtung noch als etwas Göttliches inmitten eines schweren Lebens erfuhren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 359
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Walter Nigg
Heilige und Dichter
Von Augustinus bis Reinhold Schneider
Diogenes
Emily: Gibt es Menschen, die das Leben ergründen,
während sie es leben? Können sie es jemals?
Spielleiter: Nein. –
Vielleicht die Heiligen und die Dichter –
ein wenig.
Thornton Wilder
Heilige
Gespräch mit Heiligen
Die Heiligen und wir – dieses Thema bringt zwei ungleiche Größen miteinander in Verbindung, denn die Heiligen sind große, wir aber sind kleine Menschen. Die Thematik ist nicht als Vergleich gemeint, sondern eher als eine mögliche Beziehung. Die Heiligen sind nicht nur bewundernswert geschnitzte romanisch-gotische Figuren, sie sind auch Wesen, mit denen wir reden sollten. Wir haben mit den Heiligen etwas zu tun. Es besteht eine Verbindung zwischen ihnen und uns. Ganz gewollt bringen wir uns mit ins Spiel. Es geht nicht um eine geschichtliche Angelegenheit, die sich aus kühler Distanz betrachten läßt. Keineswegs verhält es sich so, daß wir dieses Thema ebensogut fallen lassen und uns ohne weiteres einem ganz anderen Problem, wie beispielsweise «Die mittelalterliche Winzertätigkeit im südlichen Deutschland», zuwenden könnten. Das Ergebnis wäre hier rein informativ und würde unser Leben nicht weiter beeinflussen. Im leisen Gespräch mit den Heiligen liegen die Dinge ganz anders. Das Flüstern bringt ein erregendes Element hinein: wir fragen und werden zugleich gefragt; etwas geht zwischen ihnen und uns hin und her, etwas Persönliches, Intimes. Dabei lassen sich nur wenige Gesichtspunkte hervorheben, niemals aber ein System. Bei den Heiligen gibt es nur ausnahmsweise eine abgerundete Weltanschauung. Auch ist es schwer, ja beinahe unmöglich, die Heiligen überhaupt sichtbar zu machen, sind sie doch mit gewöhnlichen Augen nicht zu schauen und mit gewöhnlichen Ohren nicht zu hören. Es bedarf dazu einer gnadenhaften Stunde und vor allem auch der Fähigkeit, sie zu lieben, denn nur die Liebe, niemals das bloße Interesse, sieht die Heiligen und wird in das seltsame, allerseltsamste Gespräch mit ihnen verwickelt.
Nicht alle Menschen nehmen an diesem Gespräch teil. Die Agnostiker wollen nichts davon wissen, weil sie sich als Ungläubige bezeichnen und es auch zu sein meinen. Für sie ist ein Mann, der sich mit den Heiligen näher beschäftigt, ein offenkundiger Hinterwäldler, der ohnehin nicht auf der Höhe der Zeit steht und deshalb nicht begreift, wie bedeutsam beispielsweise Atomkraftwerke sind. Halb mitleidig, halb spöttisch blicken sie auf jede Beschäftigung mit den Heiligen. Bei der Lektüre von Elisabeth Heisenbergs Buch «Das politische Leben eines Unpolitischen» (1980) erfuhr ich von einem beinahe belustigenden Erlebnis. Die Gattin des berühmten Physikers schrieb diese Biographie, um ihren verstorbenen Mann vor Verdächtigungen zu rechtfertigen. Mitten in den sachlichen Erinnerungen stieß ich auf die Sätze: «Heisenbergs Institut war bisher noch von schweren (Bomben-) Schäden verschont geblieben. Die Mitglieder behaupteten einstimmig, das sei das Werk des heiligen Florian, von dem schon vor Jahren Debeye im Flur des Instituts eine kleine Statue hatte aufstellen lassen. Der heilige Florian ist der Heilige, der vor Feuersbrunst schützt; und jetzt, da sich auch in Dahlem die Angriffe mehrten, wurde nie versäumt, seine kleine Statue mit frischen Blumen zu schmücken. ‹Er soll ja auch helfen, wenn man nicht dran glaubt› – mit diesem so berühmten Ausspruch von Niels Bohr legten auch die größten Skeptiker ihre Blumen dem Heiligen zu Füßen.» Unwillkürlich hielt ich bei der Lektüre inne und dachte an diese superklugen Männer. Sie haben sich mit der Zukunft der Menschheit befaßt, waren mit den entscheidenden Problemen der Kernspaltung und des schweren Wassers beschäftigt und suchten nun in der Stunde der Todesbedrohung nicht bei ihrer Wissenschaft und Gelehrsamkeit, nicht bei ihren Reagenzgläsern und Molekülen ihre Zuflucht, sondern beim heiligen Florian! Überrascht fragte ich mich, wie man ihr Verhalten deuten soll. Wenn sich die schwarzen, auf uns zukommenden Wolken in einem noch nie erlebten apokalyptischen Geschichtsgewitter über unseren Häuptern entladen, so wird es so sein, daß noch ungezählte andere aufgeklärte Menschen ihre Zuflucht beim Gespräch mit den Heiligen suchen.
Doch kehren wir eilig zu unserem Anliegen zurück, denn schließlich sind wir vor allem für unsere Person verantwortlich und haben uns nicht um das Verhalten anderer Menschen zu kümmern.
Es gibt die Gestalt des Heiligen, genau wie es die Gestalt des Patriarchen, des Propheten, des Apostels oder des Reformators gibt. Gelehrt ausgedrückt, ist der Heilige eine Kategorie, das heißt, ein immer anzuerkennender Grundwert. Wer Grundwerte des Lebens in Zweifel zieht, versinkt im Sumpf des Relativismus, und wer sie bejaht, trägt zur Ordnung des Lebens bei. Wahrscheinlich hat man in der Vergangenheit die Gestalt des Heiligen arg mißbraucht. Sie ist darob für viele Christen kreditunwürdig geworden. Darf man aber wegen einiger Entgleisungen gleich alles in Bausch und Bogen verwerfen? Das Gespräch mit den Heiligen ist dem Gespräch in der Bibel zwischen Salomo und Sulamith ähnlich; im Grunde ist es ein Liebesgespräch im höheren Chor, weil es sich in der Kammer des Herzens vollzieht und keineswegs für den öffentlichen Markt bestimmt ist.
Die Überschrift unseres Themas lautet ausdrücklich «Die Heiligen» und nicht «Der Heilige». Unbedingt muß man in der Mehrzahl reden, weil es viele Heilige von stark unterscheidendem Wesen gibt. Unter den Heiligen finden sich Frauen und Männer, Jugendliche und Greise, Gelehrte und Ungebildete, eindringliche Prediger und auch stille Heilige, die in aller Leute Mund sind. Es gibt auch solche, die nicht im römischen Verzeichnis der Heiligen stehen, deswegen aber gar nicht weniger heilig sind. Man muß die Vielfalt und die Verschiedenheit der Heiligen sehen, erst dann wird klar, welcher Gewalttat man sich schuldig macht, wenn man sie alle in das gleiche, vorgeschriebene Schema hineinpreßt. Das Heiligen-Modell ist eine beliebte Sache; es legte sich von selbst auf den Präsentierteller, und viele Biographen haben sich denn auch seiner bedient. Eines aber ist gewiß und kann nicht bezweifelt werden: das Klischee hat viel zum Niedergang des Heiligengespräches beigetragen. Alle Schemata wirken steif und langweilig. Es ist nie interessant, wenn man schon am Anfang einer Geschichte weiß, wie sie endet. Jede Verallgemeinerung ist so nichtssagend wie die gegenwärtigen Schlagworte. Die Typisierung hat zu einer Versteinerung der Heiligen geführt. Wir müssen uns ganz entschieden von dieser künstlichen Stilisierung abkehren, denn sonst gelangen wir nie wieder zu einer ergreifenden Heiligenschilderung, geschweige denn zu einem inneren Gespräch mit ihnen, das doch an erster Stelle steht. Es geht bei der Erfassung eines Heiligen um seine spezifische Eigenart und Essenz, die gewöhnlich nur in Bildern angedeutet werden kann. Dabei wissen wir um das Kreuz dieser Aufgabe genau Bescheid, «daß sie ein Feuer nachbilden soll: ein Feuer, das einmal gebrannt hat» und heute leider nicht mehr brennt. Alle echte Heiligenschilderung bemüht sich unablässig, in die glimmende Glut unter der Asche kräftig hineinzublasen. Sind wir imstande, eine neue, lodernde Flamme zu entfachen, oder löschen wir mit unserer langweiligen Frömmigkeit noch alles aus?
Zunächst muß man sich fragen, in welcher Sprache von den Heiligen geredet werden soll. Ist es die Sprache des Herzens, des Verstandes? Die Tonlage ist keine bloße Verfahrensfrage und läßt sich auch nicht mit dem Stimmen der Instrumente im Orchestersaal vergleichen. Sie hängt mit dem inneren Verständnis zusammen. Die Heiligen lieben kein lautes Geschrei. Mit einer gewollten Verschwiegenheit wissen sie ihr Geheimnis zu hüten; es ist ein bedeutsames Problem, von ihrem Mysterium zu reden, ohne es zu verletzen. Auf alle Fälle sollte das Gespräch mit leiser Stimme geführt werden, frei von jedem Pathos, ungefähr so, wie wenn man einem Mädchen etwas Liebes ins Ohr sagt.
Aus naheliegenden Gründen haben sich gewöhnlich die Theologen der Heiligenschilderung angenommen. Sie haben ihre fest umrissenen Begriffe und drücken sich auf eine so grundgescheite Art aus, daß fast niemand mehr nachkommt. Aber die Heiligen sind begrifflich nicht zu fassen, ganz abgesehen davon, daß doch alle Christen am Gespräch mit ihnen teilnehmen sollten. Das Geheimnis der Heiligen – um ein solches handelt es sich – läßt sich nicht in dürre Worte fassen und schon gar nicht mit gelehrten Definitionen einfangen. Das geht nicht, und wenn man es trotzdem versucht, schlüpft das Geheimnis dem Menschen zwischen den Fingern hindurch, und unmerklich führt er ein Selbstgespräch statt eine Zwiesprache. Es geht um einen ganz realen inneren Kontakt mit den Heiligen – alles andere versandet schon im Vorfeld. Bei dem Gespräch mit den Heiligen helfen uns Gelehrsamkeit und Wissenschaftlichkeit nicht viel, weil unsere innere Verbindung mit den Heiligen eine Angelegenheit der Seele und nicht des Verstandes ist. Man kann ein eminent kluger Mensch sein und ist doch nicht fähig, mit den Heiligen auch nur zwei Worte zu reden. Wir erfassen auch die Evangelien in ihrer totalen Andersartigkeit nicht mit Hilfe der Vernunft, sondern durchaus mit dem Herzen. Die Herzkräfte sind entscheidend, weil sie das Gespräch mit den Heiligen zu einem Engagement intensivieren, das uns das Blut in die Wangen treibt. Die kritische Zergliederung hilft uns nichts. Es bedarf der Herzpfade und eines feinen Spürsinnes, um in eine innere Verbindung mit den Heiligen zu gelangen. Wir sollten von den Heiligen in jener geistigen Tonlage sprechen, deren sich Johann Sebastian Bach in seinen Kantaten und Passionen bedient hat. Das ist durchaus angebracht, denn die Heiligen stehen mit der Passion in einem Zusammenhang. Es gibt kein Heiligenleben, das nicht das Leiden gekannt hat. Trauer und Schmerz bewerten sie positiv, weil sie dabei an Sühne und Stellvertretung denken. Heilige und Leiden gehören eng zusammen; der leidende Mensch steht Gott nahe. Deswegen ist es notwendig, leise und zurückhaltend mit den Heiligen zu flüstern, ohne Eleganz oder gar Wichtigtuerei. Man müßte unserem Gespräch anspüren, daß die Heiligen eine Passion erlitten haben.
Sollte man die Heiligen in der Art bezeugen, wie Matthias Grünewald das Engelkonzert auf seinem Weihnachtsbild gemalt hat? Die musizierenden Engel ziehen unwillkürlich die Aufmerksamkeit auf sich und widerspiegeln unübersehbar jene große Freude, die durch die Menschwerdung Gottes allem Volk widerfahren ist. Wir müßten uns bei dem Gespräch unter die musizierenden Engel mischen und in ihr einzigartiges Konzert einstimmen, um der großen Freude teilhaftig zu werden. Das Schöpfungswerk Gottes ist bei den Heiligen gelungen, denn bei ihnen wird die Gottebenbildlichkeit deutlich sichtbar. Wie sollte man darüber aus innerer Freude nicht frohlocken?
Sind jedoch Passionsmusik und Engelkonzert nicht Gegensätze? Bis zu einem gewissen Grade schon, aber auf den Widerspruch kann die christliche Sprache nicht verzichten. Schmerz und Freude gehen bei den Heiligen ineinander über. Sie lebten in einer schmerzlichen Freude und in einem freudvollen Schmerz. Dieser Gegensatz gehört zu ihrem Dasein und ist viel tiefer empfunden, als wenn einer das Leben mit einem lachenden und einem weinenden Auge betrachtet. Auch bei den Heiligen sind Karfreitag und Ostern geheimnisvoll miteinander verbunden, Elend und Herrlichkeit rätselhaft verflochten. Hier ahnt man, wie leicht sie mißverstanden werden können und wie schwer es ist, das Verborgene ihres Lebens aufzuzeigen. Aus diesem Grunde stehen wir ihnen mit vielen Fragen gegenüber. Es wäre geradezu stilwidrig, die sich daraus ergebenden Probleme verdecken oder lösen zu wollen. Offen und ehrlich müssen sie dargelegt werden.
Um den richtigen Blick für die Heiligen zu erhalten, müssen einige Voraussetzungen abgeklärt werden. Die Heiligen waren Menschen aus Fleisch und Blut wie wir. Damit ist eine Selbstverständlichkeit ausgesprochen. Wie man bei der Person Christi über der Göttlichkeit die Menschlichkeit nicht übersehen darf, so verhält es sich auch bei den Heiligen. Sie waren natürliche Menschen und wußten um ihres Leibes Beschaffenheit. Wir müssen den Mut haben, die menschliche Seite nachhaltig zu unterstreichen, denn ohne diese Sicht ist das Gespräch zu Ende, bevor es begonnen hat. Wenn wir das nicht tun, bekommen wir nur unglaubwürdige Gestalten zu sehen, denen man ohnehin in vielen faden Heiligenbüchern begegnet. Beispielsweise war Nikolaus von Flüe mit seiner Dorothea wirklich verheiratet. Er hat keine Josefsehe geführt, wie man sie etlichen Heiligen angedichtet hat. Aus seiner Ehe sind zehn Kinder hervorgegangen. Der Leib fordert im Leben seine Rechte genau wie die Seele. Das Mittelalter hat die Enthaltsamkeit allzu stark betont und hat damit manchmal eher einem manichäischen als einem biblischen Ideal gehuldigt. Scheuen wir uns doch nicht, das ewige Menschengesicht des Heiligen hervorzuheben, denn nur dadurch gelangen wir überhaupt zu einem lebensnahen Gespräch, das nicht in einem bloßen Lispeln verhaucht. Das Menschsein ist etwas Großes. Auch bei den Heiligen ist es groß, eine Anerkennung, die uns zu einem charismatischen Realismus hilft, der das Siegel der Echtheit an sich trägt. Glühende Liebe zu Gott läßt sich durchaus mit der natürlichen, innigen Liebe zum anderen Geschlecht vereinbaren. Heilige haben es mit der Übernatur, niemals aber mit der Unnatur zu tun.
Damit hängt eine weitere Voraussetzung eng zusammen. Kürzlich las ich in einem ernsten Buch folgenden Passus: «In den Biographien der Heiligen fehlt immer ein Kapitel. Welches?», fragte der Schreiber. «Es ist das längste, mein lieber Sohn. Es ist das ihrer Unvollkommenheiten.» Man wird es kaum erraten, von wem diese Aussage stammt. Ein Heiliger des vergangenen Jahrhunderts, Vinzenz Pallotti, vermißte in den Heiligenbeschreibungen stets das Kapitel der Fehler der Heiligen, eine Feststellung, die durchaus zu Recht besteht. Wenn Teresa von Avila sich selbst als «ein böses Weib» bezeichnete, vermerkt der Herausgeber flugs in einer Fußnote, die Heilige habe übertrieben, während sie selbst sich beklagte, man habe sie bei der Schilderung ihrer Sünden «sehr gebunden». Verschweigt man aber alle Fehler, werden die Biographien nicht nur einseitig, sondern hemmen auch noch unsern vertraulichen Umgang mit den Boten Gottes, weil wir Menschen voller Fehler und Sünden sind. Wenn wir die Schattenseiten der Heiligen übergehen, berauben wir sie auch ihrer echten Leuchtkraft. Wir können auf den Kontrapunkt nicht verzichten. Aus diesen Gründen mißtrauen viele Christen allen Heiligenbiographien, nennen sie fromme Machwerke und zweifeln an der Echtheit. Vollkommenheit ist nicht der Fehlerlosigkeit gleichzusetzen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Nach Vinzenz Pallotti sind Unvollkommenheiten ein Kapitel, und zwar, wie er hinzufügte, «das längste, mein lieber Sohn». Freilich dürfen wir bei allem Respekt vor seiner Gestalt ergänzen: es ist wohl das längste, aber es ist nicht das wichtigste Kapitel. Man liebt keinen Menschen, von dem man nur die Fehler kennt, und wir selber haben es nicht gerne, wenn man uns unsere negativen Eigenschaften dauernd vorhält. Vinzenz Pallotti will uns jedenfalls nicht anleiten, in den Fehlern der Heiligen zu wühlen. Das würde niemandem helfen, und unser inneres Gespräch mit den Heiligen müßte bald verstummen.
Beschäftigen wir uns mit dem Leben der Dichter, Musiker und Maler, erfahren wir zu oft, daß sie zu Lebzeiten verkannt worden sind. Es legt sich uns auf die Seele, Mozart durch den Erzbischof von Salzburg und durch die meisten Zeitgenossen mißachtet zu sehen, zumal weil der Komponist doch ein ganz unvergleichliches Genie war. Viele Künstler mußten das neidische Unverständnis an sich erfahren; es ist beinahe nicht von ihnen abzulösen. Das Heiligengespräch hat mit einem solchen Problem der Verkennung nichts zu tun. Es war der kleinen Thérèse von Lisieux völlig gleichgültig, wenn man sie im Kloster nicht beachtete. Im Gegenteil, dies war ihr höchst willkommen, weil es ihrem Verlangen nach Demut entsprach. Die Heiligen wollen gar nicht berühmt werden. Sie lehnen jedes Lob ab, leben abseits und wollen auch dort bleiben. Ganz bewußt vermeiden sie alle Publizität, die heute so groß geschrieben wird und die doch so unsympathisch ist. Darin besteht einer der tiefsten Unterschiede zwischen einem Heiligen und einem Genie. Man sollte sich über die Verschiedenheit klar sein – eine Rede vom «genialen Heiligen» richtet nur Konfusion an. Das Geniale verschwindet, sobald man an die Ewigkeit denkt. Als Genie wird man geboren, es ist eine Veranlagung, während dem Heiligen die Gnade geschenkt wird. Der Heilige ist der Mensch der Stille und der Verborgenheit. Alle Anerkennung läßt ihn gleichgültig. Das Gespräch mit den Heiligen findet in einem grundsätzlich anderen Raum statt. Man muß ein Gespür dafür haben, wenn man die geistigen Dinge wieder in Ordnung bringen will. Die Heiligen flüstern uns stets zu: Sei auch du froh, wenn du unbeachtet im Winkel stehst, denn es gibt keinen herrlicheren Platz, als mit Alexius unerkannt unter der Treppe zu liegen; man sieht dort mehr als anderswo. Nach diesem Präludium stellt sich nun die entscheidende Frage: Was ist das Wesentliche bei den Heiligen? Warum wenden wir auf einen Menschen das Prädikat «heilig» an, das nach der Bibel vor allem, aber doch nicht ausschließlich, Gott zukommt, denn schon im Alten Testament heißt es: «Ich bin heilig, und ihr sollt auch heilig sein.» Was macht den Heiligen zum Heiligen, und warum kommt auch der heutige Mensch, trotz seiner vorwiegend diesseitigen Interessen, nicht von ihnen los? Ist es nicht seltsam, daß wir bei aller Besserwisserei und bei allem Hochmut in der Tiefe unseres Herzens doch eine geheime Sehnsucht haben, die uns immer wieder zu den Heiligen hinzieht, mag dies nun noch so unzeitgemäß sein? Die sensationellsten Bücher können uns blenden, Schlagzeilen der Zeitungen überraschen – in unserem Inneren wissen wir ganz genau, daß dies alles nur viel Lärm um nichts ist und daß wir ganz zuletzt, wenn aller bengalischer Zauber vorbei ist, doch hören möchten, was uns die Heiligen zu sagen haben.
An der Spitze des Wesentlichen bei den Heiligen steht die Berufung. Kein Heiliger wird als Heiliger geboren. Er lebte zunächst, wie die meisten Menschen, sein eigenes Leben, wie Charles de Foucauld mit seiner molligen Mimi am Genfersee. Ob er sich dabei etwas mehr oder etwas weniger vergnügungssüchtig gebärdete, spielt keine entscheidende Rolle. Eines Tages geschah etwas in diesem triebbedingten Dasein, das Foucauld jäh aufschreckte und seinem Leben eine radikale Wendung gab. Die Umkehr ist das große Wunder im Menschenleben. Der Mensch ist trotz seiner Klugheit ein schwerfälliges Wesen; es stehen ihm für seine trägen Gewohnheiten tausend Ausreden zur Verfügung, mag er sie nun Erbmasse oder Milieuprägung nennen. Die Heiligen dagegen waren wandlungsfähig. Manchmal genügte das Anhören einer biblischen Erzählung wie bei Antonius von Ägypten oder die aus Langeweile erfolgte Lektüre eines Heiligenbuches wie bei Ignatius von Loyola, um den großen Aufbrach zu bewirken. Das Erlebnis braucht gar nicht spektakulär gewesen zu sein, zu oft spielt es sich ganz unauffällig ab. Ein geistiger Stoß genügt, um einem Menschen Einhalt zu gebieten und ihn in eine andere Richtung zu weisen. Beim Gespräch mit den Heiligen ist es bedeutsam, sie nach der erregenden Berufungsstunde zu fragen, in der ihre Seele im Lichte Gottes bebte. Man darf über diese alles verwandelnde Stunde nicht schnell hinweggleiten. Solche geistige Explosionen ereignen sich nicht nur im Leben der Heiligen, sondern auch in unserem Dasein. Der Unterschied besteht nur darin, daß wir zwar gewöhnlich auch erschrocken zusammenfahren, aber möglichst schnell darüber hinweg zur Tagesordnung übergehen. Wir haben eine unheimliche Fertigkeit, die geistigen Einbrüche von oben in unserem Leben unwirksam zu machen, während die Heiligen aufhorchten und dem höheren Wink folgten.
Nach der Berufungsstunde begann der Kampf, denn keinem Heiligen ist seine Heiligkeit als reife Frucht in den Schoß gefallen. Auch er hat um sie ringen müssen. Die Kirche spricht gewöhnlich davon, die Heiligen hätten heroischen Tugenden nachgestrebt. Das ist eine altertümliche Ausdrucksweise, die wir nicht mehr verwenden, zumal das brave Wort «Tugend» einen faden, seifenartigen Geschmack bekommen hat. Was aber damit gemeint war, besteht durchaus zu Recht: Die Heiligen haben mit sich gestritten und haben manchmal bis aufs Blut widerstanden. Der Dornenstrauch, darin sich Benedikt vor seiner Höhle wälzte, spricht darüber eine beredte Sprache. Das war kein Ausnahmefall, sondern solche «Dornensträuche» gab es in jedem Heiligenleben auf diese oder jene Art. Die Heiligen haben sich selbst hart angefaßt, waren streng mit sich und ließen sich nicht einfach gehen. Auch Franziskus war nicht jener sonnige Mensch, der unbeschwert in der umbrischen Landschaft wanderte, kannte er doch eine eiserne Selbstdisziplin. Es gilt, die Härte der Heiligen zu sehen, und dann entdeckt man auch den Berührungspunkt zwischen ihnen und uns. Man darf eine Heiligenbiographie nicht zur bloßen Unterhaltung lesen, denn nichts ist so schädlich, wie das Christliche zum geistreichen Diskussionsgegenstand herabzuwürdigen. Der Mensch muß sich selbst die Zügel anlegen, er muß mit sich selbst ringen, und zwar vor allem in geistiger Beziehung. Ob ein Mensch den Kampf mit sich selbst aufnimmt und seelisch wächst, entscheidet über sein religiöses Schicksal. Dies ist nicht im bloß moralischen Sinn zu verstehen. Die Moral ist notwendig, aber wir verwechseln Evangelium und Moral nicht und halten das Moralisieren für ein ziemlich wertloses Denken. Der Kampf um Sein oder Nichtsein wird auf geistiger Ebene ausgetragen. Gelingt uns beim Kampf mit uns selbst kein Durchbruch, dann versandet unser Leben.
Die Heiligen haben eine Aufgabe zu erfüllen. Wenn wir dieses zentrale Anliegen in unserem Gespräch mit ihnen nicht wahrnehmen, dann haben wir uns verhört oder leiden an einer fatalen Schwerhörigkeit. Die von Gott aufgetragene Sendung kann größer oder kleiner sein – dies ist Sache der Vorsehung. Bedeutsam ist allein, daß der Heilige den Auftrag vernommen hat und ihm auch nachgekommen ist. Die Sendung, die Sendung allein ist ihm wichtig. Nach Péguy ist es erstaunlich, mit welch natürlichen Mitteln Jeanne d’Arc ihre übernatürliche Sendung ausgeführt hat. Im Verständnis und in der Erfüllung des Auftrages unterscheidet sich ein Heiliger vom andern. Natürlich darf die Sendung nicht von der Berufung und deren oft jahrelangen Verwirklichung isoliert werden. Sie gehören ganz eng zusammen. Wenn man eines Heiligen Sendung nicht nennen kann, hat man wahrscheinlich nicht verstanden, was er auf unsere Fragen antwortet.
Gewöhnlich distanzieren wir uns in dieser Beziehung von den Heiligen. Wir sind gerne bereit zuzugeben: «Ja, natürlich hatten die Heiligen einen Auftrag, deswegen sind sie eben Heilige, aber wir haben keine Aufgabe zu erfüllen, denn dafür fehlt doch jedes Anzeichen, und zudem sind wir allzu unbedeutende Leute.» In dieser Weise pflegen wir zu reden, aber, vielleicht ist dies doch zu vordergründig geurteilt. Jeder Mensch, mag er noch so schlicht gebaut sein, hat in seinem Leben ein Wort Gottes zu realisieren. Die Tragik besteht darin, daß wir uns dies gewöhnlich nicht klarmachen und dadurch unsere Bestimmung verfehlen. Die Sendung erkennen, heißt den Sinn des eigenen Lebens erfassen! An der angeblichen Sinnlosigkeit des Daseins gehen heute unendlich viele junge Menschen zugrunde. Ich habe einfache Bauersfrauen gekannt, deren Bildung gewiß nicht groß war, die aber durch ihre Geradheit, Unbestechlichkeit und Verwurzelung das Bibelwort «Der Mensch lebt nicht vom Brot allein» so leuchtend verkörpert haben, daß ich mir daneben ganz klein vorkam. Sie sind gestorben und vergessen, sind aber nach meiner Überzeugung in das Buch des Lebens eingetragen worden, und wessen Namen dort steht, ist ein Heiliger, wenn auch ein unbekannter Heiliger. Die Unterscheidung zwischen kanonisierten und unkanonisierten Heiligen ist eine menschliche Erfindung; Gott schreibt hierin eine andere Schrift, Worte, die wir nicht lesen können.
Die Heiligen sind in ihrem Wesen eine Manifestation Christi. Diese Wahrheit kommt in den alten Heiligenbiographien deutlicher zum Vorschein als in den modernen Büchern. Nach den früheren Darstellungen war man bestrebt, die Kraft Christi in einem oft armseligen Leben hervorzuheben. Die richtig verstandene Heiligenverehrung führt nicht von Christus weg, sondern zu ihm hin. Mit wem hatten es denn Augustin, Bernhard, Katharina von Siena und viele andere zu tun als mit Christus? Die Heiligen sind keine Wiederverkörperung Christi, wohl aber zeigen sie mit elementarer Wucht, welch starke Kraft Christus in einem Menschenleben sein kann. Die Heiligen wissen am besten Bescheid darüber, wie das Evangelium zu verstehen ist. Sie besaßen etwas von der Geistesmacht Christi und illustrierten mit ihrem Leben das Evangelium, und zwar lebendig und aktuell, eindringlich und atemberaubend. Man spürt, ihr Gespräch geht uns alle an.
Wir stehen unter dem Eindruck, daß der heutige Mensch keinen Zugang mehr zur Bibel findet und es ihm Mühe bereitet, sie zu lesen. Er empfindet sie als ein unverständliches, oft verschlossenes Buch, zu dem ihm der Schlüssel fehlt. Verschiedene Umstände sind daran schuld. Hemmend sind u.a. die Massenmedien, bei denen alles im Husch vorbeigeht. Von derartigen Hindernissen nehmen die Heiligen keine Notiz. Sie verlieren kein Wort der Polemik, sondern leben in der Bibel wie der Fisch im Wasser. «Sie essen vom göttlichen Wort», wie die selige Crescentia von Kaufbeuren sich ausdrückte, sie setzen es in die Tat um und geben uns mit jeder Gebärde zu verstehen, daß es da nichts zu deuteln, wohl aber unendlich viel zu tun gibt. Die Heiligen lesen die Bibel, als wäre sie ein an sie gerichteter Brief Gottes. Sie hören den Aufruf: Wacht auf! Darum ist die Meinung, die Heiligen verdrängten Christus und die Bibel, eine nichtsnutzige Ausrede. Das Gegenteil trifft zu: sie führen uns zu ihm hin, so nahe, wie man nicht näher kommen kann.
Mit all diesen Ausführungen ist das Wesentliche an den Heiligen noch nicht zu Ende gedacht. Wer nicht zur gedankenlosen Masse gehören will, muß ein Suchender werden. Erfreulicherweise begegnet man unter den Jugendlichen immer wieder Menschen, die ehrlich und ernsthaft nach einer Lebensanweisung suchen. Freilich finden sie zu oft niemanden, der ihnen dabei behilflich ist. Sie werden mutlos, wenn sie einige Jahre umsonst gesucht haben, geben vorzeitig auf, werden zynisch und sagen: Es ist doch alles nur ein Schwindel. Solche Tragödien im Leben vieler Jugendlicher gehören wohl zum Traurigsten, was es gibt.
Auch die Heiligen waren suchende Menschen, aber sie gehörten nicht zu dem unseligen Geschlecht derer, die immer suchen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Die Heiligen haben, augustinisch formuliert, gesucht, um zu finden, und sie fanden, um erneut zu suchen, damit sie nie zu den glücklich Besitzenden zu zählen seien. Um es ganz kurz und prägnant auszudrücken: Die Heiligen haben den christlichen Weg gefunden. Darin besteht eine ihrer bedeutsamsten Taten. Im Evangelium ist mehrfach vom Weg die Rede. Der schmale und der breite Weg wird erwähnt, und im Johannesevangelium sagt Christus: «Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.» Den Weg finden, ist die große Aufgabe im Dasein; sie findet bei den Heiligen die ersehnte Erfüllung. Sie haben den christlichen Weg betreten, einen Weg, der hier auf Erden beginnt und in der Ewigkeit endet. Die Heiligen haben davon verschieden, aber immer in schlichten Worten gesprochen, wie Clemens Hofbauer, der Heilige Wiens, es einmal tat: «Nicht streiten, sondern beten. Es ist besser, man redet mit Gott von dem Sünder, als mit dem Sünder von Gott.» Der christliche Weg ist den meisten unserer Zeitgenossen unmerklich aus den Augen entschwunden – gerade deswegen sind sie so ratlos und so haltlos und wissen die einfachsten Dinge nicht mehr.
Man kann davon nicht reden, ohne wiederum auf die heutige Jugend zu blicken. Es wurde bereits erwähnt, wie wichtig diese Wegfrage für sie ist. Darum dürfen wir mit den Heiligen kein eingehenderes Gespräch führen, ohne die Jugend einzubeziehen. Sie steht heute ohne Leitbilder da. Es gibt verantwortungslose Schriftsteller, die in ihren Romanen zu beweisen versuchen, daß das Vorbild eine Illusion und gleich viel wert ist, wie am Gängelband herumgeführt zu werden. Deswegen ist die heutige Jugend von einem Gefühl der Ohnmacht, Empörung und Verzweiflung beherrscht. Freilich ist es keine leichte Sache, der Jugend die Heiligen als Vorbilder hinzustellen. Bei den Kindern dürfte dies kaum gelingen, ohne das Bild des Heiligen zu verharmlosen. Die Heiligen haben manchmal göttliche Torheiten begangen, die bürgerliche Menschen irritierten. Man muß selbst den christlichen Weg beschritten haben, um den Mut, die Kunst und die Kraft aufzubringen, heilige Richtbilder den jungen Menschen so vor Augen zu rücken, daß sie Feuer aus Stein schlagen. Gerade das Ungewöhnliche an den Heiligen wirkt auf eine noch begeisterungsfähige Jugend. Wir müssen alle Kraft und den radikalen Ernst darauf konzentrieren, einer mißbrauchten und angeschlagenen Jugend einen neuen Zugang zu den Heiligen zu erschließen, die allein eine wirkliche Alternative zu unserer übersättigten Wohlfahrtsgesellschaft bilden. Wir dürfen nicht mit den bisherigen abgenutzten und verbrauchten Formeln vom heiligen Aloysius mit der weißen Lilie in der Hand zu den jungen Menschen reden, sondern müssen neue Worte finden, Worte, die uns freilich nur geschenkt werden können. Es geht nicht an, im modischen Jargon mit ihnen zu sprechen, haben sie doch ein feines Gefühl dafür, ob eine Rede echt oder ob sie eine bloße Mache ist, hinter der sich eine leere Autorität versteckt.
Zum Schluß noch ein Wort über die Heiligenverehrung. Die Heiligen verfügen, wie wenig Sterbliche, über eine ungewöhnliche Nach-Geschichte. Manchmal ist sie sogar größer als ihre Lebensgeschichte. Die Heiligenverehrung ist in der Kirche eine bedeutsame Frage, und es kann auch keinen Zweifel darüber geben, daß sie im Laufe der Geschichte einen Wandel durchgemacht hat. Aller Wahrscheinlichkeit nach gibt der Begriff der Heiligenverehrung Anlaß zu Mißverständnissen, weshalb er gegenwärtig eher zu vermeiden ist. Ich meine es ganz schlicht: Wenn man von den Heiligen redet, dann redet man nicht von den Toten. Sie leben. Sie sind mit uns unterwegs, und sie wirken in unser Dasein hinein, sonst wäre ein intensives Gespräch mit ihnen gar nicht möglich. Es gibt eine Berührung mit den Heiligen, und wer keine solche erlebt hat, sollte nicht über sie reden. Dabei vermitteln sie keine billigen Rezepte, nach denen die Menschen stets verlangen. Patentlösungen gibt es auf geistigem Gebiet nicht und darf es nicht geben, weil es bei den Heiligen nicht um Nachahmung, sondern immer um Impulse geht. Es gilt, den rechten Umgang mit den Heiligen zu finden. Sie sind für uns gegenwärtig, und wir fühlen uns von ihnen auf eine geheimnisvolle Weise umstellt. Es ist keine bloß ahnungsvolle Gefühlssache, sondern eine innere Glaubensgewißheit. Wenn wir von den Heiligen reden, dann sprechen wir indirekt von Gott. Da Gott in einem Lichte wohnt, da niemand zukommt, vermögen wir auch von ihm nur in Gleichnissen und Bildern zu sprechen. Es gibt Menschen, die von dieser Wahrheit bis ins Innerste durchdrungen sind, und wiederum andere, die eine solche Aussage dem mittelalterlichen Aberglauben gleichsetzen. Niemand bekümmere sich deswegen oder lasse sich unsicher machen. Der Glaube ist, trotz allen Schwierigkeiten, die ihm zuweilen der Verstand bereitet, eine schlichte Sache. Wir sagen in aller Einfalt, daß die Nähe der Heiligen eine Realität ist; wir sind von ihrer unsichtbaren Gegenwart fest überzeugt. Sie sind und bleiben für uns die wahren Begleiter im Leben. Ohne sie würde sich das Dasein verfinstern. Wir sagen nicht, daß mit ihnen alles glatt und glücklich geht, dies auszusprechen wäre naiv, eine Erfahrung, die uns schon das Hiobbuch verbietet. Aber die Heiligen werfen einen hellen Schein auf unseren finsteren Weg. Unser Gespräch mit ihnen hat nichts mit der heutzutage so beliebten Diskussionssucht zu tun. Wir halten davon nicht viel. Das Gespräch mit den Heiligen kann eher mit dem Wort «Gebet» charakterisiert werden. Das gebetsähnliche Gespräch ist erfüllt von der Gewißheit: Es ist heilsam und hilfreich, mit den Heiligen in vertraulicher Verbindung zu bleiben.
Eine erste Einführung: Augustinus
Es ist schade, jedoch nicht zu bestreiten: die gehaltvolle Welt der Kirchenväter ist der Christenheit unbekannt geworden. Nicht nur sind die Väter für die Laien fremde Gestalten, auch die meisten Theologen wissen wenig über sie. Laien und Theologen lesen gegenwärtig psychologische, soziologische und politologische Schriften um die Wette, keinesfalls aber patristische Werke. Wer kennt heute noch den leidenschaftlichen Tertullian, diesen altkirchlichen Kierkegaard, dessen Formulierung «Gottes Sohn ist gekreuzigt – das ist nicht beschämend, weil es eine Schmach ist; und Gottes Sohn ist gestorben – das ist glaubwürdig, weil es eine Torheit ist; und er ist begraben und auferstanden – das ist gewiß, weil es unmöglich ist» das zeitlose, denkerisch nicht zu bezwingende Paradox des Evangeliums ausspricht? Ebenso ist der durch Jahrhunderte hindurch verleumdete Bekenner Origenes erst in unserer Zeit von Henri de Lubac und Hans Urs von Balthasar rehabilitiert worden, so daß wir wieder zu ahnen beginnen, wieviel wir von seinem Schriftenverständnis zu lernen haben. Tertullian, Origenes und noch viele andere Väter führen ein vergessenes, nur dem Fachgelehrten noch bekanntes Dasein. Die Kirchenväter scheinen für die Christenheit nicht mehr zu existieren und sind in unerforschliche Tiefen versunken. Dabei stehen sie doch dem Urchristentum rein zeitlich schon viel näher als die Scholastiker und die Reformatoren. Dank den Vätern wurde Newman zu dem überaus vornehmen Theologen von führender Bedeutung. Es ist eine der großen, derzeit noch völlig ungelösten Aufgaben, die Kirchenväter neu zu erschließen und sie den heutigen Christen wieder nahezubringen; dieses schwere, sogar ungeheuer schwere Problem zu bewältigen duldet keinen Aufschub. Josef Wittig ließ mir vor seinem Tode sagen: «Die Kirchenväter lebendig zu schildern wäre noch wichtiger, als die Heiligen darzustellen.» Ich meine aber, man sollte das eine tun und das andere nicht lassen. Jedenfalls gehört die Aktualisierung der Kirchenväter zu den dringlichsten Problemen.
Eine einzige Gestalt der Kirchenväter ist dem gebildeten Christen nicht ganz aus den Augen entschwunden: Augustinus. Er verdankt dies neben seiner außerordentlichen Denkkraft und dem rhetorischen Glanz seiner Sprache besonders seinen «Konfessionen», die immer wieder aufgelegt werden. Von den Übersetzungen ist jene von Hermann Hefele in künstlerischer Beziehung wohl dem Originaltext am nächsten. Die «Konfessionen» sind bis zur gegenwärtigen Stunde der geeignetste Einstieg zu einer ernsthaften Lektüre. Dieser Anleitung wollen auch die nachfolgenden Zeilen dienen. Dabei enthalten die «Konfessionen» längst nicht den ganzen Augustin, doch vermitteln sie dem heutigen Leser am ehesten den Zugang zu diesem schöpferischen Christen und grandiosen Denker.
Zwar wurden auch die «Bekenntnisse» in der Neuzeit unterhöhlt. Nietzsche fand sie falsch, augenverdrehend, ekelhaft verlogen und behauptete, dem darin enthaltenen verpöbelten Platonismus fehle der stolze Geist. Außerdem sei das «rührselige sich vor Gott zur Schau stellen» verabscheuungswürdig, und man sähe in diesem kriecherischen Buch dem Christentum in den Bauch. Sein Urteil schwatzte André Suarès nach, indem er in seinem Aufsatz «Misère des Heiligen Augustin» höhnte: «Wie ein Dorfpfarrer hält er sein Bett und die zwei oder drei banalen Szenen, die er in den Bettlaken mit einer Frau aufführt, für die Achse der Welt.» Die geschmacklosen Urteile verraten einen Snobismus, der nichts Großes anerkennt und nicht einmal den Künstler in Augustin wahrnimmt, der von hohem Rang war.
In Wirklichkeit sind die «Bekenntnisse» ein ungemein ergreifendes Werk. Der Erbe einer ganzen Kultur schrieb es, und um seiner Großartigkeit willen überdauerte es auch die Jahrhunderte. Unzähligen Menschen wurde es eine Anleitung zur Meditation über das innere Leben. Die «Bekenntnisse», in meisterhafter Sprache abgefaßt, tönen stellenweise wie Musik, leise klagend und doch süß im Klang. Ein Lehrer der Rhetorik verfaßte das Kunstwerk, das trotzdem nie im bloß Schönrednerischen hängenbleibt. Auf keiner Seite ergeht sich Augustin in leerem Gerede; seine Worte dringen stets zum inneren Bereich vor. Er vermochte Unsagbares sagbar zu machen und erreichte damit eine der seltensten Selbsterschließungen. Sprache und Inhalt bilden in den «Bekenntnissen» eine unauflösliche Einheit und bezaubern durch ihre bedeutungsschwere Form. Augustins «Bekenntnisse» sind eine erschütternde Beichte, in der er nie dem schalen «Kult des Ich» verfällt. Bei aller Ehrlichkeit ist er frei von jener Schamlosigkeit, die sich mit den eigenen Verfehlungen noch brüstet. Augustin schrieb die Bekenntnisse im Ton eines «erkennenden Betens und eines betenden Erkennens». Er ist der Mensch, der vor Gott durchsichtig werden will und daher vor dem Angesicht des Allmächtigen über sein Leben reflektiert. Zuweilen erhebt sich seine Stimme dabei zu wahren Lobpreisungen. Nicht oft wurde in der Geschichte der Autobiographie diese Höhe erreicht; alle kritischen Bedenken gegen die Zuverlässigkeit der Berichterstattung lösen sich in ein Nichts auf. Der innere Glanz wird offenkundig, wenn man die «Bekenntnisse» mit der Lebensbeschreibung des langjährigen Schülers Possidius über Augustin vergleicht, der den zweiten Teil von dessen Leben aufzeichnete. Glücklicherweise ist Possidius’ Werklein vorhanden; namentlich vom älteren Augustin erzählt es höchst Wissenswertes. Possidius’ Prosa ist geradezu schwunglos und eingetrocknet gegenüber Augustins Autobiographie, die vom Atem der Ewigkeit durchweht ist, den auch der heutige Mensch noch spürt, wenn er sich unvoreingenommen dem Werke stellt.
Augustin war von kleiner Gestalt und machte mit seinem kahlgeschorenen Haupte und den glattrasierten Wangen keinen überwältigenden Eindruck. Der Mann mit dem scharfgeschnittenen Gesicht war von zarter Konstitution und war in seiner Kleidung von betonter Einfachheit. Alle Bilder von Augustin stammen aus späteren Epochen. Von seinem inneren Leben dagegen hat man eine anschauliche Vorstellung, obschon er vor sich selbst bekannte: «Du aber warst innerlicher als mein Innerstes und höher als mein Höchstes.»
An Augustin fällt zuerst die ewige Geistesunruhe des menschlichen Herzens auf. Es ist nicht so sehr der empirische Ablauf seines Lebens mit den verschiedenen Stationen bedeutsam, als vielmehr die in den «Bekenntnissen» geschilderte Ruhelosigkeit seiner Seele. Sie hat weder mit der Unrast noch mit der Betriebsamkeit der modernen Zeit etwas zu tun, da sich Augustin keineswegs in einer hektischen Nervosität verausgabte. Bei ihm wurde die Unruhe schöpferisch, war sie doch metaphysisch und nicht bloß psychologisch ausgerichtet, ein Verhalten, das ihn beinahe zu einer altkirchlichen Faustgestalt machte. Seine Unruhe stachelte ihn zu einem unablässigen Suchen an, das nicht mit treuloser Unbeständigkeit verwechselt werden darf. Augustin war der suchende Mensch schlechthin, der größte aller Suchenden. Die in ihm lebende Unruhe ließ ihn nicht bei einer erreichten Stufe stehenbleiben, sondern trieb ihn unablässig weiter. Er selbst sagte: «So also wollen wir suchen; als solche, die finden werden, und so wollen wir finden; als solche, die suchen werden.» Unermüdlich fragte er, gab sich mit keiner Antwort vorschnell zufrieden, und jede Antwort drängte ihn zu neuen Fragen. Er war der von einer höheren Macht gejagte Mensch, der, wie ein von Hunden gehetztes Wild, immer weiter und weiter stürmte und sich keine Ruhe gönnte. Nie hätte er zum Augenblick sagen können: «Verweile doch, du bist so schön!» Bis zu seinem vierzigsten Altersjahr fühlte er sich nicht am Ziel. Er selbst schilderte überaus anschaulich seinen Zustand: «Immer näher kam ich und immer näher kam ich, und beinahe packt ich’s schon und hielt’s! Doch noch war ich nicht dort und packte es noch nicht und hielt’s noch nicht und zauderte noch immer, den Tod zu sterben und zum Leben neu zu leben.» Diese metaphysische Unruhe, der nichts, aber auch gar nichts Irdisches Genüge tun konnte, veranlaßte ihn, höher und noch höher hinaufzusteigen, bis er schließlich über sich selbst hinaus gelangte.
Der Höhepunkt dieses Suchertums endigte mit der in der Nähe von Mailand erfolgten Bekehrung. Sie wird in den «Bekenntnissen» ebenso dramatisch wie kunstvoll erzählt, so daß sie sich zu einem der großen Beispiele verdichtete. Zwar ist das Wort «Bekehrung» abgenutzt und voll unangenehmen Beigeschmackes. Besser wäre es, vom entscheidenden Durchbruch zum neuen Leben zu reden. Das augustinische Damaskus warf ihn buchstäblich zu Boden, und im selben Augenblick empfing er eine unerwartete Erleuchtung von oben, die ihn völlig umgestaltete und seinem Leben eine andere Richtung gab. Augustin war nach diesem Ereignis nicht mehr der gleiche Mensch. Wenn er auch noch einige Zeit brauchte, um das Geschehen innerlich zu verarbeiten, war er doch eine neue Kreatur geworden: die unfruchtbare Zeit des Umherirrens war zu Ende, sein Suchertum nahm eine gestraffte Form an, und er wußte fortan um das himmlische Jerusalem. Damals jubelte Augustin: «Frieden der Ruhe, Sabbatfrieden, Frieden ohne Abend.» Er schrieb wundervolle Worte über den abendlosen Tag, Gedanken, wie sie nur ein Mensch zu schreiben vermag, der die innere Ruhe gefunden hat.
Mit einer meisterhaften Psychologie schilderte sich Augustin in den «Bekenntnissen». Damals empfand man die lebensnahe Art der Beschreibung des Aufruhrs der eigenen Seele als eine unerhörte Neuerung. Die Menschen der Antike öffneten ihr Inneres gewöhnlich nicht und blickten gleich den griechischen Statuen mit geschlossenen Augen in die Welt. Ausnahmen sind der Psalmsänger, der klagende Prophet Jeremia und Paulus mit den Ausführungen über das Gesetz, das in seinen Gliedern so widerspruchsvoll streitet. Bei diesen Männern findet sich der Anfang der religiösen Psychologie, die bei Augustin ihre mächtige Entfaltung erfährt. In den «Bekenntnissen» öffnete er sein Inneres: er läßt den Leser in seine Seele hineinschauen und verheimlicht ihm nichts, weil er weiß, daß etwas im Menschen ist, worüber auch sein eigener Geist nichts weiß. Augustin sprach von seinem Ungenügen, von seinen Vorsätzen und von seinem Versagen. Er führte aus, was er sich in religiöser Hinsicht ersehnte und aus Angst vor der Notwendigkeit einer Lebensumgestaltung doch wiederum nicht wollte. Sich selbst im Wege stehend, schrieb er: «So also ist’s kein Rätselwesen, halb zu wollen, halb nicht zu wollen, nein, eine Seelenkrankheit ist es.» Kein Mensch vor Augustin hat je sein Innerstes so offen enthüllt und sein Seelenleben so preisgegeben, wie er es getan hat. Er stand seinen inneren Vorgängen nicht verständnislos gegenüber und gehörte nicht zu den Menschen, die nicht wußten, was sie davon zu halten haben. Augustin beobachtete sich selbst genau, dachte unaufhörlich über die seelischen Regungen nach, und darum hat man es bei ihm mit dem ersten großen Psychologen zu tun, für den der Mensch ein tiefer Abgrund und dem sein eigenes Ich zur brennenden Frage geworden war: «Ein abgründiges Geheimnis ist der Mensch.»
Augustin war ein Psychologe ersten Ranges, aber er war keinem Psychologismus verfallen. Davor bewahrte ihn schon die Auffassung von der Seele als dem Reich der Innerlichkeit. Die christliche Innerlichkeit gewann bei dem Afrikaner ein Ausmaß, das, so wenig wie das Meer, je auszuschöpfen ist. Er faßte die Psyche des Menschen nicht für sich allein ins Auge, sondern immer in Beziehung auf das Ewige. Nie wanderte er bloß die Straße der Gefühle auf und nieder, auch blieb nicht alles in einer Zuständlichkeit hängen. Sie hätte ihn ohnehin daran gehindert, aus seinem Gehege herauszukommen. Augustin schrieb die berühmte Formulierung: «Gott und die Seele will ich erkennen. Nichts anderes? Nein, nichts anderes.» Die Seele befindet sich bei ihm in einem beständigen Gespräch mit Gott, wodurch er zu jener seltenen Überpsychologie kam, die der ganz aufs Metaphysische ausgerichteten Psyche entsprach. Von Gott her wird sie betrachtet, auf ihn bezogen und von ihm durchlichtet. Es gibt bei Augustin neben der äußeren Welt noch ein «Drinnen» und ein «Darüber». Mit diesen neuen Dimensionen wurde der Kirchenvater zum Begründer der christlichen Psychologie, die sich wesentlich von der wissenschaftlichen Schulpsychologie unterscheidet. Die Seele ist bei Augustin das Lebendige, das Göttliche, das sich nie restlos in Definitionen einfangen läßt. Seine christliche Psychologie fand ihre Fortsetzer bei den mittelalterlichen Mystikern, bei Pascal, Kierkegaard und Dostojewski.
Man erhält dieses ungemein bewegte Bild von Augustin aus seinen «Bekenntnissen». Er schrieb sie in seinen besten Mannesjahren. Damit war aber seine Entwicklung nicht zu Ende. Augustin reiste nach seiner Bekehrung nach Thagaste in Nordafrika zurück, um sich dort in einem kleinen Kloster den Studien hinzugeben und «frei von Geschäften vergöttlicht zu werden». Es erwachte in ihm eine starke Beziehung zum Mönchtum. Er war fest überzeugt davon, daß die Klosterinsassen mit der evangelischen Lebensverwirklichung am meisten Ernst gemacht haben. Sein Entschluß stand fest, es ihnen gleichzutun. Er schloß sich ihnen an und wurde schließlich zu einem der großen Väter des Mönchtums. Er arbeitete für sein Kloster eine ausführliche Regel in zwölf Kapiteln aus und schuf damit die älteste abendländische Mönchsregel, die es überhaupt gibt.
Doch dauerte das stille Leben der Zurückgezogenheit nicht allzulange. Während eines Gottesdienstes in Hippo bestimmte ihn das Volk stürmisch zum Priesteramt und wählte ihn einige Zeit später zum Bischof. Keineswegs ist der von der ewigen Unruhe erfüllte Augustin auf dem bischöflichen Stuhl unnahbar und würdevoll geworden. Er trennte sich in seinem Bischofsamt nicht vom Volk, sondern lebte mit ihm zusammen. Man hat schon bedauert, daß dieser große Geist seine Zeit mit so einfachen Leuten vertrödelt und unter ihnen nicht den ihm entsprechenden Gesprächspartner gefunden habe. Doch ist das Bedauern nicht am Platze. Augustin war wegen seiner Taufe vom intellektuellen Hochmut frei und sah in den einfachen Handwerkern, Hausfrauen und Arbeitern von Hippo jederzeit seine Mitchristen, die alle auch eine Seele hatten wie er und die zu betreuen er sich keine Stunde zu vornehm dünkte. Er liebte seine Herde aufrichtig, und infolgedessen gewann er eine Volksverbundenheit und Volksvertrautheit, wie sie nicht viele Menschen besaßen. Er war vorzüglich befähigt, die Gläubigen seelsorgerlich zu leiten, sie in der Predigt christlich zu belehren und sie, wenn es sein mußte, auch juristisch zu beraten. Jederzeit stand Augustin für sie zur Verfügung, nichts war ihm zu klein, und gerade deshalb steht er so groß da. Der holländische Theologe Van der Meer hat dies in seinem vorzüglichen Buch «Augustinus der Seelsorger» überaus anschaulich geschildert. Man kennt Augustin nur zur Hälfte, wenn man nicht um seine alltägliche, dreißig Jahre dauernde Arbeit in Hippo weiß, die vorbehaltloses Lob verdient. Es ist deshalb uneinsichtig, den jungen, heidnischen, gegen den alten, christlichen Augustin ausspielen zu wollen. Geistig bedeutsam ist vor allem der reife Augustin, der auch die lebendige Schilderung über seine frühere Phase gegeben hat. Er besaß religiöse Erfahrung und stellte, abgeklärt wie er inzwischen geworden war, alles jugendliche Draufgängertum in den Schatten.