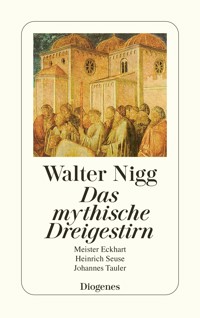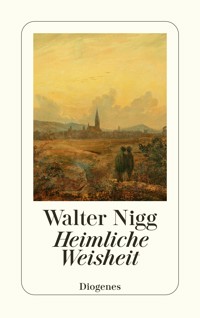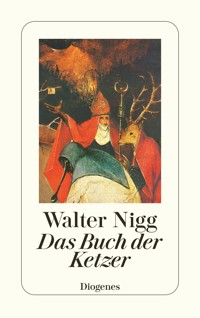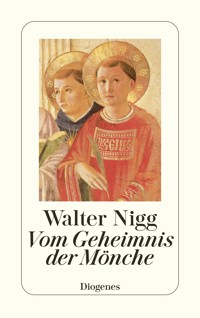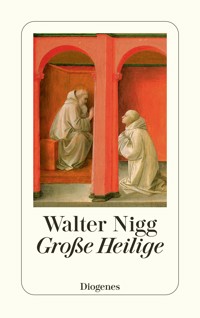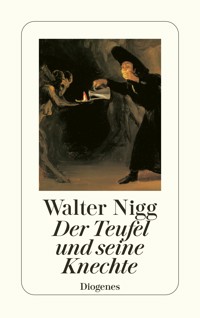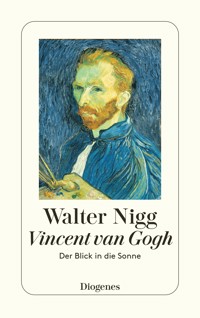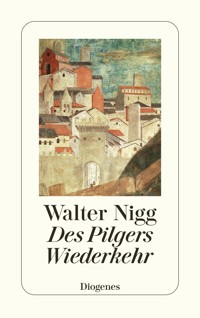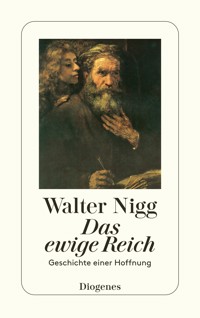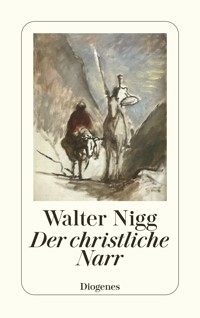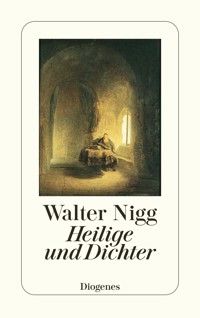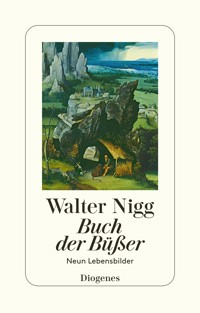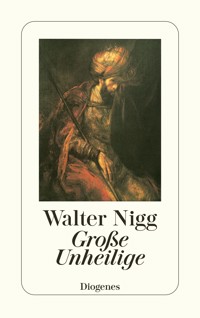
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Auf der Suche nach dem »wahren Bild des Menschen« beschreibt und deutet Walter Nigg mit großem psychologischem Einfühlungsvermögen die Verfehlungen der »Gegenspieler der Heiligen«, ohne deren Größe zu negieren. Dargestellt werden die Lebensläufe der ›Großen Unheiligen‹ König Saul, Judas Ischariot, Heloise, Kaiser Friedrich II., Michael Bakunin, Charles Baudelaire und Friedrich Nietzsche.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 350
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Walter Nigg
Große Unheilige
Diogenes
«Ach wehe und aber wehe allen unseren Lehrern und Buchschreibern, die also sicher daherfahren und speien heraus alles, was ihnen ins Maul fällt, und sehen nicht zuvor einen Gedanken zehnmal an, ob er auch recht sei vor Gott!»
Martin Luther
«Die Bedrohung kommt nicht von den unschuldigen Dingen. Was euch bedroht, ist in euch, in eurer Brust, meine Freunde, steckt in eurer Haut. Mein Gott, wie soll ich es euch sagen, damit ihr es versteht? Daß es unter euch Sünder gibt, sehr große Sünder, das hat keine besonderen Folgen, denn jede Gemeinde hat ihre Sünder. Solange aber die Gemeinde zusammenhält, bilden die Sünder und die andern einen einzigen Leib, den das Mitleid, ja vielleicht die Gnade Gottes durchrinnt wie der Saft einen Baum.»
Georges Bernanos
Einleitung
Das Bild des Menschen
«Wie kann das Bild des Menschen in dem Herzen unserer Mitbürger wieder hergestellt werden?»1 Die Frage bewegte Helmut von Moltke in seinem Kreisauer-Kreis, der sich mit dem Wiederaufbau Deutschlands nach dem zu erwartenden Zusammenbruch beschäftigte. Bedrängend war die Frage nach der Wiederherstellung des Menschenbildes, nachdem eine verbrecherische Gewaltherrschaft es mit beispiellosem Zynismus in den Boden gestampft hatte. Nicht nur damals hat sich diese brennende Frage den verantwortungsbewußten Menschen auf die Seele gelegt, sie steht in allen Zeiten im Vordergrund. Auch heute ist sie aktueller denn je, zumal der Wert des Menschenlebens auf einem Tiefpunkt angelangt ist.
Das Bild des Menschen war früher und ist heute noch gefährdet. In Vergangenheit und Gegenwart wurde es oft mit Füßen getreten. Der geschichtlichen Beispiele sind Legion. Die europäischen Völker haben es in ihren früheren Kolonien manchmal derart furchtbar geschändet, daß es einem Faustschlag ins Antlitz Jesu Christi gleichkam. Die nationalsozialistischen Schergen in den Konzentrationslagern und die Kommunisten in den Arbeitslagern vernichteten brutal das Menschenbild. Die Geschichte mit ihren zahllosen Kriegen, Verfolgungen und Revolutionen gleicht einem riesigen, nicht auszuradierenden Schandfleck.
Im Ersten Weltkrieg brach der Expressionismus mit seiner Anklage auf und protestierte gegen die Menschen-Schändung, aber die Ironie des Schicksals wollte es, daß gerade er das Menschenbild zur häßlichen Fratze verzerrte. Die abstrakte Malerei nahm vom Menschenbild überhaupt keine Notiz mehr und dokumentierte damit ungewollt die gegenwärtige Inhaltslosigkeit, die für die Zeit der Unmenschlichkeit charakteristisch ist.
Die Wiederherstellung des Menschenbildes ist keine theoretische Angelegenheit. Es geht in den nachfolgenden Ausführungen weder um eine theologische, noch um eine philosophische Frage, sondern um ein höchst aktuelles Sein des Menschen, das gegen die heutige Ratlosigkeit ausgerichtet ist. Nie darf man aufhören, über die Frage nach dem wahren Menschenbild nachzudenken, selbst wenn es keine endgültige Lösung gibt, solange wir uns auf der Wanderschaft befinden. Die Antwort muß stets aufs neue gefunden werden, denn nur dann bleibt der Mensch lebendig. Doch hat es wenig Sinn, von Menschenrechten zu reden, wenn das Bild des Menschen verschwommen wird und verdämmert.
Das christliche Menschenbild stützt sich auf das biblische Wort: «Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn.»2 Aus der Gottebenbildlichkeit leitet sich die Würde des Menschen ab. Keinem anderen Wesen hat der Ewige seinen Atem eingehaucht und es dadurch zur lebendigen Seele gemacht. Diese Tat unterscheidet den Menschen vom Tier, zu dessen Spezies man heute vielfach den Menschen zählen will, ohne sich Rechenschaft zu geben, daß auf diesem Weg die Bestimmung des Menschen noch vollends untergraben wird. Die Würde des Menschen ist kein leeres Wort, sondern ein unabdingbarer Wert. Dafür gibt es ein kleines Beispiel. Unscheinbare Begebenheiten sind oft lichtvoller als lärmende Ereignisse. Immanuel Kant war in den letzten Tagen seines Lebens krank, und der Arzt besuchte ihn.
Der achtzigjährige Philosoph bemühte sich sofort, sich von seinem Stuhl zu erheben und ihn zu begrüßen. Der Arzt bat hierauf den geschwächten Mann, doch sitzen zu bleiben, worauf Kant verlegen zauderte und mit erzwungener Stärke sagte: «Das Gefühl für Humanität hat mich noch nicht verlassen.» Diese Äußerung rührte den Arzt fast zu Tränen.3 Die wenig beachtete Szene bringt in aller Schlichtheit die menschliche Würde bildhaft zum Ausdruck. Das Zeugnis des todkranken Kant ist so bedeutsam wie seine Überzeugung, nach der man im Krieg nie Handlungen begehen dürfte, die eine Versöhnung unmöglich machen. Dermaßen hoch wurde einst das christliche Menschenbild eingestuft. Matthias Claudius schrieb ganz schlicht: «Der Mensch ist der erste und wichtigste Buchstabe von allen.»4 Dies scheint eine einfache Erkenntnis zu sein und doch wird sie selten in ihrer Bedeutung erkannt. Alles ist verwerflich, was die Gottebenbildlichkeit des Menschen verwüstet, mag es sich noch so raffiniert drapieren. Wer den Menschen schändet, der schändet Gott. Viele gegenwärtige Strömungen müssen trotz aller Modernität abgelehnt werden, weil ihnen das notwendige Verantwortungsgefühl fehlt.
Der Heilige verkörpert am anschaulichsten die Gottebenbildlichkeit des Menschen. Freilich bedarf das Heiligenbild einer tiefgreifenden Revision. Es muß mit neuen Augen angeschaut werden, da es dem Heiligen um ein Geheimnis geht, dessen man nie ganz habhaft wird. Nach der traditionellen Auffassung hat der Heilige die Tugenden im heroischem Maße geübt und sich durch Wundertaten bezeugt. Das Ideal des Heroischen geht auf die Renaissance zurück, die es von der Antike übernommen und dem Barockzeitalter weitergegeben hat. Dies ist jedoch eine verkrustete Heiligenvorstellung. Bedeutsamer ist das andere, von der spanischen Mystik herkommende Heiligenverständnis, nach dem der Heilige durch eine besondere Gottnähe gekennzeichnet ist und als Licht in der menschlichen Finsternis erscheint. Heilige verwirklichen «das hohe Bild einer christlichen Größe in Lumpengestalt», wie sich Fürstin Gallitzin ausdrückte, als Johann Georg Hamann im Münsterkreis weilte.5 Diese Auffassung vom Heiligen gibt seinem Bild eine intensivere Färbung. Heilige sind Menschen mit einer Antwort. Sie sind das Salz der Erde und gehören zu den sechsunddreißig Gerechten, um deretwillen nach einer jüdischen Legende Gott die Welt erhält. Der gottgewollte Mensch ist das ewige Thema, denn er allein weiß um die Antwort auf die Frage nach der Wiederherstellung des Menschenbildes. Der Heilige zählt zu den geistig Großen der Weltgeschichte, wobei man allerdings die Bemerkung des Wandsbecker Boten nicht überhören darf: «Nichts ist groß, was nicht gut ist». Mit der Behauptung, «die großen Menschen sind nicht als Vorbilder, sondern als Ausnahmen in die Welt gestellt worden» (Jakob Burckhardt), verbleibt man im Unverbindlichen, ja, sie werden unwirksam gemacht. Heilige sind echte Leitbilder, weil sie eine geistige Vollmacht besitzen und den Menschen den Weg zu finden helfen. Die Heiligen vertreten kein System, keine Ideologie, keine Dogmatik – das alles hilft uns wenig. Sie veranschaulichen beinahe wortlos eine neue Lebensweise, nach der wir stets suchen und die wir noch nicht gefunden haben. Es ist schwer, von ihnen nur annähernd in der ihnen entsprechenden Sprache zu reden. Es gehört Ehrfurcht, Begeisterung und vor allem Liebe dazu. Wir müssen für sie ganz neue Worte finden, Gedanken, die uns noch nicht zur Verfügung stehen. Zwar ist auch der Heilige ein Mensch mit Fehlern; es wäre uneinsichtig, dies zu vertuschen. Die Heiligen selbst besaßen ein beinahe überscharfes Gefühl für ihr Versagen. Aber trotz aller menschlichen Schwachheit bewegten sie sich auf einer viel höheren Ebene als der Durchschnittsmensch. Der Heilige verlangt nach Maßstäben, die wir noch nicht kennen, und darum bleibt alles, was wir über ihn schreiben, hinter ihm zurück. Keine noch so wohlgemeinte Darstellung erreicht seine wirkliche Höhe. Alle Hagiographie ist immer nur ein Versuch der Annäherung, und nie glückt das Wagnis endgültig. Der Heilige steht als zukünftiges Menschenbild vor uns. Er ruft uns zu einem neuen Sein auf, schreitet uns voran und stürmt uns davon. Wir aber sitzen untätig da und können uns aus unserer Lethargie nicht aufraffen.
Warum verhalten wir uns hierin so passiv? Wohl nur deshalb, weil das Thema der Heiligen durch schwere Vorurteile belastet und durch konfessionelle Voreingenommenheit getrübt ist. Die Katholiken haben zwar die Heiligen immer hochgehalten, haben sie aber im neunzehnten Jahrhundert in ein allzu enges Schema gepreßt, das oft einer Mumifizierung gleichkam. Die Protestanten nahmen von den Heiligen keine Notiz und brachten in ihrer Ablehnung weder die Reinheit des Instinktes noch die historische Gerechtigkeit zu einer Würdigung auf. Schon dem Wort allein verschließen sie sich und vermauern sich jeden Zugang zu diesen einzigartigen Gestalten. Dies hat sich auch im Zeitalter der Ökumene nicht geändert. Beide Einstellungen trugen zur Nichtbeachtung der Heiligenbücher bei. Viele Menschen nehmen alles andere in die Hände, nur kein Heiligenbuch. Sie verbinden damit sofort die Vorstellung von einer unausstehlichen Langeweile, statt in ihm eine Wegleitung zu sehen. Dabei gibt es keine Wiederaufrichtung des Menschenbildes, ohne eine neue Besinnung auf die Heiligen. Sie wissen um das Unbedingte und um den Ursprung.
Wegen des Verrufes der Heiligenbücher ist es geboten, das Thema einmal radikal umzudrehen und es von einer ganz anderen Seite anzugehen, indem man die Aufmerksamkeit auf die Unheiligen richtet. Der unheilige Mensch ist der Gegenspieler der Heiligen. Bei ihm wird die Gottferne sichtbar, und weil er sich selbst in den Mittelpunkt stellt, ist er zum Scheitern verurteilt. Bei ihm ist das Bild des Menschen in Unordnung geraten, er ist die Negation in greifbarer Gestalt, und deshalb vermag er nur ein mißratenes, verzerrtes Bild des Menschen zu zeigen. Sonderbarerweise ist der Mensch oft dermaßen verdreht eingestellt, daß ihn eine absinkende Persönlichkeit mehr interessiert als eine positive Figur, die man in der gegenwärtigen Literatur ohnehin vergeblich sucht. Das Böse ist von stärkerer Anziehung auf ihn als das Gute, besonders noch, wenn das Gute so schwächlich vertreten wird wie in unserer Zeit. Vielleicht greifen etliche Menschen zu einem Buch über Unheilige, und dann könnte ihnen eine Ahnung aufgehen, daß über Heiligkeit und Unheiligkeit nachzudenken wichtiger ist, als das Resultat vom letzten Golfspiel zu erfahren.
Keineswegs wird dadurch die Heiligen-Thematik abgeschwächt, im Gegenteil, sie wird aktualisiert. Die Konturen des Heiligen treten schärfer hervor, wenn er vom Gegenpol aus betrachtet wird. Der Antipode macht oft vieles klarer, und so treten auch die katastrophalen Folgen der Unheiligkeit deutlicher hervor, wenn man sie mit der Heiligkeit konfrontiert. Ohne sie bleibt die tiefere Sinndeutung des Lebens unverständlich. Die Dimension wird erweitert durch die Einsicht, daß auch die gestrandeten Menschen auf eine unerklärliche Weise in den Plan Gottes einbezogen sind. Viele Christen scheinen nicht den Gott zu kennen, der seine Sonne über Gerechte und Ungerechte scheinen läßt. Nach ihrer kleinlichen Auffassung dürfte die Sonne nicht über die Bösen scheinen. Die meisten Christen besitzen nicht den geistigen Mut, sich dem Negativen in der Geschichte zu stellen, was freilich zu den schwersten Aufgaben gehört. Sie fürchten sich vor dem destruktiven Anblick und flüchten ängstlich, anstatt sich ihm unerschrocken zum Kampfe zu stellen. Gewiß sind die Unheiligen Sünder, aber, will uns denn gar keine Ahnung aufgehen über die geheimnisvollen Bande zwischen den großen Sündern und den großen Heiligen? Auch die Unheiligen besaßen die Anlage zum göttlichen Ebenbild, wahrscheinlich noch stärker als viele lauwarmen Namenschristen, die weder Wärme noch Kälte kennen. Aber sie haben sich im Leben oft in böse Schuld verstrickt, haben in einer verhängnisvollen Stunde die Weichen falsch gestellt und sind deshalb unter die Räder gekommen. Tatsächlich liegt die Frage nach dem unheiligen Menschen innerhalb des religiösen Bereiches, den wir ohnehin zu stark einschränken, wenn wir solche Menschen zum voraus ausklammern. Allen frommen Einwänden zum Trotz gehören die Unheiligen zur Christenheit, denn außerhalb ihrer unsichtbaren Wände können sie gar nicht richtig erfaßt werden. Im christlichen Raum dagegen bewirken sie Schmerz und Anfechtung, die vom religiösen Denken nicht ablösbar sind, weil sie nach einer unerbittlichen Auseinandersetzung rufen. Zum mindesten bewahrt das Dasein der Unheiligen den Christen vor Selbstsicherheit, die immer den geistigen Tod zur Folge hat.
Zwischen den Heiligen und den Unheiligen besteht freilich ein tiefgreifender Unterschied. Der Heilige ist klar und durchsichtig; trotz aller Fehler wird er von den göttlichen Strahlen bis in die letzte Tiefe erhellt. Bei ihm ist, näher besehen, alles einfach und schlicht. Der Unheilige dagegen ist undurchdringlich; sein Seelengewebe ist verworren und von dämonischer Verschlossenheit. Man schaut ihm nie auf den Grund, mag man noch so viele Schichten abtragen.
Wenn eine Interpretation der Unheiligen zum wahren Menschenbild zurückfuhren soll, muß sie sich vor zwei Gefahren hüten, von denen die eine das Gegenteil der andern ist.
Zunächst wäre es sträflicher Leichtsinn, mit diesem Thema pikante Anekdoten zu verbinden. Ebensowenig denken wir daran, uns mit einem unterhaltungssüchtigen Publikum anzubiedern und schon gar nicht ist es uns darum zu tun, die ganze Unheiligkeit nochmals durchzuexerzieren. Dies ist in der Welt genug und übergenug geschehen, und es braucht wahrhaftig nicht nochmals versucht zu werden. Die heutige Lage ist dafür viel zu ernst. Auch eine bloß ironische Betrachtung weisen wir zurück. Ironie hat ihre Berechtigung in gewissen Situationen, aber sie ist kein durchgängig zu verwendendes Stilmittel. Sie weiß viel zu wenig Bescheid um das, was im Innern eines Menschen vorgeht, sieht oft nur das Lächerliche und erschöpft sich in der Verspottung. Völlig verfehlt wäre auch nur die geringste Verherrlichung des unheiligen Menschen. Es ist zwar heute Mode geworden, das Unheilige auf saloppe Art zu lobpreisen, und viele Menschen fühlen sich dadurch in ihren dunklen Trieben bestätigt. Die moderne Literatur ist größtenteils in diesen Bann geraten und hat deswegen Verrat an der echten Poesie geübt. Wer hierin gewissenlos handelt, gerät unweigerlich auf eine abschüssige Bahn, mag sie auch dem gegenwärtigen Zeitgeist noch so entgegen kommen und von verantwortungslosen Kritikern hochgejubelt werden. Denn unheilig bleibt unheilig und darf nicht spielerisch zu einer halben Heiligkeit zurechtgebogen werden. Dies kommt einer zwar verbreiteten, aber nichtsdestoweniger einer geistigen Falschmünzerei gleich, die in der modernen Zerfallszeit ihr Unwesen treibt.
Zum andern wird das Wort «Unheilige» in den nachfolgenden Ausführungen nicht in einem moralistischen Sinn gebraucht. Wohin kämen wir, wollten wir die Geschichte mit einem moralischen Maßstab messen? Wir würden in der ersten Viertelstunde zuschanden werden und unvermeidlich in einem widerlichen Pharisäismus endigen. Es geht uns nicht um eine Verurteilung des unheiligen Menschen. Wir stoßen auch kein Triumphgeschrei aus wie die Sänger über den bestraften Bösewicht im letzten Akt von Mozarts Oper «Don Juan». Es kann nicht das Amt des Historikers sein, eine Verdammung auszusprechen. Es geht auch nicht um eine Gerichtssitzung, nicht einmal um eine Entrüstung, zumal die Empörung weit eher ein Gradmesser der Unsittlichkeit als der Sittlichkeit des Herzens ist. Die Verurteilung einer Persönlichkeit entspricht nicht dem Evangelium, das doch die Menschen eindringlich warnt: «Richtet nicht!» Wir empfinden mit diesen namenlos unglücklichen Menschen eher eine erbarmende Solidarität, nicht eine Identifizierung, wohl aber eine Verbundenheit, wie sie uns Christus mit den Zöllnern und Sündern vorgelebt hat. Statt uns ganz schlicht neben und nicht über sie zu stellen, zeigen wir uns kühl und distanziert. Dabei können wir uns des Gewissensvorwurfes nicht erwehren: Wir haben diese unheiligen Menschen oft in ihrer grenzenlosen Seelennot und Verzweiflung im Stich gelassen und haben uns ob ihren bösen Worten und Taten abschrecken lassen. Wir sind nicht über alle Mauern hinweg zu ihnen vorgedrungen und sind ihnen in ihrer seelischen Finsternis nicht beigestanden.
Nur wenn wir sowohl Verherrlichung als Verurteilung vermeiden, zeigt der Kompaß die wahre Richtung an. Alles andere fuhrt zu einer Begriffsverwirrung, die unter das Gericht des Prophetenwortes fällt: «Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse heißen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen» (Jes. 5,20). Die heutige Spielerei mit dem Unheiligen schafft nur verwirrte Urteile. In den nachfolgenden Ausführungen wird ganz bewußt das Unheilige vom Standpunkt des Heiligen aus betrachtet. Eine vermittelnde Haltung würde zu einem Fallstrick für den Menschen werden, und ebenso führt jedes dialektische Denken auf diesem Gebiet zu einer Verunsicherung. Man darf sich nicht der Erkenntnis verschließen, daß der Heilige dem Menschen eine heile Sicht vermittelt und der Unheilige dem Moloche gleicht, der die eigenen Kinder verschlingt.
Beim Nachdenken über das Leben der Unheiligen stellt sich gerne die Situation ein: Während der Mensch einen andern richtet, tut er dasselbe, was er verurteilt. Wenn wir diesen Gedanken ernst zu Ende denken, führt er uns, ob wir wollen oder nicht, zum Geständnis: Wir sind mitbeteiligt an den unheiligen Gestalten, ja, wir gehören, ungeachtet des inneren Sträubens, auch dazu. Die großen Heiligen, besonders eindrucksvoll Katharina von Siena, haben nie von der Verderbnis der Welt geredet, ohne sich ihrer Mitschuld zu bezichtigen. Wie sollten wir nicht unheilig sein, wir mit unserem gleichgültigen Christentum, das sich so bereitwillig dem Zeitgeist anpaßt und nicht die geringste Leidenschaft des Glaubens mehr kennt? Bereiten wir mit unseren konfusen, aus allen Eimern zusammengelesenen Ideen nicht der Unheiligkeit den Weg? Wurde nicht auch durch unsere bequeme Indifferenz das Unheilige in der Welt verbreitet? Das Eingeständnis der eigenen Verantwortungslosigkeit muß ehrlich empfunden sein. Ein gedankenloses Lippenbekenntnis ist wertlos und wirkt sich niemals als eine umgestaltende Kraft im Leben aus.
Wäre es nicht besser, statt von Unheiligen zu reden, ein Bild vom tragischen Menschen zu zeichnen? Die Frage ist nicht zum voraus abzuweisen. Tragik ist ein gewichtsschwerer Begriff, schließt er doch Schicksal und Charakter in sich. Die Tragödie läßt den Menschen in letzte Abgründe hinabblicken, vor denen er schaudernd zurückbebt. Wer die Tragik bestreitet, weiß nichts von der Transzendenz der menschlichen Existenz. Dem Wort «tragisch» haftet allerdings der Mangel an, gegenwärtig zu oft gebraucht zu werden, weshalb es manchmal sinnverändernd wirkt und auf eine Entschuldigung hinausläuft. Nicht alles ist tragisch, was diese Benennung beansprucht. Um der echten Tragik willen, müßte man eine Zeitlang Zurückhaltung üben im Gebrauch des Wortes «tragisch», bis dieser Begriff wieder seine ursprüngliche Kraft zurückgewonnen hat. Im übrigen sind Unheilige und tragische Gestalten nicht ein und dasselbe.
Mit der Tragik ist der Schicksalsgedanke verbunden. Allzugerne sagt der Mensch, ihm sei nun einmal dieses Schicksal beschieden. Meistens ist dies zwar eine gedankenlose Ausflucht und nichts anderes. Die Schicksalsidee stammt aus der griechischen Welt, in der sie erdrückend auf dem Menschen lastet. Die Bibel weiß nichts von Schicksal; sie kennt das Wort «Schicksal» so wenig wie den Begriff «Glück». Dem Schicksalsgedanken haftet eine Blindheit an, die alles noch finsterer macht, als es ohnehin ist. Wohl kann man sich dem Schicksal ergeben, aber dies ist letztlich nur eine Resignation, die kaum der Weisheit letzter Schluß sein dürfte, weil sie einer Kapitulation gleichkommt. Wir resignieren niemals, sondern kämpfen mit der Unheiligkeit, solange Atem in uns ist, und meinen dabei nie, das Problem lösen zu können.
Wer über die Unheiligkeit nachzudenken beginnt, stößt zunächst einmal auf die Rätselnatur des Menschen. Der Lebenslauf der meisten Menschen ist selten verständlich, jedenfalls kann er nicht mit einem klaren Bach verglichen werden. Bewegten Herzens seufzt Augustinus: «Mir selbst ward ich zum großen Rätsel.»6 Warum ziehen wir aus Augustinus’ Einsicht vom Rätselwesen des Menschen, «halb zu wollen und halb nicht zu wollen», was er als eine Seelenkrankheit diagnostiziert hat, gar keine Konsequenzen?7 Was nützt alle Seelenkunde, wenn ihre echten Aussagen uns nicht dazu anleiten, darüber zu reflektieren, wie das Bild des Menschen in den Herzen unserer Mitbürger wieder hergestellt werden kann? Wie viele Möglichkeiten schließt der Mensch in sich! Es ist oft nicht zu fassen, was alles im gleichen Menschen Platz hat. Aus Widersprüchen zusammengesetzt, hat er oft keine Ahnung, welche Gegensätze in ihm schlummern, mit welcher Selbsttäuschung er herumläuft und welcher Ausbrüche er fähig ist. Es ist ungeheuerlich schwer, dem Menschen in die Seele zu schauen und den letzten Grund auszuloten. Bernanos schrieb in seinem «Haus der Lebenden und der Toten»: «Ich glaube nicht mehr an die Betrüger, seit ich ‹l’Imposture› geschieben habe, oder ich habe doch wenigstens eine ganz andere Vorstellung von ihnen … Nachdem die letzte Zeile geschrieben war, wußte ich noch nicht, ob der Abbé Cénabre in der Tat ein betrügerischer Heuchler war oder nicht, ich weiß es immer noch nicht, ich habe aufgehört, mich danach zu fragen.»8 Wenn der Dichter eine Figur, die er monatelang in sich getragen hat, bevor er sie Gestalt werden ließ, nicht einmal richtig in ihrem Wesen erkennt, wie sollen wir denn aus der Rätselnatur des Menschen klug werden? Trotzdem dürfen wir nicht aufhören, das Leben der Unheiligen zu umkreisen und zu fragen, wo die Verstrikkung begann und wann die verhängnisvolle Wendung in ihrem Dasein erfolgte. Die Pfade der Menschen sind verschlungen und oft unentwirrbar. Mit der Psychologie kommt man im besten Fall ein kleines Stück weit, nicht aber zum Ziel. Sie erhellt höchstens einen Teil, und doch darf sie nicht einfach ausgeschaltet werden. Alles, was uns ein Menschenleben besser zu verstehen hilft, ist uns willkommen. Darum gehört die verstehende Psychologie dazu, wenn man auch nicht bei ihr stehen bleiben darf. Man würde die Tiefe verfehlen, wollte man die metaphysische Betrachtung nicht einbeziehen. Biographische Darstellung ist ein überaus schweres Unterfangen, weil man von keinem Menschen alles weiß und vieles unbekannt bleibt. Einiges ist dem Verfasser verständlich, anderes ist ihm fremd und gar vieles erkennt er beim besten Willen nicht. Ein jedes Leben ist ein nicht zu erhellendes Geheimnis und wir tun gut daran, das Unerklärliche des Daseins zu respektieren. Der Christ hat vor dem Leben der Unheiligen stille zu stehen und zu verstummen. Schweigen ist immer besser, als vorlaut zu räsonieren.
Aus der großen Zahl der Unheiligen habe ich eine kleine Auswahl getroffen, der lediglich paradigmatischer Wert zukommt. Bewußt habe ich verbrecherische Naturen ausgeschlossen, weil bösartige und zynische, machtsüchtige und teuflisch gesinnte Menschen der Erwähnung unwürdig sind. Auch von kleinen Figuren sah ich ab, denn damit hätte ich mir das Problem unerlaubt leicht gemacht. Den ausgewählten Gegenspielern kann ich, trotz ihrer Unheiligkeit, einen gewissen Respekt nicht versagen. Die Schwierigkeit besteht darin, ihnen ihre Größe zu belassen und sie nicht verächtlich zu behandeln. Die Unheiligen bergen eine Reihe von Problemen in sich, die in diesem Zusammenhang nicht alle erwähnt werden können. Man muß sich jedoch einige Fragen vorlegen, damit das Menschenbild im Herzen unserer Mitbürger wieder hergestellt werde. Dabei vergesse ich keinen Augenblick, daß man das Thema «Unheilige» nur unter dem Aspekt des Erbarmens darstellen kann. Anders darf man vom wahren und verzerrten Bild des Menschen gar nicht reden.
Das Problem des Bösen tritt einem bei den Unheiligen in erschreckender Form entgegen. Jedes akademische Gebaren ist fehl am Platze. Das auf dem Katheder kühl und unbeteiligt dozierte Böse ist nicht das Böse, sondern nur eine bloße Idee vom Bösen, was etwas grundsätzlich Verschiedenes ist. Die Dichter haben hierin einen Vorsprung vor den Wissenschaftlern, man halte nur Jeremias Gotthelfs mit elementarer Wucht geschriebene «Schwarze Spinne» neben eine gelehrte Abhandlung über das Böse. Die Zeit der wissenschaftlichen Traktate über diese Thematik ist vorbei. Das Böse ist mit dem Unheiligen unablösbar verknüpft und versetzt den innerlich beteiligten Leser in eine wahre Bestürzung. Der Diabolus ist am Werk und bringt alles durcheinander. Was ist das Böse? Diese Frage warf schon Jesus Sirach auf: «O Trieb zum Bösen! Warum bist du geschaffen, den Erdkreis mit Bosheit zu erfüllen?»9 Wir wissen nicht, woher die Schlange im Paradies gekommen ist, die das erste Menschenpaar verführt hat. Diese Frage übersteigt unsere Verständnismöglichkeit. Wenn man nur eine kleine Ahnung von der Wucht des Dämonischen besitzt, weiß man, daß das Böse unerklärlich ist. Jedenfalls ist das Böse nicht nur die Abwesenheit des Guten. Diese neuplatonische Anschauung wirkt verharmlosend. Das Böse ist keineswegs bloßer Mangel, sondern stets äußerster Angriff, ist unheimliche Macht und nicht nur ein bloßes Wort wie andere Worte auch. Wer den Griff an die Kehle nicht spürt, gehört zu den Ahnungslosen, die meinen, mit einem religionsgeschichtlichen Nachweis dem Problem beizukommen. Man kann nur erschrockenen Gemütes über das Böse nachdenken, weil es in und außer dem Menschen ist. Es ist eine sich selbst zerfleischende Kraft, die Mensch, Welt und Leben zerstört. Immer hat der Mensch mit ihm zu tun, und selbst der gute Mensch wird von ihm versucht. Nie wird er damit fertig. Im unheiligen Menschen hat das Böse über ihn Gewalt gewonnen. Er ist ihm hörig geworden. Der Mensch vermag bloß den Kampf mit dem Bösen aufzunehmen und dann noch ist er ihm nicht gewachsen, es sei denn, die Gnade Gottes komme ihm zu Hilfe. Christus hat den Menschen zu beten gelehrt: «Erlöse uns vom Bösen.»
Darf man die Unheiligen mit der Prädestinationslehre in Zusammenhang bringen? Die Vorherbestimmungslehre ist nicht dem Schicksalsgedanken gleichzusetzen, da Gott hinter der Erwählung und der Verwerfung steht. Daraus ergibt sich ein anderer Klang. Der moderne Mensch übersieht geflissentlich diesen Fragenkomplex, und wenn er es ausnahmsweise nicht tut, gerät er in Harnisch. Prädestinationsgedanken bedeuten für ihn lediglich eine krasse Ungerechtigkeit, gegen die er sich auflehnt. Damit aber drückt er sich vor einem der schwersten Probleme. Ernst Troeltsch, den sicher niemand der Engstirnigkeit bezichtigen kann und der sich so viel mit dem Problem des Historismus beschäftigte, schrieb einmal: «Es ist schon so: Erwählung, Gnade, Prädestination, Auslese ist alles … Die religiösen Genies, ein Jesus und Buddha, ein Paulus und Augustin, ein Luther und Calvin, die mit dem religiösen Blick am tiefsten, wenn auch sehr partikular und einseitig in das Wesen der Dinge zu dringen pflegen, haben schon recht. Gnade und Erwählung sind das Geheimnis und Wesen der Geschichte. Das meinen ja auch die Philosophen mit ihrer Lehre vom intelligibeln Charakter und meint Goethe in seinen orphischen Urworten.»10 Mag die Vorausbestimmung noch so gegen die menschliche Vernunft verstoßen und sie zur Aufhebung förmlich reizen, so ist sie im Leben doch immer wieder wahrzunehmen. Es klingt zwar so schön zu hören, «der Mensch ist frei und wenn er in Ketten geboren wäre», doch entspricht dieses idealistische Pathos nicht der Wirklichkeit. Die Grundwasser fließen unterirdischer. Die Prädestination ist keine Lehre, sondern ein Seezeichen, das eine unverkennbare Tiefe signalisiert. Zu einer unbeweglichen Doktrin ausgedehnt, wie dies der Genfer Reformator großartig getan hat, wirkt sie sich versteinernd aus. Der von Schwermut überschwemmte Prophet Jeremias gesteht: «Ich weiß, Herr, daß des Menschen Tun steht nicht in seiner Gewalt, es steht in niemandes Macht, wie er wandle oder seinen Gang richte.»11 Ein ungeheuerliches Wort, das den Menschen zu Boden streckt, und doch, wer will ihm ernsthaft widersprechen? Begreiflich, daß Michelangelo diesen Propheten in Gedanken versunken dargestellt hat. Das prophetische Wort fällt keineswegs aus dem Rahmen des Alten Testamentes. An seiner Seite steht der hintergründige Prediger Salomo, der das Leben vom Standpunkt einer tiefsinnigen religiösen Philosophie aus zu erfassen versuchte und dabei zum Resultat gelangte: «Auch weiß der Mensch seine Zeit nicht; sondern, wie die Fische gefangen werden mit einem verderblichen Hamen, und wie die Vögel mit einem Strick gefangen werden, so werden auch die Menschen bedrückt zur bösen Zeit, wenn sie plötzlich über sie fällt.»12 Man kann diese unmeßbaren Worte nicht lesen, ohne eine namenlose Trauer im Herzen zu empfinden, weil sie uns mit ihrer Wucht beinahe zermalmen. Man vermag sie kaum anzunehmen und noch viel weniger kurzerhand abzuweisen. Es sind Tiefenworte, die wie Stacheln in unserem Fleisch sitzen und letzte Geheimnisse andeuten. Zuweilen legen sie sich auf unsere Seele; wir denken unwillkürlich an sie, wenn ein Mensch freiwillig oder unfreiwillig aus dem Leben scheidet und wir in unserer Betroffenheit nicht wissen, was wir sagen sollen. Jedenfalls sind wir unfähig, sie zu bewältigen, weil sie zu mächtig sind und unser Verstehen übersteigen. Luther schrieb «Vom unfreien Willen», ein in seiner religiösen Gewalt beinahe unmenschliches Buch, das doch alle Einwände vor sich her bläst. Trotzdem löst es das Problem der Verantwortung des Menschen für seine Taten nicht. Man kann und darf sie ihm auch nicht abnehmen. Wenn man Erasmus von Rotterdams sanfte Lehre vom freien Willen gegenüberstellt und der Meinung ist, der Mensch könne in allen Dingen frei entscheiden, so ist dies eines der fragwürdigsten Geschenke, die er erhalten hat, weil er ihm in den meisten Fällen nicht gewachsen ist. Jedenfalls ist ihm nur ein geringer Spielraum von Freiheit gewährt, werden doch die bedeutsamen Wendungen von Gott bestimmt. Die Streitfrage zwischen Luther und Erasmus ist gedanklich nicht zu lösen; man muß den Gegensatz in seiner ganzen Härte stehen lassen. Das Leben der Unheiligen drängt dem Betrachter Prädestinationsgedanken auf, deren er sich nicht erwehren kann. Wir verstehen das Leben der Menschen nicht, schon gar nicht in zukünftiger Perspektive und, rückwärts gesehen, höchstens stückweise. Erst in der Ewigkeit wird es uns klar werden, hier aber bleibt es ins Dunkel gehüllt; das Evangelium allein ist das Licht, das in die Finsternis scheint.
Es ist unmöglich, in das Innere der Unheiligen vorzudringen, ohne auf das Problem der Schuld zu stoßen, die das Bild des Menschen nochmals dunkler färbt. Auch die Schuldfrage gilt heute als ein unmodernes Problem, das der Mensch gerne mit einer leichten Handbewegung von sich schiebt und dadurch unter das Urteil fällt: Werde ein Schwätzer und siehe, alle Schwierigkeiten sind gelöst. Vielen Menschen ist das Wort «Schuld» geradezu verhaßt, auf jeden Fall versuchen sie mit allen Mitteln, sich von ihr zu befreien. Darum der Kreislauf der Geschichte: es wird immer neue Schuld auf die alte gehäuft, und nie ist ein Ende abzusehen. Wenn heutzutage schon einmal von Schuld die Rede ist, dann ist natürlich stets die Gesellschaft und nie der Einzelne schuldig. Dies ist die leichtfertige Lösung der Schuldfrage im marxistischen Denken. Der heutige Mensch spricht in seinen psychologischen Überlegungen im besten Fall noch von Schuldgefühlen, von denen er durch den Psychiater befreit zu werden hofft. Dies alles ist zu oberflächlich gedacht und läßt ein Unbehagen zurück. Ebenso uneinsichtig ist die Aussage: die andern sind auch schuld. Dies ist ein mißglückter Rechtfertigungsversuch. Wirkliche Schuld läßt sich im Unterschied zu bloßen Schuldgefühlen niemals abwälzen. Vielmehr lautet das richtige Wort: «Durch meine Schuld, durch meine große Schuld ist das Verhängnis entstanden.» Sie gehört zum Dasein des Menschen und läßt sich nicht aus dem Leben ausklammern. Man kann nicht leben, ohne schuldig zu werden. Was Schuld ist, ahnt man, wenn man Dostojewskijs «Rodion Raskolnikoff» liest. Der Dichter schildert den Mörder, der seine Schuld mit messerscharfer Dialektik vor sich selbst bestreitet. Unheimlich sind die Argumente, die der Verstand hiefür ins Feld führt. Mit der Vernunft läßt sich alles rechtfertigen – das ist das Erschreckende am Intellekt. Aber dem dialektisch geschulten Verstand steht das Gewissen Raskolnikoffs gegenüber, das er mit allen logischen Spitzfindigkeiten nicht zum Schweigen bringt. Es ist ein atemberaubendes Ringen zwischen Intellekt und Gewissen, das erst ein Ende findet, da Raskolnikoff, von einem inneren Zwang getrieben, zum Heumarkt in Petersburg geht, mitten auf dem Platz niederkniet, sich bis zur schmutzigen Erde verneigt, sie küßt und laut seine Schuld bekennt. Wer Dostojewskijs Buch liest, es nicht zur Unterhaltung liest, sondern es so liest, wie es gelesen sein will, mit brennenden Augen und pochendem Herzen, dem wird es zu einem seelischen Ereignis, dem gegenüber alles literarische Gerede sich in nichts auflöst. Warum wird es zu einer persönlichen Sache, während das Buch doch vor mehr als hundert Jahren geschrieben worden ist? Gewiß nur deshalb, weil das Schuldbewußtsein mit einer erdrückenden Wucht dem Leser nahegebracht wird, so intensiv, bis sich der Vorgang in seinem Innern und nicht nur im Buch abspielt und er nicht mehr ausweichen kann. Die Unheiligen befinden sich oft in einem Teufelskreis. Sie bringen es nicht fertig, das unselige Räderwerk anzuhalten, weil die Sühne in ihren Gedanken keinen Platz hat. Von der Schuld ist die Sühne nicht ablösbar. Schuld und Sühne sind die beiden Pole, zwischen denen sich das menschliche Leben bewegt. Es geht nicht an, das eine auf Kosten des andern preiszugeben.
Was geschah mit den Unheiligen nach ihrem Tode? Auch diese Frage, die namentlich Péguy stark beschäftigte, drängt sich auf, so unzeitgemäß sie auch klingen mag. Wir können sie ganz unmöglich beantworten, wenn wir nicht dem Urteil Gottes vorgreifen wollen, was dem Menschen in keiner Weise gestattet ist. Als Christen aber glauben wir an die Barmherzigkeit Gottes, die alles Bitten und Verstehen übersteigt. Ohne sie können weder Heilige noch Unheilige bestehen. Es ist ein Kennzeichen des Christen, daß er nie die Hoffnung preisgibt und zwar für alle, alle. Dabei ist nicht das intellektuelle Gerede über das Prinzip der Hoffnung gemeint, von dem in den letzten Jahren viel zu hören war. Die lebendige Hoffnung gründet sich auf das Evangelium und nicht auf Prinzipien. Das Evangelium aber enthält die Botschaft: «Bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich.» Ohne Hoffnung ist das Leben nicht zu bestehen; wir hoffen bis zum letzten Höllenkreis hinab. Der dauernd betrunkene Vater von Sonja sagt in einer armseligen Spelunke zu Rodion Raskolnikoff: «Er wird der Richter sein allen und wird vergeben, wie den Guten so auch den Bösen, wie den Weisen so auch den Einfältigen … Und wenn er mit allen schon fertig sein wird, dann wird er auch zu uns sprechen: ‹Kommt, ihr Betrunkenen, kommt, ihr Schwächlinge, kommt ihr Schandkerle!› Und wir alle werden vortreten, ohne uns zu schämen, und werden dastehen. Er aber wird sagen: ‹Ihr Schweine! Ihr Ebenbilder des Tieres und vom Tiere Gestempelten; aber kommet auch ihr!› Und die Weisen und die Klugen werden ausrufen: ‹Herr! Warum nimmst du denn diese auf?› Und er wird sagen: ‹Ich nehme sie auf, ihr Weisen, ich nehme sie auf, ihr Klugen, weil kein einziger von ihnen sich dessen für würdig gehalten hat …› Und er wird seine Hände uns entgegenstrecken, und wir werden niedersinken … und werden weinen … und alles verstehen! Dann werden wir alles verstehen! … Herr, dein Reich komme!»13
König Saul
(ca. 1025–1000 v. Chr.)
Jedes geschichtliche Geschehen hat seine Vorgeschichte, die im Keim schon die Nachgeschichte in sich enthält. Bei Saul ist die Vorgeschichte mit dem Namen Samuel verbunden. Er steht am Anfang des Dramas.
Der Knabe Samuel wurde dem Priester Eli zur Erziehung anvertraut, zumal in jenen Tagen «Offenbarungen des Herrn selten waren».1 Immerhin war die Lampe Gottes noch nicht erloschen. Da erlebte der junge Samuel in einer Nacht seine geheimnisvolle Berufungsstunde. Die Stimme rief ihn. Das Geschehen ist mit lapidarer Kürze erzählt, frei von jeglichem psychologischen Detail und doch voll plastischer Wucht. Nichts ist im Dasein eines Menschen bedeutsamer, als die rufende Stimme zu vernehmen. Der Mensch kann eine Berufungsstunde nicht gestalten, sondern sie nur zitternd über sich ergehen lassen. Samuel begriff sie zuerst nicht, auch Eli wußte sie nicht zu deuten und erst beim dritten Ruf der Stimme sprach der Jüngling erschrocken: «Rede, dein Knecht hört». Dann sprach der Ewige zu ihm: «Siehe, ich will in Israel etwas tun, daß jedem, der es hört, beide Ohren gellen werden.»2 Geschichte besteht immer aus ohrenbetäubenden Ereignissen; sie mag noch so träge dahinfließen, unterirdisch grollt es stets unheimlich, und nur die geschäftigen Menschen überhören in unbegreiflicher Taubheit die blitzartigen Anzeichen. Erst wenn die Katastrophen eingetreten sind, greifen sie verzweifelt an den Kopf und lernen trotzdem nichts aus ihnen. Das Gerichtswort Gottes erfüllte sich mit bestürzender Eile. Die Israeliten wurden von den Philistern geschlagen, die Bundeslade geriet in die Hände der Feinde, die lasterhaften Priestersöhne Hophni und Pinehas kamen im Kampf ums Leben, und der alte Eli fiel beim Anhören der unheilvollen Nachricht tot vom Stuhl. Schlag auf Schlag folgten die Unglücksnachrichten. Es blieb kaum Zeit zum Atem schöpfen übrig. Das Ende mit Schrecken bestand darin, daß das Haus Eli endgültig ausgelöscht wurde.
Fortan war Samuel ein Gerufener. Obwohl er etwas Zwielichtartiges an sich hatte, hatte er nach der Niederlage eine priesterliche Funktion. Samuel zählte zu den heldenhaften Richtergestalten des Alten Bundes, von denen Deborah und Gideon, Jephta und Simson schon vor ihm berühmt geworden waren. Er war der letzte von ihnen und rückte zum Seher auf, dem man später den Namen ‹Prophet› gab, obwohl er nicht einfach ein frommer Mann war, wie ihn die Bibelleser gewöhnlich sehen. Samuel war auch politisch tätig, und gerade dieses Tun war zweideutig an ihm. Nach Jesus Sirach rief er noch auf dem Sterbebett seine Umgebung zusammen, um vor Zeugen auszusagen: «Von wem habe ich Geld oder auch nur ein Paar Schuhe angenommen?»3 Man darf die alttestamentlichen Männer nicht theologisch betrachten, weil diese Sicht ihrer archaischen Wildheit nicht gerecht wird. Samuel lebte in einer ungeordneten Zeit voll gewaltiger Umbrüche. Während seines Lebens vollzog sich eine entscheidende Umwälzung in der Geschichte Israels, an der er als ein politisch handelnder Mensch maßgebend beteiligt war. Diese politische Priestergestalt hat tief in die Geschichte eingegriffen. Als ein in die Zukunft blikkender Seher klammerte sich Samuel nicht an die Vergangenheit. Er dachte ernsthaft über die Haltbarkeit der israelitischen Theokratie nach und zweifelte an ihrem Fortbestand. In seinen Gedanken über die weitere Entwicklung seines Landes schreckte Samuel nicht vor kühnen, allzu kühnen Plänen zurück.
Die Berichterstattung über Samuels Entscheidung ist nicht einheitlich. Nach der älteren, dem Seher verbundenen Überlieferung sah Gott in seinem Heilsplan vor, daß das Volk inskünftig durch einen König regiert werden soll, eine Anweisung, die Samuel ausführte. Die jüngere Berichterstattung redet von einem Volksbegehren, was wahrscheinlich der Wahrheit näher kommt. Nach ihm wollte das Volk nicht mehr der unmittelbaren Leitung Gottes unterstellt sein. Es hat damit nicht nur Samuels Richteramt, sondern Gott selbst verworfen, nachdem es, «wie die andern Völker», einen König wünschte. Ein Israel, das den übrigen Nationen gleich sein möchte, ist nicht mehr Israel; es ist vom auserwählten Volk zu einem bloßen Staat herabgesunken, ein tragischer Vorgang, der sich in anderer Weise in unserer Gegenwart erneut wiederholt.
Welche von den beiden Überlieferungen den wirklichen Sachverhalt widergibt, läßt sich nicht mit Sicherheit sagen. Die zwei verschiedenen Berichte stehen im Widerspruch zueinander und dürfen nicht harmonistisch miteinander vereinigt werden. Das Alte Testament ist ein Buch von mythischer Größe, das die stärksten Gegensätze aushält. Es kann einem dabei der Atem ausgehen. Gegen die innere Gewalt der alttestamentlichen Geschichtsschreibung mit modernen Quellenscheidungstheorien, Streichungen und Einschüben vorzugehen, heißt einen tosenden Bergbach mit einer Streichholzschachtel aufhalten zu wollen. Man kann nicht, wie die Philologen es tun, hinter den Text zurückgehen, denn ein solches Unternehmen bliebe in subjektiven Hypothesen stecken. Vielmehr müssen wir dem Text mit dem Mut zur Entscheidung begegnen, müssen uns von ihm persönlich erschüttern lassen, alles andere ist kein ebenbürtiges Verhalten. Es ist überheblich, den Text vor ein modernes Tribunal zu zitieren, um ihn rationalistisch zu zerpflücken. Das gebotene Verhalten ist umgekehrt: Der Mensch ist vor die Schranken des Textes gerufen. Die Frage lautet eher dahin, ob wir seinem mächtigen Andrang standhalten, oder ob wir uns hinter die Exegeten verstecken, von denen Matthias Claudius sagt: «Sie suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel». Wie der geschichtliche Vorgang sich auch vollzogen haben mag, sicher ist, daß Samuel sich mit seiner politischen Wendigkeit an der Umwälzung aktiv beteiligt hat, denn nur eine Gestalt von seiner Stärke konnte sie vollbringen. Jedenfalls stemmte er sich nicht dem fragwürdigen Volksbegehren mit der ganzen Wucht seiner Persönlichkeit entgegen. Er war bereit, dem Volke zu willfahren, wie dies, nach ihm, die Priester oft getan haben. Darob wurde er zum eigentlichen Königsmacher. Samuels Name bleibt für immer mit der Einführung des Königtums in Israel verbunden, denn er gab dem Lande seinen ersten König, ein Tun, das einem Abfall von der direkten Leitung Gottes gleichkam. Von dieser zweideutigen Tat kann Samuel nicht freigesprochen werden. Deutlich schimmert durch die Berichterstattung die politische Geschicklichkeit des ungewöhnlichen Mannes hindurch. Er hatte etwas Unheimliches an sich, und man hat allen Grund, Samuel als eine furchterregende Gestalt zu bezeichnen. Sein königstiftendes Tun ist schwer mit der Berufung in seiner Jugend zu vereinbaren; das politische Element hat sie getrübt. Man mag sich bei Israels enttäuschenden Erfahrungen mit den verschiedenen Königen fragen, ob Samuels Tun dem Willen Jahwes entsprochen, oder ob politischer Kalkül den Ausschlag gegeben hat.
Die Geschichte von Saul beginnt ganz alltäglich, geht aber rasch ins Außerordentliche über. In allem Gewöhnlichen ist immer ein Ungewöhnliches verborgen. Sauls Weg weist zunächst empor, denn er trat schon als junger Mann ins grelle Rampenlicht der Öffentlichkeit.
Saul war der Sohn des wohlhabenden Bauers Kis, «stattlich und schön; es war kein schönerer Mann in Israel als er».4 Vor allem wird seine Körpergröße hervorgehoben, überragte er doch um Haupteslänge seine Volksgenossen. Männliche Schönheit und Stärke beeindrucken viele Menschen, beweisen aber noch lange nicht deren Geisteskraft.
Es begab sich einmal, daß sich die Eselinnen von Sauls väterlichem Heimwesen verliefen und unauffindbar zu sein schienen. Der Vater befahl seinem Sohne, sie zusammen mit einem Knecht im Gebirge zu suchen. Saul kam dem Befehl nach und befand sich alsbald mit einem Knecht auf dem Weg. Bei der Suche nach den Eselinnen widerfuhr ihm ein unerwartetes Erlebnis, das seinem Leben eine ganz neue Wendung gab. Am Abend nach der ergebnislosen Suche ging Saul mit seinem Knecht nach Rama zu Samuel dem Seher, um ihn nach dem Verbleib der Tiere zu befragen. Samuel empfing ihn freundlich und beruhigte ihn mit der Nachricht, die Tiere seien wieder gefunden worden. Hierauf bat Samuel ihn zu Tische. Auf diese unerwartete Ehre antwortete Saul überrascht: «Ich bin ja nur ein Benjaminit, aus dem kleinsten der Stämme Israels, und mein Geschlecht ist das geringste unter allen Geschlechtern des Stammes Benjamin!»5 Was Samuel mit Saul nach dem Essen auf dem Dach des Hauses geredet hat, wird nicht überliefert.
Am andern Morgen begleitete Samuel seinen Gast bis vor die Tore der Stadt, hieß den Knecht vorangehen und sagte dann zu Saul: «Du aber stehe jetzt stille, daß ich dir kundtue, was Gott gesagt hat.»6 Nun beginnt das Geschehen unerwartet geheimnisvoll zu werden, da Samuel im Namen Gottes redet und nicht seine eigene Meinung vorbringt. Von einem übereilten Vorgehen kann nicht die Rede sein, da das eindrucksvolle Stillestehen nicht zu übersehen ist. Dann nahm Samuel ein Ölgefäß aus der Tasche, goß den Inhalt über Sauls Haupt, küßte ihn und sprach: «Hat dich nicht der Herr zum Fürsten über sein Volk Israel gesalbt? Du sollst herrschen über das Volk des Herrn, und du sollst es erretten aus der Hand seiner Feinde ringsumher.»7 Überraschend ist die Szene zwischen den beiden Männern, ungewöhnlich in jeder Beziehung und zugleich von weitreichender Bedeutung. Zweimal sagte Samuel: «Du sollst», und Saul konnte sich vor Überraschung kaum fassen. Eine zweifache Aufgabe wurde ihm übertragen: Du sollst herrschen, und du sollst retten. Eines nicht ohne das andere – dies kam dem Gesalbten des Herrn zu. Aber Samuel befahl der ersten Herrschergestalt in Israel zugleich «stille zu stehen». Wer sich ununterbrochen in Bewegung befindet, vernimmt keine höhere Stimme. Saul wurde nicht der größte, wohl aber der erste König in Israel. Noch stand alles im Frühlingslicht da. Neben dem jugendlichen Saul befand sich der politisch begabte Seher, der ihn zu diesem Amt bestellt hatte. Saul hatte nicht nach dem Königtum gelechzt. Er war kein ehrgeiziger Mann, der nach einer führenden Machtstellung strebte. Das hohe Amt wurde ihm ohne sein Zutun übertragen. Von nun an war er eine außerordentliche Gestalt. Die Bemerkung, «er überragte alle seine Volksgenossen um Haupteslänge», geht von seiner körperlichen Größe in eine geistige Vormachtstellung über. Saul war der Mann, der auszog, um zwei Eselinnen zu suchen, und dabei ein Königreich fand. Wem ist je etwas Ähnliches widerfahren?