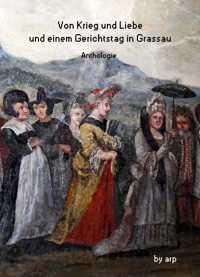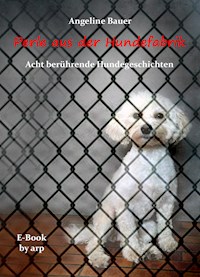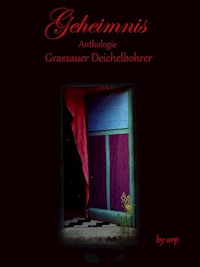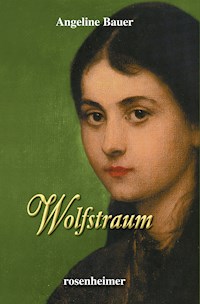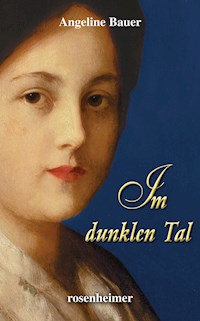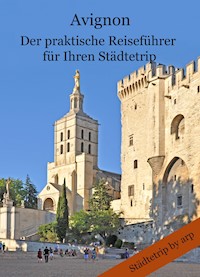9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Auf Liebe und Tod.
Regensburg im Jahr 1546. Rätselhafte Todesfälle versetzen die Stadt in Angst und Schrecken. Als auch ihre Freundin Sarina verschwindet, die für den Kaiser porträtiert wird, begreift Barbara Blomberg, dass die Morde etwas mit dem Reichstag zu tun haben - und dass Karl V., den sie heimlich liebt, das nächste Opfer sein könnte ...
Ein opulenter, einfühlsam geschriebener Roman über die legendäre Geliebte des Kaisers.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 470
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Angeline Bauer
Der Malerunddas Mädchen
Roman
Impressum
ISBN 978-3-8412-0628-2
Aufbau Digital,
veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, März 2013
© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin
Die Originalausgabe erschien 2009 bei Aufbau Taschenbuch, einer Marke der Aufbau Verlag GmbH & Co. KG
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.
Umschlaggestaltung Mediabureau Di Stefano, Berlin unter Verwendung zweier Motive von Bidgeman Art Library
E-Book Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, www.le-tex.de
www.aufbau-verlag.de
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Informationen zur Autorin
Impressum
Inhaltsübersicht
Anmerkungen zur Geschichte Regensburgs
1. Kapitel: 3. April 1546 – Regensburg
2. Kapitel: 4. April 1546 – am Morgen
3. Kapitel: 4. April 1546 – am Nachmittag
4. Kapitel: 4. April 1546 – am späten Abend
5. Kapitel: 6. April 1546
6. Kapitel: 7. April 1546 – früh am Morgen
7. Kapitel: 7. April 1546 – am Nachmittag
8. Kapitel: 8. April 1546
9. Kapitel: 10. April 1546
10. Kapitel: 12. April 1546
11. Kapitel: 14. April 1546
12. Kapitel: 16. April 1546
13. Kapitel: 19. April 1546
14. Kapitel: 23. April 1546
15. Kapitel: 29. April 1546
16. Kapitel: 2. Mai 1546
17. Kapitel: 5. Mai 1546
18. Kapitel: 6. Mai 1546
19. Kapitel: 7. Mai 1546
20. Kapitel: 8. Mai 1546
21. Kapitel: 9. Mai 1546
23. Kapitel: 9. Mai 1546
23. Kapitel: 12. Mai 1546
24. Kapitel: 13. Mai 1546 – in den frühen Morgenstunden
25. Kapitel: 14. Mai 1546 – am Abend
26. Kapitel: 15. Mai 1546
27. Kapitel: 17. Mai 1546
28. Kapitel: 18. Mai 1546
29. Kapitel: 19. Mai 1546 – in den frühen Morgenstunden
30. Kapitel: 19. Mai 1546 – am Abend
31. Kapitel: 20. Mai 1546 – in den frühen Morgenstunden
32. Kapitel: 21. Mai 1546 – in den frühen Morgenstunden
33. Kapitel: 18. Juli 1546
Nachwort: Der Kaiser und seine Politik
Literaturhinweise
Anmerkungen
Informationen zum Buch
Informationen zur Autorin
Oft genügt ein Windhauch, um einen Baum umzuwehen,
der gerade noch einem Sturm standgehalten hatte.
(Angeline Bauer)
Anmerkungen zur Geschichte Regensburgs
1245 erhob Kaiser Friedrich II. Regensburg zur freien Reichsstadt. Sie war damit nicht mehr der Herrschaft des Bischofs oder dem Bayerischen Herzog unterstellt, sondern direkt dem Kaiser. 1486 schloss sich Regensburg zwar noch einmal Bayern an, kehrte aber 1492 auf Druck Friedrich III. wieder zum Reich zurück.
Die Bürger litten unter dem ständigen Machtgerangel. Hinzu kamen Städtekriege, Bedrohung durch die Hussiten1 und Kämpfe der einflussreichen Patrizierfamilien um die Vorherrschaft, was zur Folge hatte, dass es wirtschaftlich mehr und mehr bergab ging.
In solchen Zeiten erwies es sich als äußerst ungünstig für Regensburg, als Freie Reichsstadt wie eine Insel mitten in Bayern zu liegen und außerhalb der Stadtmauern kaum über ein eigenes Territorium zu verfügen. Als Rat und Bürgerschaft 1542 dann auch noch geschlossen zum Lutherischen Glauben übertraten – nur der Bischof und die geistlichen Stifte mit ihren Untertanen blieben dem Papst treu –, hatte man sich die erzkatholischen Bayern, von denen man umgeben war, gänzlich zu Feinden gemacht. Immer wieder versuchten sie, die Stadt zu demütigen und durch Blockaden unter Druck zu setzten.
Auch im Jahr 1546, in dem dieser Roman spielt, befand sich Regensburg in einer solchen Blockade. Erst zur Eröffnung des Reichstages am 5. Juni 1546 war Herzog Wilhelm IV. von Bayern bereit, die Sperre aufzuheben.
Kaiser Karl V. hatte zu diesem Reichstag nach Regensburg einberufen. Vorausgehen sollten die so genannten zweiten Regensburger Religionsgespräche. Doch als Karl V. am 10. April 1546 in Regensburg ankam, hielten sich kein einziger Fürst mehr und nur wenige Gesandte in der Stadt auf¸ auch die meisten der Theologen waren bereits abgereist. Somit waren die Religionsgespräche gescheitert, und es blieb nur noch der Weg, den Konfessionskonflikt mit militärischen Mitteln zu lösen.
Durch den Ausfall der Religionsgespräche hatte der Kaiser bis zur Reichstagseröffnung Zeit zur Verfügung. Er begab sich auf Jagdausflüge und war wohl auch öfter als gewöhnlich mit sich alleine. Dass ihm in dieser Situation die schöne Bürgertochter Barbara Blomberg auffiel und seine Phantasie beflügelte, ist nur deshalb erstaunlich, weil er kein Frauenheld war und keine Liebschaften pflegte. Seiner 1539 verstorbenen Gattin, Isabella von Portugal, war er zeitlebens treu geblieben.
Das Verhältnis zur Jungfer Blomberg blieb geheim, nicht einmal seine nächsten Vertrauten schienen davon gewusst zu haben. Doch Barbara wurde von ihm schwanger. Am 24. Februar 1547 – dem Geburtstag Karl V. – schenkte sie einem Sohn das Leben. Der Kaiser erkannte ihn an und holte den Knaben an den spanischen Hof. Als Don Juan d’ Austria ging er später in die Geschichte ein.
1. Kapitel
3. April 1546 – Regensburg
Meister Zacharias hatte ein wenig geschlafen. Als Heinrich, der Kutscher, gegen das Kutschendach klopfte, schreckte er auf.
»Wir sind da, Herr, eine richtige Milchsupp’n liegt über der Stadt.«
Conrad Zacharias beugte sich aus dem Fenster. Endlich, nachdem er vier Stunden in diesem ungemütlichen hölzernen Kasten auf Rädern durchgeschüttelt worden war, hatten sie Regensburg erreicht. Die Steinerne Brücke mit ihren drei Tortürmen tauchte vor ihnen aus dem Nebel auf. Irgendwo im grauen Dunst über dem Fischmarkt zogen Möwen ihre Kreise. Sehen konnte man sie nicht, nur ihr Kreischen war zu hören, und vom Dom her klangen die Glocken zur vollen Stunde – es war zehn Uhr am Vormittag.
Vor dem Tor des ersten Brückenturmes zügelte Heinrich die Pferde. Zwei Schlagbäume mit langen Eisenstacheln an Ober- und Unterseite versperrten ihnen den Weg. Der vordere war der Bayrische, der hintere der Reichsstädtische. Der Turm selbst, vom Dunst benetzt, glänzte schwarz. Wie ein düsteres Mahnmal hob er sich aus dem Nebel ab, ein steinerner schwarzer Reichsadler blickte von oben auf sie herab.
Die bayerischen Wachen verlangten die Papiere, die reichsstädtischen darüber hinaus das Brückengeld, das zu entrichten war.
»Und führt Ihr Lebensmittel mit Euch?«
»Eine Kiste Äpfel, ein Feldhuhn, eine Flasche Branntwein.« Die Flasche reichte Meister Zacharias aus dem Fenster.
Der Wachmann nahm sie, zog den Pfropfen, roch daran und nickte zufrieden. Dann warf er einen Blick auf die Kiste, die unter der Bank stand. Das Feldhuhn lag obenauf. »Den Branntwein muss ich konfiszieren. Die Äpfel und das Feldhuhn habe ich nicht gesehen.«
Der Wachmann gab Zeichen, weiterzufahren. Die Kutsche rumpelte über die hölzerne Zugbrücke auf die Steinerne Brücke, und es ging der Stadt entgegen.
Bei klarem Wetter blickte man von hier auf den mächtigen Dom mit seinen beiden gedrungenen Turmstümpfen, sah die stolzen Patriziertürme, die sich weit über die Dächer der Häuser und Stadtburgen erhoben, die Zinnen des Rathauses, die Kirchtürme und Klosteranlagen, die Wehrtürme der Stadtmauer und langgezogenen Hügelketten im Süden, die der Stadt gleichsam als Kulisse dienten. Doch heute versperrte eine weiße Wand den Blick auf dieses Wunderwerk menschlicher Baukunst, das selbst Könige und Kaiser noch zum Staunen brachte.
Als sie den zweiten Brückenturm passiert hatten, klopfte Heinrich noch einmal gegen das Kutschendach. »Gleich zum Rathaus, Herr?«
»Ja. Dort setzt du mich ab, dann brauche ich dich nicht mehr. Sag meinen Töchtern, sie möchten dir für die Nacht ein Lager richten und dass in der Kiste unter den Äpfeln ein Schinken und ein Ziegenkäse liegen und ich zu Mittag eine kräftige Suppe und frischen Fisch erwarte.«
»Sehr wohl, Herr.«
Meister Zacharias seufzte. Hätte ihn nicht der Rat nach Regensburg berufen, er säße gemütlich im Garten des Anwesen seines Sohnes, das, sonnenverwöhnt, sich auf den Anhöhen des Lichtenwaldes befand. Oder er spazierte durch die Wälder. Die Holzapfelbäume und Haselnusssträucher blühten bereits, auch der Waldmeister und der Schuppenwurz. Dazu die geckernden Flugrufe der Bluthänflinge, das lachende Klüklüklü der Grünspechte und das Summen der ersten Bienen. Und über alle dem lag ein Sonnenstrahl wie Goldgeglimmer. Wahrlich, das war angenehmer, als Stund um Stund in einer Kutsche durchgerüttelt zu werden, nur um sich dann mit den Ratsherren herumzuschlagen. Der Himmel wusste, was sie von ihm wollten!
Am dritten Tor, dem eigentlichen Stadttor, wurden sie noch einmal angehalten. Der Hauptmann der Wache war der Vater eines ehemaligen Lehrlings von Meister Zacharias. Er begrüßte den alten Maler und winkte, nachdem das Torgeld entrichtet war, die Kutsche durch.
In der Stadt lichtete sich der Nebel etwas. Vor ihnen tauchte das Goliathhaus auf, eine mächtige Stadtburg, ehedem Herberge für fahrende Theologiestudenten. Doch seit gut zwanzig Jahren war sie in Martin Tuchers Besitz – ein reicher Patrizier aus Nürnberg.
Damals, als Tucher das Goliathhaus erworben hatte, war die Sprache davon gewesen, von ihm, Meister Zacharias, ein Fresko auf die Schaufront malen zu lassen. Der Riese Goliath schwebte ihm vor, und er hatte auch bereits Skizzen angefertigt. Doch nachdem Tucher kurz darauf seine geliebte Frau gestorben war, hatte er das Interesse verloren, und mittlerweile war Meister Zacharias zu alt, ein Vorhaben dieser Art auszuführen. Seine Knochen schmerzten und erlaubten ihm nicht mehr, auf Gerüsten herumzuklettern. Seine Finger waren gekrümmt von der Gicht, auch standen keine Schüler und Gehilfen mehr in seinen Diensten. Seine Werkstatt war geschlossen, sein Blick zurückgerichtet, denn würde er nach vorne schauen, er sähe nichts als das klapprige Skelett des Schnitters, der schon auf ihn wartete.
Der Gestank in der Stadt erschien Conrad Zacharias unerträglich. Im Hause seines Sohnes, oben auf den Anhöhen des Lichtenwaldes, roch es nach Äpfeln, Tannennadeln und geschrubbten Böden. Es roch nach frischem Wind und klarem Wasser, nach Speisen und Backwerk, nach Kindern und den Milchbrüsten seiner Schwiegertochter.
Wie schnell hatte er dort droben die dunklen Gassen und schreienden Marktweiber, die Bettler und Diebe vergessen, die in Regensburgs Gassen herumstreunten. Nie wieder wollte er herkommen. So schön Regensburg auch sein mochte, wenn man jung und voller Tatendrang war – er, bereits im siebenundsiebzigsten Jahr, hatte nichts mehr im Sinn, als den Vögeln zu lauschen, den jungen Hunden beim Spielen zuzusehen, den Wind zu spüren und, wenn es denn so weit war, das Haupt auf sein Kissen zu legen, um für immer die Augen zu schließen.
Doch sie hatten ihn zurückgeholt. Gottes Wege waren unergründlich.
Vor dem Rathaus zügelte Heinrich die Pferde. Er sprang vom Kutschbock und half Meister Zacharias beim Aussteigen. Unwirsch entzog der alte Mann ihm die Hand, stützte sie in den Rücken, legte den Kopf in den Nacken und betrachtete den Erker am Ratssaal, so als würde er ihn heute zum ersten Mal sehen.
Heinrich hingegen betrachtete den Alten in eben derselben Weise. Er war streng und dunkel gekleidet. Über dem schwarzen Schoßrock mit weiten bauschigen Ärmeln trug er eine kurze schwarze, pelzverbrämte Schaube, darunter spitzten oben eine weiche Halskrause, unten kurze Pluderhosen hervor. Auf dem dichten schneeweißen Haar saß eine schwarze Haarkappe, die dünnen Beine steckten in dunkelgrünen Seidenstrümpfen, die Füße in breiten Flachschuhen nach allerneuester Mode.
Vor fünfzehn Jahren, als Heinrich bei Reinbert Zacharias, Conrad Zacharias’ Sohn, als Hausdiener und Kutscher in Dienst trat, war er dem Meister zum ersten Mal begegnet. Schon damals war der Maler ein alter Mann gewesen, aber erst seit zwei oder drei Jahren sah man ihm sein Alter auch an. Das faltige blasse Gesicht hatte eingefallene Wangen, fünf Zähne hatte er im letzten Jahr verloren, die blauen Augen waren plötzlich dumpf geworden, kein bisschen Lebensfreude mehr in ihnen.
Früher war Conrad Zacharias ein gutaussehender stattlicher Mann gewesen. Sein Blick immer leicht spöttisch, ein Glanz in seinen Augen, ein Blitzen und Lachen, dass die Frauen atemlos wurden. Dazu gesunde Zähne und volles lockiges Haar, eine Brust wie ein Bär, doch Hände so zart und schlank, dass man staunen mochte. Wenn sie den Weibsbildern über die Wangen strichen, dann war es, als hätten sie eine Harfe gezupft; ein Lachen perlte aus ihren Kehlen, als würden Glöckchen aus feinstem venezianischen Glas erklingen.
Um einen aufrechten Gang bemüht, ging Meister Zacharias auf das Portal des Rathauses zu, erklomm die acht Stufen zum Tor, blieb noch einmal stehen und sah sich nach Heinrich um. Er stieg gerade auf den Kutschbock, nahm die Peitsche, ließ sie knallen und fuhr unter dem Schwippbogen zur Neue-Waag-Gasse hin Richtung Haidplatz davon.
Die Ratsherren Johannes Waller, Richard Veithberg und der Stadtkämmerer Wolfgang Winkler hielten sich mit dem Ratsschreiber Bartel Geyer im Fürstenzimmer auf. Die Herren standen vor einer Reihe Gobelins, die rechts an der langen Wand des Saales angebracht waren, und berieten, ob man die verblassten und schadhaften Teppiche – sie zeigten Szenen aus der Sage des Aenas und der Dido – durch neue ersetzen oder ob man die fensterlose lange Wand stattdessen durch ein Wandgemälde schmücken sollte.
Der Ratsschreiber notierte auf einem kleinen Schreibpult, das an Riemen um seine Schultern hing, was besprochen wurde.
Wolfgang Winkler, um die fünfzig Jahre alt, schlank, dunkelblond, ein stets freundlicher und äußerst gewissenhafter Mann, war Oberhaupt einer der angesehensten Familien Regensburgs. Er plädierte für neue Wandbehänge, verwies dabei auf die beiden kalten Außenwände und die Tür, die vom Saal aus direkt ins Freie führte, wodurch er nur schwer zu beheizen war.
»Gobelins dämmen zusätzlich gegen Kälte ab«, gab er zu bedenken und strich sich den graumelierten Bart.
Diese Ansicht vertrat auch Richard Veithberg.
»Wandgemälde hingegen könnten dem Raum ein ganz neues Gesicht und eine ungeahnte Tiefe verleihen«, hielt Johannes Waller dagegen und schlug einen Bogen zu seinem Lieblingsthema, einer Reise nach Italien, die ihn beeindruckt zu haben schien. »Ich war zu Gast in der Villa Barbaro, unweit Venedigs, und ...«
In diesem Augenblick betrat Meister Zacharias den Saal, die Herren sahen sich nach ihm um.
»Ah, Meister Zacharias, da seid Ihr ja! Bitte nehmt Platz und habt noch einen Moment Geduld.«
Als Meister Zacharias sich auf der langen Bank vor der linken Wand niedergelassen hatte, wollte Johannes Waller auf seinen Reisebericht zurückkommen. Doch Wolfgang Winkler fiel ihm ins Wort: »Wir wissen um die Pracht dieser italienischen Wandgemälde, Ihr habt uns oft genug davon erzählt. Doch hier müssen wir auch praktische Gesichtspunkte walten lassen.«
Wolfgang Winkler deutete auf eine quadratische Öffnung im Fußboden, etwa in der Mitte des Raumes, die von einer steinernen Umrandung umgeben und mit einer durchlöcherten, siebartigen Kupferplatte abgedeckt war. Es handelte sich um einen Schacht, der den Saal mit der Heizkammer im Untergeschoss verband, durch ihn wurde die warme Luft nach oben geleitet. »Wie Ihr selbst im vergangenen Winter bemerkt habt, Herr Waller, konnte die Heizungsanlage trotz des Ofens, den wir hier aufstellen und zusätzlich befeuern ließen, nur mit Müh und Not eine gewisse Behaglichkeit schaffen. Und nun stellt Euch vor, es fehlen auch noch die Gobelins!«
Johannes Waller seufzte. »Ja, ja ...« Mit einer wegwerfenden Handbewegung gab er sich geschlagen.
Die Feder des Ratsschreibers kratzte übers Papier. »Es werden also neue Gobelins bestellt?«, versicherte er sich, bevor er notierte.
Wolfgang Winkler nickte. »Verfassen Sie ein Schreiben an die Manufaktur Cornelis Mattens in Brüssel, man möge uns jemanden schicken, der uns berät.« Der Stadtkämmerer drehte sich um und ging mit ausgestreckten Armen auf Meister Zacharias zu. »Und nun zu Euch, mein Freund!«
Meister Zacharias wollte aufstehen, doch Herr Winkler drückte ihn auf die Bank zurück und setzte sich zu ihm. »Wie war die Reise?«
»Anstrengend. Das Alter setzt mir zu, doch im Übrigen geht es mir gut.«
»Das freut mich zu hören, denn wir haben einen Auftrag für Euch.«
Meister Zacharias seufzte. »Wisst Ihr denn nicht, dass ich meine Werkstatt geschlossen habe? Da seht her!« Er hielt dem Stadtkämmerer seine Hände hin. »Meine Finger sind krumm, meine Augen so schlecht, dass ich in der Nähe ohne Augengläser nicht ausreichend sehe. Und auf ein Gerüst kann ich ohnehin nicht mehr klettern. Warum nehmt ihr nicht einen jungen Maler? Er wird es euch danken!«
»Es geht nicht um ein Fresko. Wir wünschen ein Gemälde in Öl. Es soll ein Geschenk für den Kaiser sein, zur Eröffnung des Reichstages. Es bleiben Euch also nur etwa zehn Wochen für die Ausführung ...«
Meister Zacharias rang in einer großen, unwirschen Geste die Hände. »Ha!« Er lachte auf. »Zehn Wochen! Und womöglich soll es auch noch eine ganze Wand bekleiden können!«
»Nein, nein.« Herr Winkler legte beschwichtigend eine Hand auf die Schulter des Alten. »Nur ein kleines Gemälde, gut eine Elle breit und ein bis eineinhalb Ellen lang. Wir stellen uns ein zartes junges Mädchen vor, von reiner, unschuldiger, erfrischender Art. Etwa mit einem Früchtekorb im Arm, vor einer schönen Landschaft. Aber wie genau Ihr das Motiv gestalten wollt, soll ganz Euch selbst überlassen bleiben.«
Auch Johannes Waller und Richard Veithberg traten nun hinzu. »Ihr wisst ja, wie unser Kaiser ist«, sagte Veithberg. »Streng und oft ein wenig schwermütig, zudem vom Rheuma geplagt. Nur selten sieht man ihn lachen. Manchmal hat man das Gefühl, er sei des Lebens überdrüssig. Das Gemälde soll nicht nur sein Auge, sondern auch sein Herz erfreuen. Wenn er es anblickt, soll etwas in ihm lächeln, lebendig werden, soll Zufriedenheit sich bei ihm einstellen.«
»Allein Ihr seid so einer Aufgabe gewachsen, Meister Zacharias!«, fügte Johannes Waller an. »Kein anderer Maler unserer Stadt vermag einem Antlitz so viel Lebendigkeit, so viel Tiefe und Wärme zu verleihen wie Ihr.«
»Da hört Ihr es!« Wolfgang Winkler drückte dem Alten freundschaftlich die Hand. »Herr Waller ist, wie Ihr ja wisst, in Kunstdingen sehr bewandert und kann sich ein Urteil erlauben.«
Waller nickte. »Das will ich meinen. Auf meiner Italienreise habe ich Gemälde von Tizian, da Vinci und Giorgione gesehen. Einzigartig! Diese Tiefe der Farben! Diese Lebendigkeit ...«
»Und Ihr steht diesen Künstlern in nichts nach«, unterbrach Wolfgang Winkler die Schwärmereien Wallers, bevor sie ausufern konnten. Er lächelte Meister Zacharias aufmunternd zu. »Nun schlagt schon ein. Ein letztes Werk! Es ist für den Kaiser, es wird Euch zur Ehre gereichen.«
Meister Zacharias ließ seinen Blick zu den Fenstern schweifen, die zur Neue-Waag-Gasse hin lagen. Lange sah er hinaus, als könnte er auf der Fassade des gegenüberliegenden Hauses das Für und Wider ablesen. Schließlich seufzte er und nickte. »Nun gut. Ich übernehme den Auftrag.«
»Das freut mich zu hören.« Der Stadtkämmerer fasste Meister Zacharias bei den Schultern. »Nennt mir Euren Preis, Ihr werdet bekommen, was Euch zusteht.«
»Und das Mädchen, das mir Modell sitzen soll? Habt Ihr ein bestimmtes im Sinn?«
»Es liegt bei Euch. Nehmt eine Bürgertochter. Eine Jungfer von gutem Ruf, die sich ihres Namens nicht zu schämen braucht. Immerhin, des Kaisers Augen werden auf ihr ruhen!«
2. Kapitel
4. April 1546 – am Morgen
Sarina ließ beide Wassereimer fallen und stürzte auf ihre Kusine zu. Magdalena lag am Fuße der Treppe, die zum Hausturm führte, ihre Arme und Beine zuckten heftig, aus ihrem Mund rann ein Gemisch von Speichel und Blut.
»Zu Hilfe! Herbei ...! So helft mir doch!«
Endlich erschien Wiltrud Winkler, die Magdalenas Mutter und Sarinas Muhme war. »Ist es wieder so weit?« Mit vor Ekel verzerrtem Gesicht beugte sie sich über ihre Tochter und rief die heilige Jungfrau an. »Maria, Mutter Gottes, wende deine barmherzigen Augen uns zu, und nach diesem Elend zeige uns Jesus, die gebenedeite Frucht deines Leibes!« In solchen Momenten vergaß sie, dass sie auf Geheiß ihres Mannes zusammen mit der ganzen Familie zum protestantischen Glauben übergetreten war.
Plötzlich packte sie Magdalenas Hände, drehte sie zur Seite, kniete sich auf den zuckenden Körper und presste ihr das Holzkreuz, das an ihrem Gürtel hing, auf die Stirn. »Weiche, Fürst der Finsternis, im Namen Jesu Christi, weiche aus diesem Leib!«
»Um Himmels willen, Frau Wiltrud, Ihr bringt sie ja um! Wie wollt Ihr das dem Oheim erklären.«
»Nicht ich, der Satan bringt sie um!«
Sarina fasste die Muhme an den Schultern und zog sie zurück. Nur widerwillig ließ sie von ihrer Tochter ab, sank auf die Treppe und fing wieder an zu beten. Erst als das grauenhafte Zucken nachließ und Magdalena erschöpft in sich zusammensank, verstummte sie.
Voller Abscheu starrte sie ihre Tochter an, die ohnmächtig, blass und ausgezehrt dalag. Das lange blonde Haar klebte ihr auf der verschwitzten Stirn, das schmale Gesicht war eingefallen. Früher einmal ein hübsches, fröhliches Mädchen, wirkte sie durch ihre Krankheit ausgemergelt wie eine räudige Katze.
»Gedankt sei dir, Jesu Christi, für deine Gnade – Amen.« Frau Wiltrud bekreuzigte sich.
Sarina hockte sich zu Magdalena auf den Boden, zog sie an sich und drückte das blasse Gesicht an ihre Schulter. »Kurt, wir brauchen Kurt! Er muss Magdalena in die Kammer tragen.«
Die Muhme rührte sich nicht.
»Kurt!«, schrie Sarina. »Wo bleibst du denn!«
Im nächsten Moment flog die Tür auf. Gefolgt von zwei Mägden stürzte der Hausknecht herein.
»Endlich!« Erleichtert atmete Sarina auf. »Magdalena hatte wieder einen Anfall, du musst sie in die Kammer tragen.«
Kurt nahm seine junge Herrin auf die Arme. Als er mit der Kranken an den Mägden vorbeiging, pressten sie sich an die Wand und bekreuzigten sich. Wie Frau Wiltrud glaubten sie, dass Magdalena vom Teufel besessen sei.
Sarina eilte voraus. Sie stieß die Tür zur großen Schlafkammer auf, dann die zur kleineren, die dahinter lag, trat ans Bett, schlug die Decke zurück und sah zu, wie Kurt Magdalena in die Kissen legte.
Als er gegangen war, zog sie ihr die Schuhe und Kleider aus und deckte sie zu.
Frau Wiltrud betrat den Raum. Sie stellte eine Schüssel mit Wasser auf einen Schemel, legte einige Tücher daneben, setzte sich auf die Bank am Fußende des Bettes und rang die Hände. »Vater im Himmel, wofür nur hast du uns so gestraft!«
Sarina senkte den Kopf. Wie konnte die Muhme nur so verbohrt und herzlos sein? Hatte sie denn gar kein Mitleid mit ihrer Tochter?
Sarina wischte sich das dunkle Haar aus der Stirn, tauchte eines der Tücher in das Wasser und fing an, Magdalena zu waschen. Sie liebte ihre Kusine wie eine Schwester. Auch Wolfgang Winkler, ihren Oheim, mochte sie von Herzen gern. Doch meist war er außer Hauses, und dann bekam sie es mit der Muhme zu tun. Frau Wiltrud, eine schlanke, elegant anmutende Frau mit einem schmalen, ebenmäßigen Gesicht und vollem, aschblondem Haar, war launisch und herrschsüchtig, und in allen Ecken des Anwesens vermutete sie den Teufel. Befehlen konnte sie wie ein General, doch andererseits war sie schwach und oft ratlos, dann musste Sarina für sie die Kohlen aus dem Feuer holen.
Trotzdem war Sarina dankbar, dass sie hier leben durfte, denn ihre Mutter war längst tot, und ihr Vater reiste im Dienste Wolfgang Winklers, seines älteren Bruders, durch die halbe Welt.
Früher einmal waren sie eine glückliche Familie gewesen, doch das Schicksal hatte es nicht gut mit ihnen gemeint. Ihre beiden Brüder hatten nicht einmal das fünfte Lebensjahr erreicht, bei einer weiteren Geburt war ihre Mutter gestorben, und kaum ein Jahr später hatte ihr Vater bei einem undurchsichtigen Geschäft sein ganzes Hab und Gut verloren. Man hatte ihn in Nowgorod ins Schuldnergefängnis gesteckt.
Zum Glück hatte der Oheim sie bei sich aufgenommen. Er verkaufte Sarinas Elternhaus und reiste nach Russland, um mit dem Geld, das er dafür bekommen hatte, die Schulden seines Bruders zu begleichen und ihn auszulösen. Fast ein Jahr war vergangen, ehe Sarina ihren Vater, abgezehrt und verwahrlost, wieder in die Arme schließen konnte.
Gegen den Willen Frau Wiltruds nahm Wolfgang Winkler auch seinen Bruder bei sich auf. Er ließ ihn für sich arbeiten, schickte ihn nach Venedig oder Brüssel, vertraute ihm den Handel mit Seide, Gewürzen und Wein an und machte aus ihm wieder einen ehrbaren Mann.
So konnten Sarina und Magdalena weiterhin wie Schwestern aufwachsen. Zusammen mit Barbara Blomberg, der Schöngürtlerstocher, die in ihrem Alter war und nicht weit von ihnen wohnte, spielten sie Blinde Kuh oder Verstecken oder liefen mit ihren Windrädchen durch die Gassen. Oder sie stiegen heimlich auf den Turm, der zu Wolfgang Winklers Anwesen gehörte. Es war der höchste von Regensburg, und man konnte von oben weit übers Land sehen. Manchmal ließen sie auch bunte Tüchlein von den Zinnen nach unten schweben und wünschten sich etwas dabei. Sie waren überzeugt, es würde in Erfüllung gehen, so das Tüchlein nicht irgendwo hängen blieb, sondern unten in der Gasse landete. Erwischen durfte man sie allerdings nicht, sonst hätte es eine Tracht Prügel gesetzt.
Magdalenas Krankheit war vor drei Jahren ausgebrochen. Seitdem ging es bergab mit ihr. Immer öfter hatte sie diese Anfälle. Dann lag sie blass und abgemagert in den Kissen, und wenn sie die Augen nach einer Weile wieder öffnete, hatte sie diesen schrecklichen irren Blick.
Die Ärzte sprachen von Fallsucht und ließen sie zur Ader.
Die Pfaffen sprachen vom Teufel und versuchten, ihn ihr auszutreiben.
Frau Wiltrud glaubte den Pfaffen. Wenn ihr Mann geschäftlich unterwegs war, ließ sie nachts heimlich den Exorzisten kommen. Sie betete um Hilfe zur heiligen Maria und ging doch tagsüber wieder in die Neue Pfarre, die protestantische Kirche, um sich über das Unglück zu beschweren, das ihre Tochter über sie brachte.
»Man redet schon darüber! Man wird uns noch meiden wie die Pest!«
Mit einem Tuch wischte Sarina der Kranken über die Stirn, öffnete ihr den Mund, betrachtete die geschwollene Zunge und tupfte das Blut ab.
»Sie hat sich gebissen.«
»Der Teufel hat sie gebissen!«
»Das ist doch Aberglaube, Muhme.«
»Es ist so wahr, wie es wahr ist, dass tausend Sterne am Himmel stehen!« Frau Wiltrud kam näher und blickte Sarina über die Schultern.
Ein Seufzen drang aus Magdalenas Mund, ihre Lider zuckten.
»Seht nur, Muhme, Magdalena öffnet die Augen!«
»Hm«, machte Frau Wiltrud. Es schien sie nicht sonderlich zu interessieren. »Gestern wurde doch diese Kindsmörderin hingerichtet«, sagte sie plötzlich. »Zusehen konnte ich nicht, es gab anderes zu tun, aber die Nachbarin hat mir davon erzählt.«
Sarina sah sie erstaunt an. »Ja, ja, die Margarete Reitmeier. Der Henker hat ihr auf der Köpfstatt den Kopf abgeschlagen. Aber wie kommt Ihr jetzt darauf?«
»Du gehst hin.«
Sarina wurde schreckensbleich. »Zur Köpfstatt?«
»Zum Henker. Er soll dir etwas von ihrem Blut verkaufen. Es heißt, das Blut eines Gehenkten hilft gegen Fallsucht – falls es doch die Fallsucht sein sollte, was ich im Grunde nicht glaube.«
Entsetzt sprang Sarina auf. »Niemals! Ich kann doch nicht ... Der Henker ist unrein und ehrlos! Wer mit ihm verkehrt, wird selbst ehrlos und hat keine Rechte mehr! Ihr schickt mich ja ins Verderben!«
»Das sagst du mir?« Frau Wiltruds Augen wurden schmal. »Wir haben dich und deinen Vater bei uns aufgenommen. Ohne uns säßet ihr längst in der Gosse.«
Sarina öffnete den Mund und schloss ihn wieder. Fassungslos starrte sie Frau Wiltrud an. »Aber wenn mich jemand sieht!«
»Du musst eben dafür sorgen, dass dies nicht passiert. Du nimmst die kleine Deckelpfanne, mit der wir früher das Weihwasser aus der Kirche geholt haben. Um den Stiel wickelst du einen Lappen. Der Henker wird wissen, dass er ihn entfernen muss, bevor du den Stiel anfasst. Du bist nicht die Erste, die solchen Handel mit ihm treibt.« Frau Wiltrud ging zur Tür. Dort drehte sie sich nach Sarina um. »Und kein Wort zu meinem Gatten. Du und dein Vater, ihr seid mir etwas schuldig, das weißt du genau!«
Das Kinn fiel Sarina auf die Brust. »Ja, Muhme«, sagte sie artig.
3. Kapitel
4. April 1546 – am Nachmittag
Barbara beugte sich über das Schälchen mit Silberblättchen, die sie tags zuvor zusammen mit ihrer Mutter ausgetrieben und verziert hatte. Auf das erste Drittel der Blättchen hatten sie je eine Blüte ziseliert, auf das zweite Drittel je ein rechts geneigtes und auf das dritte Drittel je ein links geneigtes Blatt. Ihr Vater würde diese Beschläge in den nächsten Tagen zusammen mit Jacob, dem Lehrling, und Oswald, ihrem Bruder, auf den rindsledernen Gürtel aufbringen, den Frau Wiltrud bestellt hatte. Eine Blüte zwischen zwei Blättern, eine Silberniete, wieder eine Blüte zwischen zwei Blättern und so fort. Am Gürtel würde außerdem eine Silberkette befestigt werden, damit Frau Wiltrud all die Dinge anhängen konnte, die sie brauchte. Einen Beutel für Münzen, ein Fläschchen mit Duftöl, ihren Schlüsselbund, einen Behälter für Nadeln, einen größeren für ihr Besteck und was man eben so benötigte, wenn man ausging. Sie wollte ihn auf der Verlobung ihres Sohnes tragen, die in zwei Wochen gefeiert werden würde, entsprechend wertvoll musste er sein. Immerhin war sie die Gattin eines Ratsherrn!
Barbara nahm eines der Blättchen, polierte es mit einem Tuch und legte es in ein anderes Schälchen.
Als sie von ihrer Arbeit aufsah, begegnete sie dem Blick Friedrichs.
Friedrich Hoppe war Geselle bei ihrem Vater und würde bald die Meisterprüfung ablegen. Er machte ihr schöne Augen. Ihr Vater tat, als würde er es nicht bemerken – doch dann müsste er blind sein! Barbara ahnte, dass er es übersah, weil er einer Verbindung zwischen ihr und seinem Gesellen nicht abgeneigt wäre. Immerhin stammte auch Friedrich aus einer Gürtlerei. Meister Hoppe führte in Nürnberg eine florierende Werkstatt. Heutzutage, wo es mit der Wirtschaft in Regensburg stetig bergab ging und selbst die reichsten Patrizier verarmten, konnten verwandtschaftliche Verhältnisse nach Nürnberg doch nur von Nutzen sein. Überdies dachte der Vater darüber nach, ihren Bruder Oswald nach Beendigung seiner Gürtlerlehre zu einem Goldschmied zu schicken, damit er auch noch das Goldschmiedehandwerk erlernte – und ein Bruder Meister Hoppes war Goldschmied und wollte ihn ausbilden.
Oswald hatte keine Lust nach Nürnberg zu gehen, aber wenn der Vater es beschloss, hatte er nichts zu melden. »In Zeiten wie diesen, wo es in Regensburg mit dem Wohlstand mehr und mehr bergab geht«, hatte er zu seinem Sohn gesagt, »kann es nichts schaden, gut ausgebildet zu sein.«
Friedrich nahm einen Lederriemen und zog ihn durch eine Spange. Dabei ließ er Barbara nicht aus den Augen.
Sie hatte sich wieder ihrer Arbeit zugewendet. Friedrichs Blicke waren ihr unangenehm. Sie mochte ihn nicht! Er war jetzt schon, mit 22 Jahren, dick und unförmig wie ein alter Mann und hatte keinen Anstand. Er fraß wie ein Schwein und wusch sich nicht. Seine aschblonden Haare hingen ihm in Strähnen in die Stirn. Die Vorstellung, ihr Vater könnte sie mit Friedrich verheiraten, verschaffte ihr Übelkeit!
Sie nahm ein weiteres Silberblättchen aus der Schale und dachte dabei an das Tischgespräch von gestern, das ihr Vater mit ihr geführt hatte.
»Wir sollten dir endlich einen Mann suchen, Tochter. Mit achtzehn Jahren ist es Zeit, dass du unter die Haube kommst.«
»Aber die Mutter braucht mich doch! Ich muss mich um die Geschwister kümmern, und wenn ...«
Der Vater fiel ihr ins Wort. »Oswald wird nach Nürnberg gehen, Rebeka ist dreizehn Jahre alt, und Georg kann im Sommer als Lehrling bei mir anfangen.«
»Aber ...«
»Aber heißt nein, und ich dulde keinen Widerspruch!«
Friedrich hatte sich grinsend ein ganzes Hühnerbein in den Mund gestopft, hatte den blanken Knochen wieder herausgezogen, ihn dann in eine Schüssel geworfen und sich schmatzend das fettige Kinn mit dem Ärmel abgewischt.
Barbara schob die Erinnerung beiseite, nahm das letzte Silberblättchen zur Hand und rieb es mit dem Tuch blank. Sie liebte Regensburg und würde viel lieber hier bleiben. Doch wenn schon fort, dann weit weg, in die Welt hinaus. Nach Spanien, wo der Kaiser Hof hielt und die Orangen blühten! Wo es ein Meer gab, das so viel Wasser fasste, dass man gar kein Ende sehen konnte! Christoph Kolumbus war von dort aufgebrochen, um nach Indien zu reisen, und hatte auf seinem Weg eine ganz neue Welt entdeckt! Ja, das wäre ein Abenteuer nach ihrem Geschmack! Aber sie war eine Frau, und für Frauen hatte Gott keine Abenteuer vorgesehen. Nur Ehemänner wie Friedrich oder den alten Sonnthofer, ein reicher Kaufmann mit sechs Kindern, der um ihre Hand angehalten hatte. Ein Tattergreis von achtundfünfzig Jahren! Zugegeben, mit viel Geld, aber was hätte sie sich davon schon kaufen können? Nach seinem Tod einen anderen Ehemann, der nicht viel besser wäre.
Doch das mit dem alten Sonnthofer hatte ihre Mutter gerade noch verhindern können. »Ich brauche doch die Barbara«, hatte sie zu ihrem Mann gesagt, »damit sie mir im Haushalt und mit den Kindern hilft.« Damals war sie mit Wolfgang hochschwanger gewesen, der im Januar vor einem Jahr geboren wurde und schon an Weihnachten darauf verstarb.
Barbaras Zopf, den sie wie einen Kranz um ihren Kopf gewunden hatte, löste sich und fiel ihr auf die Schultern. Sie nahm ihn schnell und steckte ihn wieder auf. Friedrich lachte. Er zwinkerte ihr zu, als wäre sie irgendeine Straßendirne.
Auch ihr Vater sah auf, sein Blick ruhte streng auf ihr. »Bist du mit deiner Arbeit fertig?«
»Ja, Vater.«
Sie nahm das Schälchen mit den polierten Silberbeschlägen und brachte es ihm.
Er stempelte gerade Ornamente auf einen Riemen. Mit kurzen, festen Schlägen trieb er die Punze in das Leder. Kleine halbmondförmige Kreise entstanden, die wie Kettenglieder ineinander griffen.
Er sah die Beschläge flüchtig an. »Dann kehrst du noch die Werkstatt aus.«
»Ja, Vater.« Barbara holte den Besen und machte sich an die Arbeit.
Sarina blieb an der Tür stehen und atmete tief ein. Sie liebte diesen Geruch nach Leder und einem Gemisch von Bienenwachs und verschiedenen Ölen und Essenzen, die Meister Blomberg aus dem Süden von Frankreich kommen ließ ... Damit rieb er die Gürtel und Taschen ein, die er hergestellt hatte, damit das Leder nicht brach und schön fein duftete.
Die edelsten Damen ließen bei ihm fertigen. Nicht nur die Frauen der Ratsherren, auch die Gattinnen der Gesandten und Damen der Fürsten und Kurfürsten zählten zu seinen Kundinnen, wenn sie sich an der Seite ihres Gemahls in Regensburg aufhielten, weil der Kaiser wieder einmal zu einem Reichstag einberufen hatte.
Doch jetzt, um die Mittagszeit, war keine Kundschaft im Laden.
Frau Sibilla stand hinter der Theke und fädelte Perlen auf eine der Schnüre, die wie Fransen am unteren Saum einer Gürteltasche angebracht waren. Jede Perle wurde fein säuberlich verknotet, damit sie nicht verlorenging, falls die Schnur einmal reißen sollte.
»Einen wunderschönen guten Tag«, begrüßte Sarina die Schöngürtlerin.
Als sie den Kopf hob und Sarina erkannte, lächelte sie. »Ah, Jungfer Sarina! Barbara wird sich freuen, Euch zu sehen. Falls Ihr jedoch kommt, den Gürtel für Frau Wiltrud zu holen, der ist noch nicht fertig.«
»Nein, nein, das hat ja Zeit. Die Verlobung ist erst in zwei Wochen. Doch es gibt viel zu besorgen, und dabei könnte ich Barbaras Hilfe brauchen. Ich wollte bitten, dass sie mir für zwei oder drei Stunden zur Hand gehen darf.«
»Sie ist gerade in der Werkstatt, ich werde sehen, ob mein Mann sie entbehren kann.« Frau Sibilla schob die Tasche, an der sie arbeitete, unter die Theke und ging in den angrenzenden Raum.
Es dauerte nicht lange, bis sie mit Barbara zurückkehrte. Die beiden Mädchen fielen sich um den Hals und küssten sich auf die Wangen.
»Warum bist du gestern nicht wie verabredet zum Musizieren gekommen? Oswald, Rebeka und ich haben lange auf dich gewartet.« Barbara sah ihre Freundin vorwurfsvoll an, doch dann lachte sie gleich wieder. Es war ein helles melodiöses Lachen, das jeder an ihr liebte, denn es klang, als würde sie singen. Eine kurze Tonfolge aus der Kehle eines Engels, Klänge, wie aufgereihte Perlen an Frau Sibillas Lederschnüren. Dazu das Leuchten ihrer blauen Augen, die Grübchen in ihren Wangen, und hin und wieder ein etwas kecker Blick, der ihrer Mutter ein Seufzen entlockte und die Lippen ihres Vaters ganz schmal werden ließ.
Sarina beneidete ihre Freundin um ihr silberblondes, seidiges Haar, konnte sie doch ihre eigenen dunkelbraunen Locken kaum bändigen. Sie hätte auch gerne Barbaras strahlendblaue Augen gehabt, aber Gott hatte ihr große dunkle Augen gegeben, die ein wenig schräg standen, und dazu volle Lippen, für die sie sich schämte, weil sie die Männer glauben ließen, dass sie sinnlich und leicht zu haben sei. Wie oft hatte die Muhme zu ihr gesagt: »Es wäre besser für dich, du würdest einen Schleier vor dem Gesicht tragen, so wie die Türkenfrauen, denn es ist eine Schande, so auszusehen wie du.«
»Ich konnte nicht kommen«, antwortete Sarina auf Barbaras Frage, »weil es zu Hause zu viel Arbeit gab. Die Verlobung, du weißt ja. Und jetzt brauche ich deine Hilfe.«
»Ja, die Mutter sagte es schon. Der Vater lässt mich gehen. Ich hole nur noch einen Umhang, denn es ist kalt.«
Frau Sibilla nahm ihre Arbeit wieder zur Hand und fädelte Perlen auf Schnüre. »Und wie geht es dem jungen Herrn Richard?«, fragte sie dabei.
»Er ist ein stolzer Bräutigam. Er hat die Jungfer Amman schon zweimal getroffen, als sie mit ihren Eltern nach der Kirche in unserem Hause zu Gast war.«
Sibilla nickte. »Es ist, als wäre es erst gestern gewesen, dass ihr noch Kinder ward und hier auf der Gasse spieltet.« Frau Sibilla vergaß das steife Ihr und ging zum Du über. »Weißt du noch, wie Richard immer sagte, dass er einmal Ritter werden und dann unsere Barbara zur Gemahlin nehmen würde?«
»Ja, ja, ich weiß noch.«
»Und wenn wir ihm dann entgegneten, dass er später ganz bestimmt eine schönere und reichere Frau als unsere Barbara heiraten würde, wurde er wütend und behauptete, dass es keine schönere und reichere gäbe!« Frau Sibilla lachte aufgekratzt.
»Er war erst neun Jahre alt.«
»Und jetzt ist er Kaufmann und bald mit der Tochter des Ratsherrn Ammann verlobt.«
»Gott möge die beiden schützen.«
»Amen. – Und Jungfer Magdalena? Man hört, sie sei krank?« Frau Sibilla sah Sarina mit besorgter Miene an.
»Manchmal ist ihr unwohl, und sie hat keinen Appetit«, antwortete das Mädchen ausweichend.
Barbara stand plötzlich wieder in der Tür. Sie trug die pelzgefütterte Schaube ihres Bruders. »So, dann können wir gehen!« Sie gab ihrer Mutter einen Kuss und folgte Sarina nach draußen.
»Und schöne Grüße an Frau Wiltrud!«, rief Frau Sibilla den beiden noch nach.
Auf der Kramgasse herrschte reges Treiben. Ein Junge mit einem Handkarren, der mit gebrauchten Kleidern beladen war, bog zum zweiten Kramwinkel hin ab und konnte kaum an einem alten Mann vorbei, der eine Stange quer über die Schultern trug, an der Pfannen, Kannen und Tiegel hingen. Frauen, in dicke bunte Wolltücher gehüllt und mit schweren Körben beladen, kamen vom Krauterermarkt herauf, andere vom Markt herüber, und alle liefen durcheinander, lachten und redeten, stritten und feilschten, kauften bei den Händlern in der Gasse oder boten ihre Waren an.
Die beiden Mädchen hatten die Walenstraße noch nicht erreicht, als ihnen Kutja, Barbaras Hund, nachgelaufen kam. Er war nicht viel größer als ein ausgewachsener Kater und hatte ein zottiges rotbraunes Fell. Einst gehörte er einem ungarischen Musikanten, der für ein paar Pfennige bei Hochzeiten und anderen Festen aufspielte. Als der Mann auf dem nahen Domplatz sturzbetrunken unter ein Fuhrwerk geriet und noch an Ort und Stelle sein Leben ließ, nahm Barbara den Hund mit nach Hause. Sie nannte ihn Kutja, weil der Mann ihn so genannt hatte, ohne zu wissen, was es bedeutete. Erst später sagte ihr einer, der ein wenig Ungarisch verstand, dass es das Wort für Hund war.
»Geh heim!«, befahl Barbara. Sie klatschte in die Hände. »Na los, verschwinde, Frau Wiltrud mag keine Hunde, das weißt du doch!«
»Lass ihn nur. Die Muhme wird sich nicht an ihm stören, denn sie bekommt uns gar nicht zu Gesicht ...«
Barbara sah Sarina erstaunt an. »Nein? Ich sollte euch doch zur Hand gehen – ist sie denn nicht zu Haus?«
»Doch, aber ...« Sarina brach ab.
Barbara seufzte. »Himmel, nun lass dir doch nicht jedes Wort aus der Nase ziehen!«
»Wir gehen zum Henkergässel.«
Barbara blieb stehen und machte große Augen. »Jesus, was tun wir denn dort?«
»Wenn du nein sagtest, würde ich es verstehen. Aber alleine ... ich kann das nicht alleine!«
»Was kannst du nicht alleine?«
Sarina nahm Barbaras Hand und zog sie weiter. »Das kann ich dir hier auf der Straße nicht sagen. Zuerst nach Hause, in der Waschküche erkläre ich dir alles! Am besten wir gehen hinten herum über die Bachgasse, damit uns die Muhme nicht sieht, falls sie aus dem Fenster schaut.«
Als sie nach rechts zum Markt hin abbogen, kam ihnen ein Fuhrwerk entgegen. Es war mit zwei riesigen Bierfässern beladen und hielt direkt neben ihnen an. Der Bierkutscher, ein kleiner gedrungener Mann mit einem so großen Bauch, dass er ihn selbst nicht mehr umspannen konnte, schlug den Schwengel an seiner Glocke und brüllte los. »Der Bierkutscher ist da, kommt her Leute und kauft Bier! – Der Bierkutscher ist da!«
Die Mädchen hasteten an ihm vorbei, bogen vom Markt in die Bachgasse ein. Hier waren weniger Menschen unterwegs. Zwei Frauen wuschen im eiskalten Wasser des Vitusbaches ein Krautfass aus, schwätzten und lachten dabei, ein paar Kinder ließen ein selbstgebasteltes Schiff schwimmen, und weiter droben, zur Gesandtenstraße hin, tränkte ein Fuhrmann seinen Gaul.
Die Toreinfahrt zum Anwesen Wolfgang Winklers war geschlossen, nur die Tür, die ins Tor eingelassen war, stand offen. Sarina gab Barbara ein Zeichen, dass sie hinter ihr bleiben und still sein sollte. Sie sah in den Hof, entdeckte Kurt bei den Latrinen und zog hastig den Kopf zurück.
Kurt pfiff ein Lied, hantierte dabei mit Eimern. Etwas krachte, als wäre ein Zuber umgefallen, Kurt fluchte, dann hörte sie Schritte auf der Treppe, und plötzlich war es still.
Sarina schaute noch einmal in den Hof. Niemand mehr da. Sie legte einen Finger auf den Mund und winkte Barbara, damit sie ihr folgte.
Die Mädchen überquerten den Hof so schnell, dass ihre Röcke flogen. Vor einer Tür, die in den Waschkeller führte, blieben sie stehen. Während Sarina einen Schlüssel aus einer versteckten Nische zog, hob Barbara den Kopf und sah an der Fassade des Turmes hoch, der sich an das Haus anschloss. Mächtig ragte er in den Himmel, seine Zinnen schienen an die Wolken zu stoßen. Von der Walenstraße her wirkte er majestätisch und erhaben, doch hier im dunklen Geviert war er nichts als ein grauer und düsterer Klotz.
Plötzlich sprang die Tür auf. Sarina zog ihre Freundin in das Innere der Waschküche, Kutja wischte mit ihnen hinein.
Durch eine schmale Luke fiel etwas Licht. Der Raum maß etwa fünf Schritte in jede Richtung. In der Mitte stand ein Holzzuber, so groß, dass zwei oder gar drei Personen in ihm sitzen konnten, daneben ein kleinerer, in dem sich mehrere Holzeimer stapelten. An einem Wandhaken hingen zwei Ledereimer, in der Ecke stand ein großes Waschbrett.
»Was tun wir denn hier?«, fragte Barbara.
»Hier kann uns niemand hören, außerdem habe ich im Zuber die Sachen versteckt, die wir brauchen.«
»Welche Sachen! Und was, um Himmels willen, willst du im Henkergässel?«
»Psst, nicht so laut!« Sarina sah die Freundin mit beschwörendem Blick an. Sie nahm Barbara an der Hand und zog sie vom Fenster weg, in die gegenüberliegende Ecke, dort erzählte sie ihr von Magdalenas letztem Anfall und dass die Muhme sie um das Blut der Kindsmörderin zum Henker geschickt hatte.
»Aber sie kann dich doch nicht allen Ernstes ...!« Die Sache war so ungeheuerlich, dass Barbara es nicht einmal aussprechen wollte.
»Doch, sie kann. Du weißt, wie sie ist. Wenn ich nicht tu, was sie sagt, wird sie schreien und uns alle schikanieren. Sie wird die Mägde schlagen und sich krank ins Bett legen und behaupten, ich sei daran schuld.«
»Dann erzählst du es deinem Oheim! Nie und nimmer wird er erlauben, dass du zum Henker gehst!«
»Aber er ist ja gar nicht da. Er reist mit einer Abordnung von Ratsherren dem Kaiser entgegen. Außerdem hätte ich nichts mehr zu lachen, wenn ich Frau Wiltrud verriete. Sie würde alles daransetzen, dass mein Vater und ich ihr Haus verlassen müssen. Und der Oheim würde schließlich nachgeben. Früher oder später hat sie bei ihm noch immer erreicht, was sie wollte.«
Barbara seufzte. Sie wusste, dass Sarina recht hatte. Frau Wiltrud war nicht mehr ganz jung, siebenunddreißig Jahre, aber noch immer war sie eine schöne und stolze Frau und wusste ihren Mann um den Finger zu wickeln.
Sarina zog zwei schlichte Umhänge aus dem Zuber, dann zwei weiße Hauben, wie sie die verheirateten Frauen trugen. »Damit wird man uns nicht erkennen. Und du musst mich auch gar nicht bis vors Haus des Henkers begleiten. Wenn du nur bis an die Ecke mitkommst, damit ich mich nicht so alleine fühle! – Bitte!« Sarina sah Barbara flehentlich an.
Mit einem langen, tiefen Seufzen schloss Barbara die Augen. »Gut, aber ich werde den Henker nicht ansehen, und ich werde auch kein Wort mit ihm reden!«
»Nein, natürlich nicht.«
»Und du solltest es im Übrigen auch nicht tun.«
Sarina lachte bitter. »Aber wie könnte das gehen!«
Barbara betrachtete die kleine Deckelpfanne, die Sarina inzwischen aus dem Zuber geholt hatte. Sie maß etwa eine Handspanne im Durchmesser. Als ihre Familie noch katholisch war, hatten sie auch so eine Pfanne zu Hause gehabt. Damit war die Mutter an Ostern zum Dom gegangen und hatte Weihwasser geholt. »Was willst du damit?«
»Die Muhme gab mir die Pfanne als Gefäß ... Sie sagte, ich solle einen Lappen um den Stiel wickeln und sie dann vor dem Henker auf das Fenstersims stellen. Wenn er sie später mit dem Blut zurückbringt, wird er den Lappen wegziehen, damit ich nicht berühren muss, was er berührt hat.«
Barbara nickte. »Frau Wiltrud ist klug.« Eine Weile starrte sie auf das Gefäß, dann lachte sie plötzlich. »Aber wir sind auch nicht dumm!« Sie deutete auf ihren Hund. »Wie gut, dass wir Kutja haben. Jetzt weiß ich, wie es geht, damit du nicht mit dem Henker reden musst.« Am Fuße des Turmes, der zum Anwesen des Händlers und Stadtkämmerers Wolfgang Winkler gehörte, wurde die Tür zur Waschküche geöffnet. Ein Falke, der hoch droben auf den Zinnen saß, flog auf und in Richtung Dom davon. Einen Moment war es mucksmäuschenstill, dann huschten zwei Frauen, mit langen Umhängen und weißen Hauben bekleidet, über den Hof und bogen nach links in die Bachgasse ein.
Niemand beachtete sie. Es war nichts Auffälliges an ihnen, außer vielleicht, dass sie nicht miteinander redeten und fortwährend auf den Boden starrten.
Ein Hündchen folgte ihnen, in der Ferne klingelte und schrie ein Bierkutscher: »Der Bierkutscher ist da, kommt her Leute und kauft Bier! – Der Bierkutscher ist da!«
Am Eckhaus zur Gesandtenstraße, dem Lerchenfelder Hof, blieben sie kurz stehen und sahen sich an, so als überlegten sie, ob sie ihren Weg fortsetzen oder doch lieber umkehren sollten. Aber was einmal angefangen ist, muss auch zu Ende geführt werden! Also gingen sie weiter. Am Judensteg vorbei, geradeaus in die obere Bachgasse, von da in die Obermünster Gasse, ins Simader Gässchen, bis sie sich schließlich an der Ecke zum Henkergässel in eine Toreinfahrt drängten.
Den Umweg hatten sie genommen, um möglichst wenig Leuten zu begegnen. Trotzdem war ihnen gerade ein paar Schritte vor dem Henkergässel Matthias Vogel über den Weg gelaufen. Er arbeitete als Knecht beim Blaufärber Schöneder, der mit einer Base der Frau Wiltrud verheiratet war.
Sarina griff sich ans Herz. Es hämmerte gegen ihre Brust, als wollte es zerspringen. »Was meinst du – hat Matthias mich erkannt?«
Barbara schüttelte den Kopf. »Bestimmt nicht. Er hat doch nicht einmal aufgesehen. – Und jetzt?«
Sarina schloss die Augen. »Bist du sicher, dass du mitkommen willst?«, antwortete sie mit einer Gegenfrage.
»Ja, sicher. Wir tun alles ganz genau so wie besprochen.«
»Dann los!«
Entschlossen zog Sarina den Schleier der Haube um ihr Kinn und trat auf die Gasse. Links von ihnen lag der Latron, dort hatte einst der Pfalzgraf von Bayern zu Gericht gesessen, rechts drängten sich schmutzige kleine Wohnhäuser aneinander, in denen sich nichts Gutes tummelte. Der Hundsschinder, der Henker und Wasenmeister wohnten hier; Diebe, Geächtete und sonstiges Gesocks trieben sich herum.
An einem Brunnen schöpfte ein altes Weib Wasser, eine tote Katze lag neben ihr im Dreck, eine Krähe machte sich über den Kadaver her.
Nicht weit vom Brunnen würfelten drei Männer auf einem Brett. Einer von ihnen trug eine Pilgermuschel, die an einem Lederriemen um seinen Hals hing. Als sie die beiden fremden Frauen wahrnahmen, schickten sie ihnen geile Blicke nach, lachten und machten zweideutige Bemerkungen.
Von der Latrongasse, die geradewegs in die Stadt zurückführte, bog ein Mann ins Henkergässl ein. An einem Riemen, den er sich um den Brustkorb gelegt hatte, zog er einen Handkarren hinter sich her. Er war von einem eklig süßlichen Gestank umgeben, der einem schier den Atem raubte. Aus den Augenwinkeln sah Sarina, dass ein paar tote, von Gasen aufgedunsene Hunde auf der Karre lagen.
»Es ist der Hundsschinder!« Sie sagte es, und im selben Moment sah er auf und blickte sie an.
Schnell wandten die Mädchen ihm den Rücken zu. Dem Hundsschinder in die Augen zu sehen war das allergrößte Unglück von allen, die es gab! Ein böses Omen, schlimmer noch als das, dem Henker zu begegnen.
Erst als das Rattern der Wagenräder kaum noch zu hören war, wagten sie es weiterzugehen.
Irgendwo schlug eine Tür zu, ein Kind kreischte, eine Frau schrie. Dann sahen sie es plötzlich – vor einem kleinen schmutziggelben Haus mit windschiefen Fensterläden stand ein Hackstock, dahinein ein Beil geschlagen war. Es galt als Zeichen, dass hier der Henker wohnte.
Die beiden Mädchen tauschten Blicke.
»Willst du es wirklich tun?«
»Ja. Jetzt sind wir schon hier!« Sarina zog die Weihwasserpfanne unter dem Umhang hervor, wickelte den Lappen um den Stiel und stellte das Pfännchen auf einen Hocker neben der Tür des Henkerhäusels. Ihr Herz pochte dabei heftig, ihre Hände zitterten.
Barbara wandte sich ab. Sie starrte auf den Dreck vor ihren Füßen und murmelte ein Gebet.
Inzwischen war man im Hause des Henkers auf die jungen Frauen aufmerksam geworden, Sarina konnte das Flüstern hinter den Fensterluken hören. Ein Hund fing an zu bellen, und plötzlich wurde die Haustür aufgeschoben, und ein Mann trat auf die Straße.
»Wen sucht Ihr, und was treibt Euch her, gute Frau!« Seine Stimme donnerte über sie hinweg wie das herannahende Grollen eines Gewitters.
Bei einer Hinrichtung hatte Sarina den Henker schon einmal gesehen, deshalb wusste sie, dass er ungewöhnlich groß und muskulös war und dass ihm ein Finger an der linken Hand fehlte. Doch jetzt und hier wagte sie nicht aufzublicken, und so sah sie nicht mehr von ihm als seine großen Füße, die in zerschlissenen Schnabelschuhen steckten.
Statt zu antworten, rief sie Kutja zu sich. Der Hund setzte sich vor ihr hin und sah sie erwartungsvoll an. »Ach, ich wünschte, der Henker würde für dich die Pfanne dort mit etwas Blut von der Kindsmörderin füllen«, sagte sie zu ihm.
Der Henker lachte. Er wandte sich ebenfalls an Kutja. »Und was gibst du mir dafür, Köter, wenn ich dir bringe, was du verlangst?«
Sarina strich Kutja übers Fell. »Würde der Henker in der Pfanne nachsehen, er wüsste schon, was er dafür bekommt. Er sollte das Pfännchen jedoch keinesfalls mit der bloßen Hand berühren.«
Aus den Augenwinkeln sah sie, wie der Henker zum Hocker ging, mit einem Zipfel des Lappens den Deckel anhob und in die Pfanne starrte. Dann lachte er wieder. »Ich schlage ein. Der Handel ist perfekt. Dem Teufel wird’s egal sein, wohin das Blut kommt, Hauptsache, die Seel’ bleibt für ihn!« Damit verschwand er im Haus.
Es schien eine Ewigkeit zu dauern, bevor er zurückkam. Ein Kind trat mit ihm auf die Gasse, ein Junge, noch keine drei Jahre alt. Er war ganz verheult, der Rotz tropfte ihm aus der Nase. So als müsste er sich vor den Frauen fürchten, klammerte er sich an das Bein des Henkers, wischte sich mit dem Ärmel über das tränenverschmierte Gesicht und starrte die Fremden neugierig an.
Während der Henker die Pfanne auf den Hocker stellte, das Tuch vom Stiel zog und noch einmal über das Zinn polierte, fragte der Junge: »Sind die Frauen ehrlich, Vater? Sind sie rein und unbescholten?«
»So Gott und der Teufel es wollen, sind sie ehrbar und bleiben es auch.«
Obwohl Sarina sein Gesicht nicht sah, wusste sie, dass er grinste, sie hörte es an seiner Stimme.
Der Henker stopfte das Tuch in seinen Gürtel, lehnte sich mit dem Rücken gegen die Haustür und verschränkte die Arme. Sarina wünschte, er würde verschwinden, doch er machte keine Anstalten. Nachdem sie eine Weile gewartete hatte, ging sie zögerlich zum Hocker. Es kostete sie große Überwindung, nach der Pfanne zu greifen. Nicht einmal eine Ellenlänge trennte ihre Hand nun mehr vom Bein des Henkers. Vor Angst und Ekel hätte sie beinahe noch die Pfanne umgestoßen, und alles wäre umsonst gewesen!
Das Gefäß weit von sich abgestreckt, so als läge eine giftige Schlange darin, machte Sarina auf dem Absatz kehrt, griff mit der linken Hand in ihre Röcke und rannte davon. Barbara und Kutja folgten ihr.
Das Lachen des Henkers hallte noch lange in den Ohren der Mädchen. Alles war so unwirklich, so absurd, so furchtbar und angsterregend, als befänden sie sich in einem bösen Traum. Immer länger wurden ihre Schritte, immer heftiger keuchten sie und rangen nach Atem.
Barbara konnte Sarina kaum folgen. »Warte! Halt an!« Endlich gelang es ihr, sie an der Schulter zu fassen. »So bleib doch endlich stehen!«
Sarina taumelte gegen eine Hauswand und griff sich an die Brust, die sich vom Atemholen heftig hob und senkte. Wie irre blickte sie um sich hin.
»Wenn du rennst, als wäre der Teufel hinter dir her, schauen sie doch alle nach uns. Du musst langsam gehen. Gleich sind wir zu Hause, gleich haben wir es geschafft.«
Erst jetzt erkannte Sarina vor sich die Neue Pfarre, rechts davon die aufgehäuften Steine der abgerissenen Judenstadt, links, nur ein paar hundert Schritt entfernt, die Augustinerkirche. Sie nickte. »Ja, ja, langsam gehen«, ließ den Kopf auf die Brust sinken, streckte das Pfännchen wieder von sich und folgte ihrer Freundin.
Als sie nicht lange danach am Judensteg in die Bachgasse einbogen, sahen sie in der Ferne den Pfarrer laufen. Sein schwarzer Talar blähte sich im Wind auf, dass es aussah, als flöge ein Totenvogel umher. Ein schlechtes Omen, wahrlich! Und tatsächlich verschwand er in der Toreinfahrt zum Anwesen der Familie Winkler.
»Jesus!« Sarina hielt sich die Hand vor den Mund. »Es wird doch nicht die Magdalena ...« Die Worte blieben ihr im Halse stecken.
Selbst an der Einfahrt angekommen, rissen sie sich die Hauben vom Kopf, ließen sie unter den Umhängen verschwinden und betraten bangen Herzens das Haus.
Barbe kam ihnen mit einer Schüssel voll Blut entgegen. »Da seid Ihr ja, Jungfer Sarina, Frau Wiltrud hat schon mehrmals nach Euch gerufen.«
»Aber sie hat mich doch mit einem Auftrag fortgeschickt.«
Barbe zuckte die Schultern. »Die Jungfer Magdalena liegt im Sterben. Der Arzt hat sie nochmals zur Ader gelassen, aber es nützte nichts. Nun haben wir den Pfarrer geholt.«
Sarina riss sich den Umhang von den Schultern, ließ ihn auf den Boden gleiten, lief mit der Pfanne in der Hand die Treppe hinauf.
Barbara folgte ihr. Einer Sterbenden erwies man die Ehre.
Um das Bett standen der Pfarrer, Frau Wiltrud und ihr Sohn Richard, die Knechte, Mägde und zwei Nachbarinnen. Als die beiden Mädchen das Zimmer betraten, hatte Magdalena gerade ihren letzten Atemzug getan. Der Pfarrer schloss ihr die Augen und sprach dazu ein Gebet, danach stimmten die Nachbarinnen und die Mägde Klagerufe an. Nicht zu laut, denn das erlaubte der protestantische Pfarrer nicht.
Als Frau Wiltrud sich umdrehte und Sarina mit der Weihwasserpfanne in der Hand sah, packte sie die junge Frau am Ärmel und zerrte sie aus dem Raum. »Was fällt dir ein, damit ins Sterbezimmer zu kommen!«
»Aber Ihr habt mich doch danach geschickt!«
Frau Wiltrud hielt ihr den Mund zu. »Sei still! Was du in dieser Pfanne hast, will ich gar nicht wissen. Wirf sie fort! In die Latrine oder noch besser draußen in den Bach! Und kein Wort zu irgendeinem Menschen! Sie würden ohnehin alle wissen, dass du lügst. Niemand glaubt dir mehr als mir!«
»Ja, Muhme.«
»Und was tut Barbara hier? Weiß sie etwa, wo du warst?«
»Nein, Muhme, ich traf sie auf der Gasse. Wir haben gesehen, wie der Pfarrer das Haus betrat. Da wollte sie mitkommen.«
»Gut. Dann schaff mir das da aus den Augen und komm sofort zurück!« Frau Wiltrud ging wieder ins Sterbezimmer.
Sarina rannte zur Treppe. Ihre Augen füllten sich mit Tränen, sie schluchzte laut auf. Magdalena war tot! Ihre Freundin, ihre Kusine, die einzige Vertraute, die sie in diesem Haus hatte!
Sie polterte die Treppe hinunter, stürzte auf den Hof, über die Gasse zum Bach. Warf die Pfanne hinein und sank auf die Knie. Langsam färbte sich das Wasser rot, das Blut floss in Schwaden Richtung Donau davon.
Paul Sachsberger drückte sich in den Hauseingang des Gasthofs Zum Goldenen Brunnen und besah sich von dort aus das Anwesen, in dem die beiden jungen Frauen verschwunden waren. Der Turm, der auf der Ostseite des Gevierts in den Himmel ragte, war höher als alle Türme, die es in Regensburg gab – höher als der Baumburger Turm, höher als der Turm vom Goldenen Kreuz, höher als der Rathausturm. Wer hier wohnte oder auch nur ein- und ausging, der hatte in dieser Stadt ein Wort mitzureden.
Als er die feinen Damen beim Henker gesehen hatte, hatte er sich gedacht: Sachsberger, denen gehst du nach, vielleicht sind die Mäuschen ja zu melken! Und jetzt ... Himmel, jetzt hatte ihm der Zufall mit ein wenig Glück gar zwei fette Milchkühe beschert!
Ein Kaufmann trat hinter ihm aus der Gaststube. Als der Mann pfiff, führte ihm ein Bursche einen aufgezäumten Gaul zu, half ihm, sein Gepäck am Sattel festzuschnallen, und hielt ihm dann den Steigbügel. Der Kaufmann saß auf, gab seinem Gaul die Schenkel, ritt an Sachsberger vorbei auf die Gasse hinaus und trabte in Richtung Marktplatz davon.
Der Bursche hing die Daumen in den Gürtel und starrte Sachsberger an. »Was lungerst du hier herum?«
»Was geht’s dich an?«