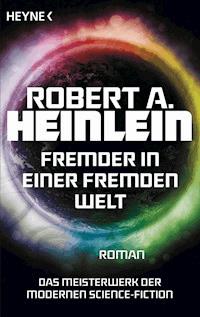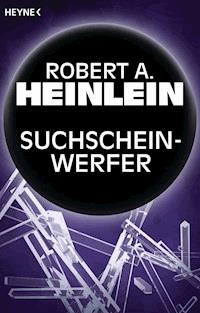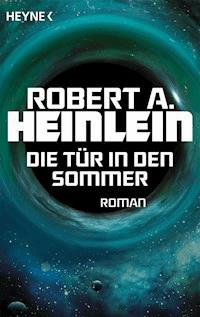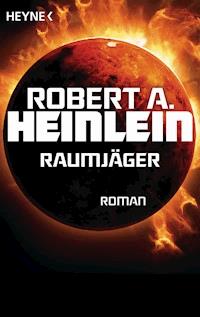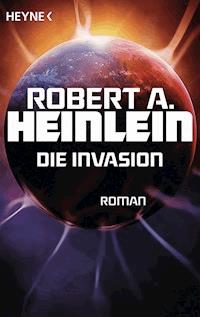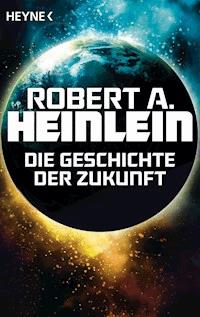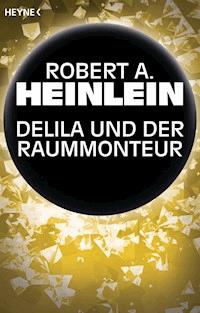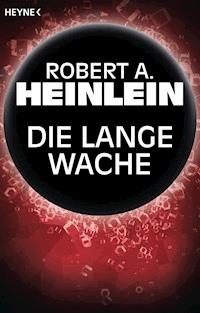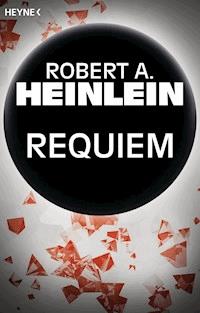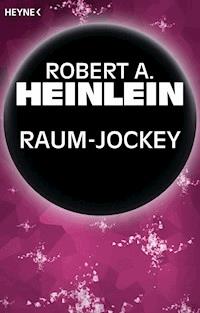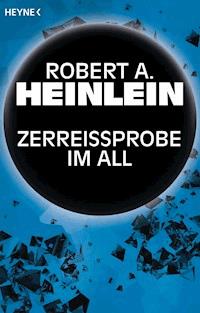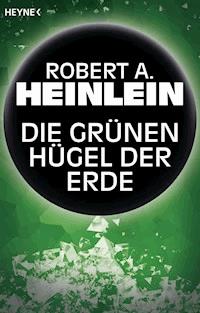8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Zeitreise wider Willen
Während eines Atomangriffs flüchtet Hugh Farnham mit seiner Familie in einen eigens für solche Zwecke konstruierten Atombunker. Als die Farnhams sich jedoch nach einiger Zeit wieder nach draußen wagen, finden sie sich nicht – wie erwartet – inmitten rauchender Trümmer wieder, sondern in einem subtropischen Paradies: Der Atomschlag hat sie zweitausend Jahre in die Zukunft katapultiert. Doch das scheinbare Idyll trügt, denn die Zukunft hält einige unangenehme Überraschungen für die Farnhams bereit ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 491
Ähnliche
DAS BUCH
Amerika zur Zeit des Kalten Krieges: Die politische Situation ist angespannt, und in der Bevölkerung ist die Angst vor einem atomaren Angriff groß, doch Hugh Farnham ist vorbereitet. Tief unter seinem Haus hat er einen sicheren Strahlenschutzbunker gebaut und mit den nötigsten Lebensmitteln und Werkzeugen ausgestattet – auch wenn er dafür von seiner Familie verspottet wird. Als es eines Abends tatsächlich Bombenalarm gibt, flüchten die Farnhams in den Bunker, wo sie eine schreckliche Nacht voller Explosionen und Todesängste verbringen. Doch als sie am nächsten Tag den Bunker verlassen, stehen sie, statt inmitten rauchender Trümmer, in einem subtropischen Paradies. Nachdem sie die erste Überraschung überwunden haben, arrangiert sich die Familie mit ihrem neuen, einfachen Leben in der Natur – bis sie eines Tages auf Menschen treffen und die Farnhams das ganze Ausmaß jener schicksalshaften Nacht begreifen: Der Atomschlag hat sie über zweitausend Jahre in die Zukunft katapultiert, in eine Welt, deren Sprache und Kultur ihnen völlig fremd sind. Für die Farnhams beginnt das größte und gefährlichste Abenteuer ihres Lebens …
DER AUTOR
Robert A. Heinlein wurde 1907 in Missouri geboren. Er studierte Mathematik und Physik und verlegte sich schon bald auf das Schreiben von Science-Fiction-Romanen. Neben Isaac Asimov und Arthur C. Clarke gilt Heinlein als einer der drei Gründerväter des Genres im 20. Jahrhundert. Sein umfangreiches Werk hat sich millionenfach verkauft, und seine Ideen und Figuren haben Eingang in die Weltliteratur gefunden. Die Romane Fremder in einer fremden Welt und Mondspuren gelten als seine absoluten Meisterwerke. Heinlein starb 1988.
Mehr über Robert A. Heinlein und seine Romane auf:
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
ROBERT A. HEINLEIN
ROMAN
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Titel der amerikanischen Originalausgabe
FARNHAM’S FREEHOLD
Deutsche Übersetzung von Birgit Bohusch, Marcel Biegerund Jürgen Langowski
Überarbeitete Neuausgabe: 01/2016
Copyright © 1964 by Robert A. Heinlein
Copyright © 1992 by Virginia Heinlein
Copyright © 2015 dieser Ausgabeby Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: DAS ILLUSTRAT, München
Satz: Schaber Datentechnik, Austria
ISBN: 978-3-641-16515-4V002
www.diezukunft.de
1
Das ist kein Hörgerät«, erklärte Hubert Farnham, »sondern ein Radio, das auf die Warnfrequenz eingestellt ist.«
Barbara Wells ließ die Gabel sinken. »Mr. Farnham! Sie glauben doch nicht im Ernst an einen Angriff?«
Ihr Gastgeber zuckte die Achseln. »Leider teilen mir die Leute im Kreml ihre Geheimpläne nicht mit.«
»Hör doch auf, die Damen zu beunruhigen, Dad«, mischte sich sein Sohn ein. »Mrs. Wells …«
»Nennen Sie mich Barbara. Ich will ohnehin beim Gericht beantragen, die ›Mrs.‹ streichen zu dürfen.«
»Dazu brauchen Sie keine Sondergenehmigung.«
»Pass gut auf, Barb«, meinte seine Schwester Karen. »Ein kostenloser Rat kommt am teuersten.«
»Ach, sei still. Barbara, bei allem Respekt meinem teuren Vater gegenüber, glaube ich doch, dass er Gespenster sieht. Es wird keinen Krieg geben.«
»Hoffentlich behalten Sie recht«, meinte Barbara Wells nüchtern. »Und was verleiht Ihnen Ihre feste Überzeugung?«
»Die Kommunisten sind doch Realisten. Sie werden nie einen Krieg anzetteln, der ihnen schadet, auch wenn sie gewinnen. Wobei ziemlich fraglich ist, ob sie gewinnen.«
»Dann sollen sie doch endlich einmal diese entsetzlichen Krisen verhindern«, empörte sich seine Mutter. »Kuba und dieses Getue um Berlin – als ob das jemanden interessierte! Und nun das! Es macht einen einfach nervös. Joseph!«
»Ja, Ma’am?«
»Bringen Sie mir einen Kaffee. Mit Schuss.«
»Jawohl, Ma’am.« Der Hausdiener, ein junger Farbiger, nahm ihr Gedeck mit.
»Dad«, meinte der junge Farnham, »siehst du nicht, dass du Mutter mit deiner Ängstlichkeit ansteckst? Hör doch auf mit dem Unsinn.«
»Nein.«
»Du musst aber! Mutter hat kaum einen Bissen heruntergebracht – und das alles wegen dieses komischen Knopfes in deinem Ohr. Du kannst doch nicht …«
»Nun mal langsam, Duke.«
»Vater?«
»Als du in deine eigene Wohnung gezogen bist, haben wir vereinbart, gute Freunde zu bleiben. Die Meinung eines Freundes ist mir jederzeit willkommen. Aber misch dich nicht in Angelegenheiten, die nur deine Mutter und mich etwas angehen.«
»Aber Hubert«, beschwichtigte seine Frau.
»Verzeihung, Grace.«
»Du bist zu hart zu dem Jungen. Es macht mich nervös.«
»Duke ist kein Kind mehr. Und ich habe nichts getan, das dich nervös machen könnte, tut mir leid.«
»Mir tut es auch leid, Mutter. Nun, wenn Dad es als Einmischung auffasst …« Duke rang sich ein Grinsen ab. »Ich glaube, ich muss mir selbst eine Frau suchen, die ich ärgern kann. Barbara, wollen Sie mich heiraten?«
»Nein, Duke.«
»Ich sagte dir doch, dass sie klug ist, Duke«, meinte seine Schwester lachend.
»Karen, du bist still. Und warum nicht, Barbara? Ich bin jung und gesund und bringe es vielleicht eines Tages sogar zu Klienten. In der Zwischenzeit können Sie ja arbeiten, um unser Haushaltsgeld aufzubessern.«
»Nein, danke. Übrigens muss ich Ihrem Vater recht geben.«
»Wieso?«
»Besser gesagt, mein Vater würde Ihrem Vater recht geben. Wissen Sie, dass jedes unserer Autos eine Notausrüstung besitzt? Und wenn Daddy auch kein solches Ding im Ohr hat, so sitzt er doch bestimmt jede freie Minute vor dem Fernseher.«
»Im Ernst?«
»In meinem Wagen draußen, der, mit dem Karen und ich von der Uni hergekommen sind, liegt im Kofferraum eine Notausrüstung, die mein Vater zusammengestellt hat, bevor ich wieder aufs College ging. Mein Vater nimmt diese Angelegenheit ernst, und ich halte es genauso.«
Duke Farnham wollte etwas sagen, doch sein Vater kam ihm zuvor. »Barbara, woraus besteht Ihre Notration?«
»Vierzig Liter Wasser. Nahrungsmittel. Ein Reservekanister Benzin. Medikamente. Ein Schlafsack. Eine Pistole …«
»Können Sie schießen?«
»Mein Vater hat es mir beigebracht. Eine Schaufel. Eine Axt. Kleider. Ach ja, ein Radio. Mein Vater meint, dass die Ausrüstung im Wagen am sichersten bei der Hand ist. Er hat mir geraten, im Ernstfall sofort in die Berge zu fahren.«
»Das müssen Sie nicht.«
»Wie bitte?«
»Dad meint, dass du herzlich eingeladen bist, unsere Panikhöhle zu teilen«, erklärte Karen lachend.
Barbara sah sie fragend an. »Wir haben einen Bunker«, erklärte Farnham. »Mein Sohn hat ihn ›Farnhams Tick‹ getauft. Ich glaube, Sie wären hier sicherer untergebracht als in den Bergen – obwohl sich keine fünfzehn Kilometer von hier eine MAMMA-Basis befindet. Im Falle eines Alarms brauchen wir nur in den Bunker zu gehen. Nicht wahr, Joseph?«
»Jawohl, Sir. So bleibe ich auch weiterhin in Ihren Diensten.«
»Blödsinn! In dem Augenblick, in dem die Sirenen losheulen, bist du fristlos entlassen. Ich werde Miete von dir verlangen.«
»Muss ich auch Miete zahlen?«, erkundigte sich Barbara.
»Sie spülen ab. Jeder muss mal spülen. Sogar Duke.«
»Mich kannst du raushalten.« Duke sah ihn finster an.
»Na? So viel Geschirr haben wir doch gar nicht.«
»Im Ernst, Dad. Chruschtschow hat versprochen, uns zu beerdigen, und du sorgst dafür, dass er recht behält. Ich habe keine Lust, mich lebend in einer Höhle unter der Erde zu verkriechen.«
»Wie Sie wünschen, mein Herr.«
»Liebling!« Seine Mutter stellte die Tasse hin. »Wenn wir angegriffen werden, kommst du selbstverständlich mit in den Bunker.« Sie hatte Tränen in den Augen. »Versprich es mir.«
Der junge Farnham runzelte die Stirn und seufzte. »Schon gut – wenn wir angegriffen werden. Das heißt, wenn die Sirenen losheulen, denn wir werden nicht angegriffen werden. Aber denk daran, Dad, ich mache das nur, um Mutters Nerven zu schonen.«
»Du bist trotzdem herzlich willkommen.«
»Schon gut. Gehen wir ins Wohnzimmer und spielen wir ein wenig Karten – vorausgesetzt, dass wir dieses Thema fallen lassen. Einverstanden?«
»Einverstanden!« Sein Vater stand auf und bot Grace den Arm. »Kommst du, Liebling?«
Grace Farnham wollte nicht Karten spielen. »Nein, Liebling, ich bin zu aufgeregt. Spiel mit den jungen Leuten und … Joseph! Joseph, bring mir bitte noch ein Tässchen Kaffee. Mit Schuss. Ach, sieh mich nicht so an, Hubert, du weißt, dass es hilft.«
»Möchtest du ein Beruhigungsmittel, Liebling?«
»Ich brauche keine Medizin. Nur ein Schlückchen Kaffee.«
Sie hoben ab und ermittelten die Partner. Duke schüttelte traurig den Kopf. »Arme Barbara! Sie werden mit Dad Ihr blaues Wunder erleben. Hast du sie nicht gewarnt, Schwesterherz?«
»Behalt deine Weisheiten für dich, Duke«, sagte sein Vater.
»Aber sie muss doch Bescheid wissen, Dad. Barbara, dieser jugendliche Heißsporn, der Ihnen gegenübersitzt, ist beim Kontrakt so optimistisch, wie er … nun ja, wie er in anderen Dingen pessimistisch ist. Achten Sie auf Bluffs. Wenn er ein besonders schwaches Blatt hat …«
»Hör auf, Duke. Barbara, welches Bietsystem bevorzugen Sie? Italienisch?«
Sie riss die Augen weit auf. »Das einzige Italienische, das ich kenne, ist Wermut, Mr. Farnham. Ich spiele Goren. Nichts Kompliziertes. Ich versuche einfach nur, mich an die Regeln zu halten.«
»An die Regeln halten«, stimmte Hubert Farnham zu.
»An die Regeln halten«, wiederholte sein Sohn. »Aber welche Regeln? Dad greift gern auf Bauernregeln zurück. Besonders, wenn Sie ein schwaches Blatt haben und kontriert und rekontriert sind. Dann wird er Ihnen nach dem Spiel beweisen, wie Sie gewonnen hätten, wenn Sie statt Karo …«
»Herr Rechtsanwalt«, unterbrach ihn sein Vater, »wollen Sie endlich Ihre Karten aufnehmen, oder muss ich sie in Ihren losen Mund stopfen?«
»Nur ruhig Blut. Welcher Einsatz? Ein Cent pro Punkt?«
»Viel zu hoch«, widersprach Barbara.
»Ihr Mädchen müsst selbstverständlich nicht zahlen«, meinte Duke. »Nur Dad und ich. Endlich eine Gelegenheit, das Geld für die nächste Monatsmiete ehrlich zu verdienen.«
»Duke will sagen«, verbesserte ihn sein Vater, »dass er seine Schulden bei seinem alten Vater wieder einmal vermehrt. Er steht schon seit der Highschool bei mir in der Kreide.«
Barbara schwieg und spielte konzentriert. Der Einsatz machte sie nervös, auch wenn es nicht ihr Geld war. Verstärkt wurde ihre Unsicherheit noch durch den Verdacht, dass ihr Partner ein erfahrener Spieler war.
Nach einer Weile, als sie den Eindruck gewann, dass Mr. Farnham mit ihren Geboten zufrieden war, entspannte sie sich ein wenig, ohne in ihrer Aufmerksamkeit nachzulassen. Allerdings war sie froh über die Verschnaufpausen, wenn sie der Strohmann war. Diese Gelegenheiten nutzte sie, um Hubert Farnham genau zu betrachten.
Mr. Farnham gefiel ihr. Er spielte Bridge, wie er seine Familie behandelte – ruhig, nachdenklich und doch kühn und respektheischend. Sie bewunderte die Art und Weise, wie er aus einem Kontrakt, den sie überreizt hatte, auch noch den letzten Stich herausquetschte, indem er so kühn war, ein As abzuwerfen.
Barbara wusste, dass Karen sie und Duke verkuppeln wollte. Nun ja, warum auch nicht? Duke wäre ein guter Fang … so hübsch wie Karen, dazu ein aufstrebender junger Anwalt mit einer gesunden, entwaffnenden Ellbogenmentalität.
Ob er erwartete, dass sie sich auf ihn einließ? Oder wartete Karen darauf und beobachtete sie deswegen mit heimlichem Amüsement? Nun, sie würde beide enttäuschen müssen.
Es machte ihr nichts aus, dass sie geschieden war, aber sie hatte etwas gegen die allgemein verbreitete Auffassung, dass eine geschiedene Frau für jeden zu haben sei. Verdammt, sie hatte seit jener schrecklichen Nacht, in der sie ihre Koffer gepackt hatte, noch mit niemandem geschlafen …
Duke sah sie an, sie wurde rot und sah weg, blickte stattdessen seinen Vater an.
Mr. Farnham war an die Fünfzig. Sein Haar wurde bereits grau und schütter. Er selbst wirkte mager, wenn man von dem Bäuchlein absah. Um seine Augen zogen sich müde Linien. Er war nicht sehr hübsch, aber männlich. Und wenn Duke nur die Hälfte von dem Charme seines Vaters besessen hätte, würde nicht mal ein Keuschheitsgürtel sonderlichen Schutz bieten. Sie warf einen ärgerlichen Blick auf Grace Farnham. Was hatte diese Frau für ein Recht, heimlich zu trinken, fett zu werden und sich gehen zu lassen, wenn sie mit so einem Mann verheiratet war?
Ob Karen später auch einmal so würde? Mutter und Tochter sahen sich sehr ähnlich, nur dass Karen noch nicht in die Breite gegangen war. Barbara schob den Gedanken hastig beiseite. Sie mochte Karen lieber als jedes andere Mädchen der Verbindung. Karen war nett, großzügig und fröhlich …
Doch vielleicht war Grace Farnham auch einst so gewesen. Müssen Frauen irgendwann nervtötend und nutzlos werden?
Hubert Farnham sah sie an. »Nicht schlecht, Partnerin. Drei Pik, Robber und gespielt.«
Sie wurde rot. »Noch einmal gut gegangen. Ich habe zu viel riskiert.«
»Aber nein. Wer nicht wagt … Karen, ist Joseph schon zu Bett gegangen?«
»Er lernt für eine Prüfung.«
»Eigentlich müsste er mitspielen. Joseph ist der beste Spieler unserer Familie – kühn genau zur rechten Zeit. Und außerdem macht er eine Ausbildung zum Buchhalter. Sie können sich vorstellen, dass er keine einzige Karte vergisst. Karen, könntest du uns eine Erfrischung bringen, ohne Joseph zu stören?«
»Jawohl, Massa. Wodka Tonic für dich?«
»Hm, ja und etwas zu knabbern.«
»Komm, Barbara. Ab in die Küche.«
Hubert Farnham sah ihnen nach und überlegte, dass es eine Schande war, dass ein hübsches Kind wie Mrs. Wells schon so eine schreckliche Ehe hinter sich hatte. Eine gute Bridge-Partnerin und auch sonst nicht ohne – na ja, etwas schlaksig vielleicht und ein bisschen pferdegesichtig –, aber einen eigenen Kopf und ein nettes Lächeln. Wenn Duke nur einen Funken Verstand im Hirn hätte …
Aber das konnte man von Duke nicht verlangen. Hubert ging zu seiner Frau hinüber, die im Fernsehsessel vor sich hin döste, und sagte sanft: »Grace? Liebling, möchtest du schlafen gehen?« Und er half ihr ins Schlafzimmer hinauf.
Als er zurückkam, saß Duke allein im Wohnzimmer. Er setzte sich zu ihm. »Duke, die Meinungsverschiedenheit von vorhin tut mir leid.«
»Schon vergessen.«
»Deine Anerkennung wäre mir lieber als deine Toleranz. Ich weiß, dass du von meiner ›Panikhöhle‹ nicht viel hältst. Aber wir haben nie darüber gesprochen, weshalb ich sie gebaut habe.«
»Was gibt es da viel zu reden? Du glaubst, dass die Russen angreifen werden. Und dass dieses unterirdische Loch dir das Leben retten wird. Beides völlig verrückte Ideen. Und für Mutter schädlich. Du treibst sie ja geradezu zum Trinken. Das gefällt mir nicht. Und noch weniger gefällt mir, dass du mich – einen Anwalt – daran erinnerst, ich solle mich nicht zwischen Ehegatten drängen.« Duke erhob sich. »Ich gehe.«
»Bitte, Junge! Erhält die Verteidigung keine Chance?«
»Hm, na meinetwegen.« Duke setzte sich wieder.
»Ich respektiere deine Meinung, wenn ich sie auch nicht teile. Die meisten Leute sind ja deiner Ansicht, zumindest hat kaum jemand etwas unternommen, um sich selbst zu schützen. Aber in zwei Punkten hast du unrecht. Ich erwarte nicht, dass Russland angreift – und ich bezweifle, dass unser Bunker stark genug ist.«
»Warum steckst du dir dann dieses Ding ins Ohr, das Mutter so zur Verzweiflung bringt?«
»Junge, ich hatte noch nie einen Autounfall. Und trotzdem zahle ich meine Versicherung. Der Bunker ist meine Lebensversicherung.«
»Aber sagtest du nicht eben, dass er uns nicht retten könnte?«
»Er würde genügen, wenn wir uns hundertfünfzig Kilometer von Mountain Springs entfernt befänden. Aber du weißt, dass die Basis ein Hauptziel sein wird – und niemand kann einen Bunker bauen, der vor einem Direkttreffer schützt.«
»Und warum hast du es trotzdem getan?«
»Ich sagte es bereits. Die beste Versicherung, die ich mir leisten konnte. Einen Direkttreffer wird er nicht aushalten. Aber wenn die Rakete nur ein bisschen danebengeht, könnten wir durchkommen. Die Russen sind auch keine Übermenschen und machen ihre Fehler. Ich habe das Risiko so weit wie möglich verringert. Mehr kann ich nicht tun.«
»Dad, ich bin kein guter Diplomat.«
»Dann versuch auch nicht, einer zu sein.«
»Also schön, ich werde offen sprechen. Musst du Mutters Leben ruinieren, nur aufgrund einer winzigen Chance, ein paar Jährchen länger zu leben? Hat es überhaupt einen Sinn weiterzuleben, wenn das Land rings um uns verwüstet ist und alle unsere Freunde tot sind?«
»Wahrscheinlich nicht.«
»Weshalb dann?«
»Duke, du bist nicht verheiratet.«
»Ich weiß.«
»Mein Junge, jetzt spreche ich einmal offen mit dir. Ich habe seit Jahren jede Lebenshoffnung aufgegeben. Du bist erwachsen und stehst auf eigenen Füßen, und Karen braucht mich auch nicht mehr. Ich selbst …« Er zuckte die Achseln. »Das Einzige, wofür ich mich noch begeistern kann, ist eine anständige Partie Bridge. Wie du vielleicht schon bemerkt haben wirst, gibt es in meiner Ehe nicht mehr viele Gemeinsamkeiten.«
»Das ist deine Schuld. Du treibst Mutter noch in einen Nervenzusammenbruch.«
»Ich wollte, es wäre so einfach. Lass mich nur eines klarstellen: Du warst an der Uni, als ich den Bunker baute. Deine Mutter war während dieser Zeit hellwach und nüchtern. Sie trank höchstens mal einen Martini und beließ es dabei – anstatt vier wie heute Abend. Duke, Grace will den Bunker.«
»Nun ja, vielleicht. Aber es ist bestimmt nicht beruhigend für sie, wenn du mit diesem Stöpsel im Ohr herumläufst.«
»Möglich. Aber ich habe keine andere Wahl.«
»Wie meinst du das?«
»Grace ist meine Frau, Duke. Und ich muss für sie sorgen, so gut ich kann. Dieser Bunker kann ihr vielleicht das Leben retten. Aber nur, wenn sie ihn rechtzeitig aufsucht. Wann kommen die Warnungen durch? Ein paar Minuten vor dem Angriff. Und wenn ich sie nicht höre, schaffe ich es nicht, Grace rechtzeitig hinunterzubringen. So muss ich eben immer bereit sein.«
»Angenommen, es geschieht nachts?«
Sein Vater lächelte. »Bei sehr schlechten Nachrichten lasse ich den Radioempfänger auch über Nacht im Ohr. Und bei wirklichen Krisen – so wie heute Abend zum Beispiel – schlafen Grace und ich im Bunker. Ich werde auch die Mädchen dazu zwingen. Duke, du bist herzlich eingeladen, ebenfalls nach unten zu kommen.«
»Nein, danke.«
»Es war nur eine Einladung.«
»Dad, angenommen, der Angriff fände wirklich statt – was nützt dir dann der Bunker mitten in einem Direktziel-Gebiet? Warum hast du keinen Platz weit weg gesucht und Mutter dorthin gebracht?«
Hubert Farnham seufzte. »Junge, sie würde ihr Haus nie verlassen.«
»Du musst sie zwingen.«
»Duke, hast du je versucht, eine Frau zu etwas zu zwingen, was sie nicht wollte? Außerdem ist ihre Schwäche für Alkohol gefährlicher, als du es dir vielleicht vorstellst. Mutter ist krank. Ich muss damit fertigwerden, so gut ich kann. Aber davon mal abgesehen, Duke, ich habe zwar eben gesagt, ich sähe nicht mehr viel Sinn darin, am Leben zu bleiben, aber einen Grund habe ich doch noch.«
»Nämlich?«
»Falls diese verlogenen, betrügerischen Mistkerle jemals ihre Mordwaffen auf die Vereinigten Staaten abschießen, dann will ich noch lange genug leben, um stilvoll zur Hölle zu fahren, und zwar mit acht Russen als Eskorte!«
Farnham beugte sich vor. »Ich meine das ernst, Duke. MeinerMeinung nach ist Amerika das Beste, was es in der Geschichte der Menschheit je gegeben hat, und wenn diese Schurken unser Land zerstören, dann will ich auch ein paar von ihnen töten. Acht Mann als Eskorte, und keinen weniger. Deshalb war ich auch ganz erleichtert, als Grace sich weigerte umzuziehen.«
»Warum das?«
»Weil ich nicht zulassen will, dass dieser schweinsgesichtige Bauer, der auch noch die Manieren eines Schweins hat, mich aus meinem Haus vertreibt. Ich bin ein freier Mann und will das auch bleiben. Deshalb hätte es mir nicht gepasst, einfach wegzulaufen. Aber still jetzt. Die Mädchen kommen.«
Karen kam mit den Drinks herein, gefolgt von Barbara. »Hallo. Barb hat sich unsere Vorräte angesehen und wurde von der fixen Idee gepackt, Crêpes Suzettes zu machen. Na, warum seht ihr uns denn so grimmig an? Schlechte Nachrichten?«
»Nein, aber wenn du den Fernseher einschaltest, sehen wir vielleicht noch einen Teil der Zehn-Uhr-Nachrichten. Barbara, diese Pfannkuchen mit dem unaussprechlichen Namen duften herrlich. Soll ich Sie als Köchin einstellen?«
»Und was wird aus Joseph?«
»Haushofmeister.«
»Einverstanden.«
Duke pfiff durch die Zähne. »Sie weigert sich, in anständiger Ehegemeinschaft mit mir zu leben, nimmt aber die sündigen Anträge meines alten Herrn an.«
»Ich habe kein Wort von Sünde gehört.«
»Aber Barbara! Wissen Sie denn nicht, dass mein Vater ein notorischer Sittlichkeitsverbrecher ist?«
»Stimmt das, Mr. Farnham?«
»Hm …«
»Deshalb habe ich doch Jura studiert, Barbara. Wir wären noch pleite gegangen, weil wir immer wieder die besten Anwälte von New York besorgen mussten.«
»Das ist schon Jahre her, Barbara«, lachte Hugh Farnham. »Bridge ist im Augenblick die einzige Schwäche, die mir noch geblieben ist.«
»Auf alle Fälle muss ich nach diesen erschütternden Neuigkeiten natürlich ein höheres Gehalt fordern.«
»Ruhe, Kinder!«, rief Karen dazwischen. Sie stellte den Fernseher lauter.
»… stimmten in den Grundfragen im Wesentlichen überein und beschlossen, die noch strittigen Punkte zu vertagen. Man kann sagen, dass die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg nun als überwunden betrachtet werden kann. Nach einer kurzen Pause bringen wir Nachrichten über eine aufsehenerregende Erfindung von General Motors …«
Karen drehte den Apparat leiser. »Was habe ich gesagt, Dad?«, meinte Duke. »Du kannst diesen Stöpsel aus deinem Ohr nehmen.«
»Später. Jetzt sind mir die Crêpes Suzettes lieber. Barbara, das wird ab jetzt mein tägliches Frühstück.«
»Dad, hör auf, sie zu verführen. Heb lieber ab. Ich möchte mich revanchieren.«
»Na, da werden wir wohl die Nacht über hier sitzen bleiben.« Mr. Farnham schob den Teller beiseite. Es klingelte. »Ich gehe schon.«
Er ging zur Tür und kehrte gleich darauf wieder zurück. »Wer war es, Dad?«, fragte Karen. »Ich habe für dich abgehoben. Wir gehören zusammen. Na, zeig dich wenigstens geschmeichelt.«
»Ich bin entzückt, Liebling. Da hat sich offensichtlich einer in der Tür geirrt.«
»Mein Freund. Du hast ihn verscheucht.«
»Wahrscheinlich. Ein abgerissener alter Glatzkopf.«
»Trotzdem mein Freund. Los, hol ihn zurück.«
»Zu spät. Er warf mir einen Blick zu und ging. Wer bietet jetzt?«
Barbara spielte weiterhin streng nach Schema. Ihr kam es so vor, als überreizte Duke sein Blatt bei jedem Spiel. Deshalb bot sie eher vorsichtig und musste sich überwinden, um auch einmal etwas zu riskieren. So verging eine langwierige, langweilige Runde, in der sie zwar einige Spiele gewannen, aber dennoch insgesamt Punkte verloren.
Es war eine Freude, die nächste Runde mit Karen als Partnerin zu verlieren. Später wechselten sie noch einmal, sodass sie wieder Mr. Farnhams Partnerin war. Er lächelte sie an. »Dieses Mal machen wir sie fertig.«
»Ich will mir Mühe geben.«
»Spielen Sie weiter wie bisher, streng nach den Regeln. Duke macht dann schon die Fehler, die uns helfen.«
»Dad, wenn du so laut tönst, kannst du auch etwas riskieren. Wie wäre es mit einer kleinen Wette nebenbei? Hundert Dollar auf diese Runde?«
»Einverstanden.«
Barbara dachte an die siebzehn einsamen Dollar in ihrer Handtasche und wurde nervös. Noch nervöser wurde sie, als Duke das erste Spiel mit fünf Treff gewann. Er hatte seine Hand überreizt und hätte verloren, wenn sie rechtzeitig dagegengehalten hätte.
Duke sagte: »Na, Chef, wollen wir verdoppeln?«
»Gut, abgemacht.«
Die zweite Hand stärkte ihr Selbstvertrauen: vier Pik geboten und erreicht. Sie konnte sogar einstechen, ehe ihr die Trümpfe ausgingen. Das Lächeln ihres Partners war ihr Belohnung genug, aber sie war immer noch etwas unsicher.
Duke sagte: »Beide Teams sind in Gefahr, keine Teilkontrakte. Daddy, was macht dein Blutdruck? Wollen wir noch einmal verdoppeln?«
»Wenn du so weitermachst, musst du bald deine Sekretärin entlassen.«
»Bekenne Farbe, oder gib dich geschlagen.«
»Vierhundert. Du kannst natürlich auch dein Auto verkaufen.«
Mr. Farnham teilte die Karten aus. Barbara nahm ihre Hand auf und runzelte die Stirn. Es sah gar nicht schlecht aus – zwei Damen, ein paar Buben, ein As, ein König –, aber keine Farbe, mit der sie reizen konnte, und der König war blank. Das war eine Blattstärke und eine Verteilung, die sie immer als »gerade gut genug für schwache Gegner« bezeichnete. Sie konnte nur hoffen, dass es eins dieser Spiele wurde, bei denen alle Spieler passten und erleichtert seufzten, wenn die Karten neu gemischt wurden.
Ihr Partner nahm die Hand auf und warf einen Blick darauf. »Drei ohne Trumpf.« Barbara unterdrückte einen entsetzten Ausruf, Karen hingegen tat sich keinen Zwang an. »Dad, hast du Fieber?«
»Biete.«
»Ich passe.«
»Oh je, oh je, was soll ich jetzt bloß machen?«, sagte Barbara bei sich. Das Gebot ihres Partners verhieß fünfundzwanzig Punkte und roch nach einem Schlemm. Sie hielt dreizehn Punkte. Achtunddreißig Punkte auf zwei Händen – ein Großschlemm.
So steht es in den Regeln, Mädchen! »Drei ohne Trumpf« sind fünfundzwanzig, sechsundzwanzig oder siebenundzwanzig Punkte. Plus dreizehn, und heraus kommt ein Großschlemm.
Aber spielte Mr. Farnham nach den Regeln? Oder überreizte er sein Blatt hoffnungslos, weil er um jeden Preis die Runde und diese lächerliche Wette gewinnen wollte?
Wenn sie passte, waren Mr. Farnham das Spiel und die Runde – und damit vierhundert Dollar – sicher. Aber falls sie einen Großschlemm schafften, kämen bei den Einsätzen, um die Duke und sein Vater spielten, fünfzehn Dollar heraus. Sollte sie vierhundert Dollar ihres Partners riskieren, um fünfzehn zu gewinnen? Das war lächerlich!
Konnte sie es mit der Blackwood Convention versuchen? Aber nein, sie hatte nicht viel zu bieten.
War dies etwa eins der Bluff-Gebote, vor denen Duke sie gewarnt hatte?
Andererseits hatte ihr Partner gesagt, sie solle sich an die Regeln halten.
»Sieben ohne Trumpf«, sagte sie entschlossen.
Duke pfiff durch die Zähne. »Danke, Barbara. Jetzt werden wir es dir zeigen, Dad. Kontra.«
»Ich passe.«
»Ich passe«, sagte auch Karen.
Barbara kontrollierte noch einmal ihre Hand. Der einsame König wirkte schrecklich nackt. Aber … entweder, das Team hatte achtunddreißig Punkte, oder eben nicht. »Rekontra.«
Duke grinste. »Danke, meine Süße. Du spielst aus, Karen.«
Mr. Farnham legte abrupt die Karten auf den Tisch und stand auf. »He, komm her und nimm deine Medizin!«, rief sein Sohn.
Mr. Farnham schaltete den Fernseher ein, ging weiter, schaltete auch das Radio ein und wechselte den Sender. »Voralarm!«, rief er. »Ich muss Grace holen.« Er lief aus dem Zimmer.
»Na hör mal, jetzt wo ich am Gewinnen bin«, protestierte Duke.
»Halt den Mund«, fauchte Karen.
Der Bildschirm flackerte. »… Sendungen abgebrochen. Stellen Sie sofort die Notsender ein. Gott möge uns schützen.«
Und als der Bildschirm nur noch eine graue, leere Fläche zeigte, hörten sie die Stimme des Nachrichtensprechers aus dem Radio: »… keine Übung. Ich wiederhole, dies ist keine Übung. Suchen Sie Ihre Bunker auf. Katastrophenpersonal an die Stationen. Gehen Sie nicht auf die Straße. Wenn Sie keinen Bunker besitzen, verbarrikadieren Sie sich im bestgeschützten Raum Ihres Hauses. Dies ist keine Übung. Unbekannte Flugkörper sind auf den Radarschirmen sichtbar. Man muss annehmen, dass es sich um Raketengeschosse handelt. Schützen Sie sich. Katastrophenpersonal an …«
»Er meint es ernst«, sagte Karen leise. »Duke, zeig Barbara den Weg. Ich wecke Joseph.« Sie lief aus dem Zimmer.
»Ich glaub’s nicht«, sagte Duke.
»Duke, wie kommt man in den Bunker?«
»Ich zeige Ihnen den Weg.« Gelassen stand er auf, nahm die Karten und schob jedes Blatt in eine eigene Tasche. »Meine und die meiner Schwester stecken in der Hosentasche, Ihre und Dads Karten sind in der Jacke. Kommen Sie mit. Soll ich Ihren Koffer holen?
»Nein!«
2
Duke führte sie durch die Küche die Kellertreppe hinunter. Mr. Farnham keuchte gerade nach unten. Er trug seine schlafende Frau. Dukes lässige Haltung änderte sich plötzlich. »Warte, Dad. Ich nehme sie dir ab.«
»Mach mir lieber die Tür auf.«
Die Tür bestand aus einer in die Kellerwand eingelassenen Stahlplatte. Sekunden gingen verloren, weil Duke keine Ahnung hatte, wie der Öffnungsmechanismus funktionierte. Schließlich übergab ihm Hubert Farnham Grace und öffnete selbst. Eine Treppe führte noch weiter in die Tiefe. Sie schafften es, indem sie Grace an Armen und Beinen nahmen und sie wie eine steife Puppe durch die zweite Tür in einen Raum schoben. Barbara blieb zurück, während Mrs. Farnham hineingetragen wurde.
Farnham erschien im Eingang. »Barbara! Schauen Sie, dass Sie hereinkommen. Wo sind Karen und Joseph?«
Die beiden kamen die Treppe herunterstürmt. Joseph trug nur sein Unterhemd und lange Hosen. Er war barfuß.
»Mr. Farnham! Ist es ein Ernstfall?«
»Ich fürchte. Beeilt euch.«
Joseph drehte sich um und schrie: »Doktor Livingstone!« Und er raste die Treppen wieder nach oben.
»Ach Gott!«, stöhnte Mr. Farnham und presste die Hände gegen die Schläfen. »Hinein mit euch, Mädchen. Karen, schieb den Riegel vor, aber mach wieder auf, wenn ich klopfe. Ich warte noch fünf Minuten.« Er sah auf seine Uhr.
Die Mädchen betraten den Bunker. »Was ist denn mit Joseph?«, flüsterte Barbara. »Übergeschnappt?«
»Nicht ganz. Doktor Livingstone ist unsere Katze. Sie liebt Joseph heiß und innig, während sie uns andere toleriert.«
Karen machte sich an den Riegeln zu schaffen, doch dann ließ sie die Hände sinken. »Fällt mir nicht ein, solange Dad noch draußen ist.«
Barbara nickte.
»Wer weiß, wo sich dieses Vieh herumtreibt.«
Barbara sah sich um. Sie waren in einem L-förmigen Raum. An der rechten Wand befanden sich zwei Kojen übereinander. Grace Farnham schnarchte in der unteren. An der linken Wand standen vollgestopfte Regale. Nur ein etwa türbreiter Gang war zwischen den Wänden freigelassen. Die niedrige, gewölbte Decke bestand aus gewelltem Stahl. Am Ende des Knicks im Gang konnte sie zwei weitere Kojen sehen. Duke erschien und richtete einen Klapptisch als Kartentisch her. Sie sah erstaunt zu, wie er die Karten, die er mitgenommen hatte, aus der Tasche zog. Wie lange waren sie jetzt hier unten? Es kam ihr vor wie eine Stunde, aber wahrscheinlich waren es nicht einmal fünf Minuten.
Duke schaute zu ihr hin, grinste und stellte Klappstühle rings um den Tisch auf.
An der Tür hörte man ein Pochen. Karen öffnete schnell, und Joseph taumelte herein, gefolgt von Mr. Farnham. Eine große rote Perserkatze sprang von Josephs Arm und ging auf Entdeckungsreise.
»Joseph, hilf mir kurbeln.«
»Ja, Sir.«
Duke kam herüber. »Alles zugeknöpft, Dad?«
»Bis auf die Schiebetür. Sie muss mit der Handkurbel bedient werden.«
»Schön. Dann komm an den Tisch und hol dir deine Abreibung.« Duke deutete auf den provisorischen Spieltisch.
Sein Vater starrte ihn an. »Duke, du willst im Ernst Karten spielen, während wir angegriffen werden?«
»Es geht um vierhundert Dollar. Und noch hundert Dollar drauf, falls wir nicht angegriffen werden. Einverstanden? In einer halben Stunde geben sie Entwarnung, und die Morgenzeitungen schreiben dann, dass die Nordlichter den Radarbeobachtern diesen Streich gespielt haben.«
»Mmmm, meine Partnerin wird für mich spielen müssen. Ich bin beschäftigt.«
»Du gibst ihr also freie Hand?«
»Natürlich.«
Barbara setzte sich wie im Traum an den Tisch. Sie sah ihre und die Karten ihres Partners an. »Karen, du fängst an.«
Karen sagte: »Verfluchter Mist!« und spielte Treff-Drei aus. Duke nahm den Dummy und sortierte die Karten nach Farben. »Womit soll ich bedienen?«, fragte er.
»Ich spiele beide Blätter offen.«
»Lieber nicht.«
»Da kann nichts passieren.« Sie deckte die Karten auf.
Duke betrachtete sie. »Verstehe«, räumte er ein. »Lassen Sie die Blätter liegen, Dad wird das sehen wollen.« Er rechnete kurz nach. »Ich würde sagen, das sind zweitausendvierhundert Punkte. Dad!«
»Ja, Junge?«
»Ich schreibe dir einen Scheck für vierhundert Dollar aus. Es wird mir eine Lehre sein.«
»Du brauchst mir das Geld wirklich nicht …«
In diesem Augenblick gingen die Lichter aus, und der Boden kam auf sie zu. Barbara fühlte einen beängstigenden Druck auf der Brust. Um herum sie war ein Lärm wie an einer U-Bahn-Endstation. Der Boden schaukelte wie bei einem Schiff auf hoher See.
»Dad!«
»Ja, Duke? Bist du verletzt?«
»Ich weiß nicht. Aber der Scheck wird sich auf fünfhundert Dollar erhöhen.«
Das Grollen um sie ließ nicht nach. Barbara hörte Hubert Farnham kichern. »Vergiss es. Der Dollar wurde soeben abgewertet.«
Mrs. Farnham begann zu kreischen. »Hubert! Hubert! Wo bist du? Hubert? Das muss sofort aufhören, verstehst du?«
»Ich komme schon, Liebling.« Ein dünner Lichtfinger bohrte sich durch die Dunkelheit und bewegte sich auf die Kojen neben der Tür zu. Hubert kroch auf Händen und Knien dahin und hielt die Taschenlampe zwischen den Zähnen fest. Er beruhigte Grace, bis sie zu schreien aufhörte. »Karen?«
»Ja, Dad?«
»Alles in Ordnung?«
»Ja, bis auf ein paar blaue Flecken.«
»Schön. Schalt die Notbeleuchtung in deinem Abteil ein. Nicht aufstehen. Dann suchst du die Spritze und bringst sie mir herüber … oh! Joseph?«
»Ja, Sir.«
»Lebst du noch?«
»Alles okay, Boss.«
»Dann überrede doch diesen pelzgesichtigen Falstaff, er möge zu dir kommen. Er sprang mir soeben über den Rücken.«
»Er meint es gut, Boss.«
»Sicher, aber ich kann ihn nicht gebrauchen, wenn ich eine Spritze in der Hand habe. Klar?«
»Klar. Komm her, Doc. Fresschen, Fresschen, Doc!«
Ein paar Minuten später ließ das Grollen nach, der Boden wurde wieder ruhig, Mrs. Farnham hatte eine Spritze bekommen, zwei Notlampen brannten, und Mr. Farnham untersuchte den Schaden.
Trotz der Gitter waren Konserven von den Regalen gefallen. Ein Viertel Rum lief mit einem leisen Glucksen aus. Das Schlimmste war, dass sich das batteriebetriebene Radio aus seiner Verankerung gelöst hatte und am Boden lag – aufgelöst in seine Einzelteile.
Hubert Farnham versuchte die Einzelteile einzusammeln. Duke sah ihm zu. »Das hat doch keinen Sinn, Dad. Kehr den Mist zusammen und wirf ihn in den Abfall.«
»Vielleicht können wir einige Teile ganz retten. Als Ersatzteile.«
»Was verstehst du denn von Radios?«
»Nichts. Aber ich habe Bücher.«
»Was nützt dir ein Buch? Ein Reservegerät wäre besser gewesen.«
»Ich habe eines.«
»Warum, um Himmels willen, holst du es nicht her? Ich möchte endlich wissen, was eigentlich los ist.«
Hubert Farnham stand langsam auf und sah seinen Sohn an. »Ich möchte es auch gerne wissen. Mein Mini-Sender empfängt nichts, aber das ist nicht überraschend. Er hat keine große Reichweite. Das Reservegerät ist mit Schaumstoff verpackt und wahrscheinlich unbeschädigt.«
»Dann schließ es an.«
»Später.«
»Später? Zum Teufel. Wo ist das Ding?«
Mr. Farnham atmete tief durch. »Das reicht mir jetzt aber wirklich.«
»Was? Tut mir leid. Sag mir einfach, wo das Reservegerät ist.«
»Das werde ich nicht tun. Ich will warten, bis ich sicher bin, dass der Angriff vorbei ist.«
»Bitte, wenn du unbedingt Schwierigkeiten machen willst. Aber wenn du mich fragst – es ist ein schäbiger Trick. Wir wollen alle wissen, was los ist.«
»Ich habe dich nicht gefragt. Wenn du unbedingt wissen willst, was draußen los ist, kannst du ja hinausgehen. Ich öffne dir die Tür und kurble sie hinter dir wieder zu. Die obere Tür kannst du selbst aufmachen.«
»Wie? Das ist doch lächerlich.«
»Aber vergiss nicht, sie hinter dir zu verschließen. Wegen der Radioaktivität.«
»Ach ja. Das wollte ich vorhin schon fragen. Hast du Geräte zur Messung der Radioaktivität? Wir müssten …«
»Du hältst den Mund.«
»Dad! Jetzt kehr doch bitte nicht den strengen Vater heraus.«
»Duke, ich bitte dich, mir eine Minute zuzuhören, ja?«
»Bitte sehr. Aber ich verbitte mir, dass du mich in Gegenwart anderer anschnauzt.«
»Dann sprich leiser.« Die anderen hatten sich in den zweiten Raum hinter dem Knick zurückgezogen, und Mrs. Farnham schnarchte friedlich in ihrer Koje. »Wirst du mir jetzt zuhören?«
»Jawohl, Sir«, sagte Duke förmlich.
»Gut. Ich habe nicht gescherzt, mein Sohn. Entweder du gehst … oder du tust genau das, was ich sage. Damit meine ich auch, dass du den Mund hältst, wenn ich es dir befehle. Also, was willst du? Absoluten, freiwilligen Gehorsam? Oder deiner eigenen Wege gehen?«
»Das klingt ein bisschen arrogant.«
»Soll es auch. Der Bunker ist eine Art Rettungsboot, und ich bin der Bootskommandant. Ich fordere Disziplin aus Gründen der Sicherheit. Selbst wenn ich mich gezwungen sehen sollte, jemanden über Bord zu werfen.«
»Das ist ein ziemlich weit hergeholtes Beispiel. Es ist ein Jammer, dass du in der Navy warst, von daher kommen nämlich solche romantischen Vorstellungen.«
»Und ich denke, es ist ein Jammer, dass du nicht gedient hast. Vielleicht würdest du die Dinge dann realistischer sehen. Also, wie sieht’s jetzt aus? Willst du gehorchen oder lieber gehen?«
»Du weißt genau, dass ich nicht gehen werde. Außerdem meinst du das gar nicht ernst. Da draußen wartet der Tod.«
»Also wirst du meinen Befehlen Folge leisten?«
»Ich werde dir nichts in den Weg legen. Aber diese absolute Diktatur … Dad, vorhin hast du ausführlich erklärt, dass du ein freier Mensch bist. Genau das bin ich auch. Ich werde mit dir zusammenarbeiten. Aber ich befolge keine unbegründeten Befehle. Und was das Mundhalten betrifft, werde ich mir da Mühe geben, doch wenn ich es für nötig halte, werde ich schon meine Meinung äußern. Freiheit der Rede. Einverstanden?«
Sein Vater seufzte. »Nein, Duke. Geh zur Seite, damit ich die Kurbel ansetzen kann.«
»Treib den Scherz nicht zu weit, Vater.«
»Ich scherze nicht, ich werfe dich raus.«
»Dad, ich sage so etwas nicht gerne – aber glaubst du nicht auch, dass ich im Notfall stärker wäre als du?«
»Ich habe nicht die Absicht, gegen dich zu kämpfen.«
»Na, dann lassen wir doch diese Diskussion.«
»Duke, ich habe diesen Bunker gebaut. Noch vor einer Stunde hast du darüber gespöttelt, hast gesagt, ich wäre verrückt. Und nun, wo sich herausgestellt hat, dass du im Unrecht warst, möchtest du den Bunker mitbenutzen. Das musst du doch zugeben.«
»Gewiss.«
»Und nun willst du mir sagen, was ich alles machen soll. Ich hätte für ein Reserveradio sorgen sollen. Wofür hast du gesorgt? Kannst du denn wirklich nicht wie ein Mann nachgeben? Schließlich hängt dein Leben von meiner Gastfreundschaft ab.«
»Ich habe doch gesagt, dass ich kooperieren werde.«
»Das tust du aber nicht. Du machst unnütze Bemerkungen, stehst mir im Weg, verschwendest meine Zeit mit Diskussionen, während ich mich mit lebenswichtigen Dingen beschäftigen müsste. Duke, ich kann deine Kooperation, wie du das nennst, nicht brauchen, wenn sie davon abhängt, ob du etwas richtig findest oder nicht. Solange wir in diesem Bunker sind, verlange ich absoluten Gehorsam.«
Duke schüttelte den Kopf. »Mach dir endlich mal klar, dass ich kein Kind mehr bin. Kooperation, ja. Aber mehr kann ich nicht versprechen.«
Mr. Farnham seufzte. »Vielleicht wäre es besser, wenn du die Verantwortung übernimmst und ich gehorche. Aber ich habe mich auf diesen Ernstfall vorbereitet und du nicht. Mein Junge, ich war darauf vorbereitet, dass deine Mutter hysterisch werden würde und hatte alles parat, um damit fertigzuwerden. Glaub nicht, ich wäre nicht auch auf diese Situation vorbereitet.«
»Wie denn das? Es ist doch purer Zufall, dass ich überhaupt hier bin.«
»Ich sagte ›auf diese Situation‹. Es hätte auch jemand anders sein können, Freunde zum Beispiel, die zu Besuch waren, oder auch ein Fremder wie dieser alte Knabe, der vorhin an der Tür geschellt hat. Ich habe den Bunker von vornherein groß genug angelegt. Glaubst du wirklich, bei all dieser Planung wäre mir nie der Gedanke gekommen, es könnte auch irgendjemand mal aus der Reihe tanzen? Und dass ich keine Mittel hätte, die Angelegenheit zu klären?«
»Wie denn?«
ENDE DER LESEPROBE