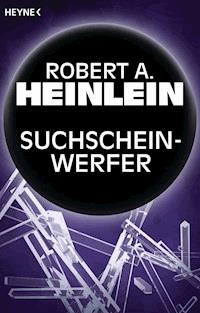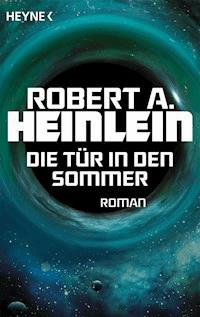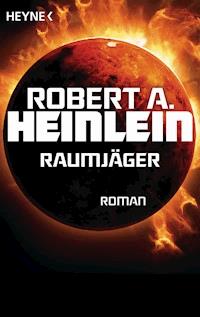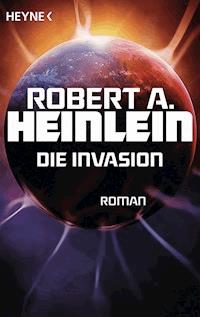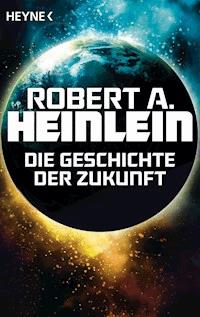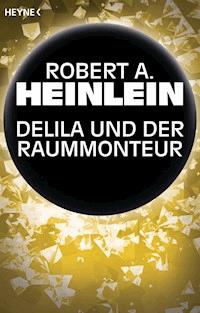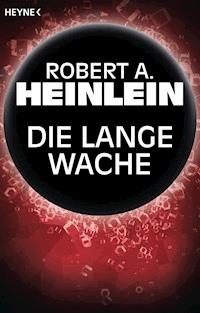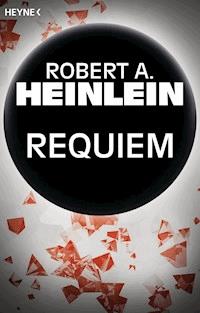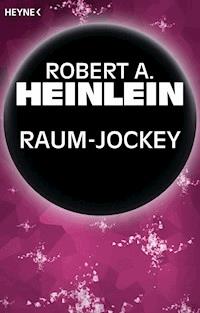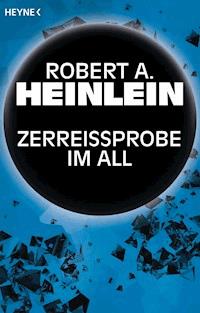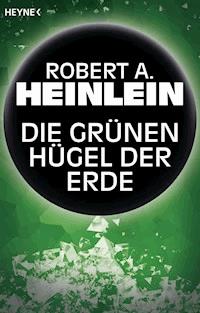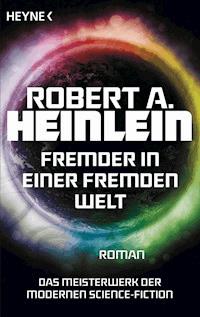
9,99 €
9,99 €
oder
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2009
Der Mann vom Mars
Die erste Mars-Expedition ist auf dem roten Planeten abgestürzt, und erst zwanzig Jahre später erreichen erstmals wieder Menschen den Nachbarplaneten. Sie finden Michael Valentine Smith, einen jungen Mann, der als Kind die Katastrophe überlebt hat und von Marsianern erzogen wurde, und nehmen ihn mit zur Erde. Die Heimatwelt seiner Eltern ist für ihn eine fremde, unverständliche Welt, und er verwendet seine mentalen Kräfte dazu, sie zu verändern. Damit wird er für die einen zum Messias, und für die anderen zu einem Feind, den man mit allen Mitteln bekämpfen muss ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 954
4,5 (38 Bewertungen)
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
FREMDER IN EINER FREMDEN WELT
Widmung
ERSTER TEIL - SEINE BEFLECKTE ABSTAMMUNG
1
2
3
4
Copyright
Das Buch
Die nicht allzu ferne Zukunft: Eine Expedition wird von der Erde zum Mars geschickt, doch das Raumschiff stürzt ab. Zwanzig Jahre später wird eine zweite Expedition gestartet, die auf dem Mars als einzigen Überlebenden der Katastrophe einen jungen Mann namens Valentine Michael Smith findet. Er war als Kind an Bord der ersten Expedition und wurde von Marsianern aufgezogen. Die Erde - auf die er nun zurückgebracht wird - ist für ihn eine fremde, völlig unverständliche Welt, und er verwendet seine mentalen Kräfte, die ihm die Marsianer verliehen haben, darauf, diese Welt nach seinen Vorstellungen zu verändern. Damit wird er für viele zu einer messiasartigen Figur - für andere jedoch zu einer Gefahr, die man mit allen Mitteln bekämpfen muss …
»Fremder in einer fremden Welt« zählt neben Klassikern der Zukunftsliteratur wie »Schöne neue Welt«, »1984« oder »Fahrenheit 451« zu den bedeutendsten Science-Fiction-Romanen des 20. Jahrhunderts. Eine Parabel auf das Wesen Mensch, erzählt aus der Sicht eines »Fremden«, der womöglich menschlicher ist als wir alle zusammen.
Der Autor
Robert A. Heinlein, 1907 in Butler, Missouri geboren, war einer der erfolgreichsten und inhaltlich wirksamsten Science-Fiction-Autoren aller Zeiten. Sein umfangreiches Werk hat sich millionenfach verkauft, und seine Ideen und Figuren haben Eingang in die Weltliteratur gefunden. »Fremder in einer fremden Welt« erschien erstmals 1961 und wurde ein internationaler Bestseller. Heinlein starb 1988.
_Vorwort_
von John Scalzi
Sie halten ein hochinteressantes Objekt in Ihren Händen. Klar: Eine Ausgabe von »Fremder in einer fremden Welt« von Robert A. Heinlein - aber das wissen Sie ja. Wahrscheinlich ist Ihnen auch bekannt, dass Sie damit den vielleicht berühmtesten - manche würden sogar sagen, den vielleicht bedeutendsten - Science-Fiction-Roman der letzten fünfzig Jahre vor sich haben. Doch es handelt sich nicht um die Fassung des Romans, der dieser Ruhm zu verdanken ist. Auch nicht die Fassung, die 1962 mit dem Hugo Award ausgezeichnet wurde. Tatsächlich halten Sie hier die Geschichte in der Hand, die Heinlein laut seiner Frau Virginia von Anfang an hatte erzählen wollen, was er damals, in den 60er Jahren, aber nicht durfte: die vollständige, ungeschnittene Fassung - und damit die Geschichte, die Heinleins eigenen Vorstellungen von seinem Roman am nächsten kommt.
Eine hochinteressante Sache, zweifellos. Aber liest sich unser neuer alter Roman auch gut? Und ist dies wirklich die bessere Version von »Fremder in einer fremden Welt«?
Die erste Frage lässt sich leicht beantworten: Ja, der Roman liest sich gut, kein bisschen schlechter als die frühere Fassung. Dabei ist der Text in dieser Form etwa 70.000 Wörter länger (auf Englisch), was 1961, als er zum ersten Mal veröffentlicht wurde, für ein komplettes eigenständiges Buch gereicht hätte. Aus diesem Grund wurden die Kürzungen auch ursprünglich vorgenommen: Der Roman war für damalige Verhältnisse einfach zu lang. Es geht hier also um eine unglaubliche Menge Wörter - aber zugleich geht es um Robert A. Heinleins Worte. Eine der größten Stärken dieses Autors war sein Geschick, die Erzählung stets voranzutreiben, den Leser auf unterhaltsamste Art und Weise mitzureißen. Ja, die ungekürzte Fassung von »Fremder in einer fremden Welt« ist etwa fünfzig Prozent länger, aber sie fühlt sich nicht zähflüssig oder unnötig ausführlich an - was ganz einfach daran liegt, dass Heinlein die Sprache gekonnt dazu verwendet, die Geschichte in Gang zu bringen und dann stetig in Gang zu halten. Keine Sorge also: Der Roman liest sich gut, so oder so. Ganz egal, ob Sie ihn zum ersten Mal lesen oder ob Sie sich dafür interessieren, welche Unterschiede es zur früheren Version gibt - Sie werden sich bestimmt nicht langweilen. Aber damit haben wir leider nur die einfachere der beiden Fragen hinter uns gebracht. Die andere lautet: Ist diese Fassung von »Fremder in einer fremden Welt« besser als die von 1961, die so viele von uns gelesen haben? Ist dies die definitive Version dieser heiß geliebten Geschichte?
In diesem Punkt will ich mich nicht festlegen und sage daher: Jein.
Heinleins Frau Virginia hat dieselbe Frage mit einem klaren Ja beantwortet - eben weil ihr Mann damals den ausführlicheren Text veröffentlicht hätte, wenn der Verlag nicht dagegen gewesen wäre. Ich will ihr nicht widersprechen, denn sie war die Gefährtin und Vertraute ihres Mannes, ich dagegen bin nichts weiter als ein Schriftsteller, dem man damit schmeichelt, dass seine Arbeit mit der des Altmeisters verglichen wird. Virginia Heinlein kannte ihren Robert besser als irgendwer sonst auf der Welt; ich durfte ihn nur lesen. Trotzdem will ich festhalten, dass die Fassung aus dem Jahr 1961 weder eine Beleidigung des Originals darstellte noch unvollständig war, auch wenn Heinlein selbst den längeren Text gewählt hätte. Zwar war es der Verlag, der damals eine Kürzung von 220.000 Wörter auf 150.000 Wörter verlangte, aber der Autor hat den Text selbst gekürzt, überarbeitet und umgestellt. Heinlein behielt also die Kontrolle über die endgültige Form seines Werks. Natürlich schrumpfte das Buch - doch im Großen und Ganzen ging dies auf Kosten der Wörter, nicht auf Kosten des »Gehalts«. Jedes wichtige Ereignis des Originalmanuskripts - also der Fassung, die Sie lesen werden - schaffte es auch in die Schnittfassung von 1961. Es wurde gestrafft, neu arrangiert, und manche Gedanken fanden sich in Ecken gedrängt wieder, doch es fiel nichts unter den Tisch. Und der Text funktionierte - nicht zuletzt weil Heinlein durch den Zwang zur Überarbeitung die Ideen, die er transportieren, und die Figuren, denen er sie in den Mund legen wollte, abermals überprüfen musste. Eine echte Herausforderung für einen Schriftsteller: Ist es möglich, einen Roman zusammenzustutzen und gleichzeitig seine Essenz zu bewahren - nicht nur das Handlungsgerüst, sondern auch die Charakterzeichnungen, die Ideen, den grundlegenden Stil? Dieser Aufgabe sah sich Heinlein gegenüber, er stellte sich ihr und lieferte schließlich eine kunstvoll komprimierte Fassung seines ursprünglichen Werks ab. Deshalb fällt es mir schwer, die längere Version des Romans als »definitiv« zu bezeichnen. Heinlein leistete so gute Arbeit beim Redigieren, dass die entscheidenden Elemente des Romans in beiden Fassungen vollständig vertreten sind. Welche Version man bevorzugt, ist also Geschmackssache.
Lassen Sie mich verdeutlichen, was ich meine - am besten anhand der ersten Zeilen der beiden Fassungen. Zunächst die aus dem Jahr 1961:
Es war einmal ein Marsianer namens Valentine Michael Smith.
Und nun die »ungeschnittene« Version:
Es war einmal vor langer, langer Zeit, da lebte ein Marsianer namens Smith. Dass es Valentine Michael Smith tatsächlich gab, lässt sich ebenso wenig leugnen wie die Existenz zu hoher Steuern.
Welche Fassung ist besser? Was die enthaltenen Informationen angeht, nehmen sie sich nicht viel: »Es war einmal« signalisiert jeweils, dass diese Geschichte gewissermaßen ein Märchen darstellt. Danach erfahren wir, dass es einen Marsianer gibt, der einen sehr menschlichen Namen trägt. Auch stilistisch gesehen sind beide Fassungen bewundernswert - jedoch aus unterschiedlichen Gründen: Die Version von 1961 ist knackig, auf den Punkt gebracht und (zumindest im Englischen) noch dazu jambisch, klingt also wie ein Singsang, der dem Leser sofort das Gefühl vermittelt, eine Geschichte erzählt zu bekommen. Die ungekürzte Fassung ist länger, opulenter (»vor langer, langer Zeit«) und schalkhafter (»die Existenz zu hoher Steuern«). Welche ist besser? Sagen Sie’s mir! Manchmal gefällt mir die kürzere Version besser, manchmal die längere. Ganz egal, wie man sich entscheidet: In beiden Fällen macht die Geschichte da weiter, wo sie angefangen hat. Einen Vorteil hat die längere Fassung von »Fremder in einer fremden Welt« allerdings: Sie steht Heinlein selbst näher. Dadurch ist sie nicht automatisch besser oder »definitiver« - Gott weiß, dass es mehr als genug Autoren gibt, deren Texte davon profitiert hätten, wenn ein Lektor etwas rigoroser mit ihnen umgesprungen wäre. Der gefährlichste Moment in der Laufbahn eines Schriftstellers ist ohnehin nicht, wenn man um die erste Veröffentlichung kämpft, sondern wenn man so erfolgreich geworden ist, dass man der Meinung ist, kein Lektorat mehr zu benötigen. Heinlein trug bekanntlich so manchen Kampf mit seinen Lektoren aus (besonders mit jener, die für seine Jugendromane zuständig war), aber selbst ihm ist durch Lektorenhand hin und wieder Gutes widerfahren. Wie dem auch sei, für die Leser, die an der Vorstellung hängen, dass die »Gestalt« eines Romans die Gedanken des Autors mehr oder weniger nachvollzieht, ist die ungekürzte Fassung von »Fremder in einer fremden Welt« eine wahre Entdeckung. Es ist die Geschichte, wie Heinlein sie zuerst entworfen und niedergeschrieben hat, und für mich persönlich ist es diese Tatsache - dass ich damit dem Geschichtenerzähler ein Stück näher komme -, die der längeren Version des Romans ihren Reiz verleiht. Und welche Fassung ist jetzt besser? Welche ist die »definitive«? Ich würde sagen: Lesen Sie beide Versionen und entscheiden Sie dann selbst. Doch um Robert A. Heinlein ein bisschen besser kennenzulernen, lese ich das Buch, das Sie gerade in der Hand halten. Vielleicht wird es Ihnen ja gehen wie mir. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Spaß dabei!
John Scalzi ist einer der populärsten amerikanischen Science-Fiction-Autoren der jungen Generation. Sein Bestseller »Krieg der Klone« steht ganz in der Tradition Robert A. Heinleins.
FREMDER IN EINER FREMDEN WELT
Für Robert Cornog Fredric Brown Philip José Farmer
Bitte beachten Sie: Alle Personen, Götter und Planeten in dieser Geschichte sind fiktiv. Jede Übereinstimmung von Namen wird bedauert.
Robert A. Heinlein
ERSTER TEIL
SEINE BEFLECKTE ABSTAMMUNG
1
Es war einmal vor langer, langer Zeit, da lebte ein Marsianer namens Smith.
Dass es Valentine Michael Smith tatsächlich gab, lässt sich ebenso wenig leugnen wie die Existenz zu hoher Steuern. Die erste menschliche Expedition zum Mars wurde nach der Theorie zusammengestellt, die größte Gefahr für den Menschen sei der Mensch. Zu jener Zeit, acht Jahre nach Gründung der ersten menschlichen Kolonie auf Luna, war eine von Menschen durchgeführte interplanetare Reise nur auf Umlaufbahnen im Freien Fall möglich - von der Erde zum Mars in zweihundertachtundfünfzig terranischen Tagen plus einer Wartezeit von vierhundertfünfundfünfzig Tagen auf dem Mars, während die Planeten weiterkrochen, bis sie die für die Rückkehr-Bahn günstigen Positionen erreicht hatten. Ein ausgesprochen langwieriges Verfahren.
Die Reise war jedoch nicht nur elend lang, sondern auch äußerst risikoreich. Nur indem sie an einer Raumstation auftankte und anschließend fast wieder in die Erdatmosphäre hineinfiel, konnte dieser primitive fliegende Sarg, die Envoy, die Reise überhaupt schaffen. Hatte sie den Mars einmal erreicht, würde sie unter Umständen auch zurückkehren - falls sie nicht abstürzte, falls Wasser gefunden wurde, um ihre Reaktionstanks nachzufüllen, falls tausend Dinge nicht schiefgingen.
Man war sich jedoch bewusst, dass die physischen Gefahren bei weitem nicht so groß waren wie die psychischen. Acht Menschen, die beinahe drei terranische Jahre lang zusammengepfercht waren, mussten unbedingt besser miteinander auskommen können, als es unter Menschen im Allgemeinen üblich ist. Eine rein männliche Crew wurde als ungesund und unstabil abgelehnt. Als optimale Lösung betrachtete man vier verheiratete Paare, sofern es möglich war, die notwendigen Spezialkenntnisse in einer solchen Kombination zusammenzufügen.
Die Universität von Edinburgh, die Hauptunternehmerin, übertrug dem Institut für Sozialwissenschaften als Subunternehmer die Auswahl der Crew. Nachdem das Institut Freiwillige aussortiert hatte, die wegen Alter, Gesundheitszustand, Mentalität, Ausbildung oder Temperament ungeeignet waren, blieben ihm neuntausend mögliche Kandidaten. Jeder von ihnen entsprach sowohl körperlich als auch geistig den Anforderungen. Es war die Aufgabe des Instituts, mehrere annehmbare Crews mit je vier Paaren vorzuschlagen.
Eine solche Crew wurde niemals gefunden.
Die benötigten Berufe waren Astrogator, Arzt, Koch, Maschinist, Schiffskommandant, Semantiker, Chemiker, Elektroniker, Physiker, Geologe, Biochemiker, Biologe, Atomwissenschaftler, Fotograf, Hydroponiker, Raketeningenieur. Jeder sollte mehr als einen dieser Berufe beherrschen. Zumindest sollte er dazu fähig sein, einen anderen in angemessener Zeit zu erlernen. Es gab Hunderte von Kombinationen aus acht Freiwilligen, die die entsprechenden Kenntnisse besaßen, und darunter drei, die aus verheirateten Paaren bestand - aber in allen drei Fällen rangen die Psychodynamiker, die die Verträglichkeitsfaktoren bewerteten, vor Entsetzen die Hände. Die Hauptunternehmerin regte an, den vorgegebenen Kompatibilitätswert herabzusetzen; das Institut erbot sich, sein Honorar von einem Dollar zurückzugeben. In der Zwischenzeit sollte eine Computerprogrammiererin, deren Name nirgendwo verzeichnet ist, eine Rumpfmannschaft aus je drei Paaren zusammenstellen. Sie fand mehrere Dutzend kompatibler Kombinationen. Jede wurde durch ihre eigenen individuellen Merkmale charakterisiert, die sie zum Gelingen der Operation benötigten.
Die Computer fuhren fort, ihre Daten zu sichten, die sich durch Todesfälle, Rücktritte und neue Freiwillige änderten. Captain Michael Brant, Magister der Naturwissenschaften, Pilot und im Alter von dreißig Jahren Mondflug-Veteran, hatte einen direkten Draht zum Institut. Seine Kontaktperson schlug für ihn Namen von ledigen weiblichen Freiwilligen nach, die (mit Brant!) eine Crew vervollständigen könnten, und paarte seinen Namen dann mit diesen, um mithilfe der Maschinen Probleme durchzuspielen, und so herauszufinden, ob eine Kombination akzeptabel wäre. Dies hatte zur Folge, dass Captain Brant nach Australien jettete und Dr. Winifried Coburn, einer unverheirateten, pferdegesichtigen Semantikerin, die überdies neun Jahre älter war als er, einen Heiratsantrag machte. Die Carlsbad-Archive zeigen sie als eine humorvolle Frau, der jedoch jegliche Attraktivität fehlte.
Vielleicht handelte Brant auch, ohne irgendwelche InsiderInformationen zu haben. Stattdessen verließ er sich ausschließlich auf jene intuitive Dreistigkeit, die man braucht, um ein derartiges Unternehmen kommandieren zu können.
Lichter blinkten, Lochkarten sprangen heraus, eine Crew war gefunden worden:
Captain Michael Brant, 32, Kommandant - Pilot, Astrogator, Vertreter der Köchin, Vertreter des Fotografen, Raketeningenieur.
Dr. Winifried Coburn Brant, 41 - Semantikerin, praktisch ausgebildete Krankenschwester, Lagerverwalterin, Historikerin,
Mr. Francis X. Seeney, 28 - stellvertretender Kommandant, Zweiter Pilot, Astrogator, Astrophysiker, Fotograf,
Dr. Olga Kovalic Seeney, 29 - Köchin, Biochemikerin, Hydroponikerin,
Dr. Ward Smith, 45 - Arzt und leitender Sanitätsoffizier, Biologe,
Dr. Mary Jane Lyle Smith, 26 - Atomingenieurin, Elektronikerin und Energietechnikerin,
Mr. Sergei Rimsky, 35 - Elektroniker, Chemotechniker, verantwortlich für Maschinen und Instrumente, Kryologe,
Mrs. Eleonora Alvarez Rimsky, 32 - Geologin und Selenologin, Hydroponikerin.
Diese Leute besaßen alle erforderlichen Kenntnisse, von denen einige in den Wochen vor der Abreise durch intensives Büffeln erworben worden waren. Wichtiger als das, sie waren gegenseitig kompatibel.
Vielleicht sogar zu kompatibel.
Die Envoy startete. In den ersten Wochen konnten ihre Sendungen von Privatleuten aufgefangen werden. Als die Signale schwächer wurden, verstärkten Radiosatelliten der Erde sie. Die Crew schien gesund und glücklich zu sein. Ringwurm war das Schlimmste, womit Dr. Smith sich zu befassen hatte. Alle gewöhnten sich an den Freien Fall und brauchten nach der ersten Woche keine Medikamente gegen Übelkeit mehr. Falls Captain Brant disziplinarische Probleme hatte, meldete er sie nicht.
Die Envoy erreichte eine Parkbahn innerhalb des Phobos-Orbits und verbrachte zwei Wochen mit einer fotografischen Erkundung. Dann funkte Captain Brant: »Wir werden morgen um 12.00 Uhr Greenwich-Sternzeit am Südrand des Lacus Soli landen.«
Es kam keine weitere Botschaft mehr.
2
Ein irdisches Vierteljahrhundert verging, ehe der Mars wieder von Menschen besucht wurde. Sechs Jahre nachdem die Envoy verstummt war, überquerte die unbemannte Sonde Zombie, finanziert von La Société Astronautique Internationale, die Leere, ging für die Wartezeit in eine Umlaufbahn und kehrte dann zurück. Fotografien, die das Robotfahrzeug aufgenommen hatte, zeigten ein nach menschlichen Begriffen wenig einladendes Land. Seine Instrumente bestätigten, dass die marsianische Atmosphäre dünn und für menschliches Leben ungeeignet ist.
Aber die Bilder der Zombie bewiesen, dass die »Kanäle« technische Leistungen waren, und andere Einzelheiten wurden als Ruinen von Städten interpretiert. Man hätte eine bemannte Expedition losgeschickt, wäre nicht der Dritter Weltkrieg dazwischengekommen.
Eine Folge von Krieg und Aufschub war jedoch auch, dass die nächste Expedition mit besseren Aussichten startete als die verschwundene Envoy. Das Föderationsschiff Champion legte den Weg mithilfe des Lyle-Antriebs in neunzehn Tagen zurück. Es hatte eine rein männliche Crew aus achtzehn Raumfahrern und beförderte dreiundzwanzig männliche Pioniere. Es landete südlich vom Lacus Soli, da Captain von Tromp beabsichtigte, nach der Envoy zu suchen. Die zweite Expedition berichtete täglich; drei Meldungen waren von besonderem Interesse. Die erste lautete:
»Raketenschiff Envoy gefunden. Keine Überlebenden.« Die zweite: »Der Mars ist bewohnt.«
Die dritte: »Berichtigung von Meldung 23-105. Ein Überlebender der Envoy gefunden.«
3
Captain Willem van Tromp war von humaner Gesinnung. Er funkte voraus: »Meinem Passagier darf auf keinen Fall ein Empfang in aller Öffentlichkeit bereitet werden. Bitte Niedrig-g-Fähre, Bahre und Ambulanz bereitstellen, dazu bewaffnete Wache.«
Er schickte seinen Schiffsarzt mit, der sich vergewisserte, dass Valentin Michael Smith in einer Suite des Medizinischen Zentrums »Bethesda« untergebracht, in ein Wasserbett gelegt und vor Kontakten von außen geschützt wurde. Van Tromp selbst ging zu einer außerordentlichen Sitzung des Hohen Rates der Föderation.
Als Smith ins Bett gehoben wurde, erklärte der Hohe Minister für Wissenschaft soeben: »Sicher, Captain, ich räume ein, dass Ihre Autorität als Kommandeur einer Expedition, die nichtsdestotrotz wissenschaftlicher Natur war, Ihnen das Recht gibt, zum Schutz einer vorübergehend in Ihrer Obhut befindlichen Person medizinische Dienstleistungen anzuordnen, aber ich verstehe nicht, wieso Sie jetzt meinen, sich in meinen Zuständigkeitsbereich einmischen zu müssen. Smith ist schließlich eine Fundgrube wissenschaftlicher Information!« »Das will ich meinen, Sir.«
»Warum bestehen Sie dann …« Der Wissenschaftsminister wandte sich dem Hohen Minister für Frieden und Sicherheit zu. »David? Diese Angelegenheit fällt nun offensichtlich in meinen Zuständigkeitsbereich. Würden Sie bitte Ihren Leuten die entsprechenden Anweisungen geben? Schließlich kann man Professor Tiergarten und Dr. Okajima, um nur zwei zu nennen, nicht zumuten, dass sie sich die Beine in den Bauch stehen.«
Der Friedensminister antwortete nicht, sondern wandte sich mit einem fragenden Blick an Captain van Tromp. Der Captain schüttelte den Kopf.
»Warum?«, wiederholte der Wissenschaftsminister. »Sie geben zu, dass er nicht krank ist.«
»Geben Sie dem Captain eine Chance, Pierre«, riet der Friedensminister. »Nun, Captain?«
»Smith ist nicht krank«, sagte Captain van Tromp, »aber er ist auch nicht gesund. Er ist noch nie in einem Ein-g-Feld gewesen. Er wiegt zweieinhalbmal so viel, wie er es gewöhnt ist, und seine Muskeln sind dem nicht gewachsen. Er ist nicht an erdnormalen Druck gewöhnt. Er ist an gar nichts gewöhnt, und die Anstrengung ist für ihn zu groß. Teufel nochmal, meine Herren, ich bin selbst hundemüde - und ich bin auf diesem Planeten geboren!«
Der Wissenschaftsminister blickte verächtlich drein. »Wenn die Beschleunigungsermüdung Ihnen Sorge macht, seien Sie versichert, mein lieber Captain, dass wir das vorausgesehen haben. Seine Atmung und sein Puls werden sorgfältig überwacht. Auch wir können uns vorstellen, wie es da draußen ist, und ziehen die Konsequenzen daraus. Schließlich bin ich selbst draußen gewesen. Ich weiß, wie man sich dabei fühlt. Dieser Mensch muss …«
Captain van Tromp fand, es sei an der Zeit, einen Koller zu bekommen. Das konnte er mit seiner eigenen sehr realen Ermüdung entschuldigen; ihm war, als sei er soeben auf Jupiter gelandet. Er war sich vollkommen im Klaren darüber, dass sogar ein Mitglied des Hohen Rates nicht allzu barsch mit dem Mann umgehen konnte, der die erste erfolgreiche Expedition auf den Mars geleitet hatte.
Also unterbrach er: »Kchnh! ›Dieser Mensch‹ - dieser ›Mensch‹! Begreifen Sie nicht, dass er keiner ist?«
»Hä?«
»Smith … ist … kein … Mensch!«
»Das müssen Sie erklären, Captain.« »Smith ist ein intelligentes Wesen mit menschlichen Vorfahren, aber er ist mehr Marsianer als Mensch. Bis wir kamen, hatte er noch nie einen Menschen gesehen. Er denkt wie ein Marsianer, er fühlt wie ein Marsianer. Er ist von einer Rasse aufgezogen worden, die mit uns nichts gemein hat - sie haben nicht einmal Sex. Smith hat noch nie in seinem Leben eine Frau gesehen. Und daran hat sich auch noch nichts geändert, wenn meine Befehle befolgt wurden. Er ist ein Mensch nach seiner Abstammung, ein Marsianer nach seiner Umwelt. Wenn Sie ihn in den Wahnsinn treiben und diese ›Fundgrube‹ verschwenden wollen, rufen Sie Ihre doofen Professoren nur herein. Geben Sie Smith keine Chance, sich an diesen Irrenhaus-Planeten zu gewöhnen. Mich geht das nichts an; ich habe meine Aufgabe erfüllt!«
Das Schweigen wurde von Generalsekretär Douglas gebrochen. »Und Sie haben gute Arbeit geleistet, Captain. Wir werden Ihren Rat beherzigen. Seien Sie versichert: Wir werden nichts Übereiltes tun. Wenn dieser Mensch oder menschliche Marsianer ein paar Tage braucht, um sich einzugewöhnen, bin ich überzeugt, dass die Wissenschaft warten kann. Also immer mit der Ruhe, Pete. Lassen Sie uns diesen Teil der Diskussion beenden und uns anderen Themen zuwenden. Captain van Tromp ist müde.«
»Eines kann nicht warten«, erklärte der Minister für die Information der Öffentlichkeit.
»Was, Jock?«
»Wenn wir den Mann vom Mars nicht sehr bald in den Stereo-Tanks zeigen, kommt es zu Aufständen, Herr Generalsekretär.«
»Hmm - Sie übertreiben, Jock. Natürlich wird in den Nachrichten etwas über die Marsgeschichte kommen. Ich, wie ich dem Captain und seiner Crew Orden verleihe - morgen, glaube ich. Captain van Tromp berichtet über seine Erlebnisse - nachdem Sie sich gut ausgeschlafen haben, Captain.«
Der Informationsminister schüttelte den Kopf.
»Reicht das nicht, Jock?«
»Die Öffentlichkeit hatte sich darauf gespitzt, dass sie einen echten, lebendigen Marsianer mitbringen. Das haben sie nicht getan, und deshalb brauchen wir Smith, und zwar dringend.«
»Lebendige Marsianer?« Generalsekretär Douglas wandte sich an Captain van Tromp. »Sie haben Filmaufnahmen von Marsianern?«
»Tausende von Fuß.«
»Da haben Sie die Lösung, Jock. Wenn Sie live nicht viel zu bieten haben, greifen Sie zu Aufnahmen. Die Leute werden es lieben. Was nun die Exterritorialität angeht, Captain: Sie sagen, die Marsianer seien nicht feindlich eingestellt?«
»Das sind sie nicht, Sir - aber uns freundlich gesonnen sind sie auch nicht.« »Ich kann Ihnen nicht folgen.«
Captain van Tromp kaute auf der Unterlippe. »Sir … wie soll ich es Ihnen erklären … ein Gespräch mit einem Marsianer ist, als rede man mit einem Echo. Man bekommt keinen Widerspruch, aber man bekommt auch keine Resultate.«
»Verständnisschwierigkeiten? Vielleicht hätten Sie - Wie heißt er gleich? - Ihren Semantiker mitbringen sollen. Oder wartet er draußen?«
»Mahmoud, Sir. Dr. Mahmoud fühlt sich nicht wohl. Ein - ein leichter Nervenzusammenbruch, Sir.« Das moralische Äquivalent, dachte van Tromp bei sich, war »stockbesoffen«.
»Raumselig?«
»Ein bisschen vielleicht.« Diese verdammten Erdschweine!
»Na, schleppen Sie ihn an, wenn es ihm wieder besser geht. Ich könnte mir vorstellen, dass der junge Smith ebenfalls eine Hilfe sein wird … als Dolmetscher vielleicht.«
»Vielleicht«, antwortete van Tromp zweifelnd.
Der junge Smith war eifrig damit beschäftigt, am Leben zu bleiben. Sein Körper, der von der seltsamen Form des Raums an diesem unglaublichen Ort unerträglich zusammengepresst und geschwächt wurde, erhielt endlich Erleichterung durch die Weichheit des Nestes, in das diese anderen ihn legten. Er brauchte sich nicht mehr anzustrengen, ihn aufrechtzuhalten, und wandte seine dritte Ebene seiner Atmung und seinem Herzschlag zu.
Er sah, dass er kurz davor war, sich selbst zu verzehren. In dem Versuch, mit dem Druck des Raums fertigzuwerden, arbeiteten seine Lungen so schwer, wie sie es zu Hause taten, raste sein Herz, um den Zufluss zu verteilen - und all das, während er von einer giftig dichten und gefährlich heißen Atmosphäre erstickt wurde. Jetzt unternahm er etwas dagegen. Schließlich schlug sein Herz nur noch zwanzigmal in der Minute, und seine Atmung war kaum mehr wahrzunehmen. Er wartete, bis er sicher war, dass er nicht dekarnieren werde, während seine Aufmerksamkeit anderswo weilte. Dann ließ er einen Teil seiner zweiten Ebene Wache halten und zog den Rest von sich zurück. Es war notwendig, die Struktur dieser vielen neuen Ereignisse zu analysieren, um sie an sich anzupassen, sie zu lieben und zu preisen - damit sie ihn nicht verschluckten.
Wo sollte er beginnen? Bei seiner Abreise von zu Hause, als er diese anderen, die jetzt seine Nestlinge waren, umfangen hatte? Oder bei seiner Ankunft in diesem zusammengepressten Raum? Er wurde plötzlich von den Lichtern und Geräuschen dieser Ankunft attackiert, fühlte sie mit gehirnerschütterndem Schmerz. Nein, er war nicht bereit, diese Konfiguration zu umfangen - zurück! zurück! Zurück über den ersten Anblick dieser anderen hinaus, die jetzt sein Eigen waren. Zurück noch über die Heilung hinaus, die dem ersten Groken gefolgt war, dass er nicht war wie seine Nestlingsbrüder … zurück zum Nest selbst.
Sein Denken enthielt keine irdischen Symbole. Er hatte jüngst gelernt, einfaches Englisch zu sprechen, doch mit weniger Geschick als ein Hindu, der in dieser Sprache mit einem Türken Handel treibt. Smith benutzte Englisch etwa wie ein Codebuch; er übersetzte mühsam und unvollkommen. Jetzt entfernten sich seine Gedanken - Abstraktionen einer fantastisch fremdartigen Kultur, gewachsen in einer halben Million Jahren - so weit von menschlichen Erfahrungen entfernt, dass sie unübersetzbar wurden.
Dr. Thaddeus spielte im Nebenzimmer Cribbage mit Tom Meechum, Smiths Privatpfleger. Thaddeus hielt dabei ein Auge auf seine Anzeigen und Messgeräte. Nicht ein einziger Herzschlag seines Patienten entging seiner Aufmerksamkeit. Als ein Licht statt zweiundneunzigmal in der Minute weniger als zwanzigmal zu flackern begann, eilte er in Smith’ Zimmer, Meechum ihm auf den Fersen.
Der Patient schwebte in der flexiblen Haut des Wasserbettes. Er sah aus wie tot. Thaddeus fluchte kurz und befahl: »Holen Sie Dr. Nelson!« »Jawohl, Sir!« Meechum zögerte. »Was ist mit den Elektroschockgeräten?«
»Holen Sie Dr. Nelson!«
Der Pfleger schoss hinaus. Der Krankenhausarzt untersuchte den Patienten, ohne ihn zu berühren. Er war immer noch damit beschäftigt, als ein älterer Arzt den Raum betrat. Er ging unbeholfen wie ein Mann, der lange im Raum gewesen ist und sich an die hohe Schwerkraft noch nicht wieder gewöhnt hat. »Nun, Doktor?«
»Atmung, Temperatur und Puls des Patienten sind vor zwei Minuten plötzlich gesunken, Sir.«
»Was haben Sie gemacht?«
»Nichts, Sir. Ihre Anweisungen …«
»Gut.« Nelson besah sich Smith, studierte die Instrumente hinter dem Bett, die Zwillinge jener im Beobachtungsraum. »Geben Sie mir Bescheid, wenn irgendeine Veränderung auftritt.« Er wandte sich zum Gehen.
Das erschreckte Thaddeus. »Aber, Doktor …«
»Ja, Doktor?«, gab Nelson zurück. »Wie lautet Ihre Diagnose?«
»Äh, ich möchte mich über Ihren Patienten lieber nicht äußern, Sir.«
»Ich habe Sie nach Ihrer Diagnose gefragt.«
»Sehr wohl, Sir. Schock - atypisch vielleicht«, schränkte er ein, »aber Schock, der zum Exitus führen wird.«
Nelson nickte. »Logisch. Das hier ist jedoch kein logischer Fall. Ich habe den Patienten ein Dutzend Mal in diesem Zustand gesehen. Passen Sie auf!« Nelson hob Smith’ Arm, ließ ihn los. Der Arm blieb, wo er war.
»Katalepsie?«, fragte Thaddeus.
»Nennen Sie es so, wenn Sie wollen. Auch wenn Sie einen Schwanz als Bein bezeichnen, ist er immer noch keiner. Machen Sie sich keine Sorgen, Doktor. Es gibt nichts Normales in diesem Fall. Bewahren Sie ihn nur davor, dass er belästigt wird, und rufen Sie mich, wenn es eine Veränderung gibt.« Er legte Smith’ Arm zurück.
Nelson ging. Thaddeus betrachtete den Patienten, schüttelte den Kopf und begab sich wieder in den Beobachtungsraum.
Meechum nahm seine Karten auf. »Spielen wir?«
»Nein.«
»Doc«, meinte Meechum, »wenn Sie mich fragen, der ist vor morgen früh ein Fall für die Blechwanne.« »Es hat Sie aber niemand gefragt. Gehen Sie, und rauchen Sie mit den Wachtposten eine Zigarette. Ich möchte nachdenken.«
Meechum zuckte die Achseln und schlenderte auf die Wachen im Korridor zu. Die zuckten zusammen, dann sahen sie, wer er war, und entspannten sich. Der größere der beiden Marines fragte: »Um was ging die Aufregung?«
»Der Patient bekam Fünflinge, und wir stritten darüber, wie sie heißen sollen. Wer von euch Affen hat eine Kippe? Und Feuer?«
Der andere Marine zog ein Päckchen Zigaretten hervor. »Wie seid ihr für einen Schwangerschaftsabbruch ausgerüstet?«
»Mittelmäßig.« Meechum steckte sich die Zigarette ins Gesicht. »Wirklich und wahrhaftig, Gentlemen, ich weiß gar nichts über diesen Patienten. Ich wünschte, es wäre anders.«
»Was hat denn der Befehl ›Absolut keine Frauen‹ zu bedeuten? Ist er sexbesessen?«
»Ich weiß nur, dass man ihn von der Champion hergebracht und gesagt hat, er müsse absolute Ruhe haben.«
»Von der Champion!«, rief der erste Marine. »Das erklärt alles.« »Erklärt was?« »Ist doch klar! Er hat keine gehabt, er hat keine gesehen, er hat keine berührt - seit Monaten nicht mehr. Und er ist krank, kapiert? Sie fürchten, wenn er eine in die Finger kriegt, bringt er sich damit um.« Er zwinkerte. »Ich würde darauf wetten. Jedenfalls würde ich das tun, wenn ich an seiner Stelle wäre. Kein Wunder, dass sie die Miezen von ihm fernhalten wollen.«
Smith hatte die Ärzte wahrgenommen, aber gegrokt, dass ihre Absichten gut waren. Es war nicht notwendig, dass der größere Teil von ihm zurückgeholt wurde.
Zu der morgendlichen Stunde, als menschliche Pfleger Patientengesichter unter dem Vorwand, sie zu waschen, mit nassen Tüchern schlugen, kehrte Smith zurück. Er beschleunigte sein Herz und seine Atmung und nahm Notiz von seiner Umgebung, die er gelassen betrachtete. Er sah sich den ganzen Raum an und pries alle Einzelheiten. Er sah ihn zum ersten Mal, da er bei seiner Ankunft unfähig gewesen war, ihn zu umfangen. Dieses Zimmer war nichts Alltägliches für ihn; auf dem Mars gab es nichts dergleichen, und ebenso wenig ähnelte es den keilförmigen, metallenen Abteilen der Champion. Nachdem er die Ereignisse, die sein Nest mit diesem Ort verbanden, noch einmal durchlebt hatte, war er jetzt bereit, ihn zu akzeptieren, zu loben und bis zu einem gewissen Grad zu lieben.
Er wurde sich eines anderen Lebewesens bewusst. Ein riesiger Weberknecht machte eine Reise von der Decke hinunter und spannte dabei seinen Faden. Smith sah ihm mit Entzücken zu und fragte sich, ob das ein nestbauender Mensch sei.
In diesem Augenblick trat Dr. Archer Frame ein, der Krankenhausarzt, der Thaddeus abgelöst hatte. »Guten Morgen«, grüßte er. »Wie fühlen Sie sich?«
Smith prüfte die Frage. Den ersten Satz erkannte er als ein Höflichkeitsgeräusch, das keine Antwort erforderte. Der zweite war in seinem Gedächtnis mit verschiedenen Übersetzungen enthalten. Wenn Dr. Nelson ihn benutzte, hatte er eine bestimmte Bedeutung; wenn Captain van Tromp ihn benutzte, war es ein Höflichkeitsgeräusch.
Ihn überkam Verzweiflung, wie so oft, wenn er versuchte, mit diesen Wesen zu kommunizieren. Das war ein beängstigendes Gefühl, wie er es niemals zuvor gekannt hatte … bis er den Menschen begegnete. Smith zwang seinen Körper, ruhig zu bleiben, und riskierte eine Antwort. »Fühle gut.« »Gut!«, wiederholte das Wesen. »Dr. Nelson wird in einer Minute kommen. Fühlen Sie sich bereit zum Frühstück?« Alle Symbole waren in Smith’ Wortschatz vorhanden, aber er hatte Mühe, zu glauben, dass er richtig gehört habe. Obwohl er wusste, dass er Nahrung war, »fühlte« er sich nicht wie Nahrung. Auch hatte er keinen Hinweis erhalten, dass er für eine solche Ehre auserwählt werden könne. Er hatte nicht gewusst, dass die Lebensmittelversorgung es notwendig machte, das Kollektiv zu verkleinern. Er empfand leichtes Bedauern, weil es immer noch so viele neue Erkenntnisse zu groken gab, doch kein Widerstreben.
Die Mühe, eine Antwort zu übersetzen, wurde ihm jedoch durch den Eintritt Dr. Nelsons erspart. Der Schiffsarzt inspizierte Smith und die Reihe von Anzeigen und wandte sich dann Smith zu. »Stuhlgang gehabt?«
Das verstand Smith; Nelson fragte es immer. »Nein.« »Wir werden uns darum kümmern. Aber zuerst essen Sie. Pfleger, bringen Sie das Tablett!«
Nelson fütterte ihm drei Bissen, dann verlangte er, dass Smith den Löffel in die Hand nehme und allein esse. Es war ermüdend, aber es erfüllte ihn mit fröhlichem Triumph, weil es seine erste selbstständige Handlung seit der Ankunft in diesem seltsam verzerrten Raum war. Er leerte die Schüssel und vergaß nicht zu fragen: »Wer ist das?«, damit er seinen Wohltäter preisen könne. »Was ist das, meinen Sie«, antwortete Nelson. »Es ist ein synthetisches essbares Gelee - und jetzt wissen Sie ebenso viel wie vorher. Fertig? Gut, steigen Sie aus dem Bett!«
»Verzeihung?« Das war ein Aufmerksamkeitssymbol, nützlich, wenn die Kommunikation versagte. »Ich sagte, Sie sollen aus dem Bett steigen. Stehen Sie auf! Gehen Sie umher! Sicher, Sie sind schwach wie ein Kätzchen, aber Sie werden nie Muskeln ansetzen, wenn Sie unentwegt in diesem Bett schweben.« Nelson öffnete ein Ventil, Wasser lief aus. Smith wies ein Gefühl der Unsicherheit zurück, weil er wusste, dass Nelson ihn liebte. Kurz darauf lag er auf dem Boden des Bettes, und die wasserdichte Decke knäulte sich um ihn. »Dr. Frame«, sagte Nelson, »fassen Sie seinen anderen Ellbogen.«
Mit den Ermutigungen Nelsons und der Hilfe beider Ärzte quälte sich Smith über die Bettkante. »Immer mit der Ruhe. Stellen Sie sich jetzt auf die Füße!«, dirigierte Nelson. »Keine Angst, wir fangen Sie auf, wenn nötig.«
Smith unterzog sich der Anstrengung und stand allein da - ein schlanker junger Mann mit unterentwickelten Muskeln und überentwickeltem Brustkasten. Das Haar war ihm in der Champion geschnitten, sein Bart dauerhaft entfernt worden. Das Auffallendste an ihm war sein leeres Babygesicht - mit Augen, die sich bei einem Mann von neunzig zu Hause gefühlt hätten.
Er stand leicht zitternd da, und dann versuchte er zu gehen. Er schaffte drei schlurfende Schritte und verzog das Gesicht zu einem sonnigen, kindlichen Lächeln. »Braver Junge!«, applaudierte Nelson.
Smith versuchte noch einen Schritt, zitterte heftiger und brach plötzlich zusammen. Den Ärzten gelang es nur knapp, ihn vor einem Fall zu bewahren. »Verdammt!«, schäumte Nelson. »Er hat schon wieder einen Anfall. Kommen Sie, helfen Sie mir, ihn aufs Bett zu heben! Nein - füllen Sie es zuerst!«
Frame stellte den Wasserzufluss ab, als die Haut sechs Zoll über der Oberkante schwebte. Sie schleiften Smith hinein, was ihnen viel Mühe machte, weil er in einer fötalen Position erstarrt war. »Schieben Sie ihm ein Nackenkissen unter den Hals«, befahl Nelson, »und rufen Sie mich, wenn Sie mich brauchen! Nein - lassen Sie mich lieber schlafen. Ich kann es gebrauchen. Es sei denn, irgendetwas beunruhigt Sie. Heute Nachmittag machen wir wieder Gehübungen mit ihm, und ab morgen werden wir das Ganze dann systematisieren. In drei Monaten wird er sich wie ein Affe durch die Bäume schwingen. Ihm fehlt im Grunde nichts.«
»Jawohl, Doktor«, antwortete Frame zweifelnd.
»Und übrigens, wenn er wieder zu sich kommt, bringen Sie ihm bei, das Badezimmer zu benutzen. Lassen Sie sich von einem Pfleger helfen; ich will nicht, dass der Patient fällt.«
»Jawohl, Sir. Äh - sollen wir irgendeine bestimmte Methode - ich meine, wie …«
»Hä? Zeigen Sie es ihm! Er wird von dem, was Sie sagen, nicht viel verstehen, aber er ist ein helles Kerlchen. Sie werden sehen: In einer Woche badet er schon ganz alleine.«
Smith aß seinen Lunch ohne Hilfe. Dann kam ein Pfleger herein, um sein Tablett abzuholen. Der Mann beugte sich vor. »Hören Sie«, murmelte er, »ich kann Ihnen einen lukrativen Vorschlag machen.«
»Verzeihung?«
»Einen Handel, eine Chance für Sie, schnell und leicht Geld zu machen.«
»›Geld‹? Was ist ›Geld‹?«
»Vergessen Sie die Philosophie; jeder braucht Geld. Ich muss schnell sprechen, weil ich nicht lange bleiben kann - es war schon kompliziert genug, mich herzubringen. Ich vertrete Peerless Features. Wir werden sechzigtausend für Ihre Geschichte zahlen, und es wird Sie kein bisschen Mühe kosten. Wir haben die besten Ghostwriter der Branche, die den Stoff zusammenstellen. Sie selbst brauchen nur Fragen zu beantworten.« Er zog ein Papier hervor. »Unterschreiben Sie das einfach. Ich habe das Geld bei mir.«
Smith nahm das Papier, hielt es mit der Schrift auf dem Kopf und starrte darauf nieder. Der Mann unterdrückte einen Ausruf. »Herr im Himmel! Können Sie kein Englisch lesen?« Smith verstand das gut genug, um zu antworten: »Nein.« »Nun gut, ich lese es vor, und dann drücken Sie Ihren Daumen auf das Quadrat, und ich unterschreibe als Zeuge. ›Ich, der Unterzeichner, Valentin Michael Smith, auch bekannt als der Mann vom Mars, übertrage exklusiv auf Peerless Features die gesamten Rechte an meinem Tatsachenbericht mit dem Titel Ich war auf dem Mars gefangen und erhalte dafür …‹« »Pfleger!«
Dr. Frame stand in der Tür; das Papier verschwand in der Kleidung des Mannes. »Komme schon, Sir. Ich habe nur dieses Tablett geholt.«
»Was haben Sie da vorgelesen?«
»Nichts.«
»Ich habe es gesehen. Na, ist ja auch egal. Machen Sie einfach, dass Sie da rauskommen. Dieser Patient darf nicht gestört werden.« Sie gingen. Dr. Frame schloss die Tür hinter ihnen. Smith lag eine Stunde lang bewegungslos, aber so viel Mühe er sich auch gab, er konnte nicht alles groken.
4
Gillian Boardman war eine kompetente Krankenschwester. Ihre Kompetenzen in anderen Bereichen wurden vor allem von den Junggesellen unter den Krankenhausärzten geschätzt - ganz im Gegensatz zu den Mitgliedern des weiblichen Geschlechts. Dabei tat sie niemandem etwas zuleide, außer dass Männer ihr Hobby waren. An diesem Tag führte sie die Aufsicht über das Stockwerk, auf dem Smith lag. Als das Gerücht zu ihr drang, der Patient in Suite K-12 habe noch nie in seinem Leben eine Frau erblickt, glaubte sie es nicht. Nachdem man sie durch detaillierte Erklärungen davon überzeugt hatte, beschloss sie, das zu ändern. Diesen seltsamen Patienten wollte sie sich einmal ansehen.
Sie wusste von der Anordnung. »Kein Besuch von weiblichen Personen«, und wenn sie sich auch nicht für einen »Besuch« hielt, probierte sie doch lieber gar nicht erst, die bewachte Tür zu benutzen - Marines sind für ihre Sturheit bekannt, mit der sie Befehle wörtlich befolgen. Stattdessen ging sie in den anstoßenden Beobachtungsraum.
Dr. »Tad« Thaddeus war ganz allein im Dienst. »Na, wenn das nicht »Grübchen« ist! Hi, Schätzchen, was führt dich denn her?«
»›Fräulein Grübchen‹ für dich, Kumpel. Ich mache nur die Runde. Was ist das für eine Geschichte mit deinem Patienten?«
»Zerbrich dir nicht den Kopf, Süße, er fällt nicht unter deine Verantwortung. Sieh in deinem Auftragsbuch nach!« »Habe ich schon. Ich möchte ihn mir ansehen.« »Mit einem Wort - nein.«
»O Tad, verschanze dich nicht hinter Vorschriften! Das hast du doch noch nie gemacht.«
Er betrachtete seine Fingernägel. »Hast du jemals für Dr. Nelson gearbeitet?«
»Nein, warum?«
»Wenn ich dich einen Fuß in das Zimmer hinter jener Tür setzen lasse, werde ich mich in der Antarktis wiederfinden. Dann kann ich Frostbeulen von Pinguinen untersuchen. Also beweg deinen hübschen Hintern hier raus und geh deinen eigenen Patienten auf den Wecker. Mir wäre es schon unangenehm, wenn Dr. Nelson dich hier in diesem Beobachtungsraum erwischte.«
Gillian stand auf. »Ist es wahrscheinlich, dass Dr. Nelson auftauchen wird?«
»Erst dann, wenn ich nach ihm schicke. Er schläft seine Niedrig-g-Ermüdung aus.«
»Was steckt also dahinter, dass du so pflichtgetreu bist?«
»Das ist alles, Schwester.«
»Sehr wohl, Doktor!« Sie setzte hinzu: »Stinktier.«
»Jill!«
»Und ein ausgestopftes Hemd bist du außerdem.«
Er seufzte. »Geht es mit Samstagabend trotzdem in Ordnung?«
Gillian zuckte die Achseln. »Schon. Ein Mädchen kann heutzutage nicht allzu wählerisch sein.« Dann kehrte sie auf ihre Station zurück und holte den Hauptschlüssel. Sie war abgewehrt, aber nicht geschlagen worden. Suite K-12 besaß nämlich eine Verbindungstür zu dem Zimmer auf der anderen Seite, das als Aufenthaltsraum benutzt wurde, wenn in der Suite ein hohes Tier lag. Das war allerdings im Moment nicht der Fall. Es wurde weder als Teil der Suite noch zu irgendeinem anderen Zweck verwendet. Sie schlüpfte hinein. Die Wachtposten merkten nichts, denn sie hatten keine Ahnung, dass Jill sie umgangen hatte.
An der Tür zwischen den beiden Zimmern zögerte Jill. Sie empfand die gleiche Aufregung wie früher, wenn sie sich aus dem Quartier der Schwesternschülerinnen geschlichen hatte. Dr. Nelson schlief, dachte sie, und Tad würde sie nicht verpfeifen, selbst wenn er sie hier erwischte. Sie nahm ihm nicht übel, dass er sich an die Vorschriften hielt - aber verpfeifen würde er sie nicht. Schließlich öffnete sie die Tür und spähte hinein.
Der Patient lag im Bett. Er sah sie an, als die Tür sich öffnete. Ihr erster Eindruck war, dieser Mann sei schon jenseits von jeder Hilfe. Seine Ausdruckslosigkeit glich der Apathie eines Todkranken. Nein - seine Augen funkelten vor Neugier! Ob er an einer Gesichtslähmung litt? Nein, entschied sie, es fehlten die üblichen Symptome.
Sie gab sich professionell. »Nun, wie geht es uns heute? Schon besser?«
Smith übersetzte die Fragen. Es verwirrte ihn, dass die erste sie beide einschloss. Vielleicht symbolisierte es den Wunsch, dass sie sich gegenseitig Ehre erweisen und sich näherwachsen sollten. Der zweite Teil glich Nelsons Sprachformeln. »Ja«, antwortete er.
»Gut!« Abgesehen von dieser verwunderlichen Ausdruckslosigkeit fand sie nichts Auffallendes an ihm - und wenn ihm Frauen unbekannt waren, brachte er es fertig, das zu verbergen. »Kann ich etwas für Sie tun?« Sie bemerkte, dass kein Wasserglas auf dem Nachttisch stand. »Soll ich Ihnen Wasser holen?«
Smith erkannte sofort, dass dieses Wesen sich von den anderen unterschied. Er verglich, was er sah, mit den Bildern, die Nelson ihm auf der Fahrt von zu Hause zu diesem Ort gezeigt hatte - Bilder, die ihm einen verwirrenden Aspekt dieser Personengruppe erklären sollten. Das also war »Frau«.
Er fühlte sich auf seltsame Weise gleichzeitig erregt und enttäuscht. Beides unterdrückte er, um tief groken zu können, und zwar mit solchem Erfolg, dass Dr. Thaddeus nebenan keine Veränderung auf den Anzeigen bemerkte.
Aber als Smith die letzte Frage übersetzte, flutete eine so gewaltige Woge von Emotionen über ihn hin, dass er beinahe seinen Herzschlag sich hätte beschleunigen lassen. Er behielt ihn jedoch unter Kontrolle und schalt sich einen undisziplinierten Nestling. Dann prüfte er seine Übersetzung.
Nein, er irrte sich nicht. Dieses Frauenwesen hatte ihm Wasser angeboten. Es wünschte, ihm näherzuwachsen.
Mit großer Anstrengung nach adäquaten Bedeutungen suchend, versuchte er sich an einer Antwort von der gebührenden Feierlichkeit. »Ich danke dir für Wasser. Mögest du immer tief trinken.«
Schwester Boardman blickte verblüfft drein. »Oh, wie süß!« Sie sah ein Glas, füllte es und reichte es ihm.
Er sagte: »Du trinkst.«
Glaubt er vielleicht, ich versuche, ihn zu vergiften?, fragte sie sich - aber seine Aufforderung hatte einen zwingenden Ton. Sie nahm einen Schluck, worauf er ebenfalls einen nahm, und dann ließ er sich zufrieden zurücksinken, als habe er etwas Wichtiges vollbracht.
Als Abenteuer war die Sache ein Misserfolg, dachte Jill bei sich. »Nun, wenn Sie sonst nichts brauchen, muss ich mit meiner Arbeit weitermachen«, sagte sie.
Sie wandte sich zur Tür. Er rief: »Nein!«
Sie blieb stehen. »Ja?«
»Geh nicht weg!«
»Nun … ich werde gehen müssen, schon recht bald.« Sie kam zurück. »Möchten Sie noch etwas?«
Er betrachtete sie von oben bis unten. »Du bist … ›Frau‹?« Die Frage erschreckte Jill Boardman. Noch nie hatte irgendjemand - selbst bei nur flüchtiger Betrachtung - ihr Geschlecht infrage gestellt. Ihr erster Impuls war, eine schnippische Antwort zu geben. Aber Smith’ ernstes Gesicht und die seltsam beunruhigenden Augen hielten sie davon ab. Gefühlsmäßig erfasste sie, dass die unglaubliche Behauptung über diesen Patienten stimmte: Er wusste nicht, was eine Frau war. Sie antwortete vorsichtig: »Ja, ich bin eine Frau.«
Smith fuhr fort, sie anzustarren. Langsam wurde es Jill peinlich. Dass ein Mann sie ansah, erwartete sie, aber das hier war, als werde sie unter einem Mikroskop betrachtet. Sie machte eine Bewegung. »Nun? Ich sehe aus wie eine Frau, oder?«
»Das weiß ich nicht«, antwortete Smith langsam. »Wie sieht Frau aus? Was macht dich Frau?«
»Ja, um Himmels willen!« So außer Kontrolle war kein Gespräch mehr geraten, das sie seit ihrem zwölften Geburtstag mit einem männlichen Wesen geführt hatte. »Sie erwarten doch wohl nicht, dass ich meine Kleider ausziehe und es ihnen zeige!«
Smith ließ sich Zeit damit, diese Symbole zu prüfen und eine Übersetzung zu versuchen. Die erste Gruppe konnte er überhaupt nicht groken. Es mochte eins der Höflichkeitsgeräusche sein, die diese Leute benutzten … doch andererseits war es mit Nachdruck gesprochen worden, als könne es eine letzte Kommunikation vor dem Rückzug sein. Vielleicht hatte er das richtige Verhalten im Umgang mit einem Frauenwesen so völlig verfehlt, dass es bereit war zu dekarnieren.
Er wollte nicht, dass die Frau in diesem Augenblick starb, obwohl es ihr Recht und möglicherweise ihre Pflicht war. Der abrupte Wechsel vom Rapport des Wasserrituals zu einer Situation, in der ein frisch gewonnener Wasserbruder den Rückzug oder die Dekarnierung in Erwägung zog, hätte ihn in Panik versetzt, wenn er die Regung nicht bewusst unterdrückt hätte. Aber er entschied, wenn sie sterben sollte, werde er sofort auch sterben müssen - etwas anderes konnte er nicht groken, nicht, nachdem sie ihm Wasser gegeben hatte.
Die zweite Hälfte enthielt Symbole, denen er bereits begegnet war. Er grokte unvollständig die Absicht, aber anscheinend gab es einen Weg, diese Krise zu vermeiden - indem er dem vorgetragenen Wunsch zustimmte. Wenn die Frau ihre Kleider auszog, brauchte vielleicht keiner von ihnen beiden zu dekarnieren. Er lächelte glücklich. »Bitte.«
Jill öffnete den Mund und schloss ihn wieder. Sie öffnete ihn von neuem. »Da will ich doch verdammt sein!«
Smith grokte ein heftiges Gefühl und merkte, dass er die falsche Antwort gegeben hatte. Er begann, seinen Geist auf die Dekarnierung auszurichten, genoss und ehrte alles, was er gewesen war und gesehen hatte, und widmete diesem Frauwesen besondere Aufmerksamkeit. Dann wurde er sich bewusst, dass die Frau sich über ihn beugte, und irgendwie erkannte er, dass sie nicht dabei war, zu sterben. Sie sah ihm ins Gesicht. »Berichtigen Sie mich, wenn ich mich irre«, sagte sie, »aber haben Sie mich eben gebeten, mich auszuziehen?«
Die Umkehrung der Satzstellung und die Abstraktionen erforderten eine sorgfältige Übersetzung, doch Smith schaffte es. »Ja«, antwortete er und hoffte, das werde keine neue Krise heraufbeschwören.
»Ich dachte doch, das gehört zu haben. Bruder, Sie sind nicht krank.«
Als Erstes betrachtete er das Wort »Bruder« - die Frau erinnerte ihn daran, dass sie im Wasser vereinigt gewesen waren. Er erbat die Hilfe seiner Nestlinge, um ermessen zu können, was dieser neue Bruder wünschte. »Ich bin nicht krank«, stimmte er zu.
»Allerdings will ich verdammt sein, wenn ich weiß, was mit Ihnen nicht stimmt. Ich werde mich nicht ausziehen. Und ich muss gehen.« Sie richtete sich auf, wandte sich der Seitentür zu - und blieb stehen und blickte mit einem eigentümlichen Lächeln zurück. »Sie könnten mich das unter anderen Umständen sehr nett noch einmal fragen. Ich bin neugierig, was ich dann tun werde.«
Die Frau war gegangen. Smith entspannte sich und ließ das Zimmer verblassen. Ihn erfüllte ein erster Triumph, weil er sich schließlich doch so verhalten hatte, dass sie beide nicht hatten sterben müssen … aber es gab viel zu groken. Die letzte Rede der Frau hatte Symbole enthalten, die für ihn neu waren, und wenn nicht neu, dann auf eine Art angeordnet, die nicht leicht zu verstehen war. Doch er war glücklich, dass die Worte dem Geschmack nach für eine Kommunikation zwischen Wasserbrüdern geeignet gewesen waren - wenn auch mit einer beunruhigenden und schrecklich angenehmen Beimischung. Er dachte über diesen neuen Bruder, das Frauwesen, nach und empfand eine merkwürdige Erregung. Das Gefühl erinnerte ihn an das erste Mal, als man ihm erlaubt hatte, bei einer Dekarnierung anwesend zu sein, und er war glücklich, ohne zu wissen, warum.
Er wünschte, sein Bruder Dr. Mahmoud wäre da. Es gab so viel zu groken und so wenig, aus dem er groken konnte.
Jill verbrachte den Rest ihrer Dienstzeit in benommenem Zustand. Sie versuchte keinen Fehler bei der Verteilung der Medikamente zu machen. Auf die üblichen Annäherungsversuche reagierte sie rein instinktiv. Das Gesicht des Mannes vom Mars blieb in ihren Gedanken, und sie grübelte über die verrückten Dinge, die er gesagt hatte. Nein, nicht »verrückt« - sie hatte auf psychiatrischen Stationen gearbeitet und war überzeugt, seine Bemerkungen seien nicht psychotisch gewesen. War der richtige Ausdruck »unschuldig«? Nein, das Wort traf es nicht. Sein Ausdruck war unschuldig, seine Augen waren es nicht. Was für ein Geschöpf konnte ein solches Gesicht haben?
Sie hatte einmal in einem katholischen Krankenhaus gearbeitet. Plötzlich sah sie das Gesicht des Mannes vom Mars umgeben von der Haube einer Pflegeschwester, einer Nonne. Der Gedanke störte sie; es war nichts Feminines an Smith’ Gesicht.
Sie zog gerade ihre Straßenkleidung an, als eine andere Schwester den Kopf in den Umkleideraum steckte. »Telefon, Jill.« Jill nahm das Gespräch, Ton ohne Bild, entgegen, während sie sich umzog.
»Ist dort Florence Nightingale?«, fragte eine Baritonstimme.
»Am Apparat. Bist du es, Ben?«
»Der wackere Bewahrer der Pressefreiheit in Person. Kleines, hast du zu tun?« »Was hast du im Sinn?«
»Ich habe im Sinn, dich zu einem Steak einzuladen, dich unter Alkohol zu setzen und dir eine Frage zu stellen.« »Die Antwort ist immer noch ›Nein‹.«
»Nicht diese Frage.«
»Oh, du weißt noch eine andere? Verrate sie mir!«
»Später. Ich will dich erst mit einem guten Essen und Alkohol gefügig machen.«
»Ein echtes Steak? Kein Syntholfleisch?«
»Garantiert. Stich die Gabel hinein, und es wird ›Muh‹ schreien.«
»Du musst ein Spesenkonto haben, Ben.«
»Das ist irrelevant und schäbig. Wie ist es?«
»Du hast mich überredet.«
»Dach des Medizinischen Zentrums. In zehn Minuten.« Sie hängte das Kostüm, das sie bereits angezogen hatte, in den Schrank zurück und nahm ein Kleid heraus, das sie dort für Notfälle aufbewahrte. Es war sittsam, aus kaum durchscheinendem Stoff und an Gesäß und Busen so wenig ausgepolstert, dass das nur die Wirkung neu erschuf, die Jill nackt hervorgerufen hätte. Obwohl es nicht danach aussah, hatte das Kleid ein ganzes Monatsgehalt gekostet. Seine Wirkung war so versteckt wie Betäubungstropfen in einem Drink. Sie betrachtete sich zufrieden und nahm den Sprungschacht hinauf zum Dach.
Sie schlug den Kragen ihres Mantels hoch, um sich gegen den Wind zu schützen. Als sie nach Ben Caxton Ausschau hielt, berührte der Dachaufseher ihren Arm. »Dort wartet ein Wagen auf Sie, Miss Boardman - die Talbot-Limousine.«
»Danke, Jack.« Jill stieg in das startbereite Taxi, dessen Tür offen stand, und wollte gerade Ben ein zweifelhaftes Kompliment machen, als sie sah, dass er nicht im Wagen saß. Das Taxi war auf Automatik gestellt; die Tür schloss sich, es stieg in die Luft, schwang sich aus dem Kreisverkehr und glitt über den Potomac. Auf einem Landeplatz über Alexandria hielt es an, Caxton stieg ein, und es hob wieder ab. Jill musterte ihn. »Was sind wir bedeutend! Seit wann schickst du einen Roboter, um deine Frauen abzuholen?«
Er klopfte ihr aufs Knie und sagte freundlich: »Ich habe meine Gründe, Kleines. Ich darf mich nicht dabei sehen lassen, wie ich dich abhole …«
»Also wirklich!«
»… und du kannst es dir nicht leisten, mit mir gesehen zu werden. Also beruhige dich, es war notwendig. Verzeih mir … Ich krieche im Staub vor dir. Ich küsse deine niedlichen Füße.«
»Hmm … wer von uns hat Aussatz?«
»Wir beide, Jill, ich bin Journalist.«
»Allmählich hielt ich dich schon für etwas anderes.«
»Und du bist Krankenschwester in dem Krankenhaus, wo
man den Mann vom Mars untergebracht hat.« »Macht mich das ungeeignet, deiner Mutter vorgestellt zu werden?«
»Brauchst du eine Landkarte, Jill? Es gibt mehr als tausend Reporter in diesem Gebiet, dazu Presseagenten, freie Journalisten, Fernsehkommentatoren, Nachrichtenjäger und die wilde Horde, die eintraf, als die Champion landete. Jeder Einzelne von ihnen hat versucht, den Mann vom Mars zu interviewen - und keiner hat Erfolg gehabt. Glaubst du, es wäre klug von uns, wenn wir uns sehen ließen, wie wir das Krankenhaus gemeinsam verlassen?«
»Ich verstehe nicht, wieso das eine Rolle spielt. Ich bin nicht der Mann vom Mars.«
Er sah sie an. »Bestimmt nicht. Aber du wirst mir helfen, ihn zu sprechen - was der Grund ist, warum ich dich nicht abgeholt habe.«
»Wie bitte? Ben, du bist ohne Hut in der Sonne gewesen. Er wird von Marines bewacht.« Sie dachte daran, wie leicht es ihr gefallen war, die Wachen auszutricksen, aber entschied sich, es nicht zu erwähnen.
»Ach ja? Also besprechen wir es.«
»Ich weiß nicht, was es da zu besprechen gibt.«
»Später. Eigentlich wollte ich das Thema erst zur Sprache bringen, nachdem ich dich mit tierischem Protein und Äthanol weich gemacht habe. Erst essen wir.«
»Jetzt redest du vernünftig. Erlaubt dir dein Spesenkonto das New Mayflower? Du hast doch tatsächlich ein Spesenkonto, oder?«
Caxton runzelte die Stirn. »Jill, ich möchte ein Restaurant, das näher als Louisville ist, nicht riskieren. Dieses Taxi würde bis dahin zwei Stunden brauchen. Wie wäre es mit Dinner in meinem Apartment?«
»›… sprach die Spinne zu der Fliege.‹ Ben, ich bin zu müde für einen Ringkampf. Das letzte Mal ist mir noch in lebhafter Erinnerung.«
»Das verlangt auch niemand von dir. Großes Ehrenwort, drei Finger aufs Herz.«
»Das gefällt mir nicht viel besser. Wenn ich bei dir sicher bin, muss ich nachlassen. Na gut, einverstanden.«
Caxton drückte Knöpfe. Das Taxi, das mit einem »Halte«-Befehl gekreist war, erwachte und schlug die Richtung zu dem Apartmenthotel ein, in dem Ben wohnte. Er tippte eine Telefonnummer und erkundigte sich bei Jill: »Wie viel Zeit möchtest du auf den Alkohol verwenden, Süße? Ich werde der Küche sagen, sie sollen die Steaks bereithalten.«
Jill dachte nach. »Ben, deine Mausefalle hat eine eigene Küche.«
»Wenn man sie so nennen will. Ich kann ein Steak grillen.«
»Ich grille das Steak. Gib mir das Telefon!« Sie gab Befehle und unterbrach sich nur, um sich zu vergewissern, dass Ben gern Endivien aß.
Das Taxi setzte sie auf dem Dach ab, und sie stiegen zu Bens Wohnung hinunter. Sie war altmodisch, und ihr einziger Luxus war ein echter Grasteppich im Wohnzimmer. Jill blieb stehen, streifte die Schuhe ab, trat barfuß in den Raum und wackelte zwischen den kühlen grünen Halmen mit den Zehen. »Ist das schön!«, seufzte sie. »Meine Füße tun mir weh, seit ich mit der Schwesternausbildung angefangen habe.«
»Setz dich doch!«
»Nein, meine Füße sollen sich morgen noch an das hier erinnern.«
»Wie du möchtest.« Er ging in seine Anrichte und mixte Drinks.
Nach einer Weile folgte sie ihm und wurde häuslich. Steak war im Speiseaufzug, zusammen mit vorgebackenen Kartoffeln. Jill bereitete rasch einen Salat zu, stellte ihn in den Kühlschrank und schaltete den Herd so, dass das Steak gegrillt und die Kartoffeln erhitzt wurden, startete den Zyklus aber nicht. »Ben, hat dieser Herd keine Fernsteuerung?«
»Natürlich.«
»Nun, ich kann sie aber nicht finden.«
Er studierte die Anordnung und kippte einen Schalter. »Jill, was würdest du tun, wenn du über einem offenen Feuer kochen müsstest?«
»Das würde ich verdammt gut machen. Ich bin Pfadfinderin gewesen. Und du, Schlaukopf?«
Sie kehrten ins Wohnzimmer zurück, Jill setzte sich zu Bens Füßen, und sie bedienten sich mit Martinis. Gegenüber von Bens Sessel stand ein als Aquarium verkleideter Stereo-Fernsehtank. Ben schaltete ihn ein, und Guppys und Tetras machten dem Gesicht des allgemein bekannten Kommentators Augustus Greaves Platz.
»… Es kann offiziell festgestellt werden«, sagte das Bild, »dass der Mann vom Mars unter Drogen gehalten wird, damit er diese Tatsachen nicht enthüllt. Die Regierung würde es außerordentlich …«
Caxton schaltete ab. »Gus, alter Junge«, meinte er liebenswürdig, »du weißt darüber kein verflixtes Wort mehr als ich.« Er runzelte die Stirn. »Obwohl du damit Recht haben könntest, dass die Regierung ihn unter Drogen hält.«
»Nein, tut sie nicht«, fiel Jill plötzlich ein.
»Wie? Wie war das, Kleines?«
»Der Mann vom Mars steht nicht unter Drogen.« Nachdem sie mehr ausgeplaudert hatte, als ihre Absicht gewesen war, setzte sie hinzu: »Ein Arzt hält ständig Wache bei ihm, aber es gibt keine Anweisungen, nach denen er Sedative bekommen soll.«
»Bist du sicher? Du bist nicht eine seiner Pflegerinnen?« »Nein. Äh … Tatsächlich existiert ein Befehl, nach dem Frauen von ihm ferngehalten werden sollen, und ein paar stämmige Marines sorgen dafür, dass er befolgt wird.«
Titel der amerikanischen Originalausgabe
STRANGER IN A STRANGE LAND
Deutsche Übersetzung von Rosemarie Hundertmarck, überarbeitet und ergänzt von Rainer Schumacher Deutsche Übersetzung des Vorworts von Ulrich Thiele
Verlagsgruppe Random House für dieses Buch liefert Arctic Paper Mochenwangen GmbH.
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Werbeagentur, München - Zürich
eISBN : 978-3-641-03273-9
www.heyne-magische-bestseller.de
Leseprobe
www.randomhouse.de