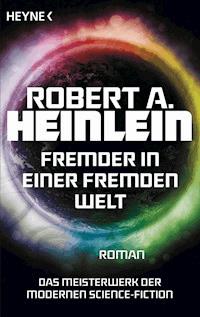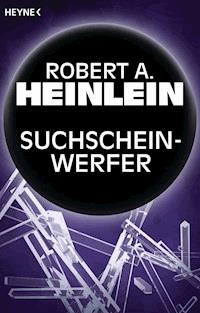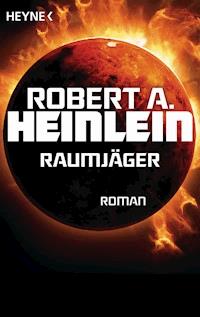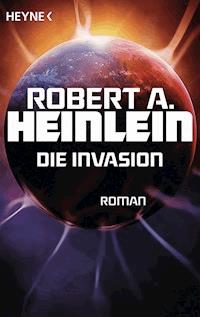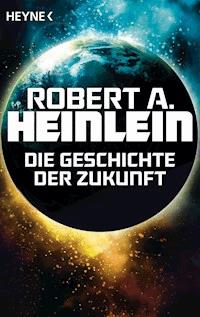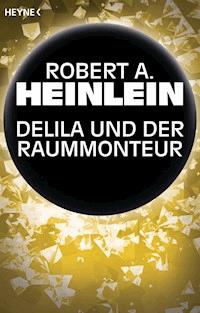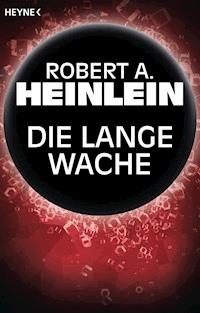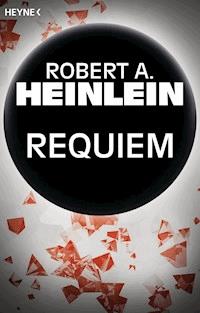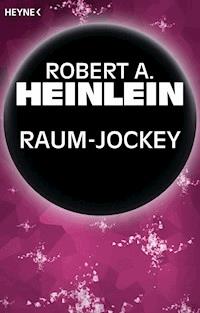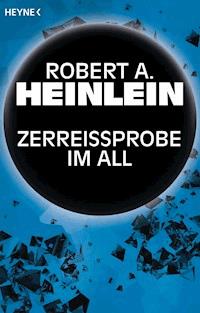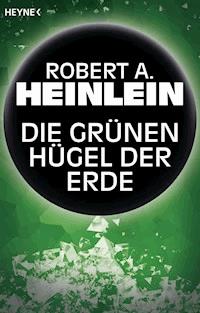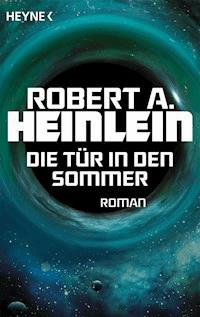
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Rache ist süß
Der geniale Ingenieur Dan Davis hat eigentlich alles, was man sich nur wünschen kann: Er ist erfolgreich, mit einer schönen Frau verlobt und hat in seinem Geschäftspartner Miles einen echten Freund gefunden – das glaubt er zumindest. Doch dann wird er von seiner Verlobten Belle und von Miles betrogen und in einen Kälteschlaf versetzt. Als Dan dreißig Jahre später wieder erwacht, ist nichts mehr, wie es war: Er befindet sich in der Zukunft. Einer Zukunft, in der inzwischen die Zeitreise erfunden wurde. Dan beschließt, in die Vergangenheit zurückzukehren und sich an Belle und Miles zu rächen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 356
Ähnliche
Das Buch
Der erfolgreiche Ingenieur Dan B. Davies hat eigentlich alles, was sich ein Mann nur wünschen kann: Mit seiner genialen Erfindung – selbstständige Haushaltsroboter – verdient er ein Vermögen, er ist mit der bezaubernden Belle verlobt und hat in seinem Geschäftspartner Miles einen echten Freund gefunden – so glaubt er zumindest. Doch dann wird Dan von Belle und Miles aufs Hinterhältigste betrogen: Nicht nur, dass sie eine Affäre miteinander haben, sie drängen Dan auch noch aus seinem eigenen Unternehmen. Und um ihn endgültig aus dem Weg zu räumen, versetzen sie ihn sogar gegen seinen Willen in Kälteschlaf. Als Dan dreißig Jahre später wieder erwacht, schreibt man das Jahr 2000, und nichts ist mehr, wie es einmal war. Noch während Dan versucht, sich in der Zukunft zurechtzufinden, begreift er, dass diese fremde neue Welt es ihm ermöglicht, sich an Belle und Miles zu rächen …
Der Autor
Robert A. Heinlein wurde 1907 in Missouri geboren. Er studierte Mathematik und Physik und verlegte sich schon bald auf das Schreiben von Science-Fiction-Romanen. Neben Isaac Asimov und Arthur C. Clarke gilt Heinlein als einer der drei Gründerväter des Genres im 20. Jahrhundert. Sein umfangreiches Werk hat sich millionenfach verkauft, und seine Ideen und Figuren haben Eingang in die Weltliteratur gefunden. Die Romane Fremder in einer fremden Welt und Mondspuren gelten als seine absoluten Meisterwerke. Heinlein starb 1988.
Mehr über Robert A. Heinlein und seine Romane erfahren Sie auf:
ROBERT A. HEINLEIN
ROMAN
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Titel der amerikanischen Originalausgabe
THE DOOR INTO SUMMER
Deutsche Übersetzung von Tony Westermayr
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Überarbeitete Neuausgabe: 07/2016
Copyright © 1957 by Robert A. Heinlein
Copyright © 1956 by Fantasy House, Inc.
Copyright © 2016 dieser Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
ISBN: 978-3-641-18042-3V002
www.heyne.dewww.penguinrandomhouse.de
Für A.P. und Phyllis,
Mick und Annette
1
Im Winter kurz vor dem Sechswöchigen Krieg lebten Petronius, mein Kater, und ich in einem alten Farmhaus in Connecticut. Ich glaube nicht, dass es noch steht; denn es war nicht weit vom Randgebiet der Manhattan knapp verfehlenden Atombombenexplosion entfernt, und diese alten Holzbauten brennen wie Zunder. Selbst wenn es noch stünde, wäre es wegen des radioaktiven Niederschlages kein lohnendes Objekt. Damals gefiel es Pete und mir jedenfalls. Der Mangel an fließendem Wasser drückte die Miete, und das frühere Speisezimmer lieferte gutes Nordlicht für mein Zeichenbrett.
Das Dumme war nur, dass es elf Türen ins Freie gab.
Zwölf sogar, wenn man Petes Tür mitzählte. Ich versuchte immer, für Pete eine eigene Tür zu organisieren – in diesem Fall ein Brett im Fenster eines der unbenützten Schlafzimmer, in das ich eine Öffnung geschnitten hatte, die für Petes Schnurrbart eben breit genug war. Zu viele Stunden meines Lebens habe ich damit verbracht, Katzen die Türen zu öffnen – nach meinen Berechnungen sind seit Anbeginn der Zivilisation neunhundertachtundsiebzig Arbeitsjahrhunderte für diese Tätigkeit aufgewendet worden. Die Zahlen könnte ich Ihnen zeigen.
Pete benützte gewöhnlich seine eigene Tür, wenn er mich nicht dazu bringen konnte, eine Leute-Tür für ihn aufzumachen, was er bei Weitem vorzog. Aber er weigerte sich, durch seine Tür hinauszuschlüpfen, wenn draußen Schnee lag.
Noch als wolliges Knäuel hatte Pete eine einfache Lebensanschauung entwickelt. Ich war zuständig für Quartier, Ernährung und Wetter; alles andere fiel in seinen Bereich. Aber vor allem machte er mich für das Wetter verantwortlich. Die kalte Jahreszeit in Connecticut taugt nur für Weihnachtskarten; in diesem Winter pflegte Pete regelmäßig seine eigene Tür in Augenschein zu nehmen, es des ekelhaften weißen Zeugs wegen abzulehnen, hinauszugehen, und von mir zu verlangen, ich sollte ihm eine Leute-Tür aufmachen.
Er war fest davon überzeugt, dass mindestens eine davon in den Sommer hinausführen müsse. Das hieß also, dass ich jedes Mal mit ihm zu allen elf Türen gehen und sie offen halten musste, damit er sich davon überzeugen konnte, dass dort draußen ebenfalls Winter war, während seine Kritik an meiner Untüchtigkeit mit jeder Enttäuschung deutlicher wurde.
Dann blieb er im Haus, bis er es einfach nicht mehr aushalten konnte und ihn die Forderungen der Natur hinaustrieben. Wenn er zurückkam, klapperten die Eisklümpchen an seinen Pfoten wie Holzschuhe auf dem Boden. Er starrte mich grimmig an und weigerte sich zu schnurren, bis er den gesamten Schnee herausgekratzt hatte … worauf er mir bis zum nächsten Mal verzieh.
Aber seine Suche nach der Tür zum Sommer gab er nie auf.
Am 3. Dezember 1970 suchte ich ebenfalls danach.
Mein Wunsch war ebenso hoffnungslos wie Petes Sehnsucht in einem Januar Connecticuts. Das bisschen Schnee in Kalifornien bleibt für die Skifahrer auf den Bergen; in Los Angeles findet man nichts davon – durch den Smog könnte sich das Zeug wohl auch kaum durchkämpfen. Aber in meinem Herzen war Winter.
Ich war nicht krank – wenn man einmal von einem schweren Kater absah. Bis zu meinem dreißigsten Geburtstag fehlten auch noch ein paar Tage, und mit den Finanzen war es nicht schlecht bestellt. Weder die Polizei noch wütende Ehemänner, noch Gerichtsboten suchten nach mir; es haperte an nichts, was nicht ein leichter Fall von Gedächtnisschwund geheilt hätte. Aber in meinem Herzen war Winter, und ich suchte nach der Tür zum Sommer.
Wenn sich das anhört, als sei es aus einem Zustand akuten Selbstmitleids heraus gesprochen, so haben Sie recht. Auf unserem Planeten musste es mindestens zwei Milliarden Menschen geben, die in schlechterer Verfassung waren als ich. Trotzdem suchte ich nach der Tür zum Sommer.
Die meisten, die ich in letzter Zeit ausprobiert hatte, waren Schwingtüren gewesen, wie diejenige vor mir jetzt – »Sanssouci-Bar-Grill«, verkündete die Neonreklame. Ich ging hinein, stellte die große Tasche vorsichtig auf den Platz neben mir, rutschte in die Nische und wartete auf den Kellner.
Die Tasche sagte: »Warrrh?«
»Sei still, Pete!«, flüsterte ich.
»Nasow!«
»Unsinn, du warst gerade. Halt den Mund, der Kellner kommt.«
Pete gehorchte. Ich sah auf, als sich der Kellner über den Tisch beugte, und sagte dann: »Einen doppelten Scotch, ein Glas Wasser und ein Gingerale.«
Der Kellner machte ein betroffenes Gesicht. »Gingerale, Sir? Zum Whisky?«
»Haben Sie’s verstanden oder nicht?«
»N-ja, natürlich. Aber …«
»Dann her damit. Ich will es nicht trinken, nur böse anschauen. Und eine Untertasse bitte.«
»Wie Sie meinen, Sir.« Er polierte die Tischplatte. »Wie wär’s mit einem kleinen Steak, Sir? Oder die Muscheln sind auch recht gut heute.«
»Hören Sie mal, Sie bekommen das Trinkgeld für die Muscheln, wenn Sie mir versprechen, sie nicht zu servieren. Ich brauche nur, was ich bestellt habe … Und vergessen Sie die Untertasse nicht.«
Er hielt den Mund und ging. Ich fauchte Pete noch einmal zu, er möge gefälligst still sein. Der Kellner kam zurück. Seinen Stolz beschwichtigte er damit, dass er das Gingerale auf der Untertasse balancierte. Ich ließ ihn die Flasche aufmachen, während ich den Scotch mit Wasser mischte. »Möchten Sie noch ein Glas für das Gingerale, Sir?«
»Ich bin ein ganz toller Bursche, ich trinke es gleich aus der Flasche.«
Er blieb stumm und ließ sich bezahlen, einschließlich Trinkgeld für die Muscheln. Als er weg war, goss ich Gingerale in die Untertasse und klopfte auf die Tasche. »Die Suppe ist fertig, Pete.«
Der Reißverschluss war offen. Wenn er in der Tasche saß, machte ich sie nie zu. Er drückte sie mit den Pfoten auseinander, steckte den Kopf heraus, sah sich schnell um, stemmte sich dann heraus und stellte die Vorderpfoten auf den Rand der Tischplatte. Ich hob mein Glas, wir sahen einander an. »Auf die Damen, Pete – schnell gefunden, schnell vergessen!«
Er nickte; ich hatte ihm aus dem Herzen gesprochen. Er neigte den Kopf und begann, das Gingerale zu schlabbern. »Wenn man kann«, fügte ich hinzu und nahm einen tiefen Schluck. Pete schwieg. Ein weibliches Wesen zu vergessen fiel ihm nicht schwer; er war von Natur aus ein eingefleischter Junggeselle.
Durch das Fenster des Lokals blinkte Leuchtreklame herein. Zuerst lautete der Text: »Arbeite im Schlaf.« Dann hieß es: »Und träume deine Sorgen fort.« Dann flammte es in doppelt großen Lettern auf:
MUTUAL VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT
Ich las alle drei Zeilen mehrmals, ohne darüber nachzudenken. Ich wusste über den Kälteschlaf ebenso viel und ebenso wenig wie alle anderen Leute auch. Bei der ersten Ankündigung hatte ich einen Artikel darüber gelesen, und zwei-, dreimal die Woche bekam ich eine Versicherungs-Werbebroschüre mit der Morgenpost. Ich warf sie gewöhnlich ungelesen weg, weil sie ebenso wenig auf mich gemünzt schien wie, sagen wir, ein Werbefeldzug für Lippenstifte.
Erstens hätte ich bis vor Kurzem den Kälteschlaf gar nicht bezahlen können; er ist teuer. Zweitens: Warum sollte ein Mann, der Spaß an seiner Arbeit hat, Geld verdient, Aussichten hat, noch mehr zu verdienen, verliebt ist und kurz vor der Hochzeit steht, quasi Selbstmord begehen?
Wenn jemand unheilbar krank war und den Tod vor sich sah, aber glaubte, die Ärzte der kommenden Generation würden ihn heilen können, dann war Kälteschlaf die logische Folgerung. Oder wenn sein Ehrgeiz darin bestand, einen Flug zum Mars zu machen, und er glaubte, die Entfernung einer Generation aus seinem privaten Lebensfilm würde ihm gestatten, sich eine Flugkarte zu kaufen, war das wohl auch ein logischer Weg. Die Zeitungen hatten von einem Brautpaar aus den Oberen Zehntausend berichtet, das vom Standesamt sofort zur Schlafhalle der Western World Versicherungsgesellschaft gefahren war, mit der Ankündigung, man dürfe es nicht wecken, bis man die Flitterwochen auf einem interplanetarischen Raumschiff verbringen könnte … obwohl ich einen von der Versicherungsgesellschaft erfundenen Reklametrick argwöhnte und die beiden unter falschem Namen bei der Hintertür hinausgeschlüpft sein würden. Dass jemand die Hochzeitsnacht im tiefgefrorenen Zustand verbringen will, klingt nicht gerade plausibel.
Und da war die übliche finanzielle Lockung, wovon sich die Versicherungsgesellschaften besonders viel versprachen: »Arbeite im Schlaf.« Halt dich schön still, und lass dein Gespartes zu einem riesigen Vermögen anwachsen. Wenn du fünfundfünfzig bist und zweihundert pro Monat Pension bekommst, warum dann nicht die Jahre verschlafen, mit immer noch fünfundfünfzig erwachen und tausend im Monat kassieren? Ganz zu schweigen von dem Gefühl, in einer hellen, neuen Welt zu erwachen, die dir wahrscheinlich ein weit längeres und gesünderes Leben versprechen kann, worin sich deine tausend pro Monat verprassen lassen. Damit gingen sie wirklich aufs Ganze, und jede Gesellschaft bewies mit unbestreitbaren Zahlen, dass ihre Auswahl an Aktien für ihren Investment-Fonds schneller mehr Geld anhäufte als irgendeine der anderen Firmen. »Arbeite im Schlaf.«
Mir hatte das nie zugesagt. Ich war nicht fünfundfünfzig, ich wollte nicht in Pension gehen, und an 1970 war mir nichts Unangenehmes aufgefallen.
Das heißt: bis vor Kurzem. Jetzt war ich im Ruhestand, ob ich wollte oder nicht. Und ich wollte nicht; statt in die Flitterwochen zu fahren, saß ich in einem zweitklassigen Lokal und trank Whisky, um mich zu betäuben. Anstelle einer Frau hatte ich einen Kater mit neurotischer Gier nach Gingerale, und was meine Einstellung zur Gegenwart betraf, so hätte ich sie auf der Stelle für eine Kiste Gin eingetauscht und dann alle Flaschen zerschlagen.
Aber ich war nicht pleite.
Ich griff in die Jacketttasche und nahm einen Umschlag heraus. Er enthielt zweierlei. Einmal einen bestätigten Scheck über mehr Geld, als ich bisher jemals auf einmal gehabt hatte, und zum anderen eine Aktie der Firma »Dienstboten-AG«. Sie waren beide schon ein wenig zerknickt; ich trug sie bei mir, seit ich sie überreicht bekommen hatte.
Warum nicht?
Warum nicht aussteigen und meine Sorgen verschlafen? Der Kälteschlaf würde mich für immer von den Ereignissen und Leuten trennen, die mir mein Leben versauert hatten, er wäre weniger unangenehm, als in die Fremdenlegion einzutreten, und weniger unappetitlich, als Selbstmord zu begehen. Warum also nicht?
An der Gelegenheit, reich zu werden, war ich nicht maßlos interessiert. Oh, ich hatte H. G. Wells’ Der Schläfer erwacht gelesen, nicht erst, als die Versicherungsgesellschaften das Buch kostenlos verteilten, sondern schon vorher, als es nur ein klassischer Roman war. Ich wusste, was Zinseszins und Aktienkenntnis zu erreichen vermochten. Aber ich hatte keine Ahnung, ob ich wirklich genug Geld für den Langen Schlaf und ein Konto von ausreichender Höhe besaß. Das andere Argument sprach mich mehr an: zu Bett gehen und in einer anderen Welt erwachen. Vielleicht in einer wesentlich besseren Welt, wenn man den Versicherungsgesellschaften glauben wollte … vielleicht auch in einer schlimmeren. Aber anders würde sie auf jeden Fall sein.
Ein Unterschied ließ sich aber ganz bestimmt erreichen: Ich konnte so lange schlummern, bis ich sicher war, dass es eine Welt ohne Belle Darkin – oder auch ohne Miles Gentry –, aber vor allem ohne Belle sein würde. Wenn Belle tot und begraben war, konnte ich sie vergessen; vergessen, was sie mir angetan hatte. Dann würde ich nicht andauernd von dem Wissen gequält werden, dass sie nur ein paar Kilometer entfernt war.
Augenblick mal, wie lange müsste das dauern? Belle war dreiundzwanzig Jahre alt – das behauptete sie jedenfalls. Einmal schien es ihr aber doch entwischt zu sein, dass sie sich an Roosevelts Präsidentschaftszeit erinnerte. Nun ja, immerhin in den Zwanzigern. Wenn ich siebzig Jahre schlief, würde nur ein Nachruf von ihr übrig sein. Um ganz sicherzugehen, lieber fünfundsiebzig.
Dann erinnerte ich mich daran, mit welchen Riesenschritten man in der Behandlung von Alterskrankheiten vorankam; man sprach bereits davon, dass hundertzwanzig Jahre als erreichbare »normale« Lebensdauer gelten dürften. Vielleicht musste ich hundert Jahre schlafen. Ich wusste nicht einmal, ob irgendeine Versicherungsgesellschaft so viel anbot.
Dann hatte ich eine teuflisch gute Idee, eingegeben vom warmen Glühen des Scotch. Ich brauchte ja gar nicht zu schlafen, bis Belle tot war. Es war mehr als ausreichend und genau die passende Rache gegenüber einer Frau, jung zu sein, wenn sie schon alt war. Gerade um so viel jünger, dass man es ihr unter die Nase reiben konnte – sagen wir, ungefähr dreißig Jahre.
Ich spürte einen sanften Pfotendruck auf meinem Arm. »Meerr!«, erklärte Pete.
»Gieriger Kerl«, sagte ich und füllte seine Untertasse wieder mit Gingerale. Er bedankte sich mit höflichem Nicken.
Aber er hatte meine angenehm bösen Gedanken unterbrochen. Was, zum Teufel, sollte ich mit Pete anfangen?
Man kann eine Katze nicht fortgeben wie einen Hund; sie lassen sich das nicht gefallen. Manchmal gehen sie mit dem Haus auf einen anderen Besitzer über, aber bei Pete war das hinfällig. Für ihn stellte ich das einzig Konstante in einer wechselhaften Welt dar, seit man ihn vor neun Jahren seiner Mutter weggenommen hatte … Es war mir sogar gelungen, ihn beim Militärdienst in der Nähe zu haben.
Er war bei guter Gesundheit. Daran würde sich auch nicht viel ändern, wenn seine Narben den ganzen Körper bedeckten. Ohne die fatale Neigung, ständig mit der Rechten zuzuschlagen, würde er mindestens die nächsten fünf Jahre hindurch noch Schlachten gewinnen und Nachkommen in die Welt setzen können.
Ich hätte ihn in einem Tierheim pflegen – undenkbar! – oder einschläfern lassen können – ebenso undenkbar! Oder ich könnte ihn einfach im Stich lassen. Darauf läuft es bei einer Katze immer hinaus: entweder man bleibt eisern dabei, oder man setzt das arme Wesen aus, lässt es verwildern und zerstört seinen Glauben an die ewige Rechtschaffenheit aller Dinge.
Wie Belle es bei mir getan hatte.
Also dann, mein Junge, vergiss das möglichst schnell. Dein eigenes Leben kann so verpfuscht sein, wie du willst, das entlässt dich keineswegs aus deinem Vertrag mit dieser verzogenen Katze.
Gerade als ich bei dieser philosophischen Wahrheit angelangt war, nieste Pete. Die Kohlensäure war ihm in die Nase gestiegen. »Gesundheit«, erwiderte ich, »und sauf gefälligst nicht so schnell.«
Pete beachtete mich nicht. Seine Tischsitten waren im Großen und Ganzen weit besser als meine, und das wusste er ganz genau. Unser Kellner hatte sich an die Registrierkasse gelehnt und sich mit dem Kassierer unterhalten. Es war die ruhige Zeit nach dem Mittagessen, und wenige Gäste saßen in der Bar. Der Kellner hob den Kopf, als ich »Gesundheit« sagte, und murmelte dem Kassierer etwas zu. Sie sahen beide zu uns herüber, dann öffnete der Kassierer die Klapptür in der Theke und kam auf uns zu.
»Abtauchen, Pete«, flüsterte ich.
Er schaute sich um und verschwand in der Tasche. Ich drückte sie oben zusammen. Der Kassierer kam heran und beugte sich über meinen Tisch, wobei er hastig die Sitze in Augenschein nahm. »Tut mir leid«, sagte er tonlos, »aber die Katze müssen Sie fortschaffen.«
»Welche Katze?«
»Die Sie eben aus der Untertasse gefüttert haben.«
»Ich sehe keine Katze.«
Diesmal bückte er sich und schaute unter den Tisch. »Sie haben sie in der Tasche versteckt«, beschuldigte er mich.
»Tasche? Katze?«, sagte ich staunend. »Mein lieber Freund, ich glaube, Sie haben Halluzinationen.«
»Was? Lassen Sie das Gerede. Sie haben eine Katze in dieser Tasche. Machen Sie sie auf.«
»Haben Sie einen Durchsuchungsbefehl?«
»Was? Ach, machen Sie sich doch nicht lächerlich.«
»Sie machen sich lächerlich, wenn Sie in meiner Tasche kramen wollen, ohne einen Durchsuchungsbefehl zu haben. Vierter Verfassungszusatz – und der Krieg ist seit Jahren vorbei. Nachdem also das geregelt wäre, sagen Sie bitte dem Kellner, dass er dasselbe noch einmal bringen soll – oder holen Sie es selber.«
Er machte ein leidendes Gesicht. »Mein Herr, ich meine es nicht persönlich, aber ich muss schließlich an meine Lizenz denken. ›Keine Hunde, keine Katzen‹ – dort oben an der Wand hängt das Schild. Wir bemühen uns, ein sauberes Lokal zu führen.«
»Dann hat sich die Mühe aber schlecht gelohnt.« Ich nahm mein Glas vom Tisch. »Sehen Sie die Lippenstiftspuren? Sie sollten sich lieber um Ihren Tellerwäscher kümmern, anstatt Ihre Gäste zu durchsuchen.«
»Ich sehe keinen Lippenstift.«
»Weil ich das meiste schon abgewischt habe. Aber gehen wir doch zum Gesundheitsamt, und lassen wir eine Bakterienprüfung machen.«
Er seufzte. »Haben Sie einen Dienstausweis?«
»Nein.«
»Dann sind wir quitt. Ich durchsuche Ihre Tasche nicht, und Sie gehen nicht zum Gesundheitsamt. Wenn Sie noch etwas trinken wollen, dann bitte an der Bar … das Haus bezahlt. Aber nicht hier.« Er drehte sich auf dem Absatz um und ging.
Ich zuckte die Achseln. »Wir wollten sowieso gerade verschwinden.«
Als ich am Kassierer vorbeikam, hob er den Kopf. »Sie tragen mir nichts nach?«
»Nein. Aber ich wollte eigentlich später mein Pferd zu einem kleinen Drink hereinbringen. Jetzt denke ich nicht mehr daran.«
»Wie Sie wollen. Von Pferden steht nichts auf dem Schild. Aber noch eine Frage – trinkt die Katze wirklich Gingerale?«
»Vierter Verfassungszusatz, haben Sie’s vergessen?«
»Ich will das Tier nicht sehen. Ich möchte nur Bescheid wissen.«
»Tja«, gestand ich, »er mag es zwar lieber mit einem Spritzer Bitters, aber wenn es sein muss, trinkt er es auch pur.«
»Schlecht für die Nieren. Schauen Sie einmal dort hinauf.«
»Wohin?«
»Lehnen Sie sich zurück, so … Jetzt schauen Sie an die Decke über den Nischen … die Spiegel oben in der Dekoration. Ich wusste, dass Sie eine Katze bei sich hatten, weil ich sie sehen konnte.«
Ich lehnte mich zurück. Die Decke des Lokals war mit billigem Zierrat geschmückt, einschließlich zahlreicher Spiegel. Ich entdeckte jetzt, dass einige davon, in der Dekoration versteckt, so angebracht waren, dass der Kassierer sie als Periskope benützen konnte, ohne seinen Platz zu verlassen. »Das ist nötig«, meinte er entschuldigend. »Sie wären schockiert, wenn Sie wüssten, was oft in diesen Nischen vor sich geht … wenn wir die Leute nicht im Auge behielten. Eine traurige Welt.«
»Und ob.« Ich ging hinaus.
Im Freien öffnete ich die Tasche und trug sie an einem Griff. Pete steckte den Kopf heraus. »Du hast gehört, was der Mann gesagt hat, Pete. ›Eine traurige Welt.‹ Mehr als traurig, wenn zwei Freunde nicht einmal mehr in aller Ruhe einen heben können, ohne gleich bespitzelt zu werden. Das schlägt dem Fass den Boden aus.«
»Naoow?«, fragte Pete.
»Wenn du meinst. Es hat eigentlich keinen Sinn, noch lange herumzugrübeln, wenn wir es tun wollen.«
»Naow!«, erklärte Pete nachdrücklich.
»Einstimmig angenommen. Drüben auf der anderen Straßenseite.«
Die Empfangsdame der Mutual-Versicherungsgesellschaft war ein wunderbares Beispiel für die Schönheit von Zweckkonstruktionen. Trotz einer Stromlinienform, die vielleicht für vierfache Schallgeschwindigkeit gereicht hätte, stellte sie frontmontierte Radargehäuse und alles andere aus, was sie für ihre Aufgabe brauchte. Ich rief mir ins Gedächtnis, dass sie eine uralte Dame sein würde, bis ich wieder herauskäme, und erklärte ihr, dass ich einen Verkäufer zu sprechen wünschte.
»Nehmen Sie bitte Platz. Ich werde nachsehen, ob einer unserer Kundendienstleiter frei ist.« Bevor ich mich hinsetzen konnte, setzte sie hinzu: »Unser Mr. Powell wird Sie empfangen. Kommen Sie bitte mit.«
Unser Mr. Powell benützte ein Büro, das verriet, über welch gesunde finanzielle Grundlage die Mutual verfügte. Er gab mir eine feuchte Hand, drückte mich auf einen Stuhl, bot mir eine Zigarette an und versuchte mir die Tasche abzunehmen. Ich ließ sie nicht los. »Wie können wir Ihnen behilflich sein, Sir?«
»Ich möchte den Langen Schlaf.«
Seine Brauen schossen in die Höhe, und sein Benehmen verriet sofort großen Respekt. Zweifellos würde die Mutual für sieben Dollar einen Werbespruch schreiben, aber der Lange Schlaf ließ die gesamte Habe eines Klienten in ihre Klauen geraten. »Eine sehr weise Entscheidung«, sagte er ehrfürchtig. »Ich wäre froh, wenn ich ebenfalls dazu in der Lage wäre. Aber … die Verantwortung für eine Familie, wissen Sie.« Er nahm ein Formblatt vom Schreibtisch. »Schlafklienten haben es meist sehr eilig. Ich möchte Ihnen Zeit und Mühe sparen helfen, indem ich das für Sie ausfülle … und Ihre Untersuchung werden wir sofort veranlassen.«
»Einen Augenblick.«
»Wie?«
»Eine Frage. Sind Sie in der Lage und willens, den Kälteschlaf für eine Katze zu arrangieren?«
Ich machte die Tasche auf; Pete steckte den Kopf heraus. »Darf ich Ihnen meinen Freund vorstellen? Beantworten Sie bitte meine Frage. Wenn die Antwort Nein lautet, möchte ich zur Central Valley Liability. Diese Gesellschaft hat ihre Büroräume doch im selben Haus, nicht wahr?«
Diesmal war er entsetzt. »Mister … ich habe Ihren werten Namen nicht verstanden.«
»Dan Davis.«
»Mr. Davis, sobald jemand hier eintritt, befindet er sich unter dem wohlwollenden Schutz der Mutual. Ich kann Sie nicht zur Central Valley gehen lassen.«
»Wie wollen Sie denn das verhindern? Können Sie Judo?«
»Ich bitte Sie!« Er sah sich nervös um. »Unsere Gesellschaft ist eine ethische Firma.«
»Die Central Valley etwa nicht?«
»Das haben Sie gesagt, nicht ich. Mr. Davis, ich möchte Sie nicht beeinflussen.«
»Das wird Ihnen auch kaum gelingen.«
»… aber beschaffen Sie sich von jeder Gesellschaft Musterverträge. Nehmen Sie einen Anwalt, besser noch: einen lizenzierten Semantiker. Prüfen Sie, was wir anbieten, und vergleichen Sie es mit dem, was Central Valley behauptet, offerieren zu können.« Er schaute sich wieder um und rückte näher heran. »Ich darf das eigentlich gar nicht weitersagen – ich hoffe, dass Sie es für sich behalten –, aber dort benützt man nicht einmal die üblichen Tabellen.«
»Vielleicht kommt das dem Kunden zugute.«
»Wie? Mein lieber Mr. Davis, wir bringen den gesamten Vermögenszuwachs zur Ausschüttung. Das verlangt unsere Satzung … während Central Valley eine Aktiengesellschaft ist.«
»Vielleicht sollte man sich ein paar Aktien kaufen – hören Sie, Mr. Powell, wir verschwenden nur Zeit. Nimmt die Mutual meinen Freund hier an, oder nicht? Wenn nicht, dann habe ich mich hier schon viel zu lange aufgehalten.«
»Sie meinen, Sie wollen dafür bezahlen, dass diesem Wesen die Hypothermie zugutekommen soll?«
»Ich meine, dass wir beide den Langen Schlaf haben wollen. Und nennen Sie ihn nicht ›Wesen‹, er heißt Petronius.«
»Verzeihung, lassen Sie mich anders fragen. Sie wären bereit, zwei Treuhandhonorare zu bezahlen, damit Sie beide, Sie und – äh – Petronius in unser Sanktum aufgenommen werden können?«
»Ja, aber nicht zwei Normal-Honorare. Ich will natürlich etwas drauflegen, aber Sie können uns beide in denselben Sarg stopfen. Für Pete dasselbe wie für einen Menschen zu verlangen wäre doch alles andere als ehrlich.«
»Das ist äußerst ungewöhnlich.«
»Selbstverständlich. Aber über den Preis sprechen wir später … oder ich verhandle mit der Central Valley. Im Augenblick interessiert mich nur, ob Sie es ermöglichen können.«
»Äh …« Er trommelte mit den Fingern auf die Tischplatte. »Einen Augenblick bitte.« Er nahm den Telefonhörer ab und sagte: »Opal, verbinden Sie mich mit Dr. Berquist.« Mehr hörte ich vom Gespräch nicht, weil er den Mithörschutz einschaltete. Aber nach einer Weile legte er den Hörer auf die Gabel zurück und lächelte strahlend, als sei ein reicher Erbonkel gestorben. »Gute Nachrichten, Sir! Ich hatte momentan übersehen, dass die ersten erfolgreichen Experimente mit Katzen durchgeführt wurden. Technik und kritische Faktoren bei Katzen stehen längst fest. Tatsächlich gibt es im Marineforschungslabor in Annapolis eine Katze, die seit über zwanzig Jahren in Hypothermie lebt.«
»Ich dachte, das MFL sei bei der Bombardierung Washingtons vernichtet worden?«
»Nur die Oberflächenbauten, Sir, nicht die Tiefgewölbe. Das ist ein Beweis dafür, wie vollkommen die Technik bereits ist. Das Tier war über zwei Jahre lang nur von automatischen Maschinen behütet … dabei lebt es immer noch, unverändert, ungealtert. Wie Sie leben werden, Sir, solange Sie sich der Mutual anvertrauen wollen.«
Ich befürchtete schon, er wollte in dieser Tonart weiterreden. »Schon gut, schon gut, dann fangen wir mit dem Handel an.«
Vier Faktoren waren zu beachten: erstens, wie wir für unseren Winterschlaf bezahlen wollten; zweitens, wie lange ich zu schlafen gedachte; drittens, wie mein Geld investiert werden sollte, solange ich im Kühlhaus steckte; viertens und letztens, was passierte, wenn ich nicht mehr aufwachen sollte.
Ich bestimmte schließlich das Jahr 2000, eine hübsche, runde Zahl, und nur dreißig Jahre in der Zukunft. Ich hatte Angst, mich überhaupt nicht mehr zurechtzufinden, wenn ich mich auf einen längeren Zeitraum einließ. Die Veränderungen der letzten dreißig Jahre – genauso lange war ich auf der Welt – reichten wirklich aus, um einen das Gruseln zu lehren: zwei große Kriege und ein Dutzend kleine, der Untergang des Kommunismus, die Große Panik, die Erdsatelliten, die Umstellung auf Atomenergie – du lieber Himmel, in meiner Kindheit gab es ja noch nicht einmal Multimorpha.
A. D. 2000 mochte mir ziemlich verwirrend erscheinen, aber wenn ich nicht wenigstens so weit in die Zukunft hineinsprang, reichte für Belle die Zeit nicht, sich eine schöne Sammlung von Falten zuzulegen.
Als wir auf die Frage zu sprechen kamen, wie mein Geld anzulegen sei, lehnte ich den Kauf von Staatsanleihen und ähnlich konservativen Anlagepapieren ab; die Inflation ist in unser Finanzsystem fest eingebaut. Ich beschloss, meinen Anteil an der »Dienstboten-AG« zu behalten und das Bargeld in anderen Industrieaktien anzulegen, unter besonderer Berücksichtigung einiger Strömungen, die mir vielversprechend erschienen. Die Automation stand erst am Anfang. Ich wählte auch eine Düngemittelfabrik aus San Francisco; sie experimentierte mit Hefen und essbaren Algen – die Bevölkerung wuchs mit jedem Jahr, und die Steaks würden sicherlich nicht billiger werden. Den Rest des Geldes wünschte ich in den Treuhandfonds der Versicherung einzubringen.
Aber die entscheidende Frage war doch: Was sollte geschehen, wenn ich im Kälteschlaf starb? Die Gesellschaft behauptete, die Chancen stünden besser als siebzig Prozent, dass ich dreißig Jahre Kälteschlaf überleben würde … und die Versicherung würde die Wette von beiden Seiten her halten. Die Chancen galten aber nicht umgekehrt, und das hatte ich auch nicht erwartet; bei jedem ehrlichen Glücksspiel hat die Bank leichte Vorteile. Nur betrügerische Spieler behaupten, dem Anfänger die besseren Chancen geben zu wollen, und das Versicherungsgeschäft ist ein gesetzlich zugelassenes Glücksspiel. Die älteste Versicherungsfirma mit dem besten Ruf, Lloyds of London, macht keine Ausflüchte – Lloyds’ Partner übernehmen die Deckung jeder Wette von beiden Seiten. Aber bessere Aussichten als 50 zu 50 darf man nicht erwarten; irgendjemand muss ja für die maßgeschneiderten Anzüge unseres Mr. Powell bezahlen.
Ich entschied, dass jeder Cent meines Vermögens im Fall meines Ablebens dem Treuhandfonds der Gesellschaft zufallen sollte … wofür mich Mr. Powell beinahe umarmt hätte, sodass ich mich zu fragen begann, wie optimistisch diese 7:3-Voraussage eigentlich sei. Aber ich blieb dabei, weil mich das, wenn ich weiterlebte, zum Erben aller anderen Kunden mit dem gleichen Entschluss machte, wenn diese starben … Russisches Roulette, wobei den Überlebenden die Jetons zufielen und die Gesellschaft wie üblich den Anteil der Bank einheimste.
Ich wählte jede Möglichkeit des höchstmöglichen Gewinnes, ohne einen Ausgleich für eine Pechsträhne zu schaffen. Mr. Powell verehrte mich, wie der Croupier einen Anfänger liebt, der ausschließlich auf Zero setzt. Als wir mein Vermögen aufgeteilt hatten, wollte er sich bei Pete besonders erkenntlich zeigen; wir einigten uns auf fünfzehn Prozent des üblichen Honorars für Petes Winterschlaf und setzten für ihn einen eigenen Vertrag auf.
Dann fehlten nur noch die gerichtliche Genehmigung und eine ärztliche Untersuchung. Letztere störte mich nicht im Geringsten; seit die Gesellschaft auf meinen Tod gewettet hatte, würde man mich sogar in den letzten Stadien der Pest akzeptieren, wie mir schien. Aber die Genehmigung eines Richters einzuholen würde wohl ziemlich viel Zeit in Anspruch nehmen. Das musste sein, weil ein Klient im Kälteschlaf gesetzlich unter Vormundschaft stand; er war am Leben, aber hilflos.
Ich hätte mir keine Sorgen zu machen brauchen. Unser Mr. Powell ließ von neunzehn verschiedenen Dokumenten vierfache Originale herstellen. Ich unterschrieb, bis sich die Finger verkrampften. Ein Bote sauste mit den Papieren davon, während ich zur ärztlichen Untersuchung ging; den Richter bekam ich nicht einmal zu Gesicht.
Die Untersuchung verlief bis auf eine Kleinigkeit normal. Am Ende sah mir der untersuchende Arzt streng in die Augen. »Sagen Sie mal, wie lange geht das jetzt schon mit dieser Sauferei?«
»Sauferei?«
»Sauferei.«
»Wie kommen Sie darauf, Doktor? Ich bin so nüchtern wie Sie. ›Fischers Fritz fischt frische Fische …‹«
»Lassen Sie den Unsinn, und antworten Sie.«
»Nun … ungefähr zwei Wochen, würde ich sagen. Vielleicht auch ein bisschen länger.«
»Quartalssäufer? Wie oft haben Sie das vorher schon gemacht?«
»Um genau zu sein, überhaupt noch nie. Wissen Sie …« Ich begann ihm zu erzählen, was mir Belle und Miles angetan hatten.
Er hob abwehrend die Hand. »Bitte. Ich habe selber Sorgen, außerdem bin ich kein Psychiater. Ich interessiere mich wirklich nur dafür, ob Ihr Herz der Belastung standhält, die durch die Abkühlung Ihres Körpers auf vier Grad Celsius eintritt. Und das wird es. Normalerweise ist mir gleichgültig, warum sich jemand in ein Loch verkriecht und es dann hinter sich zuschüttet. Ich sage mir immer, dass dann eben ein Narr weniger herumläuft. Ein Rest von beruflichem Gewissen hindert mich aber daran, irgendeinen Menschen, so armselig er auch sein mag, in einen von diesen Särgen steigen zu lassen, solange sein Gehirn vor Alkohol trieft. Drehen Sie sich um.«
»Was?«
»Drehen Sie sich um. Ich muss Ihnen eine Spritze geben.«
Ich drehte mich um, und er verabreichte sie mir. Während ich mir die schmerzende Stelle rieb, meinte er: »Jetzt trinken Sie das hier. In ungefähr zwanzig Minuten werden Sie nüchterner sein als seit Wochen. Wenn Sie ein bisschen Verstand haben – was ich bezweifle –, können Sie sich alles in Ruhe überlegen und entscheiden, ob Sie vor Ihren Schwierigkeiten davonlaufen … oder sich als Mann damit auseinandersetzen wollen.«
Ich trank.
»Das wäre alles. Sie können sich anziehen. Ich unterschreibe Ihre Papiere, aber lassen Sie sich gesagt sein, dass ich bis zur letzten Minute Einspruch erheben kann. Keinen Alkohol mehr, ein leichtes Abendessen und kein Frühstück. Kommen Sie morgen Mittag zur abschließenden Untersuchung.«
Er wandte sich ab und verabschiedete sich nicht einmal. Ich zog mich an und suchte zornig das Weite. Powell hatte alle Papiere fertig. Als ich sie nahm, sagte er: »Sie können sie auch hierlassen und morgen Mittag abholen – die Ausfertigung für das Gewölbe, meine ich natürlich.«
»Und was geschieht mit den anderen?«
»Eine Ausfertigung behalten wir, und nach Ihrem Eintritt hier wird eine zweite bei Gericht, die dritte an die Archive in den Carlsbad-Höhlen eingereicht. Hat der Arzt erwähnt, wie Sie sich mit dem Essen einrichten müssen?«
»Allerdings.« Ich studierte die Dokumente, um meinen Ärger zu verbergen.
Powell griff nach ihnen. »Ich bewahre sie über Nacht sicher auf.«
Ich zog sie zurück. »Das kann ich selbst. Vielleicht möchte ich noch Aktien umtauschen.«
»Äh … dafür ist es aber reichlich spät, mein lieber Mr. Davis.«
»Nur nicht drängeln. Wenn ich noch etwas geändert haben will, komme ich morgen früher.« Ich öffnete die Tasche und steckte die Papiere in ein Seitenfach neben Pete. Dort hatte ich schon oft wichtige Unterlagen aufbewahrt; sie waren vielleicht nicht ganz so sicher wie die Staatsarchive in den Carlsbad-Höhlen, aber doch wesentlich sicherer, als man vielleicht annehmen möchte. Ein Taschendieb hatte einmal versucht, aus diesem Seitenfach etwas herauszunehmen; die Narben von Petes Zähnen und Krallen sieht man heute noch, nehme ich an.
2
Mein Wagen war unter dem Pershing Square geparkt, wo ich ihn am Vormittag abgestellt hatte. Ich warf Geld in den automatischen Parkwächter, stellte die Automatik auf Durchfahrt/West ein, nahm Pete aus der Tasche, setzte ihn auf den Sitz und machte es mir bequem.
Das heißt, ich versuchte es jedenfalls. Der Verkehr in Los Angeles war viel zu schnell und zu mörderisch, als dass ich mich bei Automatik-Steuerung wirklich wohl gefühlt hätte; die ganze Anlage musste umkonstruiert werden – sie war tatsächlich nicht völlig narrensicher. Bis wir die Western Avenue verlassen hatten und wieder auf Handsteuerung umschalten konnten, war ich nervös und sehnte mich nach einem Glas Whisky. »Da ist eine Oase, Pete.«
»Blurr?«
»Genau da vorn.«
Aber während ich nach einem Parkplatz suchte – Los Angeles hatte von einer Invasion nichts zu fürchten; die Invasoren würden nicht einen einzigen Parkplatz finden –, fiel mir ein, dass der Arzt mir jeden Alkoholgenuss verboten hatte.
Ich gab also zunächst einmal meiner Meinung darüber lautstark und deutlich Ausdruck.
Dann fragte ich mich, ob er beinahe einen ganzen Tag später noch erkennen würde, dass ich getrunken hatte. Ich schien mich dunkel an einen Artikel über dieses Problem erinnern zu können, aber ich hatte ihn nur überflogen, weil er nicht in meine Branche fiel.
Verflucht, er brachte es glatt fertig, mir den Kälteschlaf zu verweigern. Ich musste vorsichtig sein und auf den Schnaps verzichten. »Naoow?«, fragte Pete.
»Später. Wir suchen uns jetzt erst einmal ein Rasthaus.« Mir wurde plötzlich klar, dass ich in Wirklichkeit gar keinen Whisky wollte; ich brauchte etwas zu essen und Schlaf, eine ganze Nacht lang. Der Arzt hatte recht; ich war nüchterner und fühlte mich besser als in den ganzen letzten Wochen. Vielleicht hatte er mir nur Vitamin B1 gespritzt, aber die Wirkung war erstaunlich. Wir fanden also ein Restaurant. Ich bestellte Brathuhn für mich und ein halbes Pfund Gehacktes und Milch für Pete. Bis die Sachen gebracht wurden, machte ich mit Pete einen kleinen Spaziergang. Wir aßen sehr oft in solchen Raststätten, weil ich Pete dann nicht hinein- und herausschmuggeln musste.
Eine halbe Stunde später steuerte ich den Wagen ein wenig abseits, hielt an, zündete mir eine Zigarette an, kratzte Pete unterm Kinn und dachte nach.
Dan, mein Junge, der Arzt hat recht; du hast versucht, dich in einer Flasche zu ertränken. Das reicht zwar für deinen Spitzkopf, aber für die Schultern ist sie zu schmal. Jetzt bist du stocknüchtern, du hast richtig gegessen, und zum ersten Mal seit Tagen ist dein Magen friedlich. Du fühlst dich besser.
Was noch? Hat der Arzt auch mit dem Übrigen recht gehabt? Bist du ein verzogenes Kind? Fehlt dir der Mut, dich gegen einen Rückschlag aufzulehnen? Warum tust du diesen Schritt? Ist das Abenteuerlust? Oder versteckst du dich einfach vor dir selbst?
Aber ich will es tun, sagte ich mir – ich will das Jahr 2000 erleben.
Na schön, du willst also. Aber musst du einfach davonrennen, ohne zuerst zu bereinigen, was hier faul ist?
Ja, aber wie soll ich es denn bereinigen? Ich will Belle nicht mehr, seit sie mir das angetan hat. Und was könnte ich sonst unternehmen? Sie verklagen? Lächerlich, ich habe ja keine Beweise – und außerdem hat außer den Juristen noch nie jemand einen Streitfall gewonnen.
Pete sagte: »Wrrr? Naaow!«
Ich sah auf seinen zerzausten, narbenübersäten Kopf hinunter. Pete würde nie vor Gericht gehen; wenn ihm der Schnurrbart eines anderen Katers nicht passte, forderte er ihn schlicht auf, sich zu stellen und wie eine Katze zu kämpfen. »Ich glaube, du hast recht, Pete. Ich will mir Miles vorknöpfen und ihn auseinandernehmen, bis er zu reden anfängt. Den Langen Schlaf können wir nachher auch noch machen. Aber wir müssen einfach herausbringen, was sie uns angetan haben und wer das ausgeheckt hat.«
Hinter der Küche gab es eine Telefonzelle. Ich rief Miles an, erwischte ihn zu Hause und bat ihn, dortzubleiben, bis ich käme.
Mein Vater nannte mich Daniel Boone Davis, nach dem Helden der Pionierzeit im Westen, weil er sich für persönliche Freiheit und Selbstvertrauen aussprechen wollte. Ich bin 1940 geboren, in einem Jahr, als es hieß, die Einzelperson sei dem Untergang geweiht, der Masse Mensch gehöre die Zukunft. Dad wollte nicht daran glauben. Er gab mir meine Vornamen im Widerspruch gegen diese Meinung. Er starb in einem Gefangenenlager in Nordkorea, wo er bis zuletzt versucht hatte, den Beweis für seine These zu erbringen.
Als der Sechswöchige Krieg kam, hatte ich ein Ingenieurdiplom in der Tasche und leistete meinen Wehrdienst ab. Ich hatte mein Examen nicht dazu benützt, ein Offizierspatent zu erlangen, weil mir mein Vater den unüberwindlichen Wunsch vererbt hatte, nur auf mich selbst angewiesen zu sein, keine Befehle zu geben, keine entgegenzunehmen, nicht nach Plan leben zu müssen. Ich wollte meine Zeit abkürzen und dann entlassen werden. Als der Kalte Krieg in die heiße Phase kam, war ich Feldwebel in der Sandia-Waffenzentrale in New Mexiko, stopfte Atome in Atombomben und überlegte mir, was ich nach der Entlassung tun wollte. An dem Tag, als Sandia vom Erdboden verschwand, war ich in Dallas, um eine neue Lieferung Schrecklichkeit einzuholen. Da der radioaktive Niederschlag sich in Richtung Oklahoma City ausbreitete, blieb ich am Leben und konnte meine Wehrdienst-Prämie einstecken.
Pete überlebte aus einem ähnlichen Grund. Ich hatte einen Freund, Miles Gentry, der wieder aufgerufen worden war. Er hatte eine Witwe mit Tochter geheiratet, aber seine Frau war gerade um die Zeit gestorben, als er wieder einrücken musste. Er wohnte außerhalb des Geländes in Albuquerque bei einer Familie, um ein Heim für seine Stieftochter Frederica zu haben. Die kleine Ricky – wir nannten sie nie Frederica – sorgte für Pete. Dank der Katzengöttin Bubastis waren Miles, Ricky und Pete an diesem furchtbaren Wochenende weggefahren – Ricky nahm Pete mit, weil ich ihn in Dallas nicht brauchen konnte.
Ich war ebenso überrascht wie alle anderen Leute, als sich herausstellte, dass wir Divisionen auf Thule und an anderen Orten versteckt hatten, wovon sich niemand etwas träumen ließ. Seit den Dreißigerjahren wusste man, dass sich der menschliche Körper abkühlen lässt, bis seine Aktivität beinahe auf Null reduziert ist. Aber mehr als ein Labortrick oder eine letzte Möglichkeit der Behandlung war das bis zum Sechswöchigen Krieg nicht gewesen. Eines muss man der militärischen Forschung zugestehen: Was Geld und Menschen schaffen können, setzt sie in Resultate um. Noch eine Milliarde drucken, noch einmal tausend Wissenschaftler und Techniker anheuern, und auf irgendeine unglaubliche, ausgefallene Weise ergibt sich eine Lösung. Stasis, Kälteschlaf, Winterschlaf, Hypothermie, verlangsamter Metabolismus, man mag es nennen, wie man will – die logistisch-medizinischen Forschungsgruppen hatten einen Weg gefunden, Menschen wie Brennholz zu stapeln, um sie im Bedarfsfall bei der Hand zu haben. Zuerst spritzt man dem Betroffenen Drogen, dann wird er hypnotisiert, abgekühlt und genau bei vier Grad Celsius gehalten, mit anderen Worten, bei der höchsten Wasserdichte, ohne dass sich Kristalle bilden. Wenn man ihn dann dringend braucht, kann man ihn durch Diathermie und posthypnotische Befehle in zehn Minuten auf die Beine bringen – in Nome, Alaska, schaffen sie es in sieben Minuten –, aber dieses Tempo lässt die Gewebe altern und den Betroffenen ein bisschen schwachsinnig werden. Wenn man es nicht eilig hat, sind zwei Stunden als Minimum wesentlich besser. Die schnelle Methode nennt man bei den Berufssoldaten ein »kalkuliertes Risiko«.
Das Ganze war ein Risiko, mit dem der Feind nicht gerechnet hatte, und nach Kriegsende wurde ich daher ausbezahlt, statt liquidiert oder in ein Arbeitslager verschickt zu werden. Miles und ich bauten ungefähr zu der Zeit unser Geschäft auf, als die Versicherungsgesellschaften den Kälteschlaf zu verkaufen begannen.
Wir verfügten uns in die Mojave-Wüste, richteten in einem von der Luftwaffe nicht mehr benötigten Gebäude eine kleine Fabrik ein und begannen, »Dienstmädchen« herzustellen. Ich steuerte die technischen Kenntnisse bei, Miles seine juristische und kaufmännische Erfahrung. Ja, ich habe »Dienstmädchen« und alle ihre Verwandten erfunden – »Fensterfritz« und die übrigen –, wenn Sie auch meinen Namen nicht auf ihnen finden. Während des Wehrdienstes hatte ich angestrengt darüber nachgedacht, was man als Ingenieur leisten könnte. Für die Standard, Du Pont oder General Motors arbeiten? Dreißig Jahre später bekommt man dann ein Abschiedsbankett und ein Ruhegehalt. Man kann sich in der Zwischenzeit immer satt essen und in den Flugzeugen der Firma ein paarmal hin und her fliegen. Aber sein eigener Herr ist man nie. Dann kann man auch noch Beamter werden – gutes Anfangsgehalt, ordentliche Pension, keine Sorgen, dreißig Tage Urlaub im Jahr, anständige Zuschüsse. Aber ich hatte gerade einen langen Urlaub auf Staatskosten hinter mir und wollte mein eigener Herr sein.
Was war klein genug, dass man es allein herstellen konnte, ohne sechs Millionen Arbeitsstunden dranzuhängen, bevor sich das erste Modell auf den Markt bringen lässt? Kleine Werkstatt ohne richtiges Kapital, wie Ford und die Gebrüder Wright angefangen hatten – diese Zeiten seien für ewig vorbei, hieß es.
Die Automation hatte Hochkonjunktur – chemische Fabriken, die nur zwei Messgeräte-Ableser und einen Wächter brauchten, Maschinen, die in einer Stadt Flugkarten druckten und in sechs anderen diese Plätze als »verkauft« anzeigten, Stahlmaulwürfe, die Kohle förderten, während die Burschen von der Bergarbeitergewerkschaft zuschauten. Während ich also von Onkel Sam besoldet wurde, stopfte ich so viel Elektronik, Kopplungstechnik und Kybernetik in mich hinein, wie mir zugänglich gemacht wurde.
Was würde als Allerletztes automatisiert werden? Antwort: das Heim der Hausfrau. Ich bemühte mich nicht, ein vernünftiges, wissenschaftlich fundiertes Haus zu entwerfen. Das interessierte die Frauen nicht. Sie wollten nichts als eine immer besser gepolsterte Höhle. Aber die Hausfrauen klagten noch über das Dienstbotenproblem, als Dienstpersonal längst den Weg der Saurier gegangen war. Mir war selten eine Hausfrau begegnet, die nicht eine Spur von Sklavenhalterin in sich gehabt hätte; sie schienen zu glauben, dass es einfach stramme Bauernmädchen geben müsse, die froh über die Gelegenheit wären, vierzehn Stunden am Tag Böden zu schrubben und bei einem Lohn, über den ein Schlosserlehrling nur lachen würde, die Überbleibsel vom Tisch der Herrschaft zu essen.
Deswegen nannten wir das Ungeheuer »Dienstmädchen« – es erinnerte an das halbversklavte Einwanderermädchen, das sich von Großmutter herumschikanieren lassen musste. Im Grunde handelte es sich einfach um einen besseren Staubsauger, und wir gedachten ihn zu einem Preis auf den Markt zu bringen, der mit gewöhnlichen Saugbohnern konkurrieren konnte.
Was »Dienstmädchen« schaffte – das erste Modell, nicht der halbintelligente Roboter, zu dem ich es später entwickelte –, war, Boden säubern, jeden Boden, den ganzen Tag lang, und ohne Aufsicht. Einen Boden, der Putzen oder Polieren nicht nötig hatte, gibt es nicht.